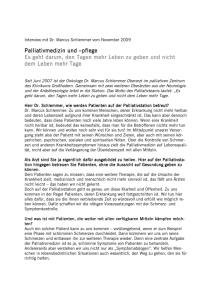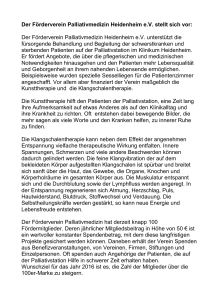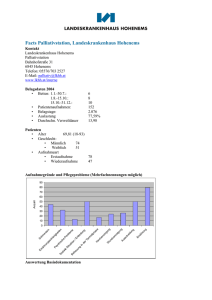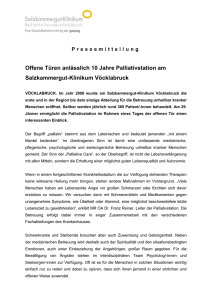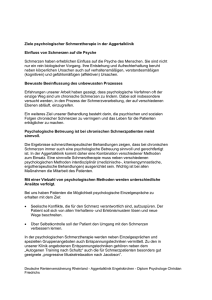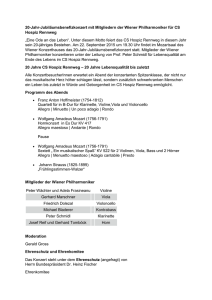23.11.2010_Noch-Sinn-im-Leben
Werbung
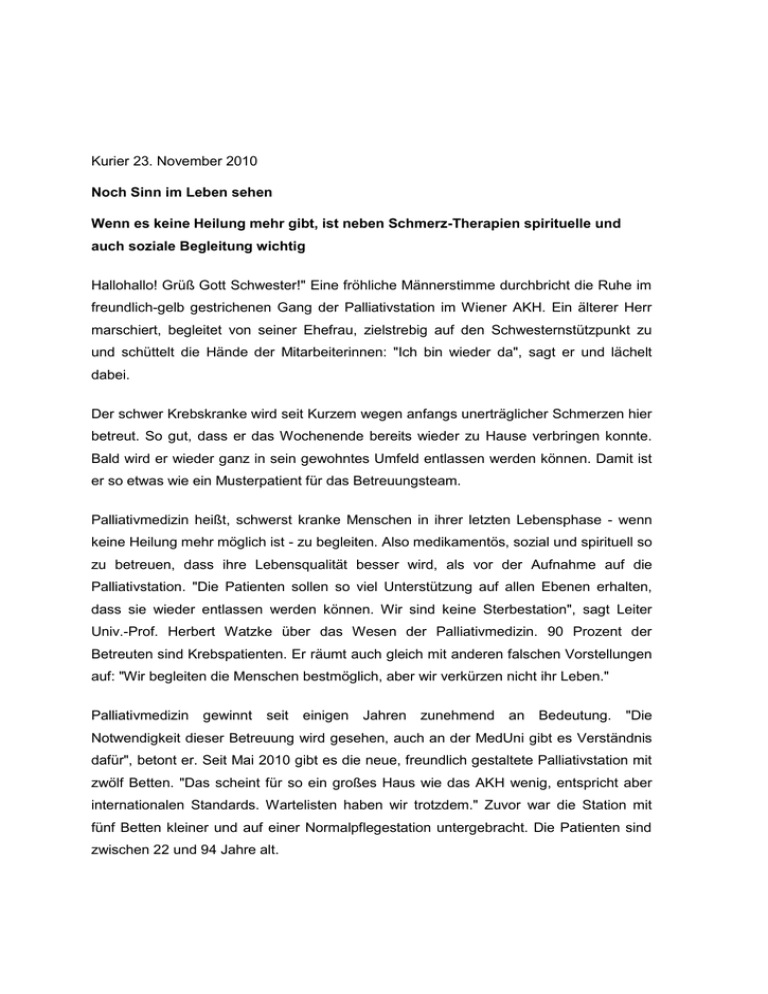
Kurier 23. November 2010 Noch Sinn im Leben sehen Wenn es keine Heilung mehr gibt, ist neben Schmerz-Therapien spirituelle und auch soziale Begleitung wichtig Hallohallo! Grüß Gott Schwester!" Eine fröhliche Männerstimme durchbricht die Ruhe im freundlich-gelb gestrichenen Gang der Palliativstation im Wiener AKH. Ein älterer Herr marschiert, begleitet von seiner Ehefrau, zielstrebig auf den Schwesternstützpunkt zu und schüttelt die Hände der Mitarbeiterinnen: "Ich bin wieder da", sagt er und lächelt dabei. Der schwer Krebskranke wird seit Kurzem wegen anfangs unerträglicher Schmerzen hier betreut. So gut, dass er das Wochenende bereits wieder zu Hause verbringen konnte. Bald wird er wieder ganz in sein gewohntes Umfeld entlassen werden können. Damit ist er so etwas wie ein Musterpatient für das Betreuungsteam. Palliativmedizin heißt, schwerst kranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase - wenn keine Heilung mehr möglich ist - zu begleiten. Also medikamentös, sozial und spirituell so zu betreuen, dass ihre Lebensqualität besser wird, als vor der Aufnahme auf die Palliativstation. "Die Patienten sollen so viel Unterstützung auf allen Ebenen erhalten, dass sie wieder entlassen werden können. Wir sind keine Sterbestation", sagt Leiter Univ.-Prof. Herbert Watzke über das Wesen der Palliativmedizin. 90 Prozent der Betreuten sind Krebspatienten. Er räumt auch gleich mit anderen falschen Vorstellungen auf: "Wir begleiten die Menschen bestmöglich, aber wir verkürzen nicht ihr Leben." Palliativmedizin gewinnt seit einigen Jahren zunehmend an Bedeutung. "Die Notwendigkeit dieser Betreuung wird gesehen, auch an der MedUni gibt es Verständnis dafür", betont er. Seit Mai 2010 gibt es die neue, freundlich gestaltete Palliativstation mit zwölf Betten. "Das scheint für so ein großes Haus wie das AKH wenig, entspricht aber internationalen Standards. Wartelisten haben wir trotzdem." Zuvor war die Station mit fünf Betten kleiner und auf einer Normalpflegestation untergebracht. Die Patienten sind zwischen 22 und 94 Jahre alt. Schmerztherapie "Die meisten Menschen haben Angst vor Schmerzen am Lebensende. Aber gerade diesen Aspekt können wir gut in den Griff kriegen. Niemand muss heute mehr höllische Schmerzen erleiden." Zur Schmerzbekämpfung werden meist Medikamente aus drei Gruppen gleichzeitig eingesetzt: Entzündungshemmer, Nervenschmerzmittel und Opiate. "Schmerz entsteht im Gehirn, dort wirken die Medikamente und blockieren den Schmerz", erklärt Watzke. Mit Schmerz-Pumpen (Infusion) oder Tabletten, die über die Mundschleimhaut viel rascher aufgenommen werden, können Schmerzspitzen zudem immer besser behandelt werden. "Wichtig ist, dass auch im verbleibenden Leben noch ein Sinn gesehen wird", betont Christiane Cap, ehrenamtliche katholische Seelsorgerin der Palliativstation. "Meine Tätigkeit sehe ich aber ganzheitlich, nicht konfessionell. Unser Angebot wird nur selten abgelehnt." Gerade im spirituellen Bereich werde vieles wieder ein Thema: "Irgendwann stellt sich jeder auf seine Art die Sinnfrage." Hilfe in der letzten Lebensphase Palliative Care Der Begriff "palliativ" leitet sich vom lateinischen "pallium" für "Mantel" ab. Laut österreichischem Spitalsgesetz sind Palliativstationen in Akutspitälern untergebracht. Die Patienten sollen dort einige Wochen lang so unterstützt werden, dass sie wieder nach Hause entlassen werden können. Hospiz Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort für "Herberge" ab. Hier soll ein würdiges Leben bis zuletzt ermöglicht werden (inkl. Schmerztherapie, psychischer und sozialer Begleitung). Es gibt in Österreich einige wenige stationäre Hospize und rund 200 mobile Dienste. Mehr Info: www.hospiz.at "Mehr Zeit, auf die Bedürfnisse unserer Patienten einzugehen" Nein", sagt Stationsschwester Anna Huber bestimmt und ihre blauen Augen blitzen hinter ihren Brillengläsern auf, "das ist keine furchtbar traurige Arbeit, wie viele glauben. Es gibt sehr viele positive Erlebnisse. Wir bekommen auch wirklich viel von unseren Patienten zurück." Die 51-jährige Diplomkrankenschwester ist seit rund sechs Jahren in der Palliativbetreuung tätig. "Ich hab' mir das nicht bewusst ausgesucht, sondern bin sozusagen hineingewachsen und habe dann einen Zusatzkurs für Palliativpflege absolviert. Die Entscheidung bereue ich keinesfalls, ich mache es sehr gern." Für die gute Stimmung sei auch die Teamarbeit der insgesamt 25 Personen - von Ärzten über Psychologen bis zu Physio- und Ergotherapeuten - verantwortlich. Die Arbeit auf einer Palliativstation unterscheidet sich für Huber von anderen Stationen. "Ich komme ursprünglich von einer Akutstation auf der Internen Abteilung. Hier habe ich viel mehr Zeit, auf die Bedürfnisse der Patienten einzugehen." Im Palliativbereich ist eine Pflegeperson durchschnittlich für vier Patienten zuständig. "Wir können deshalb viel flexibler agieren. Wir nehmen zum Beispiel auch Rücksicht darauf, wenn ein Patient länger schlafen will und die Körperpflege lieber am Nachmittag hätte." Dieser intensivere Kontakt zu den Patienten heißt aber auch: "Man muss sich mehr einlassen, sein eigenes Tun immer wieder hinterfragen und es braucht auch etwas Fingerspitzengefühl." Und professionelle Distanz, um sich nicht selbst auszubrennen. Mein Motto heißt: mitfühlen, aber nicht mitleiden." Erlebnisse, die auch den Profis nahe gehen, werden regelmäßig im Team aufgearbeitet. Einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit sieht Schwester Anna darin, "Dinge zu ermöglichen, die dem Patienten noch sehr wichtig sind". Das kann ein bestimmtes Ausflugsziel, ein Schmuckstück oder auch nur ein Gläschen Sekt sein. Sogar amtlich kann es auf der Palliativstation zugehen, wenn ein Standesbeamter organisiert werden muss: "Es kommt immer wieder vor, dass Paare hier auf unserer Station noch heiraten."