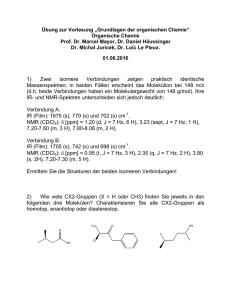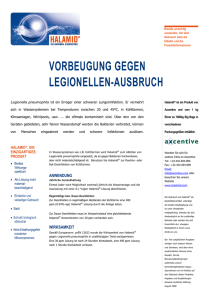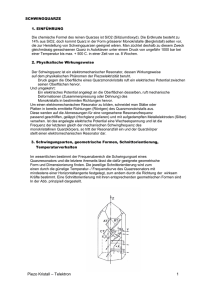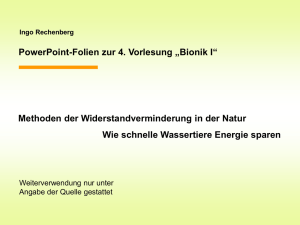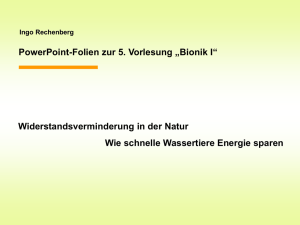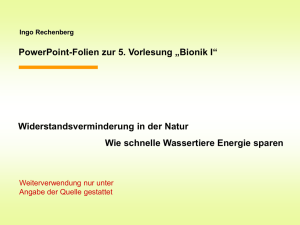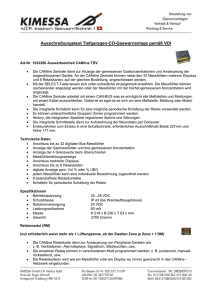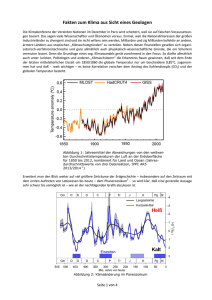CT Relaunch , 08/2008
Werbung

Schutz vor zu viel Schutz Neue Indikatorplaketten mit definierter Nachweisgrenze Anlagen, die Phosgen herstellen oder verwenden, sind auf Grund der hohen Toxizität dieses Gases mit portablen oder stationären Gaswarngeräten ausgerüstet. Während portable Geräte vorwiegend zum Personenschutz bzw. zur Lecksuche eingesetzt werden, dienen stationäre Gasdetektoren der Anlagensicherheit. Diese Instrumente melden zuverlässig, wenn Leckagen auftreten. Eine wichtige Ergänzung der Messtechnik stellt die Phosgen-Indikatorplakette dar. Nach einem Phosgen-Unfall ist die entscheidende Frage, ob eine der Personen auf dem Gelände medizinischer Hilfe bedarf. Mitarbeiter, die direkt in der Anlage arbeiten, sind mit Gaswarngeräten ausgestattet, die häufig sogar über einen Datenspeicher verfügen, der ein Konzentrations-Zeit-Profil aufzeichnet. Die Mehrzahl der auf dem Gelände anwesenden Mitarbeiter arbeitet aber nicht direkt in der Anlage und ist daher nicht mit Messtechnik ausgestattet. Information ohne aufwendiges Auswerten Um im Ernstfall zuverlässig feststellen zu können, ob jemand behandelt werden muss, erhält jeder Mitarbeiter oder Besucher beim Betreten des Geländes eine Indikatorplakette, die mit einem Clip an der Kleidung befestigt wird. Das darin enthaltene Indikatorpapier ist mit einem Farbreagenz imprägniert und verfärbt sich bei Kontakt mit Phosgen rot. Die Indikatorplakette ist mit dem Namen des Trägers und dem Datum versehen, so dass sie auf keinen Fall einer falschen Person zugeordnet werden kann. Hilfskräfte erhalten im Ernstfall auf diese Weise sofort und ohne aufwendiges Auswerteverfahren eine eindeutige Information, welche Person Hilfe braucht. Auf diesen Umstand wird vom Hersteller sehr großer Wert gelegt. Geräteunterstützte Ausleseverfahren haben den großen Nachteil, dass – wenn überhaupt – Lesegeräte nur in begrenzter Anzahl, an bestimmten Orten und mit begrenzter Verfügbarkeit vorhanden sind. Dies würde wichtige – sofort vor Ort zu treffende – Entscheidungen nur verzögern. Ein Komparatorpapier wird vom Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt, ist also stets verfügbar und zwar überall und wann immer es gebraucht wird. Es ist für den Mediziner überaus wichtig, eine objektive Entscheidungshilfe zu haben, da eine Vergiftung mit Phosgen erst nach einer so genannten Latenzphase Symptome hervorruft. Diese können je nach Dosis erst nach Stunden auftreten. Die Symptomatik kann also auf keinen Fall das einzige Kriterium für die Gestaltung der Therapie sein. Behandlung exponierter Personen Phosgen ist eine Substanz, die einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Jeder, der mit Phosgen zu tun hat, weiß, dass er beim Umgang größte Vorsicht walten lassen muss. Folgerichtig wurde der Arbeitsplatzgrenzwert Ende der neunziger Jahre von 100 ppb auf 20 ppb gesenkt. Sicher ist sicher, könnte man sagen. Je tiefer der Grenzwert, umso sicherer sind die Mitarbeiter. So einfach ist die Sache aber nicht. Phosgen ist ein Gefahrstoff, der in der Industrie sehr sorgfältig messtechnisch überwacht wird. Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass auch nur die geringste Exposition übersehen wird. In der betrieblichen Praxis gab es in der Vergangenheit aber leider sehr unterschiedliche Strategien mit exponierten Personen umzugehen. Dies kann für den Patienten unangenehme Folgen haben: Je nachdem, welche Strategie die medizinische Abteilung eines Betriebes verfolgte, wurden auch gering exponierte Personen therapiert. Diese Therapie ist für den gesunden Menschen alles andere als nützlich. Die klassische Therapie einer Phosgenvergiftung umfasst die Gabe von Kortikosteroiden, Druckbeatmung mit Sauerstoff und regelmäßiges Röntgen. Vor allem: Die medizinische Praxis war auch in verschieden Ländern sehr unterschiedlich. So konnte es passieren, dass Mitarbeiter mit gleich hoher Expositionsdosis in einem Land auf der Intensivstation landeten, während sie in einem anderen Land nach kurzer Beobachtungszeit zurück an die Arbeit gingen. Der „Toxycopy-Effekt“ Ein Mensch, der einem toxischen Gas ausgesetzt war, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Symptome spüren – auch wenn die inhalierte Dosis weit unter dem Grenzwert liegt. Zur Veranschaulichung stelle man sich folgendes Szenario vor: Ein Gastgeber lädt seine Freunde zu einem Pilzessen ein. Nach der Mahlzeit erzählt er stolz, er habe – obwohl kein Pilzkenner – die Pilze selbst gesammelt. Sein kleiner Sohn fügt grinsend hinzu, er habe auch die vom Vater aussortierten Pilze noch in das Essen geschmuggelt, da er es schade fand, so viel wegzuwerfen. Mit Sicherheit werden einige der Gäste spontan Vergiftungssymptome entwickeln. Die Wissenschaft nennt diesen Effekt „Toxycopy“. Allein durch das Gefühl, möglicherweise vergiftet worden zu sein, entwickelt der Mensch entsprechende Symptome. Um Menschen vor diesem Effekt, aber auch unnötigen Therapiemaßnahmen zu schützen, wurde in den USA eine neue umfassende Studie zur Toxizität von Phosgen durch geführt. Das Ziel war, zu international verbindlichen Richtlinien beim Umgang mit Phosgen exponierten Personen zu kommen. Neue Studien zur Toxizität von Phosgen Zusammenfassend zeigt das Ergebnis, dass die Toxizität von Phosgen bisher überschätzt wurde. Dies geschah – genau betrachtet – zum Nachteil der Gesundheit von Mitarbeitern, da die große Mehrzahl der bekannten Fälle übertherapiert wurde. Was die medizinisch sinnvolle Behandlung exponierter Personen angeht, gibt es nun eine wissenschaftliche Grundlage für klare Richtlinien. Bei Arbeitsmedizinern gelten seit Veröffentlichung der Studie folgende Schwellwerte für sinnvoll: - unter 50 ppm/min: keine Therapie, keine weitere Beobachtung; - 50 bis 150 ppm/min: Beobachtung, Überwachung von Puls und Blutsauerstoff, wiederholtes Abhorchen, gegebenenfalls Röntgen des Brustraumes. Wenn erforderlich, Wiederholung nach 8 h. Therapie: Steroide per Inhalation oder intravenös.; - über 150 ppm/min: Intensivstation, Beatmung, wiederholtes Röntgen, intensive Medikation- sowohl inhalativ als auch intravenös. Diese neuen Erkenntnisse zeigten bereits Wirkung: Der Ende der neunziger Jahre auf 20 ppb gesenkte MAK Wert wurde vergangenes Jahr in Deutschland wieder auf 100 ppb mit Überschreitungsfaktor 2 angehoben. Der EU-Kommission liegt der Vorschlag vor, diesen Wert zu übernehmen. Mit den auf dieser Ebene üblichen Verzögerungen wird dies wohl auch geschehen. Damit ist zum ersten Mal der Trend zu immer noch niedrigeren Grenzwerten für Gefahrstoffe umgekehrt worden. Die Erkenntnis, dass immer strengere Grenzwerte nicht in jedem Fall der Gesundheit der Mitarbeiter dienen, hat sich durchgesetzt. Die Mess- und Regeltechniker in den Produktionsanlagen haben nun einen Kopfschmerz weniger. Die Gasdetektion im unteren ppb-Bereich ist eine echte Herausforderung und erfordert hohe Investitionen in die Instandhaltung. Konsequent haben viele Betreiber in Deutschland ihre Geräte von einem Messbereich von 0 bis 0,1 ppm umgehend wieder auf den Bereich 0 bis 0,3 ppm umgerüstet. Eine neue Indikatorplakette musste her Für die Hersteller von Dosimeterplaketten entstand eine neue Herausforderung: Um eine Übertherapie oder den gefürchteten Toxycopy-Effekt zu vermeiden, sollten nun Plaketten entwickelt werden, die erst ab 10 ppm/min beginnen sich zu verfärben. Das Reagenz des klassischen Indikatorpapiers bildet mit Phosgen einen roten Farbstoff. Dieser Prozess beginnt mit dem ersten auftreffenden Molekül. Ab einer Dosis von rund 0,2 ppm/min wird ein Verfärben des Papieres mit bloßem Auge wahrnehmbar. Dies ist jedoch weit entfernt vom gewünschten Alarmpunkt 50 ppm/min. Die Arbeitsmediziner wünschten sich eine Verfärbung, die erst ab 10 ppm/min beginnt, sichtbar zu werden. Dieser Grenzwert errechnet sich aus der Dosis, ab der medizinisches Eingreifen erforderlich ist, nämlich: Nachweisgrenze = 50 ppm/min/5 = 10 ppm * min wobei 5 als Sicherheitsfaktor festgelegt wurde. Weiterhin sollte der Messbereich dahingehend erweitert werden, dass die Abstufungen zwischen den Expositionsdaten ab denen andere Therapiemaßnahmen erforderlich sind, klar unterscheidbar sind. Der Messbereich musste also auf 0 – 300 ppm * min erweitert werden. Das Problem bestand nun darin, die Chemie der Plaketten so einzustellen, dass die sichtbare Verfärbung erst oberhalb eines wohl definierten Startpunktes beginnt. Es entstand die Idee, das vorhandene Reagenz, das sich aufgrund seiner Zuverlässigkeit und seiner hohen Spezifität in der Praxis sehr gut bewährt hatte, beizubehalten und um eine weitere Substanz zu ergänzen. Diese Substanz sollte so genannte „Scavenger“-Eigenschaften haben, nämlich: - es sollte mit Phosgen reagieren; - diese Reaktion sollte schneller sein als die Reaktion mit dem Farbreagenz; - das Produkt dieser Reaktion sollte weiß sein, um die Farbreaktion nicht zu verfälschen; - es sollte unempfindlich gegen HCl sein; - es sollte über mindestens 1 Jahr stabil sein; - es sollte keine Querempfindlichkeiten erzeugen; - das Indikatorpapier sollte bezahlbar bleiben. Vor allem in asiatischen Raum lassen sich Kosten von mehr als einigen Cent pro Tag für das Monitoring von Arbeitsplatzgrenzwerten nicht durchsetzen; - das resultierende Indikatorpapier sollte die Gesamtdosis anzeigen: - Anzeige = (Konzentration * Zeit) – (10 ppm/min). Letztendlich konnte eine solche Substanz gefunden werden. Chemiker entwickelten ein Indikatorpapier, dessen Nachweisgrenze allein durch die Dosierung der Scavenger-Substanz über einen so weiten Bereich einstellbar ist, dass alle Forderungen der Arbeitsmediziner erfüllt werden konnten. Die Farbe des exponierten Papiers verschob sich verglichen mit dem klassischen Indikatorpapier etwas ins Gelbe, die Farbintensität blieb aber erhalten, so dass die Dosis nach wie vor ohne apparativen Aufwand problemlos abzulesen ist. Damit war aber der geforderte Messbereich noch nicht realisiert. Der Scavenger verschob ja nur den Offset um 10 ppm * min, und hob damit den Messbereich auf 10 – 160 ppm * min an. Letztendlich ist auch eine Indikatorplakette wie jeder Gasdetektor ein Molekülzähler. Um einen höheren Messbereich zu erreichen, musste also die Anzahl der auftreffenden Moleküle reduziert werden. Bei Compur Monitors entstand die Idee, eine dreidimensionale Plakette zu bauen, bei der sich das Indikatorpapier auf der Rückseite einer Reaktionskammer befindet, die von der Atmosphäre durch eine Lochfolie getrennt ist. Diese Folie wirkt als Diffusionsbremse und limitiert so den Zugang der Gasmoleküle. Ein sehr willkommener Nebeneffekt ist, dass die Folie auch den das Eindringen von Schmutz, Feuchte, Störgasen und UV – Strahlung verringert. Durch die geeignete Auswahl der Lochgröße – und Anzahl ließ sich der gewünschte Messbereich genau einstellen. Im Unterschied zur existierenden Plakette ist die neue Plakette ein Einwegprodukt. Dies hat den Vorteil, dass alle Komponenten stets frisch und sauber sind. Technische Daten Die Chemikalien – Reagenz und Scavenger – vertragen sich gut. Eine Lagerfähigkeit von über einem Jahr kann schon jetzt sicher vorhergesagt werden. Der bei Begasung entstehende Farbstoff ist sehr stabil. Das Papier ist auch nach mehreren Wochen noch gut ablesbar. Der Einfluss von Temperatur und Feuchte ist vernachlässigbar. Dieser Aspekt ist besonders wichtig, da die Plaketten weltweit einsetzbar sein sollen. Die Querempfindlichkeiten beschränken sich – wie beim existierenden Produkt – auf eine Hand voll Substanzen, die ebenfalls sehr toxisch sind. Dadurch haben sie auf die Einsetzbarkeit der Plakette keinen wirklich störenden Einfluss. Die maximale Nutzungsdauer beträgt 5 Tage. Ein Ausbleichen durch HCl - Exposition ist vernachlässigbar, solange der AGW von HCl nicht dauerhaft überschritten wird. Sollte dieser Verdacht bestehen, kann der Farbverlust durch Ammoniakdampf rückgängig gemacht werden. Die Ergebnisse wurden erstmals 2008 der Industrie vorgestellt. Im Kreis zahlreicher Sicherheitsfachkräfte stieß das neue Produkt auf Zustimmung. Als letzten Schritt vor der endgültigen Markteinführung wurde dann noch international die Meinung von Arbeitsmedizinern eingeholt, um danach endgültig über die Gestaltung des letztendlichen Produktes inklusive Farbstandards, Packungsgröße etc. zu entscheiden. Außerdem musste das Produkt noch einen Namen bekommen. Da alle Spezifikationen den Wünschen der Arbeitsmediziner entsprechen, kam man schließlich auf den Namen MEDIC. Seit Mitte 2011 wird die MEDIC Plakette nun im industriellen Maßstab hergestellt und verkauft. Die Resonanz der Anwender ist durchwegs positiv.