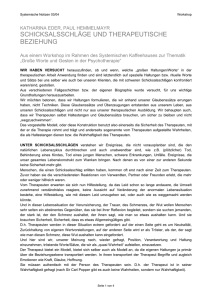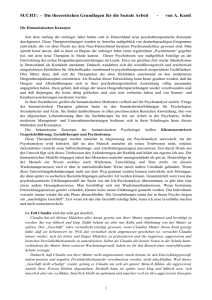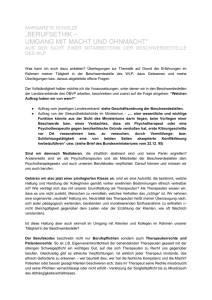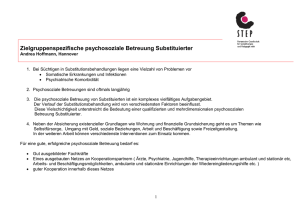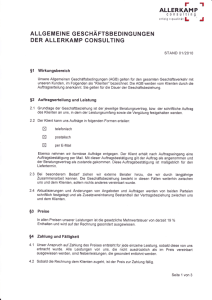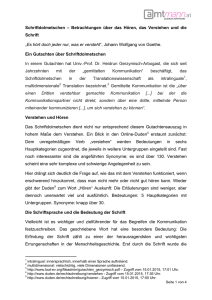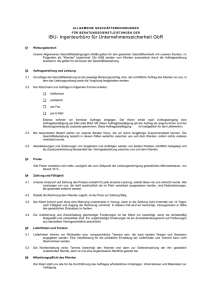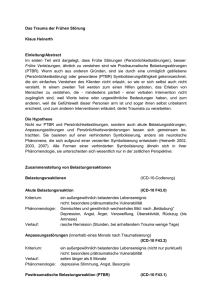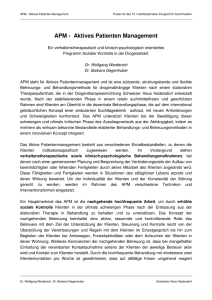Die Gesamtheit der Affekte, gedanklichen
Werbung
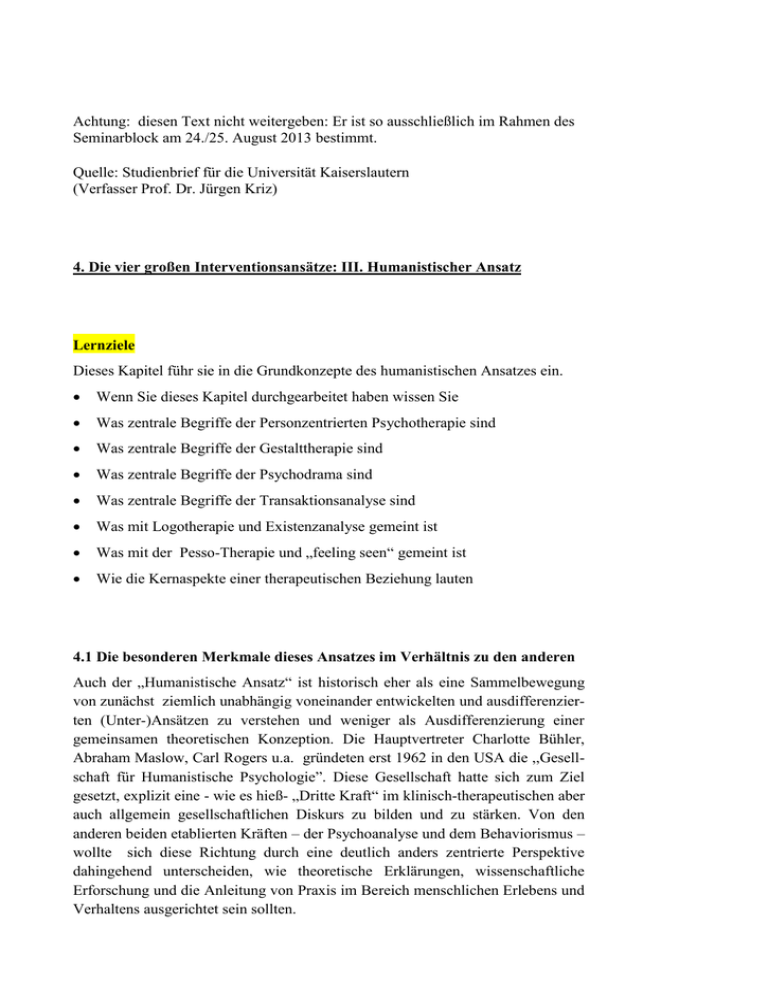
Achtung: diesen Text nicht weitergeben: Er ist so ausschließlich im Rahmen des Seminarblock am 24./25. August 2013 bestimmt. Quelle: Studienbrief für die Universität Kaiserslautern (Verfasser Prof. Dr. Jürgen Kriz) 4. Die vier großen Interventionsansätze: III. Humanistischer Ansatz Lernziele Dieses Kapitel führ sie in die Grundkonzepte des humanistischen Ansatzes ein. Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben wissen Sie Was zentrale Begriffe der Personzentrierten Psychotherapie sind Was zentrale Begriffe der Gestalttherapie sind Was zentrale Begriffe der Psychodrama sind Was zentrale Begriffe der Transaktionsanalyse sind Was mit Logotherapie und Existenzanalyse gemeint ist Was mit der Pesso-Therapie und „feeling seen“ gemeint ist Wie die Kernaspekte einer therapeutischen Beziehung lauten 4.1 Die besonderen Merkmale dieses Ansatzes im Verhältnis zu den anderen Auch der „Humanistische Ansatz“ ist historisch eher als eine Sammelbewegung von zunächst ziemlich unabhängig voneinander entwickelten und ausdifferenzierten (Unter-)Ansätzen zu verstehen und weniger als Ausdifferenzierung einer gemeinsamen theoretischen Konzeption. Die Hauptvertreter Charlotte Bühler, Abraham Maslow, Carl Rogers u.a. gründeten erst 1962 in den USA die ,,Gesellschaft für Humanistische Psychologie”. Diese Gesellschaft hatte sich zum Ziel gesetzt, explizit eine - wie es hieß- „Dritte Kraft“ im klinisch-therapeutischen aber auch allgemein gesellschaftlichen Diskurs zu bilden und zu stärken. Von den anderen beiden etablierten Kräften – der Psychoanalyse und dem Behaviorismus – wollte sich diese Richtung durch eine deutlich anders zentrierte Perspektive dahingehend unterscheiden, wie theoretische Erklärungen, wissenschaftliche Erforschung und die Anleitung von Praxis im Bereich menschlichen Erlebens und Verhaltens ausgerichtet sein sollten. Diese Unterschiedlichkeit der Perspektive lässt sich vor allem in den folgenden beiden Aspekten bündeln: a) Betonung einer phänomenologisch-existenzialphilosophischen Position: Hier wird vor allem das „Wesen des Menschen“ ins Zentrum gerückt und von daher versucht, die konkrete Situation des therapeutischen Handelns und die dort beobachtbaren Vorgänge zu verstehen und theoretisch zu rekonstruieren. Damit wird die Verankerung menschlichen Leidens in den bio-physischen Lebensprozessen sowie die Bedeutsamkeit reiz-reaktionsbedingter Lernzusammenhänge keineswegs negiert. Dass auch diese Aspekte für therapeutische Veränderung wichtig sind, wird also durchaus anerkannt. Aber als mindestens eben so bedeutsam für den Menschen - im Gegensatz zum nicht-menschlichen Bio-Organismus - ist der Aspekt, dass der Mensch als reflexives Wesen seine Existenz und sein Dasein in dieser Welt sinnhaft definieren kann und muss. b) Betonung einer ganzheitlich-systemischen Theoriekonzeption: Im Gegensatz zur ,,Elemente-Psychologie“, die von der Annahme ausgeht, dass psychische Phänomene aus (isoliert untersuchbaren) einzelnen Elementen zusammengesetzt sind, wird hier der Aspekt hervorgehoben, dass beim Wahrnehmen, beim Denken, bei Willenshandlungen und bei Bewegungsabläufen eine holistische Organisation der Abläufe stattfindet. Einflussnahme zur Veränderung bedeutet daher nicht, dass notwendig „Ordnung von außen“ vorgegeben werden muss (= Fremdorganisation), sondern sie kann auch im Bereitstellen von Bedingungen liegen, auf welche der Mensch (allgemeiner: das System) ganzheitlich selbstregulativ reagiert und innere Ordnungstendenzen zum Tragen kommen (=Selbstorganisation). Beide Aspekte sind von unserem üblichen Alltagsdenken her nicht leicht zu verstehen. Der Kern von (a), der seine philosophischen Wurzeln in der Existenzphilosophie, der Phänomenologie und im klassischen sowie französischen Humanismus hat (vgl. Kriz 2007), lässt sich aber (nach Heidegger) vielleicht an der Unterscheidung zwischen dem „Was“ und dem „Wie“ deutlich machen: Üblicherweise kennzeichnen wir etwas in der Welt durch eine Ansammlung von einzelnen Entitäten. Mit dieser Beschreibung des „Was“ klassifizieren wir etwas z.B. als „Haus“ oder „Baum“. Beim Menschen ist das Wesentliche aber nicht seine Zugehörigkeit zu einer Klasse, sein „was“ er ist, sondern die Art und Weise, wie er sich und seine Existenz selbst in dieser Welt versteht, wie er sich zur Welt, zu sich selbst und zu seinen Möglichkeiten verhält. Indem der Mensch nicht (nur) als ein Beispiel für die Spezies „Mensch“ verstanden wird, machen ihn die unterschiedlichen Weisen, er selbst sein zu können, kategoriell frei. Existenz ist somit etwas, das erst verwirklicht werden soll. Damit kann der Mensch nur von ,,innen her“, autonom, in seiner Zeitlichkeit und Endlichkeit begriffen werden. Der existenziell gelebte und erfahrene Augenblick gewinnt zentrale Bedeutung: Nicht das, was der Mensch ist, sondern das, wozu er sich jeweils durch die Tat macht, ist sein Wesen. Er ist, wie Sartre sagt, ,,zur Freiheit verdammt“, er selbst oder nicht er selbst zu sein und zu werden. Durch diese Verantwortung und den Entscheidungsspielraum werden gleichzeitig aber auch Autonomie, Identität und menschliche Würde möglich. Besonders die phänomenologische Position betont das erfahrende Subjekt mit seinen sinnlichen Möglichkeiten, seiner Intentionalität und seinen Verstehensprozessen. So hob Husserl hervor, dass alle Erfahrung von Gegenständen letztlich auf Selbsterfahrung aufbaut – eine Sichtweise, die das Ernstnehmen der subjektiven Realität eines Klienten unterstützt. In dem hier der Begriff „Lebenswelt“ eine Rolle spielt – und nicht primär nur die sog. „physikalische Welt“ – werden weniger die objektiviert-meßbaren sondern vielmehr die sinnhaft-eigenwertigen Aspekte des Lebens beachtet. Es geht um Lebenszeit und Lebensgeschichte, Sprache mit ihrer kommunikations- und traditionsbegründenden Funktion sowie Leiblichkeit und Geschlechtlichkeit als Voraussetzungen sinnerfüllten Lebens (Vetter u. Slunecko, 2000). Damit wird die übliche Subjekt-Objekt-Trennung zwar nicht überwunden aber zumindest unterlaufen. Von besonderer Bedeutung ist auch die Ich-Du-Beziehung als ,,Begegnung“ (speziell bei Buber 1923). In einer solchen Begegnung soll jeder die Möglichkeit haben, sich selbst tiefer zu finden, ohne vom anderen in irgendeiner Weise manipuliert zu werden – die Partner sind dann wechselseitig Katalysatoren zum Wachsen in Freiheit. ,,In das Leben der Dinge eingreifen“, sagt Buber (1957, nach Rogers 1977, S. 21), ,,bedeutet, ihnen wie sich selbst Schaden zuzufügen... Der vollendete Mensch... greift nicht in das Leben der Wesen ein, er erlegt sich ihnen nicht auf, sondern er 'verhilft allen Dingen zu ihrer Freiheit' (Laotse)“. Es sei bemerkt, dass eine solche Sicht nach dem klassisch-abendländischen Weltbild eben entsprechend „weltfremd„ wirken muss: Glaubte man dort doch (und hielt dies auch noch für eine „wissenschaftliche Tatsache„), dass Ordnung und Veränderung nur über Ordnen bzw. ordnende Intervention erreicht werden können. Damit sind wir aber schon beim zweiten der oben als zentral bezeichneten Aspekte: Das mit (b) verbundene theoretische Kernkonzept für das Verständnis hilfreicher Unterstützung von Veränderungsprozessen ist im humanistischen Ansatz die „Aktualisierungstendenz“ – ein Begriff, der so vor allem in der personzentrierten Psychotherapie und Beratung nach Carl Rogers auftaucht, dessen Konzept aber auch für die anderen Vorgehensweisen wesentlich ist. In heutiger Terminologie würde man sagen, dass es sich um ein systemtheoretisches Konzept handelt (das also auch dem in Kap. 7 dargestellten systemischen Ansatz zugrunde liegt). In der Psychologie wurde es aber schon vor 80 Jahren im Rahmen der Gestalttheorie der Berliner Schule entwickelt (wie im vorigen Abschnitt bereits gesagt wurde), nämlich von dem Physiologen und Psychiater Kurt Goldstein (der von „Selbstaktualisierung“ sprach – so wie wir heute von Selbstorganisation sprechen - im Gegensatz zu Fremdorganisation). Goldstein verstand darunter die selbstorganisierte Realisierung und Entfaltung inhärenter Potentiale und betonte die ganzheitliche Selbstregulation von Prozessen im gesamten Organismus. Goldstein wies z.B. nach, dass ein Organismus ein nicht mehr funktionstüchtiges Körperteil in einer ganzheitlichen Umorganisation der verbliebenen Teile kompensiert: Schneidet man einem Käfer eines oder mehrere seiner sechs Beine ab, so werden die übrigen spontan in einer neuartigen Weise erfolgreich zur Fortbewegung organisiert. Mit dieser „Tendenz zu geordnetem Verhalten“ erklärte er, warum ein Organismus auch dann oft weiter existieren kann, wenn er erhebliche Beeinträchtigungen erfahren musste. Auf der Basis weitreichender Erfahrungen mit hirnverletzten Soldaten aus dem 1. Weltkrieg stellte Goldstein die Tendenzen zur Selbstregulierung und zur Selbstaktualisierung heraus und verwies auf die grundsätzliche Interdependenz psychischer und somatischer Prozesse. Der Organismus braucht für seine Ordnung also keinen externen „Organisator“, sondern in Relation zur Umwelt strebt der dynamische Prozess selbst zu einer angemessenen Ordnung, bei der die inneren Möglichkeiten und äußeren Gegebenheiten dynamisch zu einer ganzheitlichen Gestalt abgestimmt werden. Goldstein beschrieb die Veränderung dieser dynamischen Ordnung als eine Reorganisation der alten Struktur („pattern“) zu einer neuen und effektiveren Struktur. Eine solche Aktualisierungstendenz als zentrales Erklärungsprinzip stellt auch heute für viele immer noch eine große Herausforderung für das „klassische Denken“ dar. Mit „klassischem Denken“ ist gemeint, dass unsere Vorstellungen darüber, wie „die Welt funktioniert“, wie Wirkungen auf Ursachen zuzuführen sind, welchen Prinzipien erfolgreiches Handeln unterworfen ist, wie man Sicherheit über Prognosen von Entwicklungsverläufen erreichen kann usw., in unserer Kultur im Rahmen eines rund 350 Jahre währenden Wissenschaftsprogramms entwickelt wurden. Dieses Programm, das etwa ab Beginn des 17. Jahrhunderts im Rahmen abendländischer Kultur entstand, hat sich nicht nur über einen gewaltige technologische Entwicklung auch anderer Kulturkreise bemächtigt sondern zudem unsere Alltagswelt mit ihren Prinzipien durchdrungen. Denn überall begegnen wir den Errungenschaften dieser Technologie. Selbst im Umgang mit komplizierten und komplexen Gebilden können wir die so aufbereitete Welt durch einfache mechanistische Betätigungen steuern – etwa das Gaspedal eines Autos durchdrücken, den Licht-Schalter oder ähnlich einfache Schalter zur Inbetriebnahme von Waschmaschinen, Herdplatten, Aufzügen oder Fernsehern betätigen. Zwar ist erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch der Gipfel der mechanistischen Hybris Ende des 19. Jahrhunderts, welche die gesamte Welt mit allen ihren Phänomenen für mechanistisch, berechen- und kontrollierbar erklärte, längst überschritten. Dennoch hinkt das Alltagsverständnis von „der Welt“ aufgrund dieser mechanistischen Aufbereitung durch die technischen Apparate den Veränderungen im wissenschaftlichen Weltbild hinterher. Dieser kurze kulturgeschichtliche Exkurs war notwendig, weil es sonst geradezu unfassbar wäre, warum wir selbst in der Psychotherapie vorwiegend mechanistische Metaphern unserem Verständnis von Veränderung und Intervention unterlegen. Denn „eigentlich“ ist selbst jedem Laien klar, dass es fundamentale Unterschiede gibt zwischen dem Ausbeulen einer Blechdose oder dem Reparieren einer Maschine einerseits und den Interventionen in lebende Systeme oder gar dem Durchführen von Psychotherapie andererseits. „Eigentlich“ wissen Psychologen, dass Entwicklungsverläufe – von den „Aha“-Erlebnissen der Gestaltpsychologen über die kognitive Entwicklung Piagets bis hin zu klinisch beschriebenen Krisen – typischerweise durch qualitative Sprünge gekennzeichnet sind. Und ebenso wissen sie „eigentlich“, dass fast alle relevanten Phänomene – von den Prozessen im ZNS über essentielle Prozesse von Bewusstsein und Verhalten in der ElternKind-Interaktion bis hin zu den sozialen Sinnfindungsprozessen und dem, was wir „Kultur“ nennen - auf komplex vernetzten Prozessen basiert. Dennoch wird die „Effektivität“ von Psychotherapie aufgrund von gruppenstatistischen Modellen linearer Zusammenhänge beurteilt und dabei z.B. die Isolierung in „abhängige“ und „unabhängige“ Variable vorgenommen. Diese methodologische Verfehlung des grundlegenden Charakters psychosozialer Vorgänge wäre völlig unverständlich, wenn man nicht die ideologische Verhaftung auch der Psychotherapie (und ihrer Erforschung) in den Alltagsprinzipien von Welterklärung als stillschweigende Überbleibsel des mechanistischen Zeitalters berücksichtigt. Diese Konzepte sind deshalb besonders bemerkenswert, weil man heute, im Lichte moderner naturwissenschaftlich fundierter Systemtheorie, die zentralen Annahmen in gleicher Weise formuliert. Entsprechend findet man bei dem Physiker Haken, dem Begründer der Laser-Theorie und eines großen interdisziplinären Wissenschaftsprogramms zur Selbstorganisation, der Synergetik, in den letzten Jahren mehr Hinweise auf die klassische Gestaltpsychologie als in etlichen psychologischen Werken (z.B. Haken & Stadler 1990, Haken & Haken-Krell 1994). Fairerweise muss bemerkt werden, dass allerdings auch in etlichen Werken humanistischer Psychotherapie sehr schwammige, verworrene oder gar mystisch-esoterische Vorstellungen zur Aktualisierungstendenz herumgeistern. Der oft von anderen belächelten Begriffe „Wachstum“ und „Selbstentfaltung“ sind ebenfalls im Sinne der Aktualisierungstendenz zu verstehen: Es geht dabei weder um ein „immer mehr“ (im schlechten Sinne des Wirtschaftswachstums) noch um eine autarke bis isolierte Entwicklung „aus sich heraus“. Vielmehr geht es immer um die adaptive Beziehung von Umgebungsbedingungen der Entwicklung und inneren Möglichkeiten. Wie auch heutige neurobiologische Befunde nochmals bestätigen, werden diese Möglichkeiten immer entsprechend dem Angebot aus der Umwelt konkret realisiert. Da sich diese Umgebung ständig verändert – z.B. die Anforderungs-Umgebung an einen 3-, einen 6-, einen 12- oder einen 20-jährigen – wird immer wieder neu adaptiert. „Wachstum“ meint daher das „stirb und werde!“, das in vielen Kulturen typisch für Entwicklungsvorgänge steht und sich auf typische Wachstumsprozesse in der Natur bezieht: Auch Laubbäume verlieren im Herbst einen großen Teil ihrer Biomasse, um dann im Frühjahr neue Blätter zu treiben. „Wachstum“ im Kontext von Entwicklung und Veränderung meint somit, immer wieder Teile der psychischen und behavioralen Lebensstrukturen „sterben“ zu lassen, um neue entfalten zu können – etwa das Betteln um Nahrung als 3-Jähriger in eigenständiges Holen aus der Küche als 12Jähriger und mit eigenem Geld einkaufen als 30-Jähriger. Wenn man die selbstregulatorischen Fähigkeiten der biologischen, psychischen und psychosozialen Lebensprozesse unterstützen möchte, müssen die dafür zu gestaltenden Umgebungsbedingungen sehr situations-, problem- und personspezifisch ausgerichtet und ständig am Prozess nachjustiert werden. Dies ist somit eine recht andere Herangehensweise, als mit vorher klar gefertigten Lern- und Trainingsprogrammen oder manualisierten Handlungsanweisungen zu operieren. Dies macht beispielsweise die Beweisbarkeit der Wirksamkeit humanistischer Verfahren mittels einer am klassisch-experimentellen Design ausgerichteten Vorgehensweise weitaus schwieriger, als etwa bei der Verhaltenstherapie. Denn weder die für ein solches Vorgehen notwendige Zerlegung der Prozesse in „unabhängige“ und „abhängige“ Variablen noch die ebenfalls notwendige Normierung der Vorgehensweise entspricht dem Paradigma des humanistischen Ansatzes. Allerdings konnte, der bürokratischen Notwendigkeit gehorchend, auch der humanistische Ansatz entsprechende Forschungsstudien vorlegen: selbst unter solch reduzierten Bedingungen erwiesen sich die Prinzipien dieses Ansatzes als hoch wirksam. Wenn wir nun resümierend die besonderen Merkmale des humanistischen Ansatzes im Verhältnis zu den anderen Ansätzen charakterisieren, so sind dies: Betonung der „Freiheit“ des Menschen – womit eine wesentliche Freiheit gegenüber anderen Bio-Organismen (Tieren) gemeint ist, welche weitgehend funktionell in eine Umwelt eingespannt sind. Selbstverständlich ist die evolutionär-biologische Basis auch für den Menschen wichtig. Essentiell aber ist, dass der Mensch als reflexives Wesen seine Existenz und sein Dasein in dieser Welt sinnhaft definieren kann und muss. Sinn und Bedeutung sind daher zentrale Kategorien. Damit wird auch der inneren Erlebenswelt ein entscheidender Stellenwert zugeordnet – die Art und Weise, wie sich der Mensch in seinen Beziehungen zur Welt, zu anderen Menschen und zu sich selbst versteht. Dies ist nicht einfach durch Reize determiniert. Betonung der selbstorganisierenden bzw. selbstregulatorischen Aspekte. Ordnung muss nicht nur dadurch erzeugt werden, dass von außen geordnet wird, sondern es reicht die Bereitstellung von günstigen Umgebungsbedingungen, damit interne Ordnungsprozesse in Gang gesetzt werden. Das gleiche gilt für die Veränderung von Ordnungszuständen (für Therapie und Beratung typisch). Humanistische Forschungsergebnisse und daraus resultierende Konzepte von „günstigen Umgebungsbedingungen“ (z.B. „therapeutische Beziehung“) werden ausführlich in 6.3 vorgestellt. „Wachstum“ und „Selbstentfaltung“ sind ebenfalls typische Konzepte des humanistischen Ansatzes – diese meinen aber immer eine adaptive Beziehung zwischen der Entwicklung des Menschen und seiner materiellen und psychosozialen Umwelt. Wegen der starken Betonung selbstregulatorischer Prozesse, kann in Therapie und Beratung nach diesem Ansatz weniger auf vorher gefertigte Pro- gramme und manualisierte Vorgehensweisen zurückgegriffen werden. Es werden also weniger Techniken aus einem „allgemeinen Handwerkskasten“ angewendet, sondern Prinzipien – situations- und personspezifisch – entfaltet. Auch dieser Unterschied wird in Abschnitt 6.3. noch deutlicher. 4.2. Zentrale Grundkonzepte des humanistischen Ansatzes Innerhalb des humanistischen Ansatzes hat in Deutschland die personzentrierte Richtung nach Carl Rogers (historisch und im Bereich ambulanter Krankenbehandlung auch als „Gesprächspsychotherapie“ bekannt) die größte Verbreitung an den Hochschulen und in der Versorgungspraxis gefunden, gefolgt von der Gestalttherapie. Weitere Richtungen sind das Psychodrama, die Transaktionsanalyse sowie die Logotherapie und Existenzanalyse. Auch Körperpsychotherapie und Gruppenpsychotherapie ordnen sich (teilweise) dem humanistischen Ansatz zu. Verbände mit den genannten Ausrichtungen haben sich Ende 2010 in Deutschland zur „Arbeitsgemeinschaft Humanistische Psychotherapie (AGHPT)“ zusammengeschlossen. Daneben gibt es aber weitere Richtungen, die ebenfalls durchaus dem humanistischen Ansatz zugeordnet werden können und sich auch so verstehen – etwa die Daseinsanalyse nach Ludwig Binswanger und Medard Boss (vgl. Boss u. Condrau 1983), oder die für die USA bedeutsamere Existenzielle Therapie nach Rollo May (1969) und Irvin D. Yalom (1999). Ebenso die in jüngerer Zeit auch in Deutschland bekannte werdende „PBSP - Pesso Boyden System Psychomotor“ von Albert Pesso (Pesso & Perquin 2008) bzw. – gerade für den Kontext dieser Lehreinheit bedeutsam – die von Michael Bachg (2010) entwickelte Umsetzung der PBSP für Kinder und Jugendliche, genannt „feelingseen“. Man kann ahnen, dass dieser Verbund an humanistischen Richtungen mit je eigenen Organisationen eine große Zahl an Konzepten hervorgebracht hat, die hier keineswegs erschöpfend vorgestellt werden können und sollen (vlg. Kriz 2007, Eberwein 2009). Die Ansätze sollen aber mit wenigen Kernkonzepten jeweils kurz skizziert werden. Die übergreifende Aktualisierungstendenz wurde ja bereits im vorigen Abschnitt erläutert, die ebenfalls übergreifenden Merkmale einer hilfreichen Beziehung werden in Abschnitt die 6.3 separat besprochen und auch in 6.4. sollen nochmals übergreifende Aspekte exemplarisch diskutieret werden. 4.2.1. Personzentrierte Psychotherapie Diese wurde in den 1940er Jahren von Carl R. Rogers (1902-87) aus systematischen Aufzeichnungen und Auswertungen von Therapiesitzungen entwickelt. Er formulierte aufgrund dieser Arbeit einerseits die Bedingungen für eine hilfreiche Beziehung (vgl. 6.3), andererseits eine sehr differenzierte Theorie der Entwick- lung von Persönlichkeit einschließlich ihrer Veränderungsmöglichkeiten. Hierbei übernahm er zunächst den Begriff der „Selbst-aktualisierung“ von Goldstein und verwendete ihn als Gegensatz zur Fremd-Organisation. Mit einer zunehmenden Ausdifferenzierung seiner „Selbst“-Theorie – für die Rogers neben der klinischen Psychologie und Psychotherapie vor allem im Bereich der Persönlichkeitspsychologie viel Beachtung erfuhr (z.B. im Standardwerk von Hall & Lindzey 1957) – veränderte sich Rogers Terminologie allerdings Ende der 1950er Jahre: In der Personzentrierten Psychotherapie wird „Selbstaktualisierung” seitdem als Entwicklung des „Selbst“ verstanden, während die gesamte (selbstorganisierte) Entwicklung des Organismus mit „Aktualisierung“ bezeichnet wurde. Die Selbstaktualisierung ist somit – typisch menschlicher - Teil der (organismischen Gesamt-) Aktualisierung. Es macht aber deshalb besonders Sinn, den Teil der Selbstaktualisierung analytisch von der Aktualisierung klar abgrenzen, weil die Art und Weise, wie sich das Selbst aktualisiert, keineswegs immer gut die organismischen Bedürfnisse des Menschen repräsentiert sondern oft mehr das, was seine Mitmenschen, insbesondere nahe Bezugspersonen, von ihm erwarten und für richtig halten. Es kommt dann zur Inkongruenz zwischen Erfahrungen des Organismus und dem, was davon im Selbst repräsentiert werden kann – Rogers spricht von „Symbolisierung“ als wichtigen Prozess, Erfahrung im Selbst repräsentieren zu können und sie damit bewußtseinsfähig zu machen. Da das Selbst ja nicht angeboren ist, sondern erst in der Beziehung zu den engen Beziehungspersonen und aus deren Rückmeldungen seine Strukturen entwickelt, können z.B. Affekte und emotionales Erleben, das von diesen Bezugspersonen nicht beachtet oder verstanden wird auch nicht ins Selbst integriert werden. Dies ist die Basis für psychische Störungen die sich natürlich dann auch sozial auswirken können. Aufgabe von Therapeuten und Beratern ist dementsprechend, durch empathisches Einfühlen in das Erleben das Klienten und Rückmeldung des Verstandenen (insbesondere der emotionalen Bewertungsprozesse und des Erlebens), dieses symbolisierbar und damit für das Selbst integrierbar zu machen. Neben einer „klassischen“ Vorgehensweise, die sich tatsächlich darauf beschränkt, das Erleben und seine Bewertungen sehr sorgfältig und genau „zur Sprache zu bringen“, sind in jüngerer Zeit auch unterschiedliche Vorgehensweisen entwickelt worden, welche aktiv bestimmtes Erleben unterstützen, darauf fokussieren helfen oder gar provozieren. Man spricht hier von experientiellem (also erfahrungszentrierten), bzw. emotionsfukussiertem Vorgehen. Als eigene Unterrichtung hat sich das sog. „Focusing“ von Eugen Gendlin (* 1926) – viele Jahre Kollege von Rogers in Chicago – etabliert. Hierbei werden besondere Vorgehensweisen zur Förderung des inneren Erlebens und der Lenkung der Aufmerksamkeit auf dieses Erleben angewendet (Gendlin & Wiltschko, 2004). In Deutschland wurde Personzentrierten Psychotherapie durch Reinhard Tausch unter der Bezeichnung „Gesprächspsychotherapie“ bekannt. Im heilkundlichen Bereich wurde dieser Name beibehalten. 4.2.2. Gestalttherapie Diese wurde von Frederick („Fritz“) Perls und seiner Frau Lore (amer.: Laura) entwickelt (zu den Begründern zählen aber auch weitere Personen). Es wurden dabei unterschiedliche Ansätze und Strömungen integriert: Psychoanalytisches und körpertherapeutisches Gedankengut sowie Elemente aus dem Psychodrama (s.u.). Zum Namen „Gestalttherapie“ kam es durch seine Assistententätigkeit beim Gestaltpsychologen Kurt Goldstein und durch seine Frau, die eine promovierte Gestaltpsychologin war. Entsprechend der Psychoanalyse geht es im Kern um eine Widerstandsanalyse: "Die Bewusstmachung unerwünschter Gefühle und die Fähigkeit, sie zu ertragen" (Perls 1978, S. 216). Allerdings wird der Widerstand nicht gedeutet, sondern dem Klienten durch erlebenszentrierte Vorgehensweisen erfahrbar gemacht. In der Gestalttherapie steht nicht das (wegzensierte) Material, sondern der (Kontakt- und Blockierungs-)Prozess selbst im Zentrum. Im Verhalten im Hier und Jetzt, in den Bewältigungsstrategien und in der Art des Umwelt- und Selbst-Kontaktes zeigen sich die unvollendeten, nicht geschlossenen Gestalten. Bei dieser Konzeption von Kontakt ist es von zentraler Bedeutung, dass die Strukturen des "Selbst" erst im Kontakt zwischen Organismus und Umwelt deutlich werden. Das Selbst steht hier im Dienste der organismischen Selbstregulation – es ist also Integrator des Organismus und für den Prozess der Organismus-UmweltAuseinandersetzung zuständig. Man sieht an vielen Stellen die Ähnlichkeit zum personzentrierten Konzept. Im Gegensatz zu letzterem, das stark auf die Gestaltung der therapeutischen Beziehung und wenig für Methoden plädiert, gibt es in der Gestalttherapie eine große Anzahl von "Techniken", die helfen sollen, den Klienten mehr in Kontakt mit sich selbst und mit der Umwelt zu bringen. Im Grunde aber, sagt Perls, würden sogar die folgenden fünf Fragen "als Ausrüstung für den Therapeuten ausreichen": Was tust Du? – Was fühlst Du? – Was möchtest Du? – Was vermeidest Du? – Was erwartest Du? Damit ist natürlich nicht gemeint, dass diese Fragen so an die Klienten gerichtet werden sollen, sondern diese Fragen kennzeichnen eher Leitlinien für die therapeutische Arbeit. Im Gegensatz zu anderen Therapieverfahren, z.B. zur Gesprächspsychotherapie, wird bei dieser Arbeit übrigens der Konfrontation und der Frustration des Klienten eine große Bedeutung beigemessen – allerdings nur auf der Basis einer tragfähigen Therapeut-Klient-Beziehung, die gleichzeitig durch Unterstützung gekennzeichnet ist. Das Wechselspiel zwischen Unterstützung ("support") und Frustration ("skillful frustration") ist ein wichtiges Kennzeichen des gestalttherapeutischen Interventionsstils. Es gibt in der heutigen Gestalttherapie aber unterschiedliche Schwerpunktsetzungen: psychoanalytisch orientierte, stärker mit der Gesprächspsychotherapie verbundene und auch vornehmlich gestalttheoretisch ausgerichtete Ausbildungsgänge. 4.2.3. Psychodrama Das Psychodrama geht auf Iacov Levi (eingedeutscht: Jakob Levy) Moreno (1889─1974) zurück, der seine Konzepte zunächst in Wien, ab 1925 in den USA entwickelte. Mehr noch als eine eigenständige, abgegrenzte Therapie-Richtung hat das Psychodrama dadurch Bedeutung, dass grundlegende Konzepte von vielen anderen Therapieansätzen - ggf. leicht modifiziert - übernommen wurden. So hat sich Moreno bereits 1915 in seiner Schrift „Einladung zu einer Begegnung“ mit einem zentralen Konzept humanistischer Psychologie, der Begegnung, auseinander gesetzt. Auch das Konzept der „Empathie“ wurde von Moreno erstmals thematisiert, ebenso die Hervorhebung des „Hier und Jetzt“ für das Erleben des Klienten und die therapeutische Arbeit. Ferner sind wesentliche Aspekte der heutigen Gruppentherapie und der interaktionellen, systemischen Therapie bereits Jahrzehnte zuvor von Moreno vorweggenommen worden. Fritz Perls (Gestalttherapie) und Eric Berne (Transaktionsanalyse) waren z.B. in Morenos Vorlesungen. Rollenspiel, Rollentausch und leerer Stuhl sind z.B. Elemente, die Perls für seine Gestalttherapie von Moreno übernahm. Im Zuge seiner therapeutischen Arbeit in Gruppen entwickelt Moreno bereits Anfang der dreißiger Jahre die Soziometrie – einen Ansatz zur Erfassung und Darstellung sozialer Beziehungen und Gruppenprozessen („Messen von Beziehungen“). Ein wesentlicher Aspekt der Psychodrama-Therapie ist die Katharsis, die heilende Wirkung des Nacherlebens und Ausagierens von belastenden Erfahrungen. Die „Aufrollung des Lebens im Schein wirkt nicht wie ein Leidensgang, sondern bestätigt den Satz: jedes wahre zweite Mal ist die Befreiung vom ersten'' (Moreno 1923, 1959). Obwohl Psychodrama auch als Einzeltherapie, als „Monodrama“ (bzw. „Psychodrama en miniature“), durchgeführt wird, sind die wesentlichen Konzepte doch auf eine Arbeit mit Gruppen bezogen. Die Konzeption des Psychodramas als Gruppenverfahren lässt sich anhand der typischen sechs Bestandteile („Konstituenten“) erläutern: Auf einer Bühne – oft nur ein mit einem Klebeband abgegrenzter Teil des Gruppenraumes – setzt ein Mitglied der Gruppe als Protagonist spontan das in Szene, was seine Probleme und Konflikte betrifft. Mit Hilfe des Spielleiters (Therapeut) und der Mitspieler, durch Einsatz von Sprache, Mimik, Gestik, Bewegung usw., soll ein möglichst hoher affektiver Realitätsgehalt (s.o.) erreicht werden. Die Mitspieler dienen dem Protagonisten bei der Realisierung seines Spieles, indem sie reale oder phantasierte Personen, Symbolfiguren usw. darstellen – z.B. „Mutter“, „Vater“, „Chef“, „(Phantasie-) Kontrolleur“, „Ehrgeiz“ etc. Die (übrigen) Teilnehmer der Gruppe bilden als Publikum den Resonanzboden für das dramatische Geschehen. Psychodrama-Techniken dienen dem Leiter als Mittel, dem Protagonisten und der Gruppe Prozesse, Fragen, Probleme, Beziehungen usw. deutlich werden zu lassen. Das Psychodrama wird dabei in seinem Ablauf in drei Phasen untergliedert: (1.) eine Inititialphase („Warm-Up“-, Problemfindungs-Phase), (2.) eine Handlungsphase (Aktions-, Spiel-, Problembearbeitungs-Phase) und (3.) eine Abschlussphase („Sum-Up“-, Gesprächs-, Integrations-, Nach bereitungs-Phase). Jeder Phase lassen sich spezifische Techniken zuordnen, von denen viele auch in der Gestalttherapie eingesetzt werden – z.B. „leerer Stuhl“ in der Initialphase, Rollenwechsel und Doppeln (wobei der Leiter hinter den Protagonisten tritt und Äußerungen wiederholt bzw. „mitmacht“, ggf. emotional vertiefend“) in der Spielphase. 4.2.4 Transaktionsanalyse Diese Richtung wurde von Eric Berne (1910 – 1970) in den USA der1950er entwickelt. Besonders interessant ist dieser Ansatz deshalb, weil er individuelle und interaktive Aspekte miteinander verbindet (wie sonst nur der systemische Ansatz – Kap. 7) und die Konzepte und sehr anschaulich vermittelt, so dass auch nichtFachleute ihre erlebte Wirklichkeit reflektieren, analysieren und bei Bedarf verändern können. Auf der individuellen Ebene wird zunächst – ähnlich dem psychodynamischen Ansatz ( Kap. 4) – drei Ich-Zustände unterschieden, die sich in den ersten zwölf Lebensjahren entwickeln und im Idealfall in der Interaktion Transaktionen gelingen lassen: Das Kind-Ich, dessen volle Funktion bis zum 3. Lebensjahr erreicht ist; das Erwachsenen-Ich, dessen Entwicklung vom 3. bis 6. Lebensjahr abgeschlossen wird und das Eltern-Ich, welches sich vom 10. bis 12. Lebensjahr entwickelt. Abb. 4.1: Grundmodell der Transaktionsanalyse Diese drei Ich-Zustände werden durch drei übereinanderliegende Kreise veranschaulicht (vgl. Abb. 4.1). In der sog. Strukturanalyse sind deren Grenzen für Gesundheit der Persönlichkeit wichtig: Sind sie zu durchlässig, kann es zu Trübungen kommen, sind sie zu starr, zu Abspaltungen. Beide entwickeln sich in der frühen Kindheit aufgrund der versagten Befriedigung eines oder mehrerer Grundbedürfnisse und der Notwendigkeit, diese auf andere Weise zu befriedigen – so führt übermäßige Ausweitung eines Ich-Zustands zur Trübung der anderen, die Unterdrückung zur Abspaltung. Zentralstes Grundbedürfnis ist das nach Zuwendung. Im Kommunikationsmodell der Transaktionsanalyse wird der Austausch von Botschaften zwischen den verschiedenen Ich- Zuständen zweier Partner betrachtet und dabei zwischen parallelen, überkreuzten und verdeckten Transaktionen unterschieden. Typische, immer wiederkehrende Transaktionsmuster werden als Ausdruck von eingelernten Rollen-„Spielen“ verstanden, denen ein bestimmtes Lebensdrehbuch (das „Skript“) zugrunde liegt. Sehr typische, meist mit verdeckten Transaktionen operierende Spielabläufe wurden durch Berne (2002) anhand von 36 verschiedenen Hauptspielen beschrieben. Abb. 4.2: Typische Transaktionen (aus Kriz 2007) Obwohl der Transaktionsanalyse keine fundierte Theorie zugrunde liegt, werden ihre Konzepte aufgrund der Praxistauglichkeit von anderen Therapieformen (v. a. der Paar- und Gruppentherapie) herangezogen oder abgewandelt; sie dienen aber auch der Vermittlung von Grundkompetenzen zur Wahrnehmung zwischenmenschlichen Handelns. 4.2.5 Logotherapie und Existenzanalyse Die Logotherapie von Viktor Frankl stellt die „Selbstbestimmung des Menschen aufgrund seiner Verantwortlichkeit und vor dem Hintergrund der Sinn- und Wertewelt“ (Frankl 1990, S. 230) ins Zentrum der Betrachtung. Frankl übersetzte das griechische „logos“ im Kontext seines Ansatzes mit „Sinn“. Als alternative Bezeichnung und gleichzeitig anthropologische Basis für die Logotherapie verwendete er den Begriff „Existenzanalyse“. Eines der Hauptprobleme, denen sich die Logotherapie widmet, ist „das Leiden am sinnlosen Leben“ (so der Titel eines seiner Bücher), die „noogene Neurose“. Dabei geht es nicht nur um Entwicklungs- und Lebenskrisen, sondern auch um Phobien, Depressionen, Zwänge, Süchte usw., denen ein solches „existenzielles Vakuum“ zugrunde liegt. Allerdings kann „nicht davon die Rede sein, dass die Logotherapie dem Leben des Klienten einen Sinn gibt. Den muss der selbst und selbständig finden“ (Frankl 1982, S. 183). Der Therapeut versucht, die Überzeugung beim Klienten zu wecken, dass sich der persönliche Einsatz für bestimmte Inhalte lohnt und dass selbst unter schlechten Bedingungen (sozial, ökonomisch oder körperlich) ein Sinn im Leben gefunden werden kann – und sei es nur, im Extremfall, das Schicksal mit Würde zu ertragen und Leid zu bewältigen. Der Therapeut bedient sich hier eines breiten Spektrums von konkreten Interventionsansätzen – z.B. setzt er „Sinnfindungsgespräche“ (vgl. Längle 1988) oder den „sokratischen Dialog“ ein, in dem durch geschickte Fragen bestimmte Positionen des Klienten hinterfragt werden. Die Technik der „Dereflexion“ dient - besonders bei psychosomatischen Funktionsstörungen - dazu, dass die „Hyperreflexion“, mit der bestimmten Phänomenen übermäßige Aufmerksamkeit geschenkt wird, gemildert wird. Es geht dabei darum, die Symptome zu ignorieren. Hingegen wird dort, wo die Erwartungsangst erst das Symptom, vor dem sich der Klient fürchtet, hervorruft, die Technik der „Paradoxen Intention“ eingesetzt: Dabei sollen die befürchteten Symptome quasi „herbeigewünscht“ werden. Beim Einsatz solcher Techniken ist die von Frankl hervorgehobene Fähigkeit eines guten Therapeuten zu beachten, nicht nach vorgefertigten Methoden vorzugehen, sondern zu improvisieren. Seit den 80er Jahren wurde die Logotherapie durch Alfried Längle wesentlich erweitert, besonders im Hinblick auf die Behandlung eines breiteren Spektrums psychopathologischer Störungen. Mit seiner „Personalen Existenzanalyse – (PEA)“ (Längle 1993, 2000) verschob er den Fokus von der Sinnfrage auf personale Prozesse, mit denen der Mensch sein Sein im dialogischen Austausch mit der Welt vollzieht: Mit den drei prozessualen Kernaspekten der Person - Eindruck, Stellungnahme und Ausdruck – werden Offenheit, Selektivität und Interaktivität der menschlichen Existenz verwirklicht. Diese erscheinen in der (kommunikativen) Außenperspektive als Ansprechbarkeit, Verstehen-Können und Antwort. Auf diese Weise werden in der Existenzanalyse sowohl die von Frankl wenig einbezogenen Emotionen und Affekte stärker berücksichtigt als auch die lebensgeschichtlichen Zusammenhänge des Klienten und seines Leidens betont. Längle unterteilt den Therapieprozess in vier Phasen: I) In der deskriptiven Vorphase geht es um die inhaltliche Erfassung und Beschreibung der Fakten bzw. Probleme und um die Aufnahme der therapeutischen Beziehung. Die therapeutische Haltung ist in dieser Phase eher rational-kognitiv. II) In der phänomenologischen Analyse wird bei einer empathischen Haltung des Therapeuten die primäre Emotion und deren phänomenaler Gehalt bearbeitet. III) In der Phase der Restrukturierung der Person geht es um die innere (authentische) Stellungnahme zum erlebten Inhalt. Dabei wird diese mit den bestehenden Wertbezügen des Klienten in Verbindung gebracht, wodurch die Emotion verständlich wird und Freiraum für neue Entscheidungen bezüglich der Probleme eröffnet wird. In dieser Phase arbeitet der Therapeut durchaus auch konfrontativ. IV) Als letzter Schritt wird eine entsprechende Gesamt-“Antwort“ als ein adäquater Ausdruck der gesamten Existenz in Form einer konkreten Handlung für die Problem-Herausforderung erarbeitet. In dieser Phase verhält sich der Therapeut vor allem schützend und ermutigend. 4.2.6 Pesso-Therapie und „feeling seen“ Albert Pesso (*1929) entwickelte seine PBSP („ Pesso Boyden System Psychomotor“) auf der Basis seiner Erfahrungen als Tanzausbilder und Choreograph in New York. Manchen Tänzern, die zunächst bestimmte Gefühlszustände nicht tänzerisch darstellen konnten, wurde der Ausdruck dadurch ermöglicht, dass andere eine entsprechende „Antwort“ tanzten. Die dabei oft auftretenden heftigen Emotionen führten Pesso zu der Erkenntnis, dass die Blockierung von Bewegungen und die von Emotionen zusammenhängen und durch solche Interaktionen aufgehoben werden können, in denen von anderen z.B. in der Rolle „idealer Eltern“ die lang ersehnten Reaktionen vor dem äußeren und/oder inneren Auge erfolgen. Die Arbeit in der Gruppe ähnelt somit dem Psychodrama – ergänzt allerdings um die explizite szenische Darstellung eben jener „ideal“ reagierenden Bezugspersonen und mit besonderem Augenmerk auf die Missachtung der 5 elementaren Bedürfnisse nach Platz, Nahrung, Unterstützung, Schutz und Grenzen (und zwar sowohl in realer als auch in symbolischer Form – der „Platz“ wird also zunächst einmal rein physisch in der Welt und in der Familie sein, aber dann auch ein Platz sich wohl und zuhause zu fühlen, oder ein Platz im Arbeitsteam). Und ähnlich, wie in der personzentrierten Psychotherapie wird der Symbolisierung und Versprachlichung von Gefühlen, die empathisch vom Therapeuten erkannt werden, eine zentrale Bedeutung beigemessen. In der PBSP wird dazu allerdings ein „Zeuge“, der die Gefühle sieht und benennt, als eine Art Kunstfigur eingefügt – etwa: „wenn es einen Zeugen gäbe, der hilft, Ihre Gefühle zutreffend zu benennen, dann würde er sagen: „ich sehe, wie einsam Sie sich fühlen, wenn Sie sich daran erinnern, wie Ihr Vater starb“. Damit werden die Gefühle zusammen mit den relevanten Szenen und den handelnden Personen auf einer Art „innerer Bühne“ der imaginierten Erinnerung in Szene gesetzt, was dann eben durch äußere Rollenspieler – sofern vorhanden – unterstützt und verstärkt werden kann. Auf dieser Bühne können dann später auch die „idealen“ Personen imaginativ auftreten und so der verletzenden inneren Szene der Erinnerung als ein „Gegengift“ („Antidote“) eine heilsame Szene imaginativ zur Seite stellen – etwa ein „idealer Vater, der nicht gestorben wäre“. Ausgehend von diesem Grundansatz hat Michael Bachg (*1959) unter der Bezeichnung „feeling seen“ eine Vorgehensweise entwickelt, die sich insbesondere an Kinder und Jugendliche unter Einbeziehung der Eltern richtet. Die Eltern sehen und erleben dabei, welche Gefühle ihre Kinder in Bezug auf bestimmte Ereignisse oder Situationen bewegen, wie eine andere Person damit umgeht, und wie sich das Kind „ideal“ verhaltende Eltern wünscht. Das heißt nicht, dass dieses ideale Verhalten im realen Leben tatsächlich immer so geschehen kann und muss – aber dass die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes wahrgenommen werden. Und das Kind fühlt sich vom Therapeuten und den anwesenden Eltern in seinen Gefühlen und Bedürfnissen gesehen. Bachg hebt auch hervor, dass außer belastenden Erfahrungen auch die Neigung und Fähigkeit von Kindern, Leestellen im Rollensystem der Familie einzunehmen, zu Belastungen und Störungen führen kann. Kinder werden dann z.B. zu Eltern ihrer Geschwister oder zum Partnerersatz ihrer Eltern und damit überfordert. Das sorgfältige „Micro-Tracking“ der Gefühle und Bedürfnisse von feeling seen macht es möglich, entsprechend dem „Holes-in-Roles“-Modell (Pesso 2004) die Übernahme fremder Rollen durch ein Kind zu erkennen und diese Rollenstruktur zu modifizieren. 4.27 Die Rolle des Körpers und der Gruppe Da zu Beginn von 6.2. auch Körper- und Gruppentherapie explizit genannt wurden, sollen diese hier zumindest kurz angesprochen werden. Beim Psychodrama und in der PBSP ist ohnehin die Gruppe mit vorgesehen; bei der Gestaltarbeit und der Transaktionsanalyse ist eine Erweiterung auf Gruppen leicht vorzunehmen und auch für die personzentrierte Psychotherapie sowie die Logotherapie und Existenzanalyse lässt sich – etwas modifiziert – auch mit Gruppen arbeiten. So war beispielsweise die Arbeit mit „Encounter-Gruppen“ von Rogers bzw. in dessen Ansatz in den 1960er-80er Jahre weit verbreitet. Ebenso kann gesagt werden, dass die zentrale Rolle von Emotionen, die in allen Richtungen der humanistischen Therapie zu finden ist, unmittelbar eine Einbeziehung des Körpers nicht nur nahelegt sondern geradezu erfordert. Zumal es ja vor allem auch um die noch nicht oder nicht mehr symbolisierten Gefühle und organismischen Erfahrungen geht – also um gerade nicht dem Bewusstsein zugängliche sondern im impliziten Gedächtnis, in Hormonen oder in Muskelverspannungen strukturell gespeicherte Lebenserfahrung. Ob diese Beziehung zum Körper dann „nur“ durch empathisches Einfühlen und Ansprechen begleitet wird, oder durch bestimmte fokussierende und emotionsaktivierende Vorgehensweise oder durch Anleitung zu körperlichen Übungen um direkt besimmte Lebensprozesse (etwa die Art der Atmung) zu erfahren, ist eine Frage der spezifischen Entfaltung des humanistisch-therapeutischen Potentials. Die Literatur zeigt hier ein überaus reiches Angebot an Möglichkeiten. 4.3. Was eine hilfreiche Beziehung ausmacht Der humanistische Ansatz war nicht nur der erste, welcher der Beziehung zwischen Klient und Therapeut einen zentralen Stellenwert einräumte und diese daher systematisch empirisch erforschte und die Befunde in die Theorien integrierte. Er ist auch heute noch – nachdem inzwischen auch die anderen Richtungen aufgrund umfassender Befunde aus der Psychotherapieforschung die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung betonen – der Ansatz, der die therapeutische Beziehung als essentiell für seine Wirksamkeit am weitesten differenziert und elaboriert hat. Und humanistische Therapeuten und Berater verstehen das gleich genauer dargestellte Beziehungsangebot nicht nur als Basis für ihre Arbeit, sondern als zentrale Wirkvariable selbst. Am deutlichsten ist die Beziehung im Rahmen des Personzentrierten Ansatzes ausformuliert: Rogers (1957) hat sechs Bedingungen des Therapeuten als „notwendig und hinreichend“ für konstruktive Persönlichkeitsveränderungen im Rahmen von Psychotherapie gekennzeichnet (Formulierung und Kommentar nach Eckert & Kriz 2012): 1. Zwei Menschen - ein Therapeut und ein Klient - befinden sich in einem psychologischen Kontakt. Sie beginnen, eine Beziehung zueinander aufzunehmen: Sie nehmen sich gegenseitig wahr, reagieren aufeinander, bedeuten einander etwas. Das, was wahrgenommen, worauf reagiert wird und was der eine dem anderen bedeutet, muss nicht voll bewusst sein bzw. klar erfassbar. Die Beziehung muss aber da sein.1 2. Der Klient befindet sich in einem Zustand von Inkongruenz. Er ist mit sich selbst uneins, verletzlich, ängstlich. Er erlebt, fühlt, erleidet usw. etwas, das er nicht erleben will bzw. das er als nicht zu sich selbst gehörend erlebt. 3. Der Therapeut hingegen ist kongruent: Er erlebt und fühlt im Kontakt mit den Klienten nichts, was er als nicht zu sich selbst gehörend ansehen kann oder seinem Bewusstsein fernhalten müsste. 4. Der Therapeut erlebt sich als dem Klienten unbedingt zugewandt; er kann ihn wertschätzend akzeptieren und seine Wertschätzung ist nicht an bestimmte Bedingungen gebunden, die der Klient erfüllt. Diese Bedingung wird heute auch bedingungsfreie Anerkennung genannt. 1 Diese Bedingung ist z.B. dann nicht gegeben, wenn der Klient akut psychotisch ist und im Therapeuten den Agenten einer fremden Macht sieht. 5. Es gelingt dem Therapeuten, sich in den Klienten und sein Erleben – sowie in die Art, wie der Klient sich und sein Erleben bewertet – einzufühlen. Und der Therapeut teilt dem Klienten mit, was er auf dem Wege der Empathie vom Erleben des Klienten verstanden hat. 6. Den Klienten erreicht zumindest in Ansätzen die Mitteilung des Therapeuten, dass er ihn versteht, und was er versteht, und es erreicht ihn die Mitteilung des Therapeuten, dass er ihn unbedingt wertschätzt. Heute wird diese Bedingung als Ansprechbarkeit des Klienten für das therapeutische Beziehungsangebot bezeichnet. In demselben Beitrag beschreibt Rogers drei Aspekte dieser Grundhaltung (Bedingungen 3, 4 und 5) ausführlicher, die dann von anderen häufig auf drei Basisvariablen des Therapeutenverhaltens reduziert wurden. Diese Bezeichnung kann aber insofern irreleiten, als es Rogers nicht darum ging, Verhaltens-Variablen (etwa im Sinne der Verhaltenstherapie) als eine Technik oder Behandlungsmethode einzuführen. Eine solche Sicht würde zu Recht Zweifel aufwerfen, ob die (so missverstandenen) „Bedingungen“ denn nun „wirklich“ notwendig und hilfreich sind, oder Therapeuten nicht vielmehr weitere Kenntnisse, Fertigkeiten und Vorgehensweisen berücksichtigen müssen. Wie aus Abb. 4.3 deutlich wird, hat Rogers aber die therapeutische Beziehung insgesamt wie auch das Beziehungsangebot das Therapeuten (die o. a. Bedingungen 3-5) auf einer hohen Abstraktionsebene beschrieben. Die therapeutische Beziehung ist zwar als eine Art menschlicher Beziehung (Ebene I) durch die übergreifenden Aspekte (Ebene II beschrieben). Jedoch ist das konkrete, situationsspezifische Handeln und Verhalten eines Therapeuten zwei Abstraktionsebene tiefer einzuordnen (Ebene IV) - womit deutlich wird, dass ein sehr großes Spektrum an Möglichkeiten besteht, das therapeutische Beziehungsangebot jeweils zu realisieren Ähnlich lässt sich in einer anderen Art menschlicher Beziehung, der Mutter-Kind-Beziehung, eines seiner übergreifenden Aspekte, Fürsorge, eben auf viele Weisen konkretisieren (vgl. Abb. 4.1). Aus Sicht der Verhaltentherapie würde man geneigt sein, am personzentrierten Ansatz diese Abstraktion unter dem Gesichtspunkt wünschenswerter Handlungsanweisungen als unklar zu kritisieren. Aus Sicht des humanistischen Ansatzes jedoch ist dies theoriekonform, da man hier ja gerade konkret-manualisierte Verhaltensvorschriften nicht formulieren will und kann. Vielmehr soll und muss die therapeutische Beziehung im jeweils konkreten Fall eines Klienten entsprechend dessen komplexen und spezifischen Lebens- und Leidensprozessen ebenso spezifisch ausgestaltet werden. Dazu gehört auch, dass das Beziehungsangebot des Therapeuten in seiner Konkretisierung mit dem „Beziehungsangebot“ des Klienten abgestimmt wird – d.h. insbesondere auch mit dessen „Symptomen“. Eine therapeutische Beziehung entsteht in ihrer spezifischen Form und Dynamik eben erst in der Interaktion von Therapeut und Klient. Abb. 4.3: Vier Abstraktionsebenen zur Beschreibung von Beziehung (nach Höger 2000, Eckert & Kriz 2012) Die Frage, ob die o.a. Bedingungen „wirklich“ notwendig und hinreichend sind, ist daher der Frage vergleichbar, ob „Auftrieb“ wirklich für ein Flugzeug notwendig und hinreichend ist. Auch ein „ja!“ sagt noch nichts über die genaue Konstruktion von Flügeln, von den verwendeten Materialen etc. aus. Und es wird auch nicht behauptet, dass diese Aspekte irrelevant wären oder eine Vermittlung bestimmter Kenntnisse und Fertigkeiten nutzlos wäre. Allerdings reicht es andersherum auch nicht aus, wenn man ein noch so „flugfähiges“ Material verbaut, oder wenn das „Flugzeug“ für einen Nichtfachmann fast genau so aussieht wie ein flugfähiges: Falls wegen scheinbar geringer Detailunterschiede eben kein oder wenig Auftrieb erzeugt werden kann, wird es nicht oder vielleicht nur schlecht fliegen. Berechnete „Effektstärken“ über das Flugverhalten würden dann auch wenig über die Effizienz „des Auftriebs“ aussagen können. Es gilt also zu bedenken, dass die folgende Beschreibung der drei zentralen Aspekte 3-5 des o. a. Beziehungsangebotes recht unterschiedlich umgesetzt werden wird. Zudem soll betont werden, dass es sich um drei Aspekte einer Begegnungshaltung handelt – wofür auch die empirischen Befunde sprechen: Immerhin ist der statistische Zusammenhang der drei Aspekte – als „Verhaltens““Variable“ aufgefasst – in empirischen Studien sehr hoch (Tausch 1973, S.121). 4.3.1 Bedingungsfreie positive Anerkennung Dieser komplexe Aspekt der Begegnungshaltung, die Rogers als „unconditional positive regard” bezeichnet hat, lässt sich mit deutschen Begriffen schwer ausdrücken. Man sprach lange von „positiver Wertschätzung und emotionale Wärme” und umschrieb diese durch weitere Begriffe wie „Akzeptanz“, „Achtung“ oder „Respekt“. Gerade in der heutigen Gesellschaft, mit dem antrainierten „Freundlichkeits-Verhalten” von Managern bzw. der Pseudo-Interessiertheit bei Türverkäufern, muss betont werden, dass keineswegs unechte, trainierte oder kontrollierte „Positivität” gemeint ist. Es geht vielmehr um die Fähigkeit und die Bereitschaft des Therapeuten, den Klienten als Mitmenschen zu erleben und sich auf eine existenzielle Begegnung mit ihm einzulassen, ohne ihn in Wert- und Nutzen-Kategorien aufgrund seiner Handlungen, Eigenschaften und Worte einzuordnen. Bedingungsfreie Anerkennung bedeutet nicht, dass alle Handlungen des Klienten gebilligt oder seine Einstellungen geteilt werden müssen. Vielmehr ist gemeint, jenseits dieser Oberflächenstrukturen eine tiefe Achtung vor menschlichem Leben und seiner Vielfalt empfinden zu können, wie sie sich im individuellen So-Sein des Klienten manifestiert. Es scheint mehr als zweifelhaft, dass solche Empfindungen „gelehrt“ bzw. „gelernt“ und „trainiert“ werden können (im üblichen Sinne dieser Worte). Sondern es bedarf förderlicher Bedingungen, unter denen sich eine solche Haltung entfalten kann und alle neurotischen Hindernisse, die dieser Haltung entgegenstehen, überwunden werden können. Die Wichtigkeit des Aspektes der bedingungsfreien Anerkennung hängt mit der oben dargestellten Inkongruenz zusammen, die durch chronisch unterbliebene oder nur bedingt erfolgte Anerkennung entsteht: In der frühkindlichen Entwicklung müssen die Prinzipien, der Welt zu begegnen und sich in ihr angemessen zu verhalten, überhaupt erst erworben werden. Wenn dabei Zuwendung und Verständnis nur unter ganz bestimmten Bedingungen erfolgt oder Affekte nicht bzw. falsch verstanden werden, können sich keine solche Prinzipien bilden, die alle Erfahrungen angemessen symbolisieren und kongruent im Selbst repräsentieren. Der Mensch versteht sich und sein Erleben dann teilweise selbst nicht. Bedingungsfreie Anerkennung soll somit einen Erfahrungsraum für den Klienten sichern, in dem dieser zu seinem eigenen Erleben und zu seinen eigenen Bewertungen in Kontakt kommen und sich mit ihnen auseinandersetzen kann. Zusätzlich wird ein Klient, der vom Therapeuten diese positive bedingungsfreie Wertschätzung erleben kann, zunehmend ähnliche Gefühle auch gegenüber seinem eignen Selbst und seinen Erfahrungen entwickeln und sich selbst gegenüber ebenfalls mehr Achtung und Akzeptanz entgegenbringen. 4.3.2 Kongruenz Auch für diesen zweiten Aspekt der Begegnungshaltung gibt es eine Reihe weiterer Begriffe wie „Echtheit“, „Selbstaufrichtigkeit“, „ohne-Fassade-sein“ oder „Selbstintegration“. Es geht daher auch hier nicht um eine antrainierbare Technik oder um ein über angelernte Selbstkontrolle reguliertes Ausdrucksverhalten. Vielmehr geht es darum, dass Therapeuten sich nicht hinter Fassaden, Floskeln oder Rollen verstecken und keine neurotisch-ängstlichen Abwehrhaltungen ihren eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen gegenüber haben. Sie sollten bereit und in der Lage sein, akzeptierend zu erleben, was in ihnen selbst im Kontext der therapeutischen Beziehung vorgeht und dies in die Situation einzubringen. Es geht hier also um „Ganzheit“ (im Sinne Humanistischer Psychologie) und Wahrhaftigkeit des Therapeuten in der Beziehung: Das, was er erfährt, ist in seinem Bewusstsein gegenwärtig und kommt authentisch in der Kommunikation zum Ausdruck. Auf der konkreten Verhaltensebene äußert sich Kongruenz zumindest dadurch, dass z.B. die Inhalte einer Äußerung mit Tonfall, Mimik, Gestik etc. übereinstimmen und von einem großen Reaktionsspektrum spontan Gebrauch gemacht werden kann. Die Kongruenz des Therapeuten ermöglicht Vertrauen auf Seiten des Klienten, da der Therapeut transparent wird und der Klient das auch nonverbal/analog erfahren kann, was er verbal/digital an Mitteilungen hört. Nur ein solches Vertrauen in den Therapeuten ermöglicht es, sich zu öffnen und sich seiner eigenen Person selbsterforschend zuzuwenden, statt voller Vorsicht das Gegenüber zu beobachten. 4.3.3 Empathie Ein weiterer Begriff für diesen Begegnungsaspekt ist „einfühlendes Verstehen“. Unter einer interventions-technischen Perspektive wird hierbei von einer „Therapeuten-Variable“ gesprochen, bei der es um die „Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte (VEE)“ geht. Gemeint ist aber ein umfassenderes Verständnis des Therapeuten für das, was der Klient von seinem eigenen Erleben wahrnimmt (einschließlich der damit verbundenen Bewertungen). Die Gesamtheit der Affekte, gedanklichen Repräsentationen und Bewertungen, die im Zusammenhang mit einer unmittelbaren Erfahrung von einem Klienten erlebt werden, wird als dessen innerer Bezugsrahmen bezeichnet. Dieser stellt auch den Rahmen für das Verstehen des Therapeuten dar – ohne dass dieser das Erleben des Klienten mit seinem eigenen verwechselt oder gleichsetzt (sonst wäre es eine unerwünschte Identifizierung). Auch dieser Aspekt wird oft missverstanden. So weisen z.B. Davison & Neale (1998), von einer verhaltenstherapeutischen Sicht ausgehend auf das vermeintlich „wissenschaftslogische Problem“ hin, „wie ein Therapeut auf interne Prozesse schließen soll, die dem Klienten anscheinend nicht bewusst sind“. „Empathie“ meint aber nicht statisch-diagnostischen Durchblick, sondern einen dynamischen Prozess auf der Grundlage eines Beziehungsangebotes, bei dem sowohl dem Klienten als auch dem Therapeuten anfangs sehr viele „interne Prozesse“ des Klienten unbekannt sind. Es geht aus Sich des humanistischen Ansatzes also nicht um die therapeutische Kompetenz „richtige Schlüsse über innere Zustände des Klienten” zu treffen. Sondern es geht um die therapeutische Kompetenz, den Prozess der Selbstexploration so zu fördern, dass diese inneren Zustände mehr und mehr erforscht werden können. Das Bemühen um einfühlendes Verstehen, das sich immer mehr entfaltet und vertieft, das Angebot der gemeinsamen Arbeit und die Erfahrung des (teilweisen) Verstandenwerdens geben dem Klienten den Mut, seine „internen Prozesse“ nach und nach in einem langen Prozess unter Begleitung des Therapeuten selbst zu erforschen. Da „einfühlendes Verstehen“ zumindest in vordergründigen Aspekten, noch am ehesten als „Verhaltens-Variable“ beobachtbar ist, wurde VEE am häufigsten Gegenstand empirischer Untersuchungen. Entsprechend zahlreich sind auch die Skalen, mit denen dieses Verhalten kategoriell erfasst und numerisch abgebildet wurde. Es sei abschließend bemerkt, dass sogar schon in älterer Literatur zum personzentrierten Ansatz eine Reihe „nicht klassischer Therapeutenvariablen“ als weitere wichtige Aspekte einer hilfreichen Beziehung diskutiert werden (Übersicht in: Rieger & Schmidt-Hieber 1979). Die Fülle an Aspekten der therapeutischen Beziehung selbst innerhalb eines einzigen Ansatzes der humanistischen Therapie ist nicht zuletzt ein Indiz dafür, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, Rogers komplex-abstrakte Konstrukte auf der konkreten Ebene zu entfalten. Man kann sogar sagen, dass eigentlich alle in 4.2 vorgestellten Konzepte der vielfältigen Vorgehensweisen als konkrete Umsetzungen dieser Aspekte einer hilfreichen Beziehung vor dem Hintergrund der Aktualisierungstendenz verstanden werden können. Stets geht es um Bedürfnisse des menschlichen Organismus die aber kompromissbildend an die materielle und vor allem soziale Umwelt adaptiert werden müssen. Im Selbst symbolisiert – und damit bewußtseinsfähig – ist aber nur jenes Erleben, das von den Bezugspersonen verstanden und als sinnvoll zurückgemeldet wurde. Dabei geht es besonders um die emotionale Bewertung dieser Bedürfnisse und die damit zusammenhängenden Erlebnisse. Sind Bereiche durch Ignorieren ausgeblendet oder durch Unverständnis verzerrt, so versteht der Mensch sein Handeln, das ja jenen Strukturen folgt, oft selbst nicht. Diese früh missratene Entwicklung muss – soweit möglich (vgl. Kap. 8.2) nachgeholt werden, indem ein nun empathisches Gegenüber diese Bedürfnisse, Emotionen und Bewertungen erkennt und symbolisierend anspricht ohne daran Bedingungen zu knüpfen oder diese seinerseits zu bewerten. Ob dies in der konkreten Arbeit dann in einer reinen Therapeut-Klient-Beziehung oder unter Einbeziehung einer Gruppe, ob dies „einfach“ über empathisches Verstehen oder mit Hilfe psychodramatischer, emotionsfokussierender oder erlebensaktivierender (= Körpertherapien) Vorgehensweisen geschieht, ist eine therapeut-, klient- und vor allem situationsspezifische Ausgestaltung. 4.4. Folgerungen für den Umgang mit Lern- und Entwicklungsauffälligkeiten In Abschnitt 4.2. wurde die Aktualisierungstendenz als das zentrale theoretische Konzept humanistischer Ansätze herausgestellt. Diese bedeutet ja eine immer wieder notwendige Adaptation an die sich ständig ändernden Bedingungen der materiellen, biologischen und sozialen Umwelt – im Sinne von „Entwicklungsaufgaben“. Nicht nur stellen die Mitmenschen an einen 20-Jährigen andere Anfor- derungen als an einen 6-Jährigen (= soziale Umwelt), sondern für die kognitiven und Prozesse ist beispielsweise auch die Pubertät des Organismus eine „Umgebung“ (= biologische Umwelt), welche Entwicklungsaufgaben konstelliert. („Umwelt“ ist also nicht nur physikalisch-räumlich zu verstehen, sondern als Bedingungen für jeweils betrachteten Prozesse – wie in Kap. 8 noch näher ausgeführt werden wird). Üblicherweise funktioniert diese ständig neue Adaptation mehr oder minder gut. Und es sollte nicht übersehen werden, dass auch bei Menschen, die wir als „gestört“ bezeichnen, die meisten Bereiche des Lebens gut adaptiert sind. Unter ungünstigen Umgebungsbedingungen für den Entwicklungsverlauf werden Strukturen in einzelnen Bereichen der Lebensprozesse – Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Handeln, sich selbst verstehen etc. – aktualisiert, die zwar Adaptationen an diese Bedingungen sind, die aber dann für neue Herausforderungen in der Entwicklung nicht mehr passen. Je mühevoller und schmerzhafter aber überhaupt Lösungen unter sehr belastenden Bedingungen gefunden werden, um so plausibler ist es, dass diese beibehalten werden. Das oben zitierte „stirb und werde“ erscheint dann aus bisherigen Erfahrungen zu bedrohlich und Angst machend. Und wie in den Abschnitten zuvor ausgeführt wurde, sind Erfahrungen des Organismus, die nie oder nur inadäquat von anderen verstanden wurden, ggf. nicht Teil in den Strukturen des Selbst, damit nicht bewußtseinsfähig und der Mensch wundert sich dann nur über (Teile bzw. Aspekte) seines eigenen Fühlens, Denkens und Handelns. Man kann diese Prozesse – unter etwas veränderter Perspektive – auch als Lernprozesse im Sinne der Verhaltenstherapie beschreiben. D.h. in dieser Hinsicht wäre leicht ein Konsens zu erzielen. Während aber die Verhaltenstherapie als Lösung nahelegt, die Bedingungen dieser Lernprozesse zu eruieren und zu ändern (sofern möglich), oder zumindest neue Verhaltensweisen (auch kognitive) zu lernen, sich bestimmte Fertigkeiten (auch kognitive) anzueignen und zu üben etc. (vgl. Kap. 5), geht der humanistische Ansatz einen anderen Weg. Er setzt eher auf die je einmalige Individualität des Klienten und misstraut daher allgemeinen Kategorien und Programmen – so wichtig solche Klassenbildungen und Generalisierungen auch für die Forschung sein mögen. Stattdessen schafft er quasi neue Entwicklungsbedingungen – wohl wissend, dass natürlich die Entwicklung in der frühen Kindheit nicht einfach nachgeholt werden kann. Aber die förderlichen Bedingungen für eine gesunde Entwicklung unter normalen Bedingungen werden auch als solche für die Entwicklungsschritte im Rahmen einer Therapie gesehen. Der humanistische Ansatz verwendet also weniger Programme sondern versucht die Umgebungsbedingungen für förderliche Entwicklungen zu konstellieren. Das Charakteristische dieses Ansatzes für unseren Kontext lässt sich an folgender Begebenheit schon aus den Anfängen humanistische Therapie verdeutlichen (nach Stemberger 2002): Um 1906 forschte Max Wertheimer, späterer Begründer der Berliner Gestaltpsychologie-Schule, an der Wiener Neuro-Psychiatrischen Klinik. Deren Direktor, Wagner-Jauregg, beauftragte ihn damit, herauszufinden, ob bestimmte Klienten, es handelte sich um z.T. taubstumme Kinder schwachsinnig waren. Wertheimer überprüfte das nicht mit den damals üblichen Tests, sondern indem er den Kindern bestimmte Aufgaben stellte und ihnen für die Lösung dieser Aufgaben möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen suchte (Luchins u. Luchins, 1982). Die Fähigkeiten eines Menschen auf einem bestimmten Gebiet wurden hier also in einer sehr untypischen Weise getestet: untersucht wurden jene Bedingungen, unter denen sich diese Fähigkeiten entfalten bzw. nicht entfalten können. Der Mensch wird somit nicht als Ansammlung fester, unveränderlicher Teileigenschaften oder psychischer Funktionseinheiten verstanden, die in immer gleicher, festgelegter Weise auf einen äußeren Reiz bzw. auf eine bestimmte Anforderung reagieren. Vielmehr kommt in Wertheimers Vorgehen bereits die für humanistische Ansätze grundlegende Überzeugung zum Ausdruck, dass dem Menschen die Fähigkeit zu geordnetem, der Situation angemessenem Erleben und Verhalten innewohnt, wie gestört und verschüttet diese Fähigkeit in bestimmten Situationen und Konstellationen auch sein mag. Und dass es folglich darauf ankommt, sich mit den Bedingungen zu befassen, die zu schaffen wären, um diese Fähigkeit freizulegen. In allen humanistischen Richtungen geht es also darum, Situationen zu konstellieren, in denen der Mensch sich (innerlichen und äußeren) Erfahrungsbereichen zuwendet, die er bisher nicht gemacht, nicht symbolisiert, nicht verstanden und damit dann eher vermieden hat. Aus der Inkongruenz zwischen organismischen Erfahrungen (wozu auch die Bedürfnisse gehören) und dem Selbst resultieren zudem oft Denk-, Fühl- und Verhaltensweisen, die aus dem Normbereich heraus „verrückt“ sind. Auch diese Erfahrungsbereiche gilt es, genau und achtsam wahrzunehmen und die Bewertungen dazu in Form von Fühlen und Denken zu erkunden. Wie aber schon mehrfach beton wurde, sind selbst die „verrücktesten“ Gefühle, Gedanken, Verhaltensweisen – kurz: Strukturen der (Er-)lebensprozesse – Aktualisierungen. Damit ist, nochmals gesagt, gemeint, dass es sich um Adaptationen an die biographischen (einschließlich: genetisch-dispositioneller und pränataler) Bedingungsgefüge handelt. Und Veränderung bedeutet ein „stirb und werde!“ von einigen dieser Strukturen. Dies wiederum ist, wie oben gesagt wurde, überaus Angst machend. Denn so leidvoll diese Strukturen auch sind: sie sind zumindest irgendwie „vertraut“ und haben immerhin als „Lösungen“ unter oft schwersten Beeinträchtigungen das physische und/oder psychische Überleben sichergestellt. Dies gegen eine ungewisse Zukunft aufzugeben erfordert sehr viel Mut und Vertrauen in die Begleitenden bei diesem Prozess (Therapeuten, Berater..). Und eben deshalb ist die therapeutische Beziehung, die Sicherheit und Vertrauen gibt, bei einem solchen Ansatz, wie dem humanistischen, nicht eine irgendwie „nette Basis“, sondern eine essentielle Bedingung.