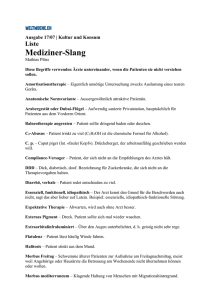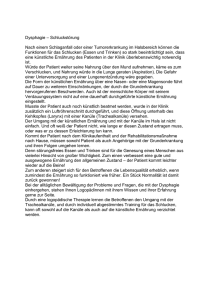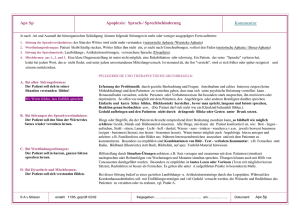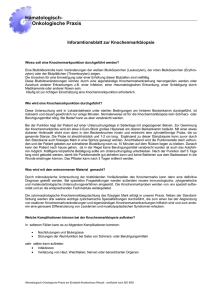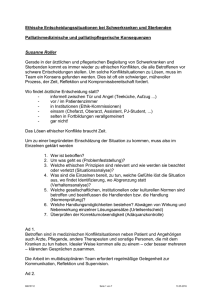Den Patienten zum Kapitän seines Lebens machen
Werbung

6. Fallkonferenz Integrative Medizin Dialogforum Pluralismus in der Medizin Palliativmedizin am 1. September 2012 in Rostock Bericht von Annette Bopp „Der Patient ist der Kapitän über sein Leben“ Zum sechsten Mal veranstaltete das von dem verstorbenen Präsidenten der Bundesärztekammer, Dr. Jörg Hoppe, 2000 mit gegründete „Dialogforum Pluralismus in der Medizin“ eine Fallkonferenz, dieses Mal zum Thema Palliativmedizin und erstmalig in der Universität Rostock. Thematisch schließt die Fallkonferenz an die Veranstaltung der Bundesärztekammer im Sommer 2012 zur Versorgungsforschung und Palliativmedizin an. Charakteristisch für diese Fallkonferenzen ist, dass ein bis zwei Kasuistiken vorgestellt werden, die dann von Vertretern verschiedener Therapierichtungen analysiert und besprochen werden. An diesen Fallkonferenzen wird möglichst auch der Patient selbst, um den es geht, beteiligt. Denn, so Dr. Matthias Girke, Leitender Arzt der Inneren Medizin am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Berlin: „Wir Ärzte schauen aus einer übergeordneten Informationskompetenz auf einen ‚Fall’ und können ganz gut abschätzen, wie etwas einzuordnen ist. In der Erlebniskompetenz jedoch, in dem, was Krankheit für einen Menschen bedeutet, ist selbstverständlich der Patient der Fachmann. Wir können heute keinen paternalistischen Arzt-Patienten-Stil mehr praktizieren, sondern wir brauchen einen partnerschaftlichen, partizipatorischen Stil innerhalb dieser Patienten-Arzt-Beziehung.“ 1 Gerade in der Palliativmedizin komme es auf das Menschenbild an, das dem ärztlichen Handeln zugrunde liege. Fragen wie „Was ist der Mensch?“, „Was ist Sterben?“, „Was ist Tod?“ seien sonst nicht zu beantworten, sagte Girke. Der Gedanke, dass sich der Mensch bis zum letzten Atemzug weiterentwickele, mache nur Sinn, wenn man nicht davon ausgehe, dass mit dem Tod alles zu Ende sei. Deshalb dürfe man den Patienten nicht nur eindimensional somatisch betrachten, sondern müsse vielmehr insgesamt vier Aspekte berücksichtigen: 1. Bestmögliche Symptomkontrolle, z. B. von Schmerzen oder körperlichen Beschwerden. 2. Mobilisieren der noch vorhandenen Ressourcen. Viele Patienten, so Girke, können eine tiefe Befriedigung darüber empfinden, wenn sie noch einmal Kräfte entwickeln, die sie schon verloren geglaubt hatten. 3. Die seelische Ebene mit der Angst vor Siechtum und Sterben, mit dem Sich-Aufbäumen im Kampf gegen die Krankheit und der Angst vor der Niederlage. Vor allem aber auch mit der Frage nach dem Sinn des Lebens, wenn der Tod ohnehin so nah erscheint. Bei vielen Menschen entstehe nur deshalb der Wunsch nach Sterbehilfe, weil sie im Leben keinen Sinn mehr erkennen können, sagte Girke. 4. Die Spiritualität und die Frage: Ist mit dem Tod alles zu Ende? Was kommt danach? Es gebe Situationen, wo sich Menschen in der Sterbephase geistig-seelisch noch einmal enorm weiterentwickeln, wo der Mensch durch seine Krankheit ein Stück wahrhaftiger, authentischer wird, wo nur noch Existenzielles zählt und nichts Äußerliches mehr, keine Titel, kein Status, keine gesellschaftliche Rolle. Alle vier Ebenen seien maßgeblich für die Gestaltung der Arzt-PatientenBeziehung. Gerade in der Palliativmedizin gehe es darum, dass man immer etwas für den Patienten tun könne – auf welcher dieser vier Ebenen auch 2 immer. Der Satz „Wir können nichts mehr für Sie tun“ dürfe einem Arzt nicht über die Lippen kommen. Gerade beim sterbenden Menschen müsse die Leitlinien-Medizin individualisiert werden, das Allgemeingültige müsse, wie Prof. Dr. Peter Matthiessen es einmal ausgedrückt hat, „der individuellen Patientensituation anverwandelt“ werden. Manchmal sei es nötig, etwas sehr Ungewöhnliches, für diesen einzelnen Patienten aber gerade Richtiges zu tun, auch wenn die Leitlinie etwas anderes vorschreibe. Vor diesem Hintergrund wurden die beiden Kasuistiken aus dem Interdisziplinären Bereich Palliativmedizin an der Universitätsmedizin Rostock besprochen. Kasuistik 1 Männlicher Patient, geb. 1967, seit 1997 trockener Alkoholiker. Im Dezember 2008 wird ein Ösophaguskarzinom diagnostiziert. Es folgen Radiochemotherapie (Februar/März 2009) und transhiatale Ösophagusresektion (Mai 2009). Im Oktober 2011 wird ein lokales Rezidiv diagnostiziert, im Februar 2012 erfolgt eine Stentimplantation in die Speiseröhre und im März/April eine erneute Radiochemotherapie. Im Juni verrutscht der Stent und muss durch einen zweiten ersetzt werden, aufgrund einer tumorbedingten Fistel zwischen Luft- und Speiseröhre wird der Patient tracheotomiert (ebenfalls im Juni) und beatmet. Hinzu kommen weitere Komplikationen in Form einer Pneumonie, anfallsartig auftretender Luftnot mit Erstickungsattacken, Infektion des Ports mit Bakterien und Pilzen, fehlende Krankheitsverarbeitung und eine chronische häusliche Überlastungssituation. Deshalb Verlegung auf die Palliativstation Anfang Juli 2012, wo der Patient am 13. August 2012 verstirbt. „Es gab viele Aspekte, wo wir dachten, wir können dem Patienten helfen – allerdings nicht im Sinne dessen, dass wir Infusionen anhängen oder den 3 Sauerstoff hochdrehen“, sagte Prof. Dr. Christian Junghanß, Leiter des Interdisziplinären Bereichs Palliativmedizin an der Universitätsmedizin in Rostock. So hatte der Patient zum Beispiel nur noch ein Ziel: die Einschulung der Tochter Anfang August 2012 zu erleben. Das ist gelungen – war allerdings wegen der möglichen Erstickungsanfälle auch ein kleines Abenteuer, wie Junghanß berichtete: „Wir haben mit der Familie, der Ehefrau und dem Patienten selbst einen Notfallplan besprochen, wir haben den Notarztdienst und die Rettungsleitstelle informiert und einen Arztbrief gefaxt. Wichtig war auch, dass Schulleitung und Lehrerkollegium informiert waren. Es ist alles gut gegangen, und am Abend kam der Patient wieder zu uns auf die Station zurück.“ Da dem Patienten keine Sprechkanüle eingesetzt werden konnte, erfolgte die Kommunikation schriftlich bzw. nonverbal, was besonders viel Aufmerksamkeit und Zeit beansprucht habe, ergänzte Maria Steuck für die Pflege. Der Patient wurde über PEJ ernährt (transdermaler Zugang). Die Mundpflege mit Zusatz von Kamille, Salbei/Thymian oder Bepanthenlösung war selbstständig am Waschbecken möglich. Der Patient bekam atemstimulierende Einreibungen und benutzte eigene Bettwäsche und Kosmetika. Das Tracheostoma wurde mehrmals täglich abgesaugt, Reinigung und Wechsel der Trachealkanüle waren nur durch ärztliches Personal möglich, weil große Tumormassen den Zugang zur Trachea verlegten und auch die Kanüle selbst sich immer wieder durch Schleim und Tumorgewebe zusetzte. Luftnot und Erstickungsanfälle brachten einen großen Betreuungsaufwand mit sich. Aufgrund der komplizierten Familienverhältnisse (Patchwork-Familie mit insgesamt fünf Kindern mit schwieriger Konstellation zwischen den verschiedenen Partnern) bestand ein großer Gesprächsbedarf. Auch die Kinder wurden psychologisch betreut. 4 Die Stationsärztin der Palliativstation, Dr. U. Szibor-Kriesen, betonte, dass es in der Palliativsituation immer wichtig sei, die Therapie- und vor allem auch die Lebensziele zu formulieren, einen offenen und ehrlichen Umgang miteinander zu pflegen und genau zu besprechen, was den Patienten auf der Station erwartet. Ihr Credo: „Der Patient ist der Kapitän über sein Leben – wir können helfen, aber entscheiden muss er selbst.“ Empfehlungen aus Naturheilkunde und Anthroposophischer Medizin Vielleicht hätte man schon im Vorfeld der Palliativsituation, als das Rezidiv festgestellt wurde, Entspannungsverfahren einsetzen können, um die Angst vor dem Ersticken und vor der Krankheit abzumildern, meinte Prof. Dr. Karin Kraft vom Lehrstuhl für Naturheilkunde an der Universitätsmedizin Rostock. Eine kognitive Verhaltenstherapie könne bestehende Denk- und Urteilsprozesse verändern und so zu einer besseren Krankheitsverarbeitung führen. Auch könne sie dazu beitragen, Angst und Depression zu überwinden, unterstützt durch autogenes Training und progressive Muskelentspannung, was auch die Schmerzkontrolle erleichtere. Angstattacken könnten mit Biofeedback besser bewältigt werden. Dazu gebe es eine positive Evidenz. Die Aromatherapie mit ätherischen Ölen aus Pfefferminze, Lavendel, Rosmarin u.a. über Einreibungen oder Dampfinhalator werde auf Palliativstationen oft noch zu wenig berücksichtigt, könne aber sehr wirksam sein, z. B. um Angst zu lindern oder das Atmen zu erleichtern. Beruhigend wirke auch das „Opium der Naturheilkunde“, der Heublumensack. Für die Anthroposophische Medizin wies Dr. Girke auf die Möglichkeiten der Symptomkontrolle mit Anthroposophischen Arzneimitteln hin: Eine Misteltherapie habe sich bei nahezu jeder Krebserkrankung bewährt, vor allem hinsichtlich Lebensqualität und Fatigue. Bei Appetitlosigkeit seien 5 Bitterstoffe wie Gentiana 5% eine gute Option, Bryophyllum wirke entängstigend und beruhigend, Johanniskraut als Hypericum Auro cultum zusätzlich stimmungsaufhellend. Bei Übelkeit und Lebermetastasen helfe ein Schafgarben-Leberwickel, bei Oberbauchbeschwerden ein OxalisWickel, bei aufgeblähtem Bauch ein Kümmel-Öllappen oder eine Einreibung mit Kümmelöl, bei Ödemen eine Auflage mit Borago-Essenz. Erfrischend am Morgen wirke das Waschen mit Rosmarin- oder ZitronenBadezusatz, beruhigend und schlaffördernd am Abend eine Fuß-Einreibung mit Lavendelöl oder ein Herz-Salben-Lappen mit einer Gold-LavendelRosen-Salbe. Eine atmende Belebung des Organismus können Rhythmische Massagen nach Wegman/Hauschka bewirken, die viele Patienten als besonders wohltuend empfinden. Die Eurythmietherapie könne auch bei Bettlägerigen erfolgen und wirke ausgleichend und harmonisierend auf Körper, Seele und Geist. Kunsttherapien wie das therapeutische Malen oder eine Musiktherapie können gerade in der Palliativmedizin eine innere Entwicklung des Patienten fördern. Mit Hilfe der Psychoonkologie und Biographiearbeit könne sich der Kranke schwierigen Fragen rund um das eigene Leben stellen, auch Sterben und Tod. Dazu gehöre, dass alle palliativmedizinisch Tätigen sich mit diesen Fragen selbst auseinandersetzen, sonst könne man mit den Patienten nicht ins Gespräch kommen – sie spüren sofort, ob man sich um diese Themen schon bemüht habe oder nicht. Auch dürfe man nie den Patienten von seiner eigenen Meinung überzeugen, sondern müsse bereit sein, mit ihm etwas Gemeinsames zu entwickeln, um diesen Weg bis zum Tod zusammen gehen zu können. Kasuistik 2 Männlicher Patient, geb. 1951. Seit 1978 Multiple Sklerose mit beinbetonten Lähmungserscheinungen. Im September 2011 Diagnose 6 eines Glioblastoms, gefolgt von Operation und Strahlentherapie. Rezidiv im Juni 2012, erneute Operation und Bestrahlung. Aufnahme auf die Palliativstation im Juli 2012. Der Patient klagt über Sehstörungen, Ungeschicklichkeit und abnehmendes Körpergefühl, ausgeprägte Müdigkeit, verweigert aber die Chemotherapie und wünscht sich stattdessen eine homöopathische Behandlung, die privat über einen befreundeten Arzt erfolgt, sowie Musiktherapie und eine gute Ernährung. Sich wohlfühlen zu können, steht für ihn im Vordergrund. Von Anfang an sei dieser Patient im Umgang mit seiner Krankheit „Kapitän“ gewesen, sagte Dr. Szibor-Kriesen. Im Verlauf der stationären Betreuung öffnet er sich für die Idee einer oralen Chemotherapie und stimmt ihr schließlich auch zu. Aufgrund seines Berufs als Banker stand der Patient früher viel in der Öffentlichkeit, er ist sehr belesen und interessiert daran, seine noch vorhandenen Fähigkeiten zu stärken. Auf seine Wünsche und Gewohnheiten wurde Rücksicht genommen, er bekommt Wunschkost und darf so lange schlafen, wie er wollte. Unterstützt wird er nur soweit, wie er es selbst zulässt und einfordert. Täglich wird er mobilisiert und in den Rollstuhl gesetzt. So fühlt er sich beweglich und nicht ans Bett gefesselt. Für Ärzte und Pflege ist unklar, ob der Patient um seine begrenzte Lebensperspektive wusste oder nicht. Eine häusliche Pflege ist ausgeschlossen, weil die Ehefrau selbst schwer krank ist. Dem Patienten fällt es schwer, Vertrauen aufzubauen. Durch die zugewandte Pflege auf der Palliativstation fühlt er sich mit der Zeit jedoch immer sicherer und würde am liebsten auf Dauer dableiben. Ende August 2012 wird er in die Kurzzeitpflege entlassen, für Ende September ist die Wiederaufnahme geplant, um die palliative Chemotherapie fortzusetzen. In einem Video-Interview äußert sich der Patient selbst zu seiner Situation: „Die Betreuung hier empfinde ich als sehr gut und sehr familiär, fast fühle 7 ich mich wie in einer Kur. Es gehört schon eine gehörige Portion Hybris dazu, wenn man sich für stärker hält als der Körper leisten kann. Es geht mir körperlich nicht so gut, wie es mir gehen sollte. Aber im Kopf und im Herzen geht es mir gut. Egal, wie es einem geht, man darf niemanden, schon gar nicht die Familie, darunter leiden lassen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil es einem selbst nichts bringt. Nur negatives Feedback, und das ist für die eigene Krankheit ganz schlecht. Ich zeige nur die schönen Dinge, die Freude. Ich lebe nach dem Wahlspruch von Immanuel Kant: ‚Ich kann, weil ich will, was ich muss.’“ Empfehlungen aus Naturheilkunde und Chinesischer Medizin Ergänzend zur Chemotherapie könne man ein Enzympräparat aus Papain, Trypsin und Chymotrypsin geben, empfahl Prof. Kraft. Es sei nachgewiesen, dass Enzyme fibrinolytisch wirken und die Oberflächenantigene von Tumorzellen demaskieren können. Damit lasse sich die Wirkung der Chemotherapie verstärken, weil der Tumor besser angreifbar werde. Zusätzlich sei die Gabe von Selen mit maximal 200 Mikrogramm täglich sinnvoll, um die Immunabwehr zu unterstützen. Vitamin D wirke antientzündlich und hemme die Angiogenese, fördere die Apoptose und wirke antiproliferativ. Bei Hirntumoren komme als besondere Therapieoption noch die Gabe von Weihrauch hinzu, in einer Dosierung von 4200 mg pro Tag. Das Medikament ist in Deutschland allerdings nicht erhältlich, sondern muss aus der Schweiz importiert werden. Bei der Ernährung habe man bei Hirntumoren gute Erfahrungen mit einer vegetarisch betonten Kost gemacht, erklärte Prof. Kraft. Flavonoide seien als Angiogenese-Hemmer bekannt, speziell beim Glioblastom. Rote, gelbe und grüne Gemüse aktivieren das Immunsystem und können ebenso wie die Schale von Zitrusfrüchten das Gliomwachstum hemmen, Kurkuma 8 verbessere die Wirkung der Chemotherapie. Auch japanischer grüner Tee sowie Ingwer, Soja, Zwiebel- und Kohlgewächse seien sinnvolle Nahrungsbestandteile. „Eine richtige Ernährung wirkt dreimal täglich, hat viele Synergieeffekte und keine Nebenwirkungen, sie birgt ein hohes Genusspotential, ist einfach und preiswert umzusetzen“, betonte Prof. Kraft. Dr. Hans Lampe von der Universitätsmedizin Rostock erläuterte die Möglichkeiten der Chinesischen Medizin, die vor allem die verschiedenen Organfunktionskreise im Fokus hat. In der pharmakologischen Therapie werden vor allem Dekokte eingesetzt, ausgekochte Kräuter, Wurzeln und andere Naturstoffe. Hinzu kommen Diätetik, Bewegungstherapien wie Qigong und Taiji, die TuiNa-Massage sowie die Akupunktur, die in der Onkologie allerdings weniger bedeutsam sei. Bei dem Patienten bestehe vermutlich eine Störung des Nierenfunktionskreises, begleitet von einem Mangel und Disharmonie im Milzfunktionskreis sowie deutlich überschießendem Yang im Herzfunktionskreis. Es gebe jedoch keine Erfahrungen zum Einsatz von Chinesischer Medizin beim Glioblastom. Auch wenn der Patient selbst nicht viel über seine durch das Glioblastom doch stark verkürzte Lebensperspektive gesprochen habe, so sei doch anzunehmen, dass er über seinen Zustand Bescheid wusste, meinte Dr. Girke. Ein Mensch, der schon so lange Zeit mit Multipler Sklerose lebt, der so weltoffen ist und sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt, der einen solchen Wahlspruch von Kant für sich gewählt hat, sei in vielem gereift und habe eine hohe Eigenkompetenz. Das zeige auch sein Wunsch nach einer homöopathischen Therapie. Der Patient könne gut auf sich hören, bestätigt Dr. Szibor-Kriesen, er wisse, was ihm gut tut und könne gut spüren, was er braucht. Vermutlich würde er auch einiges von dem, was hier zusätzlich empfohlen wurde, annehmen. 9 In der abschließenden Diskussion wurde noch einmal die vielschichtige Problematik in der Betreuung von Palliativpatienten deutlich. Die meisten möchten zum Sterben nach Hause, aber oft ist das häusliche Umfeld mit der Pflege überfordert. Auch findet sich nicht immer ein Arzt, der den Patienten in dieser Phase kontinuierlich begleitet. Andererseits lassen sich viele Patienten oft wieder so gut stabilisieren, dass sie nicht monatelang stationär bleiben können. Bei Gliompatienten kommen meist Wesensveränderungen hinzu, die eine Palliativstation vor besondere Herausforderungen stellen. „Wir müssen frühzeitig mit dem Patienten sprechen, welche Wünsche er hat, was ihm wichtig ist“, fasst Prof. Junghanß die bisherigen Erfahrungen zusammen. „Die meisten kommen erst sehr spät zu uns, wir streben deshalb an, schon bei Diagnosestellung eine Zusammenarbeit zwischen onkologischer oder neurologischer Station und der Palliativmedizin zu fördern und im Arztbrief den Aufklärungsstatus zu dokumentieren.“ 10