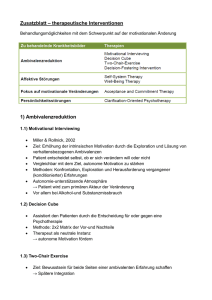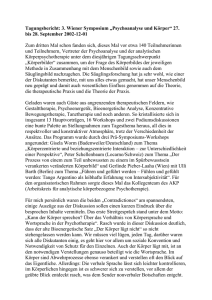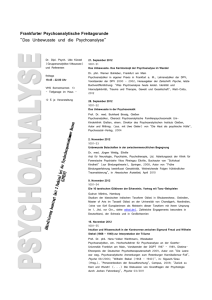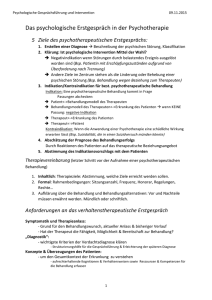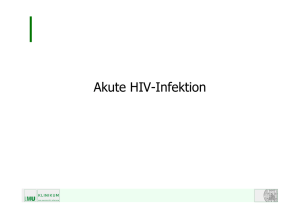Ulrich Streeck: Auf den ersten Blick
Werbung
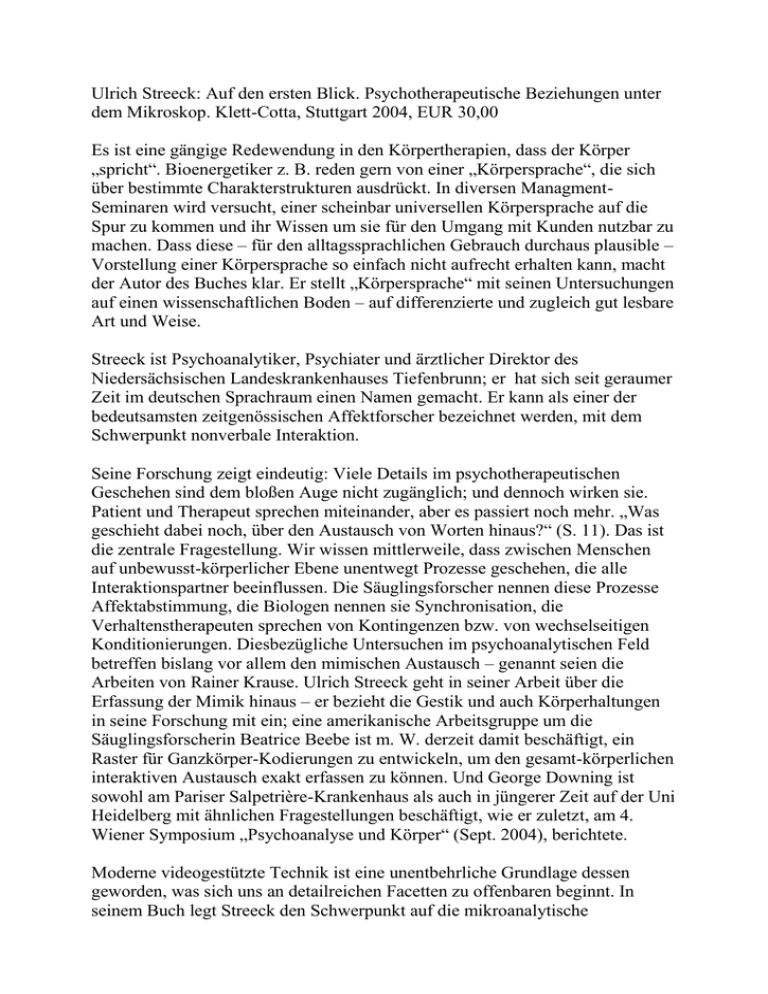
Ulrich Streeck: Auf den ersten Blick. Psychotherapeutische Beziehungen unter dem Mikroskop. Klett-Cotta, Stuttgart 2004, EUR 30,00 Es ist eine gängige Redewendung in den Körpertherapien, dass der Körper „spricht“. Bioenergetiker z. B. reden gern von einer „Körpersprache“, die sich über bestimmte Charakterstrukturen ausdrückt. In diversen ManagmentSeminaren wird versucht, einer scheinbar universellen Körpersprache auf die Spur zu kommen und ihr Wissen um sie für den Umgang mit Kunden nutzbar zu machen. Dass diese – für den alltagssprachlichen Gebrauch durchaus plausible – Vorstellung einer Körpersprache so einfach nicht aufrecht erhalten kann, macht der Autor des Buches klar. Er stellt „Körpersprache“ mit seinen Untersuchungen auf einen wissenschaftlichen Boden – auf differenzierte und zugleich gut lesbare Art und Weise. Streeck ist Psychoanalytiker, Psychiater und ärztlicher Direktor des Niedersächsischen Landeskrankenhauses Tiefenbrunn; er hat sich seit geraumer Zeit im deutschen Sprachraum einen Namen gemacht. Er kann als einer der bedeutsamsten zeitgenössischen Affektforscher bezeichnet werden, mit dem Schwerpunkt nonverbale Interaktion. Seine Forschung zeigt eindeutig: Viele Details im psychotherapeutischen Geschehen sind dem bloßen Auge nicht zugänglich; und dennoch wirken sie. Patient und Therapeut sprechen miteinander, aber es passiert noch mehr. „Was geschieht dabei noch, über den Austausch von Worten hinaus?“ (S. 11). Das ist die zentrale Fragestellung. Wir wissen mittlerweile, dass zwischen Menschen auf unbewusst-körperlicher Ebene unentwegt Prozesse geschehen, die alle Interaktionspartner beeinflussen. Die Säuglingsforscher nennen diese Prozesse Affektabstimmung, die Biologen nennen sie Synchronisation, die Verhaltenstherapeuten sprechen von Kontingenzen bzw. von wechselseitigen Konditionierungen. Diesbezügliche Untersuchen im psychoanalytischen Feld betreffen bislang vor allem den mimischen Austausch – genannt seien die Arbeiten von Rainer Krause. Ulrich Streeck geht in seiner Arbeit über die Erfassung der Mimik hinaus – er bezieht die Gestik und auch Körperhaltungen in seine Forschung mit ein; eine amerikanische Arbeitsgruppe um die Säuglingsforscherin Beatrice Beebe ist m. W. derzeit damit beschäftigt, ein Raster für Ganzkörper-Kodierungen zu entwickeln, um den gesamt-körperlichen interaktiven Austausch exakt erfassen zu können. Und George Downing ist sowohl am Pariser Salpetrière-Krankenhaus als auch in jüngerer Zeit auf der Uni Heidelberg mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigt, wie er zuletzt, am 4. Wiener Symposium „Psychoanalyse und Körper“ (Sept. 2004), berichtete. Moderne videogestützte Technik ist eine unentbehrliche Grundlage dessen geworden, was sich uns an detailreichen Facetten zu offenbaren beginnt. In seinem Buch legt Streeck den Schwerpunkt auf die mikroanalytische Untersuchung der therapeutischen Interaktion und nicht so sehr auf therapeutische Fragestellungen (S. 17), auch wenn solche mehr oder weniger intensiv berührt werden. Trotz dieser Schwerpunktsetzung ist sein Buch praxisnah und gut verständlich geschrieben und nicht nur für Psychoanalytiker, sondern für Psychotherapeuten unterschiedlicher methodischer Herkunft wärmstens empfehlbar. Die Auswirkungen der unbewussten nonverbalen Interaktion auf die therapeutische Situation sind unabsehbar – Streeck spricht dies selbst an (S. 17), wenn er meint, dass manche verbreitete Auffassungen zur Rolle des Therapeuten (wie z. B. die Forderung nach „Neutralität“) eigentlich nicht mehr aufrechtzuerhalten sind. Aufgrund der unübersehbaren Konsequenzen all dessen kann man mittlerweile durchaus von einem Paradigmenwechsel innerhalb eines Teils der Psychoanalyse sprechen: das Handeln ist mittlerweile eine vielbeachtete Dimension, die auch von einer modernen Psychoanalyse als solche anerkannt wird, und wird nicht mehr nur als „Agieren“ negativ bewertet. Streeck erweist sich – dies zeigt die Lektüre seines Buches eindeutig – als Vertreter einer solchen modernen und offenen Psychoanalyse; er scheut nicht den Kontakt mir Nachbarwissenschaften und scheut ebenso wenig die Herausforderung, liebgewonnene psychoanalytische Vorstellungen und Traditionen kritisch zu hinterfragen. Schon in der Einleitung werden wesentliche Eckpunkte des Gesamtwerks abgesteckt. Einer davon richtet sich entschieden gegen das traditionelle medizinisch-diagnostisch-zentrierte Behandeln: „Die weitverbreitete Auffassung, daß der Patient im Behandlungszimmer Zeichen einer seelischen Krankheit zeigt, die der Psychotherapeut erkennt und diagnostiziert und die er mit dafür geeigneten Mitteln behandelt, so wie der Arzt Krankheiten anhand von Zeichen feststellt und behandelt, ist wenig geeignet, die Verhältnisse zwischen Patient und Psychotherapeut im Behandlungszimmer wiederzugeben“ (S. 12) – vielmehr: „Erinnerungen und die Erzählbarkeit von Erinnerungen scheinen eher ein Epiphänomen zu sein, das von der therapeutischen Wirkung der Psychoanalyse unabhängig ist... während die Teile, die wirklich verstanden werden müssen, im Medium des Drucks kommuniziert werden, der auf den Analytiker ausgeübt wird“ (ebend.). Die einzelnen Kapitel behandeln unterschiedliche Schwerpunkte: die vielfältigen Facetten der therapeutischen Beziehung (Kapitel 1), die Bedeutung nichtsprachlichen Verhaltens für die Verständigung zwischen Patient und Therapeut (Kapitel 2), ein Exkurs in die interaktionistische Soziologie und Konversationsanalyse (Kapitel 3), Beispiele des Zusammenspiels sprachlichen und nichtsprachlichen Verhaltens (Kapitel 4), interaktive Prozesse in zwei diagnostischen Interviews (Kapitel 5), Untersuchungen zur Darstellung der Geschlechtszugehörigkeit anhand der psychotherapeutischen Arbeit mit einem transsexuellen Patienten (Kapitel 6), eine interaktionszentrierte Analyse von „Randkontakten“ wie Begrüßung und Verabschiedung (Kapitel 7), die Untersuchung einer konkreten therapeutischen Behandlung, in der die konkrete Gestaltung von Übertragung und Gegenübertragung besonders markant hervortritt (Kapitel 8), die Untersuchung der Frage, wie der Psychotherapeut erfährt, wie der Patient seine Interventionen aufgefasst hat (Kapitel 9) sowie der Versuch zu zeigen, wie Wünsche sich Regeln von Interaktionen zunutze machen können, um zu ihrem Recht zu kommen (Kapitel 10). Man bekommt beim Lesen der einzelnen Kapitel einen guten und breiten Einblick in die langjährige Arbeit Streecks und eine Ahnung dafür, was all dies therapeutisch bedeuten könnte. Eine wichtige Aussage des Buchs besteht darin, dass die nonverbale Interaktion so etwas ist wie ein eigener Strang psychotherapeutischen Handelns, neben dem Austausch symbolischer Informationen; also zwei parallel Stränge, die nebeneinander bestehen, einander wohl beeinflussen, und doch auch eine gewisse Eigenständigkeit aufweisen. Die nonverbale Kommunikation ist wesensmäßig darauf ausgerichtet, die Beziehung zwischen den Interaktanden zu regulieren: durch Mikroprozesse auf einer unbewussten Ebene – unbewusst in einem deskriptiven, nicht dynamischen Sinn; wir denken einfach nicht daran. Diese Prozesse entziehen bis zu einem gewissen Grad auch der verbalen Beschreibung, bzw. sind Worte wenig geeignet, das Wesensmäßige solcher Prozesse zu erfassen. Zu einer solchen Auffassung ist auch der bekannte Säuglingsforscher Daniel Stern gelangt. Bezugnehmend auf prozedurales Wissen sagte er einmal, es sei nahezu unmöglich zu beschreiben, was dabei passiert, wenn zwei Menschen sich küssen – das wesentliche daran sei erlebbar, sei spürbar, aber nicht gut beschreibbar. Stern war es auch, der unterschiedliche „Domänen“ des Selbstempfindens und Empfindens anderer Menschen beschrieben hat, die zueinander in einem Vorder-Hintergrund-Verhältnis stehen – zwar aufeinander aufbauend, dennoch aber unterschiedlich. Hier kann eine Parallele in zentralen Aussagen Sterns und Streecks festgestellt werden. Ab und zu nimmt Streeck direkt Bezug auf Stern – z. B. wenn er meint, dass es in der Therapie vorrangig „nicht um Veränderungen im autobiografischen Gedächtnis (geht), sondern um Modifikationen des impliziten Beziehungswissens des Patienten... (d. h.) darum, neue Wege zu erschließen, das Selbst mit anderen zu erfahren“ (S. 12). D. h.: Während Patient und Therapeut sprechen, ist ihre Beziehung im Hintergrund der Aufmerksamkeit – „(sie) regulieren ihre Interaktion, so unbemerkt, daß meist nicht einmal auffällt, daß sie das tun und wie sie das tun“ (S. 14). Das ändert sich, wenn die Interaktion selbst Gegenstand des Gesprächs wird, wie das z. B. in körperlich-interaktionellen Ansätzen durchaus immer wieder der Fall ist. „Spätestens von nun an tritt auch unübersehbar zutage, daß das Geschehen zwischen Patient und Therapeut nicht nur mit Worten abgewickelt wird und Worte nicht einmal immer das vorherrschende Medium ihrer Verständigung sind“ (ebend.). Ich hatte das Glück, Streeck vor einiger Zeit, im Rahmen des schon erwähnten 4. Wiener Symposiums „Psychoanalyse und Körper“ persönlich kennen zu lernen. Hier hat er mich, neben der mir schon vertrauten wissenschaftlichen Klarheit und Stringenz, auch menschlich beeindruckt. Er erweist sich als undogmatischer Psychoanalytiker, der offen ist für andere Perspektiven und auch Methoden, der – mit anderen Worten – Freude hat an lebendiger Auseinandersetzung und Diskussion und daher für den Dialog an der Schnittbereich von „Psychoanalyse und Körper“ auch in Zukunft wichtig und bereichernd sein wird. Fazit: Es scheint so etwas wie zwei Stränge in der Kommunikation von Menschen zu geben – einen Strang der verbal-symbolischen Aushandlung von Themen, und einen zweiten, wo etwas anderes passiert; wo körperliche Inszenierungen geschehen, wo körperlicher Ausdruck stattfindet, und wo – das ist der eigentliche Beitrag Streecks – Beziehung reguliert wird. Eine wesentliche Schwerpunktverschiebung wird deutlich: es ist nicht der Körper per se, der für Streeck von Interesse ist. Das war er z. B. in der alten bioenergetischen Tradition – erinnert sei in diesem Zusammenhang an das „Körperlesen“. Das neue Paradigma heißt: Der Körper in Interaktion. Das ist der entscheidende Bezugspunkt, und er charakterisiert den genuin psychoanalytischen Zugang. Das soll nicht heißen, dass der Körper per se keine berechtigte Perspektive wäre. Natürlich ist auch der Körper per se interessant, ein solcher Zugang wäre aber körpertherapeutisch und nicht psychoanalytisch zu nennen. Natürlich interessiert sich auch der Psychoanalytiker für den Körper per se, allerdings unter speziellen Fragestellungen, z. B. in Zusammenhang mit der Selbstrepräsentanz. Es ist dies ein Gesichtspunkt, der in der Psychoanalyse wenig belichtet ist, und wo noch viele Fragen offen sind, wie M. Buchholz kürzlich offen legte (in einem Beitrag in Psychosozial 97, Heft 3, S. 29-41). Ist die Selbstrepräsentanz analog zur Objektrepräsentanz zu denken? Welches Selbst besetzt dann, und woher bezieht es seine „Energie“? Wie kann ein Selbst sich vollständig repräsentieren, wenn es doch zu dieser Vollständigkeit einen Standpunkt von außerhalb seiner selbst benötigt? Aus therapeutischer Sicht hat sich für mich beim Lesen des Buchs folgende Punkt in den Vordergrund geschoben. Wenn also Beziehung reguliert wird, und wenn diese Regulation wichtig ist, dann ist zu akzeptieren, dass bestimmte Themen – wie z. B. Schuldgefühlsthemen – eben nicht explizit verhandelt werden, sondern interaktiv ausreguliert werden; d. h. natürlich auch, dass man sie dann nicht verbal bearbeiten kann – zumindest zunächst nicht. Dies mag z. B. bei traumatisierten Patienten durchaus wichtig und berechtigt sein. Wenn der Therapeut umgekehrt bewusst oder unbewusst den beidseitigen Regulierungserfordernissen entgegentritt und dieses Bedürfnis frustriert, wird die therapeutische Spannung steigen – mit dem Effekt, dass bestimmte Themen, wie z. B. Schuldgefühle in der gegenwärtigen ÜbertragungsGegenübertragungs-Konstellation besprechbar und durcharbeitbar werden. Ist die Frage, wann man den Regulationserfordernissen nachkommt (sofern man Regulationsbedarf überhaupt bewusst wahrnimmt) und wann nicht, also eine diagnostische? Oder sollte sie eher die gegenwärtige Beziehungssituation zwischen Patient und Therapeut berücksichtigen? Gibt es noch andere Kriterien dafür? Diese und noch andere Fragen zeigen, wie sehr mich die Lektüre des Buches angeregt haben. Peter Geißler