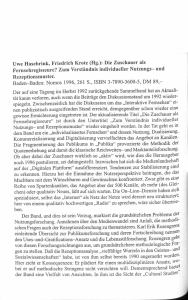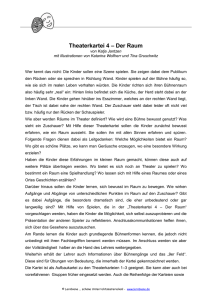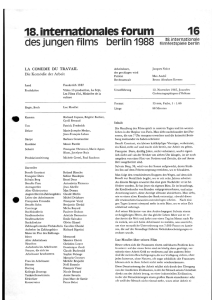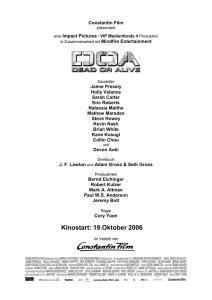Maßnahmen gegen die Gewalt
Werbung
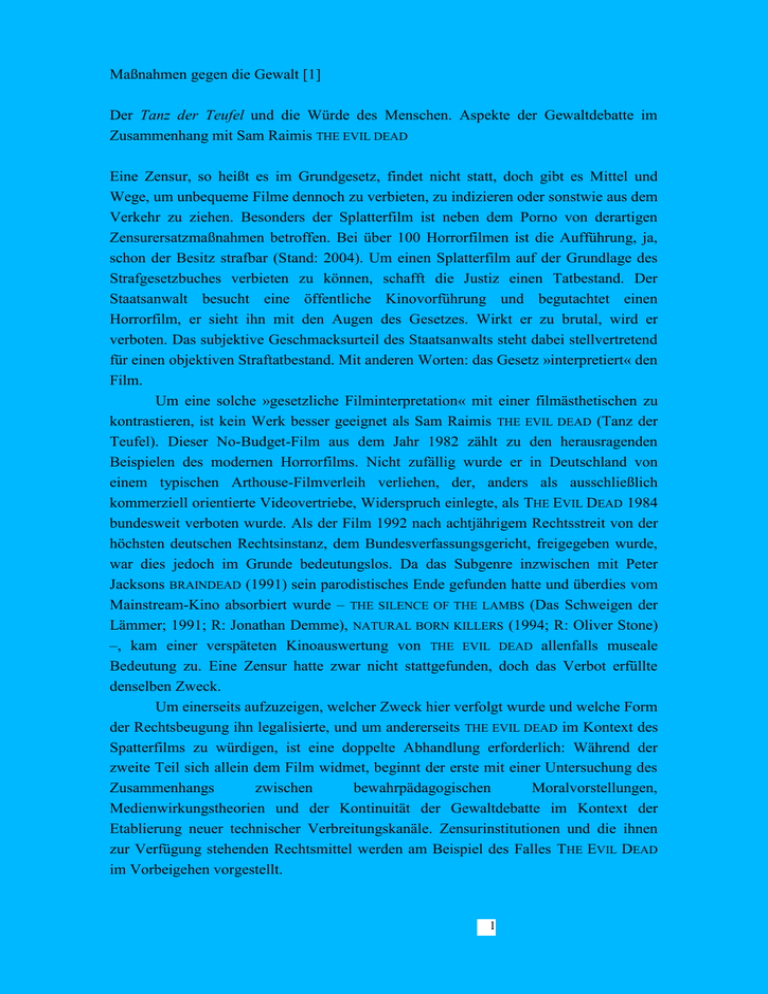
Maßnahmen gegen die Gewalt [1] Der Tanz der Teufel und die Würde des Menschen. Aspekte der Gewaltdebatte im Zusammenhang mit Sam Raimis THE EVIL DEAD Eine Zensur, so heißt es im Grundgesetz, findet nicht statt, doch gibt es Mittel und Wege, um unbequeme Filme dennoch zu verbieten, zu indizieren oder sonstwie aus dem Verkehr zu ziehen. Besonders der Splatterfilm ist neben dem Porno von derartigen Zensurersatzmaßnahmen betroffen. Bei über 100 Horrorfilmen ist die Aufführung, ja, schon der Besitz strafbar (Stand: 2004). Um einen Splatterfilm auf der Grundlage des Strafgesetzbuches verbieten zu können, schafft die Justiz einen Tatbestand. Der Staatsanwalt besucht eine öffentliche Kinovorführung und begutachtet einen Horrorfilm, er sieht ihn mit den Augen des Gesetzes. Wirkt er zu brutal, wird er verboten. Das subjektive Geschmacksurteil des Staatsanwalts steht dabei stellvertretend für einen objektiven Straftatbestand. Mit anderen Worten: das Gesetz »interpretiert« den Film. Um eine solche »gesetzliche Filminterpretation« mit einer filmästhetischen zu kontrastieren, ist kein Werk besser geeignet als Sam Raimis THE EVIL DEAD (Tanz der Teufel). Dieser No-Budget-Film aus dem Jahr 1982 zählt zu den herausragenden Beispielen des modernen Horrorfilms. Nicht zufällig wurde er in Deutschland von einem typischen Arthouse-Filmverleih verliehen, der, anders als ausschließlich kommerziell orientierte Videovertriebe, Widerspruch einlegte, als THE EVIL DEAD 1984 bundesweit verboten wurde. Als der Film 1992 nach achtjährigem Rechtsstreit von der höchsten deutschen Rechtsinstanz, dem Bundesverfassungsgericht, freigegeben wurde, war dies jedoch im Grunde bedeutungslos. Da das Subgenre inzwischen mit Peter Jacksons BRAINDEAD (1991) sein parodistisches Ende gefunden hatte und überdies vom Mainstream-Kino absorbiert wurde – THE SILENCE OF THE LAMBS (Das Schweigen der Lämmer; 1991; R: Jonathan Demme), NATURAL BORN KILLERS (1994; R: Oliver Stone) –, kam einer verspäteten Kinoauswertung von THE EVIL DEAD allenfalls museale Bedeutung zu. Eine Zensur hatte zwar nicht stattgefunden, doch das Verbot erfüllte denselben Zweck. Um einerseits aufzuzeigen, welcher Zweck hier verfolgt wurde und welche Form der Rechtsbeugung ihn legalisierte, und um andererseits THE EVIL DEAD im Kontext des Spatterfilms zu würdigen, ist eine doppelte Abhandlung erforderlich: Während der zweite Teil sich allein dem Film widmet, beginnt der erste mit einer Untersuchung des Zusammenhangs zwischen bewahrpädagogischen Moralvorstellungen, Medienwirkungstheorien und der Kontinuität der Gewaltdebatte im Kontext der Etablierung neuer technischer Verbreitungskanäle. Zensurinstitutionen und die ihnen zur Verfügung stehenden Rechtsmittel werden am Beispiel des Falles THE EVIL DEAD im Vorbeigehen vorgestellt. 1 »Spiegel«-Bilder Die Meinung, dass Gewaltdarstellung zur Nachahmung oder zumindest zur »entsittlichenden Verrohung« führt, wird maßgeblich von den Medien selbst lanciert. Ein Blick in das Nachrichtenmagazin Der Spiegel vom 12. März 1984, das an diesem Tag mit einer Titelgeschichte über Gewaltvideos aufmachte, zeigt, dass eine tendenziös verzerrende Darstellung einschlägiger Filme bereits mit der verrohenden Wirkung identisch gesetzt wird: »Ein Chirurg klärt seine auf dem Operationstisch angeschnallte Patientin auf: ›Ich werde dir nun die Schlagader durchtrennen.‹ Er zieht ihr das Skalpell über den Hals, Blut fließt heraus. Dann quetscht der Doktor der schreienden Frau eine Kiefersperre in den Mund und schnippelt mit Scheren im Rachen herum, bis es zweimal hörbar knackt. ›Jetzt stört mich dein Gebrüll nicht mehr bei der Arbeit‹, grient er, ›ich habe deine Stimmbänder durchgeschnitten.‹ Er sägt dem nur noch glucksenden Opfer die Schädeldecke auf. Diabolisch lachend metzeln zwei Mädchen im Mini einen Mann nieder. Die Blonde rammt ihm den Eispickel durch den Kehlkopf, die Brünette schlägt ihm ein Beil zwischen die Beine, dass der Unterleib fast bis zum Bauchnabel aufgerissen wird. Grunzend und grinsend machen sich Kannibalen über eine schöne Weiße her, die nackt und gefesselt auf dem Boden liegt. Mit der Machete säbelt einer der kreischenden Frau die linke Brust ab und beißt in den blutigen Fleischbatzen. Ein anderer Kannibale schlitzt der Massakrierten mit einer Lanze den Bauch auf und macht sich schmatzend über die Gedärme her. [Das Heimkino] vermittelt absonderliche Lustbarkeiten: Da werden, im ›Foltercamp der Liebeshexen‹ Mädchen mit dem Peitschenstil entjungfert; ›Asphaltkannibalen‹ schänden Frauen und flambieren sie mit Flammenwerfern; irre Killer zertrümmern Krankenschwestern mit Schlagbohrern die Köpfe – ›Absurd‹, so steht es auch auf dem Einband.« Diese hörbar lustvoll formulierten Sätze leiteten vor über 20 Jahren eine typische Spiegel-Titelgeschichte über den »Blutrausch im Kinderzimmer« ein. Der Begriff »Horror-Video« war damals so neu, dass man ihn noch mit jenem Bindestrich schrieb, der später in dem Maße verschwand, als das Medium Video selbst mit diesem Horror identifiziert wurde. Die Autoren erwecken gezielt den Eindruck, die Videothek um die Ecke entführe den Zuschauer augenblicklich in eine audiovisuelle Hieronymus-BoschHölle. Dabei stellt der Text sowohl die Filme als auch ihre Machart in einer problematischen Verdichtung dar. Wer sich die beschriebenen Filme einzeln ansieht – es handelt sich um fünf [2] –, wird feststellen, dass die genannten Szenen zwar tatsächlich vorkommen – nicht aber in der suggerierten Häufung. Von Anfang bis Ende betrachtet, sind diese Werke eher langweilig und vielfach unfreiwillig komisch. Aber davon später. Mit seinem Artikel verstärkte das Hamburger Nachrichtenmagazin die erste landesweite Hysteriewelle in Bezug auf Gewaltdarstellung. Es ging damals nicht um gewalttätige Computerspiele, auch nicht ums Internet oder das Fernsehen oder das 2 Kino. Stein des Anstoßes war das erst fünf Jahre zuvor eingeführte neue Distributionsmedium Video. Tatsächlich ausgelöst wurde die öffentliche Empörung über »Videoschund« durch die zwei Wochen vor dem Artikel in der ARD ausgestrahlte Jugendsendung Klons. Direkt nach der Tagesschau präsentierte man zur allerbesten Sendezeit einem Millionenpublikum einen minutenlangen Zusammenschnitt aus Horrorfilmen, der in ähnlicher Weise zu einem best of verdichtet war wie im oben zitierten Spiegel-Artikel. Anschließend bezeichnete die Moderatorin im Studio eher harmlos wirkende Jugendliche, die freimütig bekannten, solche Filme regelmäßig zu sehen, als krank. Hatten Pädagogen, Jugendschützer und Medienwirkungsforscher bislang weitgehend unbeachtet in Fachzeitschriften diskutiert, so geriet die öffentliche Empörung über Horrorvideos nach der ARD-Sendung und dem Spiegel-Artikel zu einem Politikum. Aus der gezeigten Gewalttätigkeit wurde unmittelbar auf eine Verrohung und eine Tendenz zur Nachahmung geschlossen. Die Forderung nach einem grundsätzlichen Verbot dieses »Schunds« führte daher kaum ein Jahr später, also 1985, zu einer erstaunlichen Gesetzesnovelle. Durch die Verschärfung des Paragraphen 131 wurde fortan eine sehr spezifische Medienwirkung zu einer Tatsache im Sinne eines Tatbestands erklärt: Gewalt darstellende Filme verletzen seit 1985 die Menschenwürde. Um diesen Schritt adäquat einschätzen zu können, ist zunächst ein kurzer Rückblick auf die Hauptströmungen der Medienwirkungsdebatte erforderlich. Am ältesten ist die auf Aristoteles zurückgehende Katharsisthese. Sie besagt, dass das Anschauen von Gewaltdarstellung eine Ventilfunktion erfüllt und tendenziell zum Abreagieren von Aggressivität führt. Diese These wird aber so gut wie nie vertreten, ebenso wie die sogenannte Inhibitionsthese, nach der Gewaltdarstellung abschreckend wirkt, weil sich der Zuschauer ihr zufolge eher mit dem Opfer als mit dem dargestellten Aggressor identifiziert. Vom genauen Gegenteil geht die Stimulationsthese aus. Nach ihr führt Gewaltdarstellung zur Enthemmung und reizt zur Nachahmung aggressiver Modellhandlungen. Prominentes Beispiel in diesem Zusammenhang ist Stanley Kubricks Klassiker A CLOCKWORK ORANGE (Uhrwerk Orange; 1971). Obwohl ein Zusammenhang zwischen den im Film gezeigten Gewalthandlungen und Jugendkriminalität nie nachweisbar war, forderte die englische Presse Anfang der 70er gemeinsam mit konservativen Abgeordneten nach jeder Vergewaltigung und jedem Raubüberfall regelmäßig das Verbot des Films. Nachdem ein Jugendlicher – der den Film gar nicht gesehen hatte – einen alten Mann zu Tode getreten hatte, wuchs der öffentliche Druck so sehr, dass Kubrick selbst seinen Film in England auf Lebzeiten verbieten ließ. Die vierte Medienwirkungsthese ist die der Habitualisierung: Regelmäßiges Anschauen von Gewaltdarstellung reizt zwar nicht zur Nachahmung, führt aber zur sogenannten »entsittlichenden Verrohung«. Dieser Begriff geht auf die Filmzensur der 20er Jahre zurück und unterstellt ähnlich wie die Stimulationsthese eine etwas weiter 3 gefasste Identität zwischen Medieninhalt und Medienwirkung. Wird Gewalt im Film als probates Mittel zur Konfliktlösung propagiert, so führt dies beim Zuschauer auf die Dauer zu einer Gleichgültigkeit gegenüber realer Gewalt und schließlich zu einer Abstumpfung. Chucky 3: das Böse kommt aus dem Fernseher Obwohl niemand ernsthaft die These der direkten Nachahmung zu vertreten scheint, dass medial vermittelte Gewalthandlungen zur Nachahmung anstiften, besteht offenbar das latente Bedürfnis danach, wie im Fall Kubrick zu einem einzelnen Gewaltverbrechen rückwirkend ein medial vermitteltes anstiftendes Vorbild zu finden. Genau dies geschah im Herbst 1993. Der brutale Mord, den die zur Tatzeit zehn Jahre alten John Venables und Robert Thompson an dem zweijährigen James Bulger begangen hatten, erregte internationales Aufsehen. Man erinnert sich an das gespenstische Szenario: Die grobkörnig verschwommenen Bilder der Überwachungskamera eines Liverpooler Einkaufzentrums zeigen zwei Jungen, die ein Kleinkind mit sich führen. Keiner der Passanten nimmt daran Anstoß, dass der kleine Junge blutet. Jeder glaubt, die beiden führen ihren kleinen Bruder nach Hause. Dreieinhalb Kilometer weiter prügeln sie den Kleinen mit einer Eisenstange zu Tode. Um die Tat als Unfall zu tarnen, legen sie die Leiche auf die Gleise einer in der Nähe befindlichen Bahnstrecke. Spektakulär wie der Mord selbst erschien auch die Erklärung des Tatmotivs, die umgehend zur Hand war: »Das Video CHILD’S PLAY 3 verwirrte die zehnjährigen Robert Thompson und Jon Venables aus Liverpool so, dass sie den zweijährigen James Bulger umbrachten«, resümierte in seinem Jahresrückblick 1993 apodiktisch Der Spiegel. Der Horrorfilm CHILD’S PLAY 3 (Chucky 3; 1991; R: Jack Bender) wird gelegentlich im Fernsehen wiederholt – ohne dass irgendjemand davon Notiz nähme. Unglücklicherweise wurde seine deutsche Erstausstrahlung kurz nach dem LiverpoolMord im November 1993 angekündigt. Obwohl er nur verschlüsselt auf dem Pay-TVSender Premiere ausgestrahlt werden sollte, löste die Ankündigung eine vehemente Debatte aus. [3] Die als sicher geltende Annahme einer unmittelbaren Parallele zwischen dem Spielfilm und dem Liverpool-Mord weckte große Empörung: »Wie Sie wissen«, teilte die damalige Bundesministerin für Familie und Frauen, Hannelore Rönsch, Premiere »mit Betroffenheit« per Telefax mit, »hat der Richter [in Liverpool] Parallelen zwischen Szenen des Films und dem Tathergang gesehen.« [4] Diese Information hatte am 26. November 1993 die Süddeutsche Zeitung verbreitet. Dort war allerdings nur von einer »Vermutung« die Rede: »Es ist nicht meine Aufgabe«, so der Richter, »über die Erziehung der beiden [Venebles und Thompson] zu urteilen, aber ich vermute, dass sie Gewalt-Videos konsumiert haben, was ein Teil der Erklärung sein könnte.« In derselben Zeitung vom Tag darauf wird dies bereits dementiert. Der leitende Polizei-Ermittler erklärt: »›Ich weiß nicht, wie [der 4 Richter] auf diese Idee kommt‹ [...] Während der Untersuchung haben Beamte 200 Videos angeschaut, die Johns Mutter ausgeliehen hatte. ›Darunter waren manche, die Sie und ich nicht sehen würden, aber es gab nichts – keinen Plot, keinen Dialog – worauf man zeigen und wovon man sagen könnte: das hat den Jungen beeinflusst.‹« Obgleich sich die Parallele zwischen Film und Mord auf eine »Vermutung« reduzierte, setzte der damalige medienpolitische Sprecher des Bündnis 90/Die Grünen, Konrad Weiß, auf die Entrüstung der Familienministerin Rönsch noch eins drauf: »Es ist eine unglaubliche Missachtung der öffentlichen Debatte über Gewalt im Fernsehen«, hieß es in einem Fax an Premiere, »wenn der Pay-TV-Kanal [...] ausgerechnet den Film ausstrahlt, der für den Mord an einem zweijährigen Jungen in England offensichtlich als Vorlage diente.« [5] Die bloße Vermutung wird hier zur Tatsache erklärt – ebenso wie in einer Fernsehreportage vom 28. November 1993. Spiegel TV berichtete, die beiden zehnjährigen Mörder hätten »nach einem Drehbuch gehandelt.« Der Vater des einen Jungen habe den Spielfilm CHILD’S PLAY 3 ausgeliehen, der, so die Bundesministerin Rönsch, »nach allem, was darüber bekannt ist, an entsetzlicher Brutalität nicht zu überbieten« sei. Die Formulierung der Bundesministerin verrät, dass sie selbst den Film nicht gesehen hatte, sondern sich auf Informationen aus fremder Hand berief. Dabei kann es sich nur um den Indizierungsbescheid der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften (BPjS) vom 8. Februar 1993 handeln. Gestützt auf eine kurze Inhaltswiedergabe aus der Zeitung Videowoche bewertete die Bundesprüfstelle auf den Antrag zweier Jugendämter hin den Film mit der üblichen Sprachregelung als »gewaltverherrlichend und verrohend«. Begründung: »Die Handlungsarmut bewirkt es, dass die Tötung der Menschen besonders langatmig ausgemalt wird [...].« Da die Handlung des Films im Prüfgutachten ebenso unberücksichtigt bleibt wie die Motive der Figuren, entsteht durch die isolierte Hervorhebung der Tötungsszenen eine Gesamtanmutung des Films, die keiner realistischen Zuschauersituation entspricht, sondern durch die selektive Wahrnehmung der Prüfer erzeugt wird. So wird im BPjSUrteil bereits die dramaturgische Konfliktsituation des Films denunziert: »Besonders pervers scheint mir hier die Tatsache, dass eine Puppe eine Metzelei nach der anderen ausübt, wobei im wirklichen Leben die Kinder den Puppen viel Vertrauen schenken.« Der an sich schon problematische Indizierungsbescheid diente bei der »Chucky«-Debatte offenbar als Diskussionsgrundlage. Rekonstruiert man den Film aufgrund der Fehlinformationen, die seinerzeit über ihn in der Presse kursierten, so entsteht der Eindruck, Journalisten hätten selbst die Regie geführt. Vor allem der Autor des zitierten Spiegel TV-Beitrags [6] aber kann den Film gar nicht gesehen haben. Dort heißt es nämlich, CHILD’S PLAY 3 zeige die Entführung einer Puppe. Als Beleg für diese Behauptung sehen wir eine Szene, in der ein Soldat eine Kinderpuppe durchs Bild trägt. CHILD’S PLAY 3 handelt jedoch nicht von der Entführung einer Puppe: Umgekehrt entführt eine Puppe ein Kind – ebenjenes Kind, das in der Spracharmut des 5 Indizierungsbescheides übrigens als »der kleine Negerjunge« bezeichnet wird. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26. November 1993 geht dem Indizierungsbescheid auf den Leim, wenn sie schreibt: Chucky »zeigt, wie ein Kind zerstückelt wird.« Umgekehrt erzählt der Film davon, wie am Ende die Puppe zerstückelt wird. Diese Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Umso interessanter ist, dass der damals als sicher geltende Zusammenhang zwischen einem Horrorfilm und der Mordtat acht Jahre später, als die beiden Täter im Februar 2001 entlassen wurden, nicht einmal mehr von der Boulevardpresse aufgegriffen wurde... 70 Bildschirm-Morde pro Tag Zu Beginn der 90er Jahre kam das Böse aus dem Fernseher. In diesem Zusammenhang ist die ungefähr zeitgleich zur Chucky-Diskussion entstandene Schlüsselstudie von Jo Groebel zu erwähnen, die von der Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen (LfR) in Auftrag gegeben und deren Ergebnis bereits im Januar 1992 veröffentlicht worden war. Vor allem konservative Politiker profilierten sich mit Bezugnahmen auf diese Studie: »Als Prof. Jo Groebel Anfang 1992 seine Untersuchung zur Analyse der Gewaltprofile deutscher Fernsehanstalten veröffentlichte, schreckte die bundesdeutsche Öffentlichkeit auf: Das Gefühl, der Zuschauer werde im Fernsehprogramm mit zuviel Gewalt konfrontiert, ließ sich jetzt in Zahlen ausdrücken. 750 Programmstunden der Sender ARD, ZDF, RTL plus, SAT 1, Tele 5 und Pro 7 wurden so aufgezeichnet, dass im nachhinein eine vollständige Fernsehwoche rekonstruiert werden konnte. Das Ergebnis damals: In fast der Hälfte aller deutschen Fernsehprogramme (47,7 Prozent) werden Aggressionen und/oder Bedrohungen in irgendeiner Weise thematisiert«, [7] erklärte die damalige Familienministerin Angela Merkel auf einer Fachtagung. Berühmt-berüchtigt wurde das von ihr zitierte »Gewaltprofil des deutschen Fernsehprogramms« [8] durch die griffige Zahl von 70 Morden, die das Fernsehen tagtäglich zeige. Um auf diese alarmierende Zahl zu kommen, hatte Groebel im Zeitraum vom 17. Juni bis zum 11. August 1991 insgesamt 1219 Sendungen aufgezeichnet. Diese Sendungen wurden nach einem Schema begutachtet, das am Ende zu so erschreckenden Aussagen führte wie: »Stündlich werden im Fernsehen durchschnittlich fast fünf aggressive Handlungen gezeigt.« [9] Da die Studie empirischen Anspruch erhob, erweckte das – bis heute unhinterfragte – Ergebnis den Eindruck, ein realer Zuschauer sei jeden Tag einem Programm ausgesetzt, bei dem er 70 Morde nicht nur erleben könne, sondern tatsächlich erlebe... Die errechnete Gewalthäufigkeit ist jedoch, wenn überhaupt, nur gültig für einen fiktiven Zuschauer – real gibt es ihn nicht nur nicht, es kann ihn gar nicht geben, und das aus mehreren Gründen. Rekapitulieren wir zunächst die Bedingungen, unter denen die Zahl von 70 Morden pro Tag überhaupt relevant sein kann. Erstens müsste der Zuschauer das gesamte Programmangebot aller sechs ausgewählten Sender simultan wahrnehmen können, was für sich genommen schon unmöglich ist, außer in einem 6 Setting, wie Nicolas Roeg es in seinem Spielfilm THE MAN WHO FELL TO EARTH (Der Mann, der vom Himmel fiel; 1976) zeigt, wo David Bowie vor einer ganzen Batterie flimmernder Bildschirme sitzt. Das weiß freilich auch Jo Groebel, der für seine Studie mitnichten einen einzigen Beobachter vor sechs Monitore, sondern sechs Beobachter vor jeweils einen Monitor setzte. Zweitens müsste dieser bereits jetzt als fiktiv erkennbare Zuschauer täglich rund 18 Stunden ohne Unterbrechung fernsehen – was Groebel seinen Beobachter ebenso wenig zumutete. Gehen wir dagegen von einer »normalen« Fernsehsituation aus, in der jeder Zuschauer nur ein Gerät und damit nur ein Programm zur selben Zeit beobachtet – und nicht ARD, ZDF, Sat1, RTL, Tele5 und Pro7 simultan –, so reduziert sich die rein statistische Häufigkeit von 70 BildschirmMorden nach der Logik, die die Studie selbst vorgibt, bereits auf ein Sechstel, nämlich auf 11,6. Gehen wir ferner davon aus, dass der einzelne Zuschauer pro Tag kein 18Stunden-TV-Marathon absolviert, sondern durchschnittlich »nur« etwa vier Stunden in die Röhre schaut, so vermindern sich diese 11,6 Morde noch einmal, so dass ein Zuschauer während seines täglichen Fernsehkonsums im Schnitt 2,6 Morde täglich wahrnehmen könnte. Das von Angela Merkel vertretene Argument, der Zuschauer sei durch die Möglichkeit des Hin-und-herzappens dennoch dem gesamten Programmangebot ausgesetzt, muss ebenfalls zurückgewiesen werden. Untersuchungen zum Zapping-Verhalten haben ergeben, dass der Zuschauer beim jeweils gewählten Kanal zu lange verweilt, um im anderen Kanal den Anschluss wahren zu können: Während er im Programm A verfolgt, wie John Wayne sein Gegenüber niederstreckt, vermöbelt zwar im Programm B Schimanski gerade einen Übeltäter – das aber entgeht dem Zuschauer, denn wenn er in dieses Programm zurückzappt, ist die Szene schon vorbei. Unseriös ist die Studie jedoch nicht nur deshalb, weil sie nur indem sie ihre eigenen Durchführungsbedingungen wegeskamotiert, unterstellen kann, ein einzelner realer Zuschauer sei tatsächlich in der Lage, an einem Fernsehtag 70 Morde mitzuzählen. Nicht minder problematisch ist die fehlende Unterscheidung zwischen fiktiven Gewaltszenen in Spielfilmen und der Darstellung von Gewaltopfern in Nachrichten und Dokumentationen, die sich in dem Neologismus »Nachrichtenaggression« niederschlägt. Über diese Unschärfen hinaus ist als entscheidender Kritikpunkt zu nennen, dass die Studie von einem nicht nur unrealistischen, sondern kognitiv unmöglichen Rezeptionsverhalten der Zuschauer ausgeht, indem sie Gewaltszenen bewusst von den ihnen vorausgehenden bzw. nachfolgenden Szenen abtrennt und so systematisch alle kontextuellen Verknüpfungen ignoriert, die die dargestellte Gewalt motivieren bzw. erklären können. Ausdrücklich heißt es bei Groebel im Hinblick auf die Erfassung von Gewaltszenen durch die sogenannten Rater: »Subjektive Interpretationen oder Hinweise/Merkmale, die sich nur aus dem Gesamtkontext der Sendung ergeben [...], blieben unberücksichtigt.« [10] Eben diese Nichtberücksichtigung jedoch – die sich bei genauerem Hinsehen als die zentrale 7 methodologische Voraussetzung von Groebels Studie erweist – bringt eine weitere Verzerrung der Ergebnisse dadurch herein, dass sie ein Rezeptionsverhalten vorschreibt, das für den »normalen« Fernsehzuschauer weder technisch noch kognitiv möglich ist. Durch den expliziten Ausschluss qualitativer Kriterien – bekanntlich der Schrecken der quantitativen Sozialforschung –, der die isolierten Gewaltszenen zu einer zählbaren Größe operationalisiert, wird die Fiktion von Zuschauern konstruiert, die – ganz so, als wäre jeder sein eigener Rater – tagtäglich nichts anderes tun, als kontextlos hintereinandergeschnittene Gewaltdarstellungen zu registrieren, und zwar gemäß eben der unterstellten Naivität, die Groebel als Direktive vorgegeben hatte: »Die Rater sollten möglichst ›naiv‹ an die Sendung selbst herangehen, also möglichst nicht schon durch das frühere Anschauen eines Films bereits ein Bedeutungskonzept des Gesamtkontexts entwickelt haben.« Kommt Groebel am Ende zu dem Ergebnis, dass in zwei Dritteln der Fälle »keine Gründe für den Einsatz von Gewalt hervor[gehen]« [11], so widerspricht er obendrein seiner eigenen Vorgabe an die Rater, »naiv« fernzusehen und nicht nach Kontexten und Begründungen zu suchen – denn wer nicht nach Gründen sucht, kann sie weder finden noch nicht finden. In auffälliger Analogie zum oben zitierten Spiegel-Artikel destilliert die Studie also im ersten Schritt aus dem gesamten Programmangebot ein Non-Stop-GewaltBombardement heraus, das so kein realer Zuschauer sehen kann, um im zweiten Schritt die ebenso irreale Wahrnehmungssituation dieses Bombardements als objektive Darstellung der »Normalrezeption« zu lancieren. Die Aussage: »21 Stunden Programm kann dann zum Beispiel für täglich 40 Minuten purer Gewaltakte stehen, als Einzelbilder ohne größere szenische Einbindung« [12], beschreibt von daher nur das der Studie selbst zu Grunde liegenden Rezeptionsparadigma. Wenn die Studienbetreiber schließlich noch behaupten, »die Tötung von Menschen [sei] zum Teil zu einem selbstverständlichen Programmelement geworden« [13] – so verdankt sich diese Wertung ihrem eigenen laborhaften Setting. Mit einer realen Fernsehnutzung hat dieses Setting allerdings nichts gemein. Eine kurze Mediengeschichte Der öffentliche Konsens über eine Gefahr, die durch eine suggerierte Häufigkeit von Gewaltdarstellungen im Kino, auf Video oder im Fernsehen ausgeht, wird verständlicher, wenn man die zyklisch wiederkehrenden Debatten über »mediale Abrüstung« vor dem Hintergrund der Mediengeschichte betrachtet. Vergleichen wir nämlich Buchzensur, Theaterzensur, Filmzensur, das Verbot von Videofilmen und schließlich den Wunsch nach »Gewaltbereinigung« des Fernsehens in ihrer historischen Abfolge, so zeigt sich strukturell immer das gleiche Muster: Die Abschaffung der Buchzensur führte im 19. Jahrhundert zu dem Paradox, dass Dramen nun unzensiert gelesen werden konnten, ihre Aufführung auf dem Theater jedoch eingeschränkt wurde. Denn durch die Versammlung einer Menschenmenge während der Aufführung erreicht 8 ein Theaterstück viele Menschen gleichzeitig. Der Gefahr einer unwillkommenen Verbreitung unerwünschter Botschaften begegnete man dadurch, dass die Theateraufführung als Versammlung definiert wurde, die als solche einem so genannten Polizeiverbot mit Erlaubnisvorbehalt unterlag. Auf die Abschaffung der Theaterzensur im Jahr 1918 folgte zwei Jahre später die Verabschiedung des doppeldeutigen Reichslichtspielgesetzes vom 12. Mai 1920: »Eine Zensur findet nicht statt, doch können für Lichtspiele durch Gesetz abweichende Bestimmungen getroffen werden.« In einer bemerkenswerten juristischen Studie aus dem Jahr 1958 fasst Johanne Noltenius diesen Vorgang wie folgt zusammen: »Es hat also den Anschein, als ob [jedes Mal] in dem Augenblick, in dem die Wirkung und Verbreitung eines Kommunikationsmittels durch die technische Entwicklung besonders gefördert wird, ganz automatisch die Forderung nach Kontrolle des Kommunikationsmittels erhoben wird.« [14] Betrachten wir nun die jüngere Mediengeschichte, so zeigt sich, dass die sogenannten Neuen Medien Noltenius’ Hypothese auf verblüffende Weise weiterhin bestätigen. Dass die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) von 1949 bis 1972 trotz grundgesetzlich garantierter Kunstfreiheit zahlreiche Filme aus politischen Gründen von der Aufführung ausschloss, ist hier nicht Thema. Entscheidend für die Gewaltdebatte ist jener Einschnitt, auf den bereits hingewiesen wurde: Der Liberalisierung der politischen Zensur, die es seit 1972 erlaubt, Filme mit der Kennzeichnung »ab 18 Jahren« auch ohne FSK-Vorlage öffentlich aufzuführen, folgte nur ein Jahr später, am 23. November 1973, die Einführung einer neuen gesetzlichen Handhabe, die es fortan der Staatsanwaltschaft ermöglichte, Filme zu verbieten, »die Gewalttätigkeiten gegen Menschen in grausamer oder sonst unmenschlicher Weise schildern und dadurch eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrücken« – der bereits erwähnte Paragraph 131 StGB. Intendiert war er als juristisches Instrument gegen das wiederaufkommende neonazistische Schrifttum. Nicht zufällig nennt der Wortlaut des Paragraphen »Gewaltdarstellung und Aufstachelung zum Rassenhass.« Ebenso wenig zufällig ist jedoch, dass die Verabschiedung des Paragraphen mit dem Boom des »Spaghetti-Western« zusammenfiel: »Es fing, glaube ich, an«, so der FSK-Veteran Horst von Hartlieb [15], »mit dem Italowestern. Der Mythos des Western wurde umgewandelt in Brutalität.« Diese Argumentation bleibt vordergründig, denn die »Umwandlung«, die von Hartlieb anprangert, kam eigentlich einer Entlarvung der bis dahin kollektiv ignorierten Gewaltverharmlosung als Darstellungsprinzip des traditionellen Western gleich: In ihm wurden »serielle Unmenschen« [16] (= Indianer) ebenso seriell niedergemetzelt: Der Mann fiel, mal vom Dach und mal vom Pferd, immer jedoch bühnenreif, und niemand störte sich daran – bis der Italowestern den bis dahin antiseptischen Einschusslöchern die Lupe vorhielt. Von da an fiel der Mann nicht mehr nur vom Pferd, er fiel auseinander. Die Western von Sergio Corbucci und Sergio Leone zerstörten den 9 Mythos des Revolverhelden als Pionier amerikanischer Zivilisation und entlarvten die verlogene Darstellung von Gewalt. Die US-amerikanische Version des Spätwesterns drehte 1969 Sam Peckinpah mit THE WILD BUNCH, der vom Spiegel im Zuge der Gewaltdebatte der frühen 90er Jahre als »einer der folgenreichsten und fatalsten Tabubrüche in der Menschheitsgeschichte« [17] verunglimpft wurde. Zwischen dem Spaghettiwestern in den 70ern und der Auseinandersetzung um die so genannten Horror-Videos fand eine weitere medientechnische Zäsur statt. Betrachtet man die erste große Debatte über Gewaltdarstellung, die zu Beginn der 80er entbrannte, so zeigt sich, dass sie signifikant zeitversetzt gegenüber dem Absatz von Videorekordern verlief. Das Videoabspielgerät als neue Distributionsform boomte in Deutschland so rasch wie in keinem anderen Land. Ab 1977 avancierte der VHSVideorekorder zum Verkaufsschlager. Bis 1984 erfolgte eine kontinuierliche Absatzsteigerung, die interessanterweise im Jahr 1985 erstmals stagnierte – zu genau dem Zeitpunkt, als die Horror-Video-Debatte ihren Höhepunkt erreichte. Der Absatzerfolg des Videorekorders basierte auf zwei Nutzungsarten: zeitversetztes Fernsehen und, vor allem, Leihkassetten aus der Videothek. Bei letzterer Nutzungsart ist auffällig, dass der Videorekorder und der Verleih von Filmen gleiche Absatzkurven aufweisen. [18] Jene 1000 Videotheken, die es 1980 in Deutschland gab, verliehen aber hauptsächlich sogenannte B-Titel: »Video war ein neues Medium, das dem Verbraucher ein Programm bot, das er sonst nicht sehen konnte. Dabei handelte es sich in den Anfangsjahren zunächst um harte Actionware, Horrorfilme und Pornokassetten.« [19] Die Marktkapazität dieser B-Titel war jedoch 1984 erschöpft. Das wirklich große Verleihgeschäft war jetzt nur noch mit dem Hitprinzip möglich. Von nun an begann man damit, die Zweitverwertung großer Kinoerfolge, sogenannte ATitel, auf Video voranzutreiben. Der Einstieg der Major-Companies [20] in das Videogeschäft im Jahr 1982 führte rasch zu einer Monopolisierung des Marktes. BTitel, die als Programmalternative den Verkaufserfolg des Rekorders bis dahin wesentlich mitbewirkt hatten, wurden angesichts des angekündigten exorbitanten Verleihgeschäfts mit Hollywood-A-Titeln bald lästig. Obwohl der Hardcore-Horrorfilm im B-Titel-Angebot bis dahin einen zahlenmäßig geringen Anteil gehabt hatte, avancierten vereinzelte, im Fernsehen zwecks »Abschreckung« gezeigte Ausschnitte (beispielsweise in der eingangs genannten Jugendsendung Klons) zum Leitbild des gesamten Mediums: »Obwohl lediglich ein kleiner Teil der Titel indiziert [21] ist, gelten Videos in der Öffentlichkeit als eine primitive, ein wenig schmuddelige Unterhaltung mit zweifelhaftem Niveau.« [22] Nicht zu übersehen ist, dass die Gewaltdebatte erst dann öffentlich Wirkung zeigte, als das Rekordergeschäft im Wesentlichen abgeschlossen war. Nun kam es zu einer mehr oder weniger unauffälligen Verlagerung. Denn nach Einführung des Privatfernsehens im Jahr 1984 zirkulierte zunächst mehr oder weniger dieselbe B-FilmMasse zwischen Sat1 und RTL (später auch Pro7): »Wir haben Spielfilme gesendet, die 10 vor uns zu Recht keiner gezeigt hatte« [23], erklärte mit seinen populistischen Zynismus der frühere RTL-Chef Helmut Thoma. Konservative Politiker, die maßgeblich an der Durchsetzung des Privatfernsehens beteiligt waren, störten sich zunächst nicht daran, dass dort verhältnismäßig mehr »Gewaltfilme« gezeigt wurden als von den öffentlichrechtlichen Sendern. Einen Grund dafür, warum die Horror-Video-Debatte zunächst nicht – etwa nach dem Motto: Wehret den Anfängen – auf das Privatfernsehen ausgedehnt wurde, sprach 1993 der bayrische Ministerpräsident Edmund Stoiber aus: »Das Ziel, die ›Monopolanstalten‹ ARD und ZDF durch Programmvielfalt zu entautorisieren, wurde erreicht.« [24] Aber diese »Programmvielfalt« bestand, zumindest in der Anfangsphase, in genau jenem »Schund«, den später Angela Merkel als moralisch verwerflich inkriminieren sollte. Kaum hatte auch das Privatfernsehen das B-Filmpaket ausgewertet, spukte zwischen Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre dasselbe Gespenst der Gewalt, nachdem es aus dem Video ausgetrieben wurde, nun auf der Mattscheibe. Der Fall THE EVIL DEAD Nachdem die zyklischen Etappen der Gewaltdebatte in groben Zügen nachgezeichnet wurden, sollen nun an einem Einzelfall die Konsequenzen der juristischen Praxis verdeutlicht werden. Es geht um den Horrorfilm THE EVIL DEAD, dessen Regisseur Sam Raimi nicht erst seit dem Welterfolg von SPIDER-MAN (2002) zu den bekanntesten seines Faches zählt. Der mit einem Minimalbudget von 380.000 Dollar gedrehte Film ist trotz einiger expliziter Szenen kein typisches Beispiel für einen HardcoreHorrorfilm. Nicht umsonst wird die Lizenz im Oktober 1983 vom Münchner KunstfilmVerleih Prokino erworben, der bislang hauptsächlich Filme von Godard, Kluge, Resnais, Visconti oder Wertmüller im Programm hatte. Mit nur 12 Kopien startet er am 10. Februar 1984 – unglücklicherweise einen Monat vor der oben zitierten SpiegelGeschichte über die Horrorvideos. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda erreicht der ab 18 Jahren zugängliche Film ohne Werbung in nur drei Monaten sensationelle 160.000 Besucher. Angespornt vom Erfolg dieses Außenseiters, lässt der Verleih weitere 30 Kopien ziehen – vergeblich, denn nach seiner Veröffentlichung auf Kassette durch VCL Video wird er am 6. Juli 1984 von der Staatsanwaltschaft München wegen Verstoßes gegen Paragraph 131 StGB bundesweit beschlagnahmt. Begründung des Münchner Amtsgerichts: Der Film »lebt überwiegend von brutalen, grausamen und geschmacklosen Szenen. In diesem Film werden anderen Menschen besondere Schmerzen und Qualen zugefügt, dabei wird von den Akteuren aus gefühlloser und unbarmherziger Gesinnung gehandelt, und die menschenverachtende, rücksichtslose und gleichgültige Tendenz findet in der Darstellung der gewalttätigen Vorgänge greifbaren Ausdruck [...]. Rohe Gewalttaten werden in aufdringlicher Weise anreißerisch und ohne jegliche Motivation um ihrer selbst Willen zum bloßen Unterhaltungsanreiz und zur Stimulierung von Emotionen 11 gezeigt. Die Darstellung exzessiver Gewalt und Grausamkeit wird mithin zum Selbstzweck erhoben.« Das Gericht schließt: »Der Film liefert insbesondere keinen Denkanstoß hinsichtlich der Problematik der Ursachen von grausamer Gewalt.« [25] In ihrer Verfassungsbeschwerde vom 9. Juni 1989 rügen die Anwälte von Prokino, die Münchner Justiz habe »die Filmhandlung [...] nicht einmal kursorisch wiedergegeben.« Dieses Versäumnis hatte vor allem die Auffassung gestützt, der Film zeige nichts als eine Aneinanderreihung von Gewalttaten ohne erkennbaren Sinn. Insofern war für das Gericht auch die von Experten vorgebrachte Ansicht, THE EVIL DEAD sei als »Kunstwerk« einzustufen, ohne Belang. Denn das Landgericht München ließ insbesondere den sogenannten »Kunstvorbehalt« nicht gelten: »Es kann dahingestellt bleiben, ob dieser Film [...] als ›Werk der Filmkunst‹ einzustufen ist. [Denn] selbst wenn man dem Film überwiegend künstlerische Darstellung zubilligen würde, [müsste trotzdem] die Kunstfreiheit hinter die Menschenwürde anderer zurücktreten«. [26] Mit diesem Standardargument wurde nicht nur THE EVIL DEAD, sondern nahezu jeder Horrorfilm verboten, der nach der Gesetzesnovelle von 1985 Gegenstand einer Verhandlung wurde. Wie ist dies juristisch möglich? Paragraph 131 Auf der Gesetzesgrundlage von 1973 war es möglich gewesen, »Schriften« – und darunter fallen auch Filme – zu verbieten, »die Gewalttätigkeiten gegen Menschen in grausamer oder sonst unmenschlicher Weise schildern und dadurch eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrücken.« [25] Damit sollte dem Wiederaufkommen neonazistischer Propaganda Einhalt geboten werden können. Deswegen nennt der Paragraph die Gewaltdarstellung mit der »Aufstachelung zum Rassenhass« in einem Atemzug. Keinesfalls um neonazistisches Gedankengut ging es jedoch, als am 25. Februar 1985 dieser »Gewaltparagraph« durch einen Zusatz erweitert wurde: Verboten werden können seitdem auch Filme, »die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellen.« Der hier eingeführte Schlüsselbegriff ist die »Würde des Menschen«, deren Begriff aus zwei Gründen in den Wortlaut der Vorschrift einfließt. Zum einen ist sie gemäß Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes »unantastbar«. Die explizite Bezugnahme auf das höchste (und zugleich abstrakteste) Rechtsgut des Staates zeigt, dass die Videodebatte im wahrsten Sinne »staatstragend« geworden war. Der im Paragraph 131 hergestellte Bezug zur Menschenwürde verfolgt allerdings nicht den Zweck, den konkreten Menschen vor einer Bedrohung zu schützen, wie sie etwa Nationalsozialismus durch die »Rassengesetze« entstanden war. Stattdessen geht es allein darum, die Reichweite der Vorschrift so weit auszudehnen, dass die in Artikel 5 garantierte Kunst- und Pressefreiheit grundsätzlich nachrangig ist. Fortan konnte jeder Horrorfilm mit »graphischer« Gewaltdarstellung, gleich ob ihm Kunstwerkcharakter 12 zugebilligt wurde oder nicht, wegen Verstoßes gegen die »Menschenwürde« verboten werden. Rekapitulieren wir den bisherigen Verlauf der Argumentation: Eine fragwürdige Darstellung wie die des Spiegel (und ähnlicher Medien) führt zu einem verzerrten Bild hinsichtlich der Machart und der Quantität eines Subgenres. Es kommt zu einer öffentlichen Empörung, Politiker sehen Handlungsbedarf. Um Horrorfilme verbieten zu können, wird das Gesetz gegen Gewaltdarstellung dahingehend novelliert, dass die im Grundgesetz geschützte Menschenwürde den Wortlaut der Vorschrift bestimmt. Durch diese Konstruktion wird der »Schutzgedanke« grundsätzlich über die in Artikel 5 Grundgesetz garantierte Kunstfreiheit gestellt. Es handelt sich um eine Rechtsbeugung, die erstmals vom Bundesverfassungsgericht gerügt wurde, als es am 20. Oktober 1992 das Verbot von Sam Raimis THE EVIL DEAD aufhob. Von den zahlreichen Gründen, die zu dieser Entscheidung führten, sollen im Rückblick nur die zwei wesentlichen hervorgehoben werden. So hatte das Landgericht München den Film unter anderem deswegen verboten, weil unmenschliche Gewalt gegen »vier reale menschliche Körper« ausgeübt wird, die »nicht nur Phantome oder Hirngespinste« seien. Wörtlich heißt es: »Das Verbot der Darstellung grausamer Gewalttätigkeiten gegen Menschen kann nicht dadurch umgangen werden, dass die Menschen als ›Besessene‹ oder etwa nur noch als menschenähnliche Ungeheuer dargestellt werden. Nach dem Willen des Gesetzgebers [...] sollen unter dem Begriff Menschen auch menschenähnliche Wesen verstanden werden, wie sie in den Videofilmen als ›Zombies‹ [...] vorkommen.« Das Landgericht München bewertete den Film also nicht als Fiktion, sondern als eine Art Dokumentarfilm. Der Richter betonte daher in seinem Urteil: »Der Film stellt reale Personen und reale Handlungen dar; die Darstellung von Gewalttätigkeiten ist nicht ins Groteske verfremdet.« Zwar widerspricht sich das Landgericht hier selbst, denn es gesteht dem Film einige Absätze später durchaus eine »dramaturgisch eingebaute ›Komik‹« zu. Trotzdem ist THE EVIL DEAD aber »keine echte Filmgroteske.« Lassen wir die Frage nach der hier implizierten objektiven Unterscheidung zwischen einer »echten« und einer unechten Filmgroteske außer acht und folgen der Argumentation der Gerichtes weiter, das »im Namen des Volkes« verfügt, dass die Komik dieses Films »nur für die Zuschauer nachvollziehbar [sei], die sich an Gewaltdarstellungen dieser Art ergötzen können.« Daraus folgt, dass der Zuschauer, der hier keine staatstragende Abscheu empfindet, von der Justiz indirekt als pervers stigmatisiert wird. Die Karlsruher Richter argumentieren in ihrer Urteilsfindung gegen diese Normativierung des Sehens, indem sie nach dem Gesamteindruck des Films einräumen, dass ein Betrachter »das Geschehen wegen seiner bizarren Überzeichnung durchaus als lächerlich und grotesk erleben kann.« Karlsruhe stellt hinsichtlich THE EVIL DEAD fest: »Es fehlen Feststellungen, dass der Betrachter zur bejahenden Anteilnahme an den 13 Schreckensszenen angeregt wird.« [26] Im Gegensatz zum Münchner Landgericht betont das Verfassungsgericht: »Gewalttätigkeit in Filmen verletzt für sich genommen die Menschenwürde nicht.« Dieser Grundsatz der obersten Richter entzieht eigentlich dem bis heute praktizierten Missbrauch des §131 den Boden. Und hinsichtlich der Kernfrage, ob gemäß dem Münchner Urteil unter »dem Begriff Menschen auch menschenähnliche Wesen verstanden werden, wie sie in den Videofilmen als ›Zombies‹ [...] vorkommen«, heißt es aus Karlsruhe: »Wenn der Gesetzgeber die filmische Darstellung von Gewalt gegen [...] Zombies hätte unter Strafe stellen wollen, hätte er dies im Wortlaut der Vorschrift zum Ausdruck bringen müssen.« [27] Mit dieser nicht unkomischen Formulierung verweist das Verfassungsgericht die Frage, wie nun die Menschenwürde im Film letztlich zu definieren sei, an die gesetzgebende Instanz zurück – die das Problem an just diesem Punkt wieder aufgriff: Als Folge einer jener zyklisch stattfindenden öffentlichen Erregungen, diesmal ausgelöst durch Robert Steinhäuser, den zwar keine Gewaltvideos mehr, sondern Computerspiele im April 2002 zum Massaker am Gutenberggymnasium in Erfurt inspiriert haben sollen, wurde gut ein Jahr später am 27. 12. 2003 der Gewaltparagraph 131 wie folgt verschärft: „In Absatz 1 werden nach den Wörtern ‚[unmenschliche Gewalttätigkeiten] gegen Menschen’ die Wörter ‚oder menschenähnliche Wesen’ eingefügt.“ (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003, vom 30.12. 2003). Der Wortlaut des Paragraphen verbietet also nun „unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen“ – mit unfreiwilliger Komik verschärft die Vorschrift so die Dichotomie zwischen ‚unmenschlich’ und ‚menschlich’ – es tobt der ewige Kampf zwischen ‚Gut’ und ‚Böse’. Genau wie im Kino, also nun Film ab: THE EVIL DEAD zählt neben THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE (1974; R: Tobe Hooper) und DAWN OF THE DEAD (Zombie; 1979; R: George A. Romero) zweifellos zu den originellsten Splatterfilmen. Das Kinodebüt des damals 23-jährigen Studenten Sam Raimi, 1981 als No-Budget-Produktion entstanden, vermag selbst nach 20 Jahren noch zu faszinieren. Zwei Besonderheiten fallen bei diesem Horror-Kammerspiel besonders ins Auge: Durch seine stilbildenden Kamerafahrten – in dieser Suggestivität vorher nur in Stanley Kubricks THE SHINING (1980) zu sehen – erzeugt der Film eine sehr unheimliche Atmosphäre; die Protagonisten werden beobachtet, aber man weiß nicht, wie und von wem. Durch diese Ungewissheit erzeugt Raimi von Anfang an eine mystische Spannung, die in gewisser Weise untypisch für Splatterfilme ist. Doch durch diese Spannung wird das prägende Motiv der Wiederkehr der »lebenden Toten« bemerkenswert variiert: Eine Gruppe typisch amerikanischer Teenager, die ähnlich wie in THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE aus zwei Pärchen – hier Ashley (Bruce Campbell) und Linda (Betsy Baker); Scotty (Hal Delrich) und Shelly (Theresa Tilly) – und einer weiteren Begleiterin – Cheryl (Ellen Sandweiss) – besteht, die in dieser Konstellation THE EVIL DEAD 14 das »fünfte Rad am Wagen« ist, unternehmen einen Ausflug zu einer tief in der bewaldeten Bergwelt Tennessees gelegenen Blockhütte. Statt des erotischen Abenteuers erwartet sie im Keller der Hütte ein Tonband, auf dem die nüchterne Stimme eines Wissenschaftlers Passagen aus einem »Buch der Toten« zitiert – wodurch die evil dead, die bösen Toten, die Teenager der Reihe nach heimsuchen. Mit Spaten, Schrotflinte und schließlich mit bloßen Händen setzt der zunächst äußerst zögerlich auftretende Antiheld Ashley sich gegen seine früheren Freunde zur Wehr und watet bald knöcheltief im Blut. Der Zugang zum Keller, Topos des Unheimlichen, erweist sich im räumlichen und auch im zeitlichen Sinne als »Abstieg ins Unbewusste«: Durch das Tonband, das Scotty und Ashley zu Tage fördern, erfahren die fünf Zuhörer nicht nur von einer grausigen Geschichte, die sich in der Hütte zugetragen hat – sie erfahren sie am eigenen Leib. Der Forscher berichtet zunächst davon, wie er sich mit seiner Frau in die Hütte zurückgezogen hat, um besagtes »Buch der Toten« zu studieren, das Ashley nun flüchtig durchblättert. Je weiter der Bericht des Forschers auf dem laufenden Tonband voranschreitet, desto mehr steigert Cheryl sich in einen hysterischen Angstanfall, bis sie entnervt das Band abschaltet. Doch Scotty – der sich in seinem Element fühlt und Cheryl mit der imitierten Melodie eines typischen Gruselfilms aufzieht – will mehr wissen und spult vor. Durch sein Zapping überspringt er wichtige Informationen, denn als er das Gerät wieder einschaltet, befinden die Zuhörer sich nicht mehr in einem »Gruselfilm«. Der Wissenschaftler zitiert gerade eine Beschwörungsformel – mit dem (un)beabsichtigten Effekt, dass die Dämonen hier und jetzt gerufen werden. Der eigentliche Spuk beginnt. Zunächst werden die drei Frauen und dann Scotty »besessen« – nicht jedoch Ashley. Was mit ihm geschieht, verrät der Film erst in der letzten Einstellung. Diese Entfesselung des Dämonischen ist nicht nur Effekt der »magischen« Beschwörungsformel allein, sondern auch der scheinbar harmlosen Erzählung des Wissenschaftlers: Der namenlose Forscher hatte sich in die Abgeschiedenheit dieser Waldhütte zurückgezogen, um das »Buch der Toten« zu studieren. Ashley, der sich später alleine und per Ohrhörer mit dem Tonband beschäftigt, erfährt, dass seine Frau von einem Dämon besessen wurde, den der Forscher »unbeabsichtigt« gerufen hatte. Sie versuchte ihren Mann zu töten, und die einzige Möglichkeit, ihrer Herr zu werden, bestand darin, ihren Körper vollständig zu zerstückeln. Genau das werden Scotty und später auch Ashley – gezwungenermaßen – tun. Das Motiv der Zerstückelung – von George A. Romeros NIGHT OF THE LIVING DEAD (Nacht der lebenden Toten; 1968; R: George A. Romero) (»Shoot them in the Head!«) bis hin zur parodistischen Überhöhung der Zerstückelungswut in Peter Jacksons BRAINDEAD der zentrale Topos des Splatterfilms – erscheint als Kehrseite des Motivs des Forschers, der »etwas Bestimmtes« wissen wollte. Was, erfahren wir durch einen Seitenblick auf die frühen Filmen David Cronenbergs, der solche Forscher als mad scientists beschreibt: In THE FLY (Die Fliege; 1986), RABID (1976), THE BROOD (Die 15 Brut; 1979), SCANNERS (1980) und ganz besonders in SHIVERS (Parasitenmörder; 1975) variiert der Kanadier stets das gleiche, dem Schauerroman entlehnte Motiv: Ein genialer Programmierer, Arzt, Psychologe oder Biologe isoliert sich aus der scientific community, um in einer dem Gesetz entzogenen Enklave seine »Erfindung« zu realisieren. Sei dies ein Omnipotenz erzeugender »Plasmapool« wie in THE FLY oder ein das Lustempfinden steigernder Parasit (in SHIVERS) – stets gilt das Forschungsinteresse einer Art transzendentalem Aphrodisiakum. Aus psychoanalytischer Sicht entpuppen sich Cronenbergs mad scientists als pervertierte Vaterfiguren, die das Genießen »jenseits des Lustprinzips« nicht, wie es ihrem symbolischen Mandat entspräche, untersagen, sondern im Gegenteil vermittels eines »verbotenen Wissens« realisieren. [28] Eine Variation dieser väterlichen Hybris, die hier nicht zu Epidemien oder Mutationen, sondern zu dem strukturell ähnlichen Effekt der Besessenheit führt, beschreibt nun Raimi. Sein vermeintlich seriöser Forscher ist ebenso wie die mad scientists bei Cronenberg eine »schwache« Vaterfigur; was er durch sein Studium in der weltabgeschiedenen Hütte suchte, ist ein Wissen um das verlorene Genießen. Paradigmatisch für dieses Genießen sind die wurmartigen Lust-Parasiten in SHIVERS. Aber während der Forscher Rollo Linski (Joe Silver) bei Cronenberg mit seinem Kollegen Roger St. Luc (Paul Hampton) über das abseitige Programm seines hybriden Kollegen gefahrlos reden kann, bewirkt in THE EVIL DEAD bereits der Bote selbst, der die schlechte Nachricht überbringt (die Stimme des Forschers auf dem Band), die unmittelbare Entfesselung des »Bösen«. Spezifisch an dieser »Geisterbeschwörung« ist weniger der Einsatz moderner Medientechnik als vielmehr die augenfällige Parallele zum heiligen Abendmahl: So wie die geweihte Hostie Fleisch und Blut Christi verkörpert, erfahren wir vom Tonband, dass das »Buch der Toten« mit Blut geschrieben und in menschliche Haut eingebunden ist. Film und Kirchenritual ebenso gemeinsam ist die Nebensächlichkeit des eigentlichen Wortsinns: Statt »Dies ist mein Leib« – hoc est corpus meum – verstanden die überwiegenden Nichtlateiner unter den Kirchgängern Hokuspokus. Ähnlich wie bei dieser Volksetymologie des »Zauberspruchs« klärt sich auch die lateinisch klingende Beschwörung in THE EVIL DEAD: Das »Samand Robeesa dar ees heiker dan zee roadza« bedeutet nichts anderes als der verfremdete Hinweis »Sam and Robert are the (hitch)hikers on the road« – Sam und Robert, Regisseur und Produzent, sind jene beiden Gestalten, die zu Beginn des Films auf der Straße winken. Statt auf den Wortsinn kommt es offenbar auf die Funktion der Stimme an: Der ausgesprochene Satz »Dies ist mein Leib« entspricht den Worten Jesu selbst – die in der Bibel nur niedergeschrieben sind. Der Priester vor dem Altar spricht sie jedoch laut aus, so, als spräche Christus selbst. Durch die vom Priester ausgesprochenen Wandlungsworte »Dies ist mein Leib« sind Fleisch und Blut jenes Christus, der vor 2000 Jahren am Kreuz starb, in der geweihten Hostie hier und jetzt unmittelbar 16 gegenwärtig. Der Priester vor dem Altar übernimmt dabei eine ähnliche Funktion wie das Tonband in THE EVIL DEAD. Das Abspielen des Bandes ist ein Äquivalent zum Abendmahl: Der Forscher ist gewissermaßen unmittelbar gegenwärtig. Allerdings führt die Fleischwerdung seines Wortes nicht wie im Abendmahl zur rituellen Kommunion, also zur dosierten oralen Einverleibung jenes göttlichen Vaters, der das Genießen untersagt, sondern zur Inkorporation des bösen Vaters, dem Evil D(e)ad: Einer nach dem anderen werden die Teenager »besessen«, sie kennen kein anderes Ziel mehr, als den noch nicht Besessenen zu überwältigen. Cheryl, als erste vom Dämon heimgesucht, wird von Scotty zunächst in den Keller gesperrt. Danach nehmen die Dämonen von Shelly Besitz, die von Scotty in einem wahren Blutrausch zerstückelt wird – zwecklos, die Leichenteile bewegen sich noch immer. Als nächstes versucht Ashley Linda zu beerdigen, erfolglos – sie kehrt aus dem bereits zugeschütteten Grab wieder. Anschließend attackieren der besessene Scotty und die inzwischen aus dem Keller entkommene Cheryl Ashley so lange, bis dieser das »Buch der Toten« ins Feuer wirft, woraufhin der Spuk beendet scheint. Normalerweise wäre ein Splatterfilm hier zu Ende, doch THE EVIL DEAD verfolgt noch eine Art zweites Motiv, dem man sich mit Seitenblick auf eine Hypothese von Slavoj Žižek nähern kann. In einer seiner ersten Arbeiten greift Žižek einen wesentlichen Zug dieser »lebenden Toten« heraus und stellt eine interessante Hypothese auf: »Unsere These ist, dass diese ›lebenden Toten‹ das verkörpern, was die Psychoanalyse ›Trieb‹ nennt – Trieb im Gegensatz zu Wunsch oder, genauer, zu Begehren; Trieb, der – im Gegensatz zum Begehren und seiner Dialektik – dem trägen, beharrlichen ›Wiederholungszwang‹ unterworfen ist.« [29] Wenn Linda in THE EVIL DEAD aus dem Grab steigt, um ihren früheren Freund Ashley selbst dann noch sexuell zu attackieren, als er ihr schon den Kopf abgeschlagen hat, so scheint diese Szene Žižeks These ebenso zu bestätigen wie jene andere, in der Cheryl trotz ihrer Angst allein in den Wald geht: Unweit der Hütte werden Äste und Zweige plötzlich lebendig, umschlingen sie, reißen ihr die Kleider vom Leib und werfen sie nieder; zuletzt wird Cheryl – die, vergessen wir es nicht, als einzige der jungen Frauen keinen Sexualpartner hat – von einem der Äste penetriert. Als Wirkung dieser Penetration wird Cheryl jedoch nicht schwanger, sondern als erste der fünf »vom Vater« besessen. Dabei bildet die Penetration durch den Ast den Ausgangspunkt einer signifikanten Kette: als nächstes bohrt die Besessene ihren Bleistift in den Fuß Lindas und gibt damit den Dämon weiter. Später wird Ashley diese penetrierende Geste aufgreifen, indem er Scotty mit beiden Daumen die Augen zerquetscht. Auf unsanfte Weise ist damit das Motiv des Sehens angesprochen, das – wie im Hinblick auf die stilbildenden, suggestiv-schwebenden Kamerafahrten bereits angedeutet – als zweites Grundthema den Film strukturiert. Das visuelle Thema ist ebenso mit dem Motiv des Phallus und des abwesenden Vaters verknüpft: So kehrt jener phallische Ast, der Cheryl penetrierte, symbolisch wieder in Gestalt eines 17 Baumstammes. Denn just auf dem Höhepunkt ihrer hysterischen Angst, als Cheryl laut schreiend fordert, das Tonband mit dem Zauberspruch abzuschalten, durchstößt ein Baumstamm das Hüttenfenster. Es ergibt sich somit eine metonymische Reihung zwischen den zerquetschten Augen, dem eingedrückten Fenster und dem weiblichen Genital. Das »Eindringen« des gleichsam materialisierten Blicks in die Hütte, der auch als subjektloser Beobachterblick gegenwärtig ist, erweist sich als thematische Variation von Cheryls Penetration im Wald. Impliziert ist damit das Thema, das dem Film seine eigentliche Struktur gibt: Die ungewöhnlichen Perspektiven, aus denen die Protagonisten förmlich angeblickt werden, ziehen sich als gestalterisches Mittel bis hin zur letzten Einstellung. Ganz zu Beginn schon wird an der Art, wie die bewegliche Kamera über den Waldboden oder einen kleinen See streicht, deutlich, dass es hier nicht nur um ein rein rezeptives Beobachten geht, sondern um etwas Paradoxes wie einen aktiv ins Geschehen eingreifenden Blick. Es entsteht der irritierende Eindruck, als gehörte der Blick zu einem unsichtbaren Beobachter. Doch im Gegensatz etwa zur Unsichtbarkeit des außerirdischen Jägers in John McTiernans PREDATOR (1987), der seine Beute bespäht – und dessen Blick dabei durch farbliche Verfremdungen gekennzeichnet ist – erweist sich der Kamerablick in THE EVIL DEAD als eine nicht zu fassende Präsenz, die unheimliche Anwesenheit einer Abwesenheit, die sich gerade nicht in der konkreten Gestalt eines Jägers oder eines Monsters materialisieren wird. Schon ganz zu Anfang, wenn dieser Blick das sich auf einer Bergstraße nähernde Auto ins Visier nimmt, zeichnet sich ab, dass er in die Geschicke der fünf im Wagen sitzenden Protagonisten eingreifen wird. Auf dem Weg zu jener abgelegenen Waldhütte haben die Teenager sich offenbar verfahren. Mit Hilfe einer Landkarte des Gebiets versucht Ashley sich zu orientieren, doch in dem Moment, als er ihren Standort ausgemacht zu haben glaubt und mit dem Finger auf der Karte fixiert, macht sich das Lenkrad selbständig, und nur mit Mühe kann Scotty den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lastwagen verhindern: Der unheimliche Kamerablick und die Zeigegeste, die einen Beinahe-Unfall verursacht, deuten an, dass der Ort, zu dem die fünf unterwegs sind, aus der symbolisch repräsentierten Welt, wie sie auf der Landkarte abgebildet ist, herausfällt: Erst am Ende wird der Zuschauer ahnen, dass die implizierte Unmöglichkeit des Ortes daher rührt, dass Ashley bereits dort ist beziehungsweise erwartet wird. Das Gefühl, die fünf Teenager würden von einer »unsichtbaren Präsenz« beobachtet, wird in der Folge durch die Wahl der Blickperspektiven sukzessive verstärkt. Als Ashley bei der Ankunft die Hütte aufschließt, wechselt die Kameraposition, so dass der Eindruck entsteht, das Innere des düsteren Raumes selbst würde ihn beobachten. Derselbe Eindruck entsteht kurze Zeit später, nachdem die Kellerluke von alleine aufklappt, worauf die sich über die finstere Öffnung Beugenden gewissermaßen vom Dunkel des Kellers selbst angeblickt werden. – Diesen Effekt, bei 18 dem das Subjekt von einem Punkt aus angeblickt wird, der in Bezug auf diesen Blick eigentlich »unmöglich« ist, hat Hitchcock unter anderem in PSYCHO (1960) und THE BIRDS (Die Vögel; 1963) ausgiebig eingesetzt. [30] Doch Raimi setzt diesen »unmöglichen Blick« nicht nur als Effekt ein, sondern als stetig variiertes Motiv, das die Handlung unmerklich vorantreibt: Als die fünf Ausflügler sich nach dem Abendessen auf ihre Zimmer zurückziehen, entsteht der Eindruck, als gehörte der Kamerablick zu einem Voyeur, der um die Hütte streicht, um die Teenager beim Entkleiden zu beobachten. Der dazu gehörige Toneffekt unterstreicht die Assoziation, dass der Blick zu etwas aus der »normalen« Welt Herausgelöstem gehört. In zwei späteren Szenen wird dieser merkwürdige Blick den Dämonen zugeordnet, also dem lebenden Tod: Als Ashley in der Beerdigungsszene seine besessene Freundin bestatten will, blickt die Tote ihn so aus dem Loch heraus an, dass der Eindruck entsteht, das Grab selbst würde ihn ansehen. Noch deutlicher ist der unheimliche Blick in der Perspektive des Dämons lokalisiert, als die besessene Cheryl im Keller der Hütte eingesperrt ist, von wo aus sie ihre früheren Freunde durch den Spalt der Kellerluke beobachtet. Auch die einzige scheinbar romantische Liebesszene des Films ist vom Thema des Blicks dominiert: Ashley stellt sich schlafend und platziert eine kleine Schachtel als Geschenk so auf seinem Knie, dass sie den neugierigen, mehrmals in Großaufnahme gezeigten Blick Lindas erregt. Das Kästchen enthält jenen lupenförmigen Anhänger, der den Film als multifunktionales Motiv durchzieht. So ist es dieser Anhänger, durch dessen Anblick allein Ashley später davor zurückschrecken wird, Linda zu zerstückeln. Er wird sie (erfolglos) begraben – und als er dabei seinen Anhänger verliert und nach ihm greift, kehrt dadurch Linda aus dem Grab wieder. Zu guter Letzt wird Ashley mit diesem Anhänger auch das »Buch der Toten« ins Feuer werfen. Es handelt sich also um ein extrem überdeterminiertes Objekt, das Ashley außerdem mehrmals aus der Hosentasche hervorholt. Betrachten wir das Blickspiel hinsichtlich dieses Anhängers, so scheint er eine Verschiebung des Phallus zu sein. Da er von seiner Form her auch an ein Auge erinnert, impliziert der Anhänger, mit dem Linda später vor den Spiegel tritt, auf vielfache Weise das Thema des Blicks. Wir sind also darauf vorbereitet, dass dieses »phallische Objekt« auch in der Liebesszene eine besondere Funktion erfüllt: Heimlich betrachtet Ashley Lindas Blick, der für ihn interessant ist, solange sie die Schachtel fixiert. Linda befindet sich hier in der Position des »Spiegel-anderen«, das heißt in ihrem Blick sucht Ashley ihr Begehren nach dem Phallus. Ashley ist also in der Position eines Voyeurs, über den Lacan sagt: »Er sucht nicht, wie man sagt, den Phallus – sondern justament dessen Absenz.« [31] Da es aber sein eigener Phallus ist, den er, als Verborgener, ihrem Blick darbietet, scheint Ashley gleichzeitig in einer exhibitionistischen Position zu sein. Die Klinik der Psychoanalyse hat gezeigt, dass der Exhibitionist durch seine »Darbietung« auf nichts anderes abzielt, als jene entsetzte Wirkung in den Augen des anderen zu 19 sehen, durch die sein Begehren gestützt wird: »Die Technik des Aktes des Exhibierens besteht für das Subjekt darin, zu zeigen, was es hat, insofern als der andere es gerade nicht hat.« Der Exhibitionist versucht »dem anderen das zu enthüllen, von dem diesem unterstellt wird, er habe es nicht, und ihn zugleich in die Scham darüber zu stürzen, was ihm mangelt.« [32] Durch den Kurzschluss zwischen der exhibitionistischen und der voyeuristischen Position scheint Ashley in einer ähnlich skurrilen Situation wie Igor (Marty Feldman), der in YOUNG FRANKENSTEIN (Frankenstein Junior; 1974; R: Mel Brooks) ein Fenster einschlägt, um eine Tür zu öffnen, worauf er vor einer Hand erschrickt, um erst im zweiten Moment zu bemerken, dass es seine eigene ist. Nur geht es in THE EVIL DEAD nicht um eine Hand, sondern um die unmögliche Wiederkehr des eigenen Blicks als fremdem. So würde sich die Suche nach dem Entsetzen im Auge des Opfers des Exhibitionisten spiegelsymmetrisch gegen Ashley selbst wenden. Vermittelt durch Lindas Blick, ist es der »Blick« des eigenen Phallus, dem Ashley in diesem Spiel einerseits ausweicht, den er aber gleichzeitig wie der Voyeur als abwesendes Objekt sucht. Das Blickspiel erweist sich so als ein Paradigma, das sich in der filmischen Struktur als ganzer spiegelt. Um zu sehen, inwiefern die erste und die letzte Szene aus symmetrischen Kamerafahrten bestehen, lohnt sich ein Seitenblick auf einen anderen Film, der die tödliche Symmetrie zwischen Voyeurismus und Exhibitionismus auf seine Weise durchdekliniert, Michael Powells PEEPING TOM (Augen der Angst; 1960): Als work in progress dreht Serienmörder Mark Lewis (Karlheinz Böhm) einen Dokumentarfilm, indem er Frauen filmt, während er sie tötet. Er ersticht sie mit einem Stilett, das eine phallische Verlängerung seines Kamerastativs darstellt. Die Akribie dieser Konstruktion des »phallischen Blicks« gipfelt darin, dass die Frauen vermittels eines an der Kamera angebrachten Spiegels im Augenblick ihres gefilmten Todes ihren eigenen angsterfüllten Blick widergespiegelt bekommen. Mark Lewis will den Blick, der den Tod gewärtigt, filmisch konservieren, um ihn hinterher auf der Leinwand als verfügbares Objekt zu genießen. Doch genau diese Konstruktion erweist sich als phantasmatisch, weil sie um einen Denkfehler herum organisiert ist: Um welchen, erfährt Mark erst, als er den unmöglichen Zirkel auf sich selbst zurückwendet. Was Mark Lewis eigentlich zu sehen begehrte, als er die Frauen tötete, erblickt er just in jenem Moment, in dem er sich selbst vor laufender Kamera in die Position der Frauen begibt. Es spricht einiges dafür, dass Ashley am Ende von THE EVIL DEAD sich in einer ähnlichen Position befindet wie Mark Lewis: Mit dem Unterschied, dass er gleichzeitig in der Position des filmenden und des gefilmten Mark Lewis ist (einmal steht Ashley sogar vor einer Filmleinwand voller Blut). Wie bereits entwickelt, werden zu Beginn die fünf Teenager im Auto von der subjektlosen Präsenz eines unmöglichen Kamerablicks beobachtet. Dabei sehen wir 20 flüchtig den »toten Blick« der Scheinwerfer eines im Sumpf steckendes Autos – desselben Auto, das sich soeben erst der Hütte nähert. Dieser paradoxe Zirkel schließt sich in der letzten Szene des Films. Vom finalen Kampf mit den Dämonen erschöpft, ist Ashley ins Freie getreten und steht mit dem Rücken zum Hütteneingang. Ein Schnitt zeigt uns, wie der »böse« Blick ihn aus dem Wald heraus zunächst beobachtet, um sich dann in immer schneller werdender Fahrt auf ihn zu zu bewegen. Dabei nimmt er den Weg durch die Hütte, wodurch wir die beiden augenförmigen Löcher in der Hüttentür sehen. Als sich die Tür vor dem rasenden Blick von selbst öffnet, fährt Ashley herum, so dass wir indirekt sehen, was Ashley jetzt voller Entsetzen sieh, bevor der Film mit einer Schwarzblende endet: es ist nichts anderes als sein eigener Blick. Auf fatale Weise vollzieht sich so die Selbstbegegnung, die in einer früheren Szene noch gescheitert war, als Ashley sein Spiegelbild mit Händen zu greifen versuchte, es dadurch jedoch – als der Spiegel sich wie im Narziss-Mythos als Wasserfläche entpuppt – zerstörte. Das Motiv der spiegelsymmetrischen Selbstzerstörung ist in Literatur und Film verbreitet. Ausgehend von DER STUDENT VON PRAG (1913; R: Hanns Heinz Ewers, Stellan Rye) hat Otto Rank in einer umfangreichen Studie aufgezeigt, inwiefern das Motiv des »unheimlichen Doppelgängers« bei Dostojewski, Wilde, Poe, Hofmann, Paul, Stevenson, Maupassant etc. stets »um ein vom Ich losgelöstes und selbständig gewordenes Ebenbild (Schatten, Spiegelbild, Porträt)« [33] kreist. Der unter Primitiven verbreitete Glaube, der Fotograf würde ihnen mit dem Bild auch die Seele rauben – der darauf beruht, dass die »Seele ein Analogon zum Bild des Körpers darstellt« [34] –, bildet die Grundlage für die ursprünglich aggressive Beziehung zum Spiegelbild, die in Ovids Narziss-Mythos erst nachträglich durch das Motiv der sprichwörtlich gewordenen Eigenliebe überformt wurde. Geister, Elfen, Dämonen, Gespenster, Zauberer und Vampire haben kein Spiegelbild, weil »sie ursprünglich selbst Schatten d.i. Seelen sind« [35]. Der Dämon ist das autonome Spiegelbild. Das unbewusste Wissen darum, dass der andere Ich ist, es aber »nur einen geben« kann, motiviert eine mörderische Ausschlussbeziehung, erzählerisches Motiv aller Doppelgängergeschichten. Das Besondere an THE EVIL DEAD ist nun, dass der Film die zwei Aspekte des Doppelgängermotivs zusammenbringt: Das (Körper-)Bild und den Blick des Bildes, der auf das Ich zurückfällt. Die slapstickhaft überzeichneten »lebenden Toten« erfüllen zunächst die Funktion, Ashleys Doppelgänger zu sein. Die im Splatterfilm variierte Notwendigkeit, die lebenden Toten möglichst vollständig zu zerstückeln, entspräche somit einer logischen Umkehrung jener einheitsstiftenden Funktion des Spiegelbildes für die Körperimago, auf die Lacan in seinem vielzitierten Aufsatz »Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion« hingewiesen hat. Insofern könnte man den Splatterfilm als Subversion der autonom gewordenen Film-Doppelgänger bezeichnen, als (lustvolle) Destrukturierung der restriktiven Körperimago des vorwiegend US-amerikanischen Mainstream--Films: Splatter als logische Kehrseite zur Schönheitschirurgie. 21 Ist in THE EVIL DEAD diese Arbeit der Zerstückelung vollbracht, so ergeht es Ashley ähnlich wie dem Erzähler aus Maupassants Kurzgeschichte Le Horla [36]. Wie in Raimis Film gibt es hier einen unsichtbaren, nicht materiellen Verfolger, dessen quälenden Blicken der Erzähler sich verzweifelt zu entziehen versucht. So beschreibt er, wie er »ihn« schließlich durch einen Trick in ein Haus einsperrt, in der Hoffnung ihn zu verbrennen. Als dies misslingt, und er nur seine Dienerschaft grausam umbringt, weiß er: »Dann muss ich mich töten«. Auch Ashley ist, nachdem die Dämonen im Zeitraffer verwest sind, in dieser fatalen Situation – mit dem Unterschied, dass THE EVIL DEAD zum Teil bereits aus der Perspektive des (unsichtbaren) Doppelgängers gedreht ist. Der Zuschauer und Ashley wissen dies nur noch nicht. Rückblickend wird klar, warum Ashley ganz zu Beginn, als er den Punkt seiner Anwesenheit auf der Karte fixiert, fast einen Unfall verursacht: Der Film wehrt sich gewissermaßen dagegen, jene Unmöglichkeit darzustellen, in der Ashley seinem eigenen Blick als Objekt begegnet. Das nicht visualisierbare Paradox besteht darin, dass Ashley wie Ödipus sehen will, wie seine herausgerissenen Augen auf der Erde liegen, von wo aus sie auf ihn zurückschauen. Ashley selbst ist ein »lebender Toter«, der erst in der letzten Szene des Films »weiß«, dass er tot ist. Was ihn die ganze Zeit über beobachtet, ist also er selbst in Gestalt des Todes – des evil dead. Seit ungefähr zehn Jahren, genauer gesagt, seit 1994, als der Kölner Privatsender RTL unter öffentlichem Druck aufgefordert wurde, seine gewaltverherrlichende Kinderserie POWER RANGERS [37] abzusetzen, ist die Gewaltdebatte zwar nicht ganz verstummt. Aber sie hat sich erneut verlagert: und zwar wiederum nach dem von Johanne Noltenius 1958 vorhergesagten Paradigma. So wird der Gewaltfilm spätestens mit Michael Moores Oscar prämiertem Dokumentarfilm indirekt rehabilitiert: »BOWLING FOR COLUMBINE räumt mit dem Vorurteil auf, dass die Schießwütigkeit auf das Konto von Medien, Filmemachern [...] gehe«, meldet im November 2002 das 3SatMagazin Kulturzeit. Unterdessen hat sich die Besorgnis nämlich auf neue Medien, nämlich zunächst auf Internetpornographie und schließlich auf gewalttätige Computerspiele verlagert. Als im April 2002 der suspendierte Schüler Robert Steinhäuser in einem Erfurter Gymnasium mit automatischen Waffen ein Blutbad anrichtete, hatte er zuvor – zumindest wenn wir der FAZ glauben – das Computerspiel »Half Life: Counterstrike« als »Trainingssoftware« benutzt. Same Player shoots again. Anmerkungen 1 Eine frühere Fassung dieses Textes erschien in: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH (Hg.), Florian Rötzer (Red.): Das Böse: jenseits von Absichten und Tätern oder: ist der Teufel ins System ausgewandert? Göttingen 1995, S. 290-327; sowie in: Helmut Monkenbusch (Hg.): Fernsehen. Medien Macht und Märkte. Reinbek 1994, S. 226-240. Eine stark gekürzte Fassung des vorliegenden 22 Textes erschien zur Tagung Bodies that Splatter an der Akademie der Künste in Berlin in: die tageszeitung, 24.4.2003. 2 Schaut man sich die einzelnen Titel an – ZOMBI HOLOCAUST (Zombies unter Kannibalen; 1980; R: Marino Girolami), MOTHER’S DAY (Muttertag; 1980; R: Charles Kaufman), ORINOCO PRIGIONIERE DEL SESSO (Foltercamp der Liebeshexen; 1980; R: Edoardo Mulargia), APOCALYPSE DOMANI (Asphalt-Kannibalen; 1980; R: Antonio Margheriti) und ROSSO SANGUE (Absurd; 1982; R: Joe D’Amato) – so wird ein gewisser »Sachverstand« der Spiegel-Autoren deutlich. Es handelt sich keineswegs um einen willkürlichen Griff ins Videoregal; ausgewählt wurden sehr gezielt Filme aus dem SubSub-Genre des italienischen Splatterfilms, der selbst unter den harten Horrorfilmen eine Ausnahme bildet (über die gesondert zu sprechen wäre). Fakt ist jedenfalls, dass besagtes Sub-Sub-Genre kaum mehr als eine Handvoll Filme umfasst. 3 In einer Diskussionssendung, die Premiere auf den öffentlichen Druck hin nach der Erstausstrahlung des Films am 10.12.1993 sendete, bekannte sich der Augsburger Pädagoge Werner Glogauer, unermüdlicher Verfechter der These, dass jedes zehnte Verbrechen, das Jugendliche begehen, auf das Konto der Medien geht, freimütig, er habe den District Court in Liverpool brieflich auf den Zusammenhang zwischen dem Mord und diesem Film hingewiesen. 4 Kopie des Fax liegt dem Autor vor, M.R. 5 Kopie des Fax liegt dem Autor vor, M.R. 6 Spiegel TV vom 28.11.1993. 7 Diese These hat Angela Merkel häufig wiederholt, u.a. in der TV-Sendung RTL Explosiv: Der heiße Stuhl vom 15.9.1992. 8 Jo Groebel: Gewaltprofil des deutschen Fernsehprogramms: eine Analyse des Angebots privater und öffentlich-rechtlicher Sender. Opladen 1993. 9 Ebenda, S. 62. 10 Ebenda, S. 48. 11 Ebenda, S. 66. 12 Ebenda, S. 71 13 Ebenda, S. 73 14 Johanne Noltenius: Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft und das Zensurverbot des Grundgesetzes. Göttingen 1958, S. 110. Lesenswert: Murad Erdemir: Filmzensur und Filmverbot. Eine Untersuchung zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die strafrechtliche Filmkontrolle im Erwachsenenbereich, Marburg 2000 sowie Karel Meirowitz: Gewaltdarstellungen auf Videokassetten. Grundrechtliche Freiheiten und gesetzliche Einschränkungen zum Jugend- und Erwachsenenschutz, Berlin 1993 15 In: Sex, Gewalt und FSK. 22.11.90. 1Plus. 16 Vgl. Friedrich Kittler: Grammophon, Film, Typewriter. Berlin 1986, S. 190. 17 Der Spiegel, Nr. 2/1993, S. 167. 23 18 Vgl. dazu: Kay Hoffmann: Am Ende Video – Video am Ende?, Berlin 1990, S. 204-221. 19 Ebenda, S. 208. 20 Warner, CBS/Fox, CIC, Euro Video [=u.a. MGM/U.A., Disney, Touchstone, Buena Vista und Lorimar], RCA/Columbia. 21 Eine Indizierung wird von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften (BPjS) vorgenommen. Ein indizierter Film ist erst ab 18 Jahren zugänglich. Es darf nicht für ihn geworben werden. 22 Hoffmann, S. 220. 23 In: Der Spiegel, 34/1993. 24 In: Gong, 41/1993. 25 Paragraph 131 StGB »Gewaltdarstellung und Aufstachelung zum Rassenhaß: (1) Wer Schriften (Paragraph 11 Abs. 3), die zum Rassenhaß aufstacheln oder die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrücken oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellen, 1. verbreitet, 2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 3. einer Person unter 18 Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht oder 4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, in den räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes einzuführen oder daraus auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1-3 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk verbreitet. (3) Die Absätze (1) und (2) gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient. [...].« 26 Den rein juristischen Aspekt dieser Debatte über Kunstfreiheit hat der Verfasser ausführlich diskutiert auf der Fachtagung der deutschen Sektion der internationalen Juristen-Kommission vom 3. bis 5.9.1993 im Kloster Banz. Vgl: Peter Lerche: Kunst und Recht im In- und Ausland. Heidelberg 1994, S. VI. 27 BVerfG-Urteil vom 20.10.1992. Auch in: Norbert Stresau (Hg.): Enzyklopädie des phantastischen Films. Weitingen, 1986 ff. (Loseblattausgabe). 28 Vgl. zu dieser Hypothese Manfred Riepe: Bildgeschwüre. Körper und Fremdkörper im Kino David Cronenbergs. Psychoanalytische Filmlektüren nach Freud und Lacan. Bielefeld 2002. 29 Slavoj Žižek: Liebe dein Symptom wie dich selbst. Berlin 1991, S. 102. 30 Ebenda, S. 60. 31 Jacques Lacan: Das Seminar Buch XI. Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Weinheim 19873, S. 191. 32 Jacques Lacan: Le séminaire livre IV. La relation d’objet. Paris 1994, S. 272. 24 33 Otto Rank: Der Doppelgänger. In: Jens Malte Fischer: Psychoanalytische Literaturinterpretationen. Tübingen 1980, S. 104-187. Hier S. 121. 34 Ebenda, S. 160. 35 Ebenda, S. 162. 36 Guy de Maupassant: Der Horla. In: Ders.: Der Horla und andere grausame Geschichten. Bergisch Gladbach 1982, S. 161-204. 37 Vgl: Manfred Riepe: Kinder des Zorns. In: die tageszeitung, 28.1. 1995. 25 -- ------------------------------------------------------- Bildbeschreibungen nach der DVD Tanz der Teufel, Version „ab 18 Jahre“. Die Zeitangaben erfolgen nach dem Echtzeit-Zählwerk des DVD Players 1) Nach dem Titel „The Evil Dead“, ca 30 Sekunden: Das im Sumpf halb versunkene Auto bzw. dessen Scheinwerfer sollen zu sehen sein. 2) Etwa 2 Minuten 17: Die beiden Tramper am Straßenrand: Bildunterschrift: Sam amd Robert are the Hitchhikers on the Road – als „zauberspruch“ aus dem Text einfügen 3) Etwa 5.36: Scotty wird vom Inneren der Hütte „angeblickt“ 4) etwa 11.00: Ashley wird vom Dunkel des Kellers „angeblickt“. 5)etwa 14.58: Das „Buch des Totes“ bildet Augen ab; es „blickt“ den betrachter an. 6) etwa 15.32: Das „Buch des Todes“ stellt einen unheimlichen Blick dar. 7) etwa 16.00: Das Tonband „erzählt“. 8) ab 19.22: Die Serie der verfehlten Blicke zwischen Ashley und Linda. 9) wtwa 25:28: Cheryl wird von einem Ast penetriert. 10) etwa 34.00: Aus Cheryl, die vor dem Fenster steht, und sich, während deie anderen Karten spielen, blickt der Dämon. 11) Etwa 35.13: Die besessene Cheryl bohrt ihren Bleistift in Lindas Fuß. 12) Etwa 37.18: Der Dämon in Cheryl beobachtet Scotty durch den Spalt der Kellerluke. 13) Etwa 45.28: Der zerstückelte Körper und die Axt. 14) Etwa 57.00: Linda als Dämon. 15) Etwa 59.20: Ashley versucht Linda zu beerdigen. 16) Etwa 1.02.50: Ashley wird von Lindas Torso „vergewaltigt“. 17) Etwa 1.06.05: Das Blut läuft aus den Steckdosen. 18) 1.10.03: Ashley verfehlt sein Spiegelbild. 19) 1.12.46: Ashley drückt dem Dämon die Augen ein. 26 20) Ab 1.15.00: Eine Serie des Zerfalls des Dämons herstellen. 21) 1.17.40 Das blutverschmierte Gesicht Ashleys. 22) Etwa 1.19.29 Ashley entsetzter Blick, als die Kamera auf ihn zurast. 27





![Teilnahmebedingungen: § 1 Grundlagen [1] Veranstalter der Dirty](http://s1.studylibde.com/store/data/001632638_1-5fe31056fb2a023ca25ae834fd8fbeca-300x300.png)