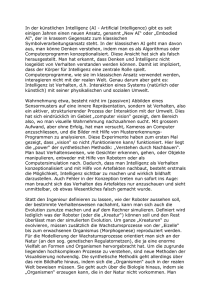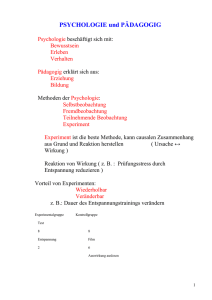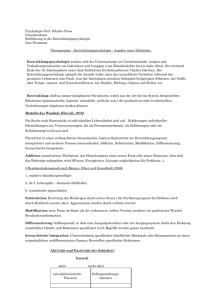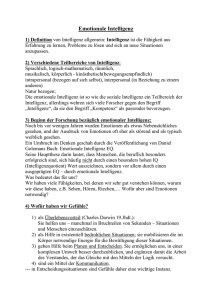Diff - stinfwww
Werbung

DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE Skript zur Vorlesung 0. Was ist Differentielle Psychologie? Gegenstand: Differenzen zwischen Menschen (interindividuelle Variabilität) Allgemeine : untersucht, was auf alle Menschen zutrifft je weiter in Evolution, desto größer interindividuelle Unterschiede Regenwürmer unterscheiden sich kaum Affen sehr (Köhler: Experimente nicht mit allen Affen möglich) selbst Paramecien unterscheiden sich schon; verteilt nach NV (vgl. Skript S. 1) Aufgaben der Differentiellen Psychologie: Beschreibungssystem zur Feststellung interindividueller Varianzen (Stichwort Sedimentationshypothese) theoretische Erklärung der interindividuellen Varianz Untersuchung impliziter (subjektiver) Persönlichkeitstheorien Was will die Differentielle Psychologie leisten? Untersuchung von Begriffen aus der Alltagssprache Bezugssystem für psychologische Eigenschaften und Sachverhalte (meist statistisch formuliert) explizite Persönlichkeitstheorien Beschränkung auf Wahrscheinlichkeitsaussagen (nicht auf Individuen, sondern auf statistische Populationen bezogen) Vorhersage eigenen und fremden Verhaltens, je nach Persönlichkeitseigenschaft Kriterien für die Nützlichkeit einer Theorie (nach Sander): Klarheit und Verständlichkeit in der Darstellung Fruchtbarkeit für die Forschung Sparsamkeit im Begriffsapparat und den Erklärungsprinzipien Empfehlungen für sinnvolles Handeln Selbstverständlichkeiten impliziter Persönlichkeitstheorien in Frage stellen (vs. Vorurteile) offen und selbstkorrigierend 1. Gegenstand und Hauptfragestellungen der diff. Psychologie 1.1. Die vier Grundprinzipien der Psychologie und die 4 Perspektiven in Bezug auf den gleichen Gegenstand KLUCKHOHN ET AL. (1953): Verhalten eines Menschen gleicht allgemein: allen Menschen (z. B. Denkfähigkeit, Angsterleben) differentiell: in mancher Hinsicht einigen, aber nicht allen Menschen Aggregatebene (z. B. über- oder unterdurchschnittliche Intelligenz) persönlichkeitspsychologisch: in bestimmter Hinsicht keinem anderen Einzelfallebene (z. B. spezifische Ausprägung der Prüfungsangst) PARS-Modell: Differentielle Perspektive: Variation der Person (P) Entwicklungsperspektive: Variation der Alterszeitpunkte (A) Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 2 Reaktionsperspektive: Variation der Reaktionsklassen (R) Situative Perspektive: Variation der Situationen (S) Die vier Perspektiven lassen sich nun auf drei Verallgemeinerungsebenen einnehmen (ASENDORPF 1991): Einzelfall: eine Person (IP), ein Alterszeitpunkt (IA), eine Reaktionsklasse (IR), eine Situation (IS) Universell: für alle Personen (UP), alle Alterszeitpunkte (UA), alle Reaktionsklassen (UR), alle Situationen (US) Aggregat: von Personen (AP), Alterszeitpunkten (AA), Reaktionsklassen (AR), Situationen (AS) Methodische Zugänge zur Differentiellen Psychologie (STERN 1911, vgl. ASENDORPF 1991, S. 14): ein Merkmal an vielen Individuen untersuchen Variationsforschung zwei oder mehr Merkmale an vielen Individuen untersuchen Korrelationsforschung eine Individualität im Bezug auf viele Merkmale Psychographie (Persönlichkeitsbeschr.) zwei oder mehr Individualitäten im Bezug auf viele Merkmale Komparationsforschung Mangel STERNs: Nichtbeachtung des Zeitfaktors (vgl. Datenwürfel von CATTELL) 1.2. Die 4 Hauptmängel der bisherigen Differentiellen und Persönlichkeitspsychologie mangelhafte Unterscheidung zwischen inter- (traits?) und intraindividueller (states?) Kovariation bisher differentielle Fragestellungen nur von oben entwickelt (durch Korrelationsstudien an Personenaggregaten) Fehlannahme, dass idiographische Forschung (Einzelfallforschung) nicht naturwissenschaftlich (empirisch), sondern nur geisteswissenschaftlich (verstehend) möglich sei Dominanz der Fragebogenforschung und der Alltagspsychologie in der nomothetisch vorgehenden Differentiellen und Persönlichkeitspsychologie Hauptmängel der empirischen (nomothetischen) Forschung: Einseitigkeit der Vpn.-Auswahl (meist Psychologiestudenten) Themenreduktion: Angst, Aggressivität, Leistungsmotivation u. ä.; andere Themen gemieden, z. B. Fähigkeit zu Liebe und Dankbarkeit 78% der Daten stammen aus einer Sitzung (keine Längsschnitte) Beziehung zwischen Vl und Vpn kaum thematisiert Vernachlässigung von Kindern und Alten 1.3. Zur Geschichte der Differentiellen und Persönlichkeitspsychologie 3 Quellen: allgemeine Lebenserfahrung (geisteswissenschaftliche Persönlichkeitspsychologie) Kasuistik: Fallstudien der Mediziner über Patienten biologisch/naturwissenschaftliche Richtung geisteswissenschaftliche Ansätze: Geschichte geht bis in Antike zurück: THEOPHRAST (um 300 v. Chr.): „Charaktere“ (erste Charakterologie überhaupt) PLATON: „Der Staat“ (Mensch soll bestimmte Ämter je nach Fähigkeit übernehmen) im MA wenig Beschäftigung mit Differentieller Psychologie ab 18. Jh.: mit KANT wieder Aufschwung sah keine Notwendigkeit für Empirie Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 3 Definitionen: z. B. „Wagehalsig ist der Leichtsinnige, der sich in Gefahr wagt, weil er sie nicht kennt.“ auch in Kunst Charakterologien: Bsp. Commedia dell’Arte: pfiffiger Diener, dummer Herr geisteswissenschaftliche Charakterologien seit Anfang des 20. Jh. in Tradition von philosophischer und künstlerischer Charakterologie z. B. Schichttheorien sensu Freud unterschiedliche Menschentypen je nach Ausprägung der Schichten L. KLAGES: „Der Geist als Widersacher der Seele“ E. SPRANGER: „Die Lebensformen“ (ökonomischer, religiöser, ästhetischer Mensch, Machtmensch etc.) LERSCH, WELLEK u. a. medizinische Ansätze: praktisch tätige Psychiater psychoanalytische Charakterlehre ADLER, FREUD FROMM: „Haben oder Sein“ RIEMANN: „Grundformen der Angst“ naturwissenschaftliche Ansätze: HIPPOKRATES, GALEN: Säfte, 4 Charaktertypen PAWLOW: glaubte, diese Charaktere bei Hunden wiederzufinden, und übertrug sie auf den Menschen Phrenologie DARWIN: Survival of the fittest Abweichungen wichtig für Überleben der Art MCKEEN CATTELL: Versuch der Entwicklung von Tests zur Untersuchung von Collegestudenten William STERN (1900): „Über die Psychologie der interindividuellen Differenzen“ KRETZSCHMER: Schluß von Körperbau auf Charakter (Konstitutionstypologie) heute: meiste Menschen sind Mischtypen Zuordnung von Charakter zu Krankheiten nur bei 2/3 zutreffend unzureichende empirische Belege 2. Grundbegriffe der differentiellen und Persönlichkeitspsychologie 2.1. Eigenschaftsbegriff / Konstruktbegriff Eigenschaften als Entitäten und Wesenszüge des Menschen existieren unabhängig von Erkenntnisbemühungen vermutliche Ursache: Besonderheiten des Nervensystems; funktionale Organe im Gehirn, die Eigenschaften entsprechen Polemik der Konstruktivisten: „metaphysischer Realismus“ Wahrheit als objektive Realität Idee der Traits (abstrahiert aus einzelnen Verhaltensweisen) Eigenschaften stabil und konsistent Eigenschaften als Konstrukte Eigenschaften sind nur Erfindungen, um menschliches Verhalten ordnen zu können (müssen durchaus nicht Realität widerspiegeln) Beobachtung von Verhaltensweisen Erschließung von Eigenschaften (können nicht direkt bestimmt werden) Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 4 empirisch überprüfbar und damit modifizierbar bzw. verwerfbar typisches Verhalten nur in typischen Situationen im Radikalen Konstruktivismus: Eigenschaften sozial ausgehandelt zwischen Wissenschaftlern (vgl. KUHN: Scientific Community) Bridgman: Operationalismus (Begriffe in Physik definiert durch die Operationen, mit denen man sie messen kann) Eigenschaften werden durch Messinstrumente determiniert Unterteilung: deskriptive Konstrukte: allgemeinere oder speziellere Beschreibungsmerkmale explikative Konstrukte: Verursachung möglicher Unterschiede zwischen Individuen bezüglich der Beschreibungsmerkmale Argumentation: einige Eigenschaften haben sich später als unzutreffend erwiesen, z. B. Phlogiston vgl. Folie 10b (Westmeyer) Unterteilung von Eigenschaften: universelle Begriffe: Allgemeine Psychologie für alle Menschen gültig (z. B. Intelligenz) populationsbezogene Begriffe: nur gültig für eine bestimmte Population individuelle Begriffe: nur gültig für Individuum, als Zusammensetzung persönlicher Verhaltensweisen (vgl. Kelley, Grid-Technik) Gegenmeinung: MISCHEL (1968): Eigenschaften sind unbrauchbare Konstrukte und sollten als Begriff aufgegeben werden sind je nach Situation so unterschiedlich, dass man keine festen Eigenschaften angeben kann Einwand: man muss bei Eigenschaftsmessung aggregieren über viele Situationen und Zufälle beachten (Fensterbeispiel) 2.2. Variablenbegriff stammt aus Mathematik; inzwischen inflationär gebraucht („Variablenpsychologie“) = Klassen von Merkmalen, die nach bestimmten Gesichtspunkten geordnet sind kontinuierlich quantitativ abgestuft (z. B. Intelligenz) oder diskontinuierlich/diskret qualitativ (z. B. Geschlecht) Variablentypen: Reaktionsvariable (z. B. Beantwortung einer Testfrage, Tastendruck) Reiz- oder Situationsvariable (situativer Kontext im Experiment oder alltäglichen Geschehen [z. B. Prüfungszimmer]) Setting: nicht nur einzelner Reiz, sondern gesamter raumzeitlicher Kontext Situation: Konstitution eines Setting mit einer nicht nur in diesem Setting vorfindbaren Leitaktivität Organismische Variable (z. B. Pulsfrequenz) „Objektive“ Außenvariable (z. B. Lebensalter) „Subjektive“ Außenvariable (Urteil eines Außenstehenden über z. B. Erziehungsstil der Eltern) nomothetische vs. idiographische Methodik: nomothetisch: allgemeine Beschreibungskategorien, die für alle Menschen gelten sollen idiographisch: ausgehend von Einmaligkeit und Unvergleichbarkeit des Individuums Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 5 3. Persönlichkeitseigenchaften unter dem Aspekt der Differentiellen und Persönlichkeitspsychologie 3.1. Wie kann man Persönlichkeitsmerkmale beschreiben? Inversionshypothese: extrem aktive Kinder im ersten Lebensjahr sind später eher passiv und vice versa nur zeitlich stabile Abweichungen vom Durchschnitt lassen auf Persönlichkeitseigenschaften schließen Berechnung von Durchschnittsverläufen Probleme: Mittelwerte können durch Extremwerte verfälscht sein Bsp.: Kind hat auf Rohpunkte bezogen immer gleiche Leistung im Test, aber die Population wird immer besser: Punkte im Test durchschnittlicher Entwicklungsverlauf individueller Entwicklungsverlauf differentieller Entwicklungsverlauf 5 10 Alter in Jahren 3.2. Phänomen der großen Verhaltensvariabilität schon bei Kindern riesige Variabilität „Kinderfehler“: Verhaltensauffälligkeiten treten bei Kindern mit signifikanter Häufigkeit auf Untersuchungen in USA bei 4- bis 6-jährigen Kindern: 20% „macht noch ins Bett“ 20% Alpträume etc. einige Unnormalitäten sind „normal“; Probleme nur bei Häufung 3.3. Stabilität von Persönlichkeitsmerkmalen erst wenn Merkmal über längere Zeit stabil: „Eigenschaft“ aber keine völlige Stabilität möglich (sowohl situativ als auch zeitlich) HERAKLIT: Man kann nicht an zwei Tagen in den gleichen Fluss steigen. je situationsbezogener Eigenschaft formuliert, desto stabiler je extremer, desto stabiler Dynamik in Entwicklung bedeutet nicht unbedingt Instabilität (denn Schwankungen über Lebensalter hinweg bestehen auch in Gesamtpopulation) Persönlichkeitsmerkmale immer im interindividuellen Kontext betrachten. Beispiele: Prognose von Körpergröße und Gewicht: mit 2 Jahren: r=.70 für spätere Größe; r=.95 für späteres Gewicht Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 6 in Pubertät Verschlechterung der Prognosequalität aber sonst Prognosequalität ansteigend Korrelation zwischen Messungen der Intelligenz im 2. bis 16. Lebensjahr mit IQ-Messungen im 18. Lebensjahr: Woher kommt diese Stabilität? Genetik: je älter die Menschen, desto größere Bedeutung erhalten die Gene Differenzen stablilisieren sich Exogenisten: Umweltbedingungen stabilisieren sich („einmal im Ghetto, immer im Ghetto“), z. B. korreliert IQ-Änderung mit Erziehungsstil (s. u.), und Erziehungsstil ändert sich nicht IQ stabil LIUNGMAN (1973): Intelligenz hängt von Erziehungsstil ab SCHAIE (1980, 302): über 14 a untersucht: Abhängigkeit Personentyp – IQ je mehr geistige Stimulanz in Umwelt, desto höher IQ-Zuwachs sozial-emotionale Merkmale / Charakter: weniger stabil als Intelligenz (schüchternes Kind kann Spitzenpolitiker werden) Intro- und Extraversion relativ stabil (aber weniger als IQ) Schüchternheit: nach 5 a nur r=.30 Thesen von Psychoanalyse und Behaviorismus, dass Verhalten in früher Kindheit geprägt wird, sind fraglich Möglichkeit der „Risikovorhersage“ (Kriminalitätsneigung etc.) problematisch (Untersuchung von Gluck (?)) aber: Untersuchung von „Risikofaktoren“ wichtig (kann man sowohl für psychische als auch physische Krankheiten feststellen) Kriminalitätsneigung hoch, wenn Eltern kriminell und Adoptivfamilie problematisch 4. Determinanten interindividueller Unterschiede 4.1. Einführung in die Problematik - Extrempositionen und Grundlegendes Alltagspsychologie: reduktionistische Generalisierungen oft alles auf eine Ursache zurückgeführt provokativ endogenistisch: MURRAY & HERRNSTEIN (1993): „The Bell Curve“ Debatte um Reduktion von Förderprogrammen von Konzeption an Interaktion Anlage – Umwelt Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 7 COOPER & ZUBEK (1958): Ratten, die am schnellsten durch ein Labyrinth kamen, wurden gekreuzt; ebenso die langsamsten „dumme“ Ratten machten immer mehr Fehler aber: bei restringenter Umwelt kluge und dumme Ratten gleich schlecht bei idealer Umwelt und gesonderter Zuwendung: Differenzen verkleinern sich bei Menschen hingegen: Differenzen vergrößern sich eher (!) in Literatur oft Prozentangaben über die Anteile von Erbe und Umwelt hoch problematisch! Gene und Umwelt addieren sich nicht einfach, sondern wirken wechselseitig aufeinander ein Verhältnis Anlage – Umwelt bei jeder Eigenschaft anders Blutgruppe: 100% Gene Gewicht: Erbe + Umwelt Verhältnis Anlage – Umwelt bei jedem Individuum anders geistige Behinderung: kann stark genetisch determiniert sein (z. B. PKU), aber bei geeigneter Umwelt (Behandlung durch spezielle Diät) vermieden werden Verhältnis Anlage – Umwelt bei jeder Altersstufe anders je älter, desto stärker Einfluss der Gene Zwillinge werden im Alter immer ähnlicher; Adoptivkinder im jüngeren Alter ihren Adoptiveltern am ähnlichsten empirische Untersuchungen zu diesem Thema immer auf westliche Industrienationen bezogen Prozente beziehen sich immer auf Persönlichkeitsunterschiede zwischen Menschen (populationsbezogene Aussagen), nicht aber auf die Einzelpersönlichkeit Heritabilitätsschätzungen (z. B. Zeitpunkt des Laufenlernens) sind keine Naturkonstanten, sondern gelten nur für bestimmte Populationen; immer Zusammenspiel Genom + Umwelt Heiratssiebung: Partner mit annähernd gleichen Eigenschaften finden sich zusammen (z. B. Partnerwahl nach IQ) nicht aus Erblichkeitsunterschieden in einer Population auf Unterschiede zwischen Populationen schließen transrassige Adoptionsstudien angebracht (z. B. Farbiger mit weißen Eltern) hohe Erblichkeit eines Merkmals bedeutet nicht, dass es sich nicht durch Umwelteinflüsse verändern ließe Flynn-Effekt: über große Zeiträume hinweg große Mittelwertunterschiede im IQ (analog säkularer Akzelleration) aber vermutlich sowohl Anlage- als auch Umwelteinflüsse erbliche Merkmale können sich manchmal erst im fortgeschritteneren Lebensalter manifestieren (z. B. Glatze) Typen der Interaktion und Kovarianz zwischen Anlage- und Umweltfaktoren: Interaktion: verschiedene Genotypen reagieren auf verschiedene Weise auf identische Umwelten Bsp.: Hochbegabte reagieren auf gleichen Kurs mit besseren Noten als „normale“ Kinder Anlage – Umwelt – Kovarianz: verschiedene Genotypen sind unterschiedlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt bzw. suchen sich diese drei Typen der Anlage-Umwelt-Kovarianz nach PLOMIN, DE FRIES und LOEHLIN (1977): (vgl. ASENDORPF 1996, S. 259; AMELANG und BARTUSSEK S. 545) a) passiver Typ: Genomträger selbst nicht beteiligt (Bsp.: intelligente Kinder wachsen in anregender Umwelt auf, weil Eltern aufgrund ihrer eigenen Intelligenz gute Umgebung schaffen) b) reaktiver Typ: soziale Umwelt reagiert auf genetisch bedingte Persönlichkeitseigenschaften (Bsp.: Kinder werden in Abhängigkeit von Intelligenz in verschiedene Schultypen eingewiesen) c) aktiver Typ: Genomträger gestaltet aufgrund seiner Gene seine Umwelt selbst (Bsp.: Menschen suchen sich intelligenzmäßig angemessene Freunde und Lektüre) Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 8 SCARR: Menschen suchen sich Umwelt selbst Hypothese: wirksame Umwelt vorwiegend durch Genotyp bestimmt (aber: Slum-Kinder?) 4.2. Methoden der Erforschung der Anlage-Umwelt-Problematik Biologische Erforschung: Humangenetik aber bis heute nicht gefunden: Gene für psychische Merkmale im Bereich der Normalität dafür: genetische Ursachen für über 1500 Krankheiten Zwillingsstudien: Beginn: Galton IQ-Korrelationen bei Zwillingen: ZZ r=.5 EZ getrennt r=.75 EZ zusammen r=.85 aber Erschwernis des Nachweises des Umweltanteils, da bei der Trennung von EZ auf etwa gleiche familiäre Bedingungen geachtet wird bei Geschwistern: eher geteilte Umweltbedingungen soziale Schicht Qualität der elterlichen Ehe Wohnumgebung eher nicht geteilte Umweltbedingungen Schulunterricht Unfälle, Krankheiten Geschwisterposition soziale Beziehungen des Kindes beide Umweltkonzepte haben unterschiedliche Auswirkungen auf Charakter und IQ Art der Variation der Umweltbedingungen: experimentell bestimmt oder im Nachhinein festgestellt Bsp.: Waisenkinder mit niedrigem IQ aus wenig anregendem Heim zu geistig behinderten Adoptivmüttern gegeben IQ stieg; dann in „normale“ Familien IQ stieg weiter 4.3. Die Anlage-Umwelt-Dialektik und die Variabilität der Individuen Lit.: W. WIESER (1998): „Die Erfindung der Individualität“ Spontanmutationen, Neuschöpfungen, geschlechtliche Fortpflanzung verantwortlich für Variabilität in Population; Ursachen für Individualität Eltern können theoretisch 22*23 Genkombinationen erzeugen Koevolution: Umwelt wird auch im Tierreich von Individuen umgestaltet (z. B. Bildung ökologischer Nischen) Wie wirken Gene auf Verhalten? Gene produzieren Proteine und Transmitter diese wirken auf Verhalten Genwirkungen nicht immer gleich: Reaktionsnormen des Gens (Genpenetranz, -expressivität) Rezessivität Umwelteinflüsse Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 9 genetisch bedingte Vulnerabilität für Störungen gleiche Umweltbedingungen, aber unterschiedliche Entwicklung (z. B. bei Alkoholismus, Neurosen) RUTTER: Menschen, die genetisch hohe Erregbarkeit des NS haben Vulnerabilität für Neurosen, aber Protektionsfaktor für Kriminalität dieselbe genet. Ausstattung sowohl Risiko- als auch Schutzfaktor die meisten Merkmale: polygen (z. B. IQ) THOMAS & CHESS (1956): vier Typen von Neugeborenen unterschieden: 40% einfache Kinder 10% schwierige Kinder (Schreikinder) 15% schwer auftauende Kinder 35% nicht klassifizierbar über viele Jahre hinweg untersucht oft große Abweichungen von Typus bei Geburt Bsp.: Schreikinder mit 3 Jahren oft sehr kreativ und lieb Prognosen für Erwachsenenzeit generell sehr schwierig [Vertretungsvorlesung Beckmann – herausgelassen] 4.4. Spezialprobleme 4.4.1. Geschlechtsunterschiede Patriarchat in Orient und Christentum Frau = verstümmelter Mann (Rippe; Penisneid) Geschlechtsstereotype Mann Erfolg, Intelligenz, Persönlichkeit Frau Liebe, Gemüt aber: eher männliche Säuglinge sterben; Frauen leben länger und sind Hunger, Belastungen und Schmerzen robuster gegenüber Annahmen und Befunde im Leistungsbereich: Annahmen: Sprache: erzeugen, befruchten, erkennen eng zusammenhängend, Erkennen Vorrecht des Mannes Männer überschätzen sich in Intelligenztests, Frauen unterschätzen sich Befunde: keine Mittelwertsunterschiede im IQ zwischen Männern und Frauen Extremwerte eher von Männern besetzt (größere Varianz) deutliche Unterschiede in mathematischen Fähigkeiten, besonders im Hochbegabtenbereich Männer deutlich besser verbale Leistungen bei Frauen deutlich höher häufiger Sprachstörungen bei Jungen Frauen kompensieren Schlaganfälle besser verbales Gedächtnis bei Frauen besser räumliches Vorstellungsvermögen bei Männern besser Schulleistungen: Mädchen besser generell gilt: viel mehr Variabilität innerhalb als zwischen den Geschlechtern Interessenbildung: sehr frühe Unterschiede Mädchen: Sozialbezug Jungen: Technik Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 10 auch mathematisch hochbegabte Mädchen wählen eher geisteswissenschaftliche Fächer Differenzen im Charakter- und Gefühlsbereich: HEYMANS (1957): Annahme: Frauen emotionaler, Männer rationaler Frauen: höhere Ängstlichkeit (zumindest zugegebene) höhere Neurotizismusneigung aber: Mädchen mit großen Brüdern oft aggressiver Männer: höhere physische Aggressivität und motorische Aktivität (Frauen eher verbal aggressiv) Geschlechter im Charakter eher ähnlicher als unähnlicher sog. „geschlechtstypisches Sozialverhalten“ Verhalten von Minderheiten, das zur Beurteilung des Geschlechts herangezogen wird Annahmen über die Determination von Geschlechtsunterschieden: a) Sozialisations- und lernbedingte Annahmen: geschlechtsstereotype Behandlung in Gesellschaft Mädchen erhalten Puppen, jungen technische Spielsachen Schimpansenweibchen in Technik besser (Nüsseknacken) erst nach 10. Lebensjahr Ausdifferenzierung typ. männlicher und weiblicher Eigenschaften b) genetisch bedingte Aktivierungspräferenzen Mädchen eher an Puppen interessiert von Eltern lediglich bestärkt c) hormonelle Einflüsse Kimura: mit wachsendem Testosteronspiegel bei Männern und Frauen steigt Leistungsfähigkeit im räumlichen Vorstellungsvermögen – bis zu Optimumwert, danach Abfall jahreszeitliche Schwankungen: wenn im Frühjahr bei Männern Testosteron niedrig: in Tests schlechter wenn bei Frauen Östrogenspiegel hoch verbal besser Hormone große Bedeutung in Embryonalzeit für Entwicklung des Zwischenhirns (Hypothalamus): Jungen dort mehr Neuronenverbände, weil mehr Testosteron; Homosexuelle weniger, weil weniger Testosteron d) neuropsychologische Hypothesen bei Männern: höheres relatives Gehirngewicht höhere Lateralisierung Planum temporale in linker Hemisphäre stärker ausgeprägt bei Frauen: stärkere bilaterale Orientierung der Sprache Spätentwickler können Tests in räumlichem Vorstellungsvermögen besser lösen; Frauen entwickeln sich generell früher e) chromosomenbedingte Differenzen nach neueren Untersuchungen keine Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 11 f) soziobiologische Erklärungsversuche Geschlechtsdifferenzen biologisch bedingt wegen unterschiedlicher Fortpflanzungsstrategien Männer suchen: Attraktivität, Gesundheit Frauen suchen: sozialen Status, Ehrlichkeit, Treue Männer Jäger besseres räumliches Vermögen Frauen Sammler bessere Feinmotorik Fazit (ASENDORPF): Psychologische Geschlechtsunterschiede beruhen auf einer durch Geschlechtstypisierung bedingten kulturellen Verstärkung genetischer und ökologisch bedingter Geschlechtsunterschiede auf hormoneller, neuronaler und Verhaltensebene. 4.4.2. Geschwisterpositionen ERNST & ANGST (1983): Differenzen sehr gering, nur geringe Signifikanzen nur ein Umweltfaktor von vielen Kinder aus Mehrkinderfamilien oft mehr Sozialstörungen aber wahrscheinlich eher wegen Schichtzugehörigkeit ZAJONC: Untersuchung von 100 000 Rekruten je größer Familie und je später Position des Kindes, desto niedriger IQ aber: liegen Geburten weit auseinander, sind die Jüngeren nicht so schlecht Begründung: confluence-Modell (???) wenn Kinder zu rasch hintereinander geboren werden Überforderung der Mutter Kritik: nie ganze Familien untersucht, sondern nur je ein Kind KUBINGER: direkter Vergleich von 2-, 3- und 4-Kinder-Familien Unterschiede viel schwächer 4.4.3. Rassenunterschiede JENSEN (1985): Weiße 15 IQ-Punkte besser als Schwarze aber: gleiche Differenz bei Unterschieden zwischen Unter- und Oberklasse JENSEN: These, dass Unterschiede genetisch determiniert Sozioökonomisches Niveau konstant gehalten durch $-Einkommen 8 Punkte Unterschied Alternativerklärung: Schwarze andere Lerner: weniger abstrakt, gutes STM anderer Unterricht nötig vgl. auch oben: MURRAY & HERRNSTEIN (1993): „The Bell Curve“ Gegenposition: beruht auf sozialem Umfeld SCARR & WEINBERG: schwarze Adoptivkinder erreichten bei weißen Familien denselben IQ wie weiße Geschwister Ist Jensens $-Einkommen ausreichender Indikator für sozialen Stand? RUSHTON (1995): Überlegenheit der asiatischen Rasse beim g-factor der Intelligen LYNN: ebenso; vor allem bei räumlich-visuellen Fähigkeiten Erklärungen: Anthropologie: längere, schwerere Eiszeit bessere Orientierung nötig (ebenso wie heute Eskimos) vgl. auch TOYNBEE: besonders harte Lebensbedingungen gut für Kulturentwicklung Schriftsprache: Zeichensystem Enzephalationskoeffizient Asiaten haben größeres Gehirn eventuell in linker Hemisphäre extra räumliches Zentrum Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 12 heikles Thema: Gefahr des Rassismus 5. Intelligenz- und Leistungsunterschiede 5.1. Begabung, Fähigkeit und Intelligenz Intelligenzbegriff sehr attraktiv, v. a. in westlicher Leistungsgesellschaft Inflation des Begriffs: soziale, emotionale, Erfolgsintelligenz etc. Was ist Intelligenz? mindestens 60 Definitionen, viele tautologisch Intelligenz Bildung (einerseits hochintelligente Menschen mit schlechter Bildung, andererseits Experten auf einem Gebiet mit durchschnittlicher Bildung) heute: Definition als Konstrukt durch gemessene Operationen Faktoren des EQ nach GOLEMAN (1996): Selbstwahrnehmung von Gefühlen und Gefühlen anderer Dezentrierung / Empathie soziale Kontaktfähigkeit Stimmungsmanagement und emotionale Selbstkontrolle Fähigkeit zur Steuerung schlechter Stimmungen Abreagieren weniger hilfreich als Umattribuierung der Situation Aussprechen mit Ärger-Erzeuger Entspannungs- und Meditationstechnik Fertigwerden mit „Belohnungsaufschub“ Die drei Bestandteile der „Erfolgsintelligenz“ nach STERNBERG (1998): Analytische oder „akademische Intelligenz“ („statische Intelligenz“) formale logische Fähigkeiten und Schulwissen geprüft in traditionellen Intelligenztests und Schulprüfungen Kreative Intelligenz selbständige Problemfindung und originelle Lösung (vgl. Konzepte konvergentes vs. divergentes Denken) geprüft in Kreativitätstests Praktische Intelligenz (Lebensintelligenz) Gedanken in praktische Taten umsetzen ergebnisorientierte, alltägliche Problembewältigung „stilles Wissen“ (tacit knowledge), durch Erfahrung erlangt geprüft in sozialen und praktischen Intelligenztests Begriffe und Definitionen zur Beschreibung der Leistungsseite der Persönlichkeit (Abgrenzungen vom Intelligenzbegriff) Fähigkeit (ability): Die zur Ausführung einer Tätigkeit (Leistung) erforderlichen inneren (psychischen) Bedingungen; in der Lebensgeschichte unter bestimmten Anlagevoraussetzungen erworbene Eigenschaften, die als „verfestigte Systeme verallgemeinerter psychischer Prozesse“ (Hacker 1973) den speziellen Tätigkeitsvollzug steuern. Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 13 Fähigkeiten Allgemeine Bereichsspezifische Fach- und berufsspezifische z. B. zur Abstraktion, sportliche, sprachliche, spezielle technische F., Flexibilität im Denken künstlerische, ... Wahrnehmungsf., spezielle ähneln Intelligenzfaktoren künstlerische F. (z. B. für Malerei) Begabung (talent): Das vor allem genetisch bedingte Insgesamt der Leistungsdispositionen und der leistungsbeeinflussenden Persönlichkeitsfaktoren (z. B. Wissbegier, Ausdauer); Spezialbegabungen beziehen sich wieder auf bestimmte Tätigkeitsbereiche (z. B. Musik, Sprache etc.). Begabung intellektuelle Begabung Intelligenz „außerintellektuelle“ Persönlichkeitseigensch. (z. B. Ausdauer, Wissbegier) Spezialbegabung Musik Sport etc. Hochbegabung korreliert mit Ausdauer Weisberg-These: vorwiegend Charakter erzeugt Genie (Hoch-)Begabungen nach der Theorie der „multiplen Intelligenzen“ von GARDENER (1983) sprachliche Intelligenz logischräumlichmathematische bildhafte Intelligenz Intelligenz = klassische (akademische) Intelligenz körperlichkinästhetische Intelligenz personalesoziale Intelligenz musikalische Intelligenz zu GARDENER „Intelligenzen“ liegen relativ unabhängige kognitive Strukturen zugrunde nimmt keine „allgemeine Intelligenz“ an bisher nur „anekdotische Beweisführung“, nicht empirisch Modell umstritten Fertigkeit (skill): Verfestigte automatisierte Handlungskomponenten, meist auf sensumotorisches Gebiet bezogen, unter geringer Bewusstseinskontrolle, im stereotypen Anforderungsbereich (z. B. Stricken, oder im Beruf), aber auch im kognitiven Bereich (z. B. Multiplizieren). Wissen (knowledge): Individuelle Abbilder von Dingen, Eigenschaften und Relationen der objektiven Realität (innere Repräsentationen) (nach nichtkonstruktivistischer Definition). deklaratives Wissen: Faktenwissen prozedurales Wissen: über Prozesse (z. B. chem. Rkt.) außerdem: verbale vs. ikonische Repräsentationen Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 14 Kompetenz (competence) und Können (achievement): Leistungsniveau eines Menschen in einem bestimmten Tätigkeitsbereich (z. B. Schachspielen, Mathematik), aber auch im sozialen Umganz (= Sozialkompetenz). Bestandteile: Fähigkeiten und Fertigkeiten, Wissen, aber auch nichtkognitive Faktoren Experten-Novizen-Untersuchungen: Wie werden Experten zu dem, was sie sind? spezielle Fähigkeiten haben z. B. beim Schach nicht so großen Einfluss: Großmeister haben kein generell besseres Gedächtnis, nur besseres Gedächtnis für Schachkonfigurationen durch Training Intelligenz als Status und Potenz (Definition): Intelligenz ist der Oberbegriff für die hierarchisch strukturierte Gesamtheit jener allgemeinen geistigen Fähigkeiten (Faktoren, Dimensionen), die das Niveau und die Qualität der Denkprozesse einer Persönlichkeit bestimmen und mit deren Hilfe die für das Handeln wesentlichen Eigenschaften einer Problemsituation in ihren Zusammenhängen erkannt und die Situation gemäß dieser Einsicht entsprechend bestimmten Zielstellungen verändert werden kann. Als Intelligenzdaten werden Informationen bezeichnet, die aus der Analyse der Lebens-, speziell aus der Bildungs- und Lerngeschichte eines Individuums, der aktuellen Schul-, Studien- und Berufsleistungen, aus der Beobachtung bei der Bewältigung von kognitiven Problemstellungen, aus der psychologieschen Exploration und aus Intelligenztests gewonnen werden und Hinweise auf die Höhe (das Niveau) sowie auf die qualitativen Besonderheiten (das Intelligenzprofil bzw. die Intelligenzstruktur) eines Individuums geben. kurz: Intelligenz = logische Denkfähigkeit bei neuen Problemen viel Kritik am klassischen Intelligenzbegriff (z. B. Goleman, s. o.) IQ kann späteren Berufserfolg nur in geringem Maße vorhersagen (v. a. im Dienstleistungsbereich) 5.2. Intelligenzbegriffe unter dem genetischen Aspekt Intelligenzanlage = Intelligenz A bei der Geburt vorhandene, aber heute noch nicht exakt diagnostizierbare Erb- bzw. Anlagebesonderheiten (anatomisch-phsysiologische Besonderheiten; individuell verschieden) Intelligenzstatus = Intelligenz B zum Untersuchungszeitpunkt vorhandene Ausprägung der Intelligenz Prdukt von Anlage und Umwelt feststellbar durch Intelligenzstatustests; Ergebnis = Ausschnitt aus diesem Status = Intelligenz C Intelligenzpotenz = Intelligenz C wichtigster Bestandteil der intellektuellen Lernfähigkeit zum Untersuchungszeitpunkt noch feststellbare Fähigkeit zur Leistungssteigerung unter „leistunsgoptimierenden Untersuchungsbedingungen“ (Feedback, Denkhilfen, Training, Motivierung etc.) kurz: Fähigkeit, Leistung zu verbessern v. a. wichtig bei Kindern in schlechtem Milieu wichtig, weil Intelligenztests v. a. dazu benutzt werden, um zukünftige Leistungen vorauszusagen Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 15 Lernfähigkeit / Intelligenz / Wissen / Kompetenz Motivation (z. B. Anstrengungsbereitschaft) allgemeine / spezifische Umweltbedingungen (z. B. Familie) aktuelle Kompetenz (z. B. Schulleistung) Qualität der Instruktion (z. B. des Unterrichts) Interessen Ergebnis des Wissenserwerbs: Wissens-, Intelligenzstatus allgemeine / spezifische Umweltbedingungen (z. B. Familie) Interessen Prozess des Wissenserwerbs Qualität der Instruktion (Bildungsmaßnahmen) Motivation Intellektuelle Lernfähigkeit (Intelligenzpotenz, Wissenserwerbsfähigkeit) 5.3. Beschreibungsdimensionen für intelligentes Verhalten - Intelligenzmodelle und theorien 5.3.1. Faktoranalytisch orientierte Modelle Faktoranalyse im Intelligenzbereich: Berechnung von Interkorrelationen zwischen verschiedenen Intelligenztests, die alle etwas Unterschiedliches messen meist positive Korrelationen SPEARMAN: 2-Faktoren-Theorie der Intelligenz general factor („geistige Energie“) allgemeine Intelligenz (heute partiell vergleichbar mit mental speed) si: special factors, spezifische Faktoren für jeden Test si haben unterschiedlichen Anteil an g (z. B. Raven-Test: großer Anteil) g-factor Test3 Test1 S1 Test2 S2 S3 Was spricht für den g-factor? gute Schüler überall gute Noten bei geistiger Behinderung jede intellektuelle Fähigkeit gestört; sehr selten hohe mechanische Merkfähigkeit bzw. motorische Fähigkeiten ( Intelligenz) Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 16 Vielseitigkeit von Genies (viele Universalgenies, z. . Leibnitz, Goethe) hohe allgemeine Intelligenz kurze Lernphase für neue Berufswege Was dagegen? Mehrfaktorentheorien (THURSTONE, 40er Jahre): es gibt keine allgemeine Intelligenz lediglich Intelligenzfaktoren, die unterschiedlichst ausgeprägt sein können: primary mental abilities es gibt typische sprachliche und mathematische Begabungen Die Hauptfaktoren der Intelligenz nach THURSTONE (1938): Sprachverständnis (verbal comprehension) (z. B. Lücken im Text sinnvoll ergänzen) Wortflüssigkeit (word fluency) (z. B. Wörter, die mit „re...“ anfangen) Numerischer Faktor (numerical) (4 Grundrechenarten) Intelligenzfaktor oder Fertigkeit? Schlussfolgerndes und regelfindendes Denken (reasoning) (Analogien, Zahlenreihen) Kernfaktor Auffassungsgeschwindigkeit (perceptual speed) (z. B. in Buchstabenfolge alle „n“ durchstreichen) Gedächtnis (memory) Raumvorstellung Probleme: Theorie: Empirie: F1 T1 F2 T2 F 4 T 4 F5 T5 F1 F3 T 3 F3 F2 T 1 T 2 F4 (für jeden Faktor genau ein Test) F 5 (Überlappungen) hierarchische Modelle als Vereinigung von SPEARMAN und THURSTONE VERNON: in Sekundäranalyse Korrelation der Primärfaktoren Hierarchie entsteht g-factor übergeordnete Gruppenfaktoren spezifische Faktoren verbal-numerisch (bildungsbedingt) verbal numer. anschaulich-praktisch ... ... ... ... CATTELL: g-factor in gc und gf unterteilt gc: cristallized intelligence (= „hardware“) bildungs- und wissensabhängig (z. B. Satzergänzungstest) Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 17 gf: fluid intelligence (= „software“) logisches Denken (z. B. Raven) g-factor gc bildungsabhängig gf wissensabhängig logisches Denken (Raven) working memory mental speed Verlauf im Lebensalter: gc: kann bei ständiger geistiger Forderung bis ins 8. Lebensjahrzehnt hinein ansteigen gf: entsprechend Adoleszenz-Maximum-Hypothese; vor allem working memory und mental speed lassen nach, logisches Denken weniger JÄGER: bimodales Intelligenzmodell 2 Modalitäten: Inhalt mit welchen Dingen setze ich mich auseinander? figural-bildhaft verbal numerisch Operationen was fange ich mit diesen Dingen an? Gedächtnis Kreativität Bearbeitungsgeschwindigkeit Verarbeitungskapazität (entspricht reasoning) Bsp. für Umsetzung: BIS (Berliner Intelligenz-Strukturtest, 1998) jede Operation wird in allen drei Inhalten erhoben; Mittelwert = g-factor GUILFORD: Structure-of-Intellect-Modell 120 Faktoren Vorbild: PSE praktisch nicht nutzbar: zu komplexes Modell Kritik an faktoranalytischer Modellbildung: ahistorische Herangehensweise Intelligenz als biologisches Faktum in allen Kulturen und Gesellschaften; in Wirklichkeit ist jeder Test kulturell geprägt mathematische Methode wie Faktoranalyse kann keine Theorie bestätigen, weil sie nur von vorherigen theoretischen Annahmen ausgeht bzw. diese bestätigt keine kulturfreie Intelligenz pragmatisch und theoriefern nur Denkprodukte betrachtet, nicht Denkprozess selbst Leistung hängt aber auch von außerintellektuellen Fähigkeiten ab, z. B. Motivation „kognitive Komplexität“ (SCHRODER & DRIVER) Anzahl der Kategorien, die jemand zur Beurteilung hat; nicht genügend berücksichtigt Hochintellektuelle können durch Aufgaben unterfordert sein überlegen zu lange, denken zu komplex große Inkonstanz der Faktorenstruktur der Intelligenz z. B. bei unterschiedlichem Alter nicht unbedingt berechtigter Kritikpunkt, da sich Intelligenz im Leben ändert zu atomistisch, zu wenig Wechselbeziehungen zwischen den Faktoren betrachtet Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 18 aber in neuerer Literatur: „schiefwinklige Rotationen“, berücksichtigen Abhängigkeiten zwischen den Faktoren auch möglich: Sekundäranalysen, bei denen die Faktoren nachträglich miteinander korreliert werden Kritik an mathematischer Methode der Faktoranalyse selbst FA geht von „statistischem Überindividuum“ aus, aber: man untersucht nur Struktur einer gesamten Stichprobe Zusammenfassung: Intelligenz homogene Fähigkeit, sondern komplexes Phänomen dennoch vermutlich g-factor, der in allen Intelligenzleistungen zum Ausdruck kommt kein allgemeingültiges Strukturmodell der Intelligenz abhängig vom Alter, Modell etc. Intelligenz nicht im Lebenslauf konstant FA liefert nur Klassifikationsmöglichkeiten für einen Gegenstandsbereich, kann Phänomene aber nicht auf ihre Bedingeungen zurückführen vgl. explorative vs. konfirmatorische FA FA trifft nur Aussagen über Denkprodukte, nicht aber Denkprozesse 5.3.2. Denk- und kognitionspsychologische Theorien Kognitiver Korrelateansatz Welche kognitionspsychologischen Prozesse wirken sich wie auf Intelligenz aus? z. B. Rolle des working memory oder der mental speed Kognitiver Komponentenansatz Analyse der kognitiven Komponenten bei der Lösung von Aufgaben Triarchische Intelligenztheorie nach STERNBERG: Kontext-Subtheorie von VYGOTSKY geprägt IQ ist kulturabhängig Zwei-Facetten-Subtheorie Lösung neuer Probleme vs. Automatisierungsprozesse Intelligenz zeigt sich nicht nur in Ersterem, sondern auch in Geschwindigkeit der Automatisierung (z. B. wie schnell man lesen kann und geistige Techniken erwirbt) Komponenten-Subtheorie a) Performanz (Testleistung auf Mikrokomponenten = Denkschritte untersucht) b) Metakognition (Begriff von FLAVELL; Fähigkeit, über eigenes Wissen und Denken nachzudenken) c) Wissenserwerb 5.3.3. Biologisch orientierte Modelle - Basalkomponenten der Intelligenz Was sind biologisch orientierte Intelligenzmodelle? Intelligenz = interindividuell variierende Eigenschaft des ZNS, Info schnell und fehlerfrei zu verarbeiten (JENSEN: = „neuronale Effizienz“) Architektur des menschlichen Geistes (hardware, ZNS) betrachtet Übertragung synaptischer Impulse: mental speed; ist stark angeboren (wodurch ist das belegt???) niedrigere Intelligenz A niedrigere Intelligenz B (wenn Synapsen nicht optimal langsamere Verarbeitung weniger Wissenserwerb) Messung der mental speed: Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 elementary cognitive tasks (ETC): sehr einfache RT-Aufgaben Verarbeitung von Reizen mit EEG untersucht 19 EYSENCK: „wahre Intelligenztests“ Historische Vorläufer F. GALTON: „Erforschung menschilcher Intelligenz“ Sensualismus: je feiner Sinne, desto höher Intelligenz (aus dieser Zeit Begriff „Schwachsinn“) J. MCKEEN CATTELL: wollte mit GALTONschen Schwellentests College-Eignung messen schlug fehl Untersuchungsparadigmen und -ergebnisse der biologischen Intelligenzforschung a) Psychologische und physiologische Paradigmen zur mental speed Psychologische: RT-Versuche HICKsches Gesetz: logarithmischer Anstieg der RT mit steigendem Informationsgehalt der Aufgabe 2 Möglichkeiten 21 1 bit 4 Möglichkeiten 22 2 bit n Möglichkeiten 2n n bit RT Informationsgehalt in bit je kleiner , desto höher Intelligenz NETTLEBECK: Inspektionszeitparadigma z. B.: zwei ungleich lange Strecken kurz präsentiert welche ist länger? Kriterium: bei welcher Zeit werden höchstens noch 3% Fehler gemacht? FAGAN III: schon bei Säuglingen Intelligenz A messen Prognose für Schulzeit looking time für roten / grünen Rhombus und grünes Quadrat gemessen wenn diese für neuen Reiz (Quadrat) länger höhere Intelligenz als Schulanfänger (r=.45) hoch genetisch determiniert keine Rassendifferenzen OSWALD & ROTH: Zahlenverbindungstest verstreute Zahlen 1 bis 90 in Matrix so schnell wie möglich verbinden r=.4 mit Intelligenztests LEHRL et al.: Kurztest Allgemeine Intelligenz (KAI) Annahme, dass Intelligenz 2 Komponenten hat: working memory und mental speed auf 4 Kärtchen 20 verschiedene Buchstaben so schnell wie möglich lesen Kritik: Vpn., die oft lesen bzw. schnell sprechen, sind im Vorteil Physiologische: ERP-Messung; z. B. je eher P3, desto höher IQ einfache Nervenleitfähigkeitsmessung (gemessen am Arm: r.5 mit IQ) Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 20 b) Energetischer Aufwand These: höher Intelligente erreichen gleiches mit weniger Aufwand komplexe Dinge vereinfachen elektrophysiologische und bildgebende Messverfahren Neuroimaging: höhere Intelligenz = geringerer Glucoseverbrauch bei gleicher Leistung EEG-Mapping: höhere Fokussierung bei höherem IQ (weniger Hirnteile aktiviert) c) Psychologische Paradigmen des WM bzw. STM STM: einfacher Speicher (Zahlen merken) WM: Verbindung zwischen Speichern und Verarbeiten (Zahlen rückwärts aufsagen) von Bedeutung für schlussfolgerndes Denken reasoning performance reasoning competence working memory space attention mental speed Untersuchungsmethoden des WM in Bezug auf Intelligenz: STERNBERG-Paradigma: RT hirngeschädigt normal Listenlänge je niedriger Ordinatenabschnitt, desto höher IQ Vierfeldertest POSNER-Paradigma: A A physical identity A a name identity für name identity höhere RT, aber je kleiner RT-Differenz, desto höher IQ Kritik an biologischen Intelligenztheorien Korrelation mit IQ nur wegen Zeitdruck aber: Leistungen verbessern sich nicht dramatisch, wenn mehr Zeit zur Verfügung steht Korrelation nur bei heterogenen Stichproben bei homogenen deutlich niedriger (dennoch vorhanden) biologische Theorie: bottom up psychologische Theorie: top down Reaktionszeit IQ Mental speed g Motivation, Aufmerksamkeit, Lernfähigkeit Reaktionszeit IQ Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 21 nach psychologischem top-down-Modell (rechts) müsste Korrelation RT IQ mit höherer Automatizität sinken, da dann alle Individuen annähernd auf demselben Niveau sind NEUBAUER: Vpn. tagelang mit ECT-Aufgaben traktiert Korrelation änderte sich kaum pro bottom-up Kulturgebundenheit der Ergebnisse: nur in westlicher Leistungsgesellschaft Geschwindigkeit so wichtig wichtig ist nicht, ob man sich 7 oder 9 Einheiten merken kann, sondern wie gut man Chunking beherrscht STM muss dem Aufgabenanspruch angepasst werden Frage: Sind die Basalkomponenten genetisch oder umweltdeterminiert? Heimkinder schneiden in fast allen Tests schlechter ab als Familienkinder (außer: OSWALD & ROTHs Zahlenverbindungstest) pro umweltbedingt auch bei EZ umweltbedingt MILLER (1994): Myelin-Hypothese je mehr Myelin, desto höher IQ (wegen höherer Nervenleitgeschwindigkeit) Myelin abhängig von eiweißreicher Ernährung in der Kindheit 6. Kreativität, Hochbegabung und Expertentum Kreativität: sowohl konvergentes als auch divergentes Denken nötig gemessen mit Kreativitätstests (z. B.: „Was kann man mit einer Büroklammer alles anfangen?“) siehe Folie „Komponentenmodell der Kreativität“ Kritik der vier Hauptannahmen der Kreativitätsforschung nach WEINERT (1991): Kreativität in einzelnen Bereichen lässt sich mit Tests bisher nicht zuverlässig genug voraussagen, um mit diesen eine Personalauswahl begründen zu können. Jemand, der auf einem bestimmten Gebiet kreativ ist, muss nicht unbedingt auf anderen Gebieten auch kreativ sein (insbesondere, wenn jene ein großes Spezialwissen voraussetzen). Kreativitätstrainings erbrachten bisher noch keinen Erfolgsnachweis, obwohl die Teilnehmer oft sehr zufrieden damit sind. Nur Teilnehmer aus bürokratisch-streng geführten Arbeitsgruppen und Menschen mit starker Scheu vor „unkonventionellem Verhalten“ profitieren von Programmen zur „Enthemmung blockierter Kreativitätspotentiale“. Hochbegabung: Triadisches Interdependenzmodell der Hochbegabung nach MÖNKS (1990): Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 Familie 22 Peers Kreativität Intelligenz Aufgabenzuwendung Hochbegabung Schule Expertentum: nur möglich bei Hochbegabung und hoher Kreativität? Nein! entscheidend: angereichertes Spezialwissen Schwellenhypothese: bei wissenschaftlichen Experten zumindest gut durchschnittliche Intelligenz, um dieses Wissen zu erwerben Differenzierungshypothese: innerhalb einer Expertengruppe entscheidet möglicherweise Intelligenz (ist jedoch umstritten) 7. Differentielle Psychologie des Persönlichkeitsbereichs 7.1. Ängstlichkeit als Persönlichkeitseigenschaft 7.1.1. Angst vs. Furcht 20. Jahrhundert: „Jahrhundert der Angst“ in Psychologie ca. 20 000 Publikationen über Angst F. Riemann: „Grundformern der Angst“ Richter: „Umgang mit Angst“ Abgrenzung Furcht Angst: Furcht bezieht sich auf bedrohendes Objekt (z. B. Abgrund, Gewitter) Angst nach KROHNE: wenn man sich dem bedrohenden Objekt nicht durch Flucht oder Angriff entziehen kann frei flottierende Angst: Objekt wird nicht wahrgenommen (v. a. im pathologischen Bereich) Angst hat viele Formen: Sozialangst (Blamage in Öffentlichkeit) Angst vor physischer Verletzung (z. B. beim Zahnarzt) Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes existenzielle Angst (kann auch auf gesamte Menschheit bezogen sein) u. v. a. m. Unterteilung worry vs. emotionality: Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 23 worry = Sorge, Sinken des SWG emotionality = Erleben von körperlicher Erregung bei Angst (z. B. Herzrate, Erregung, Hautleitfähigkeit ; Schweißausbruch, Durchfall vor der Prüfung) Angst kann auch auf andere Individuen bezogen sein, z. B. Mutter um Kind Angst um gesamte Menschheit Def. Angst: „ist ein durch die Erwartung drohenden Übels erzeugtes asthenisches (schaches) Unlustgefühl, das häufig mit dem Erleben der Selbstwertbedrohung verbunden ist.“ Angst vs. Ängstlichkeit: Ängstlichkeit: unterschiedlich ausgeprägte Eigenschaft, Angstzustände zu erleben trait Angst state 7.1.2. Wie entsteht Angst? Psychoanalytische Angsttheorien Folge unterdrückter sexueller Wünsche drängen vom ES ICH; ÜBER-ICH setzt Widerstand entgegen Abwehrmechanismen etc. Lerntheoretische Erklärungen klassisches und operantes Konditionieren (vgl. WATSON & RAYNER 1920: Albert-Exp.), Modelllernen Zwei-Prozess-Theorie (MOWRER 1939 f.): erstes Angstgefühl bei Kindern entsteht durch klassisches Konditionieren später dann instrumentelles Lernen Ausweichen vor angsterzeugenden Dingen Phobien Bsp.: Agoraphobie, weil aus irgendwelchen Gründen irgendwann einmal Angst auf einem großen Platz aufgetreten ist Differenzierungshemmung (PAWLOW): = Futter = elektrischer Schlag Ellipse immer mehr an Kreis angepasst Angst, Aggression (Hunde wussten nicht mehr, ob ausreißen oder hingehen reagierten neurotisch) DOLLARD & MILLER: Angst, wenn man sich nicht zwische Annäherung und Vermeidung entscheiden kann (z. B. Prüfungsangst: man will Schein, aber Versagen wäre sehr unangenehm) Kognitiv orientierte Angsttheorien Angst = Resultat der kognitiven Bewertung einer Situation wird bewusst verursacht vgl. Kopie „ appraisal und coping in der Theorie von LAZARUS“ 7.2. Ängstlichkeit als Konstrukt Gibt es Angst als homogenes Konstrukt? Angst = Sekundärfaktor, der sich aus vielen Primärfaktoren konstituiert (ähnlich wie Intelligenz) ENDLER (60er Jahre): 3 große „Angstgebiete“: soziale Situationen Bewertungsangst, soziale Angst (z. B. Lampenfieber) physische Bedrohung Verletzung, Freiheitsberaubung ungewisse, ambige Situationen vgl. PAWLOWs Exp. mit Kreis und Ellipse Gewöhnen an Angstsituationen: Studie mit Fallschirmspringern Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 24 unerfahrene: höchste Angstwerte Wie lässt sich Angst differenzierter darstellen? Klassifizierung und Differenzierung im Interaktions-Angst-Fragebogen von P. BECKER: Faktor dritter Ordnung Globale Angstneigung Faktoren zweiter Ordnung Faktoren erster Ordnung Angst vor physischen und psychischen Angriffen Angst vor physischer Verletzung Angst vor Erkrankungen oder ärztlichen Behandlungen Angst vor Bewährungssituationen Angst vor Abwertung und Unterlegenheit Angst vor Normüberschreitung Angst vor „Auftritten“ Angst vor Selbstbehauptung Faktor 3. Ordnung (entspricht g-factor) entsteht durch Korrelation 7.3. Messinstrumente für Ängstlichkeit Angst-Indikator Messmethode Spezifika zur Methode Subjektive Maße: Ein-Itemskalen Eigenschaftslisten Fragebogen Subjektive Tests: Fragebögen Verhaltensmäßig-expressive Reaktionen: Mimik Vokalisation, verbale Indikatoren weitere motor. Reaktionen nonverbale Erregung objektive Tests Physiologische Prozesse: Zentralnervöse Parameter Periphere Parameter Neuroendokrine Parameter Immunologische Parameter psychophysiolog. Tests v. a. 2 Komponenten untersucht: emotionality und worry KAT: Kinder-Angst-Test STAI (state-trait-anxiety-inventory) von SPIELBERGER: Wie ist Angst im Moment (state) und im Allgemeinen (trait)? TAI (test-anxiety-inventory) prüfungsfördernde und -hemmende Angst vor allem von CATTELL entwickelt Vp. merkt nicht, was gemessen wird Täuschung unmöglich Hochängstliche lernen bedingten Reflex schneller Äußerungen von Autoritäten zustimmen / ablehnen hoher Aufwand geringe Anwendung Atemfrequez, Blutdruck, Hautleitfähigkeit Anwendung am Polygraph 7.4. Differentialpsychologische Befunde und Gründe für unterschiedliche Angstneigungen Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 25 Tierversuche mit medikamentöser Beeinflussung des limbischen Systems (v. a. Hippocampus) GRAY: unterschiedliche Aktivation des Hippocampus limbisches System tastet Umwelt nach angsterregenden Reizen ab biologische Unterschiede in diesem System begründen unterschiedliche Angstneigung genetische Prädisposition Geschlecht: KAT bis 12. Lebensjahr gleiche Werte, danach ♀ höhere als ♂ aber: vielleicht Neigung der ♀, Angst eher zuzugeben, denn in physiologischen Messungen keine Unterschiede (!) bei Jungen: Ängstlichkeit korreliert mit Schüchternheit; bei Mädchen nicht Unterschichtsangehörige und Minoritäten: höhere Angstwerte Unterschicht: oft autoritäres Erziehungsverhalten aber: auch antiautoritäre Erziehung angsterzeugend, weil Kinder häufig in ambivalenten Situationen Stellung in Geschwisterreihe: Spätgeborene oft höhere Angstwerte, aber Erstgeborene und Einzelkinder höhere Angst vor physischer Verletzung frühe negative Erfahrungen erzeugen Angst, z. B. Misserfolg in Schule Angst vor Mathe fehlendes Urvertrauen (ERIKSON) BOWLBY: Untersuchung zum Bindungsverhalten unsicher-ambivalente Haltung der Mutter vom 12. bis 18. Monat höhere Angstwerte ganzes Leben lang 7.5. Represser und Sensibilisierer als unterschiedliche «Angst-Abwehr-Typen» analytische Angstabwehrstrategien: Angst unterdrücken, vermeiden (Verdrängung) Represser Zuwenden (soviel Infos wie möglich über Angstsituation sammeln) Sensibilisierer Beispiel Prüfungssituation: Sensibilisierer: will alles über die Prüfung wissen, fragt frühere Prüflinge über Prüfer, Ablauf etc. aus Represser: will gar nichts darüber hören ♂ eher Represser ♀ eher Sensibilisierer Wahrnehmungsforschung: tachistoskopische Tests: Wort nennen, sobald erkannt darunter obszöne Wörter, dabei: Represser: RT Sensibilisierer: RT BYRNE: Angst bei Horrorfilm erhoben: Fragebogen: Represser < Sensibilisierer physiologsich: Represser > Sensibilisierer Gesundheitspsychologie: Represser eher infarktgefährdet, Sensibilisierer leben gesundheitsbewusster Represser im Vorteil bei akuten und plötzlichen Belastungen (z. B. Tennis spielen) KROHNE: keine tiefenpsychologischen Strategien, sondern bewusst gewählte, kognitive Represser = „Vermeider“ eher erregungsmotiviert wollen physische Erregung abbauen Sensibilisierer = „Vigilante“ eher unsicherheitsbelastet viele Infos gesucht manche Menschen je nach Situation Represser oder Sensibilisierer, andere nichts von beiden extrem Niedrigängstliche (kann pathologisch sein) Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 26 8. Intraindividuelle Variabilität 8.1. Inter- und intraindividuelle Variabilität - und warum diese jetzt mehr beachtet wird bis in jüngste Vergangenheit: interindividuelle Variabilität stand im Vordergrund Eigenschaftsbegriff: transsituative Konsistenz und zeitliche Stabilität in jeder state-Messung steckt trait-Messung – states haben habituellen Anteil umgekehrt: traits haben Inkonsistenz intraindividuelle Varianz (= Spielbreite einer Eigenschaft) gibt es Menschen mit unterschiedlichen Spielbreiten (Konsistenzneigungen)? GERGEN: postmoderner Persönlichkeitsbegriff Persönlichkeit ändert ständig ihr Verhalten in Abhängigkeit von Situation klinische Psychologie: multiple Persönlichkeit Warum ist die Thematik so modern? Differentielle Psychologie hat erkannt, dass Verhalten hochgradig zeit- bzw. situationsabhängig ist Modifikationsstrategien (z. B. Training von Managern, Lehrern wie kann ich Verhalten ändern) dominieren über Selektionsstrategien (welches Kind an welchen Schultyp). moderne Welt verlangt flexible, wandlungsfähige Menschen; wichtig für Überleben: „modifiability“ Verlust der Identität? Nein: „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.“ Mehrpunktmessungen geeigneter für Differentialdiagnostik als herkömmliche Einpunktmessungen 8.2. Relative (In-)Konsistenz und Kohärenz Konstanz: Absolute Übereinstimmung einer psychologischen Messung bei einem Probanden (oder einer Gruppe) zu verschiedenen Messzeitpunkten Konsistenz: Relative Übereinstimmung bezogen auf Mittelwert und Varianz der Bezugspopulation Korrelation in Gruppe absolute Werte zwar verändert, aber Messabstände bleiben gleich Kohärenz: Stabilität auf dem Niveau des Individuums individuenzentrierte Korrelation Berechnung: i xy 1 (zx z y )2 2 mit z xx s – 1 i 1 (analog r) r = .49 r = .49 Vp1 Vp2 Vp3 Vp4 Messwerte Messwerte Vp1 Vp2 Vp3 Vp4 Vp5 Vp5 1 Zeitpunkt 2 1 Zeitpunkt 2 Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 27 8.3. Formen der intraindividuellen Variabilität (IV) Erhebungsmethodisch bedingte IV Unschärferelation: Methode bestimmt Ergebnis Differenzen (zwischen): Selbst- und Fremdbeurteilungen „Durchschnittsverhaltensbeurteilungen“ und situationsbezogenen Beurteilungen (z. B. „Sind Sie jähzornig?“ vs. „Waren Sie in den letzten 14 Tagen einmal zornig?“) geäußerter Einstellung und tatsächlichem Verhalten physiologischen und psychologischen Maßen von Eigenschaften innerhalb einer Methodik (z. B. direkte und indirekte Befragung) die durch die unterschiedliche Schwierigkeit der verglichenen Situationen bzw. Items hervorgerufen werden (z. B. Frage: „Wie hilfsbereit sind Sie?“ Situation entweder „Oma über die Straße helfen“ [leicht] oder „Nachts Anhalter mitnehmen“ [schwierig]) Transsituative Inkonsistenz weniger globale Eigenschaften (z. B. Aggressivität) annehmen, sondern bereichsspezifische (Aggressivität gegenüber Authoritäten, gegenüber Gleichaltrigen etc.) Zeitliche Instabilität Quellen der IV: Oszillation von Merkmalen (= Spielbreite) Extraversion Introversion t1 t1: Einpunktmessung sagt hier wenig aus : Mehrpunktmessung sagt mehr aus, variiert aber Fluktuation der Merkmalsindikatoren (durch Umwelteinflüsse) = deutliche Veränderungen in Folge bestimmter Einflüsse (z. B. Angst sinkt kurzzeitig nach Therapie; vorübergehende Depressionen nach Tod des Partners etc.) wenn Einflüsse verschwinden Rückgang der Veränderungen stabile Eigenschaftsveränderungen durch Intervention und starke Umweltveränderungen (life events) Beispiele wie in , aber dauerhaft auch möglich: Krankheiten wie Alzheimer diagnostisch-experimentell evozierte Merkmalsveränderungen minimaler Ausprägung Versuch, durch Experimente auf Eigenschaften einzuwirken (z. B. Wie hoch ist die modifiability?; Wie leicht und schnell lassen sich Menschen verändern? Test der Eignung zur Therapie) 8.4. Faktoren / Persönlichkeitseigenschaften, von denen die IV abhängig ist und Frage nach individueller (In-)Konsistenzneigung – der Moderatoransatz in der Konsistenzproblematik 8.4.1. Wie wird individuelle Konsistenzneigung bestimmt? BEM & ALLEN (1974) ließen Vpn. die Konsistenz ihres eigenen Verhaltens in einem Frageborentest schätzen gestellte Experimentalsituation „konsistente“ Personen r = .66 zwischen Testergebnis und Situationen Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 28 „inkonsistente“ Personen Nullkorrelationen Ist Konsistenzneigung stabil? Nein: abhängig von der betrachteten Eigenschaft 8.4.2. Welche Faktoren bzw. Persönlichkeitseigenschaften macht man für die individuelle Konsistenzneigung verantwortlich? Konsistenzmoderatoren Moderatorenansatz: Suche nach Moderatorvariablen; multiple Regression Konsistenzmoderatoren: Demographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Bildung etc.) mit Alter: Intelligenz differenzierter (bereichsspezifischer), i. e. intraindividuelle Variabilität wächst, während IQ stabiler wird; ebenso: Stabilität in sozialen Situationen wächst Menschen mit höherer Bildung konsistenter Attribute von Eigenschaftsindikatoren (z. B. Ausprägung, subjektive Bedeutsamkeit einer Eigenschaft) Menschen mit extremen Eigenschaften, die sie für zentral halten stark änderungsresistent Einstellungen konsistenter bei größerer Erfahrung mit dem Einstellungsobjekt Persönlichkeitseigenschaften als Konsistenzmoderatoren: a) Selbstüberwachungstendenz = öffentliche Selbstaufmerksamkeit SNYDER: Self-monitoring Neigung, sich vor Publikum zu präsentieren hohes self-monitoring: Eindrucksmanagement (um Selbstpräsentation besorgt) Normorientiertheit darstellerische Fähigkeiten Fähigkeit zur Selbstinszenierung bei gleichbleibenden Sit.: konsistent bei veränderten Sit.: inkonsistent geringes self-monitoring: autonomer eigene Persönlichkeit eingebracht keine Anpassung an Situation immer konsistent b) private Selbstbewusstheit = private Selbstaufmerksamkeit WICKLUND: private Selbstaufmerksamkeit = Neigung, sich selbst zu beobachten und mit eigener Person zu beschäftigen Exp.: Fragebogen ausfüllen, danach Experimentalsituation im Wartezimmer Vgr.: beim Ausfüllen Blick in den Spiegel Selbstaufm. hoch im Wartezimmer: konsistent Kgr.: ohne Spiegel weniger konsistent c) Bedürfnis nach neuen Erfahrungen = sensation seeking hoch inkonsistenter Problem der multiplen Persönlichkeiten: JAMES (1890): multiple selves HOLTER: patch-work Persönlichkeit Persönlichkeit wird definiert durch die Anzahl von verschiedenen Rollen, die man einnimmt jeder ist eine Art abgeschsächte multiple Persönlichkeit klinische Psychologie: multiple Persönlichkeiten als Krankheitsbild „Eve White“ und „Eve Black“ brav, konservativ vs. provokativ und exzentrisch Differentielle Psychologie – Skript von Tobias Elze, 1999 29 sogar Schrift und EEG-Muster unteschiedlich besonders häufig: Frauen hoher Intelligenz massiver Missbrauch in Kindheit hohe darstellerische Fähigkeiten 8.5. Folgerungen aus der Diskussion der intraindividuellen Variabilität für die Eigenschaftsproblematik nomothetischer Ansatz: Suche nach allgemeinen Gesetzen und Eigenschaften idiographischer Ansatz: es gibt keine allgemeinen Eigenschaften Moderatorenansatz: es gibt Menschen, die mit Eigenschaftsmodell beschreibbar sind (nomoethetisch), und andere, die idiographisch zu beurteilen sind bei den meisten Menschen: nomothetische Vorgehensweise möglich und ausreichend