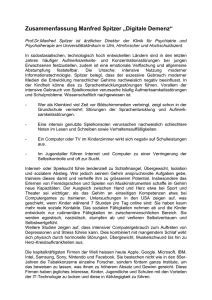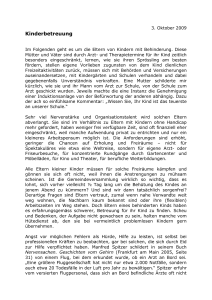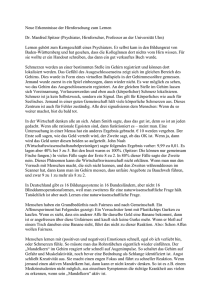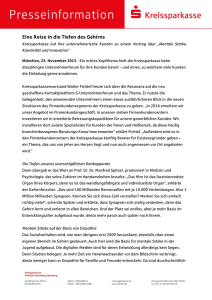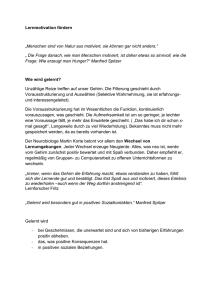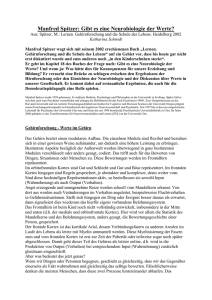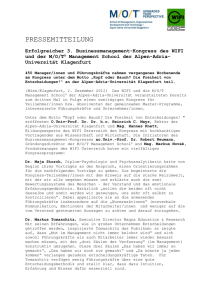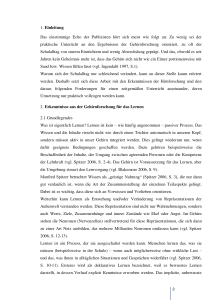Interview Spitzer
Werbung
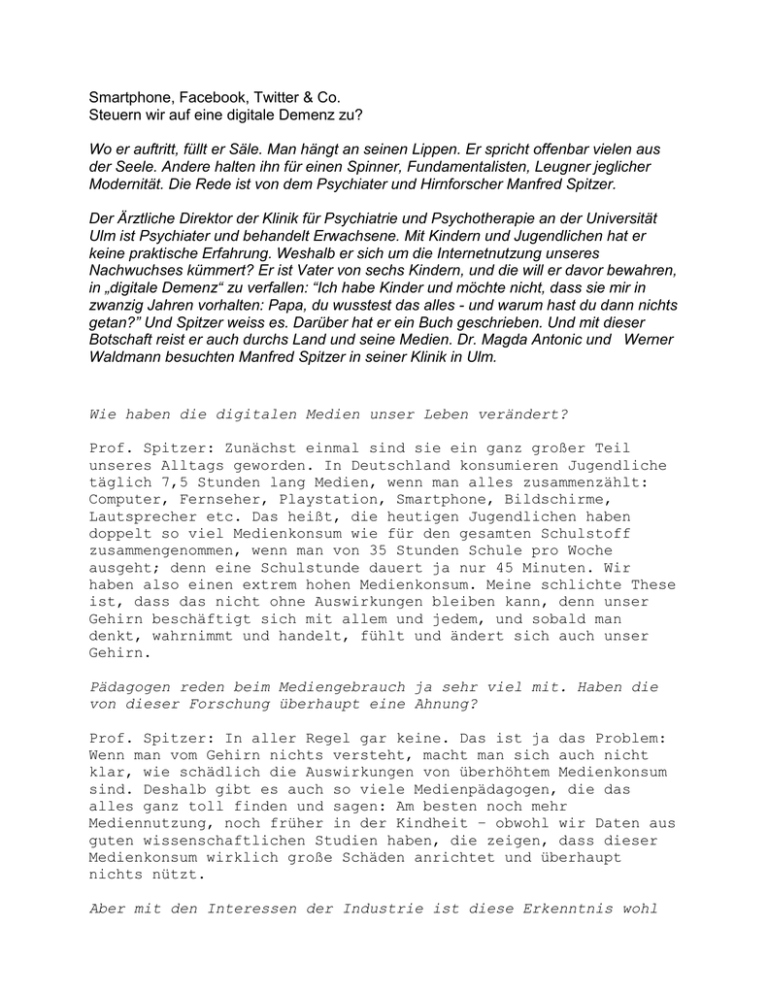
Smartphone, Facebook, Twitter & Co. Steuern wir auf eine digitale Demenz zu? Wo er auftritt, füllt er Säle. Man hängt an seinen Lippen. Er spricht offenbar vielen aus der Seele. Andere halten ihn für einen Spinner, Fundamentalisten, Leugner jeglicher Modernität. Die Rede ist von dem Psychiater und Hirnforscher Manfred Spitzer. Der Ärztliche Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Ulm ist Psychiater und behandelt Erwachsene. Mit Kindern und Jugendlichen hat er keine praktische Erfahrung. Weshalb er sich um die Internetnutzung unseres Nachwuchses kümmert? Er ist Vater von sechs Kindern, und die will er davor bewahren, in „digitale Demenz“ zu verfallen: “Ich habe Kinder und möchte nicht, dass sie mir in zwanzig Jahren vorhalten: Papa, du wusstest das alles - und warum hast du dann nichts getan?” Und Spitzer weiss es. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Und mit dieser Botschaft reist er auch durchs Land und seine Medien. Dr. Magda Antonic und Werner Waldmann besuchten Manfred Spitzer in seiner Klinik in Ulm. Wie haben die digitalen Medien unser Leben verändert? Prof. Spitzer: Zunächst einmal sind sie ein ganz großer Teil unseres Alltags geworden. In Deutschland konsumieren Jugendliche täglich 7,5 Stunden lang Medien, wenn man alles zusammenzählt: Computer, Fernseher, Playstation, Smartphone, Bildschirme, Lautsprecher etc. Das heißt, die heutigen Jugendlichen haben doppelt so viel Medienkonsum wie für den gesamten Schulstoff zusammengenommen, wenn man von 35 Stunden Schule pro Woche ausgeht; denn eine Schulstunde dauert ja nur 45 Minuten. Wir haben also einen extrem hohen Medienkonsum. Meine schlichte These ist, dass das nicht ohne Auswirkungen bleiben kann, denn unser Gehirn beschäftigt sich mit allem und jedem, und sobald man denkt, wahrnimmt und handelt, fühlt und ändert sich auch unser Gehirn. Pädagogen reden beim Mediengebrauch ja sehr viel mit. Haben die von dieser Forschung überhaupt eine Ahnung? Prof. Spitzer: In aller Regel gar keine. Das ist ja das Problem: Wenn man vom Gehirn nichts versteht, macht man sich auch nicht klar, wie schädlich die Auswirkungen von überhöhtem Medienkonsum sind. Deshalb gibt es auch so viele Medienpädagogen, die das alles ganz toll finden und sagen: Am besten noch mehr Mediennutzung, noch früher in der Kindheit – obwohl wir Daten aus guten wissenschaftlichen Studien haben, die zeigen, dass dieser Medienkonsum wirklich große Schäden anrichtet und überhaupt nichts nützt. Aber mit den Interessen der Industrie ist diese Erkenntnis wohl nicht vereinbar? Prof. Spitzer: Davon muss man ausgehen. Die weltweit reichsten Firmen (Google, Apple, Microsoft und so weiter) wollen noch reicher werden und versuchen die digitale Technik daher nun auch massiv in die Bildungsinstitutionen hineinzudrücken – mit dem Argument des pädagogischen Fortschritts und dem Appell: Wir müssen den Kindern unbedingt was Gutes tun. Dabei zeigen die vorliegenden Studien und Daten, dass Informationstechnik dem Lernen eher abträglich ist; und auch die empirische pädagogische Forschung beweist: Ein Computer in der Schule hat keine Auswirkung auf die Noten, und ein Computer zu Hause macht die Noten bei einem 15-Jährigen sogar schlechter. Die Daten sprechen also keineswegs dafür, dass wir jetzt ganz schnell für alle Schüler Internet und Computer anschaffen müssen; sie deuten eher darauf hin, dass wir das sein lassen sollten. Werden wir durch Medienkonsum und Internet zu bequem zum Mitdenken? Prof. Spitzer: Auf jeden Fall. Man weiß mittlerweile aus guten Studien, dass das Gehirn in vielerlei Hinsicht mit seinen Aufgaben wächst, aber eben nicht mehr wächst oder sich zurückbildet, wenn es entlastet wird. Deshalb bringen digitale Medien, die uns ja geistige Arbeit abnehmen, auch große Risiken und Nebenwirkungen mit sich. Der exzessive Medienkonsum stört also die geistige Entwicklung. Warum sieht die Gesellschaft dieses Problem nicht? Prof. Spitzer: Teile der Gesellschaft sehen das durchaus. Die Suchtbeauftragte der Bundesregierung spricht von einer halben Millionen internet- und computersüchtiger junger Menschen in Deutschland. Viele Mütter sehen, dass ihre Söhne nicht mehr davon wegkommen. Sie merken auch, dass die jungen Leute gar nicht mehr ohne Handy auf Klassenfahrten gehen wollen. Es ist ganz schwer durchzusetzen, dass sie einmal aufs Handy verzichten, weil sie dann „auf Entzug“ kommen und es absolut nicht aushalten, ohne diese Medien zu sein. Und genau das ist das Wesen der Sucht. Wer anfängt zu zittern und zu schwitzen, wenn man ihm sagt: Du konsumierst jetzt mal drei Tage lang keine Medien, bei dem liegt tatsächlich eine Sucht vor. Ist das bei Mädchen anders? Prof. Spitzer: Jungen sind stärker davon betroffen, denn bei den meisten Aktivitäten, die man käuflich erwerben kann, geht es um die so genannten Killerspiele, um Aggressivität und deren Ausleben im Medium – und dafür sind Jungs empfänglicher, denn Testosteron macht aggressiv. Wie würde ein akzeptabler Medienkonsum Ihrer Meinung nach aussehen? Prof. Spitzer: Das ist schwer zu sagen. Es ist wie mit dem Fernsehkonsum: Da weiß man nur, dass mehr als drei Stunden schlechter sind als zwei bis drei Stunden, und die sind wiederum schädlicher als ein bis zwei Stunden. Aber um wie viel schlechter dieser Konsum wiederum im Vergleich zu weniger als einer Stunde ist, kann man ganz schlecht sagen. Wenn ich wissen will, wie schädlich Rauchen ist, vergleiche ich Raucher mit Nichtrauchern; aber wenn ich herausfinden möchte, wie schädlich Fernsehen ist, kann ich Fernseher nicht mit Nichtfernsehern vergleichen, weil heute nahezu alle Menschen einen Fernseher haben. Wann laufen wir Gefahr, dass die virtuelle Realität zur wirklichen Realität wird? Prof. Spitzer: Das wird dann zur Gefahr, wenn ich mich nur noch in die virtuelle Realität flüchte und diese mein Leben viel mehr ausmacht und bestimmt als die wirkliche Realität. Wenn mein Zeitbudget in virtuellen Welten die Zeit, die ich in der realen Welt verbringe, weit übersteigt, dann stimmt etwas nicht. Machen die Medien uns nicht auch leicht- und schnellgläubig? Prof. Spitzer: Dazu kenne ich keine Daten. Man weiß aber, dass sie ein bisschen oberflächlich machen und Vorurteile schüren. Man wird also weniger kritikfähig; und das hat natürlich auch etwas mit Leichtgläubigkeit zu tun. Wenn ich viel fernsehe, lese ich ja auch nicht mehr gern, weil das im Vergleich zum passiven Fernsehkonsum zu anstrengend ist. Prof. Spitzer: Das stimmt. Man rezipiert dann halt eher passiv, statt aktiv zu produzieren. Beim Lesen ist die geistige Aktivität eine wichtige Komponente, weil man die Realität des gelesenen Textes anhand dieser doch sehr verarmten Kringel und Symbole unserer Schrift ja erst mal selber erzeugen muss. Führen soziale Netzwerke zu mehr oder intensiveren Kontakten, oder können sie auch in die soziale Isolation führen? Prof. Spitzer: Studien zeigen, dass eher Letzteres der Fall ist. Diese Kontakte sind ja nicht sehr intensiv. Das Gehirn wächst, wie gesagt, mit seinen Aufgaben; das gilt auch für soziale Aufgaben, und wenn man online unterwegs ist, fehlt ja die Mimik, Gestik und Sprachmelodie unseres Gesprächspartners und vieles andere mehr. Daher hat man im Internet nicht den Input, den man braucht, um soziale Kompetenz zu erlernen und das soziale Gehirn zum Wachsen zu bringen. Dazu braucht man sein Gegenüber wirklich „face to face“. Wie lernt man besser: im Dialog oder durch einseitige Medienrezeption? Prof. Spitzer: Ganz klar: live! Es gibt interessante Studien, bei denen man drei jungen Leuten einen Film zeigt, und sie können hinterher entweder darüber reden oder chatten. Zwei Wochen später fragt man jeden einzelnen noch einmal, worum es in dem Film ging, und stellt fest, dass diejenigen, die sich live darüber unterhalten durften, den Inhalt besser behalten haben als die „Chatter“. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass online mehr gelogen wird als im persönlichen Austausch. Bleibt so auch soziales Empfinden und Handeln auf der Strecke? Prof. Spitzer: Dass online mehr gelogen wird, ist durch Untersuchungen belegt. Ich war vor kurzem auf einer Tagung der Polizei zum Thema Internetkriminalität, und was ich da gehört habe, hat mich sehr erstaunt. Nirgends gibt es mehr Kriminalität als im virtuellen Raum. Dass man im Internet Sozialverhalten lernen kann, ist ein Irrtum. Aber es ist ja bequem für die Eltern, ihre Kinder vor dem Bildschirm zu „parken“. Prof. Spitzer: Genau das sagen die Eltern laut Ergebnissen einer großen amerikanischen Studie tatsächlich, wenn man sie fragt, warum ihre Kinder vor dem Fernseher sitzen: „Das ist doch bequem, dann kann ich einkaufen fahren oder...“ Der von den Eltern genannte Hauptgrund für die Mediennutzung bei Kindern ist, dass sie dann mal ruhiggestellt sind und die Eltern eine Zeitlang machen können, was sie wollen. Wenn Jugendliche zu exzessiv vor dem Fernseher oder dem Computer sitzen, geht das ja bis in die Nacht hinein oder auch die ganze Nacht durch – und das am liebsten ständig. Hat diese selbstverordnete Schlafrestriktion keine negativen Konsequenzen? Prof. Spitzer: Doch. Hier ist die Wissenschaft in letzter Zeit zu interessanten Erkenntnissen gekommen: Schlafmangel macht nicht nur müde und unkonzentriert, sondern führt zu einer prädiabetischen Stoffwechsellage und begünstigt damit die Entwicklung einer Zuckerkrankheit. Das ist mittlerweile eindeutig erwiesen, und deshalb kann ich nur sagen: Bitte jede Nacht für gesunden Schlaf sorgen! Das ist das A und O für unsere körperliche und geistige Funktionsfähigkeit. Was hat Schlaf mit Gedächtnis zu tun? Prof. Spitzer: Sehr viel. Wir wissen heute, dass während des Schlafs Zellen in der Gehirnrinde und auch weiter unten im Gehirn synchronisiert werden. Durch diese Synchronisation können sie Informationen untereinander austauschen. Man weiß inzwischen auch, dass im Schlaf Erinnerungen verfestigt und so „abgelegt“ werden, dass man sie hinterher wiederfindet. Wenn Jugendliche sich erst mal an diesen ungesunden Tagesablauf gewöhnt haben, dass sie ungern schlafen und lieber fernsehen – gibt sich das nach der Pubertät von selbst wieder? Prof. Spitzer: Nicht automatisch. Das ist ein großes Problem. Unsere heutigen Internet- und Computersüchtigen befinden sich ja nicht in der Pubertät oder kurz danach, sondern sind Mitte bis Ende Zwanzig. So lange dauert es oft, bis das Suchtverhalten so manifest wird, dass die Leute selber merken: Das geht so nicht weiter! 18 Stunden am Tag World of Warcraft, mit Kehrrichteimer neben dem Stuhl, damit man nicht mehr auf die Toilette muss, Job verloren, Wohnung gekündigt, alles vermüllt. Ich habe solche Menschen schon gesehen, die waren erst Ende Zwanzig. Das ist schon verheerend. Wie therapiert man so etwas? Prof. Spitzer: Ich habe solche Patienten hier schon auf der geschlossenen Abteilung gehabt, weil es anders gar nicht ging. Da braucht man ein Team von Psychologen und Sozialarbeitern; ein Arzt sollte auch dabei sein, um akute Exzesse zu dämpfen. Die Sozialarbeiter und Psychologen haben die Aufgabe, Zuversicht für ein ganz normales Leben aufzubauen, das bei diesen Patienten einfach nicht mehr klappt. Und wie sieht die Behandlung konkret aus? Prof. Spitzer: Man isoliert die Patienten erst mal, damit sie dem Druck, weiter zu spielen, nicht mehr nachgeben können. Außerdem schafft man Alternativen, und zum Teil gibt man tatsächlich auch Medikamente, um zu verhindern, dass ihre Computer- und Internetsucht immer wieder durchbricht. Das ist alles nicht so einfach. Ich hoffe sehr, dass wir bald noch mehr Medikamente bekommen, die zurzeit noch erforscht werden. Irgendwann wird es sicherlich mehr Therapieoptionen geben. Computersucht, Spieloder Internetsucht ist eine Sucht wie jede andere auch; man spricht dabei von `nicht stoffgebundenen Süchten´. Erkennen die Kostenträger die Therapie für diese Sucht an? Prof. Spitzer: Bislang ist das noch ganz schwierig: Es gibt viel zu wenige Therapieeinrichtungen, und die Kostenträger haben das auch noch nicht allgemein akzeptiert. Es gibt noch keine Diagnose im klassischen Sinn dafür, und wo die fehlt, gibt es auch kein Geld für die Behandlung.