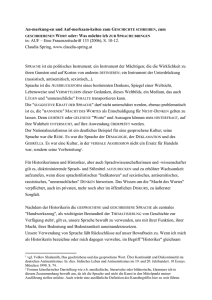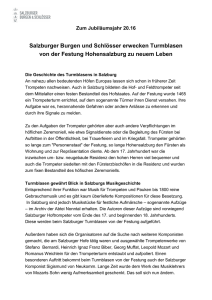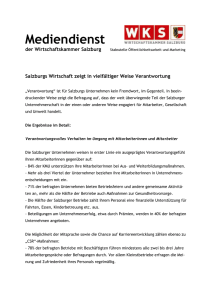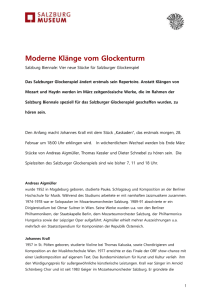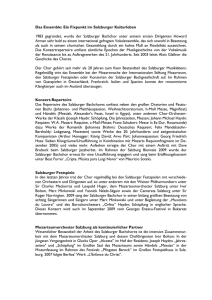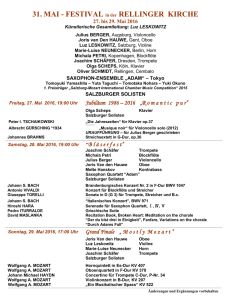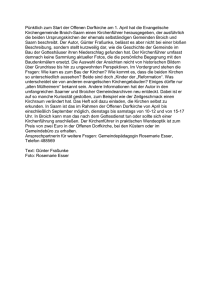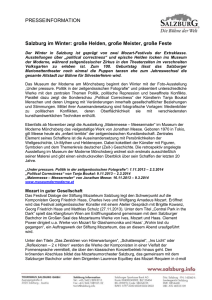Materialien
Werbung
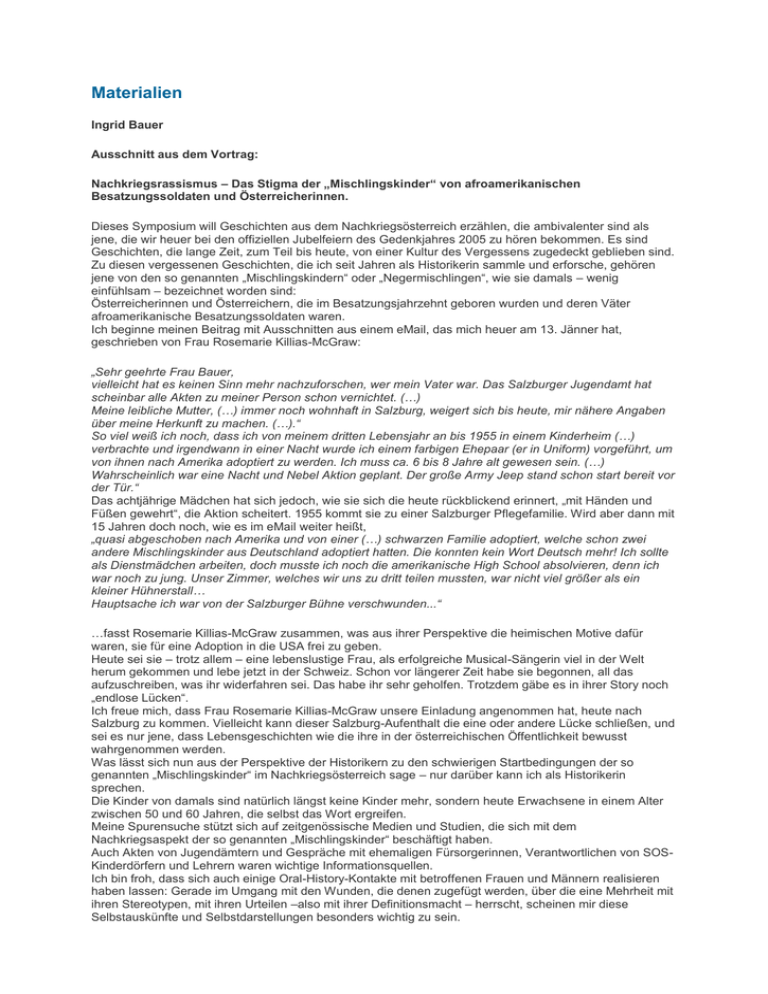
Materialien Ingrid Bauer Ausschnitt aus dem Vortrag: Nachkriegsrassismus – Das Stigma der „Mischlingskinder“ von afroamerikanischen Besatzungssoldaten und Österreicherinnen. Dieses Symposium will Geschichten aus dem Nachkriegsösterreich erzählen, die ambivalenter sind als jene, die wir heuer bei den offiziellen Jubelfeiern des Gedenkjahres 2005 zu hören bekommen. Es sind Geschichten, die lange Zeit, zum Teil bis heute, von einer Kultur des Vergessens zugedeckt geblieben sind. Zu diesen vergessenen Geschichten, die ich seit Jahren als Historikerin sammle und erforsche, gehören jene von den so genannten „Mischlingskindern“ oder „Negermischlingen“, wie sie damals – wenig einfühlsam – bezeichnet worden sind: Österreicherinnen und Österreichern, die im Besatzungsjahrzehnt geboren wurden und deren Väter afroamerikanische Besatzungssoldaten waren. Ich beginne meinen Beitrag mit Ausschnitten aus einem eMail, das mich heuer am 13. Jänner hat, geschrieben von Frau Rosemarie Killias-McGraw: „Sehr geehrte Frau Bauer, vielleicht hat es keinen Sinn mehr nachzuforschen, wer mein Vater war. Das Salzburger Jugendamt hat scheinbar alle Akten zu meiner Person schon vernichtet. (…) Meine leibliche Mutter, (…) immer noch wohnhaft in Salzburg, weigert sich bis heute, mir nähere Angaben über meine Herkunft zu machen. (…).“ So viel weiß ich noch, dass ich von meinem dritten Lebensjahr an bis 1955 in einem Kinderheim (…) verbrachte und irgendwann in einer Nacht wurde ich einem farbigen Ehepaar (er in Uniform) vorgeführt, um von ihnen nach Amerika adoptiert zu werden. Ich muss ca. 6 bis 8 Jahre alt gewesen sein. (…) Wahrscheinlich war eine Nacht und Nebel Aktion geplant. Der große Army Jeep stand schon start bereit vor der Tür.“ Das achtjährige Mädchen hat sich jedoch, wie sie sich die heute rückblickend erinnert, „mit Händen und Füßen gewehrt“, die Aktion scheitert. 1955 kommt sie zu einer Salzburger Pflegefamilie. Wird aber dann mit 15 Jahren doch noch, wie es im eMail weiter heißt, „quasi abgeschoben nach Amerika und von einer (…) schwarzen Familie adoptiert, welche schon zwei andere Mischlingskinder aus Deutschland adoptiert hatten. Die konnten kein Wort Deutsch mehr! Ich sollte als Dienstmädchen arbeiten, doch musste ich noch die amerikanische High School absolvieren, denn ich war noch zu jung. Unser Zimmer, welches wir uns zu dritt teilen mussten, war nicht viel größer als ein kleiner Hühnerstall… Hauptsache ich war von der Salzburger Bühne verschwunden...“ …fasst Rosemarie Killias-McGraw zusammen, was aus ihrer Perspektive die heimischen Motive dafür waren, sie für eine Adoption in die USA frei zu geben. Heute sei sie – trotz allem – eine lebenslustige Frau, als erfolgreiche Musical-Sängerin viel in der Welt herum gekommen und lebe jetzt in der Schweiz. Schon vor längerer Zeit habe sie begonnen, all das aufzuschreiben, was ihr widerfahren sei. Das habe ihr sehr geholfen. Trotzdem gäbe es in ihrer Story noch „endlose Lücken“. Ich freue mich, dass Frau Rosemarie Killias-McGraw unsere Einladung angenommen hat, heute nach Salzburg zu kommen. Vielleicht kann dieser Salzburg-Aufenthalt die eine oder andere Lücke schließen, und sei es nur jene, dass Lebensgeschichten wie die ihre in der österreichischen Öffentlichkeit bewusst wahrgenommen werden. Was lässt sich nun aus der Perspektive der Historikern zu den schwierigen Startbedingungen der so genannten „Mischlingskinder“ im Nachkriegsösterreich sage – nur darüber kann ich als Historikerin sprechen. Die Kinder von damals sind natürlich längst keine Kinder mehr, sondern heute Erwachsene in einem Alter zwischen 50 und 60 Jahren, die selbst das Wort ergreifen. Meine Spurensuche stützt sich auf zeitgenössische Medien und Studien, die sich mit dem Nachkriegsaspekt der so genannten „Mischlingskinder“ beschäftigt haben. Auch Akten von Jugendämtern und Gespräche mit ehemaligen Fürsorgerinnen, Verantwortlichen von SOSKinderdörfern und Lehrern waren wichtige Informationsquellen. Ich bin froh, dass sich auch einige Oral-History-Kontakte mit betroffenen Frauen und Männern realisieren haben lassen: Gerade im Umgang mit den Wunden, die denen zugefügt werden, über die eine Mehrheit mit ihren Stereotypen, mit ihren Urteilen –also mit ihrer Definitionsmacht – herrscht, scheinen mir diese Selbstauskünfte und Selbstdarstellungen besonders wichtig zu sein. Man bleibt sonst hängen beim diskriminierenden Blick und bei der diskriminierenden Sprache von damals – allein das Etikett „Mischling“ zeugt vom hilflosen Umgang mit Menschen interethnischer Herkunft. Andererseits will ich diese sprachlichen Bilder auch nicht ganz ausblenden, weil dadurch spürbar wird, wie sehr sie die Lebenswege dieser Kinder zu einer kontinuierlichen Situation des Dazwischen gemacht haben, zu einem Gang durch vielfältige Szenarien äußerer und innerer Fremdheit. Ende des Ausschnitts Die Historikerin forscht weiter zum Thema. Über Veröffentlichungen dazu werden wir Sie auf dieser Homepage informieren.