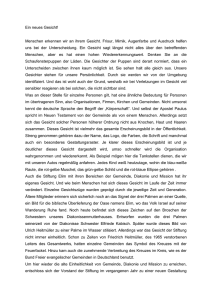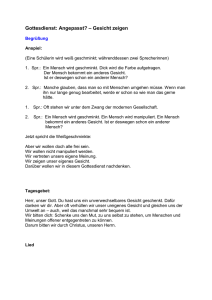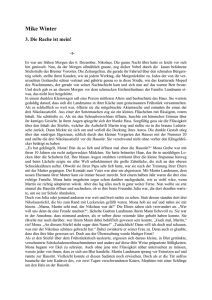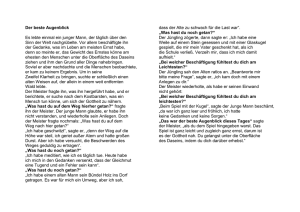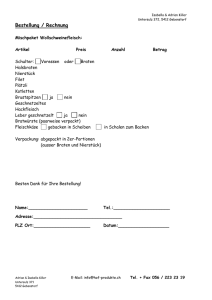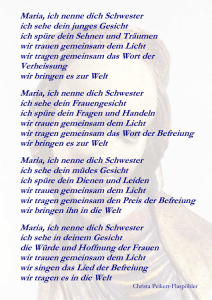Teil 12 Der Löwe
Werbung
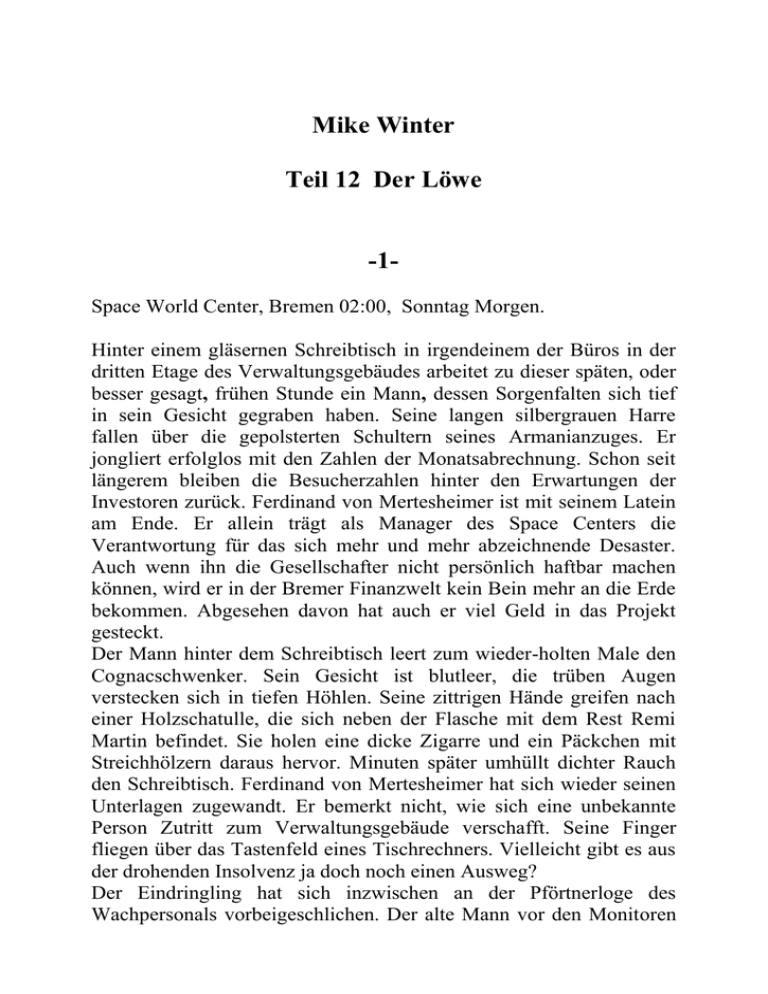
Mike Winter Teil 12 Der Löwe -1Space World Center, Bremen 02:00, Sonntag Morgen. Hinter einem gläsernen Schreibtisch in irgendeinem der Büros in der dritten Etage des Verwaltungsgebäudes arbeitet zu dieser späten, oder besser gesagt, frühen Stunde ein Mann, dessen Sorgenfalten sich tief in sein Gesicht gegraben haben. Seine langen silbergrauen Harre fallen über die gepolsterten Schultern seines Armanianzuges. Er jongliert erfolglos mit den Zahlen der Monatsabrechnung. Schon seit längerem bleiben die Besucherzahlen hinter den Erwartungen der Investoren zurück. Ferdinand von Mertesheimer ist mit seinem Latein am Ende. Er allein trägt als Manager des Space Centers die Verantwortung für das sich mehr und mehr abzeichnende Desaster. Auch wenn ihn die Gesellschafter nicht persönlich haftbar machen können, wird er in der Bremer Finanzwelt kein Bein mehr an die Erde bekommen. Abgesehen davon hat auch er viel Geld in das Projekt gesteckt. Der Mann hinter dem Schreibtisch leert zum wieder-holten Male den Cognacschwenker. Sein Gesicht ist blutleer, die trüben Augen verstecken sich in tiefen Höhlen. Seine zittrigen Hände greifen nach einer Holzschatulle, die sich neben der Flasche mit dem Rest Remi Martin befindet. Sie holen eine dicke Zigarre und ein Päckchen mit Streichhölzern daraus hervor. Minuten später umhüllt dichter Rauch den Schreibtisch. Ferdinand von Mertesheimer hat sich wieder seinen Unterlagen zugewandt. Er bemerkt nicht, wie sich eine unbekannte Person Zutritt zum Verwaltungsgebäude verschafft. Seine Finger fliegen über das Tastenfeld eines Tischrechners. Vielleicht gibt es aus der drohenden Insolvenz ja doch noch einen Ausweg? Der Eindringling hat sich inzwischen an der Pförtnerloge des Wachpersonals vorbeigeschlichen. Der alte Mann vor den Monitoren ist während seines anstrengenden Dienstes eingeschlafen. In der Faust des Unbekannten befindet sich eine italienische Beretta - Cougar, auf die ein Schalldämpfer geschraubt wurde. Der Alte hinter der Glasscheibe interessiert ihn nicht, er verfolgt ein anderes Ziel. Seine Vorgehensweise ist bis ins letzte Detail durchdacht, minutiös geplant. Der Mann mit der Cougar lächelt, während er sich an der Glasscheibe vorbeischiebt. Es hätte ihm nichts ausgemacht, den Alten kalt zu stellen, doch wenn er am Leben bleibt, ist er ihm von größerem Nutzen.. Sein behandschuhter Zeigefinger drückt auf den Taster, der die Fahrstuhltüren auseinander fahren lässt, dann betritt der Mann, dessen Bewegungen an die Geschmeidigkeit einer Katze erinnern, den Lift und die Türen schließen sich hinter ihm. Nur ein typisches Surren ist zu hören, während sich die Kabine nach oben hebt. Ein heller Gong kündet schließlich davon, dass der Fahrstuhl sein Ziel erreicht hat. Gleichmäßig schieben sich die beiden Türhälften auseinander. Vor dem elegant gekleideten Mann im Sportjackett teilt sich ein dunkler Flur. Der Eindringling verlässt den Lift. Er sieht den Gang zu beiden Seiten hinab. Hinter ihm schließen sich die mechanischen Türen der Kabine. Er entscheidet sich für die linke Seite. Lautlos tastet er sich durch die Dunkelheit. Bingo! Unter einer der Türen dringt Licht auf den Flur. Das muss das Büro seines Opfers sein. Ein letztes Mal ruft er das Bild der Zielperson vor seinem geistigen Auge ab, seine Faust umschließt die Waffe mit Nachdruck, sämtliche Sehnen seines Körpers spannen sich an, pures Adrenalin schießt durch seine Adern und noch mit demselben Wimpernschlag reißt er ruckartig die Tür auf. Zwei zu Tode erschrockene Augen starren ihn an. Der Unbekannte erkennt in dem Mann hinter dem gläsernen Schreibtisch sein Opfer wieder. Er hält die Cougar am ausgestreckten Arm. Der grauhaarige Mann im Nadel-streifenanzug erhebt sich langsam. In seinem Gesicht zeichnet sich Verwunderung. „Wer sind Sie?“, herrscht er dem Eindringling entgegen. Doch der antwortet ihm nicht, sondern schließt in seliger Ruhe die Tür. „Was wollen Sie von mir? Wenn Sie auf Geld aus sind, kommen Sie vergebens. Ich habe gerade heraus-gefunden, dass ich pleite bin.“ Mertesheimer lacht zynisch. „Sie sehen also, Sie kommen vergebens.“ „Dein dreckiges Geld will ich sowieso nicht! Ich nehme dir das, woran du neben deinem Geld am meisten hängst, Freddy, - dein Leben.“ Der Grauhaarige erstarrt zu Eis. Nur wenige Menschen kannten ihn unter diesem Namen. Tausend Gedanken schießen ihm durch den Kopf. Sein Verstand arbeitet so gut es in dieser Situation möglich ist und plötzlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Er hat den Mann, dessen Waffe weiterhin auf ihn gerichtet ist, erkannt. Lange war es her, verdammt lange und doch kommt es ihm in diesem Augenblick so vor, als habe er den Knaben erst gestern auf seinem Schoß gewogen. Dann kommt ihm die Erinnerung an jenen Tag, der auch sein Leben veränderte. Der Mann hinter dem Schreibtisch kann seine Gefühle nicht länger unter Kontrolle halten. Panik bricht in ihm aus, treibt ihm puren Angstschweiß aus den Poren. „Lass uns darüber reden,“ fleht er. Doch mehr als ein müdes Grinsen kann er seinem Gegenüber nicht entlocken. Ein schlichtes Plopp beendet sein Hoffen. Mertesheimer greift sich an die Brust. Er fühlt, wie der Schmerz darin brennt und doch will er nicht für wahr haben, dass dies seine letzten Atemzüge sein sollen. Voller Entsetzen starrt er in das Gesicht seines Richters. Dann denkt er an seinen Bruder und daran, dass er ihn warnen muss, doch der rote Fleck, der langsam das Hemd und seine Weste durchtränkt, unterhalb der Schusswunde hervorquillt, verdeutlicht ihm, nur noch wenig Zeit zu haben. Während die eine Hand unermüdlich auf die Wunde presst, greift die andere zum Telefon, wirft den Hörer von der Gabel und fingert nach der Kurzwahl, die er wegen der häufigen Telefonate mit seinem Bruder eingespeichert hatte. Der Mann mit der Cougar lässt ihn gewähren, ergötzt sich an dem verzweifelten Versuch seines Opfers. Ja, er empfindet es als eine Art Spiel, bei dem es am Ende doch nur einen Sieger geben kann. Sein lüsternes Sinnen nach Rache hat ihn derart verbittern lassen. All die Jahre seiner Kindheit, in denen er mit ansehen musste, wie sein Vater in einer leblos wirkenden Hülle, ohne das Wissen um das, was geschehen war, dahin vegetierte. All die Jahre in denen die Brüder Mertesheimer seinen Vater schmählich im Stich ließen. Sein Vater war daran zerbrochen, war inzwischen einsam und in Armut gestorben. Aber nun war er alt genug, um Rache zu nehmen und sich all das zu holen, was seiner Familie zustand. Er geht einige Schritte auf den Schreibtisch zu, dabei beobachtet er sein Opfer genau. Mertesheimer steht noch immer schaukelnd dahinter. Er ist zäh, presst nach wie vor eine seiner Hände auf die Wunde, als wenn er glaubt, auf diese Weise die Blutung zum Stillstand bringen zu können. Der Mann im Sportjackett steht nun unmittelbar vor dem Telefon. Er hört, wie sich am anderen Ende der Leitung eine Männerstimme meldet. Der Hörer liegt nach wie vor auf der Glasplatte neben dem Telefon. Mertesheimer greift danach, hat aber keine Kraft mehr, ihn anzuheben, geschweige denn, an seine Lippen zu pressen. Ja, er hat nicht einmal mehr die Kraft, einen vernehmlichen Laut von sich zu geben. Er röchelt, schwankt und sackt in den Chefsessel, hinter dem Schreibtisch, wo ihm schließlich auch die letzten Lebensgeister entschwinden. Der Unbekannte greift nach dem Hörer, hält ihn an sein Ohr und lauscht. Er vernimmt die wütende Stimme des Angerufenen, der seinen Unmut über die nächtliche Belästigung in rüdem Ton zum Ausdruck bringt. Als er seine Schimpfkanonade für einen Moment unterbricht, sagt der Unbekannte gelassen: „falsch verbunden,“ und legt auf. Ein Grinsen umspielt seine Züge. Es ist die Vorfreude auf das, was noch kommen soll, denn noch ist seine Mission nicht beendet. Er greift in die Seitentaschen seines Jacketts und kramt zwei große, blaue Plastikmüllsäcke und Klebeband hervor. Die Cougar steckt er in eine der nun leeren Taschen. Er weiß, dass er sich beeilen muss, aber noch ist er gut in der Zeit, noch läuft alles nach Plan. Den ersten Müllsack stülpt er seinem Opfer über den Kopf. Der erschlaffte Körper kippt nach vorn. Mit einer Hand verhinderte er, dass er unkontrolliert zu Boden stürzt. Mit der anderen fischt er seinem Opfer die Brieftasche und einen Schlüsselbund aus dem Anzug, an dem sich auch ein Autoschlüssel befindet. Abschließend zieht er dem Toten den Müllsack bis zum Gesäß herunter. Erst dann lässt er den Leichnam weiter nach vorn kippen, legt ihn schließlich rücklings auf dem Parkettboden ab. Er hebt die Beine seines Opfers und streift den zweiten Sack darüber. Da, wo das Plastik aufeinander trifft, verklebt er es mit dem Klebeband. Er sieht sich um und entdeckt schließlich ein geeignetes Versteck. Nur für den Fall, dass sich der müde Nachtwächter doch einmal auf seine Runde begibt und seine Nase in das Büro steckt. Mehr als 24 Stunden würde er nicht brauchen. Wenn die Putzfrau irgendwann auch in diesem Büro ihre Arbeit tut, wird sein Werk vollendet sein. Die wuchtige Ledercouch lässt sich nur mühsam von der Wand abrücken, aber um die gut verpackte Leiche dahinter verschwinden zu lassen, ist sie ideal. Der Unbekannte schleift den leblosen Körper über das Parkett. Er achtet peinlich darauf, keine Spuren zu hinterlassen. Schließlich schiebt er das Sofa so weit wie möglich an seinen Ausgangspunkt zurück. Die Akte, an der sein Opfer bis zu seinem Tode gearbeitet hat, klappt er zusammen und legt sie in eine der Schubladen des Blechcontainers neben dem Schreibtisch. Abschließend schiebt er den Chefsessel an die Glasplatte und verlässt den Raum. Dabei vergisst er nicht, das Licht zu löschen und die Tür zu verschließen. Für den Rückweg hat sich der Mann mit der Beretta für das Treppenhaus entschieden. Die kleine Halogentasch-enlampe in seiner Hand weist ihm den Weg durch den dunklen Flur. Das Schlüsselbund des Toten öffnet ihm den Weg zum Parkplatz. Soll sein Plan aufgehen, muss es den Anschein haben, als verließe nicht er, sondern Mertesheimer in seinem Auto das Gelände. Der Unbekannte braucht nicht lange suchen, er kennt den Wagen seines Opfers. Sein Plan ist von langer Hand vorbereitet und gut durchdacht. Davon zeugt auch die Perücke mit dem langen silbernen Haar, welche er jetzt aus der Umhängetasche unter seinem Jackett hervor-zieht. Mit ihr auf dem Kopf, wird der schlaftrunkene Pförtner beschwören, dass er Mertesheimer die Schranke geöffnet hat. Erst lautes Hupen reißt den alten Mann aus seinen Träumen. Es dauert einige Momente, bis sich der Wachmann orientiert hat. Der Unbekannte hebt dreist die Hand und winkt dem Pförtner zu. Der Uniformierte grüßt peinlich berührt zurück und lässt den Schlagbaum ohne zu Zögern in die Höhe schnellen. Selbst als der Wagen keine zwei Meter an der Pförtnerloge vorbeirollt, kann ihn der Alte nicht erkennen, denn der Mann hinter dem Steuer hält immer noch grüßend die Hand vor sein Gesicht. Ein entspanntes Grinsen umspielt seine Lippen, als er im Rückspiegel beobachtet, wie sich die Schranke senkt und sich der Pförtner wieder in seinem Sessel niederlässt. Der erste Teil seiner Mission ist erfüllt. Der Killer ist mit sich zufrieden. Er weiß, dass ihn nun nichts mehr stoppen kann -2Münzhandelshaus Koch, Braunschweig 23:15 Sonntag Abend. Das leise Zischen eines Klapppfeils, der durch eine Harpune abgefeuert wurde und das anschließend, deutlich hörbare Geräusch, welches verursacht wird, wenn Metall auf Stein kratzt, wurden gleichsam durch den um diese Zeit immer noch lebhaften Straßenverkehr überdeckt. Eine dunkel gekleidete Gestalt zieht vorsichtig an der dünnen Angelschnur, die mit dem Aluminiumanker verbunden ist. Neben ihr wickelt sich gleichzeitig ein besonders tragfähiges Drahtseil von einer Rolle ab, die in einer speziellen Vorrichtung steckt. Bereits nach kurzer Zeit rastet der Karabiner an der Spitze des Drahtseils in der Führungsöse des Ankers ein und die Gestalt kann das Seil straffen. Sie sichert es und montiert die kleine Gondel, mit der sie die zehn Meter über die Seitenstraße zum angrenzenden Flachdach überbrücken will. Es ist nicht das erste Mal, dass die Gestalt mit dieser Vorrichtung arbeitet. Eine gewisse Routine ist ihr deshalb anzumerken. Überdies hat sie sich gut auf das Unternehmen vorbereitet. Nachdem sich die kleinen Metallrollen am Tragbügel der Gondel ungehindert auf dem Seil hin und herbewegen lassen, hängt die dunkel gekleidete Person den Lastenträger ein. Ein Sack, in dem sie das benötigte Werkzeug hinter sich herziehen will. An ihm befestigt sie nun die Angelschnur. Auch dies klappt ohne Probleme. Mit einem letzten Check vergewissert sich die Gestalt ob das Seil ausreichend Spannung aufweist, dann schwingt sie sich einer großen Katze gleich, behände in die Gondel und zieht sich Stück für Stück über die Kante des Flachdaches und weiter über die etwa zwölf Meter unter ihr befindliche Seitenstraße, welche nur wenige Meter weiter in den Hagenring mündet. So präzise wie ein Schweizer Uhrwerk und in beinahe stoischer Ruhe hangelt sich die Gestalt Stück für Stück an sein Ziel heran. Nur noch einen Wimpernschlag ist die Gondel von der Brüstung des im spätromanischen Stil erbauten Eckhauses entfernt. Im selben Augenblick, in dem die Gondel ihr Ziel erreicht, gehen in der Wohnung des im rückwärtig gelegenen Teil des Hauses die Lichter aus. Es ist 23.42 Uhr, als die unbekannte Gestalt auf das Flachdach übersetzt und den an der Angelschnur befestigten Lastensack über die Straße zieht. Das leise Surren des Laufrades ist nicht einmal von dem jungen Paar zu vernehmen, welches gerade in diesem Moment, aus Richtung Innenstadt kommend, die Straße überquert. Der Schatten wartet einige Sekunden, bis die Passanten weit genug entfernt sind, ehe er schließlich den Sack über die Brüstung zieht. Nun geht es Schlag auf Schlag. Sein nächstes Ziel ist ein Lüftungsschacht, in dessen Gitter er einen Spiegel führt, der am Ende eines Schwanenhalses befestigt ist. Mit dem blauen Licht eines sich im Spiegel brechenden Halogenstrahls sucht er nach einem eventuell dahinter verborgenen Alarmmelder. Ein mildes Lächeln huscht über das im Dunkel der Nacht liegende Gesicht. Ein Sensor! Ein Kinderspiel! Die Gestalt bedient sich eines elektronischen Impulsgebers und überbrückt so die Kabel, mit denen der Sensor an der Alarmzentrale angeschlossen ist. Nun kann sie in aller Ruhe das Gitter abschrauben und zur Seite legen. Laut der Baupläne, die der Löwe über einen Server in Italien, völlig legal aus dem Internet heruntergeladen hat, führt der Unbekannte Schatten das Lüftungsrohr genau an den Ort seiner Begierde. Da das quadratische, etwa fünfzig Zentimeter breite Rohr zunächst steil nach unten abfällt, befestigt er vorab eine Strickleiter am Einstieg. Bevor er selbst in den Schacht klettert, lässt er unter zur Hilfename der Angelschnur den Lastensack hinunter. Dann folgt auch er. Sein Ziel befindet sich im ersten Stock des Hauses. Dort stehen mehrere mit seltenen Münzen aus aller Welt vollgestopfte Vitrinen, die schon viel zu lange darauf warten mussten, von ihm ausgeplündert zu werden. Bis dahin war es jedoch noch ein weiter und vor allem nicht ungefährlicher Weg. Doch gerade dieser Kick ist es, der den Löwen auf seinen Beutetouren reizt. Immer wieder orientiert sich der katzenhafte Schatten im Geiste an den Eintragungen des Bauplanes, ehe er schließlich durch ein weiteres Gitter den anvisierten Raum erblickt. Auch an dieser Stelle verwendet er den Spiegel und die Lampe, um die andere Seite des Lüftungsgitters nach einem möglichen Sensor abzusuchen. Er ist beinahe enttäuscht, als er feststellen muss, dass man an dieser Stelle auf einen weiteren Impulsgeber verzichtet hat. Dennoch ist er erfahren genug, um dem ersten Anschein nicht blindlings zu trauen. Und auch dieses Mal soll ihm seine Vorsicht Recht geben. An den Schrauben, mit denen man das Gitter befestigt hat, sind Kontakte angebracht, die bei geringster Berührung einen Alarm auslösen würden. Die Gestalt ist zufrieden. Jetzt weiß sie, womit man sie hinters Licht führen will. Die Gefahr liegt nicht in der Komplexität der Falle, sondern darin, sie zu übersehen, schmunzelt die Gestalt, bevor sie sich daran macht, die Kontakte kurz zu schließen. Wenig später ist auch dieses Hindernis überwunden und das Gitter abmontiert. Aber auch jetzt bleibt der Schatten vorsichtig, setzt noch nicht zum Sprung in den Raum an, sondern versprüht zunächst einen feinen Staub, der sich in der Luft des gesamten Raumes verteilt. Der Schatten sieht amüsiert, wie etwa zehn Zentimeter über dem Boden mehrere Laserstrahlen sichtbar werden. Er lässt den Lastensack hinab und folgt ihm mit einem zielsicheren Sprung aus dem etwa zwei Meter hoch liegenden Lüftungsschacht. Er landet fast lautlos an der vorbestimmten Stelle. Immer noch zeigt ihm der feine Staub, der sich nur sehr zögerlich setzt, die Linien der Lichtschranke. Auch zu diesem Zweck führt der unbekannte Schatten einige Spiegel mit sich, die er nun, auf kleinen Stativen befestigt, zwischen die Lichtstrahlen schiebt. Die kleinste Unachtsamkeit kann den Alarm auslösen. Mit viel Geduld und einer ruhigen Hand gelingt es ihm schließlich, sich so den nötigen Platz für seine weitere Arbeit zu verschaffen. Aus einem Erkundungsbesuch als interessierter Münz-sammler getarnt, weiß er, dass die Glasflächen der Schaukästen mit speziellen Berührungssensoren ausgestattet sind, welche bei der kleinsten Erschütterung Alarm auslösen. Ähnliches gilt für die elektronisch gesicherten Schlösser der Vitrinen. Lange hatte er sich den Kopf darüber zerbrochen, wie er auch dieses Hindernis überwinden kann. Es hatte ihm etliche Versuche an einem eigens nachgebauten Schaukasten gekostet, bis er die Lösung hatte. Er grinste zufrieden, schließlich nannte man ihn nicht umsonst den Löwen. Des Rätsels Lösung lag in einer kleinen Flasche Stickstoff, für die er eine Art Trichter konstruiert hatte. Gefühlvoll stülpt er den Trichter genau über den Punkt der Glasscheibe, unter dem sich der Sensor befindet. Bedächtig öffnet er das Ventil und beobachtet für einen Moment, ob die erhoffte Wirkung eintritt. Das Glas vereist innerhalb von Sekunden und überträgt die Kälte auf die Elektronik des Sensors. Der Zeitpunkt, um die Saugvorrichtung anzusetzen, ist gekommen. Mit der Diamantspitze eines Glasschneiders zeichnet er einen Kreis in das Glas. Die Sekunde der Wahrheit ist da. In dem Moment, in dem er das Stück Glas unter den Saugnäpfen herausbricht, wird sich zeigen, ob sein Plan aufgeht. Noch zögert er. Pures Adrenalin pumpt durch seine Adern. Die Anspannung in ihm steigt ins Unermessliche. Ein einziger, kraftvoller Ruck und das kreisrunde Loch gibt den Griff in das Innere der Vitrine frei. Ein Gefühl von unerreichter Größe, Einmaligkeit und ein Hauch von Größenwahn wallt durch seinen Geist. Dann geht alles sehr schnell. In Windeseile sammelt er die Kostbarkeiten ein und macht sich an den nächsten Schaukasten, um gleiches zu wiederholen. Auf diese Weise räumt er schließlich alle acht in diesem Raum stehenden Vitrinen leer. Zu guter Letzt hinterlässt er an einer der Vitrinen sein Erkennungszeichen; eine eingeritzte Pranke, dann erst macht er sich für den Rückzug bereit. Eine Aluminiumsteckleiter ist schnell zusammengebaut und unter das Lüftungsgitter gestellt. Die fast leere Stickstoffflasche und die Spiegel, sowie die kleine Leiter lässt er am Ort seines Triumphes zurück. Es ist 1:32 Uhr, als der Löwe mit seiner Beute in den Lüftungsschacht steigt. Lautlos schiebt er sich voran. Vor sich den Lastsack, der noch ein wenig schwerer geworden ist, als er zuvor schon war. Plötzlich vernimmt er einzelne Laute, die mit jedem Meter, den er sich weiter voran schiebt, lauter werden. Durch ein Lüftungsgitter fällt Licht in den Schacht. Der Dieb verharrt einige Minuten, überlegt, wie er sich verhalten soll. Die Zeit verrinnt. Er hört die Stimme zweier Männer, die sich offensichtlich in einem Streitgespräch befinden. Es sind jedoch nur Wortfetzen, aus denen er sich keinen Reim machen kann. Manchmal ist selbst bei einem Dieb die Neugier stärker als die Vorsicht, weshalb sich dieser nun anschickt, der Sache auf den Grund zu gehen. Nur noch wenige Meter trennen ihn noch von dem lichtdurchfluteten Lüftungsgitter, durch welches die Stimmen immer lauter und bedeutungsvoller zu werden scheinen. Die Sorge doch noch entdeckt zu werden veranlasst ihn, sich noch vorsichtiger vorzuarbeiten. Schließlich erreicht er die Luke, durch die sich nun der schmale Blick durch die Gitterstäbe eröffnet. Der Löwe traut seinen Augen nicht. Keine drei Meter von ihm entfernt steht ein Mann mit einer Waffe in der Hand. Er kann nicht in sein Gesicht sehen, aber er sieht, wie er auf einen Mann in einem Pyjama zielt. Der Dieb hält den Atem an. In seinem Versteck ist er keineswegs sicher vor einem Bleigeschoss, welches aus dieser Nähe auf ihn abgefeuert werden könnte. „Deine Zeit ist abgelaufen, Sebastian von Mertesheimer! Genau wie es die deines Bruders war. Mit deinem Tod wird meine Rache vollkommen und das Unrecht endlich gesühnt,“ verkündet der Mann mit der Waffe triumphal. „Was haben Sie mit meinem Bruder gemacht, Sie wahnsinniger Psychopath?“, keucht der Bedrohte panisch. „Aber Sebastian, das weißt du doch, du warst doch live dabei, als er das Zeitliche segnete. Leider hast du es nicht recht begriffen, als er sich letzte Nacht von dir verabschieden wollte. Außer einigen unflätigen Worten hast du ja nichts für ihn übrig gehabt.“ Der Mann im Pyjama verliert auch die letzte Farbe aus seinem Gesicht. „Was haben mein Bruder und ich Ihnen getan?“, fragt er mit zitternder Stimme. „Diese Frage kannst du dem Teufel stellen, der wartet schon auf dich!“ Es ist unmittelbar der Moment, bevor der Mann mit der Waffe den Abzugshahn durchzieht. Die Spannung jenseits der Lüftungsschlitze ist unerträglich. Der Löwe ist aus Prinzip unbewaffnet. Er kann nicht in das Geschehen eingreifen, ohne sich selbst zu gefährden. Er zweifelt, liegt mit sich selbst im Clinch. Letztendlich beendet der Aufschrei des Getroffenen das Zwiegespräch. Entsetzt starrt er auf das Geschehen. Der Schalldämpfer hat den Knall in ein leises Plopp verwandelt. Der Mann im Pyjama greift sich ans Herz, stößt einen spitzen Schrei aus und sackt schließlich in sich zusammen. Nur mit Mühe kann sich der Dieb beherrschen, als der Killer auf sein Opfer zugeht, die Waffe nach wie vor im Anschlag hält und den tödlich Getroffenen mit dem Fuß auf den Rücken dreht. Er sieht den Rächer hämisch grinsen und sei dies noch immer nicht genug, beobachtet er mit fassungslosen Blick, wie der Mörder nach seinem Opfer spuckt. Der Löwe empfindet Abscheu und Ekel vor einer solchen Menschen-verachtung. Wut steigt in ihm auf und genau in diesem Augenblick der Unkonzentriertheit stößt er mit der Taschenlampe in der Hand gegen das Metall des Lüftungsschachtes. Der Löwe reagiert blitzschnell, zieht seinen Kopf vom Gitter zurück und harrt der Dinge, die geschehen. Er wagt es nicht zu atmen, sämtliche Sehnen sind bis zum Zerreißen gespannt. Er lauscht, kann jedoch nicht den geringsten Laut vernehmen. Millimeter um Millimeter schiebt er seinen Kopf wieder nach vorn. Er erschreckt, als er den Killer nicht mehr als eine Armeslänge vom Lüftungsgitter entfernt erblickt. Gottlob hat dieser den Kopf gerade abgewandt und so bleibt der Dieb noch unentdeckt. Wie einer Schildkröte gleich, zieht er den Kopf zurück und verharrt bis er Schritte hört, die sich von ihm entfernen. Endlich wagt er es wieder, zu atmen, seinen von einem Krampf durchströmten Fuß zu bewegen. Die Schritte entfernen sich weiter und weiter. Schließlich vernimmt er das Quietschen einer Tür und etwas von der Anspannung in ihm beginnt sich zu lösen. Noch immer lauscht der Löwe, seine sämtlichen Sinne sind aktiviert, scannen jeden Quadratzentimeter seiner Umgebung. Einige Minuten noch verharrt er so, dann erst, als er sich sicher ist, dass der Killer nicht mehr in der Nähe ist, wagte er es, seinen Kopf zwischen den Schultern wieder nach vorn zu schieben. Tatsächlich, die Luft ist rein. Der Killer hat den Tatort verlassen. Er sieht den Toten, sieht, wie sich der hellblaue Satin des Pyjamas rot eingefärbt hat. Er schüttelt betroffen mit dem Kopf. In diesem Augenblick ahnt er bereits, was tags darauf in der Zeitung stehen wird, doch letzten Endes weiß er, dass er daran nun nichts mehr ändern kann. Zögerlich schiebt er sich schließlich weiter durch das Rohr, seinem Rückweg entgegen. -3Schwurgerichtskammer im Oberlandesgericht Bremen, Sitzungssaal 7, 10:22 Uhr Montag Morgen. „Ihr Name ist Mike Winter, Sie sind 37 Jahre alt und wohnen in der Sonnenstraße Nummer 17.“ Ich bestätigte die Angaben des Richters mit einem vernehmlichen Ja. „Sie sind Kriminalhauptkommissar und Leiter der Mordkommission 2, hier in Bremen,“ fuhr der Mann in der schwarzen Robe fort. „Jawohl.“ „Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert?" „Nein.“ Der Richter sah mich über die dicken Gläser seiner Brille prüfend an. Abschließend schob er das Gestell mit dem Zeigefinger über die Nase nach oben. „Als Kommissar ist Ihnen sicherlich bekannt, dass Sie hier die volle Wahrheit sagen müssen, nichts verschweigen oder weglassen dürfen?“ „Jawohl.“ „Dann schildern Sie uns nun bitte die Umstände, die zur Festnahme des Tatverdächtigen führten.“ Wie vom Richter gewünscht schilderte ich dem Gericht, was am Abend des 22. März vorgefallen war. „Auf Grund unserer Ermittlungen in der Mordsache Krüger, suchten meine Kollegen Kriminalhauptwachtmeisterin Edda Blache, Kriminalobermeister Aron Baltus und ich um 21:45 Uhr das Anwesen der Eheleute Speckmann auf. Es ging um eine Alibiüberprüfung, bei der sich der Angeklagte in einigen Widersprüchen verfangen hatte. Meine Kollegen und ich gingen gerade durch den Garten, als wir im Haus zwei Schüsse in kurzer zeitlicher Folge vernahmen.“ „Konnten Sie den Angeklagten zu diesem Zeitpunkt von draußen sehen?“, unterbrach der Richter meine Ausfüh-rungen. „Ich konnte lediglich zwei Schatten sehen, die durch die zugezogene Gardinen nicht näher zu bestimmen waren.“ „Sie haben also nicht mit eigenen Augen sehen können, dass mein Mandant geschossen hat?“, griff der Verteidiger den Faden auf. „Nein, das sagte ich doch bereits,“ bestätigte ich angefressen. „Was geschah dann,“ brachte der Richter meine Aussage zurück auf das Wesentliche. „Während der Kollege Baltus den Hintereingang sicherte, drangen die Kollegin Blache und ich durch eine offen stehende Terrassentür in das Haus ein. Dort fanden wir Herrn Alexander Speckmann mit einer Waffe in der Hand vor. Er stand sichtlich unter Schock. Seine Ehefrau lag etwa vier Meter von ihm entfernt blutend neben einem Couchtisch. Er stammelte: ich habe sie umgebracht.“ Für uns lag der Fall schon lange klar wie Kloßbrühe. Nicht nur sein spontanes Geständnis, sondern auch die Schmauchspuren an seinem Körper und die Auswertung der ballistischen Untersuchung kamen zu dem gleichen Ergebnis. Einmal mehr spielte die krankhafte Eifersucht des Angeklagten die ausschlaggebende Rolle in diesem Ehedrama. Natürlich versuchte der Anwalt seine bizarre Unfalltheorie zu untermauern, doch dies musste Angesichts der Tatsache, dass sich auch für den Mord an dem Geliebten seiner Ehefrau hinreichend Beweise für seine Täterschaft ergaben, nur bei einem verzweifelten Versuch bleiben. Die Ausweglosigkeit seiner Situation vor Augen gestand der Angeklagte schließlich und meine Partner und ich konnten einmal mehr eine dicke Akte schließen. Für den Rest des Tages hatte ich mir eigentlich frei genommen, um mit meiner Lebensgefährtin Trixi und unserem gemeinsamen Baby, Romy, eine Wohn-zimmercouch für unsere Wohnung auszusuchen. Aber wie so oft kam auch heute wieder ein dringender Fall dazwischen, zu dem unser Chef, Kriminalrat Kretzer, niemand anderen schicken konnte als uns. Wen wundert es, dass Trixi nicht sehr freudig auf meinen Anruf reagierte. Immerhin war sie fair genug, um mir am Ende unseres Gesprächs einen versöhnlichen Kuss durchs Telefon zu schicken. Sie wusste, dass meine Arbeit einen freien Kopf erfordert, weil jede Unkonzen-triertheit das Aus bedeuten konnte. Der Einsatz führte mich zum World Space Center, wo der Manager des Vergnügungscenters tot aufgefunden worden war. Obwohl das größte deutsche indoor Weltraum Center noch nicht lange in der Hansestadt existierte, machten bereits hartnäckige Gerüchte über eine baldige Schließung der Anlage die Runde. Wenn ich persönlich auch nicht viel von dem halte, was in der Regenbogenpresse zu lesen ist, war dies das Erste, was sich mir auf der Fahrt zum Einsatzort in den Sinn gedrängt hatte. Edda und Aron hatten bereits die Spurensicherung und den Gerichtsmediziner an den Ort des Geschehens gerufen. Meine Kollegin empfing mich an der Pförtner-loge des Verwaltungsgebäudes. Nachdem der Wachmann auf ihr Geheiß den Schlagbaum nach oben schweben ließ, parkte ich auf dem Angestellten-parkplatzes, im Hinterhof des Gebäudes. Auf dem Weg zum Fundort der Leiche informierte mich Edda über die Details, die sie in der kurzen Zeit seit ihres Eintreffens bereits in Erfahrung gebracht hatte. „Der Name unseres heutigen Hauptdarstellers ist Ferdinand von Mertesheimer. Er war Manager und Teilgesellschafter des Centers,“ erklärte sie mir. „Wer hat den Toten gefunden?“, fragte ich routinemäßig. „Seine Sekretärin, eine Frau Stichsel.“ Der Fahrstuhl beförderte uns in die dritte Etage des Bürogebäudes. Die Sekretärin hatte ihr Büro direkt neben dem ihres Chefs. Die etwa Dreißigjährige zeigte sich vom Tod ihres Brötchengebers ziemlich mitgenommen. Noch war nicht abzusehen, ob dies von dem Umstand her rührte, dass sie es war, die den Leichnam gefunden hatte, oder ob ihre Beziehung über die eines normalen Arbeits-verhältnisses hinausging. Während ich mich am Tatort weiter umsah, kümmerte sich Edda um sie. Von Frau zu Frau plaudert es sich erfahrungsgemäß leichter. Doktor Knut Hansen war der bestellte Rechtsmediziner. Wir kannten uns von vielen gleichartigen Begegnungen. Er war ein kleiner, eher schmächtiger Mann, dessen schmales Gesicht von einer metallgefassten Brille eingerahmt wurde. Er trug bevorzugt graue Jacketts von konservativem Schnitt. Wir begegneten uns auf dem Gang, direkt vor der offen stehenden Bürotür des Opfers. Ich bemerkte sofort den penetranten Fäulnisgeruch. „Das Opfer ist also erschossen worden,“ berief ich mich auf Edda. „Das Projektil hat unterhalb des zweiten Rippenbogens die linke Brustkammer getroffen. Das Geschoss hat das Herz nur knapp verfehlt und ist schließlich in den linken Lungenflügel eingedrungen.“ „War der Mann sofort tot?“ Hansen machte ein zerknirschtes Gesicht. „Schwer zu sagen, aber wenn mich nicht alles täuscht, muss er noch einige Zeit gestanden haben, nachdem er bereits getroffen war. Dafür spricht jedenfalls die Laufrichtung des aus der Schusswunde ausgetretenen Blutes.“ „Hm, der Schütze stand seinem Opfer also gegenüber?“, kombinierte ich. „Der Doc wog nachdenklich den Kopf. „Dem Einschusskanal zufolge befanden sich Täter und Opfer in einer aufrechten Position. Ob sie sich allerdings gegenüberstanden, kann ich nicht sagen.“ Ich sah mich forschend um. Die Leute von der Spurensicherung waren mit der Abnahme von Fingerabdrücken beschäftigt. Zwei Mitarbeiter von Doktor Hansen warteten geduldig darauf, dass ich ihnen mein Okay zum Abtransport des Leichnams gab und mein Partner, Aron Baltus, machte sich an der Telefonanlage zu schaffen. Ich wandte mich noch einmal an den Mediziner. „Können Sie den Todeszeitpunkt schon eingrenzen?“ Hansen legte seine Stirn in tiefe Dackelfalten. „Nun ja, anhand der Totenflecken und des Zustands des Körpers würde ich sagen, dass der Mann seit etwa dreißig Stunden tot ist. Plus – minus vier Stunden, versteht sich.“ Ich sah den Doktor erstaunt an. Im allgemeinen war ich von ihm nach der ersten Leichenschau präzisere Infos gewohnt. Der Pathologe bemerkte meine Verwunderung. „Der Tote war in Plastiksäcke gehüllt. Es hat also keinen direkten Kontakt mit der Luft gegeben. Was wiederum den gesamten Verwesungsprozess beeinflusst. Genau-eres kann ich Ihnen aber erst nach der toxikologischen Untersuchung mitteilen.“ Dabei werden Speisereste im Magen – Darmtrakt des Körpers auf den Säuregrad und ihre Zusammensetzung überprüft. Auf diese Weise lässt sich der Todeszeitpunkt recht genau bestimmen. „Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Sache vorrangig bearbeiten könnten, Herr Hansen.“ Der Mediziner schob seine Brille auf die Nasenspitze und sah mich über den Rand der dicken Gläser mürrisch an. „Ja, ja, immer das gleiche mit euch, am liebsten würdet ihr die Ergebnisse schon haben, bevor das Opfer die Augen für immer zu gemacht hat. Aber das eine derart komplexe Untersuchung ihre Zeit braucht, um eventuelle Fehler auszuschließen, wollt ihr nicht für wahr haben.“ Damit wandte er sich um und ließ mich stehen. Ich habe während meiner langjährigen Tätigkeit bei der Mordkommission schon so manche Leiche gesehen. Darunter waren auch mehrere Wasserleichen, die mir einiges an Dickhäutigkeit abverlangten, doch der Zustand in dem sich dieser Mordopfer befand, jagte selbst mir noch einen Schauer über den Rücken. Nachdem die Leute der Spurensicherung den Fundort der Leiche in Fotos dokumentiert und die Umrisse des davor stehenden Möbel mit Kreide auf dem Fußboden kenntlich gemacht hatten, war die Couch bei Seite geschoben worden. Ich versuchte mir gerade ein Gesamtbild von dem möglichen Tathergang zu verschaffen, als Aron mich nachdrücklich an den Telefonapparat bat. „Hallo, bitte melden Sie sich,“ vernahm ich am anderen Ende der Leitung eine Männerstimme. „Hier ist der Anschluss von Sebastian von Mertesheimer.“ Ich deckte die Sprechmuschel ab und wartete auf Arons Erklärung. „Ich habe die Taste für die Wahlwiederholung gedrückt.“ Dies war also der letzte Anruf den Ferdinand von Mertesheimer vor seinem Tode getätigt hatte. „Darf ich fragen, wer am Apparat ist,“ hörte ich die Stimme wieder. Ich meldete mich und war noch erstaunter, als mir mein Gesprächspartner erklärte, dass er ebenfalls von der Mordkommission sei. Die Kollegen aus Braunschweig waren ebenso wie wir gerade dabei, die ersten Spuren in einer Mordsache aufzunehmen. Als ich hörte, dass es sich bei dem Opfer in Braunschweig um den Bruder des Ferdinand von Mertesheimer handelt, war ich sprachlos und das geschieht gewiss nicht oft. Der Kollege am anderen Ende der Leitung hielt es für denkbar, dass beide Fälle in Zusammenhang standen. Diese Möglichkeit war nicht von der Hand zu weisen. Hauptkommissar Wolters und ich versprachen uns gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Ich war gespannt, ob unsere Ermittlungen in dieselbe Richtung führen würden. Kommissar Hans Stockmeier und seine Leute von der Spurensicherung hatten einmal mehr ganze Arbeit geleistet. „Wir haben eine ganze Anzahl verschiedener Fingerprints am Tatort gefunden,“ berichtete mir der Leiter der Spurensicherung. Hans und ich hatten während unserer Arbeit für das Gesetz schon so manche harte Nuss gemeinsam geknackt. Ich kannte ihn als sehr gewissenhaft und zuverlässig. Die Erscheinung des Mittfünfzigers glich nicht zuletzt wegen seines akkuraten Schnurrbarts und dem weißen Haar der eines schottischen Schlossherrn aus längst vergangenen Zeiten. „Ingo nimmt gerade die Abdrücke sämtlicher Angestell-ten, die nach Auskunft der Sekretärin unmittelbar mit dem Ermordeten zu tun hatten.“ Stockmeier rümpfte geräuschvoll die Nase. „So wie es eben aussieht, ist Mertesheimer hinter seinem Schreibtisch erschossen worden. Wir haben auf dem Parkett kaum sichtbare Schleifspuren gefunden, die eindeutig von den Schuh-sohlen des Opfers herrühren.“ „Hm, ich verstehe nicht, weshalb der Täter...“ „Oder die Täterin!“, unterbrach mich Edda, die gerade den Raum betrat. „Also schön, von mir aus auch Täterin,“ griff ich meine Überlegung wieder auf. „Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen,“ wog der Kriminaltechniker abschätzend den Kopf. „Eine Frau dürfte große Probleme dabei haben einem leblosen Körper von etwa 90 Kilogramm Gewicht in Tüten zu verpacken und ihn anschließend quer durch den Raum hinter ein Sofa zu ziehen.“ Eddas Augen verdrehten sich in Richtung Decke. „Ich kenne Frauen, die 100 Kilogramm und mehr zur Hochstrecke bringen,“ verwahrte sich Edda, die Stockmeiers Äußerung einmal mehr als einen Angriff auf die Gleichstellung der Frauen betrachtete. „Ich sprach von einer normalen Frau,“ konterte der Kommissar. Ich versuchte mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. „Warum wurde Mertesheimer in diese Müllsäcke gestopft und hinter dem Sofa versteckt, ist hier die Frage.“ „Offensichtlich sollte er nicht vorzeitig entdeckt werden,“ brachte es Aron auf den Punkt. „Das ist schon klar,“ grübelte ich weiter. „Wenn ihr mich fragt, brauchte der Täter...,“ „...oder die Täterin!“, unterbrach Stocki Eddas Überlegungen feixend. Meine Kollegin zog ein Grimasse und fuhr fort. „...die Zeit, um in aller Ruhe auch noch den Bruder unseres Opfers zu töten.“ „Wenn der Mord an Mertesheimer von Anfang an in dieser Weise geplant war, haben wir es mit einem äußerst skrupellosen Menschen zu tun,“ stellte ich fest. „Nicht nur, dass er ungesehen durch das Gebäude spazierte,“ erläuterte uns Edda. „Er war nach Auskunft des Pförtners sogar dreist genug, um sich in den Wagen seines Opfers zu setzen und damit in aller Ruhe an ihm vorbei zu fahren.“ Bereits zu diesem Zeitpunkt unserer Ermittlungen war ich mir sicher, dass uns dieser Fall noch eine ganze Zeit lang beschäftigen würde. Ich war sehr gespannt auf die ersten Untersuchungsergebnisse aus der Pathologie, von der Spurensicherung und natürlich auf das, was uns die Kollegen aus Braunschweig mitteilen würden. „Ich möchte, dass ihr euch jetzt die Angestellten vornehmt. Was für ein Chef war Mertesheimer, gab es Intrigen, gab es in letzter Zeit Entlassungen, irgendwelche Intimitäten mit weiblichen Angestellten? Ihr wisst schon, eben das übliche Programm!“ „Was hast du vor, wenn ich fragen darf?“, erkundigte sich Aron. „Ich habe da noch ein paar Fragen an den Pförtner, bevor ich mich auf den Weg zur Witwe mache. Ich schlage vor, wir treffen uns nach getaner Arbeit im Büro.“ „Sie hatten also in der Nacht von Samstag auf Sonntag Dienst?“, fragte ich den Uniformierten. Der alte Mann war sichtlich erregt. Immer wieder schüttelte er mit dem Kopf. So, als könne er immer noch nicht glauben, welches Drama sich, unter allem Vorbehalt, drei Stockwerke über ihm in jener Nacht abgespielt hat. „Ich habe den Chef doch mit eigenen Augen rausfahren sehen. Er hat sogar noch freundlich gegrüßt.“ Ich verzog mitfühlend das Gesicht. „Ich verstehe noch immer nicht ganz, wie der Mörder unentdeckt in das Gebäude kommen konnte.“ „Glauben Sie mir, darüber zermartere ich mir mein Hirn, seit ich von der Kommissarin erfahren habe, dass Herr von Mertesheimer dort oben liegt. Noch dazu, wo ich der Frau des Chefs doch gestern noch am Telefon sagte, dass ihr Mann das Gebäude gegen drei Uhr verlassen habe. Wenn ich mir vorstelle, dass der Chef zu der Zeit vielleicht noch gelebt hat...“ Der alte Mann sackte noch ein wenig mehr in sich zusammen. „Wann haben Sie mit Frau von Mertesheimer telefoniert?“ Ich hatte meinen Dienst gerade wieder angetreten,“ überlegte er. „Es muss so gegen 14 Uhr gewesen sein.“ „Dann kann ich Sie beruhigen, nach meinem bisherigen Kenntnisstand ist Herr von Mertesheimer bereits tot gewesen, als Sie seinen Mörder vom Hof fahren ließen.“ „Aber ich wusste doch nicht...,“ stammelte der Wachmann. „Es sollte auch kein Vorwurf sein.“ Ich sah auf die Monitore, die den Eingangsbereich und den Innenhof zeigten, der als Parkplatz genutzt wurde. „Werden die Bilder irgendwo aufgezeichnet?“, fragte ich mit einem kurzen Fingerdeut auf die Mattscheiben. „Ach ja,“ seufzte der Alte, „das habe ich vollkommen vergessen. Beim Hausmeister steht so ein Aufzeichnungsgerät, wo jeweils die letzten 24 Stunden festgehalten werden. Vielleicht ist ja noch etwas darauf zu sehen.“ Er griff hastig zum Telefon und tippte eine kurze Nummer ein. Wenige Minuten später saß ich bereits im Büro des Hausmeisters und starrte gebannt auf den dort aufgebauten Monitor. „Warum befindet sich der Recorder bei Ihnen und nicht in der Pförtnerloge?“, wollte ich von dem kahlköpfigen Mann wissen, während er das Band auf den Anfang zurückspulte. „Keine Ahnung, ich werde dafür bezahlt, hier meinen Job zu machen, nicht dafür, Fragen zu stellen, die mich nichts angehen.“ „Und ich ärgere mich immer über Leute, die mir durch ihr unfreundliches Verhalten den Job noch schwerer machen, als er es ohnehin schon ist.“ Leider waren auf dem Band tatsächlich nur die letzten 24 Stunden zu sehen. Die unten links auf dem Bildschirm mitlaufende Uhrzeit ließ keinen Zweifel zu. Ich beschloss, mir die Bänder dennoch aushändigen zu lassen. Wer weiß, vielleicht gab es darauf doch noch etwas interessantes zu sehen. Immerhin standen wir noch ganz am Anfang unserer Ermittlungen. Da ist man über jede, noch so vage Möglichkeit dankbar, aus der sich eine Spur ergeben könnte. „Ist die Eingangstür rund um die Uhr verschlossen?“, fragte ich beim Hinausgehen, meinen Blick auf das Schlüsselbrett gerichtet, welches sich an der Wand neben der Tür befand. „Normalerweise schon, aber der alte Wachmann ist schon derart senil, dass er es oft genug vergisst.“ „Sie scheinen nicht gerade viel von Herrn Grünlich zu halten,“ wertete ich seine Aussage. „Mein Chef ist gerade getötet worden, weil der Kerl wahrscheinlich mal wieder gepennt hat, gut möglich, dass jetzt alles hier den Bach runter geht und Sie fragen mich allen Ernstes, ob ich viel von Grünlich halte?“ Ich dachte mir meinen Teil und ließ den Glatzkopf stehen. Die Villa der von Mertesheimer befand sich in einer der gehobeneren Wohngegenden von Bremen Vegesack. In der offenen Doppelgarage, rechts neben dem Haus, stand ein Audi Sport Coupe Cabriolet. Daneben, noch in der Hofeinfahrt, ein Mercedes der A Klasse. Eine Rückfrage über die Einsatzzentrale hatte ergeben, dass die Frau des Toten bislang keine Vermisstenanzeige erstattet hatte. Ich fragte mich, warum. Auf mein Läuten öffnete eine junges, äußerst attraktives Mädchen von höchstens achtzehn Jahren. Ihre Haare waren blond und berührten in langen, weichen Wellen die Schultern. Das Gesicht war fein geschnitten, mit großen braunen Rehaugen und mit einer leicht nach oben geschwungenen kleinen Nase. Ihre schlanke Figur mit den schmalen Hüften wirkte recht knabenhaft. Sie hatte sich in einen engen Rock aus dünnem weichen Leder gezwängt, der recht viel von ihren langen schlanken Beinen frei gab. Mit einem lieblich klingenden: bitte schön, erkundigte sie sich nach dem Grund meines Besuches. Als ich meinen Ausweis sehen ließ, erschrak sie. „Um Himmels Willen, Sie sind von der Mordkommission?“ Ich wagte kaum zu nicken. „Ist etwas mit meinem Vater?“ „Wie kommen Sie darauf?“, fragte ich ziemlich verwundert. „Was ist mit Vater?“ „Es tut mir leid,“ antwortete ich betreten, „aber ich hätte zunächst gern mit Ihrer Mutter gesprochen.“ „Sie ist nicht meine Mutter,“ antwortete sie gereizt. „Die Frau meines Vaters befindet sich im Gewächshaus im Garten.“ Sie trat beiseite, und bat mich ins Haus. „Und jetzt sagen Sie mir endlich was mit meinem Vater ist:“ Noch in der Diele stehend ließ sie mir keine andere Wahl. „Herr Ferdinand von Mertesheimer ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen.“ Im nächsten Augenblick sackte das Mädchen in sich zusammen. Ich konnte sie gerade noch auffangen und auf einem der Biedermeierstühle absetzen, die so etwas wie einen Wartebereich zierten. Sie kam nur sehr zögerlich wieder zu sich. Ihre rehbraunen Augen sahen mich flehentlich an. „Bitte sagen Sie mir, dass das nicht wahr ist.“ „Es tut mir Leid.“ Das Mädchen schluchzte bitterliche Tränen. Rat und Hilfe suchend blickte ich mich um. Ich konnte sie doch jetzt unmöglich allein lassen. „Dann hat dieses Miststück nun also doch erreicht, was sie wollte!“ Ich war überrascht und verwundert zu gleich. „Wie meinen Sie das?“, nutzte ich ihre offensichtliche Unbedachtheit, um Dinge von ihr zu erfahren, die sie unter normalen Umständen vielleicht nicht ausgesagt hätte. Sicher nicht die feine englische Art, aber ein durchaus probates Mittel um an Infos zu kommen. Sie jappte nach Luft, stand wahrscheinlich unter einem Schock und doch ließ sie es sich nicht nehmen, genau die Dinge loszuwerden, die ihr in diesem Augenblick auf der Seele brannten. „Diese Schlampe ist doch Schuld an allem! Zuerst macht sie meinen Vater hörig, drängt sich in die Ehe meiner Eltern, sorgt dafür, dass meine Mutter davon erfährt und in ihrer Verzweiflung gegen einen Baum rast und dann bringt sie meinen Vater auch noch dazu sie zu heiraten:“ „Das war harter Tobak, aber ich verstehe nicht, weshalb Sie meinen, Ihre Stiefmutter hätte mit dem Tod ihres Ehemannes erreicht, was sie wollte.“ Das Mädchen sah mich hysterisch lachend an. So viel ich weiß, hat er ihr vergangene Woche das Haus und wer weiß was nicht noch alles überschrieben. Alles nur, weil es im Center zur Zeit nicht so gut läuft.“ „Darf ich fragen, wer Sie sind?“, unterbrach uns die energische Stimme einer Frau Mitte Dreißig. Noch ehe ich mich ausweisen konnte, schoss das Mädchen in die Höhe und machte einen Satz nach vorn. Erst unmittelbar vor ihrer Stiefmutter hielt sie inne. „Du kannst dich beglückwünschen! Vater ist tot, du hast ausgesorgt!“ Die Ehefrau des Ermordeten stand da, als habe sie ein Gespenst gesehen. Ich beobachtete sie genau. „Bist du jetzt völlig verrückt geworden?“, herrschte sie ihrer Stieftochter entgegen, während sie das Mädchen bei den Schultern ergriff und schüttelte. Noch ließ ich die Sache laufen, aber schon im nächsten Moment musste ich eingreifen. Die Achtzehnjährige begann, wie von Sinnen auf ihre Stiefmutter einzuschlagen. Ich hatte Mühe, die beiden Furien voneinander zu lösen. Sie zogen sich gegenseitig in die Haare, kratzten und bissen sich. Es wäre sicher leichter gewesen, ein Rudel Wölfe von einem Schaf loszueisen. Wie so oft, wenn man hilfreich eingreifen will, geriet ich zwischen die Fronten, wobei ich mir eine Schelle einfing, die nicht eben von schlechten Eltern war. „Jetzt reicht es aber!“, fuhr ich energisch dazwischen. „Wenn Sie sich jetzt nicht zurückhalten, nehme ich Sie beide mit ins Präsidium!“ Das zog. Die Damen stellten umgehend ihre Aktivitäten ein. „Wer sind Sie denn eigentlich?“, fragte die Witwe. „Mein Name ist Mike Winter, Mordkommission 2. Wie Ihnen ihre Stieftochter ja bereits mitteilte, ist ihr Gatte das Opfer eines Verbrechens geworden.“ Die Frau sah mich mit großen Augen an. Sie schien erst in diesem Augenblick zu realisieren. „Dann hat Sina nicht nur einen ihrer dummen Späße gemacht?“ Ich schüttelte wortlos den Kopf. „Ich darf ihnen Beiden mein aufrichtiges Beileid aussprechen.“ Während das Mädchen weinend aus der Diele rannte, ließ sich die Witwe auf einem der Stühle nieder. Ich war beeindruckt, mit welchem Willen sie ihre Fassung zu wahren versuchte. „Wie ist er ums Leben gekommen?“ „Ihr Gatte ist in der Nacht zum Sonntag in seinem Büro erschossen worden.“ Die sehr animalisch wirkende Frau starrte mich verwirrt an. „Aber..., aber das kann doch nicht sein. Gestern Nachmittag habe ich doch noch mit dem Pförtner gesprochen, weil Ferdinand nicht nach Hause gekommen war.“ „Geschah es öfter, dass Ihr Mann so spät noch arbeitete?", unterbrach ich sie. „Anfangs nicht, aber in der letzten Zeit lief es im Center nicht so gut. Die Investoren saßen Ferdi arg im Nacken, da kam es schon mal vor, dass es spät wurde.“ Es war ihr deutlich anzumerken, wie sehr es hinter ihrer hübschen Stirn rumorte. „Aber der Pförtner, er sagte doch Ferdi habe gegen 3 Uhr das Center verlassen.“ Ich schüttelte mit dem Kopf. „Die Person, die der Pförtner für Ihren Mann hielt, war aller Wahrscheinlichkeit nach der Mörder Ihres Gatten.“ Das Entsetzen stand ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. Entweder war sie eine hervorragende Schauspielerin, oder aber sie hatte Ferdinand von Mertesheimer wirklich geliebt. Dann allerdings musste sich die Tochter des Toten in einem großen Irrtum befinden und das wollte ich zu diesem Zeitpunkt ebenso wenig glauben. Was ich brauchte, waren erheblich mehr Antworten, als ich sie bislang erhalten hatte. „Hat mein Mann sehr gelitten?“, fragte die Witwe mit zittriger Stimme. „Der Bericht des Rechtsmediziners liegt zwar noch nicht vor, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass er sofort tot war.“ Plötzlich starrte sie mich aus schreckgeweiteten Augen an. „Sie dürfen ihn nicht aufschneiden!“ „Es tut mir außerordentlich Leid, Frau von Mertesheimer, aber in diesem Fall ist eine Obduktion zwingend vorgeschrieben.“ „Ich möchte meinen Mann noch einmal sehen.“ „Natürlich. An der Identität Ihres Gatten besteht zwar kein Zweifel, aber die Identifizierung durch einen nahen Verwandten oder dergleichen, ist ohnehin notwendig.“ Sie schien sich wieder einigermaßen beruhigt zu haben. Schließlich wurde ihr sogar bewusst, dass wir uns immer noch in der Diele befanden. „Entschuldigen Sie bitte, Sie müssen mich ja für unmöglich halten, dass ich Sie nicht hereinbitte.“ „Aber nein,“ beruhigte ich sie. „Im Gegenteil, ich bewundere es, wie Sie sich diesem Schicksalsschlag stellen.“ „Bitte folgen Sie mir, Herr Winter.“ Während ich mich auf ihr Geheiß in einer ultramodernen Rundsitzgruppe niederließ, schenkte sie uns einen Drink ein. Ich hatte mich für ein Mineralwasser entschieden. „Fühlen Sie sich in der Lage, mir noch einige Fragen zu beantworten?“ Die Frau mit dem kastanienbraunen Haar setzte sich mir gegenüber und schlug ihre gertenschlan-ken Beine übereinander. Von Mertesheimer musste um die zwanzig Jahre älter als sie gewesen sein. „Wenn es hilft, den Schuldigen hinter Schloss und Riegel zu bringen?“ „Ich wurde vorhin Zeuge einer recht heftigen Auseinandersetzung zwischen Ihrer Stieftochter und Ihnen. Vielleicht sind Sie so nett und erklären mir, was sie damit meinte, als sie Ihnen vorwarf: Sie hätten Ihr Ziel erreicht.“ Die Witwe verdrehte die Augen. „Sie dürfen dem, was Sina von sich gibt, nicht all zu viel Bedeutung beimessen, sie ist ein kleines Biest, was nur auf ihren eigenen Vorteil aus ist. Ferdinand und ich waren annähernd zwei Jahre miteinander verheiratet. In dieser Zeit hat sie uns das Leben mitunter zur Hölle gemacht. Ihrer Ansicht nach trugen Ferdi und ich am Tode ihrer Mutter die Schuld.“ „Und, trugen Sie?“, fragte ich provozierend nach. „Wo denken Sie hin! Ferdis Ehe existierte doch nur noch auf dem Papier. Erst als er mich traf, bekam das Leben für ihn wieder einen Sinn. Dies kleine Biest hat immer wieder versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben. Aber dazu war unsere Liebe zu tief.“ Gloria von Mertesheimer war jetzt geradezu bemerkens-wert gefasst. Sie nippte immer wieder an ihrem Martini, während ich mir Notizen machte. „Hm, eine Sache liegt mir nun doch noch am Herzen. Darf ich fragen, in wie weit Sie nach dem Tode Ihres Gatten finanziell abgesichert sind?“ Sie leerte ihr Glas und stellte es auf den kleinen Marmortisch, der sich neben der Sitzecke befand. „Wir hatten Gütertrennung, ich bestand darauf, als wir heirateten. Es sollte nicht heißen, dass ich Ferdi nur seines Geldes wegen genommen hätte. Aber das wollten Sie ja gar nicht wissen,“ lächelte sie theatralisch. „So viel ich weiß, gibt es eine Lebensversicherung zu meinen Gunsten. Um wie viel es sich dabei handelt, kann ich Ihnen leider nicht sagen.“ Ich steckte Block und Kuli ein und erhob mich. „Also gut, dann soll es mir zunächst reichen. Wo kann ich Sie wegen der Identifizierung erreichen, oder falls weitere Fragen auftauchen?“ Die attraktive Witwe erhob sich ebenfalls. „Ich denke, ich werde das Haus in den nächsten Tagen nicht verlassen.“ „Gut, ich werde mich bei Ihnen melden.“ Während der Fahrt ins Präsidium wollte mir das Bild der sich prügelnden Frauen nicht aus dem Sinn gehen. Immer wieder suchte ich nach dem Grund für meinen Argwohn. Irgend etwas schmeckte mir an dieser Szene nicht, aber so sehr ich auch darüber grübelte, die Erleuchtung blieb aus. -4Braunschweig, Münzhandelshaus Koch, Montag Morgen, 3:15 Uhr Der Löwe warf den Lastensack mit der schweren Ausrüstung wütend auf den Küchentisch. Alles hatte so gut begonnen, war wie am Schnürchen gelaufen, bis er unfreiwilliger Zeuge eines Mordes wurde. Tatenlos hatte er mit ansehen müssen, wie keine fünf Meter von ihm entfernt ein Mensch getötet wurde. Und das schlimmste an dieser Sache war, dass man ihm dieses Verbrechen anlasten würde. Das war so sicher, wie das Amen in der Kirche. Das Zeichen, welches er stets in der Euphorie gelungener Beutezüge am Tatort zurückgelassen hatte, um sich von den gemeinen Dieben abzuheben, würde ihm nun zum Verhängnis werden. Wie sollte er die Bullen davon überzeugen, dass er mit dem Mord nichts zu tun hatte? Zwar ahnte niemand, dass er jener Meisterdieb war, aber auch wenn es nur ein Pseudonym war, welches er sich selbst gegeben hatte, eine derart niederträchtige Tat würde alles in den Dreck ziehen. An diesem Morgen fand der Löwe nicht in den verdienten Schlaf. Jedes Mal, wenn er seine Augen schloss, hatte er das Bild des sterbenden Mannes im Pyjama vor Augen. Immer und immer wieder fragte er sich, ob er den Tod des Mannes nicht doch hätte verhindern können. Nicht etwa deshalb, weil er seinen Sinn für Gerechtigkeit plötzlich wieder entdeckt hatte, nein, darum ging es ihm nun wirklich nicht. Sein Ruf als Meisterdieb durfte nicht besudelt werden. Immer wieder rief er die Bilder des Mordes vor seinem geistigen Auge ab, doch so sehr er sich auch auf jede einzelne Szene konzentrierte, das Gesicht des Mörders konnte er nicht erkennen. Er sah sich im Geiste hinter dem Lüftungsgitter liegen. Sah sich, wie er den Killer durch die schmalen Schlitze beobachtete, wie er zurückwich, als ihm die kleine Lampe aus den Fingern glitt und der Mann mit der Waffe misstrauisch auf ihn zukam, doch nicht ein einziges Mal sah er in das Gesicht des Mörders. Bestenfalls konnte er ihn von der Seite beschreiben, aber würde eine solch vage Beschreibung ausreichen, um die Bullen von seiner Unschuld zu überzeugen? Sicher nicht, gab er sich selbst die Antwort. Es gab nur einen Ausweg aus dem Schlamassel – er musste den Mörder auf eigene Faust suchen und ihn den Bullen auf einem Silbertablett servieren. Damit würde er nicht nur den Ruf des Löwen retten, sondern eine Art Robin Hood der Neuzeit werden. Nur welchen Grund hatte der Killer, Sebastian von Mertesheimer zu töten? Alles was der Löwe aus seinem Gedächtnis abrufen konnte, waren Worte der Rache, mit denen der Mörder sein Opfer in Panik versetzte. Der Löwe stutzte. Hatte der Killer nicht auch von dem Bruder seines Opfers gesprochen? Hatte er nicht davon gesprochen, dass den Mitinhaber des Münzhandelshau-ses das gleiche Schicksal ereilen würde, wie es seinem Bruder in der Nacht zuvor bereits widerfahren war? Der Löwe kombinierte weiter. Nur so kann es sein, die Brüder von Mertesheimer mussten ihrem Mörder etwas schreckliches angetan haben. Des Rätsels Lösung musste also in der Vergangenheit der Brüder begründet sein, da war sich der Löwe sicher. Nur so konnte es sein. Es würde nicht leicht werden unerkannt zu recherchieren, aber wenn er etwas bewirken wollte, musste er auch etwas riskieren. -5Bremen, Polizeipräsidium, Montag Vormittag. „Brrrrr, dieser elende Automatenkaffee bringt mich eines Tages noch mal ins Grab,“ schimpfte ich. „Edda schüttelte verständnislos mit dem Kopf. „Du weißt doch wie er schmeckt, was holst du dir das braune Gebräu immer wieder.“ „Die Hoffnung stirbt bekanntlich zu letzt,“ bekundete ich voller Überzeugung. „So ein leckerer Kaffee, wie ihn Helga zubereitet, wäre jetzt genau das richtige,“ schwärmte ich fasziniert. Helga war die Sekretärin unseres Chefs, des Kriminalrats Gerd Kretzer, oder der Bluthund, wie wir ihn früher nannten, als er noch als Leiter der MK 2 in vorderster Front neben mir stand und wir gemeinsam, Seite an Seite das Verbrechen bekämpften. Sie war im ganzen Präsidium berühmt für ihren erlesenen Kaffee. Immer dann, wenn die Dinge nicht so gut liefen und wir zu einer Besprechung beim Chef zitiert waren, war er so etwas wie ein Licht am wolkenverhangenen Himmel. Die ersten 24 Stunden nach einem Mord sind für die Aufklärung des Falles oft von entscheidender Wichtig-keit. Nicht selten werden solche Verbrechen in dieser Zeitspanne aufgeklärt. In unserem Fall fehlten diese ersten 24 Stunden leider völlig. Daher musste das Ermittlungsschema, nach dem wir uns vortasteten, ein völlig anderes als gewöhnlich sein. Zunächst wurde das Umfeld des Opfers sondiert. Jeder, der unmittelbar mit dem Toten zu tun hatte, wurde genaustens abgeklopft. All diejenigen, die nur mittelbar mit ihm zu tun hatten, wurden rastermäßig und nach Gefühl überprüft. „Hat sich im Space Center etwas ergeben?“, fragte ich meine Dienstpartnerin Edda Blache. „Sehr beliebt war Ferdinand von Mertesheimer nicht gerade,“ resümierte sie. „Zu erst gab es nur den üblichen Kollegentratsch, aber dann wurde doch immer deutlicher, dass sich der Big Boss durch seine Heirat mit Gloria Hackspiel vor allem unter der weiblichen Belegschaft nicht gerade viele Freundinnen gemacht hatte.“ „Lass mich raten,“ unter-brach ich ihre Ausführungen. „Gloria Hackspiel tanzte vor ihrer Hochzeit auf der gleichen Bühne, wie deine Informantinnen.“ Edda hob bewundernd die Brauen. „Volltreffer! Seine jetzige Frau war seine damalige Sekretärin. Man munkelt sie habe ihn nur wegen des Geldes geheiratet. Die werte Dame soll so kalt sein, wie eine Hundeschnauze.“ Das Klappen der Tür zum Büro meiner beiden Kollegen unterbrach unser Gespräch. Es war Aron, der einige Zettel und einen Kaffeebecher in der Hand hielt. Er kam durch die offen stehende Verbindungstür zu uns herüber. „Ich war noch schnell bei den Kollegen der Spurensicherung. Die ersten Ergebnisse habe ich bereits mitgebracht,“ erklärte er und mit den Zetteln winkend. „Und?“, fragte ich erwartungsvoll, „irgend etwas verwertbares dabei?“ „Wenn du meinst ob der Mörder seinen Pass vergessen hat, muss ich dich enttäuschen, aber es wurden jede Menge Fingerabdrücke sichergestellt. Die meisten auf den Müllsäcken und dem Mobilart. Es wird eine Wahnsinns Arbeit werden, die alle zuzuordnen.“ „Wenn wir überhaupt jemals die passenden Finger dazu finden,“ warf Edda nachdenklich ihr langes, zu einem Zopf gebundenes Haar nach hinten. „War das alles was die Jungs von der Kriminaltechnik gefunden haben?“, fragte unsere Kollegin enttäuscht. Ich zündete mir eine Zigarette an und verzog ebenfalls das Gesicht. „Kann es sein, dass du dieses unselige Laster irgendwann einmal aufgibst?“, feixte sie ohne es wirklich witzig zu meinen. Edda war leidenschaftliche Nichtraucherin und Verfechterin eines rauchfreien Arbeitsplatzes. Obwohl wir uns in meinem Büro befanden, schaffte sie es immer wieder, dass ich mich wie ein Egoist fühlte, wenn ich in ihrer Gegenwart rauchte. „Entschuldige, ich war ganz im Gedanken.“ „So viel kann man doch gar nicht denken,“ konterte sie respektlos. Das war mal wieder eine dieser Situationen, in denen ich mir wünschte, einer von denen zu sein, die mehr Autorität auf ihre Mitstreiter ausüben. Andererseits war ich weder der Typ zu einem Disputen noch der Freund einer sogenannten Hackordnung. Mir ist es wichtiger, wenn ich mich auf meine Dienstpartner verlassen kann. „Hallo,“ unterbrach Aron unser Zwiegespräch. „Seit ihr gar nicht neugierig was Stocki sonst noch für uns hat?“ „Ich bin ganz Ohr,“ wandte ich mich meinem Partner und langjährigen Freund zu. „Volltreffer!“, frohlockte er. „Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.“ Ich starrte er ihn, dann Edda verwirrt an. Aber die hatte unseren Kollegen eben so wenig verstanden. „An der Tür zu Mertesheimers Büro gibt es einen Abdruck.“ „Na und?“, haderte Edda enttäuscht. „Es handelt sich um einen Ohrabdruck.“ Ich war sprachlos, was nicht gerade häufig vorkommt. Die Ohrabdrucktechnik ist eine deutsche Erfindung, die erst seit einigen Jahren Furore macht. Der Abdruck eines Ohres ist ebenso unverwechselbar, wie der gute alte Fingerabdruck. Selbst im fernen Amerika sind mit Hilfe dieser neuartigen Technik bereits Erfolge erzielt worden. Warum sollte diese Technik also nicht auch uns dabei helfen, den möglichen Täter zu überführen? Leider ist es im Bundesland Bremen bei der erkennungsdienstlichen Behandlung überführter Straftäter noch nicht Usus, neben den Fingerprints auch gleich deren Ohrabdrucke zu nehmen. Was wiederum dazu führt, dass es erst eine relativ kleine Datenbank gibt. Eine Überprüfung des gefundenen Abdrucks würde somit zwar sehr schnell vonstatten gehen, ein positives Ergebnis wäre allerdings auch einem Sechser im Lotto gleichzusetzen. „Ingo Klee hat den Abdruck schon durch den blechernen Kollegen gejagt, aber leider ohne Erfolg,“ erklärte Aron. „Hm, das war eigentlich vorauszusehen.“ Aron zuckte mit den Schultern. „Hätte ja trotzdem sein können.“ „Auf jeden Fall wird uns dieser Abdruck von Nutzen sein, wenn es darum geht, den Täter oder die Täterin zu überführen,“ resümierte Edda betont sachlich. „Nur haben müssten wir ihn halt erst einmal,“ seufzte Aron. Meine Stirn krauste sich. „Womit wir also wieder beim Thema wären.“ Ich leerte nachdenklich die lauwarme Neige in meinem Plastikbecher und wartete auf Wortmeldungen. „Nach Auskunft der Telekom wurde der letzte Anruf aus dem Büro Ferdinand von Mertesheimers um exakt 2:36 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag getätigt. Es handelte sich dabei um den Anschluss seines Bruders, den ich durch Aktivieren der Wahlwiederholung erreichte,“ fasste Aron zusammen. „Seines toten Bruders, wie wir inzwischen wissen,“ ergänzte Edda. „Gut möglich, dass es sich bei diesem Anruf um einen Hilferuf handelte,“ mutmaßte mein Partner. „Wenn es so war,“ überlegte ich, „verstehe ich allerdings nicht, weshalb er seinen Bruder im über zweihundert Kilometer entfernten Braunschweig anruft und nicht den Polizeinotruf?“ „Demnach glaubst du nicht an einen Hilferuf?“, wog Aron abschätzend den Kopf. Edda zog die Mundwinkel nach unten. „Denkbar ist grundsätzlich alles.“ „Richtig,“ pflichtete ich der Kriminalhauptwachtmeisterin bei. Aron machte ein nachdenkliches Gesicht. „Demnach wäre es auch denkbar, dass er, den sicheren Tod vor Augen, seinen Bruder warnen wollte.“ „Das setzt natürlich voraus, dass es sich um denselben Täter handelt,“ bekräftigte Edda. „Nicht unbedingt um denselben Täter,“ widersprach ich. „Aber zumindest ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass beide Verbrechen in irgendeiner Form miteinander zu tun haben.“ „Du warst doch bei den Angehörigen des Getöteten, wie war dein Eindruck von der Witwe?“, wollte Edda von mir wissen. Ich winkte ab. Gloria von Mertesheimer repräsentiert nicht gerade die Dame von Welt, wenn ihr mich fragt. Womit ich nicht gesagt haben will, dass sie nicht durchaus reizvolle Züge hätte, aber nachdem, was ich von ihrer Stieftochter Sina gehört habe, soll sie doch sehr berechnend sein.“ „Sag ich doch!“ bekundete Edda. „Das deckt sich mit dem, was man mir im Space Center von der Dame erzählte.“ „Auf jeden Fall hat die gute Frau nach dem Tode ihres geliebten Gatten ausgesorgt. Sina von Mertesheimer erzählte mir, dass ihr Vater erst vor wenigen Tagen Haus und Hof auf ihre Stiefmutter überschrieben hat.“ „Na, das passt sich ja,“ spottete unsere Kollegin mit schiefem Grinsen. Genau in dem Moment, in dem ich unser weiteres Vorgehen miteinander koordinieren wollte, läutete das Telefon. Es meldete sich der Kollege Wolters aus Braunschweig. Er hatte einige neue Erkenntnisse für uns, die meine Theorie kräftig ins Wanken brachten. Demnach ginge der Mord an dem Münzhändler wohl eher auf das Konto eines berüchtigten Einbrechers, der im Volksmund nur der ‚Löwe‘ genannt wurde. Die Kollegen waren erst bei der Besichtigung der Verkaufsräume auf Einbruchsspuren gestoßen. Dort hatte besagter ‚Löwe‘ seine Visitenkarte hinterlassen. Auch wenn sich die Ausführungen des Oberkommissars recht plausibel anhörten und ich mich der Theorie des Kollegen nicht gänzlich verschließen konnte, so war ich, nachdem unser Gespräch beendet war, doch noch nicht restlos überzeugt. Meinen Partnern ging es da nicht anders. Sie hatten das Gespräch mit dem Kollegen der Braunschweiger Mordkommission über den zugeschalteten Lautsprecher unseres Telefons mitgehört. „Und nun?“, fragte Aron denn auch ziemlich bedröppelt. „Hm, nichts genaues weiß man nicht,“ zuckte ich mit den Schultern. „Also wenn ihr mich fragt, kommt mir die Sache mit der Witwe doch recht merkwürdig vor,“ verkniff Edda ihr Gesicht. „Geht mir auch so,“ pflichtete Aron ihr bei. „Also gut, dann wirst du, Aron, den Unfall der verstorbenen Ehefrau des Ferdinand von Mertesheimer noch einmal genau unter die Lupe nehmen und du, Edda, wirst dir die jetzigen Vermögensverhältnisse der Witwe ein wenig genauer ansehen. Ich werde mich inzwischen noch mal mit der Tochter unterhalten.“ -6- Irgendwo in Niedersachsen, Montag Vormittag. Mehr als ein heruntergekommener Resthof war es nicht mehr, jenes Anwesen, zu dem vor noch nicht allzu langer Zeit ein kleiner Wald, ein idyllisch gelegener See und ein gutes Stück des besten Ackerlandes der gesamten Gegend gehörte. Ein alter Familienbesitz, der bereits seit geraumer Zeit vom Vater auf den Sohn übergeben wurde. Dem Mann in dem weißen Mercedes verkrampfte sich jedes Mal, wenn er an diesen Ort zurückkehrte, das Herz in der Brust. Dies sollte auch einmal sein Erbe werden und er sollte es an seinen Sohn weitergeben, doch alles was ihm geblieben war, war die Erinnerung an seinen Vater und an die Armut, in der er aufwuchs. Erst auf dem Sterbebett hatte sein Vater ihm von dem Unrecht erzählt, welches ihm die Brüder Mertesheimer angetan hatten und er begriff, dass der sterbende Mann in dem Bett vor ihm nicht nur körperlich, sondern vor allem seelisch schwer gelitten hatte. Das einzige, was er jetzt noch für seinen sterbenden Vater tun konnte, war in seinem Namen Rache zu üben. Der Mann nahm die Beretta aus dem Handschuhfach und schob sie in die Sporttasche, die neben ihm auf dem Beifahrersitz stand. Dann stieg er aus und öffnete das Scheunentor um den Wagen hineinzufahren. Niemand würde den Wagen darin vermuten. Niemand würde den Wagen mit Ferdinand von Mertesheimer in Verbindung bringen. Die Kennzeichen hatte er schon Wochen vorher von einem anderen Mercedes abmontiert und so gut verfälscht, dass es der Polizei nicht einmal dann auffallen würde, wenn sie direkt davor stünden. „Schön, dass du mich besuchen kommst,“ begrüßte ihn die von harter Arbeit gezeichnete Frau. Der Mann setzte wortlos die Sporttasche ab, schob sie mit dem Fuß unter die Kücheneckbank und setzte sich. Große Gefühle waren weder seine noch die Sache seiner Mutter. Zu sehr hatte sie das schwere Leben auf dem Lande geprägt. Die Frau in der Kittelschürze klapperte mit den Töpfen. „Kommst genau richtig, es wird für uns beide reichen. Ohne eine Miene zu verziehen, schob sie ihrem Sohn den Teller über die abgewetzte Holzplatte des Küchentisches. Gemeinsam aßen sie, was der Garten hergegeben hatte. „Damit ist jetzt Schluss, Mutter,“ sagte der Mann auf der Eckbank. „Der Hof wird verkauft und du kommst mit mir in die Stadt. Du sollst ein besseres Leben haben.“ „Kein normaler Mensch wird diesen Hof kaufen,“ entgegnete die Frau in der Kittelschürze. Ein hartes, von Verzweif-lung gezeichnetes Lächeln huschte über ihr faltiges Gesicht. „Ich weiß, du meinst es gut, Junge, aber hier liegt dein Vater begraben, hier will auch ich sterben.“ „Aber Mutter,“ ließ ihr Sohn nicht locker. „So nimm doch Vernunft an. Hast du all die Jahre nicht genug gelitten? Ich werde für dich sorgen und wenn du irgendwann einmal sterben solltest, dann werde ich dich neben Vater begraben.“ Er hob Zeige und Mittelfinger, als wenn er einen feierlichen Eid ablegen wollte. „Das verspreche ich dir, bei der Ehre meines Vaters.“ Seine Mutter strich ihm sanft lächelnd über das Haar. „Wenn du wirklich etwas Gutes tun willst, dann bleib hier und hilf mir den Hof zu halten.“ Der Mann erhob sich, durchmaß einige Male die Küche und blieb schließlich hinter dem Stuhl seiner Mutter stehen, um ihr seine Hände auf die Schultern zu legen. „Du weißt, dass ich nicht hier bleiben kann.“ Seine Mutter wandte den Kopf und sah zu ihm auf, um in das Gesicht ihres Sohnes sehen zu können. „Ich weiß, aber um so mehr musst du auch mich verstehen. Es war der sehnlichste Wunsch meines Vaters, dass der Hof in der Familie bleibt. So lange ich es kann, werde ich diesen Wunsch respektieren.“ „Ich wusste, dass du nicht anders reagieren würdest, aber dann erlaube mir, dass ich dir wenigstens von Zeit zu Zeit etwas Geld zukommen lasse.“ „Ich freue mich über jeden deiner Besuche, ob du mir nun etwas mitbringst oder nicht, wichtig ist, dass ich dich gelegentlich sehe.“ Noch immer ruhten seine Hände auf ihren Schultern, nur dass er ihr inzwischen den Nacken massierte. Sie genoss den sanften Druck seiner kräftigen Hände, fühlten sie sich doch genau so an, wie die, die sie vor vielen Jahren zärtlich auf ihrer damals noch jungen Haut verspürte. Es gab so vieles, was der Junge von seinem Vater hatte und doch gab es da etwas in ihm, das ihr Angst machte. Sie konnte nicht erklären, was es war, doch das Gefühl war da und jedes Mal, wenn sie in seinen Augen danach forschte, stieß sie auf eine dunkle Mauer des Schweigens, die alles verbarg. „Ich habe dich mit einem neuen Auto auf den Hof fahren sehen, seit wann hast du es?“ „Ein paar Tage,“ gab er vor und öffnete den Kühlschrank. „Kein Bier da?“ „Die Beerdigung deines Vaters hat meine gesamten Ersparnisse verschlungen.“ „Schreib auf, was du brauchst, ich fahre ins Dorf.“ Der Mann mit dem schmalen Oberlippenbart zog die blaue Sporttasche unter der Eckbank hervor und setzte sie auf dem Tisch ab. Bedächtig zog er den Reisverschluss auf, akribisch darauf bedacht, die Waffe, die er darin verstaut hatte, vor seiner Mutter versteckt zu halten. Schließlich zog er einen Umschlag aus der Tasche, griff hinein und entnahm einige Scheine, die er wortlos seiner Mutter reichte. Dann stellte er die Tasche zurück unter die Bank und verließ das Haus. „Meine Güte, dich habe ich hier ja schon ewig nicht mehr gesehen,“ begrüßte ihn der Glatzkopf mit dem weißen Kittel. „Wie geht es deiner Mutter?“ „Geht so,“ brummte der Mann mit dem Einkaufskorb. „Ich will schnell noch ein paar Dinge einkaufen, bevor Sie schließen.“ Der Glatzkopf grinste verächtlich und rieb Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand gegeneinander. „Ohne Moos nichts los.“ „Kann es sein, dass meine Mutter bei Ihnen in der Kreide steht?.“ „Allerdings,“ entgegnete ihm der Kolonialwarenhändler schnippisch. „Gut, dann machen Sie die Rechnung fertig!“ Der Glatzkopf stutzte. „Alles?“ Der Mann ihm Sportjackett, den der Einzelhändler von Kindesbeinen kannte, zog den Umschlag aus der Innentasche und entnahm drei Hunderter, die er seinem verblüfft dreinschauenden Gegenüber genüsslich unter die Nase hielt. „Reicht das? „Gewiss, gewiss,“ dienerte der Mann im weißen Kittel, um schon im nächsten Augenblick mit dem Geld in der Hand hinter der Kasse zu verschwinden. „Den Rest schreiben Sie bitte als Guthaben auf.“ „Natürlich, ganz wie du möchtest.“ Es dauerte eine Weile, bis der Mann im Sportjackett alles zusammen hatte, was ihm seine Mutter aufgeschrieben hatte. Schließlich legte er alles aufs Band und sah dem Glatzkopf zu, wie dieser die Preise in die Tasten der alten Registrierkasse tippte. „Was macht eigentlich Andrea?“, fragte er den Mann an der Kasse unvermittelt. Der Glatzkopf stellte augenblicklich seine Arbeit ein und starrte seinen Kunden entsetzt an. „Es geht ihr wieder gut und ich möchte, dass es so bleibt. Als du damals bei Nacht und Nebel das Dorf verlassen hast, hat sie sehr darunter gelitten. Es hat Monate gedauert, bis sie wieder ausgegangen ist. Ich bin froh, dass sie dich vergessen hat. Bitte belass es dabei!“ „Wenn dies auch der Wunsch deiner Tochter ist, ist es okay, aber dann soll sie es mir selber sagen.“ Der Glatz-kopf nahm all seinen Mut zusammen. Seine Fäuste ballten sich und er sah dem Mann, der seiner Tochter übel mitgespielt hatte, fest in die Augen. „In dem Augenblick, in dem ich dich durch die Tür meines Ladens hereinkommen sah, wusste ich, dass es wieder Ärger mit dir geben würde. Ich warne dich, lass meine Tochter in Ruhe!“ Der Killer lachte hämisch und gefährlich zugleich. Er erwiderte den Blick des Kolonialwarenhändlers, doch der Hass in seinen Augen war ungleich größer, als der Wille des Mannes an der Kasse. Irgendwann wandte sich der Glatzkopf ab. In diesem Moment wurde ihm bewusst, dass er den Kampf um seine Tochter zum zweiten Mal verloren hatte. „Sie brauchen keine Angst haben, dass ich Andrea ein zweites mal hier sitzen lasse.“ Der Mann im weißen Kittel wusste nicht so recht wie er die Aussage deuten sollte, aber als sein Gegenüber begann die bereits eingetippte Waren in einer Tüte zu verstauen, widmete auch er sich wieder dem Laufband zu.