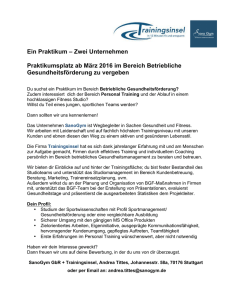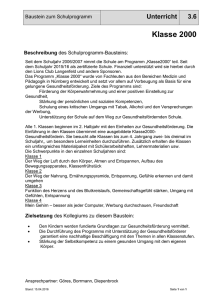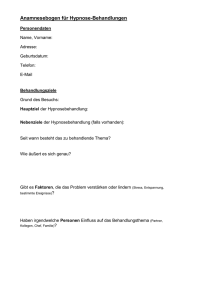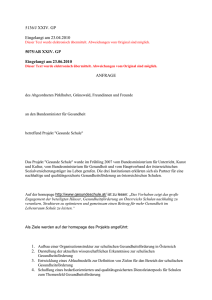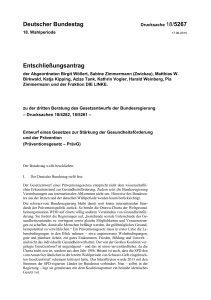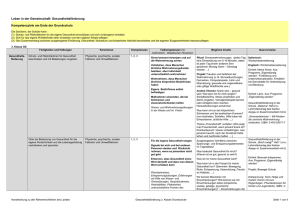KoelnerEntschl.1999aufber.19.11.08
Werbung
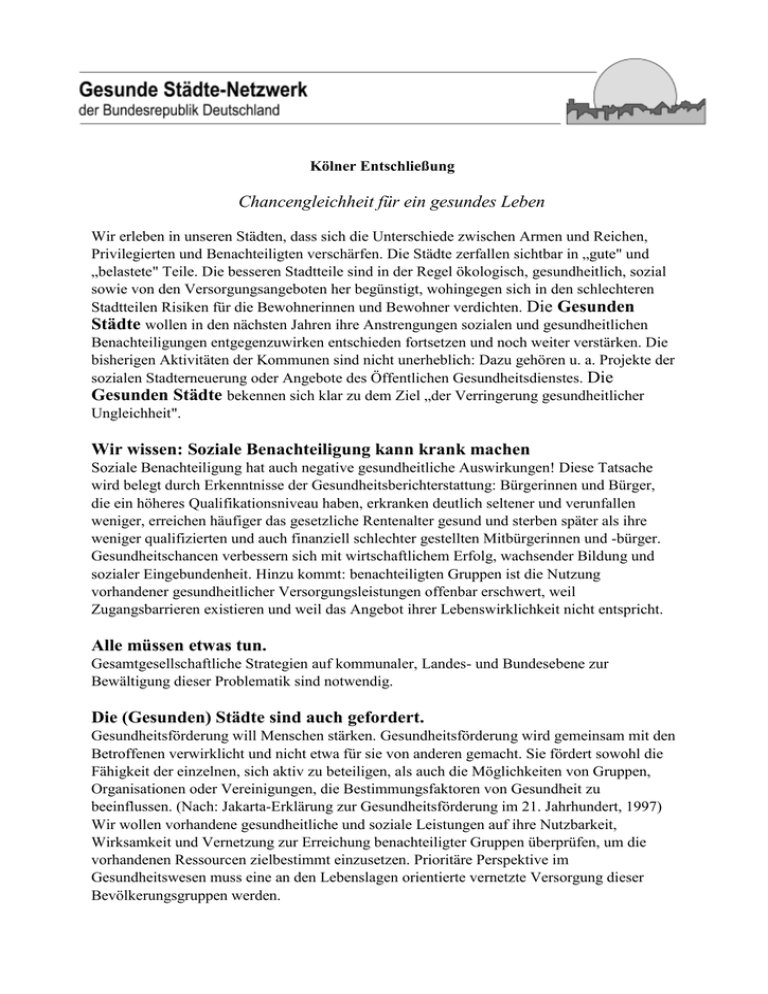
Kölner Entschließung Chancengleichheit für ein gesundes Leben Wir erleben in unseren Städten, dass sich die Unterschiede zwischen Armen und Reichen, Privilegierten und Benachteiligten verschärfen. Die Städte zerfallen sichtbar in „gute" und „belastete" Teile. Die besseren Stadtteile sind in der Regel ökologisch, gesundheitlich, sozial sowie von den Versorgungsangeboten her begünstigt, wohingegen sich in den schlechteren Stadtteilen Risiken für die Bewohnerinnen und Bewohner verdichten. Die Gesunden Städte wollen in den nächsten Jahren ihre Anstrengungen sozialen und gesundheitlichen Benachteiligungen entgegenzuwirken entschieden fortsetzen und noch weiter verstärken. Die bisherigen Aktivitäten der Kommunen sind nicht unerheblich: Dazu gehören u. a. Projekte der sozialen Stadterneuerung oder Angebote des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Gesunden Städte bekennen sich klar zu dem Ziel „der Verringerung gesundheitlicher Ungleichheit". Wir wissen: Soziale Benachteiligung kann krank machen Soziale Benachteiligung hat auch negative gesundheitliche Auswirkungen! Diese Tatsache wird belegt durch Erkenntnisse der Gesundheitsberichterstattung: Bürgerinnen und Bürger, die ein höheres Qualifikationsniveau haben, erkranken deutlich seltener und verunfallen weniger, erreichen häufiger das gesetzliche Rentenalter gesund und sterben später als ihre weniger qualifizierten und auch finanziell schlechter gestellten Mitbürgerinnen und -bürger. Gesundheitschancen verbessern sich mit wirtschaftlichem Erfolg, wachsender Bildung und sozialer Eingebundenheit. Hinzu kommt: benachteiligten Gruppen ist die Nutzung vorhandener gesundheitlicher Versorgungsleistungen offenbar erschwert, weil Zugangsbarrieren existieren und weil das Angebot ihrer Lebenswirklichkeit nicht entspricht. Alle müssen etwas tun. Gesamtgesellschaftliche Strategien auf kommunaler, Landes- und Bundesebene zur Bewältigung dieser Problematik sind notwendig. Die (Gesunden) Städte sind auch gefordert. Gesundheitsförderung will Menschen stärken. Gesundheitsförderung wird gemeinsam mit den Betroffenen verwirklicht und nicht etwa für sie von anderen gemacht. Sie fördert sowohl die Fähigkeit der einzelnen, sich aktiv zu beteiligen, als auch die Möglichkeiten von Gruppen, Organisationen oder Vereinigungen, die Bestimmungsfaktoren von Gesundheit zu beeinflussen. (Nach: Jakarta-Erklärung zur Gesundheitsförderung im 21. Jahrhundert, 1997) Wir wollen vorhandene gesundheitliche und soziale Leistungen auf ihre Nutzbarkeit, Wirksamkeit und Vernetzung zur Erreichung benachteiligter Gruppen überprüfen, um die vorhandenen Ressourcen zielbestimmt einzusetzen. Prioritäre Perspektive im Gesundheitswesen muss eine an den Lebenslagen orientierte vernetzte Versorgung dieser Bevölkerungsgruppen werden. Dieses Ziel verlangt: 1. selbstkritische Auseinandersetzung Gesundheitliche Dienstleistungen müssen auf den Prüfstand. Gefordert ist eine selbstkritische Reflektion zur Beantwortung der Frage, weshalb gesundheitliche und soziale Dienstleistungen bestimmte Gruppen von Menschen nicht erreichen und für sie eine zu geringe Attraktivität haben. Gesundheitliche und soziale Dienstleistungen müssen so organisiert werden und so auf ihre Nutzer zugehen, dass gerade die Zielgruppe benachteiligter Menschen sie nutzen kann und von ihnen profitiert. 2. Qualität Orientierungsrahmen für die Zielerreichung: 2.1 Stadtentwicklung unter gesundheitlicher und sozialer Perspektive - Wir wollen Schritt für Schritt erreichen, dass stadtpolitische Entscheidungen auch auf ihre Auswirkungen auf die Gesundheit und die Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten der Bürgerinnen und Bürger systematisch geprüft werden. Dafür wollen wir Instrumente und Strukturen entwickeln bzw. stärken. - Gesundheitsförderung, die Menschen nachhaltig erreichen will, muss herausfinden, was Bürgerinnen und Bürger wollen und sich an deren Interessen und Kompetenzen ankoppeln. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Gestaltung ihrer Lebensräume hat eine grundlegende auch gesundheitsfördernde Bedeutung. Wer beteiligt wird, gewinnt an Selbstvertrauen und Verantwortungsgefühl, weil seine Kompetenzen und Erfahrungen ernst genommen und nachgefragt werden. Damit sich Beteiligung entwickeln kann, muss es in Stadtteilen verlässliche Ansprechpartner und eine Infrastruktur geben, die Bürgerinnen und Bürger für ihre Beteiligungsaktivitäten nutzen können („der Ort vor Ort", z.B. Gruppenraum, Telefon, Kopierer, Fax). 2.2 Regionale Kooperation von Akteuren der gesundheitlichen und sozialen Versorgungsstruktur - Die Versorgungsstrukturen müssen durchlässiger werden. In den Mittelpunkt der Arbeit rücken die Fragen, wen die Einrichtungen erreichen und für welche Gruppen sie keine Attraktivität besitzen. Nutzer- bzw. Bürgerbefragungen können helfen, das inhaltliche und methodische Repertoire der Einrichtungen zu verbessern. - Eine problemgerechte Versorgung benachteiligter Bevölkerungsgruppen muss eine vernetzte Versorgung sein. Multiprofessionelle Zusammenarbeit in den Stadtteilen kann über das bessere Kennenlernen der Akteure untereinander zu einer erfolgreichen Vernetzung der gesundheitlichen und sozialen Dienstleistungen und Informationen führen, ein wirksames Frühwarnsystem zur Benennung von Defiziten sein, eine Verständigung auf prioritäre Gesundheitsziele erbringen, vorhandene Stärken weiterentwickeln, das Versorgungsnetz engmaschiger gestalten und zu -2- einer betroffenengerechten Abstimmung von Angeboten und Leistungen führen. Zum Aufbau dieser regionalen Kooperationsstrukturen bzw. zu ihrer Unterstützung (dort, wo es sie schon gibt) sind Koordinierungsstellen Voraussetzung, auch mit der Zielsetzung einer optimierten Nutzung vorhandener Ressourcen. 2.3 Einbezug von Institutionen und Personen, insbesondere außerhalb des Gesundheitsbereichs, zur Vermittlung gesundheitsbezogener Informationen - Damit benachteiligte Menschen besser als bisher gesundheitliche Leistungen nutzen können, müssen diese Angebote den Zielgruppen bekannt sein und Zugangsschwellen abgebaut werden. Deshalb sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere von sozialen und Bildungs-Einrichtungen aktiviert und unterstützt werden, die Thematik der Gesundheitsförderung aufzugreifen und entsprechende Wegweisungen zu gesundheitsbezogenen Angeboten geben zu können. 2.4 Verstärkte Angebote im Aus- und Fortbildungsbereich zur Förderung pädagogischer, psychologischer, psycho-sozialer und methodischer Kompetenzen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen müssen fortgebildet werden, damit sie durch ihre Haltung, ihr Verhalten und die Organisation ihres Leistungsangebotes mit den benachteiligten Nutzergruppen wirksam zusammen arbeiten können. - Diese Fortbildungen helfen, die Kompetenzen insbesondere der benachteiligen Gruppen zu entdecken und zu respektieren. Gesundheitsfördernde Aktivitäten sollten deshalb alle Menschen als Experten ihrer jeweiligen Lebensbereiche ansprechen. Deren Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung bzw. zur Änderung von gesundheitsgefährdenden Lebensbedingungen sind zu aktivieren. - Gegenwartsnahe Techniken der Problembewältigung sollten statt langfristiger Strategien entwickelt werden, um dem Lebensrhythmus von Teilen der Zielgruppe zu entsprechen. Die Städte nicht alleine lassen Die Kommunen brauchen die Unterstützung durch die Landesebenen und Bundesebene. Aktionspläne zu Gesundheit und sozialer Lage sind zusammen mit Kommunen zu entwickeln und zu verabschieden. Hier sind Bund und Länder gefordert, entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. Gesunde Städte-Symposiums 1999 am B. und 9.11.1999 „Gesundheit für alle - eine Herausforderung (nicht nur) für Gesunde Städte" in Köln -3-