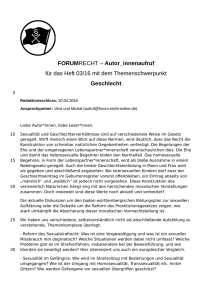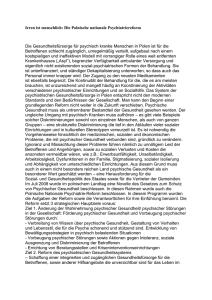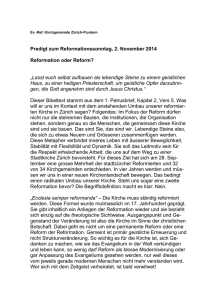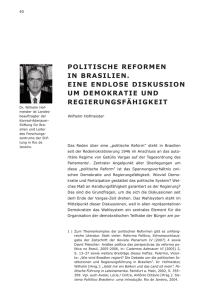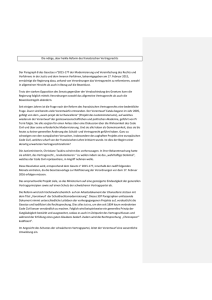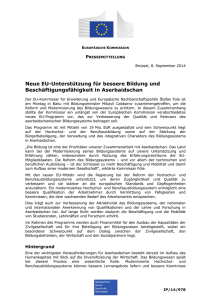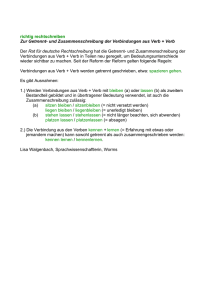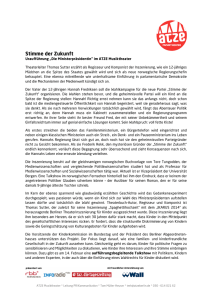Eine neue Glaubensbildung
Werbung

Zusammenfassung Otto Hauglin (red.), Håkon Lorentzen (red.) und Sverre Dag Mogstad (red.): Wissen, Erfahrung und Zugehörigkeit. Eine Evaluation der Testphase der Glaubensbildungsreform innerhalb der Norwegischen Kirche Fagbokforlaget, Bergen 2008 Einleitung Die Norwegische Kirche ist eine evangelisch-lutherische Volkskirche mit breiter politischer Stütze. 83% der Bevölkerung von 4,7 Millionen sind Mitglieder der Norwegischen Kirche. Mit dem Firmungsgesetz von 1736 und dem Schulgesetz von 1739 wurde der Taufunterricht verpflichtend, und bis 1969 war die Schule für die religiöse Bildung verantwortlich. In dieser Zeitspanne war der Taufunterricht zweigeteilt, in den Religionsunterricht in der öffentlichen Schule und den Konfirmandenunterricht in der Kirche. Mit dem neuen Schulgesetz von 1969 wurde der Religionsunterricht in der Schule nicht mehr als Taufunterricht der Kirche angesehen, sondern als ein gewöhnliches Schulfach. 1997 wurde der Religionsunterricht multireligiös und der Unterricht im christlichen Glauben auf die Hälfte reduziert. Die Änderungen im Schulgesetz und die allgemeine Entwicklung der Kultur und Gesellschaft in Norwegen Ende der 90er Jahre führten dazu, dass die Kirche eine umfassende Reformierung der religiösen Bildung einleitete. Obwohl Ende der 90er eine Reihe von Unterrichtsplänen entwickelt worden waren, bekam die Kirche erst durch die Entscheidung des Parlaments die nötige Stütze für die Reform der Glaubensbildung. Der politische Untersuchungsausschuss begann seine Arbeit 1999 und wurde 2003 damit abgeschlossen, dass das Parlament sich für eine umfassende, staatlich-finanzierte Reform des Taufunterrichts in der Norwegischen Kirche aussprach: die Glaubensbildungsreform („Trosopplæringsreformen“). Die Kirche hatte jahrzehntelang daran gearbeitet, die Glaubensbildung zu vitalisieren, und die Initiativen der Norwegischen Kirche wurden von internationalen Bewegungen bestärkt, wie z.B. der Arbeit des Lutherischen Weltverbands bezüglich der Rolle der Familie im Unterricht, lebenslangem Lernens und gemeindepädagogischem Neudenkens. Bevor die Glaubensbildungsreform begann, hatte die Norwegische Kirche bereits eine Reihe neuer Unterrichtspläne beschlossen. Die Pläne verkörperten eine Revitalisierung der Tauftheologie in der das Ziel nicht länger unbedingt war, Kinder und Jugendlichen zu Christus zu führen, sondern jedem Einzelnen von ihnen zu helfen, ihr Taufversprechen in der kirchlichen Gemeinschaft zu leben. Es war eine Bewegung weg vom Erweckungschristentum und hin zum Erziehungschristentum, in dem Unterricht als mehr als die Aneignung von Wissen verstanden wird. Die religiöse Bildung vor der Reform hielt sich im Grossen und Ganzen an die Pläne von 1991, in denen kontinuierliche und begrenzte Maßnahmen voneinander getrennt waren, und wo es einen grundsätzlichen Wissensinhalt gab. Der Unterricht umfasste Kinder und Jugendliche im Alter von 0-15 Jahren und wurde mit der Firmung abgeschlossen. Die Menge der Teilnehmer am Glaubensunterricht war nicht immer gleich, aber die Überreichung eines Religionsbuches an 4jährige und der Bibel oder des Neutestaments an 11jährige sowie die Firmung waren immer Höhepunkte. Viele Gemeinden hatten darüber hinaus nur begrenzte Angebote, und manche hatte wenige oder gar keine Angebote für bestimmte Altersgruppen. Parallel dazu erlebten die freiwilligen Kinder- und Jugendorganisationen, die ja auch eine wichtige Rolle in der Glaubensbildung spielten, einen deutlichen Rückgang an Mitgliedern ab den 80er Jahren bis heute. Das Parlament begründete die neue Reform unter anderem mit den Änderungen im Schulfach Religion, aber auch mit den großen kulturellen und religiösen Veränderungen in der norwegischen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten. Gleichzeitig äußerte das Parlament den Wunsch, die Norwegische Kirche als breite Volkskirche und Traditionsträger und Vermittler des christlichen Kulturerbes zu stärken. In einer Gesellschaft mit wachsender kultureller und religiöser Vielfalt sei es wichtig, dass Kinder und Jugendliche in ihrem eigenen Glauben unterrichtet würden, sowohl um die eigene Identität zu stärken, als auch um andere Kulturen verstehen zu können und fremden Traditionen mit Respekt und Toleranz begegnen zu können. Am 27. Mai 2003 behandelte das Parlament die Einstellung des Kirchen-, Unterrichts- und Forschungsministeriums bezüglich der Glaubensbildungsreform in der Norwegischen Kirche. Eine überwiegende Mehrheit mehrerer Parteien unterstützte den Vorschlag, die Glaubensbildung und den Taufunterricht in der Kirche zu erneuern und zu stärken. Die Reform solle von den Gemeinden ausgehen und dort verankert sein. Sie solle sich über 10 Jahre strecken, wobei die ersten 5 als Projektphase mit Versuchs- und Entwicklungsarbeit organisiert sein solle. Diese Phase solle mit einer forschungsbasierten Evaluation abgeschlossen werden. Die Projektphase wurde auf zwei Ebenen organisiert: einer zentralen Projektverwaltung, sowie lokalen Leitungsgruppen und Projektleitern in den schlussendlich 156 Versuchsprojekten, die 350 der ca. 1300 Gemeinden in der Norwegischen Kirche umfassten. Ca. 80% aller Gemeinden hatten sich darum beworben, eine Versuchsgemeinde werden zu dürfen. Bei der Evaluation des Ansuchungs- und Verteilungsprozesses haben wir festgestellt, dass die Projektverwaltung die Mittel nicht ausschließlich aufgrund der Versuchskriterien verteilt hatte, sondern die Beurteilung sowohl aus der Versuchsperspektive wie auch aus der Perspektive der Einführung der Reform vorgenommen hatte. Dies hat unserer Meinung nach die Möglichkeiten einer breiten und systematischen Erprobung bedeutend verringert. Es wurden verhältnismäßig wenige Rahmenbedingungen vorgegeben, was der Versuchsphase, wie vom Parlament vorgesehen, einen „bottom-up“ Stil gab. Die lokalen Versuchsprojekte umfassten mehrere tausend Aktivitäten, fast 300 Angestellte und mehrere tausend Freiwillige. Die Gemeinden mussten detaillierte Berichte verfassen und bekamen je einen Mentor zur Seite. Zusätzlich wurde im Laufe der Zeit ein Kompetenznetzwerk errichtet, das Mittel an die 79 regionalen und nationalen Entwicklungsprojekte verteilte. Alles in allem wurden in den Jahren 2004-2008 NOK 375 Mio. für die Durchführung der Versuchsphase bewilligt, von denen 288 Mio. an lokale Projekte gingen. Wir sind der Meinung, dass die Glaubensbildungsreform als Projekt gut organisiert war, und dass es richtig war, die Versuchsphase als Projekt zu organisieren. Die Evaluationsgruppe bestand aus Forschern der Theologischen Gemeindefakultät (MF) und der Hochschule Diakonhjemmet sowie Otto Hauglin von Otto Hauglin Consulting. Die Gruppe hat die Versuchsphase dieser umfassenden Reform 4,5 Jahre begleitet (Dez. 03 – Mai 08). Wissen, Erfahrung und Zugehörigkeit…. ist der Hauptbericht der Evaluationsgruppe in dem Funde und Analysen zusammengefasst und die wichtigsten Schlüsse gezogen werden. Die konkrete Arbeit wurde Mitte April 2008 abgeschlossen und deckt den größten Teil der 5jährigen Versuchsphase. Eine neue Glaubensbildung Die Behandlung im Parlament bedeutete eine neue Phase in der Geschichte der Glaubensbildung und deren Funktion in der Norwegischen Kirche. Das Parlament hatte eine „bottom-up“ Strategie gewählt und wenige Rahmenbedingungen gestellt, sodass die Gemeinden großen Spielraum beim Erproben neuer Initiativen für die religiöse Bildung hatten. Ziel der Reform war es, allen Gemeinden innerhalb der Norwegischen Kirche die Möglichkeit zu sichern, allen Getauften im Alter von 0 bis 18 Jahren eine systematische Glaubensbildung anbieten zu können. Das Parlament hatte spezifiziert, dass es, sollte die Norwegische Kirche eine breite Volkskirche bleiben wollen, von entscheidender Wichtigkeit war, dass Kinder und Jugendliche grundlegende Kenntnisse über den christlichen Glauben erwerben können sollten und in ihren Bestrebungen, ihr Leben im Glauben zu meistern gestärkt werden mussten. Da Parlament meinte auch, dass die Schule nicht mehr die Verantwortung für die religiöse Bildung der Getauften haben sollte und wies in diesem Zusammenhang auf die Änderungen im Lehrplan für den Religionsunterricht hin. Die Reform wurde vom Staat mit ca. 250 Millionen NOK (norwegische Kronen) pro Jahr über eine Zeitperiode von 10 Jahren finanziert. Während das Parlament für die äußeren Rahmenbedingungen zuständig war, sollten eine kirchliche Leitungsgruppe und ein Projektsekretariat dafür sorgen, die Entscheidung des Parlaments in die Tat umzusetzen. Die Norwegische Kirche formulierte ihre Zielsetzung folgender Maßen: Wir wollen eine Glaubensbildungsstrategie entwickeln, die den christlichen Glauben fördert, die Dreieinigkeit Gottes lehrt und der Altersgruppe 0-18 stützend beiseite steht, sich im Leben zu orientieren und Sinn zu finden, unabhängig vom psychosozialen Funktionsniveau des Einzelnen. In der Reformarbeit war die Trennung zwischen einer Versuchsphase und einer Implementierungsphase von zentraler Wichtigkeit. Die Gemeinden hatten die Möglichkeit, verschiedene Arten der Glaubensbildung auszuprobieren, was der Versuchsphase eine reichhaltige und variierte Erfahrungsgrundlage geben sollte. Diese Erfahrungen sollten dann systematisch bearbeitet werden und in einen konkreten Lehrplan eingehen. Theologie in der Reform Im Mandat der Reform heißt es, dass ihr „die Tauflehre der Norwegischen Kirche zugrunde liegen sollte“. Solche theologischen Prämissen sind natürlich keine eindeutigen und statischen Größen, sondern ändern und entwickeln sich. In der Evaluierung haben wir deshalb untersucht, wie die Tauftheologie und andere theologische Fragen in den Grunddokumenten der Reform interpretiert worden sind. Außerdem haben wir die „theologische Produktion“ der Gemeinden analysiert, d.h. wir haben untersucht, welche unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen auf der lokalen Ebene entstanden sind. Wir haben deutlich erkannt, dass sich das Verständnis für die Taufe als Ausgangspunkt für die kirchliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen immer weiter entwickelt. Versteht man die Taufe als Beginn einer neuen Beziehung zu Gott, wird eine rein kenntnisorientierte Glaubensbildung schwierig. Vielerorts liegt das Hauptgewicht stattdessen auf einer Glaubensbildung, die in das erlebende Glaubensleben einführt, d.h. in die christliche Praxis und Gemeinschaft. Unter den einzelnen Projekten waren nur wenige, die sich auf die reine Kenntnisvermittlung spezialisiert hatten. Aufgrund dessen stellt sich die Frage, ob der Kenntnisvermittlung sowohl im Umfang als auch inhaltsmäßig zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet worden ist. Wir fragen uns auch, was mit der Konfirmation und ihrem theologischem Aspekt geschehen wird, wenn die Glaubensbildung bis zum Alter von 18 in der Taufe verankert ist. Das Verhältnis zwischen der allgemein menschlichen und der christlichen Perspektive angesichts der Tauf- und Glaubensbildung ist in der Reform nicht abgeklärt worden. In den Grunddokumenten finden wir eine breite Perspektive, wo sowohl Sinnfindung als auch Orientierung in der Welt eine große Rolle spielen. In den Versuchsprojekten hat dies auch starken Widerklang gefunden, wobei diese Tendenz in den ersten Jahren stärker war. Gegen Ende der Versuchsperiode wurde mehr Wert auf die spezifisch christlichen Inhalte der religiösen Bildung gelegt. In unserer Konklusion empfehlen wir deshalb, dass das Verhältnis zwischen diesen Aspekten näher definiert wird. Eine Haupttendenz in den Projekten war, dass mehr Wert auf die Gemeinschaftsdimension und den Platz des Gottesdienstes gelegt wurde. Besonders deutlich zum Ausdruck kommt dies in der Rolle des heiligen Abendmahls, das früher den Abschluss des Taufunterrichts markiert hatte, und nun zu einem zentralen Wirkungsmittel der religiösen Bildung geworden war. Neu war auch, dass Kinder und Jugendliche mehr in den Gottesdienst eingebunden wurden. Kinder waren in den Mittelpunkt der Reform gerückt, und wurden aktive Teilnehmer am Gottesdienst. Diese Änderung geschah in vielen der Versuchsprojekte, aber auch in nationalen Entwicklungsprojekten, die das Ziel hatten, eine kindergerechte Religionspädagogik zu entwickeln. Glaubensbildung oder Taufunterricht? Durch die Einführung des Begriffes „trosopplæring“ (Glaubensbildung) in die norwegische Sprache war es zeitweise nicht einfach, zwischen Taufunterricht und der allgemeinen kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu unterscheiden. Glaubensbildung scheint ein Sammelbegriff für alle guten Initiativen geworden zu sein, die Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden angeboten werden. Dies wird auch in den Rapporten bestätigt, die eine breite Verteilung von spezifisch christlichen Vermittlungsinitiativen hin zu allgemeinen Aktivitäten umfassen, die nicht notwendigerweise nur von den Gemeinden angeboten werden. Gleichzeitig sehen wird, dass der Begriff „Glaubensbildung“ eine neue Denkweise in die Breite geschaffen hat. Für die meisten Gemeinden hat der neue Name dazu geführt, dass man versucht hat, alle Getauften eines Jahrgangs zu inkludieren wo man sich früher oft damit begnügt hatte, die Kinder und Jugendlichen der aktiven Mitglieder der Gemeinde zu rekrutieren. Trotz allem hätte die Reform davon profitiert, wenn es von zentraler Stelle klarere Richtlinien bezüglich des Inhaltes dieser Glaubensbildungsreform gegeben hätte. Das hätte weder der lokalen Verankerung noch Forschungsfreiheit widersprochen, und es wäre leichter gewesen, die Reform an die Tauftheologie der Norwegischen Kirche anzuknüpfen. Außerdem hätte man von Anfang an Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Taufunterricht und der allgemeinen kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit definieren können. Eine neue Denkweise im Unterricht In vielerlei Hinsicht führt die Reform die Lerntheorie des Tauf- und Konfirmationsunterrichts weiter. Lebenslanges Lernen, praxisbezogenes Lernen und Lernen in sozialer Gemeinschaft wurden in der Reform gestärkt. Die Zielgruppe wurden an beiden Enden erweitert: die Babyphase wurde als wichtige Phase miteinbezogen, und die traditionelle Glaubensbildung auf die Altersgruppe 15-18 ausgeweitet. Die Initiativen für die jüngste Altersgruppe weisen variierende Resultate auf. Obwohl ein überraschend großer Anteil der Baby-Singgruppen von kurzer Dauer war, sieht es aus als hätte die Kirche dieses Konzept ganz für sich beansprucht und das Loch zwischen Babyalter und 4jährigen erfolgreich überbrückt. Andere Projekte, die in der Versuchsphase initiiert wurden, waren z.B. die Einführung eines Schulstartrituals und die Ausweitung des Angebots für 11jährige auf 10-12jährige. Viele Gemeinden haben sich auch darauf konzentriert, den Konfirmationsunterricht zu verbessern indem sie den Unterricht besser gestalteten und umfangreichere soziale Aktivitäten planten. Die größte Herausforderung war trotz allem die älteste Altersgruppe, sowohl inhaltsmäßig als auch strukturell. Das scheint teilweise so zu sein weil evt. Angebote sich direkt an die Teilnehmer richten mussten, während man in den jüngeren Altersgruppen entweder etablierte Traditionen wie z.B. die Konfirmation hatte, oder durch die Eltern Kontakt mit den Kindern bekommen hatte. Zusätzlich sehen wir, dass die neue Ordnung die Konfirmationszeit unter Druck setzt, da die Konfirmation nicht länger das abschließende Ritual der Glaubensbildung ist. Die Evaluation hat erwiesen, dass es der Glaubensbildungsreform geglückt ist, mehrere der christlichen Glaubensdimensionen zu vitalisieren. Die narrative, mythische Dimension zeigt sich in der Bibelerzählung, während die dogmatische, systematische Dimension teilweise in Konfirmationsprojekten zugegen ist, sowie in der zentralen Rolle des Gottesdienstes in vielen Projekten. Auf die ethische Dimension wird Wert gelegt indem christliche Ethik ein wichtiger Punkt in Leben und Lehre ist, und die rituelle Dimension zeigt sich im durchgehenden Gebrauch von ritueller Glaubenspraxis innerhalb und außerhalb des Gottesdienstes, sowie durch die Schaffung neuer Rituale wie z.B. des Schulstartrituals. Die emotionelle, persönliche Dimension zeigt sich in den Bemühungen, eine persönliche Verbindung zu Gott herzustellen und den Alltag mit christlichem Glauben und dessen Praxis zu verbinden. Die ideologische Dimension finden wir in der Hilfe zur Lebensorientierung und der Lehre eines christlichen Lebenswandels. Der institutionellen und sozialen Dimension entspricht die Eingliederung in die lokale Gemeinde und die christliche Gemeinschaft, während die materielle Dimension darauf fokussiert, Kindern und Jugendlichen die visuelle und musikalische Kirchensprache näher zu bringen. Die Evaluation zeigt, dass die Kirche es geschafft hat, sich von der Schulpädagogik zu befreien und mehr als zuvor Inhalt und Kontext des Glaubens zusammenzuhalten. Im Laufe der Reform haben wir vor allem eine Verstärkung der rituellen und sozialen Dimension gesehen. Alles in allem zeigt die Breite der Dimensionen, dass die Reform die allgemeine Lerntheorie vitalisiert und weiterentwickelt hat und Wert auf praktisches Lernen in der Gemeinschaft legt. Gottesdienst und Kirchenraum Die überwiegende Mehrheit der Projekte machte sich die Lokalitäten der Kirche als Arena zunutze. Diese erweiterte Nutzung des Kirchenraums hat es möglich gemacht, durch praktisches Lernen Wissen, Praxis und Gemeinschaft zusammen zu binden. Dadurch haben der Gottesdienst und die dazugehörigen Räumlichkeiten eine Renaissance erlebt. Etablierte wie neue Glaubenspraxisen, die an den Gottesdienst und den Kirchenraum geknüpft ist, wurden dadurch revitalisiert und weiterentwickelt. Man kann sagen, dass die Reform in vieler Hinsicht eine Gottesdienstreform geworden ist, in der der Platz der Kinder und Jugendlichen im Gottesdienst im Vordergrund stand. Aber auch hier weisen die Projektberichte große Unterschiede auf. Auf der einen Seite finden wir verschiedene Glaubenspraxisen, die an den Gebrauch von Ritualen und Symbolen anknüpfen. Auf der anderen Seite sehen wir eine Reihe allgemeiner Versuche, an die christliche Lebensorientierung anzuknüpfen, indem man Aktivitäten mit einem Gottesdienst abschließt. Der Platz des Kindes und der Familie in der Reform Die wahrscheinlich wesentlichste Änderung ist der Platz des Kindes in der Gemeinde. Ein charakteristischer Zug der meisten Projekte ist, dass das Kind nicht länger als Zuschauer sondern als Teilnehmer verstanden wird. Es ist nicht länger Objekt, sondern aktives Subjekt der Aktivität. Rein sprachlich wurde diese Veränderung im Laufe der Reform dadurch deutlich, dass man nicht mehr von Aktivitäten für Kinder, sondern mit Kindern sprach. Hier sehen wir, dass die Reform Teil einer theologischen und pädagogischen Denkweise wird, die ihre Wurzeln in der Theologie Luthers hat und die in Norwegen in den 1980er Jahren neu entdeckt worden war. Einer der meist interessanten Seiten der Reform ist daher auch dass man es auf lokaler Ebene geschafft hat, diese Theologie in das aktive Glaubensleben der Gemeinde einzuflechten. Wo man die Kinder ernst nimmt, sind die Eltern gerne mit dabei. Hochqualitative Aktivitätsangebote helfen, Vertrauen aufzubauen, und relativ viele Gemeinden haben ihre Zielgruppe von Kindern auf Familien erweitert. Mehr und mehr wird darauf gebaut, eine kontinuierliche Glaubensbildung dadurch erreichen zu können, dass man den Eltern Kurse und Hilfsmittel für den Unterricht zu Hause anbietet. In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung guter Unterrichtsmaterialien von entscheidender Bedeutung. Durch die Reform waren ständig mehr digitale Medien erhältlich, was sowohl für den Kontakt mit den Eltern als auch für die Kinder, die durch digitale Medien wichtige Beiträge für ihre Glaubensbildung leicht zugänglich hatten, eine große Hilfe war. In diesen Versuchen ist auch ein anderer Trend deutlich geworden: Eltern wollen gerne mehr involviert sein, vor allem in der Konfirmationszeit. Kontextuelle Reform Die einzelnen Versuchsprojekte sollten von der „grassroot-“ Ebene initiiert werden, und wir haben eine große und kreative Vielfalt auf lokaler Ebene registriert. Die Gemeinden haben erkannt, dass sie eine Glaubensbildung brauchen, die breit anwendbar ist, und die von den Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der einzelnen Gemeinde ausgeht. Daraus entsteht ein gewisser Stolz auf die eigene Gemeinde. Besonders interessant in diesem Zusammenhang war die Entwicklung in den Gemeinden, die es gewagt hatten, sich auf eine Idee zu spezialisieren und ein ganzheitliches Projekt darauf aufzubauen. Zurechtlegung des Unterrichts Der Projektleitung war es geglückt, das Bewusstsein der Kirche im Bezug auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu heben. In der allgemeinen Glaubensbildung innerhalb der Gemeinde sollte es möglichste überall Zurechtlegung des Unterrichts für diese Kinder geben. Um diesen Punkt zu stärken, mussten unter anderem alle Projektberichte dieses Thema umfassen, und es wurde auf mehr fachliche Arbeit, Schulung der Angestellten, Entwicklung von Netzportalen und Entwicklungsprojekte verschiedener Art Wert gelegt. Wissensinhalt der Reform Die Evaluation hat in vieler Hinsicht gezeigt, dass der Reform eine nähere Definition des Wissensinhaltes fehlt. Während die Taufreform von 1991 einen Kerninhalt empfohlen hatte, fehlte eine solche Empfehlung in der Glaubensbildungsreform. Wir sind der Ansicht, dass die Versuchsphase und die Reform im Allgemeinen davon profitiert hätten, die Frage des Wissensinhaltes zu konkretisieren. Solche grundlegenden Überlegungen wären einer lokalen Verankerung nicht im Wege gestanden Indem die Projektleitung es unterlassen hat, solche grundlegenden Leitlinien zu geben, hat sie gleichzeitig die Möglichkeit versäumt, wichtige und grundlegende Forschungsarbeit im Hinblick auf den Inhalt der Reform zu betreiben. Das hat dazu geführt, dass die Projektleitung nicht imstande war, Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden einerseits und Glaubensbildung andererseits auseinander zu halten. Der Lehrplan von 1991 war auf der Erkenntnis aufgebaut, dass die kontinuierliche Arbeit kaum alle Getauften umfassen würde. Deshalb beschloss man, die Kerninhalte des Plans durch zeitlich begrenzte Aktivitäten zu vermitteln. Die Glaubensbildungsreform wies die gleiche Teilung zwischen zeitlich begrenzten und kontinuierlichen Aktivitäten auf, doch der Kerninhalt fehlte. Daher konnte die Versuchsphase auch keine kontrollierten Versuche unternehmen um herauszufinden, welcher Inhalt am besten mit welcher Art Aktivität verbunden werden sollte. In den Analysen, die wir vorgenommen haben, war deutlich zu sehen, dass Bibelerzählungen (mit Gewicht auf Jesuserzählungen), Gottesdienste und die Gemeinschaft in der Gemeinde die zentralen Inhalte der Aktivitäten waren. Je weniger sozialisierende Aktivitäten angeboten wurden, desto mehr wurden diese Inhalte gestärkt. Es gab zwar auch einzelne Projekte, die Gewicht auf Glaubenskunde legten, doch dieser Teil des christlichen Wissensverständnisses war eher wenig vertreten. Systematische Glaubensbildung Die Vorarbeiten bestätigen, dass die Reform zur Absicht hat, allen Gemeinden der Norwegischen Kirche die Möglichkeit zu geben, allen Getauften im Alter von 0-18 eine systematische Glaubensbildung anbieten zu können, unabhängig vom psychosozialen Funktionsniveau des Einzelnen. Diese systematische Glaubensbildung sollte aus grundlegendem Wissen über den christlichen Glauben bestehen, sowie zur Sinnfindung und Orientierung in der Welt im Rahmen des christlichen Glaubens beitragen. Wir haben in vorhergehenden Abschnitten kritisiert, dass die zentralen Projektleitung keine Angaben dazu gemacht hat, woraus der Wissensinhalt bestehen sollte, und den Gemeinden freien Spielraum zur Erprobung eigener Glaubensbildungsaktivitäten gelassen hat, sowohl in der Ausformung wie auch den Inhalt betreffend. Es wäre unserer Meinung nach mehr effektiv und nützlicher für die Forschung gewesen, Empfehlungen im Bezug auf Inhalt zu machen und die finanzielle Stütze Projekten zukommen zu lassen, bei denen man verschiedene Vermittlungsformen und kontextuelle Voraussetzungen experimentell nachvollziehen hätte können. Die fehlende Steuerung in Richtung Forschung hat dazu geführt, dass es kein eindeutiges Erfahrungsmaterial über die systematische Glaubensbildung für die gesamte Altersspanne 0-18 gibt. Wir meinen, dass wir auch später keine solchen Erfahrungswerte haben werden, wenn die Reform ohne zentral geleitete Versuche durchgeführt wird. Dass die Leitung auch keine zufriedenstellende analytische Arbeit der Jahres- und Projektrapporte zur Wissens- und Erfahrungssammlung initiiert hat, macht die Sache nicht besser. Ein neues Fachgebiet? Mit der Einführung des neuen Religionsunterrichtes übernahmen die Glaubensgemeinschaften die religiöse Bildung ihrer Mitglieder. Lange hatte die öffentliche Schule diese Aufgabe für die Norwegische Kirche übernommen gehabt, und die religiöse Bildung war deshalb schulpädagogisch aufgebaut. Die Reform hat bisher gezeigt, dass die Glaubensbildung der Kirche sich in vieler Hinsicht vom traditionellen Schulunterricht abgewendet hat. Viele Projekte und Aktivitäten zeugen von umfassendem Neudenken im Hinblick auf Unterricht und Glaubenspraxis für Kinder und Jugendliche in der Norwegischen Kirche. Die Entfernung vom traditionellen Schulunterricht macht es jedoch höchst notwendig, die Gemeindepädagogik als Fachgebiet zu verstärken. Gemeindepädagogik und Katechese waren zur Beginn der Reform schwache Fachgebiete, die wenig Theorie zur Verfügung hatten, auf der die Reform aufbauen hätte können. Das erklärt auch, warum es bis heute keine eindeutige Begriffserklärung für das Verhältnis zwischen Taufunterricht und Glaubensbildung auf der einen Seite und der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit gibt, bzw. zwischen dem spezifischen und allgemeinen Inhalt der Reform und einer Definition des Begriffes „Bildung“. Gemeindepädagogik als Fachgebiet muss deshalb neu etabliert werden um den Herausforderungen einer neuen Kinder- und Jugendkultur begegnen zu können. Die Projektphase hat diesem Prozess einen kräftigen Anstoß gegeben. Soll man die umfassende pädagogische Neuorientierung hantieren können, muss das Fachgebiet als Beruf, Wissensgebiet und Unterrichtsform weiterentwickelt und theoretisch verankert werden. Lokale Organisation Bezeichnend für die 156 Versuchsprojekte ist, dass weniger als die Hälfte nur einer Gemeinde zugehörten. Alle übrigen Projekte waren verschiedene Arten von Zusammenarbeitsprojekten. Dieses Muster wird wahrscheinlich Standard werden, wenn das Ziel ein komplettes Bildungsprogramm für alle Altersgruppen in allen Gemeinden der Norwegischen Kirche sein soll. Wir haben ein breites Spektrum an Fertigkeiten und Kompetenzen unter den Angestellten gefunden, wobei das Hauptgewicht auf theologischen und pädagogischen Fähigkeiten liegt. Ehrenamtliche Mitarbeiter wurden in unterschiedlichem Ausmaß benutzt, manche Projekte engagierten viele ehrenamtliche Mitarbeiter, während die meisten zwischen 2-4 solche Mitarbeiter hatten. In fast allen Projekten waren ehrenamtliche Mitarbeiter als Assistenten eingesetzt. Im Übrigen war die Integrierung der Versuchsprojekte oft von Spannungen innerhalb der Gemeinde geprägt, unter anderem was die Zielsetzung der Glaubensbildung betraf. Auch innerhalb der Projekte und zwischen den teilnehmenden Gemeinden kam es zu Spannungen, zum Teil weil die Grenzen zwischen den Gemeinden nicht genug definiert worden waren oder sie mit anderen Glaubensbildungsangeboten in Konflikt kamen. Wir haben auch eine Tendenz registriert, dass es zu einer „Staatsbildung innerhalb des Staates“ kommen kann. Über 60% der Projekte arbeiteten auf die eine oder andere Weise mit christlichen freiwilligen Organisationen und den örtlichen Gemeinde zusammen. Jedoch scheint es, dass es gerade in der Versuchsperiode einen leichten Rückgang in der Anzahl Zusammenarbeitsprojekte gab. Auch deckt der Begriff „Zusammenarbeit“ ein weites Spektrum von Verbindungen. War die Versuchsperiode erfolgreich, gemessen an der allgemeinen Teilnahme? Hat die finanzielle Stütze eine ausreichende Expansion von religiösen Bildungsprojekten und aktivitäten herbeigeführt? Solche Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Um zahlenmäßige Resultate beurteilen zu können, bräuchte man vorgegebene Zielwerte, doch waren solche weder für Umfang noch Anzahl der Aktivitäten angegeben gewesen. Daher haben wir keine Vergleichswerte, um eine solche Evaluation vorzunehmen. Am Anfang der Versuchsphase kursierten Gerüchte, dass 70% jeder Altersgruppe teilgenommen haben sollten, um die jeweilige Aktivität als erfolgreich bezeichnen zu können. Dies war allerdings ein Missverständnis, da der Prozentsatz lediglich als Berechnungsgrundlage für die Ressourcen benutzt worden war, nicht aber als Zielsetzung. In einer Versuchsphase sind alle Arten Erfahrung wertvoll, auch die, die zeigen, welche Experimente nicht besonders gut funktionieren. Aus dieser Perspektive gesehen hätten alle Gemeinden darüber informiert werden sollen, dass in dieser Phase alle Erfahrungen, auch die schlechten, wichtiger waren als zahlenmäßige Erfolge. Doch aufgrund der Vermischung von Versuch und Implementierung war diese Botschaft nicht deutlich genug vermittelt worden. Trotz dieser Einschränkungen ist es unser Eindruck, dass viele Gemeinden viel Gewicht auf die zahlenmäßige Resultate gelegt haben, zumindest in den ersten zwei Versuchsjahren, 200405. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob die angenommene Erwartung guter Teilnehmerzahlen die Gemeinden dazu bewegte, Aktivitäten zu starten, bei denen man viele Teilnehmer erwarten konnte, doch die Schlussresultate scheinen dagegen zu sprechen. Besonders in den ersten Jahren waren die Teilnehmerzahlen relativ niedrig, in den Jahren 2006 und 2007 etwas höher. Im Schnitt war der Teilnehmerprozentsatz bei 24,5% für alle Projekte im Jahre 2006, und 28,8% im Jahre 2007. Die Steigerung kann reell sein, kann aber auch mit der Änderung der Registrierungsmethode zusammenhängen. Ca. ein Drittel aller Aktivitäten hatte weniger als 10% Teilnehmer einer Altersgruppe, d.h. der Getauften eines Jahrgangs, während ca. 5 Prozent 60-70% aller Getauften eines Jahrgangs mobilisierten. In Kapitel 8 haben wir aufgezeigt, dass die Versuchsphase eine große Vielfalt an Projekten aufzuweisen hatte. Gottesdienste waren in verstärktem Grad als Umrahmung verschiedener Glaubensbildungsaktionen benutzt worden, und sind immer noch zentral bei den klassischen Initiativen wie der Überreichung des Religionsbuches an 4jährige u.ä. Für das Projekt „Gottesdienst“ im Allgemeinen war die durchschnittliche Teilnehmerzahl im Jahre 2006 30%. Auch die Projekte „Taufschule“ und „Jugendlager“ waren 2006 erfolgreich. „Cafés“, an die ältesten Jugendlichen (16-18) gerichtet, sammelten immerhin 8% ihrer Altersgruppe. Wir sehen auch, dass die Altergruppe der 10-12jährigen einen relativ hohen Anteil aller Aktionen umfasst, im Gegensatz zu den 16-18jährigen. Es ist nicht immer leicht gewesen, attraktive Angebote für Jugendliche nach dem Konfirmationsalter zu finden. Viele haben Leitungskurse, Cafés und andere Freizeitaktivitäten angeboten, doch gute Glaubensbildung für diese Altersgruppe war eine große Herausforderung, nicht zuletzt weil diese Gruppe weniger loyal und konsistent ist als jüngere Altersstufen. Tabelle 8.9. zeigt, dass es in der gesamten Versuchsperiode eine deutliche Tendenz zur Weiterführung und -entwicklung von Aktionen innerhalb des Versuchsportefeuilles gab. 2006 hatten fast die Hälfte aller Aktionen bereits vor der Versuchsphase existiert. 2007 sank die Zahl auf 30%. Das bedeutet, dass viele Gemeinden existierende Projekte in die Versuchsordnung übertrugen, und auch wenn eine solche Praxis nicht illegitim ist, bedeutete es doch, dass die Versuchsmittel nur begrenzt zur Erforschung neuer Aktivitäten verwendet wurden. 2007 schienen doch viele Gemeinden sich dafür entschlossen zu haben, alte, erprobte Aktivitäten durch neue zu ersetzen. Während der gesamten Versuchsperiode haben wir einen relativ hohen Umsatz an Aktionen gesehen. Neue Aktivitäten wurden etabliert, aber viele wurden nach 1-2 Jahren abgewickelt. Es liegt daher nahe anzunehmen, dass die Gemeinden die Versuchsperiode aktiv dazu benützt haben, verschiedene Aktivitäten auszuprobieren. Besonders in den ersten zwei Jahren wurden ständig neue Aktivitäten initiiert, oft um möglichst viele Teilnehmer aufweisen zu können. Gleichzeitig sehen wir, dass Aktionen, die in einer Gemeinde erfolgreich waren, in einer anderen abgewickelt wurden. Daraus ziehen wir den Schluss, dass der Erfolg einer Aktivität von einer Reihe lokaler Faktoren abhängig ist, auch solcher, die die Gemeinde nicht kontrollieren kann. Behörden oder andere Organisationen können z.B. ähnliche oder konkurrierende Aktionen haben, die jeweiligen Jahrgänge können klein sein oder die geographische Ausbreitung groß, um nur ein paar mögliche Faktoren zu nennen. Allumfassende Versuchsprojekte Nur 43 der 156 Versuchsprojekte haben Aktivitäten in Gang gesetzt, die die 5 Jahre der Versuchsperiode überdauert haben. 110 Projekte waren kürzer, und nur 23 von 37 Vollskalaprojekten mit Aktivitäten für 0-18jährige haben die ganze Versuchsperiode von 5 Jahren gedauert. Es kann daher mit Recht behauptet werden, dass die Erfahrungsgrundlage für allumfassende Angebote für die gesamte Altersskala von 0-18 eher begrenzt ist. Dieses Problem wird weiter dadurch unterstrichen, dass die Zusammenfassung der Erfahrungen im Hinblick auf den neuen Lehrplan ein Jahr zu früh geschieht, sodass Erfahrungen vom Jahre 2008 nicht in die Wissensgrundlage einbezogen werden können, auf der die permanente Ordnung aufbauen soll. Ehrenamtliche Mitarbeiter Ein wichtiger Gedanke im Hinblick auf die Versuchsphase war die Mobilisierung von ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Versuchsprojekten. Was wurde erreicht? Die meisten Aktionen hatten durchschnittlich 2-4 ehrenamtliche Mitarbeiter. Gottesdienste hatten im Schnitt 3. In nur ganz wenigen Versuchen waren ehrenamtliche Mitarbeiter Initiatoren oder Aktionsleiter. Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass einzelne Aktionen 20 bis 30 ehrenamtliche Mitarbeiter mobilisierten, oft Eltern und andere, die nicht nur passive Empfänger sein wollten, sondern die aktiv bei der Vorbereitung, Durchführung und Aufräumarbeit teilnehmen wollten. Solche Grosseinsätze waren allerdings eher Ausnahmen. Stützfunktionen Alle lokalen Versuchsprojekte hatten einen Mentor zur Seite bekommen, der die Projekte begleitete. Die überwiegende Mehrzahl der lokalen Projektleiter empfand die Zusammenarbeit mit einem Mentor als wichtigen Faktor für die Durchführung des Projektes. Die Außenseiterperspektive des Mentors und dessen Fähigkeit, den größeren Zusammenhang zu sehen, waren sowohl Stütze als auch Inspiration für die Projektleiter. Die wichtigsten Kompetenzen des Mentors waren dessen Erfahrung als Berater und Projektleiter sowie dessen Fähigkeit, sich in Menschen und Situationen einzuleben und zuhören zu können. Unserer Meinung nach hat die Mentorordnung dazu beigetragen, die lokalen Projekte qualitativ zu sichern, doch sollte die Rolle des Mentors besser definiert und abgegrenzt werden. Das gilt besonders für das Verhältnis zwischen Fokus des Mentors auf Beratung des Projektleiters bzw. auf Durchführung des Projektes. Wir glauben auch, dass eine Spannung zwischen den Rollen des aktiv involvierten Teilnehmers und des reflektierenden Beobachters entstehen kann. Eine Art von Mentorhilfe wäre dennoch eine große Stütze für die Reform, wenn diese in allen Gemeinden der Norwegischen Kirche eingeführt wird. Organisationen sowie Bildungs- und Forschungsinstitutionen haben durch 79 nationale und regionale Projekte Mittel zur Entwicklung von Theorien und Erprobung von Methoden erhalten. Wir haben in der Evaluation darauf hingewiesen, dass die Projektleitung die Entwicklungsprojekte besser zur zielorientierten Entwicklungsarbeit nutzen hätte können, unter anderem indem sie selbst Projekte initiierte. Nun ist eine große und umfassende Entwicklungsarbeit begonnen worden, und ein Grossteil davon ist auf verschiedene Art dokumentiert. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Koordination einer solchen Arbeit, die Publikation und Verteilung von Information an verschiedene Akteure sowie die systematische Präsentation der neuentwickelten Theorien und Methoden eine große Herausforderung ist. Ziel ist es, die Resultate allen Interessierten leicht zugänglich zu machen, aber diese Resultate auch in der weiteren Arbeit mit dem endgültigen Lehrplan für Glaubensbildung zu benutzen. Das norwegische Parlament hat darauf hingewiesen, dass es in Verbindung mit der Versuchsphase, aber auch in der weiteren Reformarbeit, ein Kompetenznetzwerk geben sollte, das zur Aufgabe haben solle, die Kompetenzen innerhalb der kirchlichen, pädagogischen und sozialwissenschaftlichen Bereiche im Rahmen des Fachgebietes religiöse Bildung zu koordinieren. Es dauerte 2 Jahre, bis das Nationale Kompetenznetzwerk für die Glaubensbildung in der Norwegischen Kirche errichtet war. Ein elektronisches Netzwerk wurde auf der Homepage der Reform errichtet, Fachkonferenzen wurden abgehalten und drei Netzwerkgruppen gebildet. Unserer Meinung nach ist das Kompetenznetzwerk nicht die zentrale Stützstruktur der Versuchsphase geworden und es ist schwer zu erkennen, wie ein so löse strukturiertes Netzwerk eine zentrale Stütze werden kann, so wie es das Parlament vorgesehen hat. Als positiv kann gewertet werden, dass die Projektleitung bestimmt hat, eine stärkere Koordinierung der Arbeit im Kompetenznetzwerk zu etablieren, unter anderem um die fachliche und systematische Bearbeitung des reichhaltigen Erfahrungsmaterials besser sammeln zu können. Vom Versuch zur endlichen Reform Am Beginn der Glaubensbildungsreform wurden weder von politischer noch von kirchlicher Seite genauere Angaben gemacht, wie der Übergang von der Versuchsphase zur endlichen Reform vor sich gehen sollte. Nach mehr als zwei Jahren der Versuchsphase begann die Projektleitung, den Übergang zu planen und die Hauptprobleme in Verbindung mit der Implementierung der endlichen Reform in allen norwegischen Gemeinden zu identifizieren. 2007 beschloss auch der Kirchenrat, dass ein Plan für die Glaubensbildungsreform in der Norwegischen Kirche erarbeitet werden sollte, und gab der Leitungsgruppe die Verantwortung für die Entwicklungsarbeit. Wir meinen, dass die folgenden zwei Aufgaben die wichtigsten Herausforderungen im Übergang vom Versuch zur endlichen Reform sind: erstens, die Verarbeitung dessen, was wir aus der Versuchs- und Entwicklungsarbeit gelernt haben, in die Arbeit mit dem neuen Reformplan. Wir glauben, dass das eine besondere Herausforderung sein wird, weil der vorgegebene Zeitrahmen es nahezu unmöglich macht, Nutzen aus der breiten Masse an Erfahrungen zu ziehen, wenn der allgemeine Reformplan bereits im November 2008 im Kirchenrat behandelt werden soll. Zweitens muss geklärt werden, welche Mittel den Gemeinden zur Verfügung stehen werden. Das Parlament hat signalisiert, dass sich die totale Summe auf 250 Millionen NOK pro Jahr belaufen wird. 2008 wurden 130 Millionen für die Reform verwendet, von denen 105 Millionen auf die verschiedenen Versuchsprojekte in den 350 Gemeinden verteilt waren. Es lässt sich kaum vermeiden, dass alle Gemeinden mit viel geringeren Mitteln auskommen werden müssen als die ursprünglichen Versuchsgemeinden, wenn alle 1 300 Gemeinden zusammen nur 250 Millionen zur Verfügung haben. Die Einführung der endlichen Reform in sowohl den ursprünglichen wie auch den neuen Gemeinden ist eine Herausforderung, die einer Lösung bedarf. Nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Personalressourcen für die neuetablierten Stellungen und Stützfunktionen im Laufe der Implementierung müssen hier bedacht werden. Es fragt sich, ob nicht lokale Zusammenarbeitsordnungen, vor allem zwischen kleineren Gemeinden, errichtet sein müssen, um es diesen zu ermöglichen, allen Getauften zwischen 0 und 18 Jahren eine systematische Glaubensbildung anbieten zu können, ohne die Dimension von 315 Stunden im Jahr zu sprengen. Konklusionen Unsere Schlussfolgerungen bauen auf den Daten, Analysen und Betrachtungen aller Kapitel des Buches auf. Da die Reform bereits in der Versuchsphase teilweise implementiert wurde, ist der Versuchsteil der Reform unserer Meinung nach geschwächt worden. Es wurde eine große Vielfalt an Aktivitäten und Aktionen durchgeführt, und diese haben die Grundlage für die lokalen Versuche, Erfahrungen und Lernprozesse gelegt. Die Gemeinden haben theologisch über Taufe und Glaubensbildung reflektiert, den Begriff „Lernen“ neu durchdacht und Gewicht auf Lernen in einer praxisorientierten Gemeinschaft gelegt. Die vielleicht wesentlichsten Änderungen sind der zentrale Platz des Gottesdienstes und die Sichtweise, die Kinder und Jugendliche als zentrale Subjekte und aktive Teilnehmer versteht. Andererseits haben wir festgestellt, dass der Glaubensreform bis heute eine nähere Bestimmung des Wissensinhaltes fehlt. Wir meinen auch, dass das Erfahrungsmaterial aus den Versuchen bis heute nichts darüber aussagen kann, wie eine systematische Glaubensbildung für die gesamte Altersspanne aussehen sollte. Es hat sich gezeigt, dass die Lokalitäten der Kirche als Arena dominieren. Hierbei wird Wert darauf gelegt, Wissen, Praxis und soziale Gemeinschaft miteinander zu verbinden. Glaubenspraxis die die Benutzung des Kirchenraumes bedingt wird hervorgehoben. Weitere langsichtige Aktivitäten setzen auf Milieuaufbau, während die kurzzeitigen Aktivitäten oft die Vermittlung von christlichen Kerninhalten an möglichst viele zum Ziel haben. Diese handeln meistens von Bibelstoff und Ethik, und wenig von Vermittlung systematischer Glaubenslehre. Der Katechismus ist hier völlig abwesend. Die Versuchsgemeinden haben wenig Gewicht auf eine multireligiöse Bildung gelegt. Am Anfang der Reformperiode wurde Wert auf relativ breite Aktivitäten mit allgemeinem Inhalt und deutlichen Sozialisierungszielen gelegt, während man sich gegen Ende mehr auf spezifisch christliche Glaubensbildung konzentriert hat. Viele der kurzzeitigen Aktivitäten wurden mit einem Gottesdienst begonnen oder abgeschlossen. Dadurch wurde die Glaubensbildung auch ein sichtbarerer Teil des Gemeindelebens. Die aktive Teilnahme der Kinder als sowohl Liturgen wie auch Teilnehmer verstärkte den allgemeinen Trend hin zur Subjektivierung des Kindes in der Glaubensbildungsreform. Sehr viele der Aktivitäten behandelten das Thema Taufe, den Eintritt in das Christentum, und den wachsenden Glauben durch religiöse Bildung. Das traditionelle Bekehrungschristentum ist hierbei so gut wie verschwunden, und das Erziehungschristentum im Fokus. Dies ist höchst wahrscheinlich ein bleibender Trend. Obwohl die Zielgruppe Kinder und Jugendliche waren, und die Aktivitäten und Rapporte auf diese Zielgruppe abgestimmt waren, haben doch einige den Versuch gemacht, Eltern und Taufpaten anzusprechen indem sie die Glaubensbildungsreform als Hilfe bei der Zurechtlegung einer kontinuierlichen Glaubenserziehung zu Hause betrachten haben. Alles in Allem sieht es so aus, als gäbe es eine erweiterte Definition der Glaubensbildung, in der die frühere katechetische Tradition mit ihrer starken dogmatischen Dimension von einer soziokulturellen pädagogischen Denkweise ersetzt worden ist, die auf die gesamte Vermittlung, das Lernen in der Gemeinschaft sowie Lernen durch Praxis in einem natürlichen Kontext Wert legt. Ausgehend von drei Hypothesen haben wir uns gefragt, was diese Änderungen in der Versuchsphase verursacht haben kann. Wir meinen zu sehen, dass die Versuchsgemeinden relativ stark von den Lernprozessen der systematischen Versuche mit verschiedenen Aktivitäten geprägt waren. Die Gemeinden passten sich den zentralen Rahmenbedingungen an, aber ließen sich weniger von den Inhalten beeinflussen. Wir stellten auch fest, dass die Gemeinden die Glaubensbildung in ihren eigenen lokalen Traditionen für die Tauf- und Glaubenserziehung weiterführten, verankerten und weiterentwickelten. Auch wenn wir feststellen müssen, dass die Projektleitung zu wenig Gewicht auf eine erforschende Versuchsstrategie gelegt hat und deswegen Probleme hat, die gesammelten Resultate in eine endliche Reform zu bringen, hat sich gezeigt, dass die Versuchsphase die Kinder- und Jugendarbeit in der Norwegischen Kirche auf beispielhafte Weise vitalisiert hat. Es gibt einige Herausforderungen im Bezug auf die Implementierung, doch eine gute Grundlage ist gelegt worden und wird 2009 sowohl den Versuchsgemeinden als auch den anderen Gemeinden der Norwegischen Kirche einen weit besseren Ausgangspunkt für eine systematische Glaubensbildung für alle Getauften im Alter von 0 bis 18 ermöglichen, als sie 2003 hatten, bevor die Reform begann.