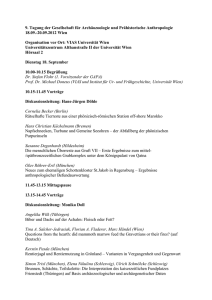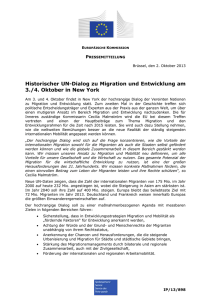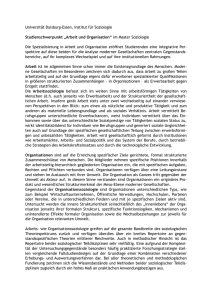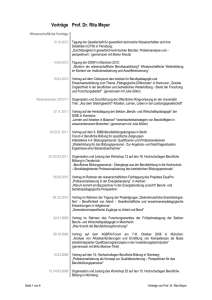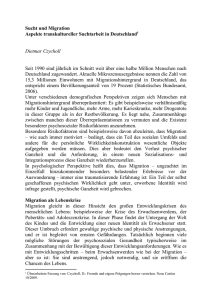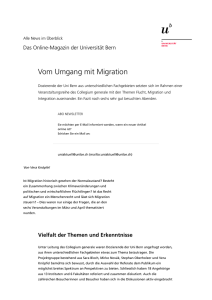Europa in der werdenden Neuzeit
Werbung
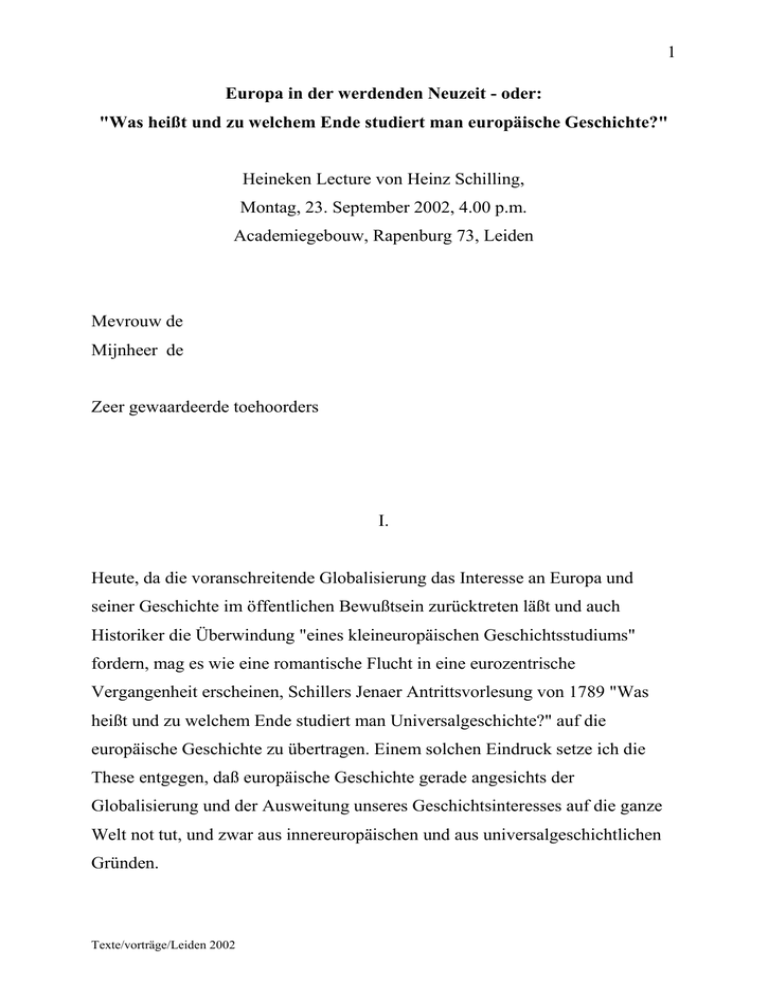
1 Europa in der werdenden Neuzeit - oder: "Was heißt und zu welchem Ende studiert man europäische Geschichte?" Heineken Lecture von Heinz Schilling, Montag, 23. September 2002, 4.00 p.m. Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden Mevrouw de Mijnheer de Zeer gewaardeerde toehoorders I. Heute, da die voranschreitende Globalisierung das Interesse an Europa und seiner Geschichte im öffentlichen Bewußtsein zurücktreten läßt und auch Historiker die Überwindung "eines kleineuropäischen Geschichtsstudiums" fordern, mag es wie eine romantische Flucht in eine eurozentrische Vergangenheit erscheinen, Schillers Jenaer Antrittsvorlesung von 1789 "Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?" auf die europäische Geschichte zu übertragen. Einem solchen Eindruck setze ich die These entgegen, daß europäische Geschichte gerade angesichts der Globalisierung und der Ausweitung unseres Geschichtsinteresses auf die ganze Welt not tut, und zwar aus innereuropäischen und aus universalgeschichtlichen Gründen. Texte/vorträge/Leiden 2002 2 Innereuropäisch tut europäische Geschichte not, weil es gar nicht zutrifft, daß ein "kleineuropäisches Geschichtsstudium" überwunden werden müßte - aus dem einfachen Grunde, weil ein solches Studium kaum irgendwo eingerichtet ist und in allen Ländern Europas gegenwärtig noch die Nationalgeschichte dominiert. Universalgeschichtlich tut europäische Geschichte vor allem aus theoretisch-methodologischen Gründen not. Denn ebensowenig wie es heute noch um jene evolutionistische Teleologie der Aufklärung gehen kann, die - wie Schiller in der erwähnten Antrittsvorlesung - das europäische "Zeitalter der Vernunft" zum Maßstab der Weltgeschichte machte, ebensowenig ist uns mit abstrakten Betrachtungen über mondiale Zusammenhänge geholfen. Moderne Universalgeschichte ist vielmehr als Zivilisationsvergleich und interzivilisatorische Beziehungsgeschichte anzulegen. Das setzt aber die Erforschung der einzelnen Weltzivilisationen voraus, und damit auch europäische Geschichte als die Geschichte des spezifischen europäischen Zivilisationstypus. Kurz - es scheint mir geboten, Ansätze, Methoden und Themenschwerpunkte einer europäischen Geschichte zu entwickeln, die sich einerseits nicht mehr dem Primat der Nationalgeschichten unterwirft und andererseits die universalgeschichtliche Perspektive eröffnet, deren Notwendigkeit heute niemand mehr in Frage stellt, dem die Geschichte mehr als eine antiquarische Wissenschaft ist. Auf einer solchen Basis ließe sich dann der interzivilisatorische Vergleich mit anderen Typen historischer Zivilisation durchführen und eine Beziehungsgeschichte der Zivilisationen und Kulturen schreiben. Texte/vorträge/Leiden 2002 3 II. Wie ist eine solche Geschichte Europas anzulegen? Auf welchen Raum bezieht sie sich? Wo liegen ihre epochalen Schwerpunkte? Was könnten oder sollten ihre Hauptthemen sein? 1. Methodisch-theoretischer Ansatz. Geschichtsschreibung ist außerordentlich "gegenwartsfühlig" - will heißen, sie reagiert in ihren Fragestellungen und Zugehensweisen sehr sensibel auf die sich ändernden Probleme und Befindlichkeiten der Gegenwart: Nachdem in den 1970er und 1980er Jahren die bis dahin dominierende traditionelle Nationalgeschichte durch eine Gesellschafts- und Strukturgeschichte abgelöst worden war, die Europas Weg in die Moderne erforschte und dabei Nationen und Einzelstaaten nicht näher berücksichtigte, verschoben sich in den 1990er Jahren die geistigen Orientierungsmarken erneut radikal. Das war eine Folge der politischen Umbrüche in Mittel- und Osteuropa, aber auch der mit Macht einsetzenden Globalisierung. In Westeuropa wurde das historische Bewußtsein zutiefst durch das Wiederauftauchen jener mittel- und ostmitteleuropäischen Hälfte Europas umgepflügt, von der man sich Jahrzehnte lang abgewandt hatte. Und da dort eine wahre Renaissance von Nationen und nationalen Kulturen zu beobachten war, die zuvor von supranationalen Ideologien erdrückt worden waren, kehrte auch die Erkenntnis zurück, daß Einzelstaat, Nation und nationale Kulturen legitime Kategorien europäischer Geschichte sind, allerdings ohne daß darüber die übergreifenden Strukturen und Prozesse, in die sie eingebunden und deren Teil sie waren, aus dem Auge verloren wurden: "Nederlandse cultuur in europese context" - so lautete das 1991 eingerichtete prioriteitsprogramma der Texte/vorträge/Leiden 2002 4 Nederlandse Organisatie voor Wettenschapelijk Onderzoek, das soeben durch fünf große Darstellungsbände abgeschlossen wurde. Damit ergibt sich als erste typologische Bestimmung der europäischen Zivilisation ihre politische, kulturelle und mentalitätsmäßige Differenzierung in unterschiedliche Länder und Nationen. Daraus ergibt sich für die Historiker eine Komplementäraufgabe: Sie müssen die Geschichte der einzelnen Länder und Völker Europas erforschen, um dadurch die Pluralität der nationalen Kulturen und Staaten samt dem daraus resultierenden Konzert der Mächte als ein wesentliches Strukturmerkmal des neuzeitlichen Europa zu erfassen. Und sie müssen die diesen gemeinsamen Haupt- oder Kardinallinien herausarbeiten, die das überstaatliche Profil Europas ausmachen. In der eingangs entwickelten universalgeschichtlichen Perspektive muß es dann drittens um den Vergleich und die Beziehungsgeschichte mit den andern Zivilisationen der "Wider World" (J.H.Parry) gehen. Texte/vorträge/Leiden 2002 5 2. Räumliche Abgrenzung; epochale Schwerpunkte Die Begegnung mit anderen Kulturen ergab sich schon alleine dadurch, daß Europa als Zivilisation geographisch-räumlich stets offen war: In der Antike hatte sich eine Kernzivilisation beziehungsweise ein "älteres Europa" gebildet, das sich über Jahrhunderte konzentrisch ausweitete und den Norden und Osten als "neueres Europa" integrierte (Peter Moraw). Im äußersten Westen des Kontinents, auf der Iberischen Halbinsel, dehnte sich der europäische Zivilisationstypus sogar erst ausgangs des 15. Jahrhunderts bis an die Grenzen des Kontinents aus, als die Reconquista die Vertreter der arabisch-islamischen Zivilisation nach Nordafrika vertrieb. - Selbst über die Meere hin war Europa offen, wie am eindrucksvollsten die atlantische Expansion der Portugiesen und Spanier belegt. Nimmt man schließlich die gleitenden Übergänge zum Zwillingskontinent Asien hinzu, so ist offensichtlich, daß "Europa" durch andere als räumlich-geographische Kriterien zu definieren ist. Gehen wir von sachlich-inhaltlichen Unterscheidungskriterien aus, so scheint es mir geboten, von einem römischen lateinisch-christlichen Zivilisationstypus "Europa" zu sprechen, der sich durch spezifische Strukturen und Prozesse konstituierte. Unter diesen kam dem Römischen Recht, den gemeindlichgenossenschaftlichen Elementen der politischen Organisation sowie den spezifischen Beziehungen zwischen Religion und Welt beziehungsweise Kirche und Staat besonderes Gewicht zu. Das ist gleich näher zu beschreiben. Dieser Zivilisationstypus römisches, lateinisch-christliches Europa ist abzugrenzen sowohl vom griechischen beziehungsweise russischen orthodoxchristlichen Europa als auch von den europäisch-atlantischen Mischzivilisationen, die sich seit dem 16. Jahrhundert in Amerika herausbildeten. Eine solche Unterscheidung schaltet die normative Eurozentrik Texte/vorträge/Leiden 2002 6 aus, die mit Konzepten wie "Western Civilization" oder "europäische Expansion" verbunden war. Denn Rußland ebenso wie die Überseegesellschaften würden nicht als minderentwickelte Randzonen oder Appendizes Europas, sondern als eigenständige Zivilisationen behandelt. Und die Beziehungsgeschichte zwischen ihnen und Europa wäre nicht mehr als Einbahnstraße angelegt, auf der europäische Institutionen wie "Staat", "kapitalistisch-rationales Wirtschaftssystem" oder "Bürger- und Menschenrechte" in die Welt gelangten. Im Vordergrund sollen vielmehr die Wechselwirkungen und der Austausch mit Rußland oder Übersee stehen, so daß auch der Gewinn deutlicher zutage träte, den Europa und einzelne seiner nationalen Sub-Kulturen - etwa die bekanntermaßen weltausgreifende niederländische - aus der Welt zogen, und zwar keineswegs nur in materieller Hinsicht, sondern auch und vor allem als Selbsterkenntnis und Bewußtseinserweiterung in der Begegnung mit dem Fremden oder gar als Herausbildung eines die Welt durchdringenden und die eigenen Kräfte weckenden frontier-Geistes, vergleichbar jenem Geist permanenten Aufbruches, den die berühmte These von Frederick Jackson Turner für die Vereinigten Staaten seit dem 19. Jahrhundert in Anspruch nimmt. Epochal erscheinen mir angesichts der post-nationalstaatlichen Aufgaben in Gegenwart und Zukunft aus der europäischen Vergangenheit weniger die Höhepunkte des Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert erhellend als die pränationalstaatliche Welt Alteuropas. Vor allem die Zeit zwischen 1250 und 1750 verdient besonderes Interesse. Denn in diesem halben Jahrtausend bildete sich das prä-nationalstaatliche, multikonfessionelle und politisch plurale Europa der frühen Neuzeit heraus, an das die gemeinsame politische Kultur und Identität eines post-nationalstaatlichen Europas weit eher anknüpfen kann als an die verfestigten und verfeindeten Strukturen der nationalistischen Epoche des 19. und 20. Jahrhunderts. Texte/vorträge/Leiden 2002 7 Das gilt es im folgenden am Beispiel mir besonders wichtig erscheinender Strukturen und Prozesse aufzuzeigen, die sich in jener Epoche durchsetzten und die das Profil der "Neuen Zeit Europas" ausmachen. Texte/vorträge/Leiden 2002 8 3. Der religionssoziologische Typus Europa Ich beginne mit theologie- und kirchengeschichtlichen Zusammenhängen, die heute nur noch schwer zu vermitteln sind, obgleich sie wie kaum etwas anderes in der zweitausendjährigen Geschichte Europas mit dazu beigetragen haben, Rationalität und Säkularität der europäischen Moderne hervorzubringen: Der Zivilisationstypus Europa beruhte wesentlich auf einem spezifischen religionssoziologischen Profil, das durch zwei Grundstrukturen und einen dadurch bedingten säkularen Fundamentalprozeß gekennzeichnet war. Erstens waren Religion und Gesellschaft, politische und kirchliche Ordnung stets eng miteinander verzahnt. Im modernen Verständnis von Gesellschaft sind Religion und Kirche untergeordnete Teile eines größeren säkularen Systems. Im Gegensatz dazu waren Religion und Kirche bis zur Aufklärung und zur Französischen Revolution tektonisch tragende Säulen der gesellschaftlichen Ordnung insgesamt. Es galt die Maxime religio vinculum societatis - Religion ist das einigende Band der Gesellschaft und für ein geordnetes Zusammenleben unverzichtbar. Daher waren in Alteuropa, also in den Jahrhunderten zwischen Antike und Französischer Revolution, Religion und kirchliche Institutionen von eminenter politischer und sozialer Bedeutung, und religiöser Wandel war immer zugleich sozialer Wandel. Zweitens, diese Verzahnung brachte keinen Monismus hervor, der Kirche und Staat ununterscheidbar gemacht hätte, wie das in asiatischen, zu einem gewissen Maße auch in der osteuropäischen, orthodoxen Zivilisation der Fall war, ebenso unter dem religiösen Fundamentalismus der Gegenwart. Das lateinische Christentum war vielmehr durch einen Dualismus von Kirche und Welt charakterisiert, in dem beide zwar eng aufeinander bezogen waren, aber stets selbständig blieben, für jeden erkennbar in der kirchlichen und weltlichen Doppelspitze Papst und Kaiser, später auch die nationalen Könige oder Fürsten. Texte/vorträge/Leiden 2002 9 Geistliche und weltliche Gewalt waren ausbalanciert, und damit die Macht sowohl des Staates als auch der Kirche begrenzt, womit zugleich hohe Barrieren gegen religiösen oder politischen Fundamentalismus errichtet waren. Aus diesem Dualismus ergab sich eine gesellschaftliche, geistige und kulturelle Dynamik, die Kirche und Gesellschaft häufig gegeneinander auftreten ließ, vor allem in den Städten, ohne daß das aber eine grundsätzliche Gegnerschaft bedeutete. Daraus ergibt sich drittens, daß Europa - wie ich thesenhaft formulieren möchte - von Anfang an auf Säkularisation angelegt war. Diese Säkularisation bedeutete aber nicht einfach, daß Kirche und Welt schrittweise auseinander traten. Es handelte sich vielmehr um einen dialektischen Prozeß, in dessen Verlauf religiöse Energien in die weltlichen Bereiche eingespeist wurden, dort in gewandelter Form fortwirkten und so eine besondere soziale, politische oder kulturelle, ja selbst wirtschaftliche Dynamik freisetzten. Ein einprägsames Beispiel für diese Übertragung ehemals religiöser Legitimation und Emphase auf innerweltliche Zusammenhänge mittels Säkularisation ist die Friedenstaube. Ursprünglich im Alten Testament ein Noah-geschichtliches himmlisches Zeichen für die Versöhnung und den Frieden zwischen Gott und den Menschen nach der Sündflut, wurde sie Schritt für Schritt zu einem Symbol des rein innerweltlichen Friedens - zunächst noch mit christlich-religiösen Konnotationen, so symbolhaft für den Westfälischen Frieden, schließlich dann in der modernen Friedenbewegung ganz losgelöst von religiös-theologischen Vorstellungen, aber weiterhin ausgestattet mit der "säkularisierten" Legitimation der Religion und dem "Kredit" christlicher Emphase. Texte/vorträge/Leiden 2002 10 4. Staaten und partizipatorische Politikkulturen Eine zweite Kardinallinie im europäischen Zivilisationsprofil sind die politische Kultur und der Staat, verstanden als spezifische Form politischer Ordnung und charakterisiert durch Flächenherrschaft, sachlich-bürokratische Verwaltung, rationales Recht und ordentlichen Gerichtsgang, Institutionalisierung und vor allem durch Autonomie der höchsten Staatsgewalt oder Souveränität. Auch die Entstehung dieses frühmodernen Staates war ein "Vorgang der Säkularisation" (Ernst-Walter Böckenförde), in dessen Verlauf ehemals religiöse Energien auf den Staat übergingen. Doch nicht diese institutionelle Seite, die noch kürzlich von Wim Blockmans und Wolfgang Reinhard ausführlich und eindrucksvoll beschrieben wurde, soll uns heute beschäftigen. Vielmehr soll es um die gleichsam kontrapunktisch zur Staatsbildung entstandene politische Kultur gehen, also um das Ringen um die beste innere Ordnung, das in theoretischen Abhandlungen, aber auch ganz praktisch in zahllosen Aufstands- und Bürgerbewegungen ausgetragen wurde. Auf diesem Wege hatte sich ausgangs des Mittelalters eine partizipatorische Politikkultur herausgebildet, die für den lateinisch-europäischen Zivilisationstypus nicht weniger charakteristisch war als der Staat. Mit Blick auf die meist vom Adel dominierten Stände hat das bereits anfangs des vorigen Jahrhunderts der Verfassungshistoriker Otto Hintze herausgearbeitet. Inzwischen haben Sozial- und Stadthistoriker auf weitere Elemente dieser partizipatorischen Politikkultur aufmerksam gemacht und zu deren Beschreibung und Analyse die Modelle "alteuropäischer Republikanismus" (Helmut Königsberger), "Kommunalismus" (Peter Blickle) und "Stadtrepublikanismus" (Heinz Schilling) entwickelt. Damit wird deutlich, daß die alteuropäische Partizipation weit über den Adel und das Ständewesen Texte/vorträge/Leiden 2002 11 hinausreichte und Bürger- oder Nachbarschaftsverbände der Städte ebenso einschloß wie bäuerliche Gemeinden. Es ist zwar richtig, daß im 17. Jahrhundert der absolutistische Machtstaat mit seinen Partizipation beschneidenden autokratischen Strukturen in den Vordergrund trat. Vernichtet wurde die Partizipationskultur jedoch nirgendwo, so daß heute die Historiker das Absolutismusmodell längst nicht mehr wörtlich nehmen oder den Begriff "Absolutismus" sogar ganz verwerfen. Vor allem aber ist zu betonen, daß stets nur ein Teil Europas "absolutistisch" regiert wurde, in der anderen Hälfte aber weiterhin Stände-, Bürger- oder Gemeindebeteiligung selbstverständlich waren. Wenn das im Geschichtsbewußtsein der Europäer noch kaum hinreichend präsent ist und libertäre Politikkulturen wie diejenige der Adelsrepublik Polen oder der Niederländischen Republik gelegentlich sogar bespottet werden, dann ist das eine Folge der Jahrhunderte langen Verherrlichung des Machtstaates durch Politiker und Historiker. Und es war auch wirklich so, daß sich die absolutistisch regierten Staaten Frankreich, Preußen, Österreich und Rußland in der Machtkonkurrenz des frühneuzeitlichen Staatensystems besser behaupteten als die partizipatorischen. Nachdem nun aber die Konfrontation der Mächte der Kooperation der europäischen Staaten und Gesellschaften gewichen ist und wir gelernt haben, daß es neben äußerer Machtentfaltung und Selbstbehauptung auch und vor allem auf die innere Integrationskraft eines Gesellschaftssystems ankommt, können wir heute jene partizipatorische Politikkultur wieder unvoreingenommen würdigen und die Vorteile libertär-partizipatorischer Integration gegenüber autokratisch-absolutistischem Zwang erkennen. In bezug auf die Niederländische Republik, die Schweizer Kantone oder die deutschen Reichsstädte ist uns das vertraut. Weniger bekannt ist dagegen und Texte/vorträge/Leiden 2002 12 sollte nicht zuletzt mit Blick auf die Osterweiterung der Europäischen Union in Erinnerung gerufen werden, daß sich ausgangs des Mittelalters in Ostmitteleuropa eine ganz ähnliche Politikkultur herausgebildet hatte: Gefördert durch das Aussterben einheimischer Dynastien und die damit einhergehende generelle Schwächung des Königtums sowie durch einen ausgeprägten Regionalismus - besonders ausgeprägt in der "zusammengesetzten" Monarchie Böhmen mit den weitgehend selbständigen Kronländern Böhmen, Mähren, Schlesien, Ober- und Niederlausitz - kam es dort zu einem raschen Ausbau der politischen Freiheiten und Partizipationsrechte und korrelierender Begrenzung des Königs, der in der monarchia mixta fast nur noch primus inter pares war. Von Polen-Litauen über Böhmen bis nach Ungarn-Transsilvanien bestand im 15. und 16. Jahrhundert eine Zone freiheitlicher Rechts- und Politikordnung, die "im westlichen Europa nur hier und dort verstreute Entsprechungen findet" (Gottfried Schramm) und konsequenter noch als England eine politische Kultur der Partizipation aufbaute. Gewalt und Zwang haben diese partizipatorischlibertären Politikkulturen zerstört - mit langfristigen gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen für diese Zone Europas. In Böhmen geschah das nach der Niederlage am Weißen Berg 1620 und in Ungarn im späteren 17. Jahrhundert durch den habsburgisch-österreichischen Absolutismus; in Polen erst ausgangs des 18. Jahrhunderts durch das Diktat der Militärmächte Österreich, Preußen und Rußland. Texte/vorträge/Leiden 2002 13 5. Das internationale System unabhängiger Staaten Es käme nun allerdings einer Geschichtsfälschung gleich, den Machtstaat und das von ihm beherrschte internationale Staatensystem als Störfaktoren oder gar Fehlentwicklung der europäischen Geschichte darzustellen. Im Gegenteil, die Herausbildung eines internationalen Mächtesystems partikularer, autonomer Staaten zwischen 1450 und 1650 ist nicht weniger charakteristisch und folgenreich für Europa als die genannten religionssoziologischen und politikkulturellen Zusammenhänge. Aus Zeitgründen kann ich dieses gewaltige kriegerische, aber auch diplomatische und geistige Ringen nicht schildern, das Europa rund zweihundert Jahre verdichteter Gewalt innerhalb und zwischen den Staaten brachte. Das waren gleichermaßen "Staatenbildungs- und Staatenkriege" (Johannes Burkhardt), das heißt sie dienten einerseits der Entscheidung über die Machtverteilung innerhalb der noch unfertigen Staaten und andererseits der Formierung einer gesamteuropäischen Politikordnung. Diese Konflikte waren nötig geworden, weil sich die mittelalterlichen Herrschaften zu Staaten mit zunehmend egoistischen Staateninteressen umbildeten und weil parallel dazu angesichts einer rasanten Verkehrs-, Bevölkerungs- und Kommunikationsverdichtung die alltäglichen Kontakte zwischen ihnen zunahmen, die friedlichen ebenso wie die konflikthaften. Das Verhältnis der Einzelstaaten zueinander ebenso wie die Staatenordnung waren machtpolitisch und konzeptionell neu zu bestimmen. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts kam hinzu, daß viele dieser Kriege als Glaubensund Konfessionskriege ausgetragen wurden, die inneren ebenso wie die äußeren und dort gerade diejenigen, die über die Gestaltung des Mächteeuropa entschieden - wie der "tachtigjarige oorlog" oder der Dreißigjährige Krieg, die beide sowohl gegen einen äußeren Feind, vorrangig gegen Spanien, als auch um Texte/vorträge/Leiden 2002 14 des Glaubens und um der inneren Verfassung der niederländischen Republik beziehungsweise des Heiligen Römischen Reiches willen geführt wurden. Mitte des 17. Jahrhunderts war es dann möglich, die neuzeitliche Staats- und Staatenordnung Europas vertrags- und völkerrechtlich festzuschreiben. Voraussetzung dafür war es, daß drei langfristige Prozesse zu einer Klärung gekommen waren - nämlich erstens, daß sich die Staaten im Innern gefestigt hatten, und zwar nicht zuletzt durch die Kriege - was selbst für die niederländische Republik gilt! - , zweitens, daß die zwischenstaatlichen Machtverhältnisse fürs erste geklärt waren, das heißt konkret die habsburgischen, vor allem spanischen Hegemonialansprüche, die seit Kaiser Karl V. eine plurale Staatenordnung Europas zu blockieren drohten, endgültig niedergerungen waren; und drittens, daß der Fundamentalismus der konfessionellen Weltanschauungssysteme überwunden wurde, der für zwei Generationen die eingangs geschilderte Tendenz des lateinischchristlichen Europa auf Säkularisation blockiert hatte, so daß die Unterscheidung zwischen Politik und Religion, zwischen Interessen des zivilen Gemeinwesens und denjenigen der Kirchen zur Norm werden konnte. In den Friedenschlüssen von Westfalen einschließlich des Vrede van Munster von 1648, von Olivar 1660 zwischen Schweden, Polen, Kaiser und Kurbrandenburg und im Pyrenäenfrieden zwischen Frankreich und Spanien von 1659, die erstmals auf großen, bis heute der Diplomatie als Vorbild dienenden Staatenkongressen ausgehandelt wurden, wurde endgültig der säkulare Pluralismus autonomer Staaten und die rechtliche Gleichheit aller Mitglieder des Mächteeuropa vertrags- und völkerrechtlich festgelegt. Und die säkulare Autonomie des Politischen war ganz konkret dadurch gesichert worden, daß sich in Münster die Vertragspartner über die Konfessionsgrenzen hinweg verpflichtet hatten, dem abzusehenden und auch tatsächlich erfolgten Protest des Papstes Texte/vorträge/Leiden 2002 15 keinerlei Geltung zu gewähren. Damit hatten auch die katholischen Leitmächte den Anspruch des Papstes, als pater commune die zwischenstaatlichen Verhältnisse regeln zu können, ein für allemal zurückgewiesen. Damit war nicht der Ewige Frieden erreicht, wohl aber war der Krieg eingehegt und bestimmten Regeln unterworfen worden, und ein neuer gesamteuropäischer Flächenbrand konnte auf dieser Basis anderthalb Jahrhunderte lang, nämlich bis zu den Französischen Revolutionskriegen, verhindert werden. Vor allem aber war mit dieser europäische Mächteordnung, die wenig später das Prinzip der Balance of Power entwickelte, eine weitere Barriere gegen Hegemoniebestrebungen nach Art Spaniens unter Philipp II oder Frankreichs unter Ludwig XIV. errichtet. Neben der Macht relativierenden, kontrollierenden und ausballancierenden Wirkung des erwähnten Staat-Kirchen-Dualismus war das der zweite Eckstein in der Konstruktion individueller und kollektiver Freiheitssicherung, die das europäische Haus stabilisierte. In dieser Tradition konnten im 20. Jahrhundert selbst die faschistischen und kommunistischen Ansprüche auf Beherrschung des Kontinents zurückgewiesen werden. Das in der frühen Neuzeit etablierte System autonomer, aber völker- und vertragsrechtlich verbundener Partikularstaaten hat Europa nicht Kriege, wohl aber die politisch, ökonomisch und vor allem geistig lähmende Bedrückung durch ein Groß- und Einheitsreich oder eine langjährige Hegemonialmacht erspart. 6. Kulturelle Differenzierung, Migration und Minderheiten Nicht weniger folgenreich als die politisch-staatliche war die kulturelle und geistige Differenzierung und Pluralisierung des Kontinents. Nachdem bereits unter dem Dach der mittelalterlichen Kirche eine beachtliche Vielfalt sozioTexte/vorträge/Leiden 2002 16 religöser und sozi-kultureller Lebensentwürfe möglich geworden war bis hin zu den bürgerlichen, individuellen Frömmigkeitsformem der Devotio Moderna, wurde bekanntlich im 16. Jahrhundert die weltanschauliche und institutionellkirchliche Einheitlichkeit des lateinischen Christenheit endgültig aufgebrochen. Die Historiker haben das traditionell mit Luther, Calvin und der protestantischen Reformation in Verbindung gebracht. Heute wissen wir, daß auch die katholische Kirche an der frühmodernen Differenzierung beteiligt war. Und wir schreiben die Veränderungen eher der sogenannten Konfessionalisierung als der Reformation selbst zu, also der Herausbildung von drei, nimmt man den Anglikanismus hinzu, von vier Konfessionskirchen, denen je unterschiedliche, in ihren Strukturen und Funktionen aber durchaus vergleichbare Konfessionsmentalitäten und Konfessionskulturen entsprachen - jede von ihnen gleichermaßen neu und neuzeitlich die katholische nicht anders als die lutherische, reformierte oder anglikanische, wenn auch jede reklamierte, das alte und ursprüngliche Christentum zu vertreten. Diese Konfessionalisierungen haben in der Verbindung mit Staats- und Nationenbildung mitgewirkt, die frühmodernen Gesellschaften und die Vielfalt von politischen Identitäten hervorzubringen, die Europa seit dem 16. Jahrhundert ausmachen und die jeder Reisende noch heute erleben kann, wenn er von Skandinavien nach Spanien oder Italien oder auch nur von Amsterdam nach Antwerpen reist. Vor allem aber haben die seit Mitte des 16. Jahrhunderts voranschreitenden Konfessionalisierungen der europäischen Staaten und Gesellschaften in einem gleichsam dialektischen Prozeß den weltanschaulichen Pluralismus der Moderne hervorgebracht, der das geistige, rechtliche und soziale Profil des modernen europäischen (und amerikanischen) Gesellschaften ausmacht. Denn die rigorose weltanschauliche, politische, soziale und religiös-kulturelle Integration, Texte/vorträge/Leiden 2002 17 Abgrenzung und Feindschaft, die den Konfessionalisierungen eigentümlich waren und sehr häufig in blutiger Gewalt innerhalb und zwischen den Staaten, ja selbst im privaten Leben gipfelten, brachten zugleich die dynamisierende Konkurrenz der Weltbilder und Kulturen hervor sowie - sollte Europa nicht im Chaos der Glaubenskriege untergehen - den Zwang zu politisch oder rechtlich abgesicherten Multikonfessionalität. Auf lange Sicht konnte dann aus dem erzwungenen Nebeneinander der christlichen Konfessionen die Forderung nach prinzipieller Akzeptanz des anderen werden - anderer Religionen ebenso wie der Nicht-Gläubigen. Das war alles andere als ein von den Konfessionen des 16. und 17. Jahrhunderts gewollter Weg. Und doch gibt es Sinn, wenn Jean Delumeau 1998 den Abschluß der Feierlichkeiten zum vierhundertsten Jahrestag des Edikts von Nantes unter das Motto l'acceptation de l'autre stellte. Und es erscheint mir als eine der vordringlichsten Aufgabe der europäischen Geschichte im eingangs skizzierten Sinne, vergleichend die Wege und Wendemarken zu erforschen, auf denen die einzelnen europäischen Gesellschaften aus dem Zwang zur Konfessionalisierung zum Prinzip der Anerkennung des anderen fanden. Dabei wäre der libertären Religionsverfassung der niederländischen Republik ebenso besonderem Aufmerksamkeit zu schenken wie der rechtlichen Einhegung der Konfessionsgegensätze im Augsburger Religionsfrieden von 1555, dessen Jahrestag den Deutschen ins Haus steht. Das kann ich heute nicht weiter entfalten. Statt dessen soll abschließend dieser außerordentlich komplexe, häufig widersprüchliche, von Widerständen und Rückschlägen umgeleitete oder unterbrochene Vorgang an einem Beispiel veranschaulicht werden, und zwar an der transkontinentalen Konfessionsmigration. Damit berühren wir zugleich eine weitere Kardinallinie im europäischen Zivilisationsprofil, nämlich die alltäglich Präsenz von Migration und Fremden. Europa war seit der Antike auf die alltägliche "kleine" und die exzeptionelle "große", transkontinentale Migration angewiesen - man Texte/vorträge/Leiden 2002 18 denke nur an die Städte, die ohne Migration gar nicht existieren konnten. Bei den heute zur Debatte stehenden Chancen oder Problemen von Integration oder Segregation von Fremden könnten die europäischen Gesellschaften also durchaus auf jahrhundertealte Erfahrungen zurückgreifen. Zwei Dinge gilt es dabei allerdings zu berücksichtigen, - daß es sich heute überwiegend um interkontinentale Wanderungen handelt und auch die quantitative Dimension und die Formen der Migration ganz anders sind als in Alteuropa; - daß sich durch eine solche historische Analyse kaum technokratische Instrumentarien für eine möglichst reibungslose Steuerung heutiger Zuwanderungsströme gewinnen lassen, wohl aber ein Gespür für die Bedeutung von Migration und Integration Fremder für die historischpolitische Kultur Europas und damit auch eine Prävention gegen Ängste, die unbegründet sind. Die sogenannte Konfessionsmigration des 16. bis 18. Jahrhunderts wurde durch die eben skizzierten Zwangsmaßnahmen der Konfessionalisierungen der einzelnen europäischen Gesellschaften ausgelöst, und auch die Lebensbedingungen in den neuen Heimatorten waren häufig von konfessionellen Gegensätzen bestimmt, besonders deutlich in den katholischen Städten Deutschlands. Insgesamt waren etwa eine dreiviertel Million Menschen betroffen, davon zwischen 100 000 und 150 000 Niederländer oder Wallonen, Engländer während der katholischen Jahre Mary Tudors, Italiener, vor allem aus Lucca, Österreicher, Böhmen, Hugenotten, Waldenser, Pfälzer und Salzburger auf protestantischer und kleinere Gruppen Katholiken etwa aus den kurzlebigen Calvinistenrepubliken der südlichen Niederlande, später aus England, Irland und Skandinavien. Es spricht einiges dafür, auch die Migration der portugiesischen und spanischen Juden als Teil der Konfessionsmigration anzusehen, weil anders als bei der mittelalterlichen Glaubensmigration von Juden - auch ihr Schicksal von der Konfessionalisierung mitbestimmt wurde, die Vertreibung ebenso wie die Aufnahme in den neuen Gastgesellschaften. Zudem waren es Texte/vorträge/Leiden 2002 19 häufig dieselben Städte, die sowohl christliche als auch iberisch-jüdische Exulanten aufnahmen - so namentlich Amsterdam und andere holländische Städte, Hamburg oder London. Die Migration erfolgte teils über kürzere, häufig aber auch über lange Distanzen - etwa nach Skandinavien oder ins Baltikum -, um in ihnen mehr oder weniger fremden Gastgesellschaften eine neue Existenz aufzubauen, ökonomisch und sozial, vor allem aber religiös und kulturell. Die Sephardim, die teils über Sekundärmigration immer weiter nach Osten zogen - nach Ungarn, in die Walachei, später nach Polen-Litauen - trugen wesentlich zu Entstehung der neuzeitlichen Kultur der Ostjuden bei. Jede einzelne Welle hatte ihr eigenes Sozial- und Religionsprofil. Die historische Analyse muß daher an konkreten Beispielen erfolgen, und dazu wähle ich aus naheliegenden Gründen die niederländischen Exulanten aus. Dabei möchte ich nicht die sozio-ökonomischen Zusammenhänge und die daraus resultierenden Integrationsprobleme ins Zentrum rücken - - also die Bedeutung der Migranten für die Verbreitung von Innovationen in Technik, Betriebsverfassung und Organisationsformen von Arbeit innerhalb der Gastgesellschaften oder auf ihren Betrag zum ökonomischen Aufschwung und den gesellschaftlichen Wandel, der von den Einheimischen meist als schmerzhaft empfunden wurde und daher zur Ablehnung der Fremden beitrug. - Konkret gesprochen die Ansiedlung neuer Gewerbezweige vor allem der Textil- und der Luxus - Zuckersiederei, Edelsteinschleiferei, Tapisserien - in London, Norwich, Frankfurt oder Köln; die Einführung neuer Techniken beim Färben, im Handel und bei der Geldschöpfung und im Versicherungswesen, die Hamburg, Frankfurt und London zu den Wirtschaftszentren des 17. Jahrhunderts aufblühen ließen; Durchsetzung des Verlagswesen, der Akkord- und Lohnarbeit oder ähnlicher neue Betriebsformen, die in den genannten Städten, vor allem aber im niederrheinischen Landgebiet (Stolberg, Monschau, Krefeld u.a.) ganz neue, modernere Formen des Wirtschaftens, und ein aus den traditionellen "feudalen" Strukturen ausbrechendes frühmodernes Wirtschafsbürgertum entstehen ließen; schließlich die berühmte Entwicklungshilfe durch den Aufbau Texte/vorträge/Leiden 2002 20 frühmoderner Montan- und Metallverarbeitungsgewerbe durch die wallonischen Unternehmer Louis de Geer und die Trippen-Familie zusammen mit einer Arbeiterschaft, die teilweise über eine Sekundärmigration aus dem Aachener Raum nach Norden kam. Es geht mir um die Rolle, die Religion und kulturelle Identität für die Selbstbehauptung der Refugianten und für ihre Stellung in den Gastgesellschaften spielte: Die niederländischen Exulanten waren dominant reformiert-calvinistisch, die meisten Zufluchtsorte dagegen lutherisch, anglikanisch oder katholisch. Da auf dem Höhepunkt des konfessionellen Zeitalters "civitas", also Bürgerschaft, nach der Definiton des Aachener Chronisten Petrus a Beeks nicht nur politische und sozial-civile Eintracht bedeute, sondern auch und vor allem "eiusdem fidei symbolo", also durch dieselbe Konfession, verbunden zu sein, mußten sich die andersgläubigen Einwanderer religiös-kirchlich als Geheim- oder Untergrundkirchen organisieren, "Kirchen unter dem Kreuz", wie sie das nannten, oder - in den protestantischen Orten - als Minderheiten- und Sondergemeinden, und zwar selbst im anglikanischen England, wo ihre presbyterial-synodal im Gegensatz zur episkopalen Kirchenverfassung stand. Das hatte zugleich die „zivilrechtliche“ Konsequenz, daß die konfessionsverschiedenen Fremden keine vollberechtigten Bürger werden konnten, sei es, daß ihnen bereits das Bürgerrecht vorenthalten wurde, sei es, daß sie keine politischen Ämter bekleiden durften. In dieser Situation wurden Religion und Kirchenzugehörigkeit in den Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Migranten häufig konfliktleitend und damit entscheidend für den Erfolg oder Mißerfolg der Integration. In den Migrationszentren bestimmte der Mechanismus von Integration nach innen und aggressiver Abgrenzung nach außen, gegenüber den Andersgläubigen über Generationen hin das Zusammenleben von Texte/vorträge/Leiden 2002 21 Einheimischen und Fremden. Diese Spannungen lösten sich erst, als seit Mitte des 17. Jahrhunderts zunehmend Politik und Religion getrennt gedacht wurden. Die Gegensätze schliffen sich auf symbolisch-rituelle Unterschiede ab. - wie sie zum Beispiel Goethe in "Dichtung und Wahrheit" mit leichter Ironie für seine Vaterstadt Frankfurt überliefert – zwischen den einheimischen Lutheranern, die zu Fuß gehen „dürfen“, nämlich in die nahegelegenen städtische Pfarrkirche; und den zugewanderten Reformierten, denen öffentliche Gottesdienst in der Stadt versagt waren und die sich daher den Luxus erlauben konnten, mit der Kutsche ins nicht weit vor den Toren gelegene Bockenheim zur Kirche zu fahren. Doch nicht nur im Verhältnis zwischen Einheimischen und Fremden, sondern auch und gerade für die Migranten selbst spielten Gemeinde und konfessionelle Zugehörigkeit oder Identität eine existentielle Rolle – für die Logistik von Aufbruch und Wanderung, für die Orientierung über mögliche Zufluchtsorte, für die Versorgung während der Migration und die erste Unterbringung am Zufluchtsort, schließlich für die Selbstbehauptung in den Gastgesellschaften. Die niederländischen Exulanten entwickelten - darauf hat insbesondere Heiko Augustinus Oberman aufmerksam gemacht - eine spezifische „Exulantentheologie“, charakterisiert durch Widerstandsrecht, Prädestination, durch einen spezifischen Kirchenbegriff, der die Einzelgemeinde zur vollgültigen Kirche und damit in jeder Situation handlungsfähig macht, schließlich durch ein ausgeprägtes Volk-Gottes-Bewußtsein, das irdisches Dasein als peregrinatio, als In-der-Welt-fremd-Sein, begreift und sich damit zugleich geschützt weiß - unübertreffbar ausgedrückt in dem verbreiteten Schiffchen-Gottes-Symbol, das auf Siegeln, Petschaften, Friesen oder Gemälden die christlichen Gemeinden in einem vom Sturm umtobten Kahn zeigt, teilweise mit dem Motto "in portu navigo" - ich segle in den Hafen, nämlich der Gottesnähe, hinein. Dieser intellektuellen Exulantentheologie entsprach in der gesellschaftlichen Praxis eine alltäglich wirksame Exulantenidentität und Texte/vorträge/Leiden 2002 22 Exulantenkultur, die allen Migranten, gleich welcher sozialen Schicht und welchen intellektuellen Profils offen stand. Beides zusammen, die Theorie der Exulantentheologie und die sozio-kulturelle Praxis der alltäglichen Exulantenkultur, sorgten für eine bemerkenswerte soziale und emotionale Stabilität der Niederländerkolonien. Darüber hinaus garantierten sie ein kollektives Gedächtnis, das in mannigfaltigen symbolischen Formen über Generationen hinweg die Zugehörigkeit und die Akzeptanz der Minderheitensituation sicherstellte. Die unbedingte religiöse Bindung, die sie zu Migranten gemacht hatte, war zugleich die notwendige Voraussetzung dafür, daß sie die Existenz als Fremde bewältigten – zur Rettung ihrer Seelen und zur Sicherung des Überlebens, in der Regel aber auch zur Mehrung des Wohlstands der Gastgesellschaften. Im Licht der säkularisierten europäischen Gesellschaften der Gegenwart mag es nicht leicht erscheinen, in der entschiedenen konfessionellen Position der frühneuzeitlichen Konfessionsmigranten einerseits und der aufnehmenden Gesellschaften andererseits funktionale Elemente gesellschaftlicher und kultureller Ordnung zu sehen. Doch gerade diese historische Verfremdung läßt uns erkennen, welche Bedeutung Religion und religiöse Institutionen für diejenigen Gruppen der gegenwärtigen transkontinentalen Migration hat oder haben kann, die aus nicht-säkularisierten Gesellschaften kommen und daher den frühneuzeitlichen Konfessionsmigranten näherstehen als den säkularisierten Gesellschaften des heutigen Europa. Damit sind zugleich die Chancen für die Gastgesellschaften offensichtlich, die Religion und die religiöse Institutionen der Migranten als Brücke für ein kulturelles wie gesellschaftliches und politisches Verstehen der und Verständnis für die Fremden zu nutzen. Damit eröffnet sich eine Verständigung, die mehr und anderes bedeutet als die Texte/vorträge/Leiden 2002 23 schlichte Forderung, die Fremden müßten die besseren Einheimischen werden. Warum sollen wir den heutigen Migranten nicht dasselbe zugestehen, was wir heute noch als Tugend der niederländischen Exulanten, Hugenotten oder Salzburger feiern, nämlich, sich in der Gastgesellschaft zu behaupten, für sie und mit ihr wirtschaftliche und kulturelle Leistungen zu vollbringen und dennoch die eigene, ganz andere religiöse und kulturelle Identität zu bewahren und noch Jahrhunderte nach der längst vollzogenen Integration ein eigenständiges Geschichtsbewußtsein zu besitzen? Voraussetzung ist allerdings, daß die fundamentalistischen Tendenzen von Religion gebändigt werden. Wie die frühneuzeitliche Konfessionsmigration zeigt, läßt sich das aber kaum durch Indifferenz in der religiösen Wahrheitsfrage bewerkstelligen, wie sie für die modernen, agnostischen Gesellschaften Europas typisch ist. Vielmehr scheint mir jene Erfahrung den richtigen Weg zu weisen, die die europäischen Gesellschaften mit ihren eigenen, zum Fundamentalismus neigenden konfessionellen Weltanschauungssystemen und deren Pazifizierung gemacht haben: Die Integration der Konfessionsmigranten in eine anderskonfessionelle Gesellschaft wurde nicht dadurch erreicht, daß man die religiösen Wahrheiten für belanglos erklärte. Die zerstörerische Gewalt des konfessionellen Fundamentalismus konnte nur dadurch überwunden werden, daß die Wahrheitsfrage als unverhandelbar anerkannt, gleichzeitig aber für das alltägliche Zusammenleben ausgeklammert wurde. Erst auf dieser Basis konnten die frühneuzeitlichen Gesellschaften - die "großen" staatlichen ebenso wie die "kleinen" Stadtgesellschaften - die Migration produktiv bewältigen. Nur so haben sie Schritt für Schritt die Freiheit des politischen Handelns unabhängig von den weiterbestehenden konfessionellen Unterschieden wiedergewonnen und soziale, ökonomische und kulturelle Lebensbedingungen hergestellt, die Einheimischen und Eingewanderten gleichermaßen förderlich waren. Texte/vorträge/Leiden 2002 24 III. Die Ihnen heute an wenigen konkreten Beispielen vor Augen gestellte Geschichte Europas, die sich als Teil eines historisch Zivilisationsvergleiches versteht und damit als Gegenentwurf zu Konzepten von Universalgeschichte als bloßer Zeitgeschichte einer global vernetzten Gegenwart, kommt in bezug auf die schicksalhafte Frage zukünftigen Zusammenlebens unterschiedlicher Religions- und Zivilisationssysteme zu optimistischeren Ergebnissen als das von dem amerikanischen Politologen Samuel Huntington entworfene Szenario eines unausweichlichen Clashs der Zivilisationen, vor allem der islamischen und der (christlich) westlichen. Denn es ist nicht einzusehen, daß die beschriebene Zähmung und rechtliche Einhegung des konfessionellen Fundamentalismus nicht auch als Modell für die gegenwärtigen und zukünftigen Beziehungen zwischen christlicher und islamischer Welt taugen könnten, und zwar innerhalb der europäischen Gesellschaften ebenso wie im globalen Zusammenleben. Texte/vorträge/Leiden 2002