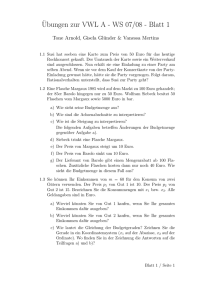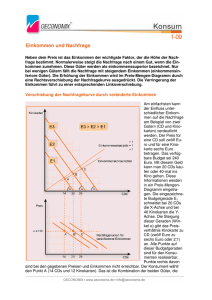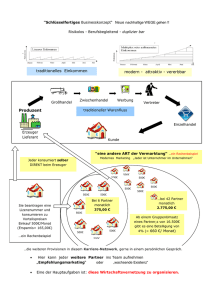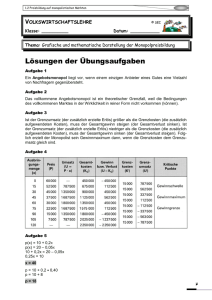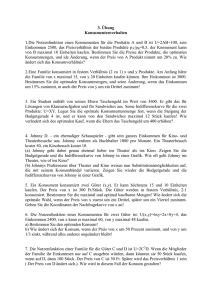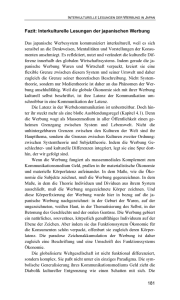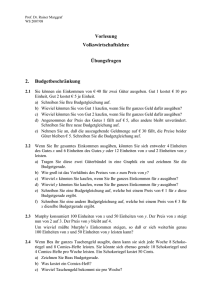1. Einleitung: Was ist Ökonomie?
Werbung

[email protected] www.Economics.Uni-Linz.ac.at Fachhochschul-Studiengang Sozialmanagement, Linz – Wintersemester 2002/2003 Vorlesung "Volkswirtschaftslehre" Inhalt: 1. Einleitung: Was ist Ökonomie? ................................................................................................... 1 1.1. Der zweifache Begriff "Ökonomie"........................................................................................ 1 1.2. Nachdenken über Ökonomie ................................................................................................ 1 1.3. Mikro- und Makroökonomie .................................................................................................. 2 1.4. Werturteile und die Wissenschaftlichkeit ökonomischer Aussagen ....................................... 2 1.5. Die Natur der ökonomischen Theorie ................................................................................... 3 1.6. Aufgaben der ökonomischen Wissenschaft .......................................................................... 5 1.7. Charakteristika der ökonomischen Wissenschaft ................................................................. 5 1.8. Effizienz und der zweifache Begriff "sozial" in der Ökonomie ............................................... 6 1.9. Das Positive an der ökonomischen Effizienz: Opportunitätskosten-Minimum ....................... 7 2. Grundlegende Fragestellungen der Ökonomie als Wissenschaft ................................................ 9 2.1. Ressourcenknappheit und Effizienzprinzip ........................................................................... 9 2.2. Ressourcenauslastung, sozialer Wohlstand und soziale Wohlfahrt ...................................... 9 2.3. Wachstum und Nachhaltigkeit ............................................................................................ 11 2.4. Verteilung: Effizienz versus Gerechtigkeit .......................................................................... 12 2.5. Marktversagen und Wirtschaftspolitik ................................................................................. 13 2.6. Politikversagen und Regelbindung ..................................................................................... 15 3. Die einzelne Unternehmung und der einzelne Markt: Angebot und Nachfrage .......................... 16 3.1. Effizienz und Wohlstand durch Spezialisierung und Arbeitsteilung, Handel und Märkte ..... 16 3.2. Das Angebot auf einem Markt bei vollkommener Konkurrenz ............................................ 18 3.3. Die Nachfrage auf einem Markt bei vollkommener Konkurrenz .......................................... 21 3.4. KonsumentInnen- und ProduzentInnenrente ...................................................................... 22 3.5. Marktformen und (materielle) Wohlfahrt ............................................................................. 23 3.6. Zwei Sichtweisen des Arbeitsmarktes: Lohnhöhe und Beschäftigung ................................ 24 4. Die Gesamtwirtschaft: Konjunktur, Wachstum, Wirtschaftspolitik .............................................. 27 4.1. Gütermarkt: Auslastung von Produktionsanlagen und Arbeitskräften ................................. 27 4.2. Ein kurzer Blick auf das Wachstum .................................................................................... 33 4.3. Staat und Wirtschaft (Anschauungen über Wirtschaftspolitik)............................................. 34 5. Schlussbemerkung ................................................................................................................... 37 1. Einleitung: Was ist Ökonomie? 1.1. Der zweifache Begriff "Ökonomie" Ökonomie heißt sparsame Lebensführung, ist gleichsam die "art and science" (Wissenschaft und Kunst) des Haushaltens. Das Wort Ökonomie verwenden wir begrifflich sowohl für (a) die Theorie der Wirtschaft (Volkswirtschaftslehre) als auch für (b) die Praxis der Wirtschaft (ein konkretes Wirtschaftssystem). (a) Im theoretischen Fall ist Ökonomie ein so genannter Idealtypus, das Bild von der Wirtschaft, wie wir es uns in unserer Ideenwelt vorstellen (obwohl er Idealtypus heißt, muss er unseren Idealvorstellungen nicht unbedingt entsprechen, da die Bezeichnung von Idee kommt, nicht von Ideal). (b) Im praktischen Fall ist Ökonomie (eine Volkswirtschaft) ein so genannter Realtypus. Den Realtypus der Wirtschaft können wir wegen seiner großen Komplexität (Größe und Unüberschaubarkeit, Vielschichtigkeit und Undurchsichtigkeit) gar nicht zur Gänze erfassen und "begreifen". Das bedingt, dass wir – sobald wir von Wirtschaft sprechen oder nur an Wirtschaft denken – einen Idealtypus vor Augen haben. Dabei hat jeder den seinigen, jede den ihrigen, je nachdem, wie ich uns in meiner Vorstellungswelt (in meinen Ideen) ein Modell (ein verkleinertes, vereinfachtes Abbild von der Realität) machen und was dabei herauskommt. 1.2. Nachdenken über Ökonomie Sobald ich mir (bewusst oder unbewusst, laienhaft oder professionell) eine Modellvorstellung von Wirtschaft mache, bilde ich eine Theorie. Denn wenn ich über Wirtschaft nachdenke, muss ich selektieren, was für mich wichtig und somit gedanklich zu modellieren ist, um das Wesentliche an der Wirtschaft oder einem Teilaspekt von ihr zu erfassen. Und das Wesentliche betrifft wohl das Funktionieren der Wirtschaft. Also habe ich bereits eine erste Erklärung der Wirtschaft im Kopf. Modellbau (Theoriebildung) bedeutet also Vereinfachung der Wirklichkeit, Absehen (Abstraktion) von der Realität. Jede Theoriebildung ist daher mit Detailverlusten an Information verbunden, aber wir gewinnen dadurch erst sinnvolle, verwertbare Information (ansonsten "sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht"). Daher kann auch keine Theorie der Welt alles gleichzeitig erklären, sonst wäre sie ja keine Theorie über die Realität, sondern ein (unmögliches) Erfassen der Realität (ein Modell im Maßstab 1:1 ist eben kein Modell, sondern das Original). 1 Wir sind BeobachterInnen, die – jeder auf seiner und jede auf ihrer eigenen – Warte sitzen, keine Details der Topografie, Straßen und Ortschafen mehr sehen, aber die Übersicht haben, um nicht die Orientierung zu verlieren und den Verkehr im Groben überblicken zu können. (a) Je niedriger meine Warte ist, desto mehr bin ich (wegen der kleinen Sichtweite und des geringen Überblicks) auf die kleine, ausschnittartige Einzelbeobachtung beschränkt (einzelwirtschaftliche Analyse): Mikroökonomie. (b) Je höher ich mir meine Warte baue, umso weniger kann ich Details und umso besser kann ich Gesamtkonturen erkennen (gesamtwirtschaftliche, aggregierte Analyse): Makroökonomie. 1.3. Mikro- und Makroökonomie Mikroökonomie und Makroökonomie sind Teilbereiche der Volkswirtschaftslehre. Sie unterscheiden sich eben nach dem Ansatzpunkt ("klein- oder großräumig") und somit auch der Methodik (Einzel- oder Aggregatbetrachtung) der Analyse. (a) Die Mikroökonomie untersucht das Verhalten einer Unternehmung (Produktion, Arbeitsnachfrage, Investition), das Verhalten eines Haushalts (Arbeitsangebot, Konsum, Ersparnis) und das Funktionieren des Marktes für ein Gut (das als Input in die Produktion eingeht oder als Output aus der Produktion hervorgeht). (b) Die Makroökonomie analysiert Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage, Produktion und Investition, Konsum und Ersparnis etc. auf jeweils einer aggregierten Ebene: Stadt, Region, Bundesland, Nationalstaat, Wirtschaftsorganisation (EG, NAFTA, APEC), supranationale Organisation (EU), Wirtschaftsraum ("Tigerstaaten" Ostasiens, Gemeinsamer Markt: EU und Assoziierte), Kontinent, Globus oder – allgemein gesprochen - Gesamtwirtschaft. 1.4. Werturteile und die Wissenschaftlichkeit ökonomischer Aussagen Jeder Beobachter, jede Analytikerin wählt jene Warte (jenen Modellbau, jenen Theorieansatz), von der er oder sie sich nach seinem oder ihrem "sechsten Sinn", nach seiner oder ihrer Weltanschauung am meisten für seine oder ihre Analyse und schließlich von seiner oder ihrer Analyse erwartet (Erkenntnisgewinn, Prestigegewinn, Einkommensgewinn, ...). Werturteile sind aber nicht alle gleich. Wir unterscheiden daher folgende Werturteile: (a) rein subjektive, irrationale (sie beruhen auf bloßem Meinen und Glauben), (b) ontologische, seinsbezogene (je nachdem, wie ich das Sein, das Funktionieren der Wirtschaft durch meine Beobachtungen interpretiere), (c) teleologische, zielbezogene (sie machen die subjektive Färbung bei der Bewertung von Zielsetzungen und von Maßnahmen zu deren Erreichung aus) und (d) ideologische (sie stellen einen Glauben an eine gesellschaftliche und politische "Philosophie" dar). 2 Irrationale Werturteile dürfen in wissenschaftlichen Aussagen keinesfalls vorkommen, ideologische Wertungen sollten ebenfalls draußen bleiben, während ontologische und teleologische Werturteile in einer Sozialwissenschaft (wie der Wirtschaftswissenschaft) offengelegt und deutlich gemacht werden sollen. Jeder die soziale und wirtschaftliche Realität analysierende Mensch darf sich seine oder ihre eigene Warte bauen und kann sie verwenden, solange (a) die Statik des Baus als hinreichend tragfähig erachtet wird und (b) die Warte an einen Ort und in einer Höhe gebaut wurde, dass man von ihr aus überhaupt mehr erkennen kann als ohne Warte auch. (a) Wenn ein logischer Konstruktionsfehler in der Warte (bzw. in der Theorie) ist, bricht sie physisch (bzw. wissenschaftlich) zusammen. (b) Wenn die Warte nur nichts gut ist, weil sie völlig unzweckmäßig hingebaut wurde (z.B. in die Erde hinein statt über Grund hinauf oder in einer engen und tiefen, leeren und bedeutungslosen Mulde) bzw. wenn die Theorie nur für eine Leeraussage gut ist, die ohnehin nicht falsch sein und daher nicht widerlegt werden kann, so brauche ich dazu die Warte (Theorie) nicht, denn sie leistet nichts: Die Theorie ist inhaltsleer, ist ohne empirischen Gehalt, ist eine Tautologie, ein Truismus (z.B. durch die Hochwasserkatastrophe wird die Wirtschaft angekurbelt oder sie wird geschwächt oder sie wird davon nicht betroffen). Fazit: Eine sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Theorie genügt den Anforderungen der Wissenschaftlichkeit (gemäß dem kritischen Rationalismus von Karl Popper), wenn sie (a) nicht in sich logisch widersprüchlich formuliert ist und (b) keine Leeraussage ist (nicht empirisch gehaltlos ist: nicht unüberprüfbar durch praktische Beobachtung ist). 1.5. Die Natur der ökonomischen Theorie Jeder und jedem seine eigene Warte: Das ist so wegen der individuellen Gedankenarbeit bei der Analyse der komplexen Realität. Daher sagen wir oft ausdrücklich: "Also, von meiner Warte aus gesehen, verhält es sich folgendermaßen ...". Wir machen also stets nur eine bedingte Aussage, eine Aussage unter den Voraussetzungen (Annahmen, Bedingungen, Prämissen) unserer Theorie über die Realität. Eine Theorie ist also eine Wenn-dann-Aussage: Sie erklärt eine Kausalität (einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang): Wenn die Annahmen gelten (die ich in meinem Modell zur Vereinfachung der Realität getroffen habe), dann ist daraus abzuleiten ... (z.B. je höher das Einkommen, desto höher die Konsumausgaben). So gesehen ist es verständlich, dass es unzählig viele Theorien gibt: Der Ideen- und Theorienpluralismus ist typisch.1 Einige dieser Theorien sind uns vielleicht (aus welchen Gründen auch immer) 1 "In fact, the existence of a multitude of paradigms in the social sciences is not necessarily a weakness but only an expression of the complexity of the subject which requires varying special assumptions and perspectives depending on the main questions asked and the contexts in which they are analysed." Kurt W. Rothschild, 1999. 3 unsympathisch. Aber wir können nicht sagen, dass sie falsch sind, außer wir weisen ihnen einen logischen Denkfehler nach. Und wir können sie nicht als unnütz bezeichnen, denn sie können legitimer Weise – d.h., wenn sie empirisch überprüfbar sind – über all die anderen Theorien hinaus gehend einen kleinen Teilbereich und Teilaspekt der Realität erklären. Also solche sind jegliche Theorien generell nützlich, aber halt, je nach Ort und Zeit, einmal mehr oder weniger oder gar nicht hilfreich bei der Erklärung von Problemursachen und – auf dieser Basis – bei der Hintanhaltung von Problementstehungen.2 Hält eine Theorie dem empirischen Test nicht stand (d.h., ist ihre Aussage mit den empirischen Beobachtungen in der Realität nicht vereinbar), dann ist die Theorie zwar "falsifiziert", aber deshalb ist sie nicht falsch. Denn zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort könnte eine Theorie ihrer Überprüfung an der Realität standhalten und für die praktische Anwendung ausgewählt werden.3 In Folge dessen gibt es auch keinen Beweis für eine Theorie. Das ist einleuchtend, wenn wir bedenken, dass eine Theorie (auf Grund ihrer vereinfachenden Annahmen notwendiger Weise) gleichsam eine Laborsituation darstellt, wo ein Experiment (der Schluss aus dem Modell heraus) unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wird, um exakte (objektiv richtige, wahre) Aussagen zu erhalten. Doch in der wirtschaftlichen und sozialen Realität lassen sich diese Laborbedingungen, die wir im Kopf, auf dem Papier und im Computer haben), nicht herstellen, lassen sich die zahllosen Wirkungseinflüsse auf das Wirtschaftsgeschehen nicht experimentell kontrollieren. Wiederum scheitern wir also am essenziellen Unterschied zwischen Wirklichkeit (Original) und Konstrukt (Abbild).4 Der Mensch ist nun einmal kein Uhrwerk, das im Modell exakt nachgebaut werden kann (sondern er oder sie ist manchmal spontan oder gar irrational); Zufall und historische Einmaligkeit können die Dynamik der Wirtschaftsentwicklung und ihrer gesellschaftlichen und natürlichen Rahmenbedingungen entscheidend beeinflussen (am ehesten noch modelliert durch die "Chaostheorie" und die "Evolutorische Ökonomie"). 2 Beispielsweise erwies sich zur Zeit der Weltwirtschaftskrise (ab 1929) die damals gängige Wirtschaftstheorie – eine mikroökonomisch ausgerichtete Theorie – als wenig geeignet für die Bekämpfung der – typisch makroökonomischen – Probleme dieser Krise. 3 "Because of its nature, economic theory cannot ever be taken as complete or ‘true’. The only meaningful evaluation of it turns on its being ‘not false’ and on its being useful in supporting and directing research and policy endeavors." Richard X. Chase, 1979. 4 "In economics and in the social sciences generally, the complexity and the historically changing character of the subject, connected with the involvement of variable human influences, make it impossible (a) to find eternally valid 'laws' and regularities, and (b) - more importantly - to carry out sufficient experiments, let alone controlled experiments. The stochastic and dynamic aspects of the subject permit only probabilistic statements with considerable uncertainty attached to them. 'Verification' and 'falsification' cease to be a clear-cut dichotomy and become fuzzy terms when it comes to an interpretation of hypotheses in the light of empirical material. Historical experience, plausibility and not least statistical conventions influence the question whether a given economist or the scientific community as a whole regard certain theoretical statements or structures (paradigms) still as tenable or not, in spite of the fact that they are sometimes 'falsified'. ... Popper's simple and clear-cut prescription is ill-suited as a guidance for social science research ..." Kurt W. Rothschild, 1999. 4 1.6. Aufgaben der ökonomischen Wissenschaft Nun kommen wir zu den Funktionen, welche die Ökonomie als Wissenschaft erfüllen soll: (a) Die Ökonomie schafft einen System von Definitionen: Bezeichnungen werden mit (abgegrenzten, definierten) Inhalten besetzt. Ansonsten würden die ÖkonomInnen weltweit einander nicht verstehen, sondern wirkungslos und sinnlos aneinander vorbeireden (z.B. wenn der eine unter Bruttoinlandsprodukt etwas Anderes versteht als die andere). (b) Die Ökonomie bietet Erklärungen für wirtschaftliche Phänomene an. Ohne Erklärungen von Ursache-Wirkungs-Beziehungen können auch keine Prognosen getroffen werden. Die Erklärung von Kausalbeziehungen fällt in den Bereich der reinen (positiven) Theorie: Es wird gesagt, was ist (wie etwas funktioniert oder nicht funktioniert). Dabei enthält man sich jeder Wertung des Erklärten. Wir wissen aber schon auf Grund der Eigentümlichkeit der Theoriebildung, dass dieser Vorgang sehr persönlich und somit auch subjektiv gefärbt ist, und so bekennen wir, dass selbst die reine (positive) Theorie nicht frei sein kann von Werturteilen (was wichtig und entscheidend ist). Ohne Erklärung eines Problems gibt es keine systematische, sinnvolle Empfehlungen für Problemlösungen, höchstens unwirksame Symptomkuren. Ohne Kenntnis der Voraussetzungen für ein klagloses Funktionieren eines idealtypischen Wirtschaftssystems gibt es keine systematischen, wirksamen Empfehlungen für die Verbesserung des Realtypus. (c) Die Ökonomie gibt Empfehlungen für die wirtschaftspolitische Ausgestaltung und Lenkung des Wirtschaftssystems. Diesen Bereich nennt man normative Ökonomie: Sie umfasst Aussagen über Sein-Sollen, es wird normiert (festgelegt), was besser, schlechter und somit am besten ist. Welche Kombination von Zielsetzungen ist optimal? (Das muss ich sagen, wenn nicht alle Ziele zugleich erfüllt werden können, d.h. wenn Zielkonflikte bestehen.) Mit welcher Maßnahme oder Maßnahmenkombination ist eine gegebene Zielkombination am besten zu erreichen. Es geht also um wirtschaftspolitische Empfehlungen, um zu verwirklichende Optima im Zielsetzungs- und im Maßnahmenbereich, auf mikro- und auf makroökonomischer Ebene. Die wirtschaftspolitischen Entscheidungen müssen von den demokratisch gewählten politischen MandatarInnen (von der Parlamentsmehrheit) getroffen werden. ÖkonomInnen, die keine PolitikerInnen sind, beschränken sich daher auf wirtschaftspolitische Beratung. 1.7. Charakteristika der ökonomischen Wissenschaft Zusammenfassend können wir feststellen: Die Ökonomie ist als Wissenschaft wie folgt zu charakterisieren: 5 Ökonomie ist eine Realwissenschaft: Ihr Zweck ist die Erklärung der Realität. Ökonomie ist eine Sozialwissenschaft: Personen wirtschaften (sie treffen wirtschaftlich relevante Entscheidungen), die Wirtschaft ist somit ein Teilbereich unseres Gesellschaftlichen Lebens. Ökonomie ist eine empirische Wissenschaft (Erfahrungswissenschaft): wir beurteilen die Anwendbarkeit einer Theorie auf eine konkrete Fragestellung, indem wir dabei die Daten der Realität heranziehen (wir schauen uns die Realität an, so gut es eben geht). Ökonomie ist eine keine wertfreie, sondern eine normative Wissenschaft: Sie trifft Aussagen über die Qualität (Suboptimalität – Optimalität) von Zuständen (Zielkombinationen) und von Mitteln zur optimalen Erreichung der gewählten Zielkombinationen. Ökonomie ist eine politische Wissenschaft: Ihre Ergebnisse sind für die Wirtschaftspolitik relevant, sie dienen der wissenschaftlichen Fundierung der praktischen Wirtschaftspolitik (oder sollen es zumindest tun). 1.8. Effizienz und der zweifache Begriff "sozial" in der Ökonomie Von Optimalität ist die Rede. Allein das Wort Idealtypus suggeriert schon Optimalität (muss aber, wie schon erwähnt, nicht unbedingt Optimalität bedeuten). Aber was ist das für eine Optimalität, für welche die ökonomische Wissenschaft die Voraussetzungen aufzeigt und den Weg zu deren Realisierung weist (oder sich bemüht oder glaubt, es tun zu können)? Vom Standpunkt der Ethik und praktischen Sittlichkeit aus dürfen ökonomische Überlegungen nicht unbedingt gesehen werden. Das ökonomische Prinzip besagt lediglich, dass (a) ein vorgegebenes Ziel (egal welches, selbst wenn es die Ermordung einer unliebsamen Person sein sollte) mit dem geringsten Aufwand erreicht werden soll bzw. (b) mit den gegebenen Mitteln ein Maximum an Erfolg erzielt werden soll (wie auch immer dieser Erfolg umrissen sein mag: selbst die Maximierung des Gewinns unter Inkaufnahme von Sklaverei). Dieses ökonomische Prinzip (der Grundsatz wirtschaftlicher, nicht sittlicher Rationalität) hat nur eines zum Ziel: Effizienz. Sie kann, wie eben gesagt, alternativ auf beiderlei Fragestellungen angewandt werden: (a) als Input-Effizienz und (b) als Output-Effizienz. Der ökonomische Effizienzbegriff wird auch mit dem Ausdruck Pareto-Effizienz erfasst (benannt nach dem italienischen Soziologen und Ökonomen Vilfredo Pareto). Pareto-Effizienz ist dann gegeben, wenn keine Person besser gestellt werden kann, ohne dass dadurch eine andere Person schlechter gestellt wird. Insofern ist der Zustand Pareto-optimal. Pareto-Effizienz bringt somit – neben ihrer positiven Eigenschaft, das Effizienzmaximum zu charakterisieren – folgende Unzulänglichkeiten mit sich : 6 (a) Es wird keine Aussage darüber getroffen, von welcher Anfangsausstattung (Verteilung von Vermögen – Arbeit, Boden, Kapital – und folglich Einkommen) am besten ausgegangen wird, bis sich durch freiwillige Tauschaktionen auf den Märkten ein Pareto-Optimum ergibt. (b) Es wird daher auch keine Aussage über die Umverteilung getroffen, zumal Umverteilung doch dadurch charakterisiert ist, dass jemand schlechter gestellt wird, um damit jemand anderen besser zu stellen. Weil wirtschaftspolitische Maßnahmen realistischer Weise mit Umverteilung verbunden sind, hat man als Alternative zum Kriterium der Pareto-Effizienz das so genannte Hicks/Kaldor-Kriterium eingeführt, das besagt, dass Optimalität gegeben ist, wenn jene, die durch eine Umverteilungsmaßnahme bessergestellt werden, einen so großen Nutzenzuwachs erhalten, dass sie die durch diese Maßnahme schlechter Gestellten entschädigen können müssten und sie dann immer noch aus der Umverteilungsmaßnahme (netto) bessergestellt hervorgehen. Mit Sozialem oder Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit im landläufigen Sinn hat ökonomische Effizienz nichts zu tun – außer von (isoliert betrachteter) Leistungsgerechtigkeit: je effizienter das Verhalten, desto lohnender das Ergebnis und desto besser das Gesamtergebnis (allerdings mit der entsprechenden Verteilung). Wenn ÖkonomInnen von sozialer Effizienz sprechen, so meinen sie (meist) damit Effizienz auf gesellschaftlicher (= sozialer) Ebene. Wir werden erst später auf den Unterschied zwischen ökonomischer Effizienz (auf einzelwirtschaftlicher Ebene) und so genannter allokativer Effizienz (Effizienz auf sozialer, gesellschaftlicher Ebene) eingehen. 1.9. Das Positive an der ökonomischen Effizienz: Opportunitätskosten-Minimum Maximum an ökonomischer Effizienz bedeutet, dass jene Alternative gewählt wurde, welche mir – insgesamt und netto: Vor- und Nachteile zusammen gerechnet – den größten Vorteil bringt oder, anders formuliert, geringsten Nachteil daraus erbringt, dass ich keine andere Alternative gewählt habe. Wir können das kurz und bündig auch so ausdrücken: Die Opportunitätskosten (Alternativkosten) sind minimal. Opportunitätskosten (Alternativkosten) sind nichts Anderes als der quantifizierte (exakt messbar ausgedrückte) Nachteil, der entsteht, wenn ich eine günstige Gelegenheit (eine Opportunität) auslasse, also diese Alternative nicht realisiere, sondern eine andere. So sind z.B. die Opportunitätskosten Ihrer Ausbildung hier der Verdienstentgang in den Unterrichts- und Lernstunden bzw. der Nutzenentgang durch Opferung von Freizeitstunden, zweckmäßiger Weise bewertet wiederum mit dem Stundenlohn (Lohnsatz), der Ihnen pro Unterrichts- und Lernstunde entgeht (entgangene Opportunität durch Wahl der Alternative Fachhochschul-Studium). Ökonomisch effizient ist ihre Entscheidung zu studieren dann, 7 wenn Ihr Studium die Alternative mit den größten Wohlfahrt (positive Nutzen plus negative Nutzen, einheitlich bewertet und subtrahiert) für Sie darstellt (Wohlfahrtsmaximum = NettoNutzenmaximum) bzw. – umgekehrt formuliert – wenn Ihr Studium Ihnen den geringsten Wohlfahrtsverlust (negative Nutzen plus positive Nutzen) daraus erbringt, dass Sie die anderen Alternativen nicht wählen (Freizeit mit ihrem direkten Nutzen und/oder Arbeitszeit mit ihrem indirekten Nutzen via Einkommenserzielung und Nutzenerzielung durch Konsum). Auf sozialer (gesellschaftlicher Ebene) ist die Situation schwieriger. Denn Sie als Individuum können relativ leicht beurteilen, was ihr individuelles Wohlfahrtsmaximum (Maximum Ihrer eigenen aggregierten Nutzen) ist. Aber für ein Kollektiv von Menschen kann das Wohlfahrtsmaximum – das soziale Wohlfahrtsmaximum – nur ermittelt werden, wenn die Nutzen unter den Kollektivmitgliedern hinreichend exakt verglichen werden können. Doch dies scheitert in der Realität an der Unmöglichkeit exakter interpersoneller Nutzenvergleiche, denn es gibt weder einen "wohlwollenden Diktator" noch eine perfekte Sozialplanerin, der oder die alles wissen, können und gesellschaftlich (sozial) optimieren. Darum überlassen ÖkonomInnen die Bewertung sozialer (gesellschaftlicher) Zustände gern dem Marktmechanismus. Er sei nämlich ein unparteiischer, objektiver Bewertungsmechanismus. Denn die Wirtschaftssubjekte werden ein Gut nur dann kaufen, wenn sie den Nutzenzuwachs (den "Grenznutzen"), den sie aus dem Konsum dieses Gutes ziehen, mindestens so groß ist wie der Kaufpreis des nachgefragten Gutes. Die Zahlungsbereitschaft für ein zusätzliches Gut (die marginale Zahlungsbereitschaft) entspricht dem Grenznutzen. Das wird durch den Kaufakt enthüllt. Der vollzogene Kaufakt zeigt uns nämlich, dass die marginale Zahlungsbereitschaft (= der Grenznutzen) mindestens so groß ist wie der (freiwillig!)bezahlte Preis. Wenn nun der Marktmechanismus frei walten kann, so kann sich daraus ein soziales (gesellschaftliches) Wohlfahrtsmaximum (Nutzenmaximum) ergeben, weil ja alle Transaktionen (Geschäfte) freiwillig abgeschlossen werden und jede am Markt teilnehmende Person den Anreiz hat, sich ökonomisch effizient zu verhalten (das ökonomische Prinzip jeweils in seinen beiden alternativen Ausprägungen – Input- und Output-Effizienz –zu befolgen).5 Wir ahnen aber schon, zumal die Verwirklichung des Effizienzprinzips zu Pareto-Optimalität führt, dass dieses soziale (gesellschaftliche) Optimum nach unseren sozialen (ethischen) Vorstellungen nicht optimal sein muss. Das behandeln wir aber später unter der Überschrift "Marktversagen". 5 "Nichts besseres fällt ihm ein, als sich Pomade ins Glanzhaar zu schmieren, dem Hans, Brillantine, das gibt die gefürchtete zusätzliche Polsterwascharbeit für die Mama, fettige Flecke, die sich nur schwer entfernen lassen, mit jedem Makel geht es ähnlich. Aber es geschieht, um sich kraft schöneren Aussehens die Chance auf ein schöneres Leben zu erwirken. Ein möglichst tolles Mädchen, das auch Elvis-Platten sammelt wie er. Man muß etwas investieren, dies ist einer der Hauptsätze der Ökonomie, die Hans alle nicht kennt, weil er glaubt, er macht es nur so zum Spaß." Elfriede Jelinek, 1980, Die Ausgesperrten. Roman. 8 2. Grundlegende Fragestellungen der Ökonomie als Wissenschaft 2.1. Ressourcenknappheit und Effizienzprinzip Ressourcen – all jene Faktoren, die zur Produktion erforderlich sind – sind nur begrenzt vorhanden und daher knapp. Ressourcenknappheit bedeutet, dass Kapital (Natur-, Sach- und Finanzkapital) und Arbeit (Humankapital) jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht in jenen Mengen vorhanden sind, dass diese Produktionsfaktoren nicht mehr am Markt gehandelt werden könnten, weil sie ohnedies unbegrenzt und daher für alle frei und gratis verfügbar sind. Denn was unbegrenzt vorhanden ist, kann nicht gegen einen positiven Preis am Markt verkauft werden; das würde jeder ökonomischen Rationalität widersprechen (das ökonomische Effizienz-/Prinzip verletzen); Sie würden auch nicht jemandem die Atemluft abkaufen, wenn ohnedies alle problemlos und auch kostenlos atmen könnten, oder? Andererseits sind die Bedürfnisse (Wunschträume) eines Menschen schier unbegrenzt, und schon gar trifft die Unbegrenztheit der Bedürfnisse für die gesamte Menschheit zu – auf jeden Fall, wenn die künftigen Generationen mit berücksichtigt werden. Zumindest können wir angesichts der begrenzten Ressourcen – und somit der begrenzten Produktionsmöglichkeiten – nicht allen Menschen ihre Bedürfnisse erfüllen. Bedarfsdeckung (das ist die Erfüllung der Bedürfnisse) wird durch die Ressourcenknappheit eingeschränkt und macht nur einen Teil der menschlichen Bedürfnisse aus. Sollen die Bedarfsdeckung und – was das selbe ist: der Wohlstand – größtmöglich sein (und das ist offenbar wünschbar und erwünscht), dann müssen wir jede vorhandene Ressource so produktiv wie möglich einsetzen (das Maximum aus ihr "herausholen" = die Opportunitätskosten des Ressourceneinsatzes minimieren). Ein perfekter (effizienter) Markt führt zu einem Produktivitätsmaximum (Pareto-Effizienz) und folglich auch zu einem Wohlstandsmaximum in der Gesellschaft (soziales Wohlstandsmaximum). Daher dürfen in keiner Zeitstrecke Ressourcen verschwendet werden (d.h. ungenützt bleiben), denn sonst wären die Produktionsmenge und das dabei entstehende Einkommen (die Leistungen der Produktionsfaktoren werden ja entgolten, Faktor- und Leistungseinkommen entsteht) unnötig und unsinnig gering, eben ineffizient: Der aktuelle Output (die aktuelle Produktion) bzw. das aktuelle Einkommen läge unter seinem potenziellen (maximal möglichen Niveau), eine Output-, Einkommens- bzw. Wohlstandslücke klaffte auf. 2.2. Ressourcenauslastung, sozialer Wohlstand und soziale Wohlfahrt Durch maximale Produktivität beim Ressourceneinsatz (effizienter Ressourceneinsatz heißt Vermeidung von Ressourcenverschwendung!) und Einsatz aller verfügbaren Ressourcen (Vollauslastung der Ressourcen) werden also Produktion und Einkommen (beides bedeutet Wohlstand) maximiert. Wenn diese Bedingungen für alle Unternehmen und Märkte erfüllt sind, so muss sich daraus ein soziales (gesellschaftliches) Wohlstandsmaximum ergeben. Dies schwebt den VertreterIn- 9 nen des ökonomischen Liberalismus vor. Doch die Gesamtgröße sozialer Wohlstand sagt noch nicht alles über die Verteilung des Wohlstands und somit noch nicht alles über das Wohlbefinden aller Mitglieder der Gesellschaft zusammen aus. Und zwar sind auf der anderen Seite die Erzielung von Einkommen und der Konsum von Gütern nicht alles, was Lebensqualität im umfassenden Sinn ausmacht: Wohlfahrt ist der weitere Begriff, er umfasst sowohl materielle Wohlfahrt (= Wohlstand) als auch immaterielle (kaum in Zahlen anzugebende) Wohlfahrt. Qualitative Komponenten der Wohlfahrt sind beispielsweise eine solidarische, möglichst gerechte Verteilung von Vermögen (Human-, Natur-, Sach-, Finanzkapital). Eine eher ausgewogene Verteilung von menschlichen Fähigkeiten (Bildung!) und Vermögensbesitz schafft nämlich auch eine eher ausgeglichene Einkommensverteilung und damit eine breitere soziale Sicherheit. Das besondere am immateriellen Teil der sozialen Wohlfahrt ist, dass es sich dabei überwiegend um Verteilungsgesichtspunkte handelt. Bei der Erhaltung und Verteilung der Umweltqualität und des Naturkapital sowie bei einer sozial (gesellschaftlich) akzeptablen Verteilung von Beschäftigung, Einkommen und Vermögen sprechen wir – im Unterschied zu den privaten Gütern, wie sie auf Märkten gehandelt werden – von so genannten öffentlichen Gütern (Gemeinschaftsgütern, Kollektivgütern, Gemeinschaftsinteressen). Daher erfassen statistische Ämter (z.B. die Statistik Österreich und Eurostat) die qualitativen Faktoren der sozialen Wohlfahrt mit einer Liste so genannter sozialer Indikatoren (Erziehungs- und Bildungsniveau, Arbeitsplatzqualität und -sicherheit, Wohn- und Siedlungsgüte, Umweltentwicklungen usw.). Das typische für öffentliche Güter ist, dass sie sich auf Märkten, die nach dem Konkurrenzprinzip statt nach dem Solidarprinzip organisiert sind und funktionieren, systematisch nicht oder zu wenig ergeben. Ausgewogene Verteilungen beruhen nämlich auf solidarischen, sozial (gesellschaftlich) orientierten Entscheidungen, und diese widersprechen eben den wettbewerbsmäßigen, individuell ausgerichteten Entscheidungen der Unternehmen (die ihren eigenen Gewinn maximieren) und der Haushalte (die ihren persönlichen Nutzen maximieren). Verteilungsgerechtigkeit kann auf Märkten nicht gehandelt werden; sie betrifft alle, kann daher auch nicht an einzelne verkauft werden. Manche Güter, wie der Bestand an Naturressourcen und die weltweite Umweltqualität, werden globale öffentliche Güter genannt. Weniger an Quantitativem kann manchmal mehr an Qualitativem und insgesamt daher mehr Lebensqualität sein (z.B. weniger Verkehr und Einkommen, aber mehr Umweltqualität und Daseinszufriedenheit – unter der Bedingung, dass die Einkommensverhältnisse nicht zu ungleich sind, denn sonst leiden die Armen netto unter der Umweltverbesserung, weil sie mehr Wohlstand verlieren als Umweltqualität bekommen, so dass das Hicks/KaldorKriterium für soziale Effizienz nicht erfüllt sein muss). Eine paradoxe Situation entsteht dann, wenn – trotz grundsätzlicher Ressourcenknappheit – einige Ressourcen über längere Zeit hinweg oder gar ständig ungenützt bleiben. Das schlagendste Beispiel ist Arbeitslosigkeit. Arbeitskraft (Humankapital) ist verfügbar und will eingesetzt werden, um Einkommen zu erwirtschaften, wird aber nicht verwendet und bleibt daher nutzlos vergeudet. Es ist leicht einzusehen, dass Vollbeschäftigung im Besonderen (Ressourcenauslastung im Allgemeinen) ein öffentliches Gut darstellt, das die Märkte nicht sozial effizient bereitstellen. 10 2.3. Wachstum und Nachhaltigkeit Selbst wenn der Staat bereits wirtschaftspolitisch dafür sorgt, dass keine Produktions-, Beschäftigungs-, Einkommens- und somit kein Wohlstandslücke aufklafft, sondern das aktuelle dem potenziellen Wohlstandsniveau entspricht, kann das erreichte Wohlstandsmaximum erhöht werden. Der Schlüssel dafür ist die Erhöhung der Produktivität im Einsatz der Ressourcen für die Produktion. Das geschieht durch technisch-organisatorischen Fortschritt. Gleichwohl muss dadurch das soziale Wohlfahrtsmaximum (im Vergleich zum sozialen Wohlstandsmaximum) nicht gesteigert werden. Technisch-organisatorischer Fortschritt kann zwar Arbeit sparend sein (die verfügbare Arbeit kann, weil produktiver eingesetzt, auch für zusätzliche Produktionen eingesetzt werden), aber dieser Fortschritt muss nicht natürliche Ressourcen sparend sein. Es kann demnach zu sozial ineffizient hohem Ressourcenverbrauch kommen. Im Bereich nachwachsender, reproduzierbarer Ressourcen (z.B. Bioenergieträger, Fischbestände u.dgl.) darf die kritische Verbrauchsschwelle nicht überschritten werden, ab der sich der verbliebene Ressourcenbestand nicht mehr rasch und stark genug reproduzieren kann, um nicht unreproduzierbar zu werden. Es darf also keine Übererntung (wie der Fachausdruck heißt) eintreten. Bei nicht reproduzierbaren, nicht nachwachsenden, also absolut knappen Ressourcen muss der durch den steigenden Verbrauch unumkehrbar steigende Knappheitsgrad sich im Marktpreis solcher Ressourcen ausdrücken. Und zwar muss der Marktpreis so stark steigen, dass dadurch einerseits der Verbrauch so weit reduziert (verlangsamt) und die Forschung und Entwicklung alternativer, reproduzierbarer Ressourcen (Plastik substituiert Holz, Wind ersetzt Kohle etc.) so stark beschleunigt wird, dass die neue, substitutive Ressource ausreichend zur Verfügung steht, wenn der Bestand der bisherigen Ressource erschöpft ist. Allerdings kann gezeigt werden, dass Situationen eintreten können, wo der Markt die ökologische Nachhaltigkeit (keine Übererntung, kein vorzeitiger Verbrauch!) einer wachsenden und immer mehr Ressourcen verbrauchenden Wirtschaft nicht garantieren können muss. Ökonomisch effiziente Märkte, auf denen die Unternehmen ihre Produktivität und ihren Gewinn maximieren wollen, müssen nicht unbedingt eine allokativ effiziente Lösung (optimale Produktions- und Umweltlösung auf sozialer Ebene) herbeiführen können. Daher gibt es hier einen Anlass für den Staat, umweltpolitisch einzugreifen. Ebenso muss ein maximales Wachstum (eine maximale Wohlstandsentwicklung) nicht sozial optimal (nicht allokativ effizient) sein. Daher ist man vielfach von quantitativen zu qualitativen Wachstumszielsetzungen übergegangen. Ein qualitatives Wachstumsziel berücksichtigt auch die Zusammensetzung des wachsenden Output im Hinblick auf seinen Ressourcenverbrauch und somit letztlich auf seine ökologische Nachhaltigkeit. 11 2.4. Verteilung: Effizienz versus Gerechtigkeit Neben der ökologischen Nachhaltigkeit ist zunehmend auch von der ökonomischen oder sozialen Nachhaltigkeit die Rede. Selbst wenn die ökologische Nachhaltigkeit gewährleistet wäre, könnte langfristig ein Wachstumshindernis auftreten, indem die ungleichen Verteilungsverhältnisse im Einkommens- und Vermögensbereich als Wachstumshemmnis zu wirken beginnen. Der materielle Anreiz für das Individuum, persönliches Einkommen zu erzielen und Vermögen zu bilden, wird als Schlüsselfaktor für die Erreichung ökonomischer (nicht allokativer!) Effizienz und somit auch für Produktivitätssteigerungen, Wachstum und Wohlstandsentwicklung angesehen. Zumindest gilt das in marktwirtschaftlichen Systemen. In planwirtschaftlichen Systemen (Zentralverwaltungswirtschaften) fehlte dieser materielle Anreiz zu ökonomisch effizientem Individualverhalten weitgehend. Andererseits waren Beschäftigung, Einkommen und Vermögen etwas gleicher verteilt als in Marktwirtschaften. Aus diesen Überlegungen wird von vielen geschlossen, dass Umverteilung in Richtung einer ausgewogeneren Verteilung von Einkommen und Vermögen leistungsfeindlich und daher schädlich für die ökonomische Effizienz und das Wirtschaftswachstum sei. Nivellierende (tendenziell gleichmachende) Umverteilung wird demnach als anreizinkompatibel bezeichnet (d.h., als unvereinbar mit Anreizen, die ökonomisch effizientes Individualverhalten fördern). Anders formuliert könnte man sagen, es mag einen Interessen- und Zielkonflikt zwischen Verteilungsgerechtigkeit und ökonomischer Effizienz (in statischer Sicht: Produktivität – in dynamischer Sicht: technischem Fortschritt) geben. John Rawls wies in seiner Theorie der Gerechtigkeit (A Theory of Justice, 1971) darauf hin, dass sich Menschen in Umverteilungsfragen strategisch verhalten, d.h., sie denken bei Umverteilungsentscheidungen (Wahlen, Volksabstimmungen etc.) letztlich daran, wie gut oder schlecht sie selbst aus der Umverteilung aussteigen werden, statt eine möglichst gerechte Verteilung als öffentliches Gut zu sehen, das politisch bereitgestellt werden muss und seine Grundlegung daher in kollektiven, demokratischen, sozial (statt individuell) orientierten Entscheidungen haben muss. Rawls bediente sich der Fiktion, alle Menschen wären in einem Urzustand ("original state"), in dem sie sich unter einem Schleier der Unwissenheit ("veil of ignorance") befänden und ihre spätere Einkommensposition in der Gesellschaft noch nicht kennten. In einer solchen Situation könnten sie sich auch nicht strategisch verhalten (weil sie noch nicht wüssten, ob sie einst reich oder arm sein würden). In der Theorie durchgedacht würde sich aus dem Rawls'schen Konzept eine Gleichverteilung der Einkommen ergeben. In der Praxis kann man das Prinzip daraus ableiten, dass jene wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu treffen sind, die den jeweils am schlechtesten Gestellten am meisten nützen würden (Minimax-Prinzip: Die durch ein minimales Ergebnis so schlecht gestellte Person sollte durch die Wirtschaftspolitik im Vergleich zu den anderen maximal profitieren). 12 Aus ökonomischer Sicht kann extreme Ungleichverteilung auch als Wachstumsbremse gesehen werden. Karl Marx (19. Jh.) und Michal Kalecki (20.Jh.) wiesen darauf hin, dass die BezieherInnen niedriger Einkommen einen viel größeren Anteil ihres Einkommen für Konsumgüter verausgaben würden als Haushalte mit hohen Einkommen. Dadurch reduziert eine steigende Ungleichheit im Wohlstand die Nachfrage und die Produktion und somit die Entwicklung des aktuellen und potenziellen Einkommens (das Wachstum der Wirtschaft). Zur Umverteilung ist anzumerken, dass – im Unterschied zur Propagierung der "flat tax", einem einheitlichen Steuersatz für alle SteuerträgerInnen – die progressive Einkommensteuer (d.h., mit zunehmendem Einkommen steigt der Einkommensteuersatz) von der Ökonomie als gerecht angesehen wird, und zwar als gerecht gemäß der jeweiligen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (und daher auch der Fähigkeit, mit Steuern zur Finanzierung von Gemeinschaftsgütern beizutragen). Heinrich Gossen stellte die Theorie vom abnehmenden Nutzen einer zusätzliche Einheit eines Gutes bzw. eines Einkommens ("Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen") auf: Jede zusätzliche Einheit Einkommens (bzw. der zusätzliche Güterkauf damit) bringt zwar einen positiven, aber immer kleineren Grenznutzen (zusätzlichen Nutzen). Wenn alle SteuerzahlerInnen durch ihre jeweilige Steuerleistung den gleichen Nutzenverlust erleiden sollen, dann müssten sie demnach für ein höheres Einkommen einen höheren Prozentsatz an Steuern zahlen als für ein niedrigeres. Sogar in den USA diskutiert man in den vergangenen Jahren bereits Ansätze, die immer ungleicher werdende (sich polarisierende) Einkommens- und Vermögensverteilung zu korrigieren, ohne dabei anreizinkompatible Signale auszusenden und die ökonomische Effizienz zu beeinträchtigen. Dabei denkt man an Beteiligungen der ArbeitnehmerInnen an den Firmen, in denen sie arbeiten, statt ihnen höhere Löhne oder Unterstützungen zu bezahlen. Offenbar fürchtet man die "soziale Sprengkraft", die der empfundenen Ungerechtigkeit der Benachteiligten über ihre krasse Schlechterstellung innewohnt. Sozialer Unfrieden und wirtschaftliche Interessenkonflikte sind natürlich auch kostenträchtig und können die Wirtschaftsentwicklung benachteiligen. Schließlich gibt es einige wenige empirische Studien über den langfristigen Zusammenhang zwischen Verteilungsnivellierung und Wirtschaftswachstum. Dabei weisen die Ergebnisse darauf hin, dass entweder kein statistisch aussagefähiger Zusammenhang zwischen Verteilung und Wachstum besteht oder aber dass eine gleichmäßigere Verteilung die langfristige Wirtschaftsentwicklung leicht fördert. Dennoch führt das strategische Denken der beteiligten Interessengruppen in einer Marktwirtschaft tendenziell zu einer relativ geringen Beachtung des Verteilungsziels gegenüber dem Effizienz- und Wachstumsziel. 2.5. Marktversagen und Wirtschaftspolitik In einer liberalen Gesellschaft mit einer (folgerichtig) marktwirtschaftlichen Organisation der Wirtschaftsangelegenheiten sind wirtschaftspolitische Eingriffe des Staates (das sind Eingriffe in die Produktions-, Eigentums- und Konsumfreiheit der WirtschaftsteilnehmerInnen) nur gerechtfertigt, wenn der Markt unweigerlich versagt und daher staatlicher Korrekturbedarf bei den Marktergebnissen besteht. Denn Staatseingriffe müssen kollektiv finanziert werden (Steuereinhebungsgewalt). 13 Die für die Finanzierung der Staatsaktivitäten erforderlichen Steuern entziehen den Privaten Ressourcen und verursachen bei diesen Opportunitätskosten. Gemäß dem Prinzip der Opportunitätskostenminimierung (Maximierung der allokativen Effizienz auf sozialer Ebene) ist daher theoretisch jeder Staatseingriff begründungspflichtig und nur durch Marktversagen begründbar. Von Marktversagen sprechen wir nicht, wenn der Wettbewerbsmarkt wegen mangelnden Wettbewerbs schlecht funktioniert; in dieser Situation muss der Staat natürlich Wettbewerbspolitik betreiben und die nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für einen funktionsfähigen Wettbewerb schaffen. Wenn die Voraussetzungen eines perfekten Marktes nicht gegeben sind, kann der Markt klarer Weise nicht funktionieren, was aber nicht an einem systematischen Funktionsversagen liegt. Marktversagen stellen wir hingegen fest, wenn der Markt perfekt funktioniert (der Wettbewerb ist gewährleistet und funktionsfähig; der Realtypus entspricht im Wesentlichen dem Idealtypus). Aber die Marktergebnisse sind aus sozialer (gesellschaftlicher) Perspektive als unerwünscht einzustufen (Kinderarbeit, Gewaltvideos, Umweltzerstörung, Ausbeutung unselbstständig Beschäftigter u.dgl.). Das Versagen besteht darin, dass der Markt eben auf Grund seiner Funktionsprinzipien (Anreize, Wettbewerb, ökonomische Effizienzmaximierung) systematisch gewisse Ergebnisse eben nicht produzieren kann, etwa ausschließlich gesellschaftlich erwünschte Güter, Vollbeschäftigung, Umweltschonung, Entlohnungsfairness etc. Obwohl die ökonomische Effizienz (die Effizienz auf individueller Ebene) maximal sein mag, ist es die allokative Effizienz (die Effizienz auf sozialer Ebene) nicht. Für Marktversagen gibt es mehrere Gruppen von Ursachen: (a) Ökonomische Irrationalität im Verhalten: WirtschaftsteilnehmerInnen handeln nicht ökonomisch rational (z.B. frühzeitiger Schulabbruch, um Einkommen zu verdienen, aber Verlust von Lebenseinkommen wegen einer den persönlichen Fähigkeiten nicht angemessenen Ausbildung). (b) Öffentliche Güter (Kollektivgüter, Gemeinschaftsgüter): Verteilungsgerechtigkeit, Vollbeschäftigung, Umweltschonung, stabile Wirtschaftsentwicklung etc. erstrecken sich mit ihrem Nutzen auf alle Menschen, können aber auch nur von allen oder zumindest vielen Menschen erzielt werden.6 Dabei versagt der Wettbewerbsmarkt als Mechanismus zur solidarischen, sozialen Koordination der individuellen Verhaltensweisen. (c) Abnehmenden Stückkosten: Je größer die Produktion der Firma und je größer die produzierende Firma ist, desto geringer können die Produktionskosten pro Outputeinheit sein. Unter dieser Voraussetzung führt funktionierender Wettbewerb dazu, dass jeweils die Unternehmen mit der geringsten Produktivität und den höchsten Stückkosten und Preisen aus dem Markt ausscheiden. Das bedeutet, langfristig gesehen, eine Monopolisierungstendenz: Immer weniger AnbieterInnen verbleiben am Markt. Dadurch wird der Wettbewerb schließlich versiegen und der verbleibende Monopolist beutet mit überhöhten Preisen die NachfragerInnen aus. 6 "Was alle angeht, können nur alle lösen. Jeder Versuch eines Einzelnen, für sich zu lösen, was alle angeht, muß scheitern." Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame. 14 (d) Externe Effekte schädigen die Gesellschaft: Kosten, die bei der Produktion entstehen, aber nicht von der verursachenden Firma getragen werden müssen (weil sie – mangels wirtschaftspolitischer Regelung – der Allgemeinheit zur Last fallen: z.B. die Kosten der Umweltzerstörung durch Emissionen), werden von den VerursacherInnen tatsächlich nicht übernommen. Denn selbst bei gutem Willen mag es unmöglich sein, wegen des harten Wettbewerbs die Kosten freiwillig zu übernehmen, die durch die externen Effekte (z.B. die ungebremste Umweltverschmutzung) für die Gemeinschaft entstehen. In all diesen Fällen hat der Staat als überindividuelle, hoheitliche Instanz, die staatspolitisch verantwortungsvoll handeln soll, nicht nur die Berechtigung, sondern auch die Verpflichtung, wirtschaftspolitisch tätig zu werden und die Marktversagensfälle gar nicht erst entstehen zu lassen oder zumindest deren sozial schädliche Auswirkungen auszugleichen. 2.6. Politikversagen und Regelbindung Allerdings handelt es sich bei der Institution Staat (Realtypus) nicht um einen "wohlwollenden Diktator" (Idealtypus), der allwissend und allmächtig ist und nichts Anderes tut, als die soziale Wohlfahrt durch optimale Wirtschaftspolitik zu maximieren (die sozialen Opportunitätskosten zu minimieren). Der wirtschaftspolitische Realtypus weicht von seinem Idealtypus ab. Jede staatliche Institution mit ihren Organen basiert auf einer Organisation, die von OrganwalterInnen (natürlichen Personen) getragen wird. Das Volk als der politische Souverän ist der "oberste Prinzipal" aller OrganwalterInnen ("agents"). Das "principal-agents problem" (die Organschaftsproblematik) besteht darin, dass die "agents" von den "principals" kaum effektiv zu kontrollieren sind und daher eher nach ihren individuellen Interessen (individuell rational) handeln statt nach den Gemeinschaftsinteressen (kollektiv rational). Individuelle Ziele von "public agents" können rein persönlich sein (Behaglichkeit während der Arbeit oder aber Bereicherung, Macht und Prestige) oder ideologisch (alles wird für den Sieg der eigenen Partei oder Weltanschauung getan). Daraus ergibt sich das Phänomen der Ressourcenverschwendung im öffentlichen Sektor: Politikversagen (Staatsversagen) ist festzustellen. Während Liberale das dieses Politikversagen als gravierender einstufen, sehen AnhängerInnen einer eher solidarischen Sichtweise (Kommunitarismus: Gemeinschaftsinteressen sind wichtig!) vielmehr das Marktversagen als das größere der beiden Übel an. So beobachten wir längerfristig eine Art Pendelbewegung in der Realität: Marktversagen wird anlassbezogen einmal besonders stark empfunden, so dass der Staat stärker eingreift. Das macht das Politikversagen merklicher, und eine Zurückdrängung ("roll-back") des Staates wird verstärkt angestrebt. Auswege aus der Problematik des Politikversagen sucht die Institutionenökonomie (Verfassungsökonomie). Es wird überlegt, welche Normen für staatliches Handeln, die meist mit einer qualifizierten Mehrheit ("Verfassungsmehrheit" von zwei Dritteln oder so) beschlossen werden, das hoheitliche Verhalten der EntscheidungsträgerInnen in Politik und Verwaltung institutionell am besten in Richtung sozial effizienter Ergebnisse lenken. 15 Das Gegenargument dazu lautet, die gewählten VolksvertreterInnen sind mit einem allgemeinen politischen Mandat ausgestattet und könnten die ihnen übertragende politische Verantwortung nur dann größtmöglich wahrnehmen, wenn sie tatsächlich frei sind, nach ihrem eigenen Gutdünken entscheiden zu können (Diskretionarität der Entscheidungen, diskretionäre Entscheidungen). 3. Die einzelne Unternehmung und der einzelne Markt: Angebot und Nachfrage 3.1. Effizienz und Wohlstand durch Spezialisierung und Arbeitsteilung, Handel und Märkte 3.1.1. Das berühmte "Stecknadelbeispiel" von Adam Smith Im Mittelpunkt des Wirtschaftens steht prinzipiell der Mensch – oder sollte dort stehen. Inwiefern? Ein Beispiel: Sie brauchen eine Stecknadel. Kein Problem! Sie kriegen sie im nächsten Supermarkt, geöffnet von 07:30 bis 19:30 Uhr, oder an der Tankstelle, rund um die Uhr offen. Und sie kostet (gemessen an Ihrem Einkommen) nur eine winzige Kleinigkeit. An diesen Fall dachte schon Adam Smith, vor etwa 250 Jahren. Er gab zu bedenken: Wenn Sie selbst die Stecknadel produzieren, müssen Sie beim Erzschürfen anfangen. Die Produktion der einen, läppischen Nadel wird Sie viel Zeit und Mühen kosten (geringe Arbeitsproduktivität), denn Sie sind nicht darauf spezialisiert, und die Qualität Ihres Arbeitsergebnisses wird daher schlecht sein. Was hätten Sie in all dieser Zeit alles anfangen können, was viel sinnvoller und notwendiger gewesen wäre! Die Opportunitätskosten (Alternativkosten) sind sehr hoch, die Effizienz ist gering. Sie hätten sich nämlich (durch eine so genannte "Reallokation der Ressourcen": durch einen geänderten, alternativen Einsatz der Ressourcen für Produktionszwecke) auf die Tätigkeit spezialisieren können, die Sie bestens beherrschen, für die Sie am meisten geeignet und am besten ausgestattet sind – sei diese Tätigkeit auch nur ein kleiner Schritt (z.B. das Eloxieren von Nadeln) oder ein winziger Teilbereich (z.B. Kostenrechnung) irgendwo in der langen Fertigungskette von der Urproduktion (z.B. Erzschürfung) bis zum fertigen Endprodukt (z.B. Nadeln). Adam Smith demonstrierte an diesem Beispiel den ungeheuren Vorzug der Arbeitsteilung: Spezialisieren Sie sich doch auf Ihre vergleichsweisen Vorzüge (komparative Vorteile)! Produzieren Sie nicht bloß für den Eigenbedarf (Subsistenzwirtschaft), tauschen Sie den Rest auf dem Markt für andere Güter ein, und zwar für jene, die andere am Besten produzieren können. Handel bietet erst die Möglichkeit zu effizienter (arbeitsteiliger, spezialisierter, auf Austausch von Gütern beruhender) Produktion. 3.1.2. Arbeitsteilung, Spezialisierung und Geldwirtschaft: Tausch von Gütern gegen Einkommen Tauschen Sie aber nicht Gut gegen Gut (Realtauschwirtschaft), sondern Gut gegen Einkommen. Das am Markt erzielte Einkommen erhalten Sie in Form von Forderungen auf Güter (d.h. in Form 16 von Geld). Geld ist ein Tauschmittel, das auch von allen anderen im Land (Währungsraum) gern akzeptiert wird (Geldwirtschaft). Es wäre doch schade um die Zeit (Opportunitätskosten!) und den sonstigen Aufwand (Suchkosten!), wenn Sie einen Tauschpartner oder eine -partnerin suchen müssten, der bzw. die Ihnen eine Stecknadel gegen, sagen wir, 15 Sekunden Ihrer Leistung als professionelle KostenrechnerIn eintauscht. Das wäre ein doppelter und doppelt seltener Zufall, nämlich dass einE NadelhändlerIn nur 15 Minuten Kostenrechnung sucht und Sie als KostenrechnerIn 1 Nadel brauchen. Also dann doch lieber mit Kostenrechnung Einkommen verdienen und davon gegebenenfalls und jederzeit eine Stecknadel kaufen.7 Das ist Effizienz! Wir sind also bei der Outputeffizienz: Sagen wir, Sie benötigen für die Eigenproduktion dieser einen Stecknadel 1 Monat. Mit dem Monatseinkommen eineR KostenrechnerIn könnten Sie aber theoretisch, sagen wir, 10.000 Stecknadeln kaufen (= Realeinkommen = Einkommen in Gütern, hier z.B. in Stecknadeln gerechnet). Der Kauf 1 Nadel kostet Sie aber nur 1/10.000 Monatseinkommen. Für das restliche Einkommen kaufen Sie sich Wohnraumnutzung, Bier etc. (= Realeinkommen = Einkommen in Gütern, hier in einem repräsentativen Konsumgüterbündel ausgedrückt). 3.1.3. Arbeitsteilung, Spezialisierung und Märkte Arbeitsteilung und Spezialisierung erfolgen aus Gründen der Effizienz und somit auch der Wohlstandsmaximierung: Je höher die Produktivität ist, desto größer sind die Möglichkeiten (ist das Potenzial) für unsere Bedarfsdeckung (Bedarfsdeckung = tatsächliche Bedürfnisbefriedigung durch Güter = Wohlstand). Arbeitsteilung und Spezialisierung erfordern, dass die ProduzentInnen jene Güter (Waren und Dienstleistungen), die sie nicht selbst erzeugen, aber (a) als UnternehmerInnen für ihre Produktion brauchen (Vorleistungen und Investitionsgüter) und (b) als private Haushalte für ihren persönlichen Konsum benötigen, auf dem Markt kaufen. Ähnliches gilt (c) für ArbeitnehmerInnen (unselbstständige Beschäftigte) und (d) für jene, die von ihrem Sach- und Finanzvermögen leben (Rentiers): Sie verkaufen Arbeits- bzw. Kapitalleistungen, um Arbeits- bzw. Kapitaleinkommen zu erhalten und aus diesen Einkommen zu konsumieren, zu sparen und Steuern zu zahlen. Arbeitsleistungen (die Zurverfügungstellung von Humankapital) durch ArbeitnehmerInnen sowie die Leistungen "Zurverfügungstellung von Sachkapital und Finanzkapital" durch Rentiers kommen auf die Märkte für Produktionsfaktoren (Ressourcen); das sind, mit anderen Worten ausgedrückt, die Faktormärkte. Wir unterscheiden die Produktionsfaktoren (a) Arbeit (Humankapital-Leistungen), 7 "Wenn es in der ökonomischen Wissenschaft ein zentrales Thema gibt, dann ist es zweifellos die Auffassung von Wettbewerb als Mittel für gesellschaftliche Organisation, das selbstsüchtige Wirtschaftssubjekte veranlasst, danach zu trachten, anderen Personen, an deren Wohlergehen sie keinerlei Interesse empfinden, zu Diensten zu sein" (Viktor J. Vanberg, in: Kyklos 2000, S. 363). 17 (b) Boden (eine Form von Sachkapital, die aber auch zum Kapital gezählt werden kann und nicht extra erwähnt werden muss) und (c) Kapital, nämlich: sonstiges Sachkapital (wie etwa Maschinen), Naturkapital (Bodenschätze, Boden, reine Luft, Trinkwasser usw.) sowie Finanzkapital (wie Aktien, Anleihen, Sparbücher, Geld etc.). Die Inputmärkte (Märkte für Waren und Dienstleistungen, die in einen Produktionsprozess Eingang finden), umfassen also verschiedene Inputs: (a) Produktionsfaktoren (die Ressourcen Arbeit und Kapital i.w.S.) und (b) Vorleistungen (Vorprodukte); diese Vorleistungen wurden ihrerseits auch mit Ressourcen und meist auch mit Vorleistungen erstellt. Hingegen werden auf den Outputmärkten Güter (Waren und Dienstleistungen) gehandelt. Sie dienen (a) entweder dem Konsum durch (a1) private Haushalte (Briefpapier, InstallateurInnenleistungen) oder (a2) den Staat (z.B. Schreibpapier, BeamtInnenleistungen) oder (b) der Investition durch Unternehmen (Firmenautos etc.) oder den Staat (z.B. Polizeiautos). Investitionsgüter, auch Kapitalgüter genannt (z.B. Maschinen), gehen in der Produktion nicht unter (d.h. sie werden in der Produktion nicht sofort verbraucht). Vielmehr werden sie für die Produktion verwendet und letztendlich auch verschlissen (abgeschrieben), d.h. durch Gebrauch und Abnützung werden sie immer weniger wert und sind schließlich nichts mehr wert. Der rechnerische Gegenwert des Sachkapitalverschleißes ist die Abschreibung. 3.2. Das Angebot auf einem Markt bei vollkommener Konkurrenz 3.2.1. Unsere Annahmen Die mirkoökonomische Produktionstheorie erklärt die Produktionsentscheidung auf dem Markt für ein einzelnes Gut. Der Einfachheit halber setzen wir Produktion und Angebot auf dem Markt gleich; d.h., wir nehmen an, es erfolgt weder eine Produktion für die eigene Unternehmung (selbsterstellte Vorleistungen und selbsterstellte Anlagen) noch für den eigenen Privathaushalt (den eigenen persönlichen Konsum: Eigenverbrauch und Eigenwohnung) der UnternehmerInnen, und es werden keine Lagerveränderungen vorgenommen: Die ganze Produktion geht als Angebot auf den Markt. Eine realistische und legitime Annahme zur Erklärung des Produktionsverhaltens ist die Zielsetzung, den Gewinn zu maximieren.8 Also stellt sich für die Unternehmung die Frage: Bei welcher Produktionsmenge ist der Gewinn maximal? Den Gewinn definieren wir als Umsatz (Ertrag, Erlös) minus Kosten. Der Umsatz (Ertrag, Erlös) ist seinerseits das Produkt von verkaufter Menge mal erzieltem Marktpreis. 8 Selbst der sozialdemokratische Bundeskanzler Bruno Kreisky meinte, "Gewinne sind der Motor der Wirtschaft". 18 3.2.2. (Marginalistische) Gewinnmaximierung Die ÖkonomInnen verwenden dabei die marginalistische Analysemethode: Sie untersuchen, beginnend mit der ersten Einheit des Outputgutes, wie hoch der Gewinn bzw. Verlust der jeweils produzierten Outputeinheit ist. Es geht also immer darum, wie viel Gewinn die Produktion einer weiteren Outputeinheit bringt (= wie hoch der Grenzgewinn der Produktion der ersten, zweiten, dritten ... Einheit ist). Der Grenzgewinn errechnet sich, indem vom Grenzumsatz (dem Umsatz, der mit zusätzlich produzierten Outputeinheit gemacht wird) die Grenzkosten (die Kosten, die durch die zusätzlich produzierte Outputeinheit entstehen) abgezogen werden: Grenzgewinn ist Grenzumsatz minus Grenzkosten. Wenn der Grenzgewinn der ersten Outputeinheit negativ ist (d.h., wenn ich das erste Stück produziere, mache ich damit einen Verlust), probiert man marginalistisch (Schritt für Schritt) weiter: die zweite, dritte ... Outputeinheit. Es ist wahrscheinlich, dass der Grenzverlust mit fortschreitender Produktionsmenge zuerst noch größer, aber dann immer kleiner wird, bis der Grenzverlust = Grenzgewinn gerade null ist; danach (mit einer weiteren Outputeinheit) wird der Grenzgewinn positiv (Grenzverlust negativ), bis der Grenzgewinn maximal ist und bei über diese Menge hinaus gehender Produktion wieder abnimmt. Aber das Maximum des Grenzgewinns ist nicht das Maximum des Gesamtgewinns: Denn solange der Grenzgewinn positiv ist, wird die Produktion einer zusätzlichen Outputeinheit den bisher angesammelten Gesamtgewinn noch vergrößern. Wenn nach fortschreitender Ausweitung der Grenzgewinn kleiner und kleiner und schließlich wieder null wird, sind wir endlich im Gewinnmaximum angelangt. Denn eine weitere Outputeinheit würde einen negativen Grenzgewinn (positiven Grenzverlust) bringen und somit den bislang aufsummierten Gesamtgewinn wieder kleiner machen. 3.2.3. Das gewinnmaximale Angebot der einzelnen Unternehmung In unserem Modell (von unserer Warte aus gesehen) herrscht vollkommener Wettbewerb auf dem betrachteten Markt für ein bestimmtes Gut. Das bedeutet, dass die vielen Unternehmen, die als KonkurrentInnen auf diesem Markt sind – die Marktform heißt Polypol (viele VerkäuferInnen) –, nicht vom gängigen Marktpreis abweichen können: Sie sind PreisnehmerInnen. Würden sie einen höheren Preis verlangen, hätten sie keine Nachfrage mehr nach ihrem Produkt, weil alle NachfragerInnen bei den Konkurrenzfirmen kaufen würden. Und umgekehrt: Würde eine einzelne Unternehmung den Preis unter den Marktpreis senken, hätte sie die Nachfrage des ganzen Marktes auf sich gezogen, könnte sie nicht befriedigen und würde den Preis erhöhen. Bei perfektem Wettbewerb ist also der Marktpreis ein Datum (eine Gegebenheit) für die Einzelfirma ist. Egal, wie viel die Unternehmung produziert und auf den Markt bringt, sie kann jede Outputeinheit (Tonne, Kilometer, Hektoliter, Stunde oder Stück) zum selben Preis verkaufen. Der Umsatz ist als Verkaufsmenge mal Marktpreis definiert. Wenn der Preis – unabhängig von der Menge – konstant ist, dann ist der Durchschnittsumsatz (-erlös, -ertrag) – das ist der Umsatz dividiert durch die Outputeinheiten – immer gleich dem Marktpreis. Bei vollkommener Konkurrenz ist 19 der Marktpreis gleich dem Durchschnittsumsatz und dem Grenzumsatz, und diese Größen sind konstant (von der Produktionsmenge unabhängig). Die Gewinnmaximierungsregel im Allgemeinen verlangt doch: Der Grenzgewinn muss null sein. Der Grenzgewinn ist wiederum Grenzumsatz minus Grenzkosten. Daher können wir die Gewinnmaximierungsregel auch so formulieren: Der Grenzumsatz muss gleich den Grenzkosten sein. Das wird in der nachstehenden Grafik verdeutlicht: Während der Grenzumsatz (= Durchschnittsumsatz = Preis) mit zunehmender Produktionsmenge gleich bleibt, sinken zunächst die Grenzkosten, bevor sie wieder zunehmen. Dabei ist es zwei Mal der Fall, dass die Grenzkosten so hoch sind wie der Grenzumsatz: erstens beim Verlustminimum und zweitens beim Gewinnmaximum. Für die Gewinnmaximierung der Unternehmung ist offensichtlich nur der zweite dieser Fälle relevant. Grenzkosten, Grenzumsatz = = Marktpreis Grenzkosten Grenzumsatz = Marktpreis Menge Gewinnmaximale Produktionsmenge Wir können sagen, dass bei vollkommener Konkurrenz die Unternehmen PreisnehmerInnen und MengenanpasserInnen sind, weil sie ihren Gewinn mit der Wahl der Produktionsmenge maximieren. Denn die Produktionsmenge entscheidet im Wege der mengenabhängigen Grenzkosten und bei gegebenem Grenzumsatz über den Grenzgewinn. Bei Befolgung der Gewinnmaximierungsregel (Grenzkosten = Grenzumsatz = Marktpreis) ergibt sich daraus eben eine Produktionsmenge, bei der die Gesamtkosten größtmöglich unter dem Umsatz liegen (= Gewinnmaximum). Wenn nun auf Grund geänderter Rahmenbedingungen für den Markt (z.B. weil die NachfragerInnen reicher werden) der Marktpreis steigt (grafisch gesprochen: die Grenzumsatz- und Preisgerade verschiebt sich nach oben), dann erkennen wir allein schon an der Grafik, dass die gewinnmaximale Produktionsmenge der einzelnen Unternehmen zunimmt. Denn mehr Produktion steigert die Grenzkosten und gleicht sie dem erhöhten Grenzumsatz (= Preis) an, und wir haben ein neues Gewinnmaximum. Somit haben wir das Angebot auf dem einzelnen Markt in Abhängigkeit vom Marktpreis erklärt: Wir haben eine Angebotsfunktion entwickelt und damit eine Angebotstheorie aufgestellt; Sie lautet: Je höher der Marktpreis ist, desto höher ist auch das Angebot. Auf Grund anderer geänderter Rahmenbedingungen wie technischem Fortschritt, der die Produktivität steigert und mithin die Kosten senkt, verschiebt sich (grafisch gesprochen) die Grenzkostenkurve nach unten: Auf jedem Produktionsniveau kann die nächste zusätzliche Outputeinheit billiger 20 produziert werden. In diesem Fall erkennen wir schon grafisch, dass die gewinnmaximale Produktionsmenge zunimmt. Denn die gesunkenen Grenzkosten nehmen mit der steigenden Produktion wieder zu und entsprechen wieder dem unverändert gebliebenen Grenzumsatz (= Preis). Bei vollkommener Konkurrenz steigert technischer Fortschritt in einer Unternehmung deren Output. 3.3. Die Nachfrage auf einem Markt bei vollkommener Konkurrenz Wenn wir unser Modell des Marktes für ein einzelnes Gut vervollständigen wollen, um Produktionsmenge und Preis gleichzeitig erklären zu können, brauchen wir noch eine Erklärung der Nachfrage in Abhängigkeit vom Marktpreis; d.h. eine Nachfragefunktion (Nachfragetheorie), die zu unserer Angebotsfunktion (Angebotstheorie) passt. Wir gehen davon aus, dass der einzelne private Haushalt ein gegebenes Einkommen bezieht, das in Geldeinheiten ausgedrückt ist; wir nennen es das Nominaleinkommen (Geldeinkommen), also z.B. 2000 € pro Monat. Mit diesem kurzfristig (etwa über ein Jahr, nämlich bis zum nächsten Lohnabschluss) gegebenem Nominaleinkommen kauft der Haushalt – bei gegebener Aufteilung des Einkommens in Steuerzahlen, Konsum und Ersparnis – eine ganze Palette von Konsumgütern (ein Güterbündel), in unserem einfachen Modell zwei Konsumgüter (z.B. Brot und Wein). Wir können davon ausgehen, dass der Haushalt – der menschlichen Natur gemäß, d.h. ökonomisch effizient – seinen Nutzen maximiert, indem er dasjenige Güterbündel (aus weniger oder mehr Brot und mehr oder weniger Wein) zusammenstellt, das ihm am liebsten ist. Wenn eines der beiden Güter oder beide teurer werden, dann kann sich der Haushalt von seinem fix vorgegebenen Nominaleinkommen (Geldeinkommen) nur mehr weniger Güter kaufen als zuvor. Wir sagen: Das Realeinkommen (die Kaufkraft des Einkommens) ist durch Teuerung gesunken. Wenn nun der Preis eines der beiden Konsumgüter unseres Modells, sagen wir Wein, steigt, dann wird das andere Gut (Brot) relativ (d.h. im Vergleich zu Wein) billiger und wird stärker nachgefragt, während das (absolut und relativ) teurer gewordene Gut (Wein) weniger stark nachgefragt wird. Das teurere Gut wird teilweise durch das billigere ersetzt. Das ist der Substitutionseffekt der relativen Preisänderung. Durch die Teuerung von Wein wird aber das Realeinkommen des Haushalts geringer, wodurch sowohl vom relativ verteuerten als auch vom relativ verbilligten Gut weniger nachgefragt wird. Das nennen wir den Einkommenseffekt der relativen Preisänderung. Beide Effekte der relativen Preisänderung werden wirksam. Der Substitutionseffekt bewirkt eine Reduktion der Nachfrage nach dem verteuerten Gut (Wein) und eine Vergrößerung der Nachfrage nach dem relativ verbilligten Gut Brot. Zugleich verstärkt der Einkommenseffekt den Nachfragerückgang von Wein und dämpft der Einkommenseffekt den Nachfrageanstieg nach Brot. Denn der Haushalt kann sich wegen der Teuerung insgesamt weniger leisten, aber er mildert seinen Realeinkommensrückgang dadurch, dass er weniger vom verteuerten und mehr vom verbilligten Gut kauft; so wirkt der Substitutionseffekt. 21 Für unsere Nachfragetheorie nach einem einzelnen Gut bedeutet das: Je höher der Preis ist, desto geringer ist die Nachfrage des Hauhalts. Unsere Kenntnisse versetzen uns nun in die Lage, den Markt für ein Gut zu erklären (siehe nächste Grafik). Der Marktpreis bestimmt Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage wiederum bestimmen den Marktpreis usw. Wir haben es hier mit einer wechselseitigen Abhängigkeit zwischen Preis und Mengen (Angebots- und Nachfragemenge) auf dem Markt zu tun. Marktpreis Angebot Neuer bzw. alter Gleichgewichtspreis Y X X’ Überschussnachfrage Nachfrage alt (links) und neu (rechts) alte neue Menge (hier: Brot) Gleichgewichtsmenge Ausgehend vom alten Gleichgewicht (Punkt X) auf dem Markt für Brot steigt nun die Nachfrage, weil Wein teurer geworden ist und/oder die Haushalte reicher geworden sind. Die Überschussnachfrage (die Nachfrage X’ ist größer als das Angebot X) steigert den Preis. Weil Angebot und Nachfrage u.a. auch vom Preis abhängig sind, steigen Produktion und Angebot und sinkt die Nachfrage, bis schließlich in Punkt Y das neue Gleichgewicht erreicht ist. 3.4. KonsumentInnen- und ProduzentInnenrente Ein wirtschaftstheoretisch gebräuchliches Maß für die Wohlfahrt (wohlgemerkt: damit ist der materielle Aspekt der Wohlfahrt, nämlich der Wohlstand, gemeint) ist die Gesamtrente, die sich in KonumentInnen- und ProduzentInnenrente aufteilt. Wie in der Grafik zu sehen, ist die KonsumentInnenrente die Dreiecksfläche (KR) zwischen Marktpreis und Nachfragefunktion, und die ProduzentInnenrente entspricht der Dreiecksfläche (PR) zwischen Marktpreis und Angebotsfunktion (Grenzkostenfunktion). Marktpreis Angebot GleichgeWichtsPreis KR PR Nachfrage Gleichgewichtsmenge 22 Menge Die KonsumentInnenrente und die Gesamtrente sind umso größer und die ProduzentInnenrente ist umso kleiner, je niedriger der Marktpreis und je höher die dazugehörige Gleichgewichtsmenge ist. Die Gesamtrente ist ja deshalb ein (materielles) Wohlfahrtsmaß, weil es mehr Wohlstand bedeutet, wenn auf einem Markt mehr Güter zu geringeren Preisen erzeugt und verkauft werden. 3.5. Marktformen und (materielle) Wohlfahrt 3.5.1. Vollkommene und unvollkommene Konkurrenz Im perfekten Markt (Polypol bei vollkommener Konkurrenz und Information) sind sowohl die KonsumentInnenrente als auch die Gesamtrente maximal. Denn die einzelne Unternehmung hat keine Preissetzungsmacht (kann den Preis nicht willkürlich setzen), und Preisabsprachen (Preiskartelle) gibt es im perfekten Markt nicht. Wenn aber die Intensität des Preiswettbewerbs abnimmt, d.h., die Preissetzungsmacht der Unternehmen zunimmt, dann setzen die Unternehmen den Preis oberhalb des Konkurrenzpreises (Grenzkostenpreis, minimaler Preis) an (bildlich: die Angebotsfunktion verschiebt sich nach oben), und die Nachfrage geht zurück. Zu höheren Preisen werden weniger Güter produziert, verkauft und gekauft. Der verringerte Preiswettbewerb bewirkt eine Wohlstandsminderung (materielle Wohlfahrtseinbuße). 3.5.2. Monopolistische Konkurrenz Sobald die Unternehmen Produktdifferenzierung betreiben (d.h., jede Unternehmung im selben Markt für ein Gut gestaltet ihr Produkt etwas anders), um die direkte Vergleichbarkeit der Güterqualität einzuschränken, schaffen sich die Unternehmen dadurch einen mehr oder minder hohen Preissetzungsspielraum nach oben (über den Konkurrenz- = Grenzkostenpreis hinaus); wir sprechen von einem Monopolgrad; er ist die prozentuelle Abweichung des Marktpreises vom Konkurrenzpreis (Grenzkostenpreis). Selbst wenn ein Polypol (eine Vielzahl von AnbieterInnen am Markt) besteht, ist der Preiswettbewerb unter diesen Voraussetzungen nicht mehr optimal, und wir bezeichnen diese Marktform als monopolistische Konkurrenz: Es ist ein Polypol bei Produktdifferenzierung und folglich monopolistischer Preisüberhöhung im Ausmaß des Monopolgrades. 3.5.2. Monopol Im Extremfall ist nur eine Unternehmung auf dem betreffenden Markt vertreten: Wir haben es mit einem Monopol zu tun. Eine einzelne Firma sieht sich als einzige Anbieterin auf einem Markt für ein bestimmtes Gut der gesamten Nachfrage nach diesem Gut gegenüber und kann daher den Preis beliebig festsetzen und auf diese Weise die Nachfragemenge steuern. Der Monopolgrad ist maximal, ebenso die ProduzentInnenrente, während die KonsumentInnenrente und die Gesamtrente minimal sind. Vollkommene Konkurrenz und Monopol stecken daher im Hinblick auf die (materielle) Wohlfahrt die Extremwerte von Mengen und Preisen ab: Stets gilt, die Monopolmenge ist geringer als die Konkurrenzmenge, und der Monopolpreis ist höher als der Konkurrenzpreis (wie die Grafik zeigt). 23 Preis Monopolpreis Nachfrage Konkurrenzpreis Menge Monopolmenge Konkurrenzmenge 3.6. Zwei Sichtweisen des Arbeitsmarktes: Lohnhöhe und Beschäftigung 3.6.1. Neoklassik und freiwillige Arbeitslosigkeit Von der Warte der Neoklassik aus betrachtet, ist Arbeit nichts als ein Leid. Dabei ist das Arbeitsleid umso größer, je mehr gearbeitet wird (jede weitere Stunde fällt noch schwerer). Ein nutzenmaximierender Haushalt wird also nur Arbeit anbieten, wenn das Arbeitsleid (Nutzenentgang) der zuletzt angebotenen Arbeitsstunde kleiner oder höchstens gleich groß ist wie die Kaufkraft des Stundenlohns (= Reallohnsatz, Nutzenstiftung durch den Kauf von Konsumgütern für das Entgelt einer Stunde Arbeit). Das Nutzenmaximum (optimale Arbeitsangebot) des Haushalts ist dort, wo das Grenzleid der Arbeit (Leid der letzten Arbeitsstunde) gleich ist dem Grenznutzen der Arbeit (Reallohnsatz). Jede weitere Erhöhung des Arbeitsangebots setzt voraus, dass auf dem Arbeitsmarkt höhere Löhne geboten werden: Wir haben hiermit eine Arbeitsangebotsfunktion (Arbeitsangebotstheorie). Höhere Löhne und höheres Arbeitsangebot sind dann zu beobachten, wenn die Unternehmen (gemäß ihrer Arbeitsnachfragefunktion) mehr Arbeit nachfragen. Der Lohnsatz entspricht den Grenzkosten einer Arbeitstunde, also den Kosten, die der Unternehmung für jede zusätzliche Arbeitsstunde entstehen. Herrscht vollkommene Konkurrenz am Arbeitsmarkt, so ist der Lohnsatz zwar ein Datum für die einzelne Unternehmung. Dennoch haben wir es mit steigenden Grenzkosten der Produktion zu tun. Die Produktivität der Arbeit nimmt nämlich ab, wenn die Produktion steigt; der Grund liegt in der immer stärkeren Auslastung der gegebenen Produktionsanlagen durch immer mehr ArbeiterInnen (Überlastung, Stehzeiten). Wenn die Arbeit weniger produktiv wird, muss mehr Arbeit für eine erzeugte Outputeinheit eingesetzt werden. So steigen die Grenzkosten der Produktion, obwohl die Grenzkosten einer Arbeitstunde konstant sind. Die Unternehmung maximiert ihren Gewinn und befolgt daher die Gewinnmaximierungsregel: Grenzkosten der Produktion = Grenzumsatz. Der Grenzumsatz ist der vorgegebene Preis auf dem Gütermarkt, und die Grenzkosten der Produktion nehmen zu (vgl. die Grafik in Punkt 3.2.3.). Unsere Arbeitsnachfragefunktion (Arbeitsnachfragetheorie) besagt also, die Arbeitsnachfrage einer Unternehmung ist umso größer, je niedriger der Lohnsatz ist (die Grenzkosten der Arbeit sind). Denn wenn die Grenzkosten der Arbeit sinken, dann sinken auch die Grenzkosten der Produktion. Und deshalb wird die Unternehmung mehr produzieren. Die Grenzkosten wieder nämlich dann wieder zunehmen und wieder dem unverändert gebliebenen Grenzumsatz entsprechen (das neue Ge- 24 winnmaximum ist dann erreicht). Und für die steigende Produktion werden mehr Arbeitskräfte bzw. Arbeitsstunden benötigt und nachgefragt. Somit ist unser neoklassisches Arbeitsmarktmodell komplett. Je höher der Lohnsatz ist, desto größer ist das Arbeitsangebot der Haushalte und desto kleiner ist die Arbeitsnachfrage der Unternehmen. Wenn das Arbeitsangebot größer ist als die Arbeitsnachfrage – und das ist der Fall, wenn der Lohnsatz zu hoch (höher als der gleichgewichtige Lohnsatz) ist –, dann herrscht Arbeitslosigkeit in Höhe von Arbeitsangebot minus Arbeitsnachfrage (siehe die gestrichelte Linie in der Grafik). Wenn der Arbeitsmarkt perfekt funktioniert, dann konkurrieren die Arbeitslosen und die Beschäftigten um die von den Unternehmen nachgefragten Arbeitsmenge (Zahl der Arbeitsplätze bzw. Arbeitsstunden): Die KonkurrentInnen auf dem Arbeitsmarkt unterbieten einander im Lohnsatz; der Lohnsatz sinkt; bei sinkendem Lohnsatz wollen die Haushalte weniger Arbeit anbieten und die Unternehmen mehr Arbeit nachfragen. Schließlich ist dadurch der Arbeitsmarkt wieder ausgeglichen: Arbeitsangebot = Arbeitsnachfrage, und der gleichgewichtige Lohnsatz ist vorläufig (bis zur nächsten Störung) stabil. Wer jetzt – im Arbeitsmarktgleichgewicht – noch ohne Arbeit ist, ist es freiwillig, denn alle Arbeitslosen könnten Beschäftigung finden, wenn sie in ihren Lohnvorstellungen nach unten nachgeben würden. Ist der Arbeitsmarkt hingegen nicht perfekt, weil gewerkschaftliche Macht ein Sinken des Lohnsatzes bei Arbeitslosigkeit verhindert, dann kann die Arbeitslosigkeit auch nicht auf ihr gleichgewichtiges (strukturelles) Niveau sinken. Die solcherart überhöhte Arbeitslosigkeit ist eine kollektivfreiwillige; das Kollektiv namens Gewerkschaft hat sich entschlossen, den Lohnsenkungswettbewerb durch (Androhung von) Arbeitskampfmaßnahmen zu blockieren, und bei dem verteidigten hohen Lohnsatz wollen die Haushalte viel Arbeit anbieten, bleiben aber zum Teil un- oder unterbeschäftigt; es herrscht Arbeitslosigkeit, weil der Lohnsatz zu hoch ist. Allerdings haben sich die ArbeitnehmerInnen kollektiv dazu entschlossen, den Lohn nicht zu senken und daher eine Reduktion der Arbeitslosigkeit (Erhöhung der Beschäftigung) kollektiv-freiwillig ausgeschlossen. Beschäftigungspolitik wäre eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes ("Entkrustung" durch Zerschlagung der Gewerkschaftsmacht). Reallohnsatz Überhöhter Lohnsatz Gleichgewichtiger Lohnsatz Arbeitsangebot Arbeitslosigkeit (kollektiv-freiwillig) Arbeitsnachfrage Arbeitsmenge Arbeitsmarktgleichgewicht mit freiwilliger Arbeitslosigkeit 25 3.6.2. Keynesianismus und unfreiwillige Arbeitslosigkeit Keynesianische ÖkonomInnen sehen den Arbeitsmarkt von einer anderen Warte. Arbeit ist eine Notwendigkeit zur täglichen Bedarfsdeckung, schützt außerdem vor Qualifikationsverlust und verleiht dem Leben Sinn und den Arbeitenden Zufriedenheit und Sozialprestige. Es geht dabei aber auch darum, die Kaufkraft des bisher erreichten Lohnsatzes zumindest zu erhalten (Inflationsausgleich) oder in kleinen Schritten zu erhöhen (Teilhabe an den Produktivitätssteigerungen). Wie viele Leute wie viele Stunden Beschäftigung finden, hängt hingegen ganz zentral davon ab, wie groß die Güternachfrage ist, also wie viel die Unternehmen verkaufen können und somit produzieren wollen und wie viele Arbeitskräfte bzw. Arbeitsstunden sie dazu brauchen (und nicht, wie hoch der Lohnsatz ist). Kurzfristig – bei gegebenem Stand der Technik und Organisation und daher bei gegebener Arbeitsproduktivität – ist daher die Arbeitsnachfrage ziemlich proportional zur Güternachfrage. Demgemäß besteht Beschäftigungspolitik vornehmlich darin, für ausreichend Güternachfrage und folglich Produktion, Leistungseinkommen und Kaufkraft zu sorgen. In unserem Modell keynesianischer Prägung werden in der industriellen Fertigung Maschinen und Arbeitskräfte in einem festen, technisch vorgegebenen Verhältnis eingesetzt. Daher können wir jede beliebige Menge mit den selben direkten Kosten (das sind die dem Produkt verursachungsgemäß zurechenbaren Kosten) herstellen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die direkten Kosten (= Grenzkosten des Produkts) konstant sind. Wenn wir aber auch indirekte Kosten (wie Miete, ManagerInnengehälter oder Zinsendienst) haben, die vom Produktionsniveau unabhängig sind, dann sind die durchschnittlichen Kosten (Gesamtkosten pro Outputeinheit = direkte plus indirekte Kosten pro Outputeinheit) umso geringer, je mehr produziert wird. Z.B., wenn die direkten Durchschnittskosten 10 € sind und die indirekten Kosten 1000 € betragen, dann sind die indirekten Kosten im Durchschnitt (pro Outputeinheit) 100 €, wenn 10 Einheiten erzeugt werden, aber nur 1 €, wenn 1000 Einheiten erzeugt werden. Die Durchschnittskosten insgesamt wären bei 10 Einheiten 110 € (= 10 € durchschnittliche direkte Kosten + 100 € durchschnittliche indirekte Kosten). Hingegen wären die gesamten Durchschnittskosten nur 11 € (= 10 € durchschnittliche direkte Kosten nach wie vor, aber nur 1 € durchschnittliche indirekte Kosten). Das ist eben der Kostenvorteil der Massenfertigung (Kostendegression). Durchschnittskosten (= Gesamtkosten pro Outputeinheit), Preis Preis Durchschnittskosten Menge (Outputeinheiten) 26 Der Marktpreis (= Durchschnittsumsatz = Grenzumsatz) ist in unserem Modell konstant, weil die Unternehmen bei monopolistischer Konkurrenz (was keine unrealistische Annahme ist) den Preis bilden, indem sie auf die durchschnittlichen direkten Kosten einen fixen Aufschlag draufgeben, der ihnen die durchschnittlichen indirekten Kosten und einen befriedigenden Durchschnittsgewinn bringen soll (Kostenaufschlagskalkulation). Anhand der Grafik sehen wir deutlich, dass bei konstantem Preis und sinkenden Durchschnittskosten das Gewinnmaximum (der Gewinn ist Durchschnittsgewinn mal Anzahl der Outputeinheiten) erreicht wird, wenn so viel produziert wird, wie nur irgend verkauft werden kann. Die Höhe des Lohnsatzes spielt für die Höhe der Produktion und Beschäftigung keine Rolle (ganz im Unterschied zur neoklassischen Theorie!). Sinken die Durchschnittskosten bis auf oder über die Aufnahmefähigkeit des Marktes für ein Gut, führt ein funktionierender Wettbewerb dazu, dass schließlich und endlich nur mehr eine Unternehmung (nämlich, die, welche die niedrigsten Kosten hat und die niedrigsten Preise bieten kann) auf dem Markt verbleibt. Doch dann ist diese Unternehmung Monopolistin, und sie wird ihre marktbeherrschende Position dazu nützen, ihren Monopolgewinn zu maximieren. Das bedeutet, wie wir oben gesehen haben, höhere Preis und niedrigere Mengen, also einen (materiellen) Wohlfahrtsverlust (eine minimale Gesamtrente). Diese Situation nennt man natürliches Monopol (Monopol auf Grund stetig abnehmender Durchschnittskosten). Daher besteht bei stetig abnehmenden Durchschnittskostenverläufen das wirtschafspolitische Dilemma, den Wettbewerb zwecks Kosten- und Preissenkung zu fördern und dadurch eine Monopolisierung zumindest zu riskieren (und möglicherweise am schlechtesten auszusteigen) oder aber den Wettbewerb zu behindern und höhere Kosten und Preise in Kauf zu nehmen (aber immerhin ein Monopol und somit die schlechteste Situation sicher zu vermeiden). 4. Die Gesamtwirtschaft: Konjunktur, Wachstum, Wirtschaftspolitik 4.1. Gütermarkt: Auslastung von Produktionsanlagen und Arbeitskräften 4.1.1. Das Gesetz von Say: Das Angebot schafft sich seine Nachfrage Schon 1802 behauptete der französische Ökonom Jean Baptiste Say, das Angebot an Gütern schaffe sich die Nachfrage nach diesen Gütern selbst. Say meinte damit, dass niemand produziert, wenn er oder sie das Einkommen, das dabei geschaffen wird, nicht auch auszugeben plant. In einer realen Tauschwirtschaft (Tausch von Gut gegen Gut statt von Gut gegen Einkommen in Form von Geld), wo nur Dienstleistungen und rasch verderbliche Waren (beide können sie nicht gelagert werden) produziert und gehandelt werden (ein Frisör wird heute nicht mehr Leuten die Haare schneiden, als er von ihnen heute gegen seine Haarschnitte Reinigungsleistungen, Informationsdienste etc. in Anspruch nehmen will), gilt Says Gesetz jedenfalls; es dürfen dabei also auch keine Kredite vergeben werden (ich schneide dir heute die Haare und du hilfst mir nächsten Monat beim Installieren meines Druckers), damit es gültig bleibt. Mit anderen Worten: Es dürfen keine Ersparnisse gebildet werden (d.h. es darf kein nicht konsumiertes Einkommen entstehen). 27 Dann funktioniert das "Say'sche Gesetz" sicher. Es kann kein Mangel an Güternachfrage auftreten, weil nur produziert wird, was selbst verbraucht und was gegen andere Güter eingetauscht wird. Daher sind der Wert der Produktion (= des Angebots), der Betrag des Einkommens und die Nachfrage in einer Wirtschaft immer gleich groß. Wir haben kein Problem damit, dass jemand über seinen oder ihren Bedarf hinaus produziert und diesen Überschuss nicht gegen die Produkte der anderen eintauscht; daher bleiben die anderen nicht auf ihren produzierten Gütern sitzen, sondern können sie gegen all das eintauschen, was sie brauchen und daher verbrauchen wollen (Konsum). 4.1.2. Das Gesetz der effektiven Nachfrage: Die Nachfrage schafft sich ihr Angebot Allerdings kann es unter realistischen Bedingungen vorkommen, dass das aktuelle Einkommen höher ist als die laufende Nachfrage daraus (= die Nachfrage nach den Gütern, bei deren Produktion das betreffende Einkommen entstanden ist). Die Differenz ist die Ersparnis, die nicht nachfragewirksam wird (d.h. effektiv im Hinblick auf Produktion und Beschäftigung wirkt). Die effektive Nachfrage ist unzureichend, ist kleiner als sie sein könnte, weil sie kleiner ist als das Einkommen, das eine höhere Nachfrage ermöglichen würde: So wird nicht das gesamte Einkommen für Güter verausgabt, nicht die gesamte Produktionsmenge wird nachgefragt. Wir sprechen von einem gesamtwirtschaftlichen Nachfragedefizit und daher auch von einem gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungsdefizit (Problem der unzureichenden effektiven, beschäftigungswirksamen Nachfrage), und wir beobachten Unterauslastung von Produktionsanlagen (Kapitalstock, Kapitalgütern) und Arbeitskräften (konjunkturelle Arbeitslosigkeit). Die Ursachen konjunktureller Probleme können verschieden und zugleich mehrfach sein: Die privaten Haushalte sparen zu viel (konsumieren zu wenig) von ihren Einkommen; die Unternehmen sparen zu viel (investieren zu wenig von ihren einbehaltenen, versteuerten Gewinnen); der Staat spart zu viel (konsumiert und investiert zu wenig von seinen Abgabeneinkommen). Die Folgen treten schrittweise ein: Die Unternehmen müssen die gerade produzierten Güter auf Lager nehmen (falls sie lagerfähig sind, ansonsten wird sofort weniger produziert), den Produktionskosten stehen geringere Verkauferlöse und somit geringere Gewinne und Gesamteinkommen gegenüber als erwartet, die Produktion wird reduziert (man kann nicht auf unabsehbare Zeit auf Lager produzieren), die Einkommen sinken daher weiter, der Einkommensrückgang verstärkt seinerseits den Nachfragerückgang: Eine ungünstige "Spirale" dreht sich in Richtung Rezession (Wirtschaftsrückgang) und Krise (Konjunkturtief); wir haben ein Problem mit dem Wirtschaftskreislauf. Auf dem Arbeitsmarkt kommt es zu Überstundenabbau, Zwangsbeurlaubungen, Einstellungsstopps, Kurzarbeit, Entlassungen. Warum ist dieses Konjunkturproblem eigentlich ein Kreislaufproblem? Nun, wir wissen, bei Produktion entsteht Einkommen, Einkommen ist eine Hauptquelle der Nachfrage, und Nachfrage die Bestimmungsgröße für die Produktion (womit der Kreislauf geschlossen wäre). Kreislaufprobleme gibt es dann, wenn Einkommen aus dem Kreislauf abfließt, d.h., wenn dieses Einkommen nicht nachfragewirksam wird. Ein Teil der Unternehmenseinkommen (unverteilte, versteuerte Gewinne), ein Teil der Haushaltseinkommen und ein Teil der Abgabeneinkommen (Steuern, Gebühren, Beiträge, 28 Strafen) fließt in Finanzvermögen oder in den Kauf ausländischer Güter (deren Produktion ausländischen Einkommen zu Gute kommen), statt in die Nachfrage nach inländischen Gütern (die zum Inlandseinkommen beitragen). Fragen die InländerInnen mehr ausländische Güter (Importgüter) nach als die AusländerInnen inländische Güter (unsere Exportgüter) nachfragen, geht die Handelsbilanz (und somit gleichsam die Bilanz der im Außenhandel mit Gütern – auf dem Weltmarkt verdienten – Einkommen) zu Ungunsten der InländerInnen aus: Der Beitrag der Außenwirtschaft zum Inlandsprodukt (= Inlandseinkommen) ist negativ, denn die Importe übertreffen die Exporte (Importüberschuss, Handelsbilanzdefizit). Aus dem Kreislauf von Produktion, Einkommen und Nachfrage fließen folgende Stromgrößen (Flussgrößen) ab (Einkommen versickert, statt Nachfrage zu bilden): die Ersparnisse der Haushalte und der Unternehmen, die Steuern und sonstige Abgaben an den Staat sowie die Importnachfrage. Andererseits gibt es Zuflüsse von effektiver Nachfrage in den Kreislauf hinein (ebenfalls Strom- oder Flussgrößen): die Investitionen der Unternehmen, die Ausgaben des Staates (für Güter, Transferzahlungen und öffentlich Bedienstete) und die Exportnachfrage (Auslandsnachfrage). Daher gibt es Gütermarktgleichgewicht (Produktion = Nachfrage) und somit keine Tendenz, dass sich Produktion, Einkommen und Beschäftigung ändern, wenn die Summe der Zuflüsse nämlich der Summe der Abflüsse entspricht: Investition + Staatsausgaben + Export = Ersparnis der Privaten + Abgaben an den Staat + Import. Oder, anders gesehen, das Nachfragedefizit der Privaten aus In- und Ausland muss gleich sein dem Nachfrageüberschuss (Budgetdefizit) des Staates: Ersparnis der Privaten – Investition der Unternehmen – Nettoexport = Budgetdefizit. Wenn also die privaten InländerInnen und die AusländerInnen nachfragemäßig "auslassen", kann der Staat eine Rezession durch ein entsprechend hohes Budgetdefizit vermeiden. 4.1.3. Selbststabilisierung der Wirtschaft Können Investitionen die private Ersparnis ausgleichen, damit die inländischen Privaten kein Nachfrageproblem verursachen? Können die Exporte die Importe ausgleichen, damit die Außenwirtschaft kein Nachfragedefizit schafft? Kann der Staat Budgetdisziplin halten, so dass seine Ausgaben genau seine Einnahmen (die Abgaben) kompensieren? Wenn ja, und wenn wir uns auf dem erwünschten Niveau von Einkommen und Beschäftigung befinden (Vollbeschäftigungseinkommen!), dann ist die Wirtschaft stabil im "Zustand der besten aller Welten". Und wenn der Idealzustand einmal gestört ist, gibt es dann eine automatische Tendenz der Wirtschaft nicht nur zum Gleichgewicht, sondern auch zum Gleichgewicht auf einem erwünschten Niveau von Einkommen und Beschäftigung? Die liberalen ÖkonomInnen ("Supply-Siders") sagen ja. Warum? Die Ersparnisse gehen alle auf den Finanzmarkt (Markt für Finanzkapital) und finanzieren – im Wege der Finanzvermittlung (Finanzintermediation) – die Investitionen (Aufbau und Ersatz von Sachkapital, von Kapitalgütern). Dabei wird umso mehr investiert und umso weniger gespart, je 29 geringer der Zinssatz auf dem Finanzmarkt ist (und analog umgekehrt). So gleicht der Zinssatz tendenziell Investition und Ersparnis aus, und es herrscht Gleichgewicht auf dem Gütermarkt. Wie die folgende Grafik des Finanz- und Sachkapitalmarktes zeigt, wird eine Zunahme der Ersparnis – unabhängig vom Zinssatz (also bei jedem Zinssatz) – den Zinssatz senken, deswegen zusätzliche Investitionen hervor rufen und mithin sogar die Produktion und das Einkommen steigern statt zu senken. Für die Expansion der Wirtschaft erfüllt also die Ersparnis (der Nicht-Konsum) die aktive, initiierende, führende Funktion. Mit anderen Worten: Der Aspekt der Finanzierbarkeit der Investition durch die Ersparnis (durch die Bildung von Finanzkapital) steht im Zentrum. Zinssatz altes Angebot an Ersparnis neues Angebot an Ersparnis Zinssatz alt Zinssatz neu Ersparnis alt = = Investition alt Investitionsnachfrage Ersparnis, Investition Ersparnis neu = = Investition neu Die Exporte und Importe werden durch den Preiswettbewerb zwischen den Unternehmen im Inland und denen im Ausland (mit einer Preisangleichungstendenz) sowie durch die Anpassungen des Wechselkurses (Auf- bzw. Abwertungen der Währungen) einander tendenziell angeglichen. Hat ein Land Importüberschüsse, dann fragt es für die Bezahlung seiner Importe mehr Fremdwährung nach als es an Erlösen für seine Exporte in Fremdwährung erlöst hat; die Übernachfrage nach Auslandswährung(en) lässt diese Fremdwährung(en) mehr wert werden; Fremdwährung wertet gegenüber der heimischen Währung auf und, was das selbe ist, die heimische Währung wertet gegenüber Fremdwährung(en) ab. Durch die Abwertung werden Importe verteuert und Exporte verbilligt, folglich sinken die Importe und die Exporte steigen, bis die Handelsbilanz wieder ausgeglichen ist. 4.1.4. Stabilisierungsversagen der Wirtschaft Gegen die problemlose Selbststabilisierung der Wirtschaft gibt es angesichts der immer wieder problematischen Entwicklungen in der Praxis und der daran anknüpfenden theoretischen Überlegungen einige Vorbehalte. Hier folgen einige zentrale Punkte davon. In einer Situation, wo die gesamte Güternachfrage (aggregierte Nachfrage, effektive Nachfrage) gering ist und die Unternehmen ohnehin schon Probleme haben, ihre Produktion abzusetzen, werden Unternehmen kaum investieren: Sie werden nämlich ihre ohnehin schon schwächer ausgelasteten Produktionsanlagen (ihren Kapitalstock, ihre Kapazitäten) nicht noch durch Anlageninvestitionen vergrößern (dann wäre nämlich die Nettoinvestition = positiv); vielleicht werden sie ihren Kapitalstock konstant halten, indem sie nur abgeschriebene (verschlissene) Maschinen ersetzen (Bruttoinvestition = Abschreibung, Nettoinvestition = null), vielleicht werden sie die Produktionsan- 30 lagen sogar schrumpfen lassen, indem sie abgeschriebene (verschlissene) Anlagen nicht mehr durch neue ersetzen (Bruttoinvestition = null), oder vielleicht werden noch intakte Maschinen mangels Nachfrage und Auslastung stillgelegt oder gar ganze Betriebe geschlossen (Deinvestition). Unter solchen Umständen wird auch ein starkes Sinken des Zinssatzes etwa gar bis auf nahezu null die Unternehmen kaum anreizen zu investieren. Billige Kredite ändern somit wenig daran, dass viele Unternehmen erwarten, die mit eventuellen Anlageninvestitionen künftig zu produzierenden Güter nicht mit Gewinn absetzen zu können. Die Investitionsnachfrage reagiert somit nicht mehr empfindlich auf Zinsänderungen (der so genannte Keynes-Effekt versagt). Die absetzbare Produktion (das absetzbare Einkommen) ist dann eben merklich kleiner als die potenzielle Produktion (das potenzielle Einkommen). Zinssatz altes Angebot an Ersparnis neues Angebot an Ersparnis Zinssatz alt Zinssatz neu Investitionsnachfrage Ersparnis, Investition Ersparnis alt = = Investition alt Ersparnis neu = = Investition neu Man könnte noch einwenden, dass die Unternehmen wissen, die gegenwärtige Ersparnis ist künftige Güternachfrage. Einstweilen könnten sie in Ruhe ihre Kapazitäten durch Anlageninvestitionen ausweiten, damit sie in Zukunft, wenn die heutige Ersparnis dann durch Entsparen zur effektiven Güternachfrage wird, diese Nachfrage werden befriedigen können. Doch investieren die Unternehmen deswegen nicht während Nachfragekrisen (Ersparnis ist größer als Investition), weil sie nicht wissen können, wann in Zukunft jeweils in welchen Mengen die Nachfrage nach welchen Produkten auftreten wird. Der Markt gibt also nicht hinreichend Signale an die InvestorInnen, um die heutigen Sparentscheidungen (künftigen Konsumentscheidungen) mit den heutigen Investitionsentscheidungen (heute zu treffenden Entscheidungen über die künftige Produktion) zu koordinieren: Der Markt versagt bei der intertemporalen Koordination von Produktion und Nachfrage. Was die Außenwirtschaft betrifft, muss eine Änderung des Wechselkurses keine Abhilfe schaffen. Eine Abwertung der heimischen Währung gegenüber Fremdwährungen (=Aufwertung der Fremdwährungen gegenüber der heimischen Währung) macht zwar unsere Währung und somit unsere Güter für AusländerInnen billiger und die Fremdwährungen und folglich auch die ausländischen Güter für die InländerInnen teurer. Doch muss das keine entscheidende Verbesserung der Handelsbilanz (Erhöhung der Nettoexporte) und als solche keine Steigerung des Außenbeitrags zum Inlandsprodukt (Inlandseinkommen) leisten. Denn bei so manchen Gütern ist nicht der Preis das entscheidende Kriterium für die Nachfrage nach ihnen, sondern das können technische Qualität, unbedingter Bedarf und absolute Vorlieben sein; bestimmte Mengen werden grenzüberschreitend gehandelt, und zwar kaum mehr oder weniger davon, selbst wenn sich ihre Preise wesentlich ändern. 31 4.1.5. Und sie stabilisiert sich doch? Selbst wenn der Keynes-Effekt (Zinssenkungen kurbeln Anlageninvestitionen an) nicht funktioniert, kann der so genannte Pigou-Effekt greifen. Arthur Pigou meint, bei nominell (d.h. in Geldeinheiten) gegebenem Finanzvermögen wird die Kaufkraft des Finanzvermögens (das reale Finanzvermögen, das Finanzvermögen ausgedrückt in den Gütereinheiten, die man damit kaufen kann) größer, wenn die Preise der Güter insgesamt fallen (Deflation herrscht statt Preisniveaustabilität oder gar statt Inflation). Dieser Pigou-Effekt, auch Realkasseneffekt genannt (unsere Kasseninhalte werden durch Preisniveausenkungen real mehr wert), wirkt direkt anregend auf die Güternachfrage. Pigou soll (überspitzt) formuliert haben, notfalls – in einer schweren Rezession – müssten halt die Preise so stark sinken, dass mit 1 Cent die gesamte U.S.-Wirtschaft voll beschäftigt werden könnte. Doch auch gegen die Wirksamkeit von Preisniveausenkungen lassen sich Gründe finden. Gerade die Reichen sind es, die über viel Finanzvermögen besitzen und durch Deflation (Preisniveausenkungen) noch reicher werden (Umverteilungseffekt); allerdings sind auch sie es, die nur einen kleinen Prozentanteil ihres riesigen Einkommens für Konsum verausgaben, während die kleinen Einkommen notgedrungen fast zur Gänze konsumiert werden müssen. So mag der Pigou-Effekt bescheiden bleiben. Weiter mögen die WirtschaftsteilnehmerInnen angesichts der fallenden Preise erwarten, dass sich diese Deflation noch länger fortsetzen wird, und sie könnten selbst bei steigender Kaufkraft ihre Käufe vor sich hin in die Zukunft (wann es noch billiger sein dürfte) verschieben (Erwartungseffekt). Das hilft der Wirtschaft aber nicht aus der Nachfragekrise. Weiter wird darauf hingewiesen, dass es für ein wesentliches Senken der Preise erforderlich ist, dass auch die Löhne (ein maßgebliches Kostenelement, das in den Preisen drinsteckt) ebenso wesentlich gesenkt werden müssen. Doch wer beginnt damit und begibt sich seines oder ihres Vorteils? Die ArbeitnehmerInnen, welche Gruppe von ihnen? Oder sollen die Unternehmen mit Preissenkungen beginnen und auf nachfolgende Lohnsenkungen hoffen? Das Gefühl der vergleichsweisen Benachteiligung (relative Deprivation) gegenüber anderen Gruppen mag Lohn- und Preissenkungen ebenso verhindern, wie es die in der Praxis durchaus üblichen mittelfristigen Lohn- und Preisvereinbarungen sind. Auch in dieser Hinsicht weist der Markt ein Koordinationsversagen auf. Schließlich, selbst wenn es gelänge, Löhne und Preise stark zu senken, wäre dann nicht eben diese scharfe Deflation von den WirtschaftsteilnehmerInnen allein aus ihrer praktischen Erfahrung ein Zeichen für die Ernsthaftigkeit der Problemsituation – und in einer schweren Krise wird kaum jemand viel ausgeben, sondern vorsichtshalber vorerst einmal mehr sparen als gewöhnlich. Und dieses Vorsichtssparen verschärft die Krise. Alle oder zumindest die meisten WirtschaftsteilnehmerInnen könnten sich allesamt selber aus dem konjunkturellen "Sumpf" ziehen, wie Münchhausen sich mitsamt seinem Pferd an seinem eigenen Haarzopf aus dem Sumpf gezogen haben soll. Die Wirtschaft könnte sich – unter günstigen Voraussetzungen – ebenso selbst stabilisieren. Doch wird sie das tun – selten oder häufig – rasch oder erst nach längerer Krise? 32 Wird dabei der Staat die Konjunktur sogar noch verstärken, wenn die (egoistische) Regierung, nachdem sie ins Amt gewählt worden ist, eine Sparpolitik (restriktive fiskalische Nachfragepolitik) betreiben, um das Budget zu verbessern und dann, Jahre später, vor der nächsten Wahl, wenn sich die Konjunktur endlich erholt hat, mit guten Wirtschafts- und Budgetdaten nochmals gewählt zu werden, denn die WählerInnen sind wohl myopisch (kurzsichtig)? Wir sprechen von Politzyklen (politisch, durch Wahlen bestimmten oder verstärkten Konjunkturzyklen). So gibt es zwei Gruppen von ÖkonomInnen, deren eine – die liberale – einer effektiven Selbststabilisierung der Wirtschaft innerhalb einer vernünftigen, zumindest tolerierbar kurzen Zeit anhängt und jeden Versuch des Staates einzugreifen an dessen Egoismus oder Unfähigkeit scheitern sieht, und deren andere – die kommunitaristische, interventionistische Gruppe –, die vom Gegenteil überzeugt ist. 4.2. Ein kurzer Blick auf das Wachstum Der Wachstumsaspekt betrachtet die lange Frist: die Entwicklung über zumindest ein oder mehrere Jahrzehnte. Die traditionelle Wachstumstheorie schenkt daher den kurz- bis mittelfristigen Problemen (Auslastungs- und Stabilitätsprobleme) kein Augenmerk. Vielmehr liegen in der langfristigen Perspektive das Problem und die Herausforderung darin, dass angesichts begrenzter Ressourcen ein permanentes, nachhaltiges Wachstum möglich ist bzw. möglich gemacht wird. Somit sind es zunächst einmal das Wachstum der Bevölkerung und das Wachstum des Kapitalstocks (der Produktionskapazitäten), welche für das Wachstum von Produktion und Einkommen verantwortlich erscheinen. Doch die äußerst ungleiche Verteilung der natürlichen und ökonomischen Lebens- und Überlebensbedingungen lässt es notwendig erscheinen, die Bevölkerungsentwicklung in den armen, benachteiligten Ländern zu bremsen und in den reichen Ländern zu fördern – sofern internationale Migration aus nationalistischen oder Verteilungsgründen unterbunden oder zumindest gering gehalten wird. Zum anderen ist Wachstum kein Selbstzweck, sondern soll Wohlstand bringen. Dabei ist ein mehr oder minder geeigneter Wohlstandsindikator das reale (also in mit dem Einkommen kaufbaren Gütern ausgedrückte) Produktions- und Einkommensniveau pro Kopf der Bevölkerung. Daher müssen wir die langfristige Entwicklung dieser Pro-Kopf-Größe untersuchen. Dabei geht man davon aus, dass die Arbeitsproduktivität (Output pro Arbeitseinheit) mit wachendem Arbeitseinsatz (also mit wachsender Bevölkerung) abnimmt und so das Wachstum verlangsamt wird. Mit Kapitalwachstum und Kapitalproduktivität verhält es sich ebenso. Je mehr Kapital eingesetzt wird, um mehr produzieren zu können, desto weniger Output kann pro Kapitaleinheit nur mehr erzeugt werden. Folglich muss, um eine konstante Wachstumsrate der Wirtschaft (d.h. von Produktion und Einkommen) aufrecht erhalten zu können, ein überproportionales Wachstum des Kapitalstocks und somit der Anlageninvestitionen geschafft werden. Doch, zumal langfristig das Problem der Ressourcenknappheit überwiegt, muss die erforderliche rasante Investitionsentwicklung auch finanziert werden können. Das setzt wiederum voraus, dass ein immer größerer Anteil des Einkommen nicht konsumiert werden darf, sondern gespart werden muss, so dass der Konsumanteil 33 am Einkommen tendenziell abnimmt und letztlich an eine Grenze stößt, nämlich dann, wenn die Leute nicht mehr bereit sind, immer mehr zu sparen, also immer weniger zu konsumieren. Als Konsequenz ergibt sich, dass es der produktivitätssteigende und umweltschonende Verfahrens- und Produkt-Fortschritt ist, der das Problem der Ressourcenknappheit und die Herausforderung eines ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Wachstums allein lösen kann. Daher haben in diesem Sinn Bildungspolitik, Forschungs- und Entwicklungspolitik, Umwelt- und Ressourcenpolitik sowie Industriestruktur- und Infrastruktur-Politik auf lange Sicht eine zentrale Bedeutung. Diese Langfristigkeit bedeutet aber nicht, dass Gesellschaft und PolitikerInnen sich bei den entsprechenden Politiken Zeit lassen und wirksame Maßnahmen stets in die Zukunft verschieben könnten. Vielmehr brauchen wachstumspolitische Maßnahmen lange Zeit, um sich auswirken zu können. Daher besteht die Kunst der Politik darin, langfristige Entwicklungstrends einigermaßen richtig abzuschätzen (Problemprognose und Wirkungsprognose der Lösungsmaßnahmen) und die erforderlichen Maßnahmen effizient zu gestalten und rasch zu beginnen. Unterstützend kann und soll sich dabei auch die Einflussnahme auf die beiden anderen Wachstumskomponenten – Bevölkerungs- und Kapitalwachstum – auswirken. Eine offenere Migrationspolitik lässt das vorhandene und wachsende Arbeitskräftepotenzial besser nutzbar machen. Weiter lässt eine Vollbeschäftigungspolitik (Vollauslastung des Arbeitskräfte- und Produktionspotenzials durch Nachfragesteuerung) in der kurzen Frist jeweils höhere Einkommen entstehen, aus denen dann leichter die langfristig entscheidenden Investitionen finanziert werden können und wollen. 4.3. Staat und Wirtschaft (Anschauungen über Wirtschaftspolitik) Ökonomie ist eine politische Disziplin. Das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft, aus ökonomischer Sicht insbesondere die Frage, ob, wie viel und welche Wirtschaftspolitik betrieben werden soll (normative Ökonomie), ist stark werturteilsbehaftet und oft ideologisch mitgeprägt. Damit erlangt die neue politische Ökonomie, die relativ wertfrei erklärt, wie es in der Praxis zu den beobachteten Politikmaßnahmen kommt (positive Ökonomie), ebensolche Bedeutung. Und der Kreis schließt sich wieder, wenn erwogen wird, welche institutionelle Regelungen getroffen und welche politisch-ökonomischen Grundprinzipien aufgestellt und befolgt werden sollen (normative Ökonomie), weil die Praxis, wie die positive Ökonomie sagt, unerquicklich weit von den normativen politischen Vorstellungen entfernt ist. 4.3.1. Klassischer Ökonomischer Liberalismus Der Klassische ökonomische Liberalismus (Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill u.a.) suchten Befreiung von staatlichen Zwängen, welche die Produktivitätsentwicklung und das Einkommenswachstum behinderten (staatlicher Merkantilismus). Dabei waren neben der Zulassung der größtmöglichen individuellen Freiheit auf den Märkten und der Schaffung einer möglichst großen Freiheit vom Steuerdruck immerhin nicht die (produktivitätsmindernde) Anarchie, sondern die staatliche Gewährleistung der Eigentumsrechte und Durchsetzung der Vertragstreue sowie öffentliche Infrastrukturpolitik (Standortpolitik) zentrale Forderungen. Die Behandlung der Sozialen Frage war auf eine knapp bemessene Armenfürsorge aus rein karitativen (feigenblattartigen) Motiven 34 beschränkt. Leistung sollte das Gerechtigkeitsprinzip, Wettbewerb der Leistungsanreiz sein, und die Freiheit und kreative Entfaltung auf den Märkten sollte in ihrem effizienten Ergebnis soziale Harmonie bringen. 4.3.2. Keynesianismus und Marxismus Der Marxismus und der Keynesianismus (John Maynard Keynes: 1883-1946) wiesen auf die Problematik einer meist unzureichenden aggregierten, effektiven Nachfrage und der damit verbundenen Beschäftigungs- und Einkommensproblematik hin. Laut Keynes sollte der Staat mittels Budgetpolitik (Fiskalpolitik), unterstützt durch Geldpolitik, antizyklische Nachfragepolitik (Demand Management) betreiben, also die nachfragebestimmten Konjunkturprobleme aktivistisch ausgleichen. In der Praxis ist keynesianische Konjunkturpolitik aber oft asymmetrisch, weil die Budgetexpansionen (Deficit Spending) in schwachen Konjunkturlagen vielfach größer ausfallen als die Budgetkonsolidierungen in starken Konjunkturzeiten. Eine wirkliche Vollbeschäftigungspolitik wurde aber trotz aller Asymmetrie meist gar nicht lang genug durchgehalten, scheiterte sie mittel- bis langfristig an steigender Inflation, Staatsverschuldung und Nachfrageabflüssen ins Ausland. Manche meinen, dass die als oft zu expansiv kritisierte staatliche Nachfragepolitik meist sogar noch zu wenig expansiv war, um Vollbeschäftigung zu erreichen und abzusichern (die Wirtschaftsentwicklung selbsttragend zu machen). Marx wollte das Problem der Krisenanfälligkeit der Wirtschaftsentwicklung (Ursache sollten die ungleichen Verteilungsverhältnisse sein) durch ein Gemeineigentum an Produktionsmitteln lösen (Politische Ökonomie). 4.3.3. Volkswirtschaftliche Rahmenplanung Im Westeuropa der 50er- und frühen 60er-Jahre war der Gedanke der volkswirtschaftlichen Rahmenplanung (z.B. die planification francaise), einer indikativen (d.h. nicht verbindlichen) zentralen Planung wichtiger gesamtwirtschaftlicher Aggregate (z.B. Investitionen) nicht verpönt, sondern zunächst ein Renner. Allerdings war diese Art der Zentralplanung einerseits zu wenig verbindlich und somit wenig erfolgreich, andererseits aber schon kaum mehr vereinbar mit einer freien Gesellschaftsordnung (z.B. in Österreich wurde 1957 das Wirtschaftsdirektorium, eine Planungsbehörde, als nicht verfassungsmäßig aufgehoben). 4.3.4. Monetarismus In den 60er-Jahren eroberten – quasi als Gegenrevolution gegen den Keynsianismus – die MonetaristInnen die wirtschaftstheoretische und wirtschaftspolitische Bühne. Der Monetarismus baut auf der Quantitätsgleichung des Geldes auf: Die im Umlauf befindliche Geldmenge (G) muss so oft verwendet worden sein (nämlich U mal, wobei U die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist), dass die gemessene Quantität an Gütern (Q) erzeugt werden und zum Preisniveau (P) verkauft werden konnte. Also gilt: G mal U = Q mal P. Auf dieser Definitionsgleichung beruhend, wurde die Quantitätstheorie des Geldes gebildet (Irving Fisher, Milton Friedman): Die paretoeffizienten Preisverhältnisse zwischen den Gütern sorgen für die Vollauslastung der Ressourcen. Die Umlaufgeschwindigkeit ist durch die sich nur sehr langsam ändernden Zahlungsgewohnheiten und -systeme be- 35 dingt. Folglich verbleibt es noch, den Schluss zu ziehen, dass die Höhe (bzw. Zuwachsrate) der Geldmenge die Höhe des Preisniveaus (bzw. die Inflationsrate) bestimmt. Die Zentralbank brauche nur die Geldmengenentwicklung einzuschränken, und die Inflation sinke, ohne dabei – und wenn, dann höchstens nur ganz kurzfristig – der Produktion und Beschäftigung zu schaden. In vielen Fällen löste solch eine restriktive Geldpolitik aber schwere Rezessionen (Konjunkturrückgänge und -krisen) aus. 4.3.5. Neue Politische Ökonomie Die Neue Politische Ökonomie (NPÖ, mit James Buchanan, Gordon Tullock u.a.) nahm etwa gleichzeitig mit dem Monetarismus ihren Aufschwung. Beide Strömungen sind eher konservativ geprägt. Die NPÖ sieht den Staat allegorisch als ein Ungeheuer ("Leviathan-Ansatz"), das seinen Zweck in sich selbst sieht und, um seinen eigenen Zweck maximal zu erfüllen (Ideologieverwirklichung, Machtabsicherung), den Privaten (SteuerzahlerInnen) möglichst hohe Abgaben auferlegt. Oder der Staat wird als Opfer gesehen ("Laokoon-Ansatz"), das sich im politisch-ökonomischen Gestrüpp nicht von den bestimmenden Einflüssen der mächtigsten LobbyistInnen befreien kann. Beide Ansätze können wir unter dem Schlagwort "Tax and Spend" (Steuern einheben und ausgeben) zusammenfassen. 4.3.6. Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik Eine Wiederkehr des Ökonomischen Liberalismus (nämlich den Neoliberalismus) brachten die Angebotsorientierte Wirtschaftstheorie und -politik (im US-amerikanischen Anwendungszusammenhang in der Ära Reagans als Supply-side Economics oder Reaganomics bekannt geworden). Die Wirtschaft müsse nur von den staatlichen Belastungen steuerlicher Art (Steuerdruck) und administrativer Art (Arbeits-, Umwelt- und Sozialschutz) entlastet werden (Deregulierung), dann werde wieder produktiv gearbeitet, weil viel verdient werden kann und wenig weggesteuert wird, und so tendiere die Wirtschaft zu hohem Wachstum bei Vollbeschäftigung. Arthur Laffer, ein ökonomischer Berater Reagans, meinte doch, durch Senkungen des Steuersatzes auf Arbeits- und Kapitaleinkommen könne die Steuersumme sogar erhöht werden, weil die Leute mehr Anreiz bekämen viel zu arbeiten, zu verdienen (Say's Gesetz!) und zu sparen, aber auch, weil, steuerlich entlastet, weit weniger an Steuern zu hinterziehen. Aber dieser "Laffer-Effekt" blieb aus; dennoch machte und macht die Welt diese Wirtschaftspolitik den USA nach – bis heute. 4.3.7. Neue Klassische Makroökonomie Jüngste Entwicklung ist die Neue Klassische Makroökonomie. Sie umfasst verschiedene Ansätze, die erklären wollen, dass staatliche Nachfragepolitik zumeist völlig unwirksam ist: Die Theorie der rationalen Erwartungen (Robert Lucas) besagt, dass die WirtschaftsteilnehmerInnen genau wissen, dass sich infolge staatlicher Nachfragesteuerung lediglich das Preisniveau ändert und dass die ArbeitnehmerInnen und ProduzentInnen daher gar nicht auf staatliches Demand Management reagieren (Politikunwirksamkeits-Hypothese). Das bedeutet aber auch, dass restrikti- 36 ve Wirtschaftspolitik das Preisniveau bzw. die Inflation senken kann, ohne dass Produktion, Einkommen und Beschäftigung darunter leiden. Das Barro/Ricardo-Äquivalenztheorem argumentiert hingegen, dass Steueränderungen keine Änderung in der aggregierten Nachfrage (gesamten Güternachfrage) bewirken, weil bei niedrigeren Steuern die SteuerzahlerInnen steigende Budgetdefizite und künftige Steuererhöhungen erwarten, so dass sie aus Sorge um ihre Kinder mehr sparen (weniger konsumieren) und so den Nachfrageimpuls der Steuersenkung neutralisieren. Und schließlich haben einige der Neuen Klassischen MakroökonomInnen (King, Plosser, Kydland, Prescott u.a.) Theorien der realen Konjunkturzyklen (Real Business Cycle Models) entwickelt, die auf Folgendes hinaus laufen. Die schwankenden Wirtschaftsentwicklungen, die immer wieder beobachtet werden, seien kein Zeichen für die Instabilität der Wirtschaft, sondern sogar ein Hinweis auf die effiziente Selbststabilisierung der Wirtschaft! Denn die Schocks (Impulse), die die Wirtschaft immer wieder treffen, seien eigentlich keine Nachfrageschocks, sondern Angebotsschocks (Produktivitäts- und Strukturschocks), die zwingend zu anderen Gleichgewichtseinkommen führen. Und die Anpassung der Wirtschaft an diese neuen, durch staatliche Nachfragepolitik nicht änderbaren Gleichgewichtseinkommen erscheint bloß als Marktversagen, ist es aber nicht, sondern zeugt vielmehr die Leistungsfähigkeit der Märkte, immer wieder rasch ins Gleichgewicht zu kommen. 4.3.8. Post-Keynesianismus Dem setzen die Post-KeynesianerInnen (ein Zweig der NachfolgerInnen von Keynes) entgegen, dass selbst strukturelle Schocks in ihren Auswirkungen auf Einkommen und Beschäftigung gemildert kompensiert oder gar weitgehend vermieden werden können, wenn der Staat nur lange genug expansive Nachfragepolitik betreibt und solcherart die Wirtschaftsentwicklung auf einem möglichst hohen Niveau stabilisiert (letztlich selbsttragend macht: Hysterese-Theorie). *** 5. Schlussbemerkung Zurückkommend auf den Anfang des Skriptums: Es gibt in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften keine Beweise, nur logische Argumente und empirische Anhaltspunkte für oder gegen deren Gültigkeit. Viel hängt von der subjektiven Vorstellung vom Funktionieren der Wirtschaft und somit vom Wirken oder Nichtwirken der Wirtschaftspolitik ab. Legen Sie sich also Ihre Argumente zurecht, treffen Sie Ihre Wahl und glauben Sie nicht ungeschaut, was man Ihnen (oft unter dem Deckmantel irgendeiner Autorität) weismachen will. Hoffentlich haben Sie gelernt, mit ÖkonomInnen und ihrer charakteristischen Denkweise zumindest ein wenig besser zurecht zu kommen und mit ihnen leidlich argumentieren zu können. Und vielleicht haben Sie auch das eine oder andere Interessante kennen gelernt. Jedenfalls sollten Sie keine Scheu (mehr) vor der Ökonomie haben. Sie betrifft uns, und die von uns mitbestimmte Politik betrifft die Ökonomie. 37