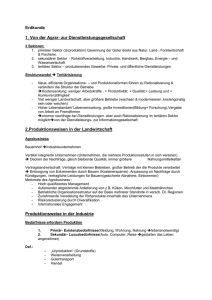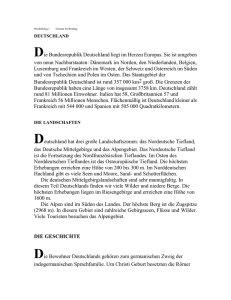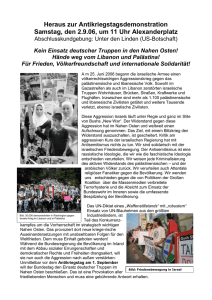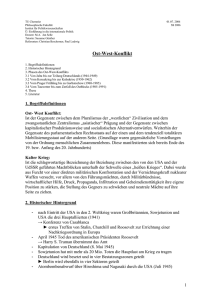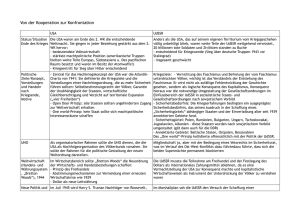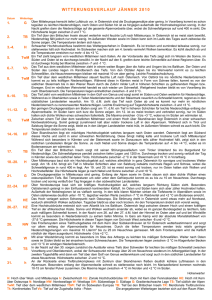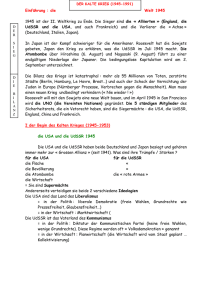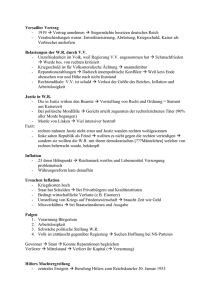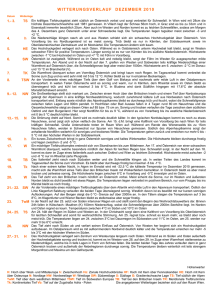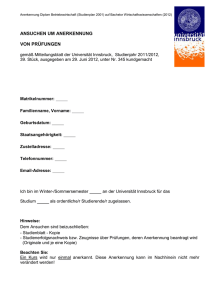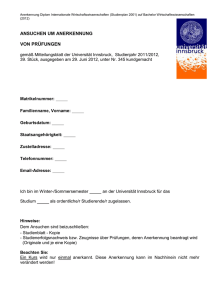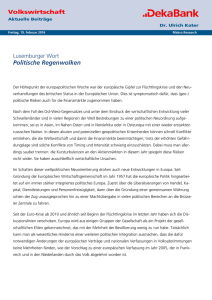Vorschläge des Arbeitswissenschaftlichen
Werbung

Michael Hepp „Die Durchdringung des Ostens in Rohstoff- und Landwirtschaft“ Vorschläge des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der Deutschen Arbeitsfront zur Ausbeutung der UdSSR aus dem Jahr 1941 Aus: 1999, Heft 4, S. 96 – 134 (1987) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seite 1-5: Einführung von M. Hepp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seite 6-20: Abdruck des Dokuments des AWI der DAF vom 17. November 1941 Postanschrift AWI: Berlin W9, Leipziger Platz 14.Quellen: - Amtliches Fernsprechbuch für den Bezirk der Reichspostdirektion Berlin / hrsg. v. der Reichspostdirektion Berlin; S. 935, 3. Spalte; Ausg.: Juni 1941, Stand: 1. Februar 1941 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Arbeitswissenschaftliche Institut der Deutschen Arbeitsfront (AWI) wurde 1935 gegründet und entwickelte sich rasch zu einem der wichtigsten sozialpolitischen Planungszentren des „Dritten Reiches“. Es sollte die umfangreichen Akten- und Bibliotheksbestände der im Mai 1933 zerschlagenen Gewerkschaften aufarbeiten und für die Zwecke der Deutschen Arbeitsfront (DAF) und des Sicherheitsdienstes (SD) benutzbar machen. Zum anderen sollte das Institut den Dienststellen der Deutschen Arbeitsfront konkrete Planungsdaten und Konzepte für ihre vielfältigen Aufgaben erarbeiten. Darüber hinaus fertigte es für Dienststellen der NSDAP und einzelne Ministerien Gutachten zu den verschiedensten Problemen und Fragestellungen. Die Bandbreite reichte von den klassischen Themen der Arbeitswissenschaft wie Lohn-. und Preispolitik, Arbeitszeit, Berufserziehung, Rationalisierung über sozialpolitische Fragen wie Nahrungsmittelversorgung, Beobachtung der Sozialpolitik des Auslands, Freizeitgestaltung, bis hin zu kolonialpolitischen Planungen für Afrika und die eroberten „Ostgebiete“. Durch die „Statistische Zentralstelle des AWI“ wurden laufend Betriebserhebungen durchgeführt, Lohn- und Preisstatistiken sowie Unfallstatistiken erstellt, die Wirtschaftslage beobachtet und die statistischen Grundlagen für die Denkschriften und Gutachten des AWI erarbeitet. Die Klammer dieser weitgesteckten Aufgaben war die weltanschauliche Ausrichtung der Forschung. Sozialpolitische Reformkonzepte verbanden sich mit dem Ziel, die Effizienz des nationalsozialistischen Unterdrückungssystems zu steigern. So sollte das AWI zum Beispiel Vorschläge zur Stabilisierung der "Heimatfront“ im „totalen Krieg“ entwickeln, Modelle zur „Leistungssteigerung“ von ausländischen Zwangsarbeitern erarbeiten, Rationalisierungsmöglichkeiten in der industriellen Produktion – speziell unter den Voraussetzungen der Kriegsplanungen – aufzeigen, gleichzeitig aber auch Kompensationsangebote zum Ausgleich steigender Leistungsanforderungen entwickeln. Großangelegte sozialtechnische Konzepte wie „Reichslohnordnung“, einheitliche „Altersversorgung des deutschen Volkes“ mit einer Mindestrente, „Wohnungsbauprogramm“, „Gesundheitswerk“ usw. sollten den Arbeiter für den nazistischen Staat gewinnen und dem latenten Widerstand entziehen. Im Verlauf der Radikalisierung der nationalsozialistischen Expansionspolitik bekam das AWI eine weitere Aufgabe zugewiesen. Es erstellte für SS, Verwaltung und Wehrmacht umfangreiche soziologische und wirtschaftspolitische Untersuchungen über die okkupierten Länder und machte Vorschläge zu ihrer Ausbeutung. So wurde zum Beispiel nach dem Einmarsch in Österreich 1938 eine eigene Außenstelle des AWI in Wien eingerichtet, um die wirtschafts- und sozialpolitische „Gleichschaltung“ anhand von aktuellen Planungsdaten möglichst rasch und reibungslos durchführen zu können. Führende Mitarbeiter der Berliner Zentrale wurden zeitweise für spezielle Aufgaben nach Wien geschickt. In großangelegten Untersuchungen wurde zum Beispiel das Lohn-Preis-Verhältnis durchgeleuchtet. Vergleiche der Arbeitsleistung von Arbeitern im „Altreich und der Ostmark“ folgten. Spezielle Betriebsuntersuchungen schlossen sich an, Wirtschaftskarten wurden angefertigt, Miet- und Wohnungsprobleme aufgezeigt. Kürzlich gefundenes umfangreiches Dokumentationsmaterial macht es erstmals möglich, die Rolle der Deutschen Arbeitsfront und des AWI bei der „Eingliederung“ Österreichs genau zu rekonstruieren. Für die weitgefächerten Aufgaben rekrutierte das AWI aus sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen Institutionen wie etwa dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) usw. hochqualifizierte Mitarbeiter. Zahlreiche Wissenschaftler aus Universitäten und Institutionen konnten als freie Mitarbeiter gewonnen werden. 1935 wurden sogar Verhandlungen darüber geführt, ob das REFA-Institut nicht komplett dem AWI angegliedert werden sollte. Zu den Mitarbeitern des AWI zählen so bekannte Soziologen, Sozialpolitiker, Statistiker und Volkswirtschaftler wie Hans Peter, Wilhelm Brepohl, Albert Brengel, Heinz Rhode, Theodor Bühler, Adolf Günther, Johannes Riedel, Friedrich Sitzler, Heinrich von Stackelberg oder Werner Ziegenfuß. Aber auch einige ehemalige ADGB (Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund)-Sekretäre wie Clemens Nörpel oder Kurt Gusko arbeiteten im AWI an den nationalsozialistischen Unterdrückungsplänen mit. Bisher konnten rund 200 Mitarbeiter identifiziert werden. Nach dem Organisationsplan von 1940 (Friedensplanung)1 war das AWI allerdings wesentlich größer. 560 Planstellen waren vom Leiter des Instituts, Wolfgang Pohl, beantragt worden. Davon entfielen etwa zwei Drittel auf das wissenschaftliche Personal. Dementsprechend umfangreich war auch 1940/41, in denen sich das AWI als das bedeutendste arbeits- und sozialpolitische Planungszentrum für die nazistische „Neuordnung“ Europas profilierte und in zahlreichen Denkschriften und soziologischen Untersuchungen die Bedingungen einer optimalen Einverleibung analysierte. Seit dem Sommer 1939 beschäftigte sich das AWI in zahlreichen Denkschriften und Untersuchungen mit der UdSSR. Der Hitler/Stalin-Pakt vom August 1939 sah neben den territorialen Absprachen auch eine Intensivierung des Warenaustauschs vor, besonders im Bereich der landwirtschaftlichen Produkte und der Rohstoffe wie Erz, Erdöl usw. Damit rückt die Sowjetunion verstärkt in das Blickfeld wirtschaftlicher Planungen. Voraussetzung dafür waren aber möglichst genaue Daten über die „wirtschaftlichen Möglichkeiten der Sowjetunion“, über ihre geographische Struktur usw. bis hin zu sozialpolitischen Datensammlungen. Gleichzeitig erfüllen die umfangreichen AWI-Denkschriften auch weitgehend die Forderungen von General Thomas, Chef des Wehrwirtschafts- und Rüstungsamts des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW). Für seine Planungen gegen „potentielle Kriegsgegner“ benötigte er Angaben über: „a) industrielle Leistungsfähigkeit, insbesondere der Rüstungsindustrie, d.h. die Fertigung von Kriegsgerät unter Berücksichtigung von Engpässen, industriellen Zusammenballungen, Grenznähe usw. b) Rohstoff- und Energieversorgung, und zwar vorhandene Rohstoffquellen wie auch fehlende Rohstoffe, und damit in Abhängigkeit der Rüstungsindustrie von kontinentalen oder überseeischen Importen, c) Arbeitseinsatzlage und ihre voraussichtliche Veränderlichkeit im Kriege, d) Ernährungslage e) Finanzlage und Finanzkraft eines Landes und seine eventuelle Abhängigkeit von Verbündeten, f) Außenhandel, g) Verkehrsverhältnisse im Land und über die Grenzen, h) Hafenanlagen, Umschlagseinrichtungen und deren Verlagerungsvermögen, i) soziale Verhältnisse, k) Versorgungseinrichtungen.“2 Knapp zwei Jahre später- am 22. Juni 1941 überfiel die Wehrmacht mit über drei Millionen Soldaten die Sowjetunion – machte das AWI dann konkrete Vorschläge zur Ausbeutung und Einverleibung der eroberten Gebiete. Noch im Mai 1941 erschienen umfangreiche Beiträge zur sowjetischen Sozialpolitik, im Juni folgten drei Arbeiten mit Karten und Angaben über die wirtschaftsgeographische Struktur der UdSSR. Im Dezember 1941 legten die Autoren des AWI dann drei Denkschriften vor, in denen Umfang und Ausmaß der geplanten deutschen Plünderungspolitik konkret beschrieben sind. Die beiden ersten Arbeiten „Raum formt Sozialpolitik“ und „Erwägung zur Nutzung der eroberten Gebiete durch das deutsche Volk“ verstehen sich als allgemeiner Überblick über die Probleme, die die Unterwerfung eines so riesigen Gebietes aufwarf. Die dritte Denkschrift „Die Durchdringung des Ostens in Rohstoff- und Landwirtschaft“ (Dokument) zeigt dagegen bereits erste konkrete Möglichkeiten und Berechnungen zur „Ausbeutung“ auf. Sie wurde ein Jahr später wesentlich erweitert und modifiziert und unter dem Titel „Die Erschließung der Rohstoff- und Landwirtschaft des Ostens“ erneut publiziert. Da der Umfang von 70 Seiten jedoch den Rahmen dieses Heftes sprengen würde, dokumentieren wir die erste Fassung vom Dezember 1941. Die drei Denkschriften müssen vor dem Hintergrund der deutschen Großmachtpläne seit dem Ersten Weltkrieg gesehen werden. Bereits 1914/15 wurde in zahlreichen Denkschriften die Forderung aufgestellt, den „europäischen“ Teil Rußlands dem Deutschen Reich einzuverleiben, um mit „einem Schlage ein mächtiges deutsches Land“ zu bekommen.3 Auch damals waren die wirtschaftlichen Interessen – Rohstoffe und landwirtschaftliche 1 2 Georg Thomas, Geschichte der deutschen Wehr- und Rüstungswirtschaft, hg. von Wolfgang Birkenfeld, Boppard/Rhein 1996, S. 113. Auszugsweise ist die Arbeit von Thomas auch als Nürnberger Dokument PS 2353 in IMT, Bd. 30 veröffentlicht. 3 Paul Rohrbach, Rußland und wir, Berlin 1915. Weitere Denkschriften stammten u.a. von Thyssen, Erzberger, Stresemann, Krupp, Stinnes, Kirdorf. Siehe dazu: Werner Basler, Die Politik des deutschen Imperialismus gegenüber Litauen 1914-1918, in: Jahrbuch für die Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Länder Europas, Bd. 4, Berlin 1960, S. 235 f. Erzeugung – ausschlaggebend. Wie weit die territorialen Minimalforderungen gesteckt waren, kann man dem „Friedensvertrag“ von Brest-Litowsk entnehmen. Nach dem verlorengegangenen Weltkrieg gingen die Bemühungen weiter, sich den russischen Reichtum an Rohstoffen zunutze zu machen und die eigenen Absatzgebiete zu erweitern. Zu diesem Zweck wurde der Rußland-Ausschuß der deutschen Wirtschaft – unter Federführung des Reichsverbandes der deutschen Industrie – gegründet. Mitglieder waren u.a. Siemens, AEG, Gutehoffnungshütte, Krupp, Otto Wolf und die führenden Großbanken. Während des „Dritten Reiches“ wurde dieser Rußland-Ausschuß zur Speerspitze erneuerter Annexionsplanungen. Er löste sich am 30. September 1941 auf, als Industrie und Hochfinanz sich durch die deutschen Eroberungen am Ziel ihrer Wünsche sahen. Das Sprachrohr des Ausschußes erschien allerdings weiter, um „über die Wirtschaftslage, die Wirtschaftsentwicklung und den Wirtschaftsaufbau in den besetzten Ostgebieten und den Restgebieten (sic!) der Sowjetunion ...“ zu berichten.4 Neben dem Rußland-Ausschuß gab es noch eine ganze Reihe von Institutionen, die sich teilweise lange vor dem Überfall auf die Sowjetunion mit Planungen für die Ausraubung Rußlands beschäftigten. Neben der SS mit ihrem „Generalplan Ost“5 ist hier besonders der spätere „Reichsminister für die besetzten Ostgebiete“, Alfred Rosenberg, zu nennen. Erste größere Ausarbeitungen aus dem Aktivitätsbereich Rosenbergs sind bereits aus dem April 1941 „über die Ziele und Methoden einer künftigen deutschen Besetzung weiter Teile der Sowjetunion“ bekannt.6 Grundtenor dabei war, „durch Ansiedlung rassisch möglicher Elemente dieses Gebiet (Estland, Lettland, Litauen und Belorußland, von den Nazis als „Weißruthenien“ bezeichnet, M.H.) zu einem Teil des Großdeutschen Reiches umzuwandeln“.7 In personellen Bedarfsplanungen vom 28. Juni 1941, also kurz nach dem deutschen Überfall, wurde bereits das gesamte Gebiet bis zum Ural einbezogen. Rosenberg forderte zur Verwaltung dieses riesigen Gebiets vier „Reichskommissare“, 24 „Generalkommissare“, 80 „Hauptkommissare“ und mehr als 900 „Gebietskommissare“.8 Als Rosenberg zum „Reichsminister“ ernannt wurde, schrieb er in sein Tagebuch: „Der Führer schenkt mir heute einen Kontinent.“ Daß es sich bei den Planungen nicht nur um wirtschaftliche Raubzüge handelte, zeigt deutlich ein Leitartikel mit der Überschrift „Germanisieren?“ in der SS-Zeitschrift „Das Schwarze Korps“: „Unsere Aufgabe ist es, den Osten nicht im alten Sinne zu germanisieren, das heißt dort vorhandene Menschen deutsche Sprache und deutsche Sitten beizubringen, sondern dafür zu sorgen, daß im Osten nur Menschen wirklichen deutschen, germanischen Blutes wohnen.“9 Ähnliche Vorstellungen finden sich auch in den Denkschriften des AWI. Trotzdem war erstes und oberstes Ziel, „Erdöl und landwirtschaftliche Produkte zu erbeuten... In diesen beiden wichtigen Punkten war das Wirtschaftspotential des europäischen Kontinents, so weit es bisher dem deutschen Imperialismus für seinen Krieg zur Verfügung stand, am schwächsten. Das Öl sollte vorwiegend zur unmittelbaren Kriegführung über Kontinente und - wie auf längere Sicht geplant – Ozeane dienen. Mit den Lebensmitteln sollte die Wehrmacht ernährt und die deutsche Zivilbevölkerung von Mangel und damit Unzufriedenheit und Kriegsunlust ferngehalten werden.“10 Gemeinsamer Konsenz und Grundlage für alle Planungen war das Ergebnis einer Besprechung Hitlers mit Rosenberg, Lammers, Göring und Keitel am 16. Juli 1941: „Grundsätzlich kommt es also darauf an, den riesenhaften Kuchen handgerecht zu zerlegen, damit wir ihn erstens beherrschen, zweitens verwalten und drittens ausbeuten können.“11 In seinen „Richtlinien für die Führung der Wirtschaft“ stellte Göring deshalb die Forderung, „alle Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um die sofortige und höchstmögliche Ausnutzung der besetzten Gebiete zugunsten Deutschlands herbeizuführen. Dagegen sind alle Maßnahmen zu unterlassen oder zurückzustellen, die dieses Ziel gefährden könnten“.12 4 Die Ostwirtschaft, Jg. 1942, Heft 1. Siehe dazu auch die Arbeit von Roswitha Czollek (vgl. Anm. 8). Siehe dazu: Erster „Generalplan Ost“ (April/Mai 1940) von Konrad Meyer in: Mitteilungen der Dokumentationsstelle zur NS-Sozialpolitik, hg. von der Dokumentationsstelle zur NS-Sozialpolitik in Hamburg, (1) 1985, Heft 4, Seite 45 ff. 6 IMT, Bd 26, S. 547-554. Dok. PS 1017. Rosenberg wurde im April 1941 zum „Beauftragten für die zentrale Bearbeitung der Frage des osteuropäischen Raumes“ ernannt. 7 Ebenda, S. 573 ff.: Instruktion für einen Reichskommissar im Ostland“. Dok PS 1029 8 Roswitha Czollek, Faschismus und Okkupation. Wirtschaftspolitische Zielsetzungen und Praxis des faschistischen Besatzungsregimes in den baltischen Sowjetrepubliken während des Zweiten Weltkrieges. Berlin (DDR) 1974, S. 46. Das Buch gibt einen detailreichen Überblick über die verschiedenen Planungen seit dem Ersten Weltkrieg, dem der Verfasser wertvolle Hinweise entnahm. 9 Das Schwarze Korps, 20. August 1942. 10 Diedrich Eichholtz, Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft, Bd. I, Berlin (DDR) 1969, S. 209. 11 IMT, Bd. 38, Dok. 221-L, S. 86 ff. 12 Der Reichsmarshall des Großdeutschen Reiches (Hg.), Richtlinien für die Führung der Wirtschaft, Teil I, Berlin 1941, S. (Hervorhebung im Original) 5 In diesem Gesamtzusammenhang müssen auch die Denkschriften des Arbeitswissenschaftlichen Instituts gesehen werden. Im Gegensatz zu den Planungen Rosenbergs stellten die Arbeiten des AWI nüchterne sozialwissenschaftliche Methoden dar, um bei der geplanten Ausbeutung der eroberten Gebiete möglichst Widerstand seitens der unterdrückten Bevölkerung und damit politische Reibungsverluste zu vermeiden. Die Denkschriften gehen von einem Stufenplan aus, nach dem der europäische Teil der UdSSR, einschließlich des „Ural Industriegebiets“, Schritt für Schritt unter deutsche Kontrolle gebracht und – als Endziel – über weite Teile auch von Deutschen besiedelt werden sollte. Konsenz war, daß die „kulturell und geistig unterlegenen“ Russen zu Sklavenarbeitern degradiert werden sollten. In der Denkschrift „Raum formt Sozialpolitik“ wird sogar davon ausgegangen, daß bei der schrittweisen Kolonialisierung nur noch „Reste der ... Ostbevölkerung“ überleben sollten.13 Voraussetzung war für das AWI, daß die „bisher von den Eingliederungs- und Anschlußfachleuten gehandhabte Methoden“ aufgegeben und völlig neue Konzepte erarbeitet wurden. Den puren Ausbeutungsanforderungen hielt das AWI entgegen: „Die einfache Angliederung der neuen Gebiete an das Reich würde ... zwar der industriellen Wirtschaft einen nicht unwillkommenes Menschenreservoir erschließen, damit aber gleichzeitig eine volkspolitische Entwicklung in die Wege leiten, die der politischen Ordnungsaufgabe des europäischen Raumes völlig entgegengesetzt ist.“14 Hier näherten sich die AWI-Autoren deutlich den Germanisierungsbestrebungen der SS. Um die „Europäisierung“ des Ostens durchführen zu können, bedarf es nach Ansicht der Planer sozialer Anreize, um genügend Menschen in die eroberten Gebiete zu bekommen. Abgesehen davon, daß der Lebensstandard der im Land belassenen Russen auf maximal 60 Prozent der deutschen „Einwanderer“ bestimmt wurde, sollte der Umzug „mit einem unmittelbar fühlbaren sozialen Aufstieg verbunden sein“.15 Also vom Arbeiter im „Altreich“ zum Vorarbeiter in den eroberten Gebieten, oder vom Vorarbeiter zum Werksleiter. Dabei sollte die Qualifikation hinter den Primat der Politik zurückstehen: „Man wird sich daran gewöhnen müssen, in dem gegenüber dem alten Gebiet unendlich angewachsenen neuen Reichsraum (sic!) auch die Befähigungsnachweise bei der Besetzung der Arbeitsplätze mit anderen Maßstäben zu messen.“16 In der Denkschrift von 1943 „Die Erschließung der Rohstoff- und Landwirtschaft des Ostens“ wird dieser Punkt konkretisiert: „Aus naheliegenden politischen Gründen kommen für den sofortigen Einsatz als Siedler im Osten nach dem Krieg vor allem politische Aktivisten und ehemalige Angehörige der Wehrmacht in Frage, während der Gesichtspunkt der charakterlich bedingten Bodenständigkeit, der berufliche Qualität und der vorhandenen bzw. zu erwarteten Kinderzahl vorläufig zurücktritt.“17 Diese Prämisse steht in eindeutigem Widerspruch zu den Ausführungen der im Anhang abgedruckten Denkschrift. Diese Modifizierung ist möglicherweise auf Anregung von SS und Partei zurückzuführen, die mehrfach die bevorzugte Landzuweisung an „verdiente Kämpfer der Bewegung“ forderten. Noch in einem anderen Punkt weicht die Arbeit von 1943 von den Denkschriften von 1941 ab. Wurde hier in der ersten Euphorie teilweise noch der Eindruck erweckt, das Gebiet bis zum Ural sollte langfristig zu einem fast ausschließlich von Deutschen bewohnten Gebiet werden, sprechen die Autoren 1943 nur noch von „Streusiedlungen in den wirtschaftlich wichtigsten Gebieten“. Als neue Komponente wird dabei allerdings die Einbeziehung von fast 10 Millionen Auslandsdeutschen eingeplant: „Hier besteht eine Reserve, die solange ausgeschöpft werden kann, bis es mit Hilfe einer zweckentsprechenden Bevölkerungspolitik, d.h. durch eine starke Zunahme der Geburten gelungen ist, einen jährlichen Überschuß für den Osten sicherzustellen.“18 Insgesamt schwebte den AWI-Planern eine „grundlegende Neuordnung“ der volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Grundlagen vor. Durch den ständigen Mangel an „Arbeitskräften und insbesondere an 13 AWI, Raum formt Sozialpolitik (Erste Gedankenskizze), Berlin Dezember 1941, S. 34 Ebenda, S. 21 15 Ebenda, S. 29 16 Ebenda, S. 31. 17 AWI, Die Erschließung der Rohstoff- und Landwirtschaft des Ostens. Problematisches und Grundsätzliches, Berlin Januar 1943, S. 9. 18 Ebenda, S. 11 14 hochqualifizierten Arbeitskräften“ ändere sich die gesamte „Arbeitsverfassung und Wirtschaftsorganisation Europas“. Zwangsläufige Folge sei eine „Mechanisierung, Rationalisierung und Technisierung des täglichen Lebens..., die das weit in den Schatten stellen (wird), was bisher etwa in Nordamerika an Ansätzen dazu gemacht worden ist“.19 Gleichzeitig sei eine „größere Disziplin“ in den Arbeitsverhältnissen erforderlich, da die „deutschen Volksgenossen“ nicht mehr „Untertanen des Reiches, sondern Träger, also Herren des Reiches“ seien. Mit den Mittelchen des Untertanenstaates“ könne der Zusammenhalt in einem derart großen Gebiet nicht aufrechterhalten werden. Im Gegensatz zu den „Herren des Reiches“ werde die „ortsansässige Bevölkerung ... zur Arbeitsleistung im Dienst der deutschen Nation verpflichtet sein, wofür sie zwar einen Lohn zum Lebensunterhalt erhält, der aber doch nur einen Teil des gesamten Arbeitsertrags ausmacht. Der übrige Teil geht in den Gesamthaushalt der deutschen Volkswirtschaft ein, an dem die Bewohner der neuen Gebiete als Nutznießer so weit beteiligt sind, als es ihnen gestattet ist, sich zum deutschen Volk zu rechnen ... Im übrigen richtet sich jede soziale Stellung und ihr Rechtsverhältnis einerseits nach den Bedürfnissen, die durch die politische Beherrschung des Raumes durch das deutsche Volk gegeben sind, andererseits nach dem Ton, der von diesen Völkern selbst den Deutschen gegenüber angeschlagen wird.“20 Die zweite grundsätzliche Denkschrift vom Dezember 1941 „Erwägungen zur Nutzung der eroberten Gebiete durch das deutsche Volk“ umfaßt nur neun Seiten. Neben einer allgemeinen Einleitung , in der aus „zwingenden politischen Gründen“ die „ausschließliche wirtschaftliche Nutzung ... der eroberten Gebiete“ vorgeschlagen wird, werden mögliche Wege hierzu aufgezeigt. Konsens dazu ist, daß die Bewohner der eroberten Gebiete „nur einen Teil ihrer Produktion selbst verbrauchen können. Der andere Teil soll dem Staatsvolk als Gegenwert für seine politische Führung vorbehalten bleiben.“ Dies „Mehrwert“-Abschöpfung könne auf verschiedenen Wegen erreicht werden. Einmal die „koloniale Ausbeutung durch auf Erwerb ausgerichtete Kapitalgesellschaften nach dem Beispiel der von Holland, Frankreich, Portugal und England seit Jahrhunderten geübten Kolonialpolitik"“ Der Nachteil sei, daß der Gewinn bei den Unternehmen bleibe. Dieser Mißstand sei dadurch zu vermeiden, daß der „Staat die koloniale Nutzung selbst in dem Kolonialgebiet auftritt, oder aber sich mindestens ein Handelsmonopol mit den Kolonialgebieten sichert“. Der einfachste Weg sei, „daß das Deutsche Reich die in der Sowjetunion vorgefundenen Staatsbetriebe und Kollektivwirtschaften für seine Rechnung betreiben läßt.“21 Als weitere Möglichkeiten werden noch die Ausbeutung über „die Lohn- und Preispolitik“ und über die Steuern aufgezeigt. Nachdem der Autor in einem zweiten Teil „Einzelfragen über den Wettbewerb zwischen der Produktion des Ostens und des Altreichs“ skizziert und Berechnungen über die Ertragsaufteilung in den Kolchosbetrieben angestellt hat, kommt er zu dem Schluß: „Auf lange Sicht ist ... die primitive Ausbeutungswirtschaft durch eine planmäßige Anpassung der Wirtschaftsstruktur an die Bedürfnisse des deutschen Volkes zu ersetzen. Erst dann ist ein wirklicher ‚Gewinn‘ des deutschen Volkes gesichert.“22 Das nachfolgend komplett abgedruckte Dokument ist offensichtlich bereits vor den beiden oben kurz skizzierten Arbeiten fertiggestellt worden. Es trägt das Datum des 17. November 1941. Diese Denkschrift stellt die ersten konkreten Planungen und Berechnungen des AWI vor. Im Gegensatz zu der Arbeit „Raum formt Sozialpolitik“ wird hier die klare Forderung aufgestellt – in deutlicher Übereinstimmung mit den Richtlinien Görings -, daß während des Kriegs die Gebiete lediglich für den „Nahrungsmittel- und Materialbedarf unseres Heeres“ auszubeuten seien. Weiterreichende Konzepte seien erst nach dem Ende des Krieges möglich. Aber auch hierfür legten die Sozialplaner der Deutschen Arbeitsfront bereits konkrete Vorschläge vor, aufgebaut auf einem Vierstufenplan. In dieser Denkschrift schließt sich auch wieder der Kreis zu den Planungen des Ersten Weltkriegs. Es sind in etwa die gleichen Gebiete, die vom AWI zur „geschlossene(n) Besiedlung“ vorgeschlagen werden, wie 1915. 19 Raum formt Sozialpolitik, a.a.O., S. 33 Ebenda. 21 AWI, Erwägung zur Nutzung der eroberten Gebiete durch das deutsche Volk, Berlin, Dezember 1941, S. 3 f. 22 Ebenda, S. 9. 20 Geheim Die Durchdringung des Ostens in Rohstoff- und Landwirtschaft Inhaltsübersicht A. Die politischen Notwendigkeiten 1. Lebensraumerweiterung und Bevölkerungsabgabe 2. Die Grundformen des Menscheneinsatzes B. Die wirtschaftlichen Probleme 1. Volkswirtschaft und Staatsraumwirtschaft 2. Raubbau oder optimale Urproduktion 3. Industrialisierung und Kontingentierung der Rohstoffe 4. Wiederaufbau und gedrosselter Lebensstandard C. Die sozialpolitischen Konsequenzen 1. in der Bauwirtschaft 2. in der Eisengewinnung 3. im Kohlebergbau 4. in der Nichteisengewinnung 5. in der Treibstoffgewinnung 6. in der Landwirtschaft 7. in der Forstwirtschaft D. Die geopolitischen Gegebenheiten Nach den Siegen im Westen 1940 und im Osten 1941 zeichnen sich ganz klar zwei große wirtschafts- und sozialpolitische Aufgaben ab: - die wirtschaftliche Durchdringung des Ostens und die Führung der europäischen Großraumwirtschaft Möglicherweise wird zu diesen beiden Aufgaben noch eine dritte treten: die Erschließung eines Teiles des afrikanischen Raumes. A. Die Politischen Notwendigkeiten 1. Die Eroberungen der weiten Gebiete im Osten ist nicht Selbstzweck, d.h. ihr Sinn liegt nicht darin, diese großen Gebiete lediglich politisch zu beherrschen und zu verwalten, sondern sie sollen den bisher zu engen Lebensraum des deutschen Volkes erweitern und für Jahrhunderte Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Dies bedeutet, deutsche Menschen in diesen Gebieten des Ostens zum Einsatz zu bringen, um sie wirtschaftlich auszuwerten. Damit ist diese Aufgabe im wesentlichen ein Problem des Menscheneinsatzes. Es ist hierzu ein gewaltiger Einsatz notwendig und die Frage liegt nahe: Wieviel Menschen stehen zur Verfügung? a. Nimmt man einmal an, daß die bisherige durchschnittliche Dichte im Deutschen Reich bestehen bleiben soll, so bedeutet dies, daß in jedem Jahr der Bevölkerungszuwachs von fast 1 Million Menschen für den Osten zur Verfügung steht. Würde das Ausmaß der Abwanderung höher sein, so bestünde die Gefahr des Rückganges der Intensität der Wirtschaft im Altreich; würde die Bevölkerungsabwanderung wesentlich darunter bleiben, so müßte dies als Versäumnis im Aufbau der neuen Gebiete des Ostens bezeichnet werden. Also ohne Schädigung des bisher im Altreich Erreichten und ohne Versäumnis der Möglichkeiten im Osten muß die Abwanderung jährlich fast 1 Million Deutsche betragen. b. Darüber hinaus aber ist zu überlegen, in welchem Umfang eine einmalige Bevölkerungsabgabe des Altreiches an den Osten möglich ist, um die riesengroßen Aufgaben im Osten mit Hochdruck beginnen zu können, d.h. mit anderen Worten: Wieviel Menschen vermag das Altreich einmalig abzugeben, ohne daß dadurch seine Wirtschafts- und Sozialstruktur gestört wird. Es soll vielmehr durch diese Abgabe eine Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen des Altreiches erreicht werden. Da außerdem die europäischen Führungsaufgaben einen nicht unerheblichen Menschenbedarf erfordern, so erscheint es unvermeidlich, daß eine umfangreiche koloniale Betätigung des deutschen Volkes in Afrika die Durchführung der Ostaufgaben, denen aus naheliegenden politischen Gründen unbedingt der Vorrang gebührt, ungünstig beeinflussen müßte. 2. Aus den politischen Notwendigkeiten der zu bewältigenden Aufgaben, die zeitlich und gebietlich unterschiedlichen Charakter tragen, ergeben sich grundverschiedene Formen des Einsatzes des deutschen Menschen: a. Solange der Krieg währt, handelt es sich in erster Linie darum, in den Ostgebieten das wirtschaftliche und soziale Leben so weit in Gang zu bringen, daß dadurch die Nahrungsmittel- und Materialbedarf unseres Heeres im besetzten Gebiet sichergestellt bzw. erleichtert wird. Alle Maßnahmen der Besestzungsstellen sind in diesem Sinne kriegsbedingt ausgerichtet. b. Nach dem Krieg wird es sich darum handeln, die ehemals russischen Gebiete zunächst dauerhaft mit Deutschen wirtschaftlich zu durchdringen, d.h. die besten Rohstoffvorkommen und die besten landwirtschaftlichen Gegenden unter die wirtschaftliche Leitung Deutscher zu bringen. Dieser Zustand ist im wesentlichen während des Krieges bereits im Warthegau und Gau DanzigWestpreußen sowie in dem wieder zurückgewonnenen Ostoberschlesien erreicht worden. c. Nach dem Krieg wird es sich ferner darum handeln, vor allem im Warthegau und im Gau DanzigWestpreußen die geschlossene Siedlung durchzuführen und die Polen weiter nach dem Osten umzusiedeln. Anschließend an die geschlossene Besiedlung des Warthegaues und des Gaues Danzig-Westpreußen wird es sich darum handeln, Jahr für Jahr Zone um Zone die Besiedlung geschlossen vom Westen nach dem Osten vorzuschieben. d. Es wird aber auch nach dem Krieg Gebiete geben, die infolge des Mangels ausreichender deutscher Menschen im weiten Osten vorläufig lediglich politisch geführt werden. Sicherlich wird dies beispielsweise für die Gebiete östlich des Urals (vielleicht schon östlich der Wolga) zutreffen, für die auch die Form der wirtschaftlichen Durchdringung mit Deutschen zumindest zunächst nicht in Frage kommen kann. Sie bleiben vorwiegend wirtschaftlich Reservate der Russen und anderer Völker. Diese vier Stufen der Entwicklung lösen sich zeitlich gesehen gegenseitig ab Dies gilt ganz besonders von der Durchdringung, die früher oder später durch die Siedlung abzulösen ist, und dies gilt genauso von den wirtschaftlichen Reservaten, denen später die wirtschaftliche Durchdringung folgen wird. B. Die wirtschaftlichen Probleme Diese politischen Notwendigkeiten und Einsichten werfen wirtschaftspolitische Probleme von größter Tragweite auf. 1. Es ist zunächst zu entscheiden, in welcher Form das Sich-Aufeinander-Einspielen der großdeutschen Volkswirtschaft und der Volkswirtschaft der UdSSR von sich gehen soll. a. Es sind dabei zunächst grundsätzlich zwei Möglichkeiten zu unterscheiden: Sollten die Gebiete im Osten lediglich eine, wenn auch äußerst wertvolle und enge Ergänzung der großdeutschen Volkswirtschaft darstellen oder aber sollen beide Räume, d.h. der deutsche und der russische, völlig zu einer wirtschaftlichen Einheit verschmolzen werden? Im ersten Fall handelt es sich um zwei getrennte Volkswirtschaften, im zweiten Fall um eine einzige Volkswirtschaft. Im ersten Fall wird man z.B. für Großdeutschland am Prinzip der Selbstversorgung in Rohstoffen und Nahrungsmittel festhalten müssen, im zweiten Fall wird man dieses Erfordernis nur für beide Gebiete zusammen anstreben. Es ist die Frage, ob es möglich und zweckmäßig erscheint, eine einheitliche Volkswirtschaft für beide Teile herzustellen, wenn doch aus innenpoliltischen Gründen eine Zweiteilung bestehen bleiben muß, weil sich ja die ausschließlich bzw. vorwiegend mit Deutschen bevölkerten Gebiete von denen mit slawischer Bevölkerung abheben müssen – auch wenn diese Grenze von Jahr zu Jahr weiter nach Osten verschoben wird. Aus außenpolitischen Gründen ist die Frage zu entscheiden: Sind bei zukünftigen außenpolitischen Konflikten des deutschen Volkes z.B. die Zechen und Eisenhütten im Ruhrgebiet stärkter gefährdet als die Zechen und Hüten in Oberschlesien oder im Donezbecken oder im Ural? Eine gleichmäßigere Verteilung der Urproduktion, als sie heute besteht, dürfte vielleicht den besten Schutz gegen alle Möglichkeiten darstellen, sofern man einmal von den ausgesprochenen Randgebieten absieht. Es besteht also nach den bisher üblichen Auffassungen von einer Wirtschaftspolitik zwischen den außen- und innenpolitischen Erwägungen gewisse widerstreitende Gesichtspunkte. Die praktische Lösung wird ohne Zweifel zwischen diesen geschilderten Extremen liegen müssen. b. Eine klare geistige Linie, an der jeder konkrete Fall ausgerichtet werden kann, ist aber nur möglich, wenn unsere bisherige Vorstellung vom Begriff der Volkswirtschaft revidiert wird. Das, was wir bislang als Volkswirtschaft bezeichnet haben, war die Wirtschaft innerhalb eines Raumes, der im großen und ganzen von einer rassisch einheitlichen Bevölkerung bewohnt war. Staatsraum und Volk deckten sich also. Das Wort Volkswirtschaft deutet aber bereits an, daß es die Wirtschaft eines Volkes darstellen soll und nicht die Wirtschaft der Bevölkerung innerhalb eines fest umrissenen Staatsraumes. Die Staatsraumwirtschaft kann durchaus zwei Volkswirtschaften, d.h. die Wirtschaften zweier Völker umfassen. Demnach wäre in Zukunft die deutsche Volkswirtschaft als die Wirtschaft der deutschen Volksgenossen in dem von ihm politisch beherrschten Raum zu bezeichnen. Für diese Volkswirtschaft gelten ganz bestimmte organisatorische Formen und rechtliche Normen. Für die gleichfalls in dem vom deutschen Volk beherrschten politischen Raum wohnenden anderen Völkern gilt ein anderes, d.h. ein minderes Wirtschaftsrecht. Dies trifft ganz besonders für den Bergbau und den Landbau zu. Diese Entwicklung begann mit der Eingliederung der Tschechen, setzte sich fort mit der Einverleibung der Polen und hat ein riesengroßes Ausmaß mit der Eroberung der ehemals russischen Gebiete angenommen. Daß es in einem Staatsraum völkische Rechtsunterschiede gibt, ist nichts Neues. Wir finden dies im mittelalterlichen Reich der Deutschen ebenso wie im Weltreich der alten Römer. 2. Die großen Aufgaben, die uns im Osten erwarten, werden einen Menschenmangel hervorrufen, der uns mehr noch als bisher dazu zwingt, auch in der Volkswirtschaft und nicht nur in der Betriebswirtschaft auf die Durchführung des ökonomischen Prinzips schärfstens zu achten, d.h. auf eine Organisation, bei der mit den geringsten Mitteln die höchsten Leistungen erreicht werden. Ziehen die großem Aufgaben im Osten einen Menschenmangel nach sich und führt wiederum der Menschenmangel zur schärfsten Beachtung des ökonomischen Prinzips, so folgt daraus, daß im Osten nur die besten Lagerstätten an Rohstoffen von deutschen Arbeitern ausgewertet und nur die besten Böden von deutschen Landwirten bestellt werden dürfen. Darüber hinaus aber bieten die reichen Quellen im Osten die Möglichkeit, daß wir unsere Naturreichtümer in Großdeutschland vor allem auf dem Gebiete der Rohstoffwirtschaft nicht nur schonen müssen, sondern infolge der Naturreichtümer des Ostens auch schonen können. Wir werden also die Rohstoffquellen in Großdeutschland möglichst sparsam abbauen, um sie in Fällen der Not als Reserve zur Hand zu haben. Grundsätzlich gilt also auch für die Lagerstätten und Ackerböden in Großdeutschland das gleiche, d.h. daß infolge des Menschenmangels, der zur schärfsten Beachtung des ökonomischen Prinzips zwingt, nicht mehr die geringwertigen Lagerstätten und Ackerböden weiterhin ausgebeutet werden. Dies bedeutet einen ganz grundsätzlichen Wandel unserer bisherigen Agrar- und Rohstoffpolitik. Wir waren bisher in Deutschland durch die außenpolitischen Verhältnisse gezwungen, in klarer Erkenntnis des kommenden Krieges auch die schlechtesten Lagervorkommen und geringwertigsten Böden zur Selbstversorgung heranzuziehen. Dies steigerte sich in vielen Fällen bis zu Raubbau und Unwirtschaftlichkeit. Anstelle dieser Ausrichtung, die politisch zeitlich bedingt war, tritt nach dem Krieg im Osten die Ausrichtung, mit möglichst geringem Einsatz an Menschen möglichst viel zu erzeugen, mit anderen Worten, die gesamte Rohstoff- und Landwirtschaft auf eine wirtschaftlich und sozial optimale Lage zu bringen. 3. Die allgemeine Entwicklungsrichtung des Ostens wird aber nicht nur dadurch ein vollkommen anderes Gepräge erhalten, daß die russische Volkswirtschaft ausgerichtet wird und daß die kommunistischen Formen im Osten allmählich beseitigt werden, sondern vor allem auch dadurch, daß das allgemeine Industrialisierungstempo, das die Bolschewisten eingeschlagen hatten, abgebremst wird. War doch der Anteil der städtischen Bevölkerung in der UdSSR in der Zeit von 1926 von 18 v.H. bis 1938 auf 33 v.H. gestiegen. Wir haben kein Interesse an einer industriellen Überproduktion in diesen Gebieten, die uns wahrscheinlich dazu zwingen würde, in einem so hohen Umfang zu exportieren, daß unter Umständen über die Notwendigkeit des Exports eine allzu große wirtschaftliche Abhängigkeit von anderen Großwirtschaftsräumen entstehen würde, die gegebenenfalls unsere politischen Entscheidungen beeinträchtigen könnte. Uns kommt es vielmehr darauf an, die Produktion des Ostens sowohl in der Richtung als auch in dem Ausmaß so zu heben, daß sie der wachsenden Aufnahmefähigkeit der deutschen Volkswirtschaft entspricht. Diese Überlegungen gelten ganz besonders von der Rohstoffwirtschaft und der Landwirtschaft. Was zunächst die Landwirtschaft anbetrifft, so werden wir entsprechend der Abbremsung der sowjetischen Industrialisierung eine Intensivierung der Landwirtschaft durchführen, weil hier die russische Wirtschaft die deutsche Wirtschaft am besten zu ergänzen vermag. Die Frage, wie es möglich sein wird, die allgemeine Industrialisierung in den Gebieten der ehem. UdSSR abzustoppen, gleichzeitig aber in hinreichendem Maße Rohstoffe für die deutsche Volkswirtschaft zu erhalten, ist dahingehend zu beantworten, daß hier ein Kontingentierungssystem nach dem Krieg unvermeidlich sein wird, d.h. lediglich ganz bestimmte Quoten an Eisen, Kohle, Häuten und Faserstoffen werden den russischen Völkern zum Verbrauch freigegeben, während der Rest für die deutsche Volkswirtschaft zur Verfügung zu stellen ist. Wenn auf diese Weise die bearbeitende und verarbeitende Industrie in der ehem. UdSSR in ihrer Ausdehnung begrenzt bleibt, so wird nicht nur der Sog der russischen Industrie aufhören, sondern es werden auch die nötigen Arbeitskräfte für die Intensivierung der Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Im übrigen aber wird dieses Mittel der Kontingentierung dazu beitragen, den Lebensstandard der russischen Völker auf der politisch gewünschten Höhe zu halten, d.h. in einem merklichen Abstand zum deutschen Volk (etwa 60 v.H.). Die Notwendigkeit der Abbremsung der Industrialisierung und der Förderung der Agrarisierung in der ehemaligen UdSSR werfen die Frage auf, in welcher Weise der Wiederaufbau der russischen Industrie vor sich gehen soll. Einmal soll der russische Raum zur Erweiterung des deutschen Lebensraumes dienen, ein andermal soll er, soweit er noch nicht für die geschlossene Besiedlung reif ist, und das ist der für absehbare Zeit bei weitem überwiegende Teil, nicht nur eine wertvolle Ergänzung der deutschen Volkswirtschaft darstellen, sondern in des Wortes wahrster Bedeutung eine Bereicherung des deutschen Volkes. Ohne Zweifel richtet sich das Interesse zunächst darauf, die ehem. Sowjetischen Gebiete vornehmlich in rohstoffwirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Hinsicht auszubauen. Demzufolge hätte die Fertigwarenindustrie eine untergeordnete Rolle zu spielen. Immerhin läßt sich die Frage nicht umgehen, inwieweit die Fertigwarenindustrie aufgebaut bzw. wieder in Gang gebracht werden soll, denn diese Waren können ja unmöglich alle von Deutschland geliefert werden. Soweit es sich bei den Fertigwaren um Verbrauchsgüter des täglichen Lebens handelt, d.h. um Schuhe, Kleider, Küchengeräte, Möbel u.a.m., wird man ihre Fabrikation zugestehen müssen. Zu den Fertigwaren zählen indessen auch Produktionsgüter und sowohl unter den Produktionsgütern als auch unter den Fertigwaren spielen Erzeugnisse der Rüstung eine bedeutsame Rolle. Im Frieden vermag man unter den Verbrauchsgütern und unter den Produktionsgütern mit ziemlicher Sicherheit jene herausfinden, die als wehrwirtschaftlich wichtig zu bezeichnen sind. Im Krieg ist der Kreis dieser Ereignisse sehr viel weiter gezogen. Rüstungsindustrie im engen Sinn ist selbstverständlich in keinem Fall in den ehem. Gebieten der UdSSR aufzubauen. Aber weder der Gesichtspunkt der Rohstoffwirtschaft und Landwirtschaft noch der der Verbrauchsgüterindustrie und der Wehrwirtschaft vermag auf die Dauer für Friedensverhältnisse eine politisch zweckvolle Ausrichtung in allen konkreten Fällen zu ermöglichen, denn die zukünftige Volkswirtschaft des Ostens soll nicht nur wirtschaftlich abhängig von der großdeutschen Volkswirtschaft sein, sondern sie soll vielmehr auch so gestaltet sein, daß aus politischen Gründen ein gewisser Lebensstandard von den dortigen Völkern nicht überschritten wird. Dies führt zu dem Grundgedanken, daß nur solche Betriebe in Rußland wieder in Gang gebracht werden dürfen, deren Erzeugnisse lediglich niedere oder normale Arbeitsbeanspruchungen erfordern. Industriewerke, die hohe Anforderungen an einen großen Teil der Belegschaft stellen wie z.B. optische Werke, Flugzeugbau, Lokomotivbau u.a.m. führen zwangsläufig dazu, daß hochqualifizierte russische Arbeiter herangezogen werden. Erfüllt ein Teil der russischen Arbeiterschaft die Bedingungen hochqualifizierter Arbeit, so folgt daraus über kurz oder lang die soziale Forderung entsprechender Löhne. Da hohe Löhne wegen der Aufrechterhaltung eines starken Unterschiedes in der Lebenshaltung zwischen den deutschen und den ehem. Sowjetischen Völkern nicht gewährt werden dürfen, so würden hierdurch zwangsläufig soziale Spannungen durch Unzufriedenheit in Lohngestaltung entstehen. Es ist demnach nur dann möglich, die russische Arbeiterschaft mit einem wesentlich geringeren Lebensstandard zufriedenzustellen, als es in Deutschland der Fall ist, wenn auch die Arbeitsanforderungen gering bleiben. Dies zwingt aber dazu, nur solche Industriebetriebe zuzulassen, die hochwertige Arbeitskräfte nicht benötigen. Es kommen also im wesentlichen in Frage: Rohstoffbetriebe, Landwirtschaftsbetriebe, Forstbetriebe, Reparaturwerkstätten, Baufirmen und Betriebe, die Produkte des täglichen Lebens herstellen (z.B. Möbel, Küchengeräte, Schuhe, Bekleidung). Nicht in Frage kommen daher z.B. Werkzeugmaschinen, Schiffswerften, Lokomotivfabriken, chemische Fabriken, Flugzeugwerke, Glühlampenfabriken, Nähmaschinen- und Schreibmaschinenwerke. Gerade am Beispiel der Nähmaschinen und Schreibmaschinen kommt die Bedeutung der Arbeitsbeanspruchung im Gegensatz zum wehrwirtschaftlichen Gesichtspunkt klar zum Ausdruck. Trägt man bei dem Wiederaufbau der russischen Volkswirtschaft lediglich wehrwirtschaftlichen Belangen Rechnung, so könnte die Fabrikation von Schreibmaschinen und Nähmaschinen ohne weiteres zugelassen werden. Vom arbeitswissenschaftlichen Standpunkt aus aber stellt die Erzeugung von Schreibmaschinen und Nähmaschinen große Anforderungen an die Arbeiter, die in den Lohnansprüchen und damit in der Lebenshaltung ihren Niederschlag finden müssen. Soweit in Betrieben, die im allgemeinen lediglich Arbeiten normaler Beanspruchung auszuführen haben, einige hochwertige Arbeitskräfte für Spezialarbeiten benötigt werden, sind für diese ohne Ausnahme deutsche Arbeiter, Vorarbeiter oder Werkmeister anzustellen. Es darf auch nicht vergessen werden, daß bei einer Trennung in Rohstoffwirtschaft und Fertigwarenindustrie nicht lediglich eine Abhängigkeit der russischen Volkswirtschaft in Fertigwaren von Deutschland eintreten würde, sondern umgekehrt eine entsprechende Abhängigkeit auch der deutschen Volkswirtschaft in Rohstoffen von der russischen Volkswirtschaft. Unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsbeanspruchung und dementsprechend der Lohnansprüche können z.B. in Zukunft im Osten Traktoren gebaut werden, nicht aber die dazu notwendigen Zündkerzen und Bunareifen. Auf diese Weise wird zwar auch eine gegenseitige Abhängigkeit herbeigeführt, deren Schwergewicht aber durchaus zu Gunsten Deutschlands verlagert wird. Die Besitzfrage könnte in dem Sinne gelöst werden, daß die ehemals russischen Staatsbetriebe der Industrie ausnahmslos deutsche Staatsbetriebe werden. Dem Reich bleibt es überlassen, die Betriebsführung an geeignete Parteigenossen zu vergeben, sei es in Form der lebenslänglichen Verpachtung oder als Angestellter bzw. Beamter. Sofern es sich um kleine und mittlere Betriebe handelt, können diese als Eigentum übertragen werden. C. die sozialpolitischen Konsequenzen Die Entscheidungen über diese wirtschaftspolitischen Probleme werden sozialpolitische Konsequenzen von außerordentlichen Auswirkungen nach sich ziehen: 1. Im Altreich bzw. in Großdeutschland nach dem Stand von 1939 wird die Stabilisierung der Bevölkerung zu einer gewissen Stabilisierung der Wirtschaft führen, denn es fehlt der Impuls, den die Wirtschaft bisher von der Seite der Bevölkerungsvermehrung erhielt. Damit verlegen sich die Möglichkeiten der Entwicklung weitgehend nach dem Osten. Ganz besonders fühlbar wird sich dies auf dem Gebiete der Bauwirtschaft bemerkbar machen. Wenn die Bevölkerung nicht mehr wächst, werden Wohnhäuser nur noch insoweit neu errichtet werden, als alte ersetzt werden müssen und insoweit bessere Häuser anstelle der bisherigen infolge gestiegener Lebenshaltung gesetzt werden sollen (abgesehen von dem Rückstand an Wohnungsbauten). Die Bauwirtschaft und das Baustoffgewerbe werden demnach in ihrer Bedeutung zurückgehen. Selbst der Hinweis auf das große Wohnungsbauprogramm nach dem Krieg wird daran insofern wenig ändern, als dessen Schwergewicht in jene Ostgebiete verlegt werden muß, die sofort geschlossen besiedelt werden sollen. Im Altreich tritt durch diesen Ostzug eine Entlastung der Wohnungsknappheit von selbst ein. Nimmt man die im Baugewerbe und seinen Nebengewerben beschäftigten Erwerbspersonen mit rund 2 Mill. im Altreich an, so haben diese schätzungsweise jährlich die Bauten zu errichten für die Erweiterung der Volkswirtschaft im Ausmaß des Bevölkerungszuwachses von 1 v.H. und ferner Ersatzbauten für baufällige Gebäude im Durchschnitt von 2 v.H. Daraus ergibt sich, daß durch eine Stabilisierung der Bevölkerungsdichte im Altreich fast 700.000 Bauarbeiter für den Osten frei würden. Wäre nicht gleichzeitig der Wohnungsbau durch den Krieg und durch die Aufrüstung vor dem Krieg stark im Rückstand, so müßte diese Zahl noch höher liegen; denn nach dem Krieg soll nicht nur der Bevölkerungszuwachs nach aus dem Osten gesiedelt werden, sondern es soll darüber hinaus auch eine einmalige Abgabe an deutsche Menschen nach dem Osten erfolgen, um die wirtschaftliche und soziale Struktur des Altreiches zu verbessern und gleichzeitig die Erschließung des Ostens kräftig zu beginnen. Schon die Erfordernisse des Krieges bringen es mit sich, daß der Wirtschaftszweig Steine und Erden im besetzten Ostgebiet sofort wieder in Gang gebracht wird, vor allem für den Bau von Straßen, aber auch von Unterkünften und für die Wiederinbetriebnahme kriegswichtiger Erzeugungsstätten (Schlachthäuser, Lagerhäuser, Kraftwerke, Reparaturwerkstätten, Zuckerfabriken u.a.m.). Ganz besonders aber wird nach dem Krieg das Ziegeleigewerbe im Osten in Gang zu bringen sein, denn der Zug von Millionen von deutschen Volksgenossen nach dem Osten setzt eine hinreichende Produktion von Ziegeln voraus, um die Wohnungen bauen zu können, die zur Aufnahme der Deutschen erforderlich sind, ganz gleich, ob es sich um die Gebiete mit geschlossener Siedlung oder um die Gebiete der wirtschaftlichen Durchdringung handelt. Mit der Stabilisierung der Bevölkerungsdichte im Altreich erfolgt im allgemeinen auch eine Stabilisierung der Kapazitäten der Industrie, soweit nicht die Aufgaben im Osten eine Erweiterung nach sich ziehen. Dies dürfte aber wohl nur für jene Industriezweige in größerem Umfang in Frage kommen, die aus den oben geschilderten Gründen der hohen Arbeitsbeanspruchungen im Osten nicht wieder in Gang gebracht werden. Soweit die Ostgebiete geschlossen besiedelt werden, ist grundsätzlich das gesamte dazu notwendige Gewerbe mitaufzubauen, selbstverständlich soweit sich dadurch mangelnde oder reichhaltige Rohstoffvorkommen keine Abweichungen erforderlich machen. 2. Im Osten wird es zunächst darauf ankommen, die besten Vorkommen mit Deutschen zu durchdringen. Eine geschlossene Siedlung kommt solange nicht in Frage, als sich diese besten Lagerstätten nicht an der deutschen Siedlungsgrenze befinden. Gegenwärtig und für absehbare Zeit liegen sie tief im Inneren der ehem. UdSSR. Die Durchdringung setzt die Übernahme der ehemals staatlichen Werke der UdSSR in die Hände des Reiches voraus, denn nur so scheinen uns die Vorbedingungen für solche tiefgreifenden Wandlungen gegeben zu sein – mag auch die Betriebsführung vorläufig in den Händen der Wirtschaftsgruppe liegen und später in den Händen von Einzelpersonen. Entschließt man sich, die besten Vorkommen im Osten aufs intensivste unter Heranziehung deutscher Menschen auszuwerten, so betrifft dies in erster Linie Eisen und Kohle. Sowohl in der UdSSR als auch in Großdeutschland wurde vor dem Krieg die Eisengewinnung in unerhörter Weise ausgebaut, wie nachstehende Zahlen über die Rohstahlgewinnung in (1.000 t) zeigen: Jahr 1933 1935 1938 Deutschland 9.130 16.144 21.826 Sowjetunion 6.842 16.338 18.022 Bei der Beibehaltung dieser Tendenz wäre mit einem Überangebot an Eisen zu rechnen. Wahrscheinlich dürfte es aber infolge des Mangels an deutschen Arbeitern überhaupt nicht möglich sein, die Eisengewinnung in Großdeutschland in diesem Tempo weiter zu steigern, ohne andere Sektoren der Wirtschaft zu beeinträchtigen. Der Hinweis auf den unbegrenzten Bedarf an Eisen infolge der großen Aufgaben im Osten ist insofern nicht stichhaltig, als auch die Aufnahmefähigkeit Deutschlands begrenzt ist – ganz abgesehen von der Wahrung der Wirtschaftlichkeit auch im Verbrauch und nicht nur in der Produktion, sofern kein Druck auf die Lebenshaltung erfolgen soll. Die großen Eisenerzvorkommen im Osten bieten die Möglichkeit, die knappen aber guten Eisenerzvorkommen in Deutschland zu schonen und die weniger guten zu meiden. Dieser Entschluß dürfte um so leichter fallen, als das Überangebot an Eisen und der Mangel an Eisenarbeitern sowieso einen Ausgleich erfordern. Die Drosselung der Eisengewinnung könnte durch Stillegung eines Teils der Betriebe erfolgen, die in Großdeutschland als Schattenwerk weiter bestehen bleiben, um in Notzeiten wieder zur Deckung von Selbstversorgung in Betrieb gesetzt zu werden. Auf diese Weise würden nicht nur das drohende Überangebot von Eisenprodukten am Markt beseitigt, die Rohstoffvorräte an Eisenerzen in Deutschland geschont und die Eisengewinnung gebietlich gleichmäßig verteilt werden, sondern es würde auch dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit in höchstem Maße Rechnung getragen, ohne das Prinzip der Selbstversorgung zu verletzen, da die Werke als Schattenbetriebe bestehen bleiben. Darüber hinaus aber würde diese Stillegung eines bestimmten Prozentsatzes der Eisengewinnung in Deutschland überhaupt erst die Möglichkeit schaffen, eine hinreichend große Zahl von Menschen für die Durchdringung der Eisenwerke im Osten frei zu bekommen. Der Vorarbeiter des Ruhrgebietes zum Werkmeister in Krivoy Rog oder in Stalino, so daß die wirtschaftspolitische Umschichtung von einem sozialen Aufstieg begleitet sein wird. Nimmt man einmal an, daß 20 v.H. der Eisenhütten stillgelegt würden, so würde dadurch nicht nur die deutsche Eisenerzeugung um etwa 20 v.H. sinken, sondern auch 20 v.H. der in der deutschen Eisengewinnung beschäftigten Menschen würden frei werden, d.h. rund 10.000 Erwerbspersonen der Eisengewinnung ständen zum Einsatz im Osten zur Verfügung. Fast 20 v.H. betrug der Anteil des direkten Exports von Eisen an der Erzeugung (1937), der seit Beendigung des Weltkrieges vielfach zu unauskömmlichen Preisen erfolgte. Da die russische Eisengewinnung fast ebenso groß ist wie die deutsche, so ist auch die Auswirkung des Einsatzes dieser 100.000 Betriebe des Ostens einigermaßen mit Sicherheit zu überblicken. Sie würden sicherlich zu einer weitgehenden Durchdringung der Eisenhütten im Osten mit deutschen Menschen beitragen, h.h. ebenfalls zu ca. 20 v.H., und zu einer entsprechenden Steigerung der Erzeugung. Wie aus nachstehender Übersicht hervorgeht, konzentriert sich dieses Problem auf die Ukraine. Eisenerzeugung der UdSSR 1937 Roheisen Mill. t. Ukraine 9,2 Ural 2,6 Zentrum 1,2 Rohstahl % 63,4 17,9 8,3 Mill. t 9,3 3,6 3,1 % 52,8 20,5 17,6 10,4 100,0 1,6 17,6 9,1 100,0 Walzerzeugnisse Mill. t % 6,9 53,0 2,8 21,6 2,2 16,9 (Moskau, Tula) Sibirien Zusammen 1,5 14,5 1,1 13,0 8,5 100,0 Dem Eisengehalte nach werden in Krivoy Rog 91 v.H. der Eisenerzförderung der europäischen Reviere der ehem. UdSSR gewonnen. 3. Bei der Kohle ist die Situation ähnlich wie bei Eisen, wenn England in das politische System des neuen Europa einbezogen wird. Dann bestünde ein sehr reichliches Angebot in Kohle in dem neuen Großwirtschaftsraum von der Atlantik-Küste bis zum Ural. Europa verfügte 1937 einschließlich England über einen Kohlenüberschuß von 21,7 Mill. t bei einer Gesamtförderung von 591 Mill. t, d.h. der Überschuß beträgt 3 v.H.. Rechnet man hinzu das bedeutendste Steinkohlengebiet in der UdSSR, das Donezbecken in der Ukraine, so erhöht sich die gesamte Förderung des Großwirtschaftsraumes um 77 Mill. t auf 668 Mill. t. Da das Donezbecken ebenfalls über einen erheblichen Kohlenüberschuß verfügt, den es allerdings größtenteils bisher an andere Teile der ehem. UdSSR abgegeben hat und nur zum kleinen Teil direkt exportierte, und da sich in den übrigen Gebieten der UdSSR noch große wenig erschlossene Kohlenvorkommen befinden, so ist die Annahme berechtigt, daß das Donezbecken seinen Kohlenüberschuß, den man auf rund 20 Mill. t. schätzen kann, zur Ausfuhr bringen könnte. Bei einer solchen Umschichtung hätte Europa einen Überschuß von mindestens 6 v.H. (unter Zugrundelegung der Zahlen von 1937. Ein solcher Überschuß liegt aber weder im Interesse gesunder Absatzverhältnisse im neuen Großwirtschaftsraum noch im Interesse einer sparsamen Bewirtschaftung dieses für die menschliche Wirtschaft und Kultur so äußerst wichtigen Grundstoffes, dessen Vorkommen als eng begrenzt angesprochen werden müssen. Großdeutschland könnte diese Lage dazu benutzen, seine Kohlevorkommen zu schonen und die Kohlenzechen des Ostens verstärkt abzubauen. Gewiß würde hierdurch die bisherige Kohlenmarktstruktur Europas wesentlich verschoben: insbesondere könnte England seine Kohle nicht mehr nach dem Mittelmeer exportieren, sondern vornehmlich nach dem Norden Europas. Die an das Mittelmeer angrenzenden Länder, besonders Italien, Griechenland, aber auch Frankreich, Spanien und Nordafrika, müßten nunmehr vom Donezbecken aus beliefert werden. Deutschland führte bisher jährlich etwa 35 Mill. t Steinkohle (einschließlich Koks) aus, d.h. durchschnittlich 20 v.H. seiner Förderung. Würde man die deutsche Steinkohlenförderung um 20 v.H. kürzen, so ergäbe dies folgende Konsequenzen: 1. Der deutsche Steinkohleexport käme in Wegfall, 2. im deutschen Steinkohlebergbau würden rund 125.000 Erwerbspersonen weniger benötigt 3. das Donezbecken müßte den Ausfall am Exportmarkt decken. Die Stillegung deutscher Steinkohlenzechen im Ruhrgebiet in einem Ausmaß von etwa 20 v.H. der Förderung ist also wirtschaftspolitisch vertretbar und ermöglicht überhaupt erst die Durchdringung der Steinkohlenbezirke im Osten mit deutschen Arbeitern. Den Export des Ruhrgebietes übernimmt das Donezbecken, die stillgelegten Kohlenzechen im Ruhrgebiet bleiben als Schattenwerke bestehen. In Wirklichkeit wird dieser neue Export des Donezbecken von denselben Menschen geleistet, die bisher die Exportmengen des Ruhrgebietes bewerkstelligen, denn es handelt sich dabei um jene 125.000 Erwerbspersonen des Steinkohlenbergbaus, die im Ruhrgebiet frei und im Donezbecken angesetzt werden. Entscheidend für die Umschichtung ist der Gesichtspunkt, den Osten zu durchdringen. Die reichen Vorkommen an Kohle im Osten bieten die Möglichkeit, die deutschen Lagervorräte zu schonen und durch Aufrechterhaltung der stillgelegten Zechen als Schattenwerke nicht gegen das Prinzip der Selbstversorgung zu stoßen. Das Donezbecken ist in der Lage, den Export des Ruhrgebietes mengenmäßig im Rahmen des Großwirtschaftsraumes auszugleichen. Die Menschen, die hierdurch für den Osten frei werden, werden dort sozial auf einer höheren Stufe stehen, da die Arbeiten mit niedrigen Anforderungen den Russen vorbehalten bleiben. Ob das Marktangebot an Kohle mehr oder weniger reichlich bzw. knapp im Hinblick auf die großen Aufgaben der Zukunft (betr. Besonders synthetische Rohstoffe) beurteilt wird, ist hierbei insofern unerheblich, als die Arbeitskräfte in jedem Fall begrenzt sind. Dagegen besteht in der Wahl der vornehmlich abzubauenden Steinkohlenbezirke eine größere Freiheit, die im Interesse der Zukunft des deutschen Volkes zu treffen ist. Ein eventueller Engpaß an Waren ist in Wirklichkeit immer ein Engpaß an Arbeitskräften. Die Kohlenbilanz der UdSSR sieht wie folgt aus: Revier Kohlenart Donezbecken Steinkohle Moskauer Revier Braunkohle Ural Steinkohle Ukraine Braunkohle Kaukasus Stein- und Braunkohle Petschora Steinkohle Europ. Gebiet Sa. z.Vgl: Großdeutschland Steinkohle zum Vergleich Groß-Dtl: Braunkohle Ruhrgebiet Steinkohle Vorrat Mrd. t 89 12 8 5 114 62 69 32 Förderung 1938 „Mill.t“ 78,3 7,4 8,6 ? ? ? 94,3 186 198 127 Während in Europa der Steinkohlenvorrat unter Zugrundelegung der derzeitigen Förderung etwa 400 Jahre reichen würde, könnte der europäische Teil der UdSSR seinen Bedarf auf 1.000 Jahre hinaus decken. Es kann kein Zweifel bestehen, daß die Kohle in Europa ohne Einbeziehung Englands und des Ostens sehr knapp sein würde – ganz abgesehen davon, daß England stets darauf angewiesen ist, einen Teil seiner Kohle nach Europa auszuführen. Der asiatische Teil der UdSSR weist einen Vorrat an Kohle von 1.540 Mrd. t auf bei einer Förderung von bisher nur 25 Mio t im Jahr. Hier liegen für den europäischen Großwirtschaftsraum unerhörte Reserven, falls sein Bereich so weit gesteckt werden sollte. 4. Die Probleme der Durchdringung sind bei der Nicht-eisen Metallgewinnung nicht geringer als wie bei der Förderung von Eisenerzen und Kohle. Der Metallbergbau und Metallgewinnung nahmen in Deutschland seit 1933 einen ungeahnten Aufschwung. Die außenpolitische Lage zwang auf diesem Gebiet noch mehr als auf dem Gebiete des Eisens, jede irgendwie ausnutzbare Quelle zu verwerten. So stieg die Zahl der Beschäftigten im Blei- Zinkbergbau von 5.363 im Jahr 1933 auf 13.567 im Jahr 1938, Kupfererzbergbau von 8.315 im Jahr 1933 auf 9.819 im Jahr 1939, sonstiger Erzbergbau von 193 im Jahr 1933 auf 1.619 im Jahr 1938 Dieselbe Steigerung finden wir bei Metallhütten. Es beschäftigten die .. ----------------------------------------------------------------------------------------------Zinn- und Zinkoxydhütten 1.803 Mann 1933 und 5.262 Mann 1938 ------------------------------------------------------------------------------------------------Sonst. Metallhütten (bes. Aluminiumhütten) 2.545 Mann 1933 und 14.383 Mann 1938 Der drohende Krieg zwang Vorkommen abzubauen, die nur durch staatliche Subventionen die Aufrechterhaltung der Betriebe ermöglichten. Die Metallerzproduktion vermochte trotz aller Bemühungen nur mäßig zu steigen, ebenso weil die deutschen Vorkommen meistens wenig hochwertig oder fast erschöpft sind. So betrug die Kupfererzförderung (Kupferinhalt) im Altreich in der UdSSR 31.500t 32.700t 1933 1933 und und 30.000 t 95.500t 1938 1938 Der Bleiinhalt der geförderten Bleierze belief sich im Altreich auf 52.000t in der UdSSR auf 13.700t 1933 1933 und und 89.300t 69.000t 1938 1938 Der Zinkinhalt der geförderten Bleierze betrug im Altreich in der UdSSR 104.400t 21.900t 1933 1933 und und 196.400 t 70.000t 1938, 1938 Die Förderung von Bauxit (Aluminiumerzen) stellt sich .. im Altreich auf 12.000t in der UdSSR auf 50.600t 1933 1933 und 99.400t und 250.000t 1938, 1938. Die Zahlen sollen lediglich die Zukunftsaussichten im Osten andeuten. Die reichen und guten Vorkommen in den Gebieten der ehem. UdSSR bieten die Möglichkeit, auch hier die deutschen Arbeitskräfte der NE-Metallerzgewinnung wirtschaftlicher anzusetzen und damit zugleich die noch bestehenden geringen deutschen Vorkommen vor der völligen Erschöpfung zu bewahren, wodurch stille Reserven für Notzeiten offengehalten würden. Im ganzen handelt es sich auf diesem Sektor um rund 50.000 Erwerbspersonen, die zu einem großen Teil unwirtschaftlich angesetzt sind. Hier würde es sich also nicht darum handeln, lediglich einen kleinen Prozentsatz im Osten zum Einsatz zu bringen, sondern schätzungsweise ca. 50 v.H.. Das an NE-Metallerzen reichste Gebiet des Ostens ist der Ural. 5. Für die Treibstoffe können ähnliche Erwägungen angestellt werden. Kohle und Erdöle stellen im wesentlichen die Ausgangsprodukte für die Treibstoffgewinnung und insbesondere für Benzin dar. Das auf synthetischem Wege gewonnene Benzin ist schätzungsweise dreimal so teuer wie das Benzin aus Erdöl. Um eine Tonne Kohlebenzin zu erzeugen, ist ein Energieverbrauch von 3.000 kWh notwendig gegenüber nur 12 kWh bei Benzin aus Erdöl. Da die russischen Gebiete eine hohe Erdölgewinnung aufweisen, so wäre zu prüfen, ob nicht der deutsche Bedarf an Treibstoff völlig aus russischem Erdöl gedeckt werden könnte, wodurch kapitals- und arbeitseinsatzmäßig eine wirtschaftlichere Gestaltung eintreten könnte. Die russische Erdölgewinnung betrug vor dem Krieg rund 30 Mill. t. Davon gelangten maximal 6 Mill. t jährlich zum Export. Der deutsche Zuschuß an Mineralöl betrug vor dem Krieg knapp 5 Mill. t. Nimmt man einmal an, daß die synthetische Treibstoffgewinnung rund 2 Mill. t vor dem Krieg betrug, so ergibt sich ein Zuschußbedarf von etwa 7 Mill. t, den nunmehr Rußland zu decken hätte. Es wird dies möglich sein, sofern entweder der russische Verbrauch etwas gedrosselt oder aber die russische Erdölgewinnung gesteigert wird. Würde man die synthetische Reibstoffgewinnung in Deutschland im wesentlichen stillegen und die Betriebe als Schattenwerke für Notzeiten weiter bestehen lassen, so würde damit schätzungsweise 20.000 Erwerbspersonen für einen wirtschaftlicheren Einsatz im Osten freiwerden. 6. In der Landwirtschaft liegen die Dinge insofern anders, als hier keine Schattenbetriebe möglich sind. Daher ist auch die Frage der Selbstversorgung anders zu beurteilen. Die Selbstversorgung ist eine völkische Notwendigkeit, damit die politische Handlungsfreiheit jederzeit gewährleistet ist. Die Selbstversorgung ist also für den jeweils deutschen Lebensraum zu fordern, d.h. für jenes Gebiet, in dem Deutsche geschlossen wohnen. Erweitert sich dieses Gebiet nach dem Osten, so erweitert sich auch der Raum der Selbstversorgung. Für diesen Lebensraum des deutschen Volkes im engeren Sinn ist die Selbstversorgung in Brotgetreide und Kartoffeln unbedingt sicherzustellen, denn sie bilden das Rückrat der Ernährung. Die Veredelungswirtschaft der deutschen Bauern im geschlossenen Siedlungsgebiet des deutschen Volkes ist nur insoweit zu fördern und zu steigern, als die hundertprozentige Versorgung mit Brotgetreide und Kartoffeln aus der Scholle dieses geschlossenen Siedlungsraumes in keiner Weise angetastet wird. A. Der deutsche Bauer, Landwirt und Landarbeiter wird in erster Linie zur Besiedlung der an das Deutsche Reich unmittelbar anstoßenden Ostgebiete eingesetzt werden. Von Jahr zu Jahr wird man hier die Grenze der Besiedlung vom Westen nach dem Osten vorschieben. Der Gesichtspunkt der besten Böden kann hier also nicht ausschlaggebend sein, vielmehr das Erfordernis einer geschlossenen und ausgeglichenen Volkstumsgrenze. Gebiete mit schlechtem Böden sind aufzuforsten. Die Menschen für diese Siedlung werden im Altreich zunächst durch eine einmalige Aktion der Schließung der Klein- und Kümmerbetriebe freigesetzt, nach deren Durchführung die Besiedlung des Ostens nur noch im Zuge der Bevölkerungsvermehrung fortgesetzt werden kann. Wie in der Untersuchung des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der Deutschen Arbeitsfront über den Aufbau der neuen Gebiete im Osten und Westen bereits Ende 1940 dargelegt worden ist, würde eine Verdoppelung der Durchschnittsgröße aller landwirtschaftlicher Betriebe von 2 bis zu 10 ha die Freisetzung von 700.000 Bauernfamilien bedeuten und damit die Möglichkeit eröffnen, 700.000 neue Betriebe im Osten zu schaffen (sofern man einmal von der Fähigkeit und der Willigkeit der Betroffenen zum Siedeln absieht und von der Notwendigkeit des Ausgleichs innerhalb der landwirtschaftlichen Bevölkerung). Die Betriebsverdoppelung würde ferner bedeuten, daß im Altreich die kleinste Betriebsgrößenklasse in der Landwirtschaft durchschnittlich 10 ha aufweisen würde. Der Arbeitseinsatz ist in den verschiedenen landwirtschaftlichen Betriebsgrößenklassen recht unterschiedlich. Er beträgt in Deutschland für die Betriebsgrößenklasse von 5 ha rund 80 Arbeitskräfte je 100 ha. Daraus folgt, daß die Verdoppelung der Betriebsgrößenklassen in Deutschland zu keinem höheren Bedarf an Arbeitskräften in den vergrößterten Betrieben zu führen braucht, denn diese können nunmehr mit Maschinen rationeller bewirtschaftet werden. Da auch noch mancher mittlere Hof in Deutschland erweiterungsbedürftig ist, so können über den Weg der Betriebsvergrößerungin Deutschland ohne Zweifel Neubauern für eine sehr große Zahl von Höfen des Ostens einmalig gewonnen werden, schätzungsweise bis zu 1 Million. Rechnet man für diese 1 Million Osthöfe eine Durchschnittsgröße von 50 Hektar, was durchaus möglich ist, da die Betriebe teilweise noch größer sein dürften, so ergibt dies eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 50 Mill. ha. Dies bedeutet mit anderen Worten die geschlossene landwirtschaftliche Besiedlung eines Gebietes, das etwa das frühere Baltikum und das ehem. Polen umfasst. b. Anders ist die Lage in jenen Ostgebieten, die in absehbarer Zeit nicht für eine geschlossene Besiedlung in Frage kommen oder vielleicht sogar niemals; denn gewisse Gebiete im weiten Osten werden immer den Slawen als Lebensräume vorbehalten bleiben müssen, gleichviel, ob man diese Siedlungsgrenze am Dnjepr, an der Wolga oder am Ural zieht. Zwischen dem eigentlichen deutschen Siedlungsgebiet und jenem Gebiet, das den Slawen vorbehalten bleibt, befindet sich jene Zone, die lediglich mit deutschen Menschen durchdrungen werden soll, um sie zu beherrschen, zu verwalten und wirtschaftlich auszuwerten. Diese Zone wird erst allmählich vom Westen her in längeren Zeiträumen geschlossen besiedelt werden können. Solange dies nicht der Fall ist, werden hier die deutschen Bauern bzw. Landwirte aus der Masse der Slawen herausgehoben werden müssen, und zwar nicht nur durch eine politische Sonderstellung, sondern auch durch wirtschaftlich bestens fundierte Höfe. Dieses letztere ist aber nur möglich 1. Wenn für diese deutschen Höfe nur die besten Böden herangezogen werden, 3. wenn die Größe dieser Betriebe eine wirtschaftliche Sonderstellung ermöglicht. Auf diesen besten Böden sollen unter deutscher Bewirtschaftung die höchsten Erträge, die höchsten Viehleistungen herausgeholt werden; es werden demnach in dieser Zone deutsche Staatsgüter und wohl auch deutsche private Großbetriebe als die Form der landwirtschaftlichen deutschen Durchdringung vorherrschen müssen. In der ehem. UdSSR (einschl. des asiatischen Teils) gab es 10.000 Sowjetgüter (Sowchosen und Koopchosen). Diese 10.000 Sowjetgüter weisen im Durchschnitt eine Anbaufläche von 2.750 ha auf. Ihr Anteil an der Anbaufläche in der gesamten UdSSR betrug rund 10 v.H.; von den übrigen 90 v.H. der Anbaufläche befanden sich rund 85 v.H. in der Bewirtschaftung der Kolchosen, d.h. kollektivistischen Produktionsbetrieben der Bauern eines Ortes. Ihre Größe beträgt im Durchschnitt 480 ha und ihre Zahl belief sich auf 242.000 Betriebe vor dem Krieg. Es liegt der Gedanke nahe die Sowjetgüter restlos in deutsche Staatsgüter überzuführen und die Kolchosen vorwiegend in private Großbetriebe umzuwandeln, soweit deren Land nicht für die Erweiterung der Sphäre des Privateigentums an Boden und Vieh bei den russischen Bauern Verwendung finden soll. Nimmt man einmal an, daß die bessere Hälfte der Kolchosen in deutschen Großgrundbesitz übergeführt würde, so ergibt sich hieraus für die landwirtschaftliche Durchdringung ein Bedarf von schätzungsweise mindestens 200.000 deutschen landwirtschaftlichen Erwerbspersonen im europäischen Teil der ehem. UdSSR, sofern man einmal davon ausgeht, daß auf diesen Großbetrieben mindestens je zwei Deutsche vorhanden sein müssen (der Betriebsleiter und sein Stellvertreter). c. Das Fortschreiten der geschlossenen Besiedlung vom Westen her bedeutet die Verschiebung der Zone der Staatsgüter und der privaten Großbetriebe weiter nach Osten in jene Zone, die zunächst den Slawen wirtschaftlich voll vorbehalten blieb (sog. Reservate). Die Form des privaten landwirtschaftlichen Großbetriebes im Osten, anknüpfend an die Kolchosen, ist also rechtlich so zu wählen, daß dieser Prozeß der Siedlung und Durchdringung vom Westen nach dem Osten nicht aufgehalten wird. Es wäre also im Gegensatz zum Erbhof im geschlossenen deutschen Siedlungsgebiet das Lebensgut in jenen Gebieten zu schaffen, das zu einer geschlossenen Siedlung noch nicht reif ist. Unter einem Lebensgut könnte in Anlehnung an die mittelalterlichen Verhältnisse ein landwirtschaftlicher Besitz verstanden werden, der nicht käuflich erworben wird, sondern der vielmehr ohne Geld als Gegenleistung vom Staat einem geeigneten Parteigenossen zur lebenslänglichen Bewirtschaftung übertragen wird. Dementsprechend sind auch die Besitz- und Erbansprüche anders zu regeln. Die Kinder des Besitzers eines solchen Lehensgutes haben dann kein Recht auf eine weitere, wiederum lebenslängliche Bewirtschaftung, wenn das Gebiet als siedlungsreif erklärt wird. In diesem Fall haben sie das Recht, neue Lehensgüter in jenen weiter östlich gelegenen Zonen zu übernehmen, die nunmehr für die Durchdringung reif geworden sind und damit nicht mehr ausschließlich den Slawen wirtschaftlich vorbehalten bleiben. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, Erbhöfe in den neuen Gebieten mit geschlossener Besiedlung zu übernehmen. Auf diese Weise bleiben sowohl der politische als auch der materielle Anreiz bestehen, ohne daß das Fortschreiten der Siedlung und Durchdringung des Ostens aufgehalten wird. Selbstverständlich kann ein kleiner Prozentsatz der Lehensgüter, wenn das fragliche Gebiet siedlungsreif geworden ist, in Erbhöfe von dieser Größe umgewandelt werden, damit eine landwirtschaftliche Besiedlung mit gesunder Mischung der Betriebsgrößen entsteht. Aber dies können naturgemäß nur Ausnahmefälle bleiben. Demgegenüber ist unter allen Umständen daran festzuhalten, daß die Entstehung eines landwirtschaftlichen Großgrundbesitzers der alten reaktionären bzw. liberalen Prägung von vornherein vermieden wird. 7. Durch die Abgabe von Waldbesitz aus Händen der Gemeinden und anderer öffentlicher Korporationen, aber auch von industriellen Jagdgrundbesitzern an Bauern und Landwirte in Großdeutschland könnten in nennenswertem Umfang Forstbeamte für den Osten freigesetzt werden, damit diese Gebiete baldmöglichst einer geordneten Forstwirtschaft zugeführt werden. Während dem Bauernwald in Großdeutschland eine höhere Bedeutung zugewiesen werden müßte, hat das Schwergewicht im Osten in höherem Maße als in Großdeutschland bei den Staatsforsten zu liegen. Dies entspricht durchaus den verschiedenartigen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zuständen. Die Zuteilung von Bauernwald in Großdeutschland würde wesentlich zur wirtschaftlichen Gesundung vieler Bauernhöfe beitragen, und zwar besonders in Ostdeutschland bei den sogenannten Sandbauern und in Süddeutschland bei den Bergbauern. Das wesentliche Moment liegt hier auf dem Gebiete des Arbeitseinsatzes und der Arbeitsgestaltung auf dem Bauernhof. Dier Sommersaisoncharakter der Landwirtschaft und der Wintersaisoncharakter der Waldwirtschaft ergänzen sich in einem Betriebe auf das glücklichste. Feld und Wald gehören auch biologisch zusammen, wie die Verhinderung der Bodenerosion beweist. Der Waldbesitz verteilt sich im Altreich wie folgt: 1. Anteil der Staatsforsten: 33 v.H. der Waldfläche, 2. Anteil der Gemeinden, Stiftungen und Genossenschaften: 3. Anteil des Privatbesitzes: 47 v.H. der Waldfläche. 20 v.H. d. Waldfläche, Daraus folgt, daß eine Zuteilung der Gemeinde- und Stiftungswälder an die Bauern und Landwirte rund 3 Mill. ha Waldfläche bedeuten und eine Vergrößerung der landwirtschaftlichen Betriebe um 10 v.H. der Fläche nach herbeiführen würde. Das Entscheidende aber ist, daß diese zusätzliche Flächen in der saisonmäßig toten Zeit der Landwirtschaft mit bewirtschaftet würden und daß auf diese Weise roh geschätzt 20 v.h. der in der Forstwirtschaft tätigen Personen zum Einsatz für den Osten frei würden, h.h. 28.000 Erwerbspersonen. C. die geopolitischen Gegebenheiten Im Krieg haben die geopolitischen Gegebenheiten ein anderes Gesicht als im Frieden; aber ebenso sind sie in den Gebieten des Ostens, die geschlossen besiedelt werden, von einer anderen Bedeutung als in jenen Gebieten, die zunächst lediglich wirtschaftlich durchdrungen werden sollen. Dies erhellt allein schon daraus, daß es sich bei der geschlossenen Besiedlung um Zonen handelt, die vom Westen nach dem Osten zusammenhängend fortschreiten, und bei der Durchdringung um die Ballung oder Streuung von Stützpunkten je nach den Böden und Vorkommen. 1. Was zunächst die Besiedlung anbetrifft, so ist hier entscheidend, daß diese von dem Westen nach dem Osten geschlossen durchgeführt wird. Die Güte der Böden und der Reichtum an Rohstoffvorkommen stehen erst an zweiter Stelle. Sie bestimmen unter Umständen die Stoßrichtung der Besiedlung. Es wäre z.B. möglich, mit Rücksicht auf die guten Böden die Besiedlung vornehmlich nach Südosten, d.h. in die Richtung der Ukraine besonders voranzutreiben. Es ist aber ebenso denkbar, aus politischen Gründen in erster Linie in nordöstlicher Richtung zu siedeln, um das Kernvolk der ehem. UdSSR, die Großrussen, zurückzudrängen und vor allem von der Ostsee abzuriegeln, während umgekehrt den nicht großrussischen Völkern der ehem. UdSSR eine gewisse Förderung zuteil wird. Darüber hinaus können in der Stoßrichtung der Siedlung verkehrspolitische und militärische Erwägungen maßgebend sein. Militärisch gesehen haben kurze Grenzen unter Ausnutzung natürlicher Hindernisse besondere Vorteile. Verkehrspolitisch spielen vor allem die Binnenschiffahrtswege zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer eine ausschlaggebende Rolle. 2. Bei der Durchdringung geht es darum, die wirtschaftlichen besten und wichtigsten Gebiete unter den entscheidenden Einfluß der Deutschen zu bringen. Hier handelt es sich nicht um geschlossene Zonen, sondern um die Errichtung von Zentren um die besten Vorkommen und Böden. Was Kohle und Eisen anbetrifft, so ist hier der östliche Teil der Ukraine ausschlaggebend. Für die Buntmetalle und Leichtmetalle kommt ganz vorwiegend der Ural in Frage, mit Ausnahme der bedeutenden Bauxitvorkommen bei Tichwin (östlich von Leningrad). Auch bei der Forstwirtschaft ist die Standortsfrage eindeutig geklärt. Nur der Norden des europäischen Teils Rußlands hat große Überschüsse aufzuweisen, während die Waldbestände des Südens sehr geschont werden müssen. Wahrscheinlich muß hier sogar in gewissem Umfang aufgeforstet werden. Bei der Landwirtschaft ist die Lage am schwierigsten zu beurteilen. Zwar liegt hier das Schwergewicht durchaus beim Schwarzerdegebiet, das sich vom Südwesten nach dem Nordosten quer durch den europäischen Teil der UdSSR zieht, doch ist der östliche Teil nicht gleichwertig dem westlichen. Im westlichen Teil ist das Klima mild und feucht, es wird nach Osten immer trockener und im Winter immer kälter, d.h. es wird immer kontinentaler, so daß die Sicherheit der Erträge nach dem Osten zu abnimmt – ganz abgesehen davon, daß auch die Intensität der Bodenbearbeitung mit dem Kulturstand der einheimischen Bevölkerung nach Osten zu abnimmt. Im Gegensatz hierzu weisen die podsoligen Böden, die sich nördlich des Schwarzerdegürtels vom Westen nach dem Osten hinziehen, zwar keinen so hohen Humusgehalt und damit keine so hohe Fruchtbarkeit auf, indessen sind sie im Ertrag sicherer, zumal in ihrem Gebiet die Niederschläge häufiger sind. Im allgemeinen nimmt in Rußland die Niederschlagshäufigkeit vom Nordwesten nach dem Südosten ab (von Smolensk nach Astrachan). Es ist daher kein Zufall, daß sich die russischen Staatsgüter (Sowchosen) im wesentlichen im Schwarzerdegürtel befinden, während die Verbreitung der Kolchosen in der Zone der podsoligen Böden am größten ist. Sicherheit und Höhe der landwirtschaftlichen Erträge laufen also in Rußland nicht parallel. Das größte Überschußgebiet gemessen an der Bevölkerung ist der östliche Teil des Schwarzerdegürtels. Er leidet zugleich unter der größten Unsicherheit infolge von Dürregefahren. Die Beachtung dieser Gegebenheiten ist für die Durchdringung der landwirtschaftlichen Gebiete Rußlands mit Deutschen von größter Bedeutung. 3. Eine Standortsfrage gibt es in der Rohstoffwirtschaft und Landwirtschaft insofern nicht, als diese durch die natürlichen Gegebenheiten gebunden sind. Erst bei der Bearbeitung und Verarbeitung der Grundstoffe setzt dieses Problem ein. Letzten Endes entscheidend ist hier der in Abschnitt B 4 aufgestellte Grundsatz: Die Fabrikation von Erzeugnissen, die hohe Arbeitsbeanspruchungen erfordern, ist in den Gebieten des Ostens mit fremdstämmigen Belegschaften nicht aufzunehmen. Zusammenfassung Zusammenfassend muß davon ausgegangen werden, daß der Bedarf an Menschen für die Ostgebiete praktisch unbegrenzt ist, daß aber grundsätzlich nur der Bevölkerungszuwachs Großdeutschlands zur Verfügung steht, d.h. knapp 1 Mill. jährlich. Eine Ausnahme hiervon ist nur einmal möglich und insoweit zweckmäßig, als hierdurch die wirtschaftliche und soziale Struktur Deutschlands nicht fühlbar gestört wird. Die Möglichkeit einer einmaligen Beschaffung von deutschen Menschen für die Rohstoff- und Landwirtschaft des Ostens besteht darin: 1. daß ein Teil der deutschen Eisenhütten mit einer Kapazität von rund 20 v.H. der Rohstahlerzeugung stillgelegt wird. 2. Daß ein Teil der Ruhrkohlenschächte ihre Förderung einstellt, der etwa einer Kapazität von 20 v.H. der Gesamtförderung entspricht. 3. Daß ca. 50 v.H. der großdeutschen Ne-Metallgewinnung eingestellt wird. 4. Daß der größte Teil der synthetischen Treibstoffgewinnung eingestellt wird. 5. Daß mindestens 700.000 landwirtschaftliche Klein- und Kümmerbetriebe beseitigt werden (maximal 1 Mill.), deren Besitzer entweder für die landwirtschaftliche Besiedlung oder für die landwirtschaftliche Durchdringung angesetzt werden. 6. Daß ca. 20 v.H. öffentlicher Forst als Bauernwald den landwirtschaftlichen Betrieben zugeteilt werden. 7. Daß durch die Stabilisierung der Bevölkerungsdichte im Altreich rund 30 v.H. der Bauarbeiter frei werden. Auf diese Weise werden teils ohne fühlbare Beeinträchtigung der bisherigen Wirtschaft des Altreiches, teils unter einschneidender Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Altreich einmalig weit über 1 Mill. deutscher Erwerbspersonen für den Einsatz in der Rohstoff- und Landwirtschaft des Ostens frei. Auch für die übrigen Aufgaben des Ostens (politische Führung, staatliche Verwaltung, Fertigwarenindustrie, Handel und Verkehr) könnten einmalig durch strukturelle Änderungen und Vereinfachungen deutsche Menschen und damit Arbeitskräfte freigesetzt werden (Vereinfachung der Verwaltung, Vereinheitlichung der wirtschaftlichen Selbstverwaltung, Rationalisierung der Industriebetriebe, Technisierung der Fertigwaren, Rationalisierung der Erzeugung von Luxuswaren u.a.m.). Nach der kurzfristigen Durchführung des einmaligen Programms würde dann lediglich der Bevölkerungszuwachs des Altreichs zum Einsatz für die Siedlung und Durchdringung im Osten zur Verfügung stehen, so daß der weitere Prozeß zwangsläufig in einem wesentlich ruhigeren Tempo vonstatten gehen muß. Etwa in 100 Jahren wäre dann das Gebiet bis zum Ural von Deutschen geschlossen besiedelt und zwar in der Dichte der derzeitigen sowjetischen Besiedlung – sofern man von der heutigen deutschen Geburtenhäufigkeit ausgeht und sofern es gelingt, sowie überhaupt politisch für zweckmäßig gehalten wird, die ehemals sowjetische Bevölkerung auf die Gebiete östlich des Urals zurückzudrängen, die nicht minder fruchtbar und reich an Bodenschätzen sind als der europäische Teil der ehemaligen UdSSR. Es kann aber kein Zweifel bestehen, daß ein solch gewaltiger Einsatz im Osten nur von Erfolg gekrönt sein kann, wenn es gelingt, die freiwillige Mitarbeit dieser Millionen zu erhalten. Ganz gleich, ob jemand als politischer, wirtschaftlicher, technischer oder wissenschaftlicher Pionier nach dem Osten gehen will oder soll – ihm muß damit die größte Chance seines Lebens in ideeller und materieller Hinsicht geboten werden. Berlin, den 17. November 1941