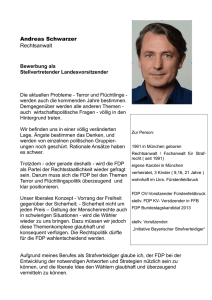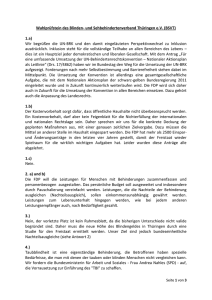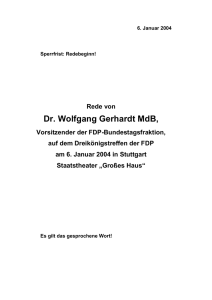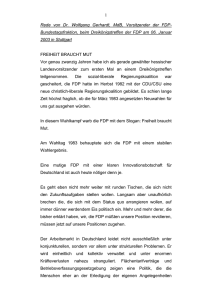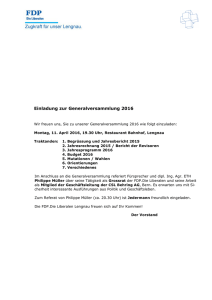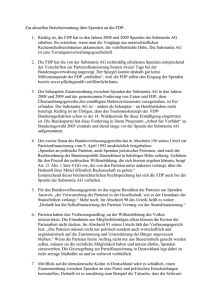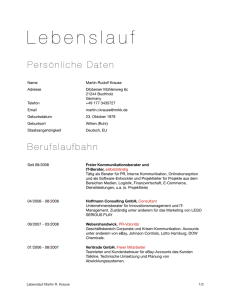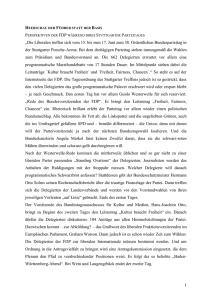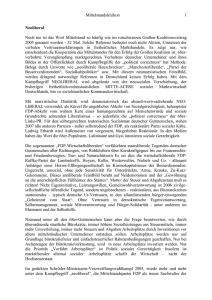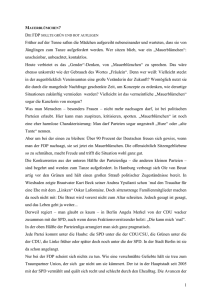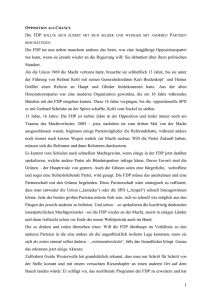Einerseits: „Ohne Organisation ist die Demokratie nicht denkbar
Werbung
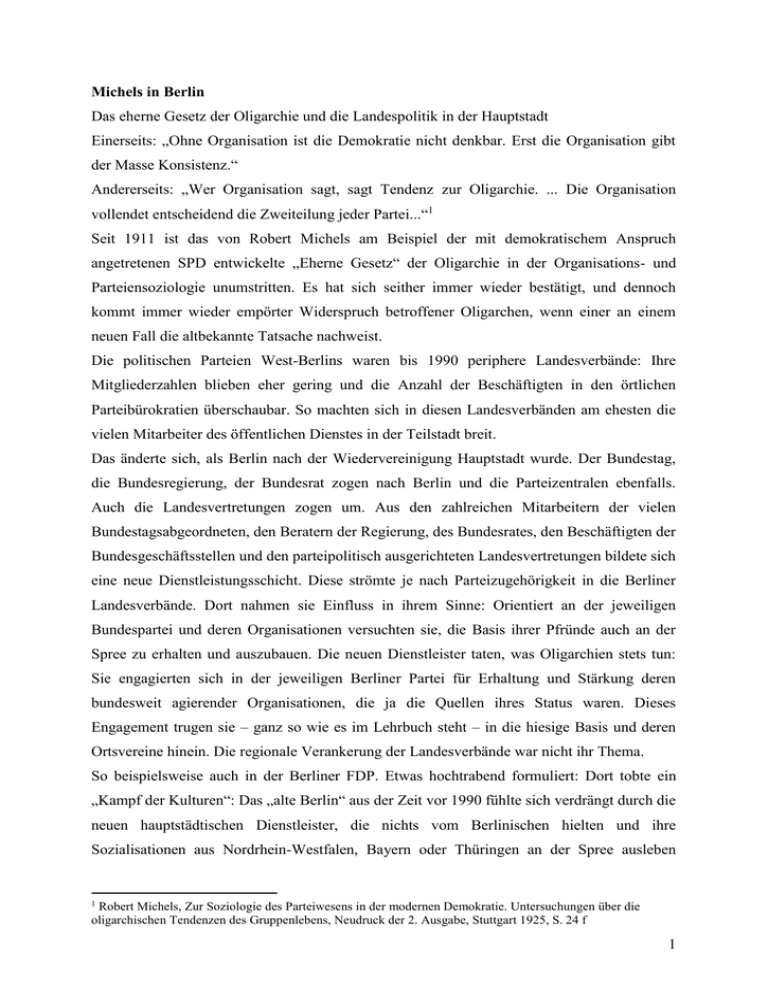
Michels in Berlin Das eherne Gesetz der Oligarchie und die Landespolitik in der Hauptstadt Einerseits: „Ohne Organisation ist die Demokratie nicht denkbar. Erst die Organisation gibt der Masse Konsistenz.“ Andererseits: „Wer Organisation sagt, sagt Tendenz zur Oligarchie. ... Die Organisation vollendet entscheidend die Zweiteilung jeder Partei...“1 Seit 1911 ist das von Robert Michels am Beispiel der mit demokratischem Anspruch angetretenen SPD entwickelte „Eherne Gesetz“ der Oligarchie in der Organisations- und Parteiensoziologie unumstritten. Es hat sich seither immer wieder bestätigt, und dennoch kommt immer wieder empörter Widerspruch betroffener Oligarchen, wenn einer an einem neuen Fall die altbekannte Tatsache nachweist. Die politischen Parteien West-Berlins waren bis 1990 periphere Landesverbände: Ihre Mitgliederzahlen blieben eher gering und die Anzahl der Beschäftigten in den örtlichen Parteibürokratien überschaubar. So machten sich in diesen Landesverbänden am ehesten die vielen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in der Teilstadt breit. Das änderte sich, als Berlin nach der Wiedervereinigung Hauptstadt wurde. Der Bundestag, die Bundesregierung, der Bundesrat zogen nach Berlin und die Parteizentralen ebenfalls. Auch die Landesvertretungen zogen um. Aus den zahlreichen Mitarbeitern der vielen Bundestagsabgeordneten, den Beratern der Regierung, des Bundesrates, den Beschäftigten der Bundesgeschäftsstellen und den parteipolitisch ausgerichteten Landesvertretungen bildete sich eine neue Dienstleistungsschicht. Diese strömte je nach Parteizugehörigkeit in die Berliner Landesverbände. Dort nahmen sie Einfluss in ihrem Sinne: Orientiert an der jeweiligen Bundespartei und deren Organisationen versuchten sie, die Basis ihrer Pfründe auch an der Spree zu erhalten und auszubauen. Die neuen Dienstleister taten, was Oligarchien stets tun: Sie engagierten sich in der jeweiligen Berliner Partei für Erhaltung und Stärkung deren bundesweit agierender Organisationen, die ja die Quellen ihres Status waren. Dieses Engagement trugen sie – ganz so wie es im Lehrbuch steht – in die hiesige Basis und deren Ortsvereine hinein. Die regionale Verankerung der Landesverbände war nicht ihr Thema. So beispielsweise auch in der Berliner FDP. Etwas hochtrabend formuliert: Dort tobte ein „Kampf der Kulturen“: Das „alte Berlin“ aus der Zeit vor 1990 fühlte sich verdrängt durch die neuen hauptstädtischen Dienstleister, die nichts vom Berlinischen hielten und ihre Sozialisationen aus Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Thüringen an der Spree ausleben 1 Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, Neudruck der 2. Ausgabe, Stuttgart 1925, S. 24 f 1 wollten. Die Berlinischen aus Ost und West waren bemüht, verloren gegangenes Terrain im Landesverband zurück zu erobern. De liberale Abteilung der Zuarbeiter und Hilfswilligen des von Bonn nach Berlin gewechselten Hauptstadtbetriebes dagegen wollte die Landes-FDP zu einer gleichförmigen Filiale der Bundespartei machen. Sie wähnte sich auf der Höhe der Zeit in Richtung einer liberalen Weltgesellschaft und hatte das Spitzenpersonal der Bundespartei hinter sich. Die „Altberliner“ wehrten sich dagegen, dass die politischen Kulturen aus Ost- und WestBerlin in der Zeit vor 1990 verloren gehen würden, und sie wollten, dass das spezifisch Berlinische der Berliner FDP erhalten bleibe. Dabei taten sich sogar Ossis und Wessis gelegentlich zusammen, weil sie etwas dagegen hatten, dass ihr Landesverband zur Beute der Karrieresüchte einer herbeigeeilten hauptstädtischen Dienstklasse würde. So betonten sie die Rechte und Interessen der Stadtbezirke, der Kieze und der dort lebenden Menschen mit ihren Sorgen und Anliegen. Ihre Partei sollte in erster Linie eine für die Menschen und weniger für die Weltgesellschaft sein. Die hauptstädtische Dienstklasse dagegen fand das Bodenständige und die alten Geschichten der Region spießig und überhaupt nicht passend zu den eigenen Erfahrungen aus Godesberg, Neu-Ulm oder auch Radeberg. Es irritierte Alteingesessene, wenn ein Berliner Nachwuchspolitiker sagte, der Spitzenkandidat der Berliner CDU für das Abgeordnetenhaus sei ein achtbarer Gegner, dem man anrechnen müsse, dass er in der Lage sei, seine Meinung zu ändern – auch in der Hauptstadtfrage. Bei der Bonn-Berlin-Debatte im Bundestag jedoch war Friedbert Pflüger schon ein gewählter Abgeordneter und mithin wahrscheinlich im Vollbesitz seiner politischintellektuellen Möglichkeiten gewesen: Der ehemalige Redenschreiber des Regierenden Bürgermeisters Richard von Weizsäckers setzte aufs falsche Pferd und sprach vehement gegen Berlin als Hauptstadt. Ausgerechnet der wurde nun CDU-Spitzenkandidat in Berlin und möglicher Partner anderer Parteien. Ob einer „hauptstädtischer Dienstleister“ oder „Altberliner“ wurde, hing allerdings nicht unbedingt von der persönlichen Biographie ab. Das war eine Frage der Sensibilität. Vielen Bundespolitikern kamen die hauptstädtischen Verbände politisch fremd vor. Unter dessen neuen und alten Mitgliedern fanden diese Bundespolitiker etliche, die bereit waren, ihnen dabei zu helfen, den Berliner Parteien das Berlinische auszutreiben. Schließlich winkte so manche Pfründe in und mit den Bundesparteien. Umgekehrt gab es aber auch viele „Zugezogene“, welche die Eigenart der Berliner begriffen und sie in Politik umsetzen wollten oder das sogar auch getan haben. So einer war beispielsweise der damalige 2 Bundesbauminister Klaus Töpfer, der im Gegensatz zu seiner Vorgängerin den Umzug der Hauptstadt von Bonn nach Berlin überhaupt erst ermöglicht hatte. Die Berlinischen wussten, dass Berlin mehr noch als andere Städte Zuzug braucht. Das war nicht neu. Ohne den Zuzug würde die Metropole verdorren. Es ging aber darum, dass es in den örtlichen Parteien viele gab, die Politik auch für die Alteingessenen und nicht nur für die Berater der „politischen Klasse“ wollten. Die Parteien mussten sich 2006 zu den Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahlen im Herbst entscheiden, welcher „Kultur“ oder „Philosophie“ sie sich verschreiben würden: Derjenigen der Stadt mit ihren Traditionen und Problemen oder derjenigen der Bundesführungen, die im Falle der FDP es seit 1998 drei Mal „geschafft“ hatte, bei Bundestagswahlen in der Opposition zu landen. In den Führungsgremien der Berliner Parteien saßen viele, die sich an den jeweiligen Bundesparteien und nicht an der Stadt orientierten. Als diese geteilt war, mochten diese Parteiführer sich hier noch nicht engagieren. Nun waren sie da. Das war gut so, aber sie sollten sich darauf konzentrieren, die Verantwortlichen in der Bundespolitik zu beraten: Das ist nötig und wichtig genug. Noch einmal zur Berliner FDP: Seit 2001 hatte die Partei wieder eigene Abgeordnete und Bezirksverordnete. Die meisten von denen hatten nach einem parlamentarischen „Aus“ die Chance erhalten, zu erfahren, was in der Stadt wirklich geschieht und wie viele Menschen durch neoliberale Politik auch der SPD und der Grünen in Not geraten sind. Diese Mandatsträger konnten sehen, wie wichtig für das Leben in Berlin der seit 1920 praktizierte bezirkliche Aufbau der Stadt ist. Sie mussten sich darüber wundern, dass es einige vermeintliche Rationalisten unter ihnen gab, die mit dieser Tradition brechen wollten. Nach der Wahl 2001 hatte ein Parteitag beschlossen, die Berliner FDP möge mit ihren neuen Mandatsträgern den Liberalismus für die Hauptstadt „neu erfinden“. Leider bemächtigten sich Hilfswillige der neuen Dienstklasse dieser Aufgabe und heraus kam ganz im Sinne der neoliberalen Bundespartei FDP die unberlinische und daher schon vergessene „Berliner Freiheit“. Die Mandatsträger mit Blick für die wirkliche Lage der Berliner kämpften indes dafür, dass der Landesverband Berlin innerhalb der FDP ein eigenständiges Gebilde bleiben sollte: eine Großstadtorganisation, welche die Traditionen der Region bewahrt und im Unterschied zum Bundesverband die soziale Verantwortung betont. Die herbeigeeilte hauptstädtische Dienstklasse hätte solche Rückbesinnung ertragen können. Sie war ja nicht da, um den Berlinern zu sagen, was sie falsch gemacht hatten und wo es lang 3 ginge. Denn wären die „Altberliner“ während der Teilung nicht geblieben, würde die Dienstklasse noch immer in Bonn werkeln. Hinter dem Siebengebirge würde sie ihre Erfahrungen aus Hannover oder der Oberpfalz ausleben. An der Spree allerdings werden spätestens ihre Kinder den Rhythmus, der zwischen Kiez und Weltstadt klingt, erspüren: ganz so wie es dem alten Berlin-Gegner Johannes Rau mit seinem Nachwuchs ergangen ist. Berlin aber sollte sich auf die Berlinversteher unter den Hilfswilligen verlassen. Die anderen Hilfswilligen sollten sich darauf konzentrieren, ihre Abgeordneten zu beraten, ihre Landesvertretungen zu führen oder ihre Geschäftsstellen auf Trapp zu halten. Von der Berliner FDP unter anderem nehmen sie besser die Finger. Diese Partei hatte es unter sehr verschiedenen Umständen in den Zeiten ihren Vorsitzenden Carl-Hubert Schwennicke, William Borm, Hermann Oxfort, Wolfgang Lüder, Walter Rasch und Günter Rexrodt immer selber verstanden, die Politik jeweils für die Berliner der Zeit gemäß zu formulieren. Dabei ist irrelevant, was einige dieser Politiker später getan haben oder was posthum über sie bekannt geworden ist. Zu ihrer Zeit waren sie Berlinversteher, ebenso wie bei den großen Parteien Ernst Reuter, Willy Brandt oder Richard von Weizsäcker. Dabei könnte es auch bleiben. Berlin ist ein sozialer Brennpunkt in der Republik. Berlin hat aber auch aus der Zeit der Teilung des Landes mehr Erfahrungen mit der Nation als andere Orte in Ost und West. Wenn eine Partei hier erfolgreich sein will, muss sie sich von der Bundespartei unterscheiden. Die Berliner Politiker müssen sozialer sein als die anderen, sie müssen die Geschichte der Nation, aber auch die Beziehungen zu den ehemaligen Siegern mehr beachten, und sie müssen Freiheit und Rechtstaatlichkeit höher halten als alle anderen. In der Berliner Politik haben sich nach dem Hauptstadtumzug bundespolitische Dienstleister der Parteien breit gemacht. Sie sind eine neue Oligarchie, die vor allem am Fortleben der jeweiligen Bundesparteiorganisationen interessiert ist. Das bringen sie in die Landesverbände ein. Hier nun müssen sich - so lautet ein bewährtes Rezept gegen das „eherne Gesetz der Oligarchie“ – „Gegeneliten“ bilden, die sich an den Bodenständigen orientieren. In der neuen Hauptstadt Berlin wird das alte Klagelied von der Oligarchie gesungen. Die Parteienforschung kennt das schon lange, aber nicht nur die erste, sondern auch die zweite Strophe. Und die handelt davon, dass der „nach oben“ orientierten Oligarchie eine „nach unten“ ausgerichtete Strategie entgegen gesetzt werden kann. Jürgen Dittberner 4