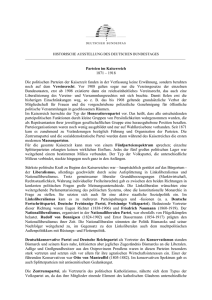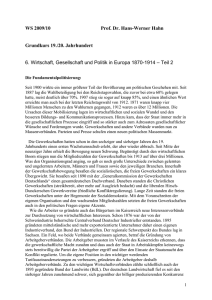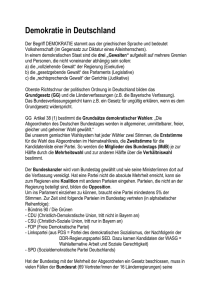Prof. Dr. Hans-Werner Hahn Vorlesung Wintersemester 2010/11 Mi
Werbung
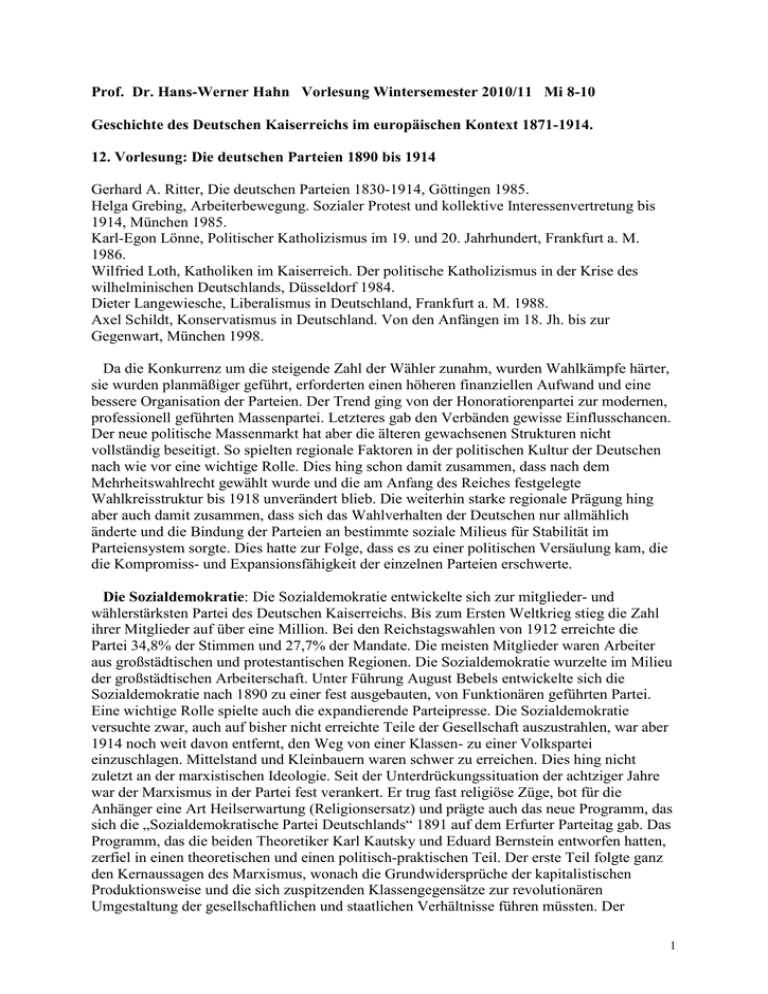
Prof. Dr. Hans-Werner Hahn Vorlesung Wintersemester 2010/11 Mi 8-10 Geschichte des Deutschen Kaiserreichs im europäischen Kontext 1871-1914. 12. Vorlesung: Die deutschen Parteien 1890 bis 1914 Gerhard A. Ritter, Die deutschen Parteien 1830-1914, Göttingen 1985. Helga Grebing, Arbeiterbewegung. Sozialer Protest und kollektive Interessenvertretung bis 1914, München 1985. Karl-Egon Lönne, Politischer Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1986. Wilfried Loth, Katholiken im Kaiserreich. Der politische Katholizismus in der Krise des wilhelminischen Deutschlands, Düsseldorf 1984. Dieter Langewiesche, Liberalismus in Deutschland, Frankfurt a. M. 1988. Axel Schildt, Konservatismus in Deutschland. Von den Anfängen im 18. Jh. bis zur Gegenwart, München 1998. Da die Konkurrenz um die steigende Zahl der Wähler zunahm, wurden Wahlkämpfe härter, sie wurden planmäßiger geführt, erforderten einen höheren finanziellen Aufwand und eine bessere Organisation der Parteien. Der Trend ging von der Honoratiorenpartei zur modernen, professionell geführten Massenpartei. Letzteres gab den Verbänden gewisse Einflusschancen. Der neue politische Massenmarkt hat aber die älteren gewachsenen Strukturen nicht vollständig beseitigt. So spielten regionale Faktoren in der politischen Kultur der Deutschen nach wie vor eine wichtige Rolle. Dies hing schon damit zusammen, dass nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt wurde und die am Anfang des Reiches festgelegte Wahlkreisstruktur bis 1918 unverändert blieb. Die weiterhin starke regionale Prägung hing aber auch damit zusammen, dass sich das Wahlverhalten der Deutschen nur allmählich änderte und die Bindung der Parteien an bestimmte soziale Milieus für Stabilität im Parteiensystem sorgte. Dies hatte zur Folge, dass es zu einer politischen Versäulung kam, die die Kompromiss- und Expansionsfähigkeit der einzelnen Parteien erschwerte. Die Sozialdemokratie: Die Sozialdemokratie entwickelte sich zur mitglieder- und wählerstärksten Partei des Deutschen Kaiserreichs. Bis zum Ersten Weltkrieg stieg die Zahl ihrer Mitglieder auf über eine Million. Bei den Reichstagswahlen von 1912 erreichte die Partei 34,8% der Stimmen und 27,7% der Mandate. Die meisten Mitglieder waren Arbeiter aus großstädtischen und protestantischen Regionen. Die Sozialdemokratie wurzelte im Milieu der großstädtischen Arbeiterschaft. Unter Führung August Bebels entwickelte sich die Sozialdemokratie nach 1890 zu einer fest ausgebauten, von Funktionären geführten Partei. Eine wichtige Rolle spielte auch die expandierende Parteipresse. Die Sozialdemokratie versuchte zwar, auch auf bisher nicht erreichte Teile der Gesellschaft auszustrahlen, war aber 1914 noch weit davon entfernt, den Weg von einer Klassen- zu einer Volkspartei einzuschlagen. Mittelstand und Kleinbauern waren schwer zu erreichen. Dies hing nicht zuletzt an der marxistischen Ideologie. Seit der Unterdrückungssituation der achtziger Jahre war der Marxismus in der Partei fest verankert. Er trug fast religiöse Züge, bot für die Anhänger eine Art Heilserwartung (Religionsersatz) und prägte auch das neue Programm, das sich die „Sozialdemokratische Partei Deutschlands“ 1891 auf dem Erfurter Parteitag gab. Das Programm, das die beiden Theoretiker Karl Kautsky und Eduard Bernstein entworfen hatten, zerfiel in einen theoretischen und einen politisch-praktischen Teil. Der erste Teil folgte ganz den Kernaussagen des Marxismus, wonach die Grundwidersprüche der kapitalistischen Produktionsweise und die sich zuspitzenden Klassengegensätze zur revolutionären Umgestaltung der gesellschaftlichen und staatlichen Verhältnisse führen müssten. Der 1 der zweite Teil aber erhob nicht die Forderung nach Revolution und Vergesellschaftung aller Produktionsmittel. Er beschränkte sich auf praktische Forderungen zur Demokratisierung des Staates und zur sozialen Besserstellung der Arbeiter. Eine grundsätzliche Äußerung zur künftigen staatlichen Ordnung – demokratische Republik oder Diktatur des Proletariats – fehlte völlig. Die Sozialdemokratie folgte mit dem Erfurter Programm der Überzeugung Kautskys, die dieser aus seinem Marxverständnis abgeleitet hatte. Die sozialökonomische Entwicklung lief demnach gesetzmäßig auf das Ende der Klassenherrschaft und des bestehenden Staates zu. Bis dahin sollte sich die Sozialdemokratie innerhalb des bestehenden Systems um politische und soziale Verbesserungen bemühen. Der Widerspruch zwischen theoretischen Vorgaben und praktischer Politik sorgte bald für parteiinternen Streit. Die vor allem in Süddeutschland beheimateten Reformisten wie Georg von Vollmar betrieben eine auf dem Boden der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung stehende Reformpolitik, ohne aber die theoretischen Grundaussagen der Partei in Frage stellen zu wollen. Die Revisionisten um Eduard Bernstein forderten, dass die Partei angesichts ganz anders verlaufender sozialökonomischer Tendenzen auch ihre radikal-revolutionären Dogmen aufgeben sollte, Bernstein konnte sich auf den Parteitagen zu Beginn des 20. Jahrhunderts damit jedoch nicht durchsetzen. Die Mehrheit um Bebel und Kautsky verwarf aber auch die andere Alternative, die von der radikalen Linken um Rosa Luxemburg kam. Sie wollte wie Bernstein Theorie und Praxis in Einklang bringen, aber eben dadurch, dass die Sozialdemokratie keine Politik des revolutionären Attentismus betrieb, sondern durch stärkere Mobilisierung der Massen auf die politisch-soziale Revolution zusteuerte. Es waren nicht zuletzt die Gewerkschaften, die sich einem solchen Kurs widersetzten. Die Sozialdemokratie hatte zwar in ihrer praktischen Politik begonnen, sich immer mehr in das Staats- und Gesellschaftssystem des Kaiserreichs zu integrieren, blieb aber angesichts staatlich-gesellschaftlicher Diskriminierung wie eigener Abschottung noch immer in einer Außenseiterposition. Zentrum: Zweitgrößte Partei nach der Sozialdemokratie war das Zentrum. 1912 erhielt die Partei noch 16,4% der Stimmen. Das reichte dank vieler sicherer Wahlkreise noch für 23% der Mandate. Das Zentrum blieb das gesamte Kaiserreich hindurch fest im katholischen Milieu verankert, allerdings lockerten sich auch hier allmählich die Bindungen. Es stützte sich auf Honoratioren in den Wahlkreisen, auf Kirche und Klerus und auf ein breites katholisches Vereinswesen: Bauernvereine, christliche Gewerkschaften, Borromäusverein und vor allem den 1890 entstandenen Volksverein für das katholische Deutschland. Diese Vereine sicherten dem Zentrum einen breiten Anhang. Verbindendes Glied aller im Zentrum vereinten Gruppen war die katholische Religion und das Bestreben, die Einheit und die gemeinsamen Interessen des Katholizismus im politischen Raum zu vertreten. In der Politik des Zentrums vereinten sich moderne (Rechtsstaat, Sozialpolitik, Wahlrecht) und traditionale Elemente (christlicher Wertekatalog, Schulpolitik). In vielen Fragen wurde der Konsens innerhalb der Partei, je länger das Kaiserreich dauerte, jedoch immer brüchiger. Die Anhängerschaft des Zentrums kam aus vier sehr unterschiedlichen sozialen Gruppen, die durch die katholische Religion als mentalitätsprägendes Deutungsmuster zusammengehalten wurden. Die erste bildeten der katholische Adel und die kirchliche Hierarchie, die zu Beginn des Zentrums noch eine wichtige Rolle spielten, dann aber mit der Massenpolitisierung an Einfluss verloren. Die zweite Gruppe war das katholische Bürgertum. Die dritte Gruppe waren agrarische und mittelständische Populisten, deren soziale und politische Forderungen zum Teil auf Widerspruch der Bürgerlichen stießen (Schutzzoll, Gewerbeordnung). Die vierte Gruppe war schließlich die katholische Arbeitnehmerschaft. Aus dieser Zusammensetzung ergab sich eine komplizierte innenpolitische Situation, die Klassenkonflikte der Gesellschaft schlugen schließlich auch immer stärker auf die Partei durch, es gab innere Machtkämpfe und Machtverschiebungen. Zunächst löste das Bürgertum in der Parteiführung den Adel und die kirchlicher Hierarchie ab. Nach 1900 gewann vor allem 2 der populistische Flügel, in dem Matthias Erzberger eine wichtige Rolle spielte, an Einfluss. Über die Funktion des Zentrums im politischen System des Kaiserreichs ist viel gestritten worden. Die einen sahen im Zentrum bereits eine moderne Volkspartei mit demokratischem Charakter; andere betonten vor allem den konservativen und das System stabilisierenden Charakter des Zentrums. Differenzierter argumentiert Loth, für den die Politik des Zentrums sowohl beharrende als auch moderne Züge trug. Es habe einerseits durch die Integration von Massen und die stärkere Rolle im politischen Prozess (Mehrheitsbeschaffer im Reichstag) Demokratisierungs- und Parlamentarisierungstendenzen gefördert, angesichts der inneren Gegensätze und gegenläufigen Interessen diesen Kurs aber bis 1914 andererseits nicht konsequent genug zu Ende geführt. Liberale Parteien: Der Liberalismus hatte um 1900 mit seinen Politikangeboten an Attraktivität eingebüßt, er war nicht mehr die klar dominierende Kraft innerhalb des Parteienspektrums und hat von der Politisierung der Massen am wenigsten profitiert. Die Liberalen versuchten zwar, ihre Organisationen auszubauen, einen engeren Schulterschluss mit den neuen Verbänden im bürgerlichen Lager zu suchen (Nationalliberale und Bund der Industriellen) und mit der Flotten- und Weltpolitik neue Themenfelder zu finden, konnten damit aber den verlorenen Boden nicht mehr zurückgewinnen. Die „liberalen Imperialisten“ setzten darauf, dass nur ein modernes Deutschland die weltpolitischen Aufgaben bewältigen könne und deshalb Reformen im Sinne der Liberalen anstreben müsse. Friedrich Naumann, der zu dieser Gruppe gehörte, versuchte die Liberalen darüber hinaus durch eine Politik des Sozialliberalismus wieder attraktiv zu machen. Sein 1896 gegründeter Nationalsozialer Verein, der die Arbeiterschaft durch demokratische und soziale Reformen mit dem Staat des Kaiserreichs versöhnen wollte, scheiterte jedoch. 1903 schloss sich Naumann der linksliberalen Freisinnigen Vereinigung an. Innerhalb des zersplitterten Linksliberalismus unternahm man 1910 noch einmal den Versuch, alle Organisationen in der Freiheitlichen Volkspartei zusammenzuführen. Zugleich verstärkte man die Verbindung zu bürgerlichen Verbänden. Zum Sympathisantenumfeld gehörten der Bund deutscher Frauenvereine, Vereine des Kulturprotestantismus und vor allem der 1909 gegründete Hansa-Bund. Im letzteren schlossen sich zahlreiche bürgerliche Organisationen zusammen, um eine konservativagrarische Reichspolitik zu bekämpfen. Der Hansa-Bund sollte ein wichtiger Reformmotor werden und trat auch für die Kooperation mit der Sozialdemokratie ein. Seine Erfolge waren jedoch begrenzt. Die bedeutendste Kraft im liberalen Lager blieb bis 1914 die nationalliberale Partei. Sie war um 1890 noch eine reine Honoratiorenpartei. Auf die Massenpolitisierung suchte man durch engere Kooperation mit den Verbänden zu reagieren. Erst 1907 verstärkten jungliberale Kräfte, darunter Gustav Stresemann, die Bemühungen um den Ausbau der Partei durch Gründung von Ortsvereinen und eine gezielte Mitgliederwerbung. Der Liberalismus konnte auch am Ende des Kaiserreichs nicht mehr an seine Stellung in den frühen siebziger Jahren anknüpfen. Das hing damit zusammen, dass viele seiner Ideen längst große Teile der Gesellschaft durchzogen. Dies galt für Verfassungs- und Rechtsstaatsidee, für den Bildungsgedanken und nicht zuletzt für die Idee der Nation. Die Konservativen: Die Konservativen standen für Autorität statt Majorität, gegen den Parlamentarismus, gegen die Alleinherrschaft des Marktes und gegen die Trennung von Staat und Kirche. Den Nationalstaat, den die Konservativen lange bekämpft hatten, machten sie seit 1878/79 zunehmend zur eigenen Angelegenheit. Im Zeitalter der Massenpolitik schienen nationale Parolen geeignet, um neue Wähler an die Konservativen zu binden. So konnten auch die Konservativen zwischen 1890 und 1914 die Zahl der Wähler leicht ausbauen, bei den Stimmenanteilen fielen sie jedoch nun deutlicher zurück. Bei den Mandaten machte sich der Bedeutungsverlust weniger stark bemerkbar, da die Konservativen von der ungerechten Wahlkreis-Einteilung und Bevorzugung der ländlichen Regionen profitierten. Die Deutsch3 Konservativen, größte Partei im konservativen Spektrum, hatte nach wie vor ihre Hochburgen im ländlich-agrarischen Ostelbien. Im preußischen Abgeordnetenhaus, das nach dem Dreiklassen-Wahlrecht gewählt wurde, waren die Konservativen deutlich stärker als im Reichstag. 1892 gaben sich die Deutsch-Konservativen ein neues Programm, das auch gegenüber den städtischen Mittelschichten und der Arbeiterschaft neue Angebote machte. Ziel war es, eine konservative Volkspartei aufzubauen. Als Integrationsklammer diente hierbei auch der Antisemitismus. Das Parteiprogramm sprach sich für die Zurückweisung des jüdischen Einflusses auf Staat und Gesellschaft und für das Prinzip des christlichen Staates aus. Diese Passagen gingen zurück auf Ideen des Berliner Hofpredigers Stöcker, dessen Christlich-Soziale Partei sich im Umfeld der Konservativen bewegte. Als Stöckers Strategie bei den Wahlen von 1893 wenig Erfolge brachte und er sich auch in anderen Fragen mit der Führung der Konservativen überwarf, trennte man sich erst einmal wieder. Eine dauerhafte Massenbasis für die Konservativen, die ebenso wie die Liberalen keine feste Parteiorganisation hatten, brachte das Bündnis mit dem Bund der Landwirte. Der Bund kanalisierte das ländliche Protestpotential, das sich zeitweise radikalen Antisemitenparteien zugewandt hatte, führte es den Deutschkonservativen zu und stärkte deren Basis. Ganz problemlos war aber auch diese Kooperation nicht, weil die Agrarier die Konservativen in einer Weise zu instrumentalisieren suchten, die denen in manchen Fragen zu weit ging (Mittellandkanal). Neben den Deutsch-Konservativen existierte weiterhin die Freikonservative oder Reichspartei. Ihr Einfluss ging aber seit 1890 kontinuierlich zurück. III. Antisemitismus Sh. Volkov, Die Juden in Deutschland 1780-1918 (=EDG, Bd. 16), 2. Verb. Aufl., München 1994. Der seit 1873 hervortretende moderne Antisemitismus knüpfte einerseits an ältere Formen der Judenfeindschaft an, enthielt aber insofern neue Elemente, weil er sich nun gegen eine emanzipierte jüdische Minderheit richtete, vor allem gegen die assimilierten Juden, die als Agenten der Moderne angesehen wurden und für alle Krisen dieser Moderne verantwortlich gemacht wurden. Der moderne Antisemitismus schloss sich zudem in Parteien und Verbänden zusammen und erfuhr vor allem durch die Aufnahme von Rassentheorien und völkischen Vorstellungen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine weitere Verschärfung. Er richtete sich nicht mehr allein gegen Glaubensjuden, sondern auch gegen christliche deutsche Staatsbürger mit jüdischen Vorfahren. Die Gründung der Christlich-sozialen Partei des Berliner Hofpredigers Stöcker und der vom Historiker Treitschke ausgelöste Berliner Antisemitismusstreit zeigten schon Ende der siebziger Jahre, dass der Antisemitismus sowohl im Bildungsbürgertum als auch im Mittelstand Aufnahme fand. Hier wurde jetzt offen verlangt, die rechtliche Gleichstellung der Juden wieder aufzuheben. Dennoch blieb den aufkommenden Antisemitenparteien im Kaiserreich ein politischer Durchbruch versagt. 1893 kamen sie auf 16 Reichstagsmandate, 1907 auf 22. Letztlich hatte der parteipolitische Antisemitismus nur regional begrenzte Erfolge wie in Hessen, wo der Marburger Bibliothekar Otto Böckel mit einem populistischen, gegen die Hierarchien in Staat und Gesellschaft gerichteten Antisemitismus unter den Bauern große Erfolge erzielte. Angesichts innerer Gegensätze und zwielichtiger Persönlichkeiten gelang es den Antisemitenparteien zu keinem Zeitpunkt, eine eigene große Partei zu gründen und damit den antisemitischen Protest zu bündeln. Dieses Scheitern darf nun aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich antisemitisches Denken in der Gesellschaft des Kaiserreichs um 1900 auf vielfache Weise ausgebreitet hatte. Es gab um 1900 zweifellos in weiten Teilen der nichtjüdischen Gesellschaft ein wachsendes Ressentiment gegen die Juden, das häufig auch mit 4 Konkurrenzängsten und Konkurrenzneid zusammenhing. Die Verbände des Mittelstandes und der Bund der Landwirte nutzten den Antisemitismus als Integrationsklammer und zur Mobilisierung ihrer Anhänger. Die großen Parteien verurteilten zwar den Radauantisemitismus, eine kompromisslose Absage kam aber nur von Sozialdemokraten und Linksliberalen. Der Staat des Kaiserreichs nahm die vollzogene Gleichstellung der Juden nie zurück, und er schützte die Juden in Deutschland weitgehend erfolgreich vor gesellschaftlicher Gewalt. Auf der anderen Seite waren aber im Staatsapparat, im Militär und in der Justiz antisemitische Strömungen weit verbreitet, die sich in der Verweigerung von Aufstiegschancen für Juden niederschlugen. Der Antisemitismus war in Deutschland einerseits kein beherrschender Faktor der politischen Kultur. Er wurde auch von den Juden selbst nicht so empfunden. Andererseits wuchsen allgemeine Vorbehalte gegenüber der jüdischen Minderheit, und durch die Kooperation der Konservativen mit antisemitischen Splitterparteien (etwa in den Stichwahlen) und mit antisemitisch geprägten Verbänden (BdL) gewann antisemitisches Gedankengut auch in Organisationen an Einfluss, die sich nicht offen als antisemitisch einstuften. IV. Nationalismus Der Nationalismus war eine wichtige Prägekraft im politisch-gesellschaftlichen Leben des Kaiserreichs. Er spielte innerhalb der Massenpolitisierung eine zentrale Rolle. Die Nationalisierung der Massen war ein Grundzug der europäischen Geschichte des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Deutsche Besonderheiten zeigen sich aber darin, dass sich im Kaiserreich um 1900 eine neue Variante des europäischen Nationalismus stärker als anderswo bemerkbar machte: der sogenannte völkische Nationalismus oder auch Radikalnationalismus. Der deutsche Nationalismus vor und nach 1914 ist aber nicht ausschließlich mit dieser Variante gleichzusetzen. Thomas Nipperdey unterscheidet drei Formen. Er spricht zunächst einmal von einem Nationalpatriotismus. Hierunter versteht er das, was man als Wir-Gefühl oder als deutsche Identität bezeichnen kann. Bis 1914 schwanden in der deutschen Gesellschaft viele ursprüngliche Vorbehalte gegen diese nationale Identität. Am Ende des Kaiserreichs waren regionale Bindungen des einzelnen noch immer wichtig, man war Bayer, Württemberger oder Thüringer, aber diese einzelstaatliche oder regionale Identität wurde überwölbt von der des Reiches. Im Zuge dieses Prozesses schwanden auch die Vorbehalte von Katholiken gegen das neue Preußen-Deutschland, und selbst die meisten Sozialdemokraten konnten sich diesem Nationalpatriotismus nicht entziehen. Dies hing zweifellos auch mit den Leistungen zusammen, die der Staat des Kaiserreichs für die Alltagsbewältigung der Menschen erbrachte. Als zweiten Typus nennt Nipperdey den „Normal-Nationalismus“. Gemeint sind zum einen ein gouvernementaler, von der Regierung genutzter und geförderter Nationalismus und zum anderen auch ein autonomer Nationalismus von Parteien und Verbänden. Über Schule, Heer, nationale Feiern, Denkmäler und Vereine wie Sänger-, Turner-, Schützen- und Kriegervereine wurde der Nationalismus zu einem Massenphänomen. In diesem Zusammenhang verstärken sich die Elemente von Abgrenzung nach innen und nach außen. Nach innen sollte der Nationalismus gegen vermeintliche Reichsfeinde mobilisieren, nach außen gegen den „Erbfeind“ Frankreich, gegen Russland und immer stärker auch gegen den Konkurrenten Großbritannien. Der offizielle Nationalismus kam in den Denkmälern für Kaiser Wilhelm I. zum Ausdruck. Der autonome Nationalismus der Gesellschaft kam in den vielen BismarckDenkmälern und Türmen zum Ausdruck, die seit den späten neunziger Jahren entstanden. Das Symbol der Nation ist hier nicht mehr die Monarchie, der Symbolheld Bismarck repräsentiert die Nation an sich. Reichs- und Normalnationalismus waren Faktoren, die zur Stabilität des politischen Systems beitrugen. Beim dritten Typus, dem Radikalnationalismus, traten dagegen die systemkritischen Elemente stark hervor. Die politische Ordnung des Kaiserreichs wurde als 5 unzureichend angesehen, um die neuen nationalen Forderungen nach außen und innen machtvoll durchsetzen zu können. Im Radikalnationalismus verstand man die Nation als Volksnation, und zwar nicht mehr nur im Sinne älterer Vorstellungen als von Sprache und Kultur bestimmte Volksnation, sondern nun zunehmend im rassenbiologischen Sinne als eine Abstammungsgemeinschaft. Zu dem völkischen Umfeld gehörten der Deutschbund Friederich Langes, die Gobineau-Vereinigungen und die Richard-Wagner-Vereine. Gerade im Bildungsbürgertum wuchs um 1900 die Bereitschaft, den Vorgaben der völkisch-rassischen Propheten zu folgen und die Ideen Lagardes, Langbehns, Chamberlains von der Überlegenheit der nordisch-arischen Rasse zu übernehmen. Getragen wurde das ganze auch von der Großstadt- und Zivilisationskritik, die dann in eine Blut- und Bodenideologie mündete. All das machte den völkischen Nationalismus besonders expansiv und aggressiv. Seit den neunziger Jahren begann sich die neue radikale Rechte in Verbänden zu organisieren. Die wichtigste dieser Organisationen war der Alldeutsche Verband. Die Alldeutschen propagierten ein koloniales Imperium des Reiches und wollten zugleich die außerhalb des Deutschen Reiches stehenden deutschen Bevölkerungsteile durch ein größeres kontinentaleuropäisches Reich von den Niederlanden bis zum Baltikum und die deutschen Gebiete der Habsburger Monarchie in ein völkisches Staatswesen einbeziehen. Die Erfolge des Alldeutschen Verbandes waren zunächst sehr begrenzt. 1908 geriet der Verband in eine schwere Existenzkrise, konnte sich aber unter Führung von Heinrich Claß und durch Unterstützung von Industriellen wie Krupp (mit Generaldirektor Hugenberg) konsolidieren. Danach schlug er endgültig die völkisch-antisemitische Richtung ein. Jetzt verbesserten sich auch seine Kontakte zur Reichsregierung wie zu den traditionellen Konservativen. Die neue Rechte hatte zwar in der deutschen Wählerschaft keine Mehrheit, konnte aber bei Themen wie der deutschen Wehrkraft durchaus Massen mobilisieren, indem sie andere große Verbände wie den Bund der Landwirte, den Flottenverein oder den deutschnationalen Handlungsgehilfenverband in die Agitation einbezog. Sie fand auch Rückhalt in Teilen des staatlichen und militärischen Establishments und unter den Journalisten wie Professoren (Dietrich Schäfer). Sie schuf ideologische Grundlagen und organisatorische Netzwerke, auf denen andere in den zwanziger Jahren aufbauen konnten, wenngleich die Thesen einer ungebrochenen Kontinuität zwischen 1890 und 1933 in der neueren Forschung eher relativiert werden. 6