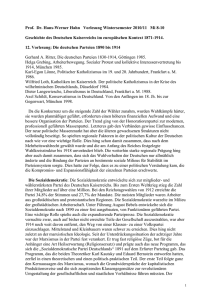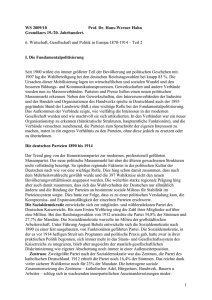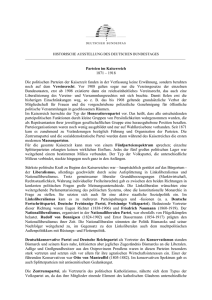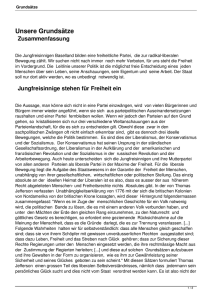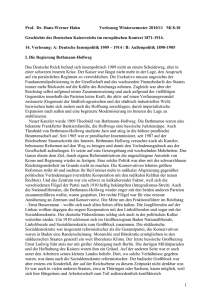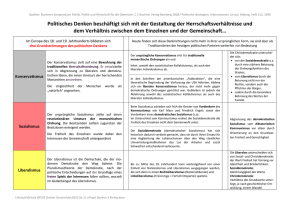grundkurs-06
Werbung

WS 2009/10 Prof. Dr. Hans-Werner Hahn Grundkurs 19./20. Jahrhundert 6. Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in Europa 1870-1914 – Teil 2 Die Fundamentalpolitisierung: Seit 1900 wirkte ein immer größerer Teil der Bevölkerung am politischen Geschehen mit. Seit 1887 lag die Wahlbeteiligung bei den Reichstagswahlen, die zuvor bei etwa 60% gelegen hatte, meist deutlich über 70%. 1907 stieg sie sogar auf knapp 85%, und einen ähnlichen Wert erreichte man auch bei der letzten Reichstagswahl von 1912. 1871 waren knapp vier Millionen Menschen zu den Wahlurnen gegangen, 1912 waren es über 12 Millionen. Die Ursachen dieser Mobilisierung lagen im wirtschaftlichen und sozialen Wandel und den besseren Bildungs- und Kommunikationsprozessen. Hinzu kam, dass der Staat immer mehr in die gesellschaftlichen Prozesse eingriff und so stärker auch zum Adressaten gesellschaftlicher Wünsche und Forderungen wurde. Gewerkschaften und andere Verbände wurden nun zu Massenverbänden. Parteien und Presse schufen einen neuen politischen Massenmarkt. Die Gewerkschaften hatten schon in den sechziger und siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts einen ersten Wachstumsschub erlebt, der aber wieder abbrach. Seit Mitte der neunziger Jahre erhielt die Bewegung neuen Schwung. Begünstigt durch den wirtschaftlichen Boom stiegen nun die Mitgliedszahlen der Gewerkschaften bis 1913 auf über drei Millionen. Was den Organisationsgrad anging, so gab es noch große Unterschiede zwischen gelernten und ungelernten Arbeitern, Männern und Frauen sowie den jeweiligen Branchen. Innerhalb der Gewerkschaftsbewegung besaßen die sozialistischen, die freien Gewerkschaften ein klares Übergewicht. Sie besaßen seit 1890 mit der „Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands“ einen gesamtdeutschen Dachverband. Daneben standen die Christlichen Gewerkschaften (streikbereit, aber mehr auf Ausgleich bedacht) und die liberalen HirschDunckerschen Gewerkvereine (friedliche Konfliktregulierung). Lange Zeit standen die freien Gewerkschaften unter der Hegemonie der Sozialdemokratie. Mit dem Voranschreiten der eigenen Organisation und den wachsenden Mitgliedszahlen setzten die freien Gewerkschaften auch in den politischen Fragen eigene Akzente. Wie die Arbeiter so gründete auch das Bürgertum im Kaiserreich neue Interessenverbände zur Durchsetzung von wirtschaftlichen Interessen. Schon 1876 war der von der Schwerindustrie beherrschte Centralverband Deutscher Industrieller entstanden. 1895 gründeten mittelständische und mehr exportorientierte Unternehmer daher einen eigenen Industrieverband, den Bund der Industriellen. Der regionale Schwerpunkt des Bundes lag in Sachsen. Ein Feld, wo beide Verbände gemeinsam agierten, betraf die Gründung von Arbeitgeberverbänden. Die Arbeitgeber mussten im Verlaufe des Kaiserreichs erkennen, dass die gewerkschaftliche Macht zunahm und dass auch der Staat in Arbeitskämpfen keineswegs stets bereitwillig die Partei der Arbeitgeber ergriff und über den Einsatz der Staatsmacht den Konflikt regulierte. Um die eigene Position in den wichtiger werdenden Tarifauseinandersetzungen zu verbessern, gründeten die Arbeitgeber deshalb Arbeitgeberverbände. Zu den wichtigen Wirtschaftsverbänden zählte schließlich auch der 1893 gegründete Bund der Landwirte (BdL). Der deutschen Landwirtschaft fiel es seit den siebziger Jahren zunehmend schwer, sich gegenüber der billiger produzierenden Konkurrenz 1 aus Übersee und Osteuropa zu behaupten. Die Landwirtschaft verlangte Schutzzölle und baute die bestehenden Interessenorganisationen zu schlagkräftigen Verbänden aus. Der BdL baute eine mächtige, professionell geführte Organisation auf, die 1913 etwa 300 000 Mitglieder zählte und bei den Wahlkämpfen vor allem der Deutsch-Konservativen Partei kräftige Unterstützung gab. Auch der alte Mittelstand, Handwerk und Kleinhandel, und der neue Mittelstand, vor allem die Angestellten (Handlungsgehilfenverband), gründeten neue Verbände, um ihr Interessen im Staat wirkungsvoller vertreten zu können. Das Aufkommen der Verbände zeigte erstens, wie vielfältig die Interessen in der modernen Gesellschaft waren und wie machtvoll sie sich artikulierten. In den Verbänden war zweitens ein neuer Organisationstyp zu erkennen (bürokratische Strukturen, hauptamtliche Funktionäre). Die Verbände wurden drittens zunehmend in die Prozesse politischer Willensbildung einbezogen. Die Verbände versuchten, die Parteien zum Sprachrohr der eigenen Interessen zu machen und traten in ein engeres Verhältnis zu den Parteien, ohne diese jedoch zu ersetzen oder zu übernehmen. I. Die deutschen Parteien 1890 bis 1914 Gerhard A. Ritter, Die deutschen Parteien 1830-1914, Göttingen 1987. Helga Grebing, Arbeiterbewegung. Sozialer Protest und kollektive Interessenvertretung bis 1914, München 1985. Karl-Egon Lönne, Politischer Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1986. Wilfried Loth, Katholiken im Kaiserreich. Der politische Katholizismus in der Krise des wilhelminischen Deutschlands, Düsseldorf 1984. Dieter Langewiesche, Liberalismus in Deutschland, Frankfurt a. M. 1988. Axel Schildt, Konservatismus in Deutschland, München 1996. Da die Konkurrenz um die steigende Zahl der Wähler zunahm, wurden Wahlkämpfe härter, sie wurden planmäßiger geführt, erforderten einen höheren finanziellen Aufwand und eine bessere Organisation der Parteien. Der Trend ging von der Honoratiorenpartei zur modernen, professionell geführten Massenpartei. Letzteres gab den Verbänden gewisse Einflusschancen. Der neue politische Massenmarkt hat aber die älteren gewachsenen Strukturen nicht vollständig beseitigt. So spielten regionale Faktoren in der politischen Kultur der Deutschen nach wie vor eine wichtige Rolle. Dies hing schon damit zusammen, dass nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt wurde und die 397 Wahlkreise nicht den neuen Bevölkerungsverhältnissen angepasst wurden. Die weiterhin starke regionale Prägung hing aber auch damit zusammen, dass sich das Wahlverhalten der Deutschen nur allmählich änderte und die Bindung der Parteien an bestimmte soziale Milieus für Stabilität im Parteiensystem sorgte. Dies hatte zur Folge, dass es zu einer politischen „Versäulung“ kam, die Kompromiß- und Expansionsfähigkeit der einzelnen Parteien erschwerte. Die Sozialdemokratie: Die Sozialdemokratie entwickelte sich zur mitglieder- und wählerstärksten Partei des Deutschen Kaiserreichs. Bis zum Ersten Weltkrieg stieg die Zahl ihrer Mitglieder auf über eine Million. Bei den Reichstagswahlen von 1912 erreichte die Partei 34,8% der Stimmen und 27,7% der Mandate. Die meisten Mitglieder waren Arbeiter aus großstädtischen und protestantischen Regionen. Die Sozialdemokratie wurzelte im Milieu der großstädtischen Arbeiterschaft. Unter Führung August Bebels entwickelte sich die Sozialdemokratie nach 1890 zu einer fest ausgebauten, von Funktionären geführten Partei. Eine wichtige Rolle spielte auch die expandierende Parteipresse. Die Sozialdemokratie versuchte zwar, auch auf bisher nicht erreichte Teile der Gesellschaft auszustrahlen, war aber 1914 noch weit davon entfernt war, den Weg von einer Klassen- zu einer Volkspartei 2 einzuschlagen. Mittelstand und Kleinbauern waren schwer zu erreichen. Dies hing nicht zuletzt an der marxistischen Ideologie. Seit der Unterdrückungssituation der achtziger Jahre war der Marxismus in der Partei fest verankert. Er trug fast religiöse Züge, bot für die Anhänger eine Art Heilserwartung (Religionsersatz) und prägte auch das neue Programm, das sich die „Sozialdemokratische Partei Deutschlands“ 1891 auf dem Erfurter Parteitag gab. Das Programm, das die beiden Theoretiker Karl Kautsky und Eduard Bernstein entworfen hatten, zerfiel in einen theoretischen und politisch-praktischen Teil. Der erste Teil folgte ganz den Kernaussagen des Marxismus, der zweite aber erhob nun nicht die Forderung nach Revolution und Vergesellschaftung aller Produktionsmittel. Er beschränkte sich auf praktische Forderungen zur Demokratisierung des Staates und zur sozialen Besserstellung der Arbeiter. Eine grundsätzliche Äußerung zur künftigen staatlichen Ordnung: demokratische Republik oder Diktatur des Proletariats fehlte völlig. Die Sozialdemokratie folgte mit dem Erfurter Programm der Überzeugung Kautskys, die dieser aus seinem Marxverständnis abgeleitet hatte. Die sozialökonomische Entwicklung lief demnach gesetzmäßig auf das Ende der Klassenherrschaft und des bestehenden Staates zu. Bis dahin sollte sich die Sozialdemokratie innerhalb des bestehenden Systems um politische und soziale Verbesserungen bemühen. Der Widerspruch zwischen theoretischen Vorgaben und praktischer Politik sorgte bald für parteiinternen Streit. Die vor allem in Süddeutschland beheimateten Reformisten wie Georg von Vollmar forderten eine auf dem Boden der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung stehende Reformpolitik. Die Revisionisten um Eduard Bernstein forderten, dass die Partei angesichts ganz anders verlaufender sozialökonomischer Tendenzen auch ihre radikalrevolutionären Dogmen aufgeben sollte, konnten sich auf den Parteitagen zu Beginn des 20. Jahrhunderts damit nicht durchsetzen. Die Mehrheit um Bebel und Kautsky verwarf aber auch die andere Alternative, die von der radikalen Linken um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht kam. Sie wollte wie Bernstein Theorie und Praxis in Einklang bringen, aber eben dadurch, dass die Sozialdemokratie keine Politik des revolutionären Attentismus betrieb, sondern durch stärkere Mobilisierung der Massen auf die politisch-soziale Revolution zusteuerte. Es waren nicht zuletzt die Gewerkschaften, die sich einem solchen Kurs widersetzten. Die Sozialdemokratie hatte zwar in ihrer praktischen Politik begonnen, sich immer mehr in das Staats- und Gesellschaftssystem des Kaiserreichs zu integrieren, blieb aber angesichts der staatlich-gesellschaftlichen Diskriminierung wie eigener Abschottung noch immer in einer Außenseiterposition. Zentrum: Zweitgrößte Partei nach der Sozialdemokratie war das Zentrum. 1912 erhielt die Partei noch 16,4% der Stimmen. Das reichte dank vieler sicherer Wahlkreise noch für 23% der Mandate. Das Zentrum blieb das gesamte Kaiserreich hindurch fest im katholischen Milieu verankert, allerdings lockerten sich auch hier allmählich die Bindungen. Es stützte sich auf Honoratioren in den Wahlkreisen, auf Kirche und Klerus und auf ein breites katholisches Vereinswesen: Bauernvereine, christliche Gewerkschaften, Borromäusverein und vor allem dem 1890 entstandenen Volksverein für das katholische Deutschland. Diese Vereine sicherten dem Zentrum einen breiten Anhang. Verbindendes Glied aller im Zentrum vereinten Gruppen war die katholische Religion und das Bestreben, die Einheit und die gemeinsamen Interessen des Katholizismus im politischen Raum zu vertreten. In der Politik des Zentrums vereinten sich moderne (Rechtsstaat, Sozialpolitik, Wahlrecht) und traditionale Elemente (Wertekatalog, Schulpolitik). In vielen Fragen wurde der Konsens innerhalb der Partei, je länger das Kaiserreich dauerte, immer brüchiger. Das vom Zentrum repräsentierte katholische Milieu untergliederte sich in vier unterschiedliche soziale Gruppen. Die erste war der katholische Adel und die kirchliche Hierarchie, die zu Beginn des Zentrums noch eine wichtige Rolle spielten, dann aber mit der Massenpolitisierung an Einfluss verloren. Die zweite Gruppe war das katholische Bürgertum. Die dritte Gruppe waren agrarische und mittelständische Populisten, deren soziale und politische Forderungen zum Teil auf 3 Widerspruch der Bürgerlichen stießen (Schutzzoll, Gewerbeordnung). Die vierte Gruppe war schließlich die katholische Arbeitnehmerschaft. Aus dieser Zusammensetzung ergab sich eine komplizierte innenpolitische Situation, die Klassenkonflikte der Gesellschaft schlugen auf die Partei durch, es gab innere Machtkämpfe und Machtverschiebungen. Nach 1900 gewann vor allem der populistische Flügel, in dem Matthias Erzberger eine wichtige Rolle spielte, an Einfluss. Über die Funktion des Zentrums im politischen System des Kaiserreichs ist viel gestritten worden. Die einen sahen im Zentrum bereits eine moderne Volkspartei mit demokratischem Charakter; andere betonten vor allem den konservativen und systemstabilisierenden Charakter des Zentrums. Differenzierter argumentiert Loth, für den die Politik des Zentrums sowohl beharrende als auch moderne Züge trug. Es habe einerseits durch die Integration von Massen und die stärkere Rolle im politischen Prozeß (Mehrheitsbeschaffer im Reichstag) Demokratisierungs- und Parlamentarisierungstendenzen gefördert, angesichts der inneren Gegensätze diesen Kurs aber bis 1918 andererseits nicht konsequent genug zu Ende geführt. Liberale Parteien: Der Liberalismus hatte mit seinen Politikangeboten an Attraktivität eingebüßt, er war nicht mehr die klar dominierende Kraft innerhalb des Parteienspektrums und hat von der Politisierung der Massen am wenigsten profitiert. Die Liberalen versuchten zwar, ihre Organisationen auszubauen, einen engeren Schulterschluss mit den neuen Verbänden im bürgerlichen Lager zu suchen (Nationalliberale und Bund der Industriellen) und mit der Flotten- und Weltpolitik neue Themenfelder zu finden, konnten damit aber den verlorenen Boden nicht zurückgewinnen. Die „liberalen Imperialisten“ setzten darauf, dass nur ein modernes Deutschland die weltpolitischen Aufgaben bewältigen könne und deshalb Reformen im Sinne der Liberalen anstreben müsse. Friedrich Naumann, der zu dieser Gruppe gehörte, versuchte die Liberalen darüber hinaus durch eine Politik des Sozialliberalismus wieder attraktiv zu machen. Sein 1896 gegründeter Nationalsoziale Verein, der die Arbeiterschaft durch demokratische und soziale Reformen mit dem Staat des Kaiserreichs versöhnen wollte, scheiterte jedoch. 1903 schloss sich Naumann der linksliberalen Freisinnigen Vereinigung an. Innerhalb des zersplitterten Linksliberalismus unternahm man 1910 noch einmal den Versuch, alle Organisationen in der Freiheitlichen Volkspartei zusammenzuführen. Zugleich verstärkte man die Verbindung zu bürgerlichen Verbänden. Zum Sympathisantenumfeld gehörten der Bund deutscher Frauenvereine, Vereine des Kulturprotestantismus und vor allem der 1909 gegründete Hansa-Bund. Im letzteren schlossen sich zahlreiche bürgerliche Organisationen zusammen, um eine konservativ-agrarische Reichspolitik zu bekämpfen. Der Hansa-Bund sollte ein wichtiger Reformmotor werden und trat auch für die Kooperation mit der Sozialdemokratie ein. Seine Erfolge blieben jedoch begrenzt. Die bedeutendste Kraft im liberalen Lager blieb bis 1914 nationaliberale Partei. Sie war um 1890 noch eine reine Honoratiorenpartei. Auf die Massenpolitisierung suchte man durch engere Kooperation mit den Verbänden zu reagieren. Erst 1907 verstärkten jungliberale Kräfte, darunter Gustav Stresemann, die Bemühungen um Ausbau der Partei durch Gründung von Ortsvereinen und eine gezielte Mitgliederwerbung. Der Liberalismus konnte auch am Ende des Kaiserreichs nicht mehr an seine Stellung in den frühen siebziger Jahren anknüpfen. Das hing auch damit zusammen, dass viele seiner Ideen längst alle Teile oder große Teile der Gesellschaft durchzogen. Dies galt für Verfassungs- und Rechtsstaatsidee, für den Bildungsgedanken und nicht zuletzt für die Idee der Nation. Die Konservativen: Die Konservativen standen für Autorität statt Majorität, gegen den Parlamentarismus, gegen die Alleinherrschaft des Marktes und gegen die Trennung von Staat und Kirche. Den Nationalstaat, den die Konservativen lange bekämpft hatten, machten sie seit 1878/79 zunehmend zur eigenen Angelegenheit. Im Zeitalter der Massenpolitik schienen nationale Parolen geeignet, um neue Wähler an die Konservativen zu binden. So konnten auch die Konservativen zwischen 1890 und 1914 die Zahl der Wähler leicht ausbauen, bei den 4 Stimmenanteilen fielen sie jedoch nun deutlicher zurück. Bei den Mandaten machte sich der Bedeutungsverlust weniger stark bemerkbar, da die Konservativen von der ungerechten Wahlkreis-Einteilung und Bevorzugung der ländlichen Regionen profitierten. Die DeutschKonservativen, größte Partei im konservativen Spektrum, hatte nach wie vor ihre Hochburgen im ländlich-agrarischen Ostelbien. Im preußischen Abgeordnetenhaus, das nach dem Dreiklassen-Wahlrecht gewählt wurde, waren die Konservativen deutlich stärker als im Reichstag. 1892 gaben sich die Deutsch-Konservativen ein neues Programm, das auch gegenüber den städtischen Mittelschichten und der Arbeiterschaft neue Angebote machte. Ziel war es, eine konservative Volkspartei aufzubauen. Eine wichtige Integrationsklammer sollte hierbei auch dem Antisemitismus zufallen. Das Parteiprogramm sprach sich für die Zurückweisung des jüdischen Einflusses auf Staat und Gesellschaft und für das Prinzip des christlichen Staates aus. Diese Passagen gingen zurück auf Ideen des Berliner Hofpredigers Stöcker, dessen Christlich-Soziale Partei sich im Umfeld der Konservativen bewegte. Als Stöckers Strategie bei den Wahlen von 1893 wenig Erfolge brachte und er sich auch in anderen Fragen mit der Führung der Konservativen überwarf, trennt man sich später wieder. Eine dauerhafte Massenbasis für die Konservativen, die ebenso wie die Liberalen keine feste Parteiorganisation hatten, brachte das Bündnis mit dem Bund der Landwirte. Der Bund kanalisierte das ländliche Protestpotential, das sich zeitweise radikalen Antisemitenparteien zugewandt hatte, führte es den Deutschkonservativen zu und stärkte deren Basis. Ganz problemlos war aber auch diese Kooperation nicht, weil die Agrarier die Konservativen in einer Weise zu instrumentalisieren suchten, die denen in manchen Fragen zu weit ging (Mittellandkanal). Neben den Deutsch-Konservativen existierte weiterhin die Freikonservative oder Reichspartei. Ihr Einfluss ging aber seit 1890 kontinuierlich zurück. II. Antisemitismus und Nationalismus Sh. Volkov, Die Juden in Deutschland 1780-11918, München 1994. Der seit 1873 hervortretende moderne Antisemitismus knüpfte einerseits an ältere Formen der Judenfeindschaft an, enthielt aber insofern neue Elemente, weil er sich nun gegen eine emanzipierte jüdische Minderheit richtete, die assimilierten Juden und die bekämpfte Moderne weitgehend gleichsetzte, sich zu Parteien und Verbänden zusammenschloss und durch die Aufnahme von Rassentheorien und völkischen Vorstellungen eine Verschärfung erfuhr. Er richtete sich nicht mehr allein gegen Glaubensjuden, sondern auch gegen christliche deutsche Staatsbürger mit jüdischen Vorfahren. Die Gründung der Christlich-sozialen Partei des Berliner Hofpredigers Stöcker und der vom Historiker Treitschke ausgelöste Berliner Antisemitismusstreit zeigten Ende der siebziger Jahre, dass der Antisemitismus sowohl im Bildungsbürgertum als auch im Mittelstand von 1878 Aufnahme fand. Dennoch blieb den aufkommenden Antisemitenparteien ein politischer Durchbruch versagt. 1893 kamen sie auf 16 Reichstagsmandate, 1907 auf 22. Letztlich hatte der parteipolitische Antisemitismus nur regional begrenzte Erfolge wie in Hessen, wo der Marburger Bibliothekar Otto Böckel mit einem populistischen, gegen die Hierarchien in Staat und Gesellschaft gerichteten Antisemitismus unter den Bauern große Erfolge erzielte. Angesichts innerer Gegensätze und zwielichtiger Persönlichkeiten gelang es den Antisemitenparteien nicht, eine eigene große Partei zu gründen und den antisemitischen Protest zu bündeln. Dieses Scheitern darf nun aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich antisemitisches Denken in der Gesellschaft des Kaiserreichs um 1900 auf vielfache Weise ausgebreitet hatte. Es gab um 1900 zweifellos in weiten Teilen der nichtjüdischen Gesellschaft ein wachsendes Ressentiment gegen die Juden, das häufig auch mit Konkurrenzängsten und Konkurrenzneid zusammenhing. Die Verbände des Mittelstandes und der Bund der Landwirte nutzten den Antisemitismus als Integrationsklammer und zur Mobilisierung ihrer Anhänger. Die großen Parteien verurteilten zwar den Radauantisemitismus, eine kompromisslose Absage kam aber nur von 5 Sozialdemokraten und Linksliberalen. Der Staat des Kaiserreichs nahm die vollzogene Gleichstellung der Juden nie zurück, und er schützte die Juden in Deutschland weitgehend erfolgreich vor gesellschaftlicher Gewalt. Auf der anderen Seite waren aber im Staatsapparat, im Militär und in der Justiz antisemitische Strömungen weit verbreitet, die sich in der Verweigerung von Aufstiegschancen niederschlugen. Dennoch war der Antisemitismus in Deutschland kein beherrschender Faktor der politischen Kultur. Er wurde auch von den Juden selbst nicht so empfunden, wenngleich Sorgen wuchsen. Der Nationalismus war eine der wichtigsten Prägekräfte im politisch-gesellschaftlichen Leben des Kaiserreichs. Er spielte innerhalb der Massenpolitisierung eine zentrale Rolle. Die Nationalisierung der Massen war ein Grundzug der europäischen Geschichte des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Deutsche Besonderheiten zeigen sich aber darin, dass sich im Kaiserreich um 1900 eine neue Variante des europäischen Nationalismus stärker als anderswo bemerkbar machte: der sogenannte völkische Nationalismus oder auch Radikalnationalismus. Der deutsche Nationalismus vor und nach 1914 ist aber nicht ausschließlich mit dieser Variante gleichzusetzen. Thomas Nipperdey unterscheidet drei Formen. Er spricht zunächst einmal von einem Nationalpatriotismus. Hierunter versteht er das, was man als Wir-Gefühl oder als deutsche Identität bezeichnen kann. Bis 1914 schwanden in der deutschen Gesellschaft viele ursprüngliche Vorbehalte gegen diese nationale Identität. Am Ende des Kaiserreichs waren regionale Bindungen des einzelnen noch immer wichtiger, man war Bayer oder Württemberger, Thüringer, aber diese einzelstaatliche oder regionale Identität wurde überwölbt von der des Reiches. Im Zuge dieses Prozesses schwanden auch die Vorbehalte von Katholiken gegen das neue Preußen-Deutschland, und selbst die meisten Sozialdemokraten konnten sich diesem Nationalpatriotismus nicht entziehen. Dies hing zweifellos auch mit den Leistungen zusammen, die der Staat des Kaiserreichs für die Alltagsbewältigung der Menschen erbrachte. Als zweiten Typus nennt Nipperdey den „Normal-Nationalismus“. Gemeint sind zum einen ein gouvernementaler, von der Regierung genutzter und geförderter Nationalismus und zum anderen auch ein autonomer Nationalismus von Parteien und Verbänden. Über Schule, Heer, nationale Feiern, Denkmäler und Vereine wie Sänger-, Turner-, Schützen- und Kriegervereine wurde der Nationalismus zu einem Massenphänomen. In diesem Zusammenhang verstärken sich die Elemente von Abgrenzung nach innen und nach außen. Nach innen soll der Nationalismus gegen vermeintliche Reichsfeinde mobilisieren, nach außen gegen den „Erbfeind“ Frankreich, gegen Russland und immer stärker auch gegen den Konkurrenten Großbritannien. Der offizielle Nationalismus kam in den Denkmälern für Kaiser Wilhelm I. zum Ausdruck. Der autonome Nationalismus der Gesellschaft kam in den vielen BismarckDenkmälern und Türmen zum Ausdruck, die seit den späten neunziger Jahren entstanden. Das Symbol der Nation ist hier nicht mehr die Monarchie, der Symbolheld Bismarck repräsentiert die Nation an sich. Der dritte Typus ist der Radikalnationalismus. Er verstand die Nation als Volksnation, und zwar nicht mehr nur im Sinne älterer Vorstellungen als von Sprache und Kultur bestimmte Volksnation, sondern nun zunehmend im rassenbiologischen Sinne als eine Abstammungsgemeinschaft. Zu dem völkischen Umfeld gehörten der Deutschbund Friederich Langes, die Gobineau-Vereinigungen und die Richard-Wagner-Vereine. Gerade im Bildungsbürgertum wuchs um 1900 die Bereitschaft, den Vorgaben der völkisch-rassischen Propheten zu folgen und die Ideen Lagardes, Langbehns, Chamberlains von der Überlegenheit der nordisch-arischen Rasse zu übernehmen. Getragen wurde das ganze auch von der Großstadt- und Zivilisationskritik, die dann in eine Blut- und Bodenideologie mündete. All das machte den völkischen Nationalismus besonders expansiv und aggressiv. Seit den neunziger Jahren begann sich die neue radikale Rechte in Verbänden zu organisieren. Die wichtigste dieser Organisationen war der Alldeutsche Verband. Die Alldeutschen propagierten ein koloniales Imperium des Reiches und wollten zugleich die 6 außerhalb des Deutschen Reiches stehenden deutschen Bevölkerungsteile durch ein größeres kontinentaleuropäisches Reich von den Niederlanden bis zum Baltikum und die deutschen Gebiete der Habsburger Monarchie in ein völkisches Staatswesen einbeziehen. Die Erfolge des Alldeutschen Verbandes waren zunächst sehr begrenzt. 1908 geriet der Verband in eine schwere Existenzkrise, konnte sich aber unter Führung von Heinrich Claß und durch Unterstützung von Industriellen wie Krupp (mit Generaldirektor Hugenberg) konsolidieren. Danach schlug er endgültig die völkisch-antisemitische Richtung ein. Jetzt verbesserten sich auch seine Kontakte zur Reichsregierung wie zu den traditionellen Konservativen. Die neue Rechte hatte zwar in der deutschen Wählerschaft keine Mehrheit, konnte aber bei Themen wie der deutschen Wehrkraft durchaus Massen mobilisieren, indem sie andere große Verbände wie den Bund der Landwirte, den Flottenverein oder den deutschnationalen Handlungsgehilfenverband in die Agitation einbezog. Sie fand auch Rückhalt in Teilen des staatlichen und militärischen Establishments und unter den Journalisten wie Professoren (Dietrich Schäfer). Sie schuf ideologische Grundlagen und organisatorische Netzwerke, auf denen andere in den zwanziger Jahren aufbauen konnten, wenngleich die Thesen einer ungebrochenen Kontinuität in der neueren Forschung zurückgewiesen werden.. III. Der „neue Kurs“ 1890-1894 Die skizzierten Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft und die neue Dynamik auf dem Felde der außenpolitischen Beziehungen stellten die Reichsregierung seit 1890 vor neue Herausforderungen. Der unmittelbare Nachfolger Bismarcks, der General Leo von Caprivi, hat mit seinem „neuen Kurs“ zunächst durchaus versucht, auf diese Herausforderungen zu reagieren. Von der Außenpolitik werden wir später reden. Schauen wir zuerst auf die Innenpolitik. Caprivi wollte den monarchischen Staat aus den gesellschaftlichen Konflikten herausziehen und als neutrale Instanz moderieren. Die neue Politik sollte von Ausgleich und Versöhnung bestimmt sein und die inneren Konflikte vermeiden, in die Bismarcks Politik hineingeführt hatte. Das Sozialistengesetz wurde nicht mehr verlängert. Statt dessen erhielt der preußische Handelsminister von Berlepsch den Auftrag, den unter Bismarck vernachlässigten Arbeiterschutz auszubauen und das Arbeitsrecht zu reformieren. In der Gewerbeordnungsnovell von 1891 wurde dies zum Teil auch umgesetzt. Der Arbeiterschutz wurde verbessert und die Gewerbeaufsicht des Staates verstärkt. Der große Durchbruch blieb freilich noch aus. Eine Neuorientierung gab es schließlich auch in der Handelspolitik. Caprivi wollte durch Handelsverträge mit europäischen Staaten der deutschen Industrie bessere Absatzchancen verschaffen. Caprivi ging davon aus, dass dauerhafte Arbeitsplätze für die wachsende Bevölkerung nur durch die Expansion der Industrie entstehen würden. Die Handelsverträge mit den anderen, wirtschaftlich rückständigeren Staaten waren aber nur möglich, wenn man diesen die Chance gab, die deutschen Industrieerzeugnisse mit dem Erlös aus dem eigenen Agrarexport zu bezahlen. Das bedeutete, dass die deutschen Agrarzölle gesenkt werden mussten und stieß auf Widerstand der Konservativen. Eine weitere Reform, die den neuen Wirtschaftsstrukturen Rechung trug, war die preußische Steuerreform von 1891. Die Besteuerung wurde dem Wandel vom Agrar- zum Industriestaat angepasst, zu einer grundlegenden Korrektur des preußischen Drei-Klassenwahlrechts kam es aber nicht. Der neue Kurs brachte somit zwar einiges in Bewegung, aber die eher halbherzigen Reformen führten zu keinem grundlegenden Wandel des Systems. Trotz der geringen Reichweite seiner Reformen stieß der neue Kanzler innerhalb der alten Eliten rasch auf Widerstand. Ein besonderes Problem ergab sich aus der Doppelfunktion Reichskanzler und preußischer Ministerpräsident. Auf der Reichsebene versuchte Caprivi eine Brücke zu jenen Parteien zu schlagen, die Bismarck als Reichsfeinde diffamiert hatte. Das galt vor allem für 7 das Zentrum, aber Caprivi wollte auch ein besseres Verhältnis zu Linksliberalen und Sozialdemokraten. Er hatte schließlich zunächst keine Mehrheit im Reichstag. In Preußen dagegen war die Lage anders. Hier hatte das Kartell von Konservativen und Nationalliberalen dank eines anderen Wahlrechts nach wie vor eine Mehrheit, und die Mitglieder des preußischen Staatsministeriums tendierten dazu, ein solches Kartell auch auf der Reichsebene wieder stark zu machen. Die Politik zwischen Reich und Preußen geriet aus dem Gleichschritt. Schon 1892 mußte Caprivi wegen des Widerstandes der preußischen Eliten das Amt des preußischen Ministerpräsidenten aufgeben. Im Reichstag konnte er kein Gegengewicht aufbauen, weil weder Linksliberale noch Sozialdemokraten und das Zentrum an die Regierung gebunden werden konnten und sollten. Liberale und Sozialdemokraten kritisierten die von Caprivi in die Wege geleitete Reform des preußischen Schulgesetzes, die auch das Zentrum nicht zufrieden stellte und schließlich zurückgezogen wurde. Streit gab es auch um die Heeresvorlage von 1892/93, mit der ein neuer Rüstungsschub – von der personalzur materialintensiven Rüstung - eingeleitet werden sollte. Sozialdemokraten, Linksliberale und Teile des Zentrums lehnten ab. Erst die Auflösung des Reichstages und Neuwahlen brachten dem Kanzler die Mehrheit für eine nochmals modifizierte Heeresvorlage. Mit Ausnahme der Sozialdemokratie, die 1893 weitere Mandate hinzu gewann, büßten alle Gegner der Heeresreform Stimmen und Sitze ein. Die Wahlen, aus denen Konservative und Nationalliberale gestärkt hervorgingen, brachten Caprivi aber keine feste Mehrheit. Denn jetzt waren es vor allem die Konservativen, die ihn wegen seiner Handelsvertragspolitik heftig attackierten. Der 1893 gegründete Bund der Landwirt beklagte die mangelnde Berücksichtung der Agrarinteressen. Der Kanzler ohne „Ar und Halm“, wie Caprivi von den ostelbischen Junkern genannt wurde, musste weg. Entscheidend für Caprivis Sturz war aber am Ende jener Mann, der auch schon Bismarck aus dem Amt gejagt hatte: der junge Kaiser Wilhelm II. Ihm ging es darum, seine kaiserlichen Rechte gegenüber der Regierung angemessen zur Geltung zu bringen. Ob es Wilhelm tatsächlich gelungen ist, ein „persönliches Regiment“ zu etablieren, das wurde schon von den Zeitgenossen kontrovers beurteilt. Auch die Historiker sind sich bis heute nicht einig. Lange Zeit standen sich zwei Positionen gegenüber. Die einen nahmen den Anspruch Wilhelms für die Wirklichkeit. Sie argumentierten, dass Wilhelm das konstitutionelle System durchbrochen habe und damit hauptverantwortlich sei für die zahlreichen Fehler der Innen- und Außenpolitik. Die andere Seite argumentierte, dass der Kaiser gar nicht die notwendigen Fähigkeiten besessen habe, um ein persönliches Regiment zu etablieren, schon gar nicht im Sinne eines institutionalisierten, also planvollen und ständigen Regierungshandeln. Das persönliche Regiment sei deshalb allenfalls bloßer Schein gewesen. Lange Zeit schien sich diese zweite Position zu behaupten. Dann war es der englische Historiker John C. Röhl, der in umfangreichen Arbeiten und in einer groß angelegten Wilhelm II.-Biographie die These zu untermauern versuchte, dass Wilhelm und sein engerer Beraterkreis (Philipp Graf zu Eulenburg) tatsächlich darauf hingearbeitet hätten, die Macht des Kaisers und seinen unmittelbaren Einfluss auf die deutsche Politik zu erweitern. Und man habe damit durchaus Erfolg gehabt, denn Wilhelm II. habe letztlich dem politischen System seinen Stempel aufgedrückt und es zu einem monarchozentrischen, also auf die Person des Monarchen zugeschnittenen System gemacht. Der Kaiser habe – gestützt auf einen engen Vertrautenkreis – letztlich vieles selbst entscheiden können. Röhl bietet in seinen Arbeiten ein eher erschütterndes Bild vom Deutschen Kaiserreich in seiner zweiten Phase. Der machtpolitisch und wirtschaftlich so dynamische Staat wurde demnach von einem teils fürchterlichen, teils lächerlichen „Operettenregiment“ geführt. An der Spitze steht ein von Jugend an im wahrsten Sinne verkorkster Monarch. Röhl beginnt seine Charakterskizzen mit Wilhelms schwieriger Geburt, dem verkrüppelten linken Arm und den fehlgeschlagenen Erziehungsmethoden seiner Mutter. Wilhelms Haß auf England wird nicht zuletzt auf den Haß zurückgeführt, den der Sohn 8 gegenüber der Mutter und englischen Königstochter entwickelt hat. Wer sich für solche Fragen interessiert, dem steht eine reichhaltige Literatur zur Verfügung. Wilhelm II. ist ein beliebter Gegenstand der Biographieforschung in all ihren Variationen, nicht zuletzt auch in Form der Psychohistorie. In diesem Zusammenhang wird etwa auch nach den homoerotischen Neigungen des Kaisers und vor allem nach den homosexuellen Exzessen in seinem Umfeldes gefragt, Themen übrigens, die auch schon die Zeitgenossen beschäftigten und den Hof Wilhelms in der Öffentlichkeit diskreditierten. Die fast byzantinistische Hofhaltung dieses Kaisers, die im europäischen Vergleich auch viel Geld verschlang, passte jedenfalls kaum zur Modernität von Wirtschaft und Gesellschaft. Dennoch darf man nicht übersehen, dass das Kaisertum in der wilhelminischen Zeit, also nach Bismarck, zu einem wichtigen Sinnbild der Nation aufstieg. Große Teile der Gesellschaft sahen sich durch Wilhelm II. repräsentiert und integriert. Mit dem Kaisertum verbanden sich dabei allerdings verschiedenste Hoffnungen. Es gab unter anderem die unitarisch-nationalstaatliche Kaiseridee, die das Kaisertum als zentrale Klammer der deutschen Nation sah. Es gab die imperiale Kaiseridee, die das neue Kaisertum als Ausgangspunkt deutscher Weltpolitik und -herrschaft ansah. Es gab die Idee des Volkskaisertums, das nach dem Willen von Friedrich Naumann die Arbeiterschaft mit Staat und Gesellschaft versöhnen sollte. Wilhelm II. hat versucht, möglichst viele dieser Erwartungen zu bedienen. Er verstand es durchaus, sich öffentlichkeitswirksam und scheinbar omnipräsent in Szene zu setzen. Er verknüpfte verschiedenste Traditionen und moderne Erwartungen und führte so seine Monarchie an den politischen Stil der Massengesellschaft heran. Der Kaiser setzte durch sein Verhalten auch in der Gesellschaft eigene Akzente, etwa mit seiner Nordlandbegeisterung. Zwischen 1889 und 1914 unternahm Wilhelm II. mit seiner Yacht Hohenzollern jeden Sommer Jahr eine mehrwöchige Fahrt zu den norwegischen Fjorden. Damit begünstigte er den Nordlandtourismus des Bürgertums ebenso wie die Beschäftigung mit dem Germanenmythos. Nun aber zurück zur Politik. Wilhelm konnte, um auf die Kontroverse über das persönliche Regiment zurückzukommen, Reichspolitik nicht mehr nach Gutsherrenart gestalten. Dazu waren mit der Bürokratie, dem Reichstag und der Öffentlichkeit längst andere Machtzentren entstanden, an denen ein Monarch nicht einfach vorbeikam. Er war ein Akteur neben anderen, aber immerhin ein wichtiger Akteur. Schon durch die Besetzung der wichtigsten Ämter konnte er gestalten, aber er versuchte auch darüber hinaus Einfluß zu nehmen. In den ersten Jahren nach Bismarcks Entlassung war dies beachtlich, auch noch einmal 1897 bis 1900, seit 1908 ging dieser Einfluß aber deutlich zurück. Einen Einschnitt bildete die sogenannte DailyTelegraph-Affäre, als eine englische Zeitung tölpelhafte Bemerkungen Wilhelms abdruckte, die ihm sein für die Politik verantwortlicher Kanzler Bülow nicht herausgestrichen hatte. Wenn Wilhelm II. in die Reichspolitik eingriff, so kann man abschleißend festhalten, dann geschah dies eher planlos, mehr verhindern als gestaltend und darum meist mit negativen Folgen auch für den Kaiser selbst. Am Ende trug der Versuch Wilhelms, ein persönliches Regiment zu installieren, eher zur Selbstzerstörung der Monarchie bei als zu ihrer Festigung. Der Großvater hatte sich da geschickter verhalten. Und viele andere europäische Monarchenfamilien, gerade die englische Verwandtschaft, wussten um 1900 besser als die Hohenzollern, was auf Dauer der eigenen Sache nutzen und was Schaden würde. Überall dort, wo die Monarchen sich auf ihre repräsentativen Aufgaben beschränkten und die Politik den gesellschaftlichen Kräften überließen, haben sie überleben können. In Deutschland war es bekanntlich anders. Kehren wir an dieser Stelle nun zum Kanzler Caprivi zurück. Sein „neuer Kurs“ war im Oktober 1894 definitiv zu Ende. Der Kanzler musste weichen, weil er Wilhelms politischen Plänen im Wege stand und weil Wilhelm selbst den neuen Kurs für verfehlt hielt. Er hatte die Legitimationsbasis des Systems keinesfalls vergrößert. Wilhelm steuerte nun gegen. Er söhnte sich wieder mit Bismarck aus, lehnte weitere Zugeständnisse an die Arbeiter ab, sondern 9 wollte den Kampf gegen die Sozialdemokratie mit neuen Mittel wieder aufnehmen. Im Streit über die sogenannte „Umsturzvorlage“, die das Straf- und Presserecht verschärfte, und Staatsstreichpläne zur Änderung des Wahlrechts kam es schließlich zum Bruch mit Caprivi. 1984 wurde Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst zum neuen Reichskanzler berufen. Er übernahm nun auch wieder gleichzeitig das Amt des preußischen Ministerpräsidenten. Hohenlohe war schon 75 und galt als Verlegenheitslösung. Er wurde keineswegs zum willfährigen Werkzeug des Kaisers und erklärte gegenüber dem Monarchen einmal: „Ich bin nicht Kanzleirat, sondern Reichskanzler und muss wissen, was ich zu sagen habe.“ Dementsprechend gab es Konflikte, sowohl zwischen dem Kanzler und dem Beraterkreis des Kaisers als auch zwischen der Reichsleitung und der preußischen Regierung. Die Einheit von Reichsleitung und preußischem Staatsministerium ging verloren, Hohenlohe büßte mehr und mehr an Macht ein, vieles kam ins Stocken. Dies galt vor allem für die Sozialpolitik. Der noch amtierende Handelsminister Berlepsch erhielt keine Rückendeckung mehr vom Kaiser. Widerstand gab es auch von den Konservativen und den Nationalliberalen. Der seit 1896 amtierende neue preußische Handelsminister setzte dann die Akzente im Schutz des Mittelstandes. Das entsprach den Wünschen der Konservativen wie des Zentrums, und das versprach innenpolitisch auch mehr Erfolg als der Arbeiterschutz. Schützte man das Handwerk – und das tat man 1897 durch ein neues Handwerkergesetz – dann gewann die Reichsregierung Unterstützung bei einem noch immer zahlenmäßig beachtlichen Teil der Bevölkerung. Von den Arbeitern wäre ein solcher Rückhalt nicht so schnell zu erhalten gewesen. Hohenlohe war im Übrigen zwar bereit, die Maßnahmen gegen die Sozialdemokratie wieder zu verschärfen. Er lehnte aber neue Ausnahmegesetze und staatstreichartige Maßnahmen gegen einen widerspenstigen Reichstag ab. Umsturz- und Zuchthausvorlage – letztere sollte den Koalitionszwang bei Streiks mit härteren Strafen ahnden – fanden im Reichstag keine Mehrheit, da ohne das Zentrum nichts ging und die Partei des deutschen Katholizismus auf rechtsstaatlichem Kurs blieb. Hinzu kam, dass auch die öffentliche Meinung klar gegen neue Sozialistengesetze war. Selbst innerhalb Preußens fand die Verschärfung des Vereins- und Versammlungsrechtes keine Mehrheit. Das einzige neue Gesetz, das hier durchkam, war die „Lex Arons“. Sie schloß Sozialdemokraten von allen akademischen Lehrämtern aus. Aron war ein deutsch-jüdischer Privatdozent, der der Sozialdemokratie beigetreten war. Der Kaiser und Teile seiner Umgebung liebäugelten Mitte der neunziger Jahre damit, den Kampf gegen die Sozialdemokratie mit außergesetzlichen Mitteln zu führen. Die entsprechenden Staatsstreichpläne konkretisierten sich zwar nicht, wirkten aber durchaus als Druck- und Einschüchterungsmittel. Zwischen 1890 und 1897 war die innenpolitische Lage des Deutschen Reiches somit recht krisenhaft. Erst danach ebbten die Konflikte zwischen Kaiser und Kanzler, Regierung und Reichstag ab. Dies war auch die Folge von Neubesetzungen der Ministerämter. Hohenlohe behielt zwar seine Ämter, erhielt aber in Preußen durch Miquel als neuem Vizepräsidenten des Staatsministeriums und dem konservativen Innenminister Graf Posadowsky neue starke Männer zur Seite. Das gleiche passierte auf der Reichsebene. Hier wurde der Kanzler eingerahmt durch den neuen Staatssekretär des Äußeren, Bernhard von Bülow, und durch den Konteradmiral Alfred Tirpitz, der nun Staatssekretär im Reichsmarineamt wurde. Beide teilten und unterstützten Wilhelms Vorstellungen einer neuen deutschen Weltpolitik und den Aufbau der dazu notwendigen Flotte. Wilhelms Eingriffe in die Reichspolitik gingen nun zurück, da er wichtige Vertrauensleute an den Schaltstellen hatte. Drei Jahre später wurde dann der neue starke Mann, Bülow, Nachfolger Hohenlohes im Amt des Reichskanzlers wie des preußischen Ministerpräsidenten. Bülow soll mein Bismarck werden und vor allem im Inneren Ruhe schaffen, hatte Wilhelm II. schon 1895 gesagt. Bülow entwickelte wegen seiner engen Kontakte zum Kaiser einen starken Führungsanspruch. Wichtigste Männer neben ihm waren Tirpitz und Posadowsky. 10 Die folgenreichste Weichenstellung der neuen Männer war der Beginn des Flottenbaus und die neue Weltpolitik. Bülow prägte die griffige Formel vom deutschen Platz an der Sonne. Tirpitz sollte den Ausbau der Flotte voranbringen, mit der man Großbritannien als erster Seeund Kolonialmacht politisch und notfalls auch militärisch die Stirn bieten wollte. Davon werden wir im Zusammenhang mit der Außenpolitik noch hören. Der kostspielige und abenteuerliche Flottenbau musste aber finanziert werden. Dafür brauchte man zunächst einmal die Zustimmung des Reichstages und damit der deutschen Öffentlichkeit. Große Teile des deutschen Bürgertums hatten seit längerem erkennen lassen, dass es sich für eine große deutsche Flotte begeistern ließ. Hinzu kamen hier auch wirtschaftliche Interessen. Werften, Zuliefererindustrien, besonders der Stahlbereich, aber auch andere Branchen würden von dem Bau einer Flotte profitieren. Auch die Exportindustrie versprach sich von der Weltpolitik einen besseren Schutz der eigenen Interessen. Die Nationalliberalen und die Freikonservativen unterstützten den Flottenbau vorbehaltlos. Die Deutschkonservativen forderten für ihre Zustimmung Kompensationen auf dem Felde der Zölle. Eine Mehrheit für ein Flottengesetz kam aber im Reichstag nur zustande, wenn auch das Zentrum zustimmte. Sozialdemokraten und Linksliberale waren dagegen. Im Zentrum gab es lange und heftige Auseinandersetzungen. Am Ende setzte sich die Parteiführung durch, die für das eingebrachte Flottengesetz war. Sie wollte die Flottenpolitik in überschaubare Bahnen lenken und die Regierung davon abhalten, die Sache am Parlament vorbei zu regeln. Noch immer wirkte die Staatsstreichdrohung. Das Zentrum sicherte so dem Flottengesetz nach Zugeständnissen in der Budget- und Finanzierungsfrage 1898 eine Mehrheit. Zwei Jahre später folgte eine Novelle zu diesem Gesetz. Sie wurde notwendig, weil die Flottenrüstung viel teurer wurde als anfangs geplant. Die Flottenmehrheit einigte sich darauf, diese Mittel durch kleinere Steuererhöhungen und durch neue Agrarzölle aufzubringen. Es schien zunächst so, als ob die Pläne Bülows aufgehen würden und er eine vergleichsweise stabile Reichstagsmehrheit hinter sich bringen könnte. Sein Ziel war eine Sammlung aller staatserhaltenden und produktiven Kräfte. Sie sollte die Flottenpolitik tragen und das politische System stabilisieren. Die Sammlungspolitik sollte sich stützen auf Konservative, Nationalliberale und das Zentrum. Stärkste Kraft war hierbei das Zentrum, das bei den Wahlen von 1898 ein Viertel aller Mandate errungen hatte. Neben der Flottenpolitik, die der Industrie nutzte, sollte die Zollpolitik zum zweiten Fundament der Sammlungspolitik werden. In der historischen Forschung ist diese Sammlungspolitik als ein weitreichendes innenpolitisches Krisenrezept interpretiert worden. Dabei sei es Bülow nicht mehr nur darum gegangen, die alte Sammlungspolitik Bismarcks – Konservative und Nationalliberale gegen die Arbeiterbewegung – fortzusetzen. Ihm habe eine große Sammlung vorgeschwebt, bei der Flotte, Weltpolitik und imperiales Kaisertum die fragile Gesellschaft des Kaiserreichs integrieren sollte. Andere Historiker, vor allem Eley, bezweifeln dagegen, dass diese Sammlungspolitik ein geeignetes Krisenkonzept sein konnte. Sie sei mehr Wunsch als Wirklichkeit gewesen, denn die Verbindung von Flottenpolitik und Zollpolitik habe allenfalls kurzfristig die tiefgreifenden Interessengegensätze zwischen den Beteiligten überdecken können. Diese Sicht scheint überzeugender zu sein, wie vor allem der Streit um die Zollpolitik zeigt. Außenwirtschaftliche und innenpolitische Gründe sprachen um 1900 für eine Revision der deutschen Zolltarife. Zum einen mussten Handelsverträge mit anderen Staaten erneuert werden. Zum anderen verlangte die Landwirtschaft angesichts der Dauerkrise, in der sie sich befand, weiter nach höheren Zöllen. Bülow und vor allem Miquel hofften, mit dem neuen Zolltarif einen Kompromiss zwischen Agrariern, Industrie und Handel zu finden. Sehr schnell zeigte sich aber, dass dies nicht möglich war. Die Schutzzollwünsche der Landwirtschaft, organisiert im mächtigen Bund der Landwirte, gingen weit über das hinaus, was Handel und Industrie zu akzeptieren bereit waren. Wie hart gerungen wurde, zeigte die Abstimmung über den Bau des Mittellandkanals, der Rhein und Elbe verbinden sollte. Die Industrie und der 11 Handel wünschten ihn ebenso wie Kaiser und Regierung. Die Konservativen stellten sich auf Druck der ostelbischen Gutsbesitzer dagegen, weil sie fürchteten, dass der Kanal zu noch mehr billigeren Agrarimporten führen werde. Im preußischen Abgeordnetenhaus lehnten Konservative und Zentrum die Kanalvorlage ab, unter den verweigernden Abgeordneten waren auch viele Beamte, die hier gegen den eigenen Monarchen votierten und auf dessen Druck hin vorläufig beurlaubt wurden. Die Frage der Agrarzölle führte zu einem langem Ringen. Strikte Gegner höherer Agrarzölle waren Sozialdemokraten und Linksliberale, weil die Zölle die Lebenshaltungskosten der Massen verteuerten. Die Befürworter höherer Agrarzölle hatten aber im Reichstag keine eigene Mehrheit. Erst 1902 kam es mit Hilfe des Zentrums, das intern ebenfalls hart um einen Ausgleich zwischen den divergierenden Interessen gerungen hatte, zu einem Kompromiss. Der neue Tarif kam der Landwirtschaft entgegen, aber nicht so, wie diese es gewünscht hatte. Er bescherte dem Reich Mehreinnahmen, die aber nicht alle in die Flottenrüstung gingen, sondern auf Wunsch des Zentrums in eine Witwen- und Waisenversicherung des Reiches. Das ganze Vorgehen zeigte, dass das Zentrum zu diesem Zeitpunkt als stärkste Fraktion des Reichstages in der Reichspolitik in eine Schlüsselstellung gelangt war. Auf seinen Druck hin wurde nun auch die Sozialpolitik wieder aufgenommen. Auch in der öffentlichen Meinung forderte man zu diesem Zeitpunkt wieder verstärkt sozialpolitische Initiativen. Wichtig war hier die 1901 gegründete „Gesellschaft für soziale Reform“, mit der bürgerliche Gelehrte wie Werner Sombart neue Akzente zur Lösung der sozialen Probleme setzen wollten. Für die Sozialreform sprachen sich also auch Teile der Liberalen aus, vor allem weil es galt, etwas gegen die anhaltenden Wahlerfolge der Sozialdemokratie zu unternehmen. Die Sozialdemokratie hatte bei den Reichstagswahlen von 1898 27,2% der Stimmen erhalten. Bei den nächsten Wahlen 1903 kletterte sie auf 31,7%, die jetzt für ein Fünftel der Reichstagsmandate reichten. Man hatte den Wahlkampf übrigens mit der Parole vom Brotwucher – also gegen die Agrarzölle – geführt. Trotz dieses Erfolges hatten die Parteien, die Bülows Sammlung unterstützten, auch nach den Wahlen von 1903 weiter eine Mehrheit im Reichstag. Sie hatten ihre Mandatszahl weitgehend behauptet. Bülow konnte somit seine Politik weiter fortsetzen, allerdings mit der Folge, dass er in wichtigen Fragen dem Zentrum entgegenkommen musste. Dies zeigte sich zum einen in der Sozialpolitik. Die Regierung bot an, den Kreis der Sozialversicherten zu erweitern, die Leistungen anzuheben, das Verbot der Kinderarbeit auch auf das Heimgewerbe auszudehnen, den Arbeiterwohnungsbau mehr zu fördern und die Gewerbegerichte in größeren Gemeinden obligatorisch zu machen. Hier kam man voran, aber weitergehene Initiativen des preußischen Innenministers Posadowsky, der die Sache betrieb, scheiterten an fehlenden Mehrheiten. Dies galt vor allem für die Verbesserung der Rechtsstellung von Gewerkschaften und klarere Regelungen des Tarifwesens. Der gewachsene Einfluss des Zentrums zeigte sich auch in der Finanzpolitik des Reiches. Seit 1900 wuchsen bedingt durch die Heeres- und Flottenrüstung die Ausgaben des Reiches rascher als die Einnahmen. Da man den Mehrbedarf nicht einfach auf die Länder umlegen konnte, nahm das Reich Anleihen auf. Damit wuchsen erst einmal die Schulden. 1890 hatten sie bei 1,1 Milliarden Mark gelegen, 1909 waren es schon knapp 5 Milliarden. Die Neuordnung des Finanzsystems war daher einwichtiges Gebot. Zu einer grundlegenden Reform kam es jedoch nicht. Dies lag nicht zuletzt daran, dass die stärkste Partei – das Zentrum – zwar die Mehrausgaben für Heer und Marine bewilligte, angesichts der inneren Gegensätze und aus Rücksicht auf die Wähler aber wenig Initiativen zur großen Reichsfinanzreform ergriff. Zu den Zugeständnissen, die das Zentrum als Preis für seine Kooperation mit Bülow erreichte, gehörte auch die Zurücknahme einiger verbliebener Kulturkampfgesetze (2. § des Jesuitengesetzes). Dies missfiel dem protestantischen Bürgertum, also vor allem den Nationalliberalen, und zeigte, wie tief noch immer die konfessionellen Gegensätze waren. 12 Auch eine andere wichtige innenpolitische Entscheidung ging auf das Zentrum zurück: die Einführung von Diäten im Jahre 1906. Die Abgeordneten des Reichstages erhielten von nun an eine Entschädigung von 3000 Mark im Jahr. Mit Ausnahme der Konservativen waren alle Parteien dafür. Die Summe war nicht viel, aber es war ein erster Schritt zur weiteren Aufwertung des Parlaments und zur Anerkennung des Berufspolitikertums, das sich in der Praxis längst etabliert hatte. Viele Abgeordnete wurden im Grunde von Verbänden und Parteien bezahlt und bestritten ihre Tätigkeit längst nicht mehr nur aus eigenen Mitteln. Die Sammlungspolitik trug mit all dem dazu bei, die innenpolitische Lage des Reiches für einige Zeit zu stabilisieren. Dennoch sollte die neue Allianz nicht mehr allzu lange halten. Viele waren unzufrieden mit den Kompromissen, auf denen die Kooperation beruhte. Dies galt gerade für das Zentrum. Hier wirkten sich nun innerparteiliche Machtverschiebungen aus. Innerhalb des Zentrums machen sich seit 1900 die Kräfte der katholischen Arbeiterbewegung stärker bemerkbar. Sie forderten Sozialreformen und mehr politische Rechte für die Arbeiter (preußisches Drei-Klassen-Wahlrecht bedrückte viele Katholiken). Die Arbeiterführer verbanden sich im Zentrum mit den Kräften des agrarischen und kleingewerblichen Populismus, die seit 1890 an Gewicht gewonnen hatten. Die neue Richtung der „Zentrumsdemokraten“ um Erzberger nahm die Kooperation mit der Regierung nicht mehr als selbstverständlich hin und setzte in entscheidenden Fragen zunehmend auch auf Konfrontation. Dies galt besonders für die Kolonialpolitik. Erzberger kritisierte 1806 wie die Sozialdemokratie die Korruption und die Greuel in den deutschen Kolonien. Er kritisierte die Kriege, die die Truppen des Reiches 1904/05 in Südwest- und Ostafrika gegen die einheimische Bevölkerung auf eine brutale Weise geführt hatten. Für Konservative und Nationalliberale erwies sich das Zentrum als unzuverlässiger Partner. Sie kritisierten den Kanzler, dass er dem Zentrum zu viel Einfluss gewährt habe. Bülows Position wurde zu diesem Zeitpunkt aber auch durch Vorwürfe aus der Umgebung des Kaisers geschwächt. Es hieß, dass der Kanzler die Sozialdemokratie nicht entschieden genug bekämpfe und seine Außenpolitik nicht erfolgreich genug sei. All das veranlasste Bülow nun zur Kurskorrektur. Als Zentrum und Sozialdemokraten im Dezember 1906 einen Nachtragshaushalt ablehnten, durch den weitere Mittel für den Kampf gegen die Hereros in Südwestafrika bereitgestellt werden sollten, löste Bülow den Reichstag auf. In Anlehnung an Bismarcks Strategie schürte die Reichsleitung nun die nationalen Emotionen gegen die Sozialdemokratie und das unzuverlässige Zentrum. Unterstützt wurde sie vom Reichsverband gegen die Sozialdemokratie. Zugleich bemühte sich Bülow im Wahlkampf, Konservative, Nationalliberale und jetzt auch Linksliberale zu einem Bündnis zusammenzuführen. Gemeinsamer Nenner waren das nationale Interesse, die antisozialistische Grundrichtung und der Antikatholizismus. Bülow wollte sich so eine neue Reichstagsmehrheit sichern. In der Tat wurden die sogenannten Hottentottenwahlen – den Begriff prägte Bebel – zu einem Erfolg des neuen Blocks. Konservative und Liberale verbuchten Gewinne und hatten gemeinsam eine knappe Mehrheit im Reichstag. Das Zentrum verbesserte sich zwar um 5 Mandate, hatte aber seine parlamentarische Schlüsselstellung verloren. Der große Verlierer der Wahlen war die Sozialdemokratie. Sie vergrößerte zwar die Zahl der Wählerstimmen, verlor aber bei den Stimmanteilen fast 3% und büßte vor allem fast die Hälfte ihrer Reichstagsmandate ein. Die SPD hatte nur noch 11% der Mandate. Bülow schien mit seiner Strategie also Erfolg zu haben. Es musste sich allerdings noch erweisen, ob er die ihn unterstützenden Parteien zu einem festen Block zusammenbringen konnte. Das war nicht einfach. Die Konservativen stellten Bedingungen, da sie nun in einer Schlüsselstellung waren. Sie hätten nämlich auch gemeinsam mit dem Zentrum eine Mehrheit gehabt. Die Linksliberalen waren inzwischen auf die Linie der Weltpolitik eingeschwenkt, weil sie den liberalen Imperialismus zur inneren Reform nutzen wollten. Sie hofften darauf, durch die Kooperation mit der Regierung nun einen Teil ihrer innenpolitischen Ziele durchsetzen zu können. Am stärksten setzten sich die Nationalliberalen für den neuen Kurs 13 ein. Sie wollten eine Mittlerstellung zwischen Konservativen und Linksliberalen einnehmen und moderate Reformen vorantreiben. Der Bülow-Block hat dann auch einiges auf den Weg gebracht. So wurde 1908 das Vereins- und Versammlungsrecht liberalisiert. Auch ein neues Börsengesetz wurde verabschiedet. In anderen Fragen traten aber bald die Gegensätze innerhalb des Blockes deutlich hervor. Dies galt zum einen für die Wahlrechtsfrage. Die Linksliberalen plädierten für eine Abschaffung des preußischen Drei-Klassen-Wahlrechts. Die Nationalliberalen wollten dagegen nur moderate Veränderungen. Die Konservativen lehnten es ganz ab. Uneinig war man sich ferner bei den noch ungelösten Fragen der Reichsfinanzreform. Wenn der Block doch eine Weile hielt, dann hing dies an zwei Dingen. Zum einen fand das Zentrum noch kein Konzept, um den Block aufzubrechen, Zum anderen überschattete 1908/09 die sogenannte Daily-Telegraph-Affäre alle anderen innenpolitischen Fragen. Die britische Zeitschrift Daily-Telegraph veröffentlichte im Oktober 1908 ein Interview mit Kaiser Wilhelm. Da dieser dort manche taktlosen und politisch unklugen Dinge zu besten gab, erregte der Artikel in der internationalen Presse großes Aufsehen. In Deutschland sorgte er dafür, dass die Kritik am persönlichen Regiment des Kaisers neue Nahrung erhielt. Der lange aufgestaute Unmut über den Kaiser und die Skandale in seiner Umgebung brach sich Bahn und stürzte das Reich in eine schwere innere Krise. Das Vertrauensverhältnis zwischen Monarch und Kanzler, das schon nicht mehr gut gewesen war, ging endgültig zu Bruch. Der Kaiser hatte das Interview vor der Veröffentlichung Bülow vorgelegt und dessen Einwilligung erhalten. Er hatte sich also verfassungsgemäß verhalten und der politische Verantwortung des Kanzlers Rechnung getragen. Als Bülow dennoch versuchte, sich aus der Verantwortung zu stehlen, sah dies Wilhelm als Verrat an. Bülow verteidigte den Kaiser nur sehr lau, als in der Reichstagsdebatte über die Affäre Redner fast aller Fraktionen das persönliche Regiment des Kaisers kritisierten und verlangten, dass sich Wilhelm in solchen Dingen künftig heraushalten solle. Bülow nötigte den Kaiser zu einer Erklärung, dass er künftig die verfassungsmäßigen Verantwortlichkeiten wahren werde, um den öffentlichen Unmut zu dämpfen. Bei Wilhelm machte er sich mit all dem verhasst. Der Kaiser wartete nur auf eine Gelegenheit, den Kanzler loszuwerden. Die Affäre berührte natürlich auch die Stellung des Reichstages. Er hätte die Möglichkeit gehabt, nun seine Macht auszuweiten. Sozialdemokraten, Freisinn und Zentrum beantragten auch, dass der Artikel 17 der Verfassung, der die Verantwortlichkeit des Kanzlers regelte, neu gefasst werden sollte. Über die konkreten Schritte waren sie sich aber nicht einig. Zu einem klaren Bekenntnis zur parlamentarischen Monarchie konnte man sich nicht durchringen. Die Sozialdemokratie kam dieser Position noch am nächsten. Die Nationalliberalen wollten dagegen das konstitutionelle System beibehalten, aber die Befugnisse des Kaisers begrenzen. Die Konservativen lehnten dies strikt ab und waren für den Status quo. Im Grunde war das politische System des Kaiserreichs an einem Scheideweg angekommen. Sollte es wie andere europäische Monarchien in ein parlamentarisches System transformiert werden – oder sollte alles beim alten bleiben. Der Reichstag hat sich 1908/09 um eine klare Entscheidung gedrückt. Am Ende kam es zwar 1909 zum Kanzlersturz durch eine Mehrheit des Reichstages, aber das konnte man, wie wir sehen werden, noch nicht als Durchbruch zum Parlamentarismus werten. IV. Politische Systeme in anderen europäischen Staaten Alle europäischen Staaten standen spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vor den Herausforderungen der neuen kulturellen, sozialökonomischen und politischen 14 Veränderungen. Die Probleme, die sich aus der Beschleunigung des industriellen Wachstums, den Veränderungen der Gesellschaften und den daraus abgeleiteten Konflikte für die politischen Systeme und die bisherigen Machteliten ergaben, waren durchaus miteinander vergleichbar. Langfristig gingen alle Staaten ähnliche Wege. Aber es gab natürlich innerhalb Europas große Unterschiede, die sich politisch, sozial und ökonomisch in West-Ost- und Nord-Süd-Gefällen niederschlugen. Die jeweils spezifischen Voraussetzungen und Traditionen führten zu unterschiedlichen Lösungswegen. a) Autokratie und innere Reformen: Russland 1856-1914 Für Russland wurde die ökonomisch-soziale Rückständigkeit zum großen Problem. Das unterentwickelte Agrarland (1897 noch 77% landwirtschaftlich tätige Bevölkerung) blieb ökonomisch weit hinter den wirtschaftlichen Fortschritten des Westens zurück. Man ging dann auch in Russland unter Zar Alexander II. nach dem verlorenen Krimkrieg den Weg einer Reform von oben, hob 1861 die Leibeigenschaft auf und führte Justiz-, Verwaltungs- und Militärreformen durch. Es gab auch wirtschaftliche Fortschritte, die langfristig den innenpolitischen Veränderungsdruck erhöhten. Alle neuen Ansätze reichten aber nicht aus, um den politischen und wirtschaftlichen Abstand zum Westen aufzuholen. Das politische System Russlands schwenkte nicht auf jene Bahnen des Konstitutionalismus ein, die für das übrige Europa fast die Regel wurden. Russland wurde auch unter den Zaren Alexander II. (1881 ermordet) und Alexander III. autokratisch regiert. Die oppositionellen Strömungen hatten wenig Erfolg. Dies führte aber nur zu einer weiteren Verschärfung der innenpolitischen Repression. Erst mit der Revolution von 1905 wurden nochmals Ansätze unternommen, Anschluss an die west- und mitteleuropäische Verfassungsentwicklung zu gewinnen. b) Verfassungsfragen und Nationalitätenkämpfe: Österreich-Ungarn 1867-1890 Die Habsburger Monarchie folgte seit 1861 nicht mehr der Linie des Neoabsolutismus. Die Machteliten dieses Vielvölkerstaates mit dem von 1848 bis 1916 regierenden Kaiser Franz Joseph waren aus innen- wie deutschlandpolitischen Gründen auf die Bahn des Konstitutionalismus eingeschwenkt. Nach dem Krieg von 1866 wurde die Innenpolitik der Habsburger Monarchie durch die österreichisch-ungarischen Ausgleichsgesetze auf neue Grundlagen gestellt. Gewinner waren die Ungarn. Das alte Königreich Ungarn wurde mit weitreichenden Autonomierechten wiederhergestellt. Die Habsburger Monarchie bestand künftig aus zwei, durch eine gemeinsame dynastische Spitze (Kaiser von Österreich und König von Ungarn) verbundenen Reichsteilen: aus Ungarn und der cisleithanischen Reichshälfte. Außenpolitik, Finanzen und Kriegswesen wurden gemeinsam geregelt. Ansonsten gab es für jede Reichshälfte eigene Regierungen. Beide Reichshälften waren Vielvölkergebilde. In der ungarischen Hälfte hatten die Magyaren 1880 einen Anteil von 41,2%, in der anderen Hälfte die Deutschen zur gleichen Zeit einen Anteil von knapp 37%. Die zwei konstitutionellen Gebilde wurden durch ein System absoluter Prärogative der Krone überformt. Die konstitutionellen Elemente blieben weit schwächer als der Reichstag des Deutschen Reiches. Auch beim Wahlrecht blieb man weit hinter dem deutschen Reichstagswahlrecht zurück. Ein allgemeines Wahlrecht für Männer wurde in Cisleithanien erst 1907 eingeführt, in Ungarn bis 1914 nicht. Seit 1873 wurden die Abgeordneten des cisleithanischen Reichsrates direkt gewählt. Zwischen 1867 und 1878 dominierten auch in Cisleithanien zunächst einmal die Deutsch-Liberalen. Sie waren zentralistisch und gesamtstaatlich gesinnt und wollten den Deutschen die historisch gewachsene Führungsrolle bewahren. Es gab eine Liberalisierung des staatlichen Lebens, Wirtschaftsreformen und auch im katholischen Österreich eine Art Kulturkampf, mit dem die Liberalen die seit 1855 (Konkordat) besonders starke Stellung der katholischen Kirche zurückdrängen wollten. 1878 war auch in Österreich die liberale Phase schon wieder zu Ende. Auch hier spielten die 15 wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Krise von 1873 eine große Rolle. Mit dem neuen langjährigen Ministerpräsident Graf Taaffe (bis 1893) setzte nun eine konservative Regierungspolitik ein. Gegen den Kurs der Deutschliberalen, die auf die Befindlichkeiten der anderen Nationalitäten zu wenig Rücksicht nahmen, formierten sich nicht nur die nichtdeutschen Bevölkerungsteile. Auch in den deutschsprachigen Gebieten selbst stellten sich neue Parteirichtungen gegen die Liberalen. Die Christlich-soziale Partei unter dem Wiener Bürgermeister Karl Lueger wurde zur ersten Massenpartei Österreichs und verband ihr antiliberales Konzept mit dem Gedankengut katholisch-konservativer Sozialreform und einem kräftigen Schuss Antisemitismus. Mit dem Voranschreiten der Industrialisierung, die besonders im Wiener Raum und in Böhmen beachtlich war, wurde auch die Arbeiterbewegung immer wichtiger. Innerhalb des Deutschliberalismus vollzogen sich schließlich weitreichende Wandlungen, die den Charakter dieser Richtung völlig änderten. Aus dem Liberalismus entwickelte sich angesichts der Nationalitätenproblematik ein Deutschnationalismus, und aus ihm wiederum das „Alldeutschtum“. Wichtigster Führer war Georg von Schoenerer, der mit sozialreformerischen und antisemitischen Parolen gegen die Dynastie und die übernationale österreichisch-ungarische Monarchie, die katholische Kirche, die Juden und das Großkapital zu Felde zog. Die Deutschnationalen wollten die deutschsprachigen Gebiete Österreichs in eine staatsrechtliche Sonderstellung bringen und so ihren deutschen Charakter bewahren. Die Parteien der Habsburger Monarchie verstanden sich in der Regel als Nationalitätenparteien. Im Grunde haben vor 1914 nur die Sozialdemokraten unter den Austromarxisten Otto Bauer und Karl Renner um nationsübergreifende Konzepte gerungen. Aber auch sie sind schließlich schon innerhalb ihrer eigenen Richtung im Streit mit den Tschechen gescheitert. Die Nationalitätenkonflikte haben in beiden Reichshälften die Politik immer stärker belastet. Zu einer wirklichen Völkergemeinschaft mit gleichmäßiger Machtverteilung und Dezentralisierung ist es in der Habsburger Monarchie bis 1914 nicht mehr gekommen. Die eigentümliche Struktur des Vielvölkerreiches stand einer Modernisierung des politischen Systems im Wege und engte zugleich den außenpolitischen Spielraum immer mehr ein. c) Niederlage und Erneuerung: Frankreich zwischen 1870 und 1900 Das Erbe der Revolution: Das politische System Frankreichs war zwischen 1800 und 1871 von großer Instabilität, wechselnden Herrschaftsordnungen (Napoleon I., Herrschaft der Bourbonen 1815-1830; Julimonarchie 1830-1848, II. Republik 1848-1852, Kaisertum Napoleons III. 1852-1871) und schweren inneren Konflikten geprägt. Die politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung Frankreichs wurde nachhaltig bestimmt durch die langfristigen Folgen der Französischen Revolution. Die Revolution von 1789 wirkte im politischen Bereich durch den Bruch im politischen Bewusstsein der Franzosen, durch die Spaltung in Anhänger und Gegner der Revolution, weiter. Sie wirkte im sozialen Bereich durch die Beseitigung der alten Privilegiengesellschaft und die Schaffung einer rechtlich egalitären Gesellschaftsordnung weiter, deren Prinzipien seit der Revolution nicht mehr in Frage gestellt wurden. In wirtschaftlicher Hinsicht wirkte die Revolution aber eher bremsend auf den weiteren Verlauf des Modernisierungsprozesses, weil sie gesellschaftliche Kräfte stärkte, die wie die Bauern und Kleinbürgertum den Weg in die neue industriekapitalistische Gesellschaft eher hemmten. 16 Die Entstehung der III. Republik: Nach den schweren Niederlagen gegen die Deutschen erfolgten schon am 4. September 1870 die Ausrufung der Republik und die Bildung einer provisorischen Regierung unter den republikanischen Parlamentariern Léon Gambetta und Jules Favre. Die Anfang Februar 1871 abgehaltenen Wahlen zu einer Nationalversammlung führten zum Sieg der konservativen „Partei der Ordnung“. In der Nationalversammlung, die Adolphe Thiers zum Präsidenten der Republik wählte, die Frage der Staatsform aber noch offen hielt, hatten Legitimisten und Orléanisten, die Anhänger einer Herrschaft der alten Königsdynastien, eine Mehrheit. Sie waren sich aber über die Zukunft Frankreichs nicht einig. Die Legitimisten wollten den Grafen von Chambord auf dem Königsthron sehen. Die anderen – die Orléanisten – setzten sich für den Enkel der früheren Königs Louis Philippe ein. Letztere wollten eine moderne, gegenüber den neuen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen aufgeschlossene Monarchie. Die Legitimisten beschworen das alte Frankreich der Bourbonen, sie lehnten die Tricolore und die politische Kultur des nachrevolutionären Frankreich ab. Die Republikaner als zweitstärkste Kraft in der Nationalversammlung zerfielen in gemäßigte und linke Republikaner. Die Arbeiterbewegung spielte trotz der französischen Beiträge zur sozialistischen Tradition und Theoriebildung (Babeuf, Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Blanqui) im Parteienspektrum noch keine große Rolle. Ihre weitere Entwicklung wurde durch die Niederschlagung der Pariser Kommune behindert. Die Pariser Kommune: Der doppelte Schock der militärischen Niederlage und des konservativen Wahlerfolges löste unter den radikal-demokratisch-jakobinischen und den sozialistischen Kräften der Hauptstadt Paris Unruhen aus. Als die neue französische Nationalversammlung, die wegen des Krieges zunächst in Bordeaux zusammengetreten war, am 10. März 1871 beschloss, ihren Sitz nach Versailles, nicht aber nach Paris zu verlegen, wurde das von vielen in Paris als Signal einer Restauration der Monarchie angesehen. Nach ersten Straßenkämpfen zog Präsident Thiers am 18. März die Truppen aus der Stadt ab und verhängte über Paris den Belagerungszustand. In Paris und dem dazu gehörenden Seine-Departement wurde daraufhin am 26. Mai ein Generalrat gewählt (die Wahlbeteiligung lag unter 50%). Generalrat und Stadtkomitee bildeten nun die Regierung eines sich für selbständig erklärenden Stadtstaates. Man forderte die übrigen Städte Frankreichs auf, sich Paris anzuschließen. In den anderen Städten des Landes kam es aber nur zu kleineren Aufständen. In Paris selbst führte man bis Ende Mai 1871 zahlreiche Reformen durch. In der marxistischen Tradition wurde die Pariser Kommune als der erste große Klassenkampf einer zu neuem politischen Bewusstsein gelangten Arbeiterklasse interpretiert. Neuere sozialgeschichtliche Untersuchungen betonen dagegen, dass der Aufstand noch mehr in der Tradition des Juniaufstandes von 1848 stand und keineswegs bereits die neuen sozial- und politikgeschichtlichen Tendenzen des Industriezeitalters widerspiegelte. Die Regierung Thiers und die französische Nationalversammlung traten der Kommune und ihren sozialistischen und föderalistischen Ordnungsvorstellungen unversöhnlich entgegen. Sie beauftragten General Mac-Mahon, den Verlierer von Sedan, mit der militärischen Unterwerfung der Hauptstadt. Dies geschah Ende Mai 1871 mit ungewöhnlicher Brutalität. Der Bürgerkrieg forderte am Ende etwa 30 000 Tote, von denen aber nur etwa 1000 auf die Regierungstruppen entfielen. Zwischen Restauration der Monarchie und republikanischer Ordnung: In den ersten Jahren nach 1871 schien in Frankreich alles auf die Restauration einer Monarchie zuzulaufen. 1873 wurde Thiers als Präsident durch den legitimistisch orientierten Marschall Mac-Mahon ersetzt. Ministerpräsident wurde der legitimistische Herzog von Broglie. Die Restauration scheiterte, als sich der Herzog von Chambord weigerte, die 17 Trikolore und die parlamentarische Regierungsform zu akzeptieren. Daraufhin schwenkten Teile der Orléanisten um und schufen mit den Republikanern 1875 die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Dritten Republik. Wesentliche Elemente waren die nach dem allgemeinen gleichen Männerwahlrecht gewählte Deputiertenkammer, die gemeinsam mit dem Senat (75 Mitglieder auf Lebenszeit, 225 von den Departements gewählt) die Legislative bildete. An der Spitze der Exekutive steht ein auf 7 Jahre gewählter Präsident, der eine Regierung ernennt, die zugleich vom Vertrauen der Nationalversammlung abhängig ist. Die endgültige Festigung erhielt das neue System 1877, als Präsident Mac-Mahon mit seinem Versuch scheiterte, die seit 1876 von den Republikanern dominierte Deputiertenkammer durch vorzeitige Auflösung zu disziplinieren. Mac-Mahon verlor die Kraftprobe mit den republikanischen Kräften und trat 1879 als Präsident zurück. Neuer Präsident wurde Jules Grévy (bis 1887). Im Unterschied zum Deutschen Reich setzte sich Ende der 70er Jahre in Frankreich die parlamentarische Regierungsweise durch. Die neue Regierung der gemäßigten Republikaner betrieb eine Politik der inneren Reformen, wobei ein Schwerpunkt auf den Bildungsreformen lag. Dies führte zu heftigen Konflikten mit der katholischen Kirche. Darüber hinaus stellte sich Frankreich nun ganz in die Tradition von 1789. Der 14. Juli wurde Staatsfeiertag, die Marseillaise Nationalhymne. Ausbau und Krisen der Dritten Republik: Die neue Ordnung wurde getragen von den Kräften des industriellen Großbürgertums und den wichtiger werdenden bürgerlichen Mittelschichten. Der Industrialisierungsprozess entwickelte in Frankreich zwar eine geringere Dynamik als in England oder Deutschland, brachte trotz der Reformversuche (Regierung Ferry 1879-1885) aber auch hier neue Konflikte mit sich. Die neuen Arbeiterparteien spielten in den achtziger Jahren noch eine bescheidene Rolle im politischen System. Die Unzufriedenheit über mangelnden sozialen Fortschritt und eine außenpolitische Stagnation führte Mitte der achtziger Jahre zur antiparlamentarischen und nationalistischen Bewegung um den General und Kriegsminister Georges Boulanger (18371891). Nach spektakulären Wahlerfolgen Boulangers gelang es der Regierung aber 1889, durch Verfolgung Boulangers weitere Erfolge und Staatsstreichplanungen zu durchkreuzen. Dass der neue, antiparlamentarische und autoritäre Nationalismus, der unter Boulanger deutlich geworden war, weiterwirkte zeigte die Dreyfus-Affäre, die zwischen 1894 und 1906 die französische Nation in zwei Lager spaltete. Auf der einen Seite standen die rechten Kräfte, die sich in neuen Organisationen wie der „Action francaise“ unter Maurras formierten. Auf der anderen Seite standen die radikalen Republikaner und Intellektuellen, die sich für die rechtsstaatlichen Prinzipien einsetzten. Die Dreyfus-Affäre hat zum einen die bis dahin schleppend verlaufende Herausbildung moderner Parteien beschleunigt und zum anderen zur Ablösung der seit 1880 dominierenden gemäßigten Republikaner geführt. Die vor allem vom Kleinbürgertum unterstützten bürgerlich-linksdemokratischen „Radikalsozialisten“ (Waldeck-Rousseau, Clemenceau, Briand) dominierten nun bis 1914 die französische Innenpolitik. Sie verschärften noch einmal den Kampf gegen die als konservativ-restaurative Macht angesehene katholische Kirche und wurden hierin von den sich neu formierenden Sozialisten (SFIO seit 1905; Jean Jaurès) unterstützt. Die Allianz zerbrach aber wieder infolge der wachsenden sozialen Konflikte, in denen auch die Radikalsozialisten mit harten Maßnahmen gegen streikende Arbeiter einschritten. Auch die Republik mit ihrem parlamentarischen Regierungssystem und einer an 1789 ausgerichteten Geschichtskultur wurde somit ähnlich wie das ganz anders verfasste Deutsche Reich immer wieder mit heftigen inneren Konflikten konfrontiert. Neben den Prozessen der inneren Nationsbildung (Kultur, Wirtschaft, Verkehr) war es auch in Frankreich häufig ein nach außen gerichteter Nationalismus, mit dem die vielfältigen Integrationsprobleme überdeckt werden sollten. 18 d) Stabilität im Wandel: Das politische System Großbritanniens 1867 bis 1900 Großbritanniens Weg wurde von Historikern oft als mustergültiger Weg in die Moderne angesehen. Das Land erschien als Vorbild einer erfolgreichen Anpassung der politischen Herrschaftsordnung an veränderte wirtschaftliche und soziale Verhältnisse durch Reformen. Hierbei muss man sich jedoch vor der Gefahren einer Idealisierung hüten. Die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen werden oft ebenso unterschätzt wie die Tatsache, dass auch Großbritannien viele schwere soziale und politische Konflikte im 19. Jahrhundert durchlebte. Auch die Herausbildung einer britischen Identität erfolgte nicht nur über die freiheitlichen Traditionen, sondern ähnlich wie bei anderen europäischen Nationen vor allem durch einen nach außen gerichteten Nationalismus. Wirtschaftliche Entwicklungen im 19. Jahrhundert: Die um 1780 einsetzende Industrielle Revolution führte zu einem ökonomischer Vorsprung Englands gegenüber den anderen europäischen Staaten, die bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts deutlich zurückblieben. Seine entscheidende Beschleunigung erhielt der wirtschaftliche Strukturwandel in Großbritannien durch den in den zwanziger Jahren einsetzenden Eisenbahnbau. Nach den Stockungen und Krisen in den vierziger Jahren verzeichnete man in den fünfziger und sechziger Jahren eine neue große Aufwärtsentwicklung. Das Wachstum des Sozialprodukts lag deutlich über dem der Bevölkerung. 1800 hatte das Vereinigte Königreich mit Irland knapp 16 Millionen Einwohner; 1871 waren es 32 Millionen um 1900 waren es etwa 40 Millionen. Das Bevölkerungswachstum war verbunden mit einem raschen Urbanisierungsprozess. Schon 1871 lag der Anteil der Stadtbevölkerung an der britischen Gesamtbevölkerung bei 65%. 1837 hatte es 5 Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern gegeben, 1891 waren es 23. London zählte zu diesem Zeitpunkt bereits über 4 Millionen Einwohner. Der Anteil der Landwirtschaft am Sozialprodukt und ihr Anteil an den Erwerbstätigen gingen trotz der Produktionssteigerungen Agrarsektors stark zurück. Nach vorübergehenden Wachstumsschwächen in den siebziger und achtziger Jahren setzte um die Jahrhundertwende auch in Großbritannien nochmals ein starkes Wachstum des industriellen Sektors und des tertiären Sektors (Handel, Verkehr, Dienstleistungen) ein. Die gesellschaftlichen Strukturen: Die neuen sozialen Entwicklungen waren geprägt vom Aufstieg der middle classes und vom starken Anwachsen der working classes. Trotz des rasanten Wirtschaftswachstums, der Urbanisierung und des sozialen Wandels besaßen allerdings die vorindustriellen Strukturen und Mentalitäten noch lange Zeit ein beachtliches Gewicht. Alte Hierarchien hielten den neuen Entwicklungen lange stand. An der Spitze der britischen Gesellschaft stand die Königliche Familie. Die Monarchie festigte ihr zeitweise gesunkenes Ansehen durch Queen Victoria (1837-1901). In der viktorianischen Epoche passte sich die Monarchie endgültig in das parlamentarische System ein und erhob keine eigenen weitergehenden Machtansprüche mehr. Der Adel blieb eine starke gesellschaftliche Kraft und behielt trotz der Reformen einen wichtigen Platz in der politischen Führungsschicht: Regierung, Oberhaus, Unterhaus, lokale Verwaltung. Er setzte sich aus den zwei Gruppen Hochadel oder Nobility (ca. 200 Familien) und Gentry zusammen und umfasste insgesamt 1,4% der Bevölkerung. Im Unterschied zum ständisch abgeschlossenen kontinentalen Adel erwies sich der englische Adel als flexibler und reformfreudiger. Middle classes: Der Begriff umschrieb jene Teile der Gesellschaft, die weder dem Adel noch den städtischen und ländlichen Unterschichten angehörten. Gemeinsame Merkmale 19 dieser Gruppe waren ein Tugendkatalog (Arbeitssamkeit, Zielstrebigkeit und Gewissenhaftigkeit), das Kriterium der Selbständigkeit und ein gemeinsames politisches Bewusstsein. Wichtigster Teil der middle classes waren die besitz- und bildungsbürgerlichen Gruppen. Die Jahre zwischen 1850 und 1870 werden als wichtige Phase im Aufstiegsprozess der neuen bürgerlichen Kräfte angesehen. Die Politik paßte sich zunehmend den neuen wirtschaftlichen Interessen an (wirtschaftsliberaler Kurs). Die in der Gesamtgesellschaft dominierenden Werte wurden immer mehr von den Middle Classes bestimmt (bürgerliche Normen, viktorianischer Puritanismus). Entwicklung der Arbeiterschaft: Die industrielle Lohnarbeit gewann mit dem wirtschaftlichen Fortschritt rasch an Bedeutung. Ländliche und städtische Unterschichten lebten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vielfach in bitterstem Elend (Schilderungen bei Charles Dickens, Friedrich Engels). Ursache der Verarmung war nicht allein die Industrialisierung, sondern zunächst einmal die starke Bevölkerungsvermehrung, die trotz des wirtschaftlichen Wachstums zunächst dem Arbeitsplatzangebot vorauseilte. Die Not in den nicht entwickelten Gebieten (Irland) war weit größer als in den Industrieregionen. Es kam deshalb auch zu großen Abwanderungsbewegungen in die Städte. Dort entstand ein Reservoir an billigen Arbeitskräften, das dem Diktat des Arbeitsmarkts ausgeliefert war. Die schlimmsten Zustände herrschten in der Textilindustrie (hoher Anteil von Frauen- und Kinderarbeit). Insgesamt zeichnet sich die Arbeiterschaft noch durch große Heterogenität aus. Die unteren Schichten der Gesellschaft fielen bei der Verteilung des Sozialprodukts im Laufe des Industrialisierungsprozesses immer weiter zurückfielen. Ihr Lebensstandard hat sich aber zumindest nach den Krisen der vierziger Jahre allmählich verbessert, ohne dass die sozialen Probleme gelöst waren. Aus dem wirtschaftlichen und sozialen Wandel erwuchsen für die Politik zwei große Aufgaben: politische Reformen, die dem politischen Mitgestaltungsanspruch der neuen middle classes gerecht wurden und soziale Reformen, die den bislang unerfüllten Bedürfnissen der Arbeiterschaft nachkamen. Politische Systemkrisen und Reformpolitik in Großbritannien 1832-1867: Der englische Parlamentarismus hat eine lange Entstehungsgeschichte. Er gründet auf Institutionen und Traditionen, die bis ins Mittelalter zurückreichen und die im Verlaufe der Neuzeit in mehreren Etappen umgeformt worden sind. Wichtige Etappen waren die Revolutionen des 17. Jahrhunderts. Im Unterschied zu den neuen Verfassungen des 19. Jahrhunderts (z. B. Belgien) beruhte der englische Parlamentarismus nicht auf einem klar definierten Normensystem, sondern auf Konventionen, die das Parlament im Laufe von Jahrhunderten ausgebildet und durch seine Praxis aufrechterhalten hat. Es gibt keine geschriebene Verfassung. Es gibt im Grunde auch keine echte englische Parlamentarismustheorie. Das politische System wurde um 1800 von einer kleinen aristokratischen Gruppierung beherrscht, die nicht nur das House of Lords, sondern auch das politisch wichtigere House of Commons kontrollierte. Die Parteikämpfe waren Machtkämpfe rivalisierender Adelscliquen. Das Wahlrecht blieb auf einen exklusiven Kreis begrenzt. Die neuen, wirtschaftlich und sozial aufstrebenden Middle Classes waren im Parlament kaum vertreten. Je weiter der wirtschaftliche und soziale Wandel voranschritt, desto lauter wurde die Kritik am System. Nach verschiedenen Reformen in den zwanziger Jahren (Zulassung von Gewerkschaften, Gleichstellung von Dissenters und Katholiken) kam es 1832 auf Druck einer mächtigen bürgerlichen Reformbewegung zu einer ersten wichtigen Anpassung an die neuen Verhältnisse. Die unter Führung der Whigs durchgesetzte Reformbill von 1832 brachte erstens eine Neustrukturierung der Wahlkreise (Aufhebung der rotten boroughs), zweitens eine Neuregelung des Wahlrechts und drittens die endgültige Etablierung eines parlamentarischen Regierungssystems. Die Zahl der Wähler stieg aber nur von 500 000 auf 20 800 000, damit auf etwa 15% der Bevölkerung. Da sich das System reformfähig erwiesen hatte, trat zwar eine vorübergehende Beruhigung ein. Schon bald aber stellte die Arbeiterschaft über die Chartistenbewegung (William Lovett) weitergehende Ansprüche auf politische Partizipation. Die Bewegung zerfiel am Ende der vierziger Jahre wieder. Die britische Arbeiterbewegung ordnete sich in der Folgezeit zunächst einmal dem politischen Führungsanspruch der middle classes unterzuordnen und kämpfte in Kooperation mit dem Liberalismus für weitere Reformen. Eine weitere wichtige Weichenstellung erfolgte 1846 mit der Aufhebung der Kornzölle. Durch den Sieg der Anti-Kornzoll-Liga (Cobden, Bright) setzten sich die wirtschaftlichen Interessen des aufstrebenden Bürgertums (Freihandel) gegen die alte Aristokratie (Agrarzölle) durch. Es kam zur Spaltung der Konservativen. Die Gruppe um Peel und William Gladstone stieß später zu den Liberalen, die in den fünfziger Jahren politisch dominierten (Russell, Palmerston). Angesichts des sich beschleunigenden sozialen Wandels kam es um 1860 zu neuen Debatten über eine Reform des politischen Systems. Beide großen Parteien formierten sich neu und versuchten, sich auf die Erfordernisse der neuen Gesellschaft einzustellen. Aus den Anhängern Peels, den radikalen Reformern (Bright, Mill) und den alten Whigs formierte sich zu Beginn der sechziger Jahre eine neue liberale Partei, in der die aristokratischen Kräfte gegenüber den aufstrebenden bürgerlichen Kräften deutlich an Einfluss verloren. Nach einer trotz der Wahlrechtsdebatte politisch noch relativ ruhigen ersten Hälfte der sechziger Jahre nahm der Reformdruck seit 1866 schlagartig zu. Es entstanden neue Reformbewegungen wie die 1865 gegründete National Reform League, in der Gewerkschaftsführer, ehemalige Chartisten und radikalliberale Parlamentsabgeordnete den Ton angaben. Daneben entstand die gemäßigtere, ganz von den bürgerlichen Kräften geprägte National Reform Union. Auch die politischen Ereignisse im Ausland - der amerikanische Bürgerkrieg, der Polenaufstand von 1863 und die italienische Einigung verstärkten die Debatten und den innerbritischen Politisierungsprozeß. Die Wahlrechtsreform von 1867: Die Wahlrechtsoffensive wurde durch den neuen starken Mann der Liberalen eröffnet, durch William Gladstone, den Schatzkanzler der amtierenden Regierung Palmerston. Nach dem Tod von Palmerston wurde Lord John Russell 1865 neuer Premier. Gladstone blieb Schatzkanzler und legte im März 1866 einen Gesetzentwurf zur Wahlrechtsreform vor. Er sah die Ausweitung des Wahlrechts, nicht aber das allgemeine gleiche Wahlrecht vor. In den folgenden Monaten gab es intensive Debatten und wechselnde Parlamentsmehrheiten durch ganz neue Koalitionen, denn auch die Konservativen beteiligten sich nun aktiv an den Planspielen um die Wahlrechtserweiterung. Benjamin Disraeli, der kommende Mann der Konservativen, verbündete sich mit radikalen Liberalen gegen Gladstone. Ein Teil der Liberalen unter Robert Lowe (Adullamiten) lehnte die Wahlrechtsreform ab, so daß die Liberalen keine eigene Mehrheit besaßen. Demgegenüber hielt Disraeli seine Konservativen in der Wahlrechtsfrage zusammen. Am Ende trieben sich die Kontrahenten Disraeli und Gladstone unter dem Druck der öffentlichen Meinung gegenseitig zu einer Reform, die in bezug auf die Ausweitung des Wahlrechts weit über das hinausging, was beide ursprünglich wollten. Im Mai 1867 kam es zum Abschluß der zweiten Wahlrechtsreform. Die Zahl der Wähler stieg von etwa 1,4 auf über 2 Millionen. Damit blieb man noch weit vom allgemeinen gleichen Wahlrecht entfernt. Hinzu kamen beträchtliche Unterschiede zwischen den Regelungen in den Städten und denen auf dem Land. Die soziale Öffnung des Wahlrechts blieb in den ländlichen Regionen deutlich zurück. Erst die dritte Wahlrechtsreform des 19. Jahrhunderts beseitigte 1884 diese Ungleichheit. Die Durchsetzung des allgemeinen MännerWahlrechts erfolgte jedoch erst 1918. Die Einführung des Frauenwahlrechts, über das schon 1867 diskutiert wurde (John Stuart Mill) sogar erst 1928 abgeschlossen. Trotz der Defizite 21 unterstrich die Reform des Jahres 1867 erneut die Anpassungs- und Überlebenskraft des traditionsreichen englischen Systems. Politische Folgen der Wahlrechtsreform: Die Wahlrechtsdebatten und die Reform beschleunigten den Niedergang des bisherigen aristokratischen Systems. Sie ebneten den Weg zu einer stärker bürgerlich geprägten Politik. Sowohl die Liberalen als auch die Konservativen verstärkten durch neue organisatorische, programmatische und taktische Überlegungen die Modernisierung von Partei und Öffentlichkeitsarbeit. Sie stellten sich auf die Erfordernisse der heraufziehenden Massendemokratie ein. Bei den Konservativen wurde der Außenseiter Disraeli (getaufter Jude, sozialer Aufstieg aus kleinen Verhältnissen) zum wichtigsten Modernisierer. Man hat darüver spekuliert, ob er bei der Wahlrechtsreform nur den eigenen politischen Aufstieg im Kopf hatte oder von einem weitgefaßten Plan einer TORY-DEMOKRATIE geleitet wurde. Dieser große Plan scheint nicht existiert zu haben. Disraeli hatte Erfolg, weil er eine konservative Politik betrieb, die zwar an bestimmten Grundlinien ausgerichtet war, aber die nötige Flexibilität besaß, um auch ganz neue Wege zur Machteroberung und -sicherung einzuschlagen. Dies setzte er später mit der Verbindung von Sozialreform und imperialistischer Politik weiter fort. 1868 wurde Disraeli kurze Zeit Premierminister. Bei den ersten Wahlen nach der neuen Reform kam es jedoch zum Wahlsieg der Liberalen unter Gladstone. Dieser regierte bis 1874, ehe ein konservativer Wahlerfolg Disraeli erneut zum Premier aufsteigen ließ. 1880 wurde er dann erneute durch Gladstone abgelöst. Schluß: Großbritannien lief nicht nur wirtschaftlich, sondern auch mit seiner politischen Entwicklung dem Kontinent um einiges voraus. Es entwickelte von den großen Staaten als erstes ein parlamentarisches System. Es entwickelte als erstes westeuropäisches Land moderne Parteiorganisationen, die den Erfordernissen der Massendemokratie gewachsen waren, und es zeichnete sich durch eine relative Stabilität des politischen Systems aus. Andererseits gab es gemessen an einem "idealen" demokratischen Modernierungsmodell - auch noch Defizite. Es gab kein allgemeines gleiches Wahlrecht und auch keine moderne geschriebene Verfassung. Die britische Entwicklung war aufgrund der besonderen Voraussetzungen (pol. Tradition, Industrialisierung) auf dem Kontinent nicht einfach zu kopieren. Dennoch wirkte sie in vielfältiger Weise (politische Debatten, Vorbild von Parteien und anderen Organisationen) auch auf die dortigen Entwicklungen ein. 22 PROF. DR. HANS-WERNER HAHN VORLESUNG SOMMERSEMESTER 2003 DAS LANGE 19. JAHRHUNDERT, TEIL 2: GRUNDZÜGE DER EUROPÄISCHEN GESCHICHTE 18711914. 7./ I. ERFOLGE, KRISEN UND GRENZEN DES LIBERALEN SYSTEMS IN EUROPA. INFORMATIVE UND SEHR ANSCHAULICHE LÄNDERÜBERBLICKE UND WEITERFÜHRENDE LITERATURHINWEISE BEI: JÖRG FISCH, EUROPA ZWISCHEN WACHSTUM UND GLEICHHEIT 18501914, STUTTGART 2002. I. Die Staaten des nördlichen Europa: Die kleineren Staaten Europas waren im Zeitraum zwischen 1871 und 1914 von den gleichen inneren Entwicklungen betroffen wie die großen Mächte. Ein in unterschiedlichem Tempo verlaufender wirtschaftlicher Strukturwandel und die damit einher gehenden sozialen Veränderungen führten auch hier zur Transformation der politischen Systeme. Die Entwicklungen in den skandinavischen Staaten Das durch die Kriegsniederlage von 1864 endgültig in die Reihe der kleineren Staaten getretene und noch sehr agrarisch geprägte Dänemark besaß seit 1849 zwar eine der liberalsten Verfassungen Europas. Aber erst um die Jahrhundertwende etablierte sich auf Druck der Mehrheit in der zweiten Kammer (bäuerliche und sozialdemokratische Opposition) ein neues System, das nun auf dem allgemeinen und geheimen Wahlrecht beruhte und die Abhängigkeit der Regierung von einer Parlamentsmehrheit klar festschrieb. In Schweden wurde 1866 die bisherige Ständeversammlung in ein modernes Parlament umgewandelt, die Wahlrechtsregelungen blieben bis 1909 noch weit hinter dem Prinzip des allgemeinen Wahlrechts zurück, und auch die Regierung war bis 1917 offiziell dem König und nicht dem Reichstag politisch verantwortlich. In der Verfassungspraxis setzte sich der Parlamentarismus allerdings bereits früher durch. Die Industrialisierung, die in Schweden intensiver war als in den anderen Ländern des Nordens, und das Bevölkerungswachstum sorgten auch in Skandinavien für soziale Krisen. Ihre Eskalation wurde jedoch durch zwei Faktoren verhindert. Zum einen durch einen langsamer verlaufenden wirtschaftlichen Strukturwandel, der mehr Zeit zur Anpassung ließ. Zum zweiten durch eine verhältnismäßig große Auswanderung nach Nordamerika. Schweden und Norwegen hatten im 19. Jahrhundert nach Irland die höchsten Auswanderungsraten in Europa. Norwegen erlangte erst 1905 die internationale Anerkennung als souveränes Königreich (vorher Personalunion mit Schweden), hatte aber seit 1814 eine eigenständige Verfassung. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden die Rechte des Storting gegenüber der Regierung ausgedehnt und das Wahlrecht in mehreren Schritten erweitert. 1907/1913 erhielten hier auch die Frauen das Wahlrecht. II. Die Benelux-Staaten und die Schweiz: Der schnellere Industrialisierungsprozeß dieser Staaten sowie Religions- und Sprachenkonflikte sorgten dafür, daß hier der Transformationsprozess konfliktreicher verlief. Das 1831 entstandene Königreich Belgien besaß von Anfang an eine Verfassung, die den Monarchen an die Mehrheit des Parlaments band. Der Wahlzensus war allerdings sehr hoch und wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts nur allmählich abgesenkt. Schließlich kam es 1893 zu einem allgemeinen Wahlrecht, das aber nicht gleich war (Pluralwahlrecht). Wichtigste politische Gruppen waren die zunächst dominierenden Liberalen, der an Einfluß gewinnende politische Katholizismus und die Arbeiterbewegung. In den Niederlanden setzte sich 1848 ohne Revolution das parlamentarische System durch, das lange vom Liberalismus bestimmt wurde. Das zunächst hohe Zensuswahlrecht wurde in der Folgezeit nur langsam 23 abgeschwächt. 1913 waren erst knapp 70% der erwachsenen Männer wahlberechtigt. Zum allgemeinen Wahlrecht kam es erst 1917. Die sozialen Konflikte wurden auch in den Niederlanden zunächst teilweise recht brutal niedergeschlagen, ehe dann auch hier der Weg in eine moderne Arbeits- und Sozialgesetzgebung eingeschlagen wurde. Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich in Luxemburg, das seit 1867 ein eigenständiger Staat war. Die Schweiz war im 19. Jahrhundert eine der wenigen europäischen Republiken. Sie behielt die 1848 geschaffene bundesstaatliche Ordnung bei und damit auch das damals durchgesetzte allgemeine Männerwahlrecht. Die Schweizer Innenpolitik blieb auch nach 1848 nicht frei von Konflikten – z. B. Kulturkampf und die mit der Industrialisierung einsetzenden „Klassenkämpfe“. Am Ende aber reagierte das System flexibel genug, um schwerste Krisen zu verhindern. III. Die südeuropäischen Staaten: Obwohl hier die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungsprozesse weit weniger dynamisch verliefen als in der Mitte und im Westen Europas, war das politische System im 19. Jahrhundert häufiger und teilweise auch schwereren Konflikten ausgesetzt. Das galt für das 1830 geschaffene Königreich Griechenland, in dem 1862 der regierende Monarch Otto I (Haus Wittelsbach) gestürzt und durch König Georg I. ersetzt wurde, ebenso wie für die Staaten der iberischen Halbinsel. Ökonomische Rückständigkeit, marode Staatsfinanzen, eine noch sehr traditionale Gesellschaft und Analphabeteraten standen einer raschen Anpassung an die politischen Strukturen West-, Nord- und Mitteleuropas entgegen. In Griechenland, Spanien und Portugal spielten das Militär häufig eine wichtige Rolle bei den innenpolitischen Veränderungen. In Spanien wurde 1868 die Königin Isabella vom Militär abgesetzt. Spanien war zeitweise Republik, kehrte aber 1874 zum System einer konstitutionellen Monarchie zurück. Das Wahlrecht blieb bis ins 20. Jahrhundert hinein auf eine mit zwei Parteien agierende schmale Schicht begrenzt. Ein modernes politisches System hat sich in dem wirtschaftlich zurückgebliebenen Land nicht entwickeln können. Das Gleiche galt für Portugal, das seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine konstitutionelle Monarchie auf der Grundlage eines Zensuswahlrechts besaß, 1910 aber nach einem Militärputsch Republik wurde. Während in Deutschland die politische Verfassung den sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen hinterherzuhinken schien, lief in den südeuropäischen Staaten die Modernisierung des politischen Systems unter Führung gebildeter und progressiver Teile der Oberschicht und der Militärs den gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnissen häufig weit voraus. Damit aber waren das Scheitern moderner Verfassungen und Politikansätze sowie schwere innere Krisen vorprogrammiert. Spanien und Portugal verloren infolge ihrer Rückständigkeit und innerer Krisen auch außenpolitisch weiter an Boden. ITALIEN: Die zeitgleich verlaufenden italienischen und deutschen Einigungsprozesse sind oft miteinander verglichen worden. Neben Gemeinsamkeiten (Einigung durch Kriege, Führungsrolle Preußens und Piemont-Sardiniens; Bismarck und Cavour, Kompromiß mit bürgerlichen Kräften) gab es auch Unterschiede: Zum einen hatte die republikanische Linke im italienischen Einigungsprozess selbst entscheidende Akzente gesetzt (Garibaldi) Staatenpolitik und revolutionäre Nationalbewegung wirkten also zusammen. Zum anderen war die politische Einigung Italien stärker als die deutsche, die sich auf einen in Jahrzehnten gewachsenen Unterbau stützen konnte, das Programm einer kulturellen Elite, die mit ihren Vorstellungen der wirtschaftlichen und sozialen Realität ein ganzes Stück vorauseilte. Die innere Nationsbildung war noch nicht so weit vorangeschritten wie in Deutschland. Das ökonomische und soziokulturelle Gefälle innerhalb des neuen Staates war in Italien weit größer (Nord-Süd-Gefälle). Dies und die anhaltenden Auseinandersetzungen mit dem politisch entmachteten Papsttum war der Hintergrund für einen zentralistischen Staatsaufbau, 24 der allerdings im Süden durch die Kompromisse mit den regionalen Eliten wieder etwas durchlöchert wurde. Italien war wie das Kaiserreich eine konstitutionelle Monarchie mit starker Stellung des Herrschers. Die Minister waren dem König verantwortlich. Dieser besaß auch das Recht, das Abgeordnetenhaus aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben. In Italien schaffte es das Parlament aber im Laufe der Zeit, die eigene Position im politischen Prozess gegenüber dem Herrscher deutlich auszubauen und ein parlamentarisches System zu etablieren. Das Wahlrecht war allerdings an einen hohen Zensus und die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben gebunden. Bis 1882 konnten in Italien nur etwa 8% der erwachsenen Männer wählen, danach waren es 30%. Der Ausschluß der unteren Schichten und das päpstliche Verbot, sich als Katholik auf der nationalen Ebene politische zu betätigen, führten zu einem Zweiparteiensystem. Die Rechte war die Partei der piemontesischen Eliten, die zunächst vom Prestige ihrer erfolgreichen Einigungspolitik profitierte. Sie bekannte sich zum Reformprogramm eines gemäßigten Liberalismus. Die Politik lief bis 1876 in den von Cavour (1861 gestorben) geebneten Bahnen. Die innenpolitische Wende brachte dann die Linke an die Macht, die sich auch als liberale Partei verstand, sich aber stärker aus dem mittleren Bürgertum und aus dem Süden rekrutierte und Reformen entschiedener vorantrieb (Wahlrecht, Bildungssystem). Die Politik in Italien war damit lange Zeit Sache einer in zwei Parteien gespaltenen oligarchischen Herrschaftselite. Mit der Wahlrechtsreform der frühen achtziger Jahre und dem sich nun deutlicher abzeichnenden wirtschaftlichen Wandel begannen sich dann in den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts aber neue Kräfte zu formieren, die die bisherigen Herrschaftsstrukturen in Frage stellten. Der seit 1887 amtierende Ministerpräsident Crispi versuchte es mit innenpolitischen Reformen (Gesundheitswesen, Bildung), einem autoritären Regierungsstil und dem Streben nach außenpolitischen Erfolgen. Unter Crispi wandelte sich der bisherige emanzipatorische Nationalismus endgültig in einen integralen Nationalismus (Sammlung der nationalen Kräfte, Nationaldenkmal in Rom, imperialistische Politik). Nach außenpolitischen Niederlagen war dieses System nicht mehr zu halten. Unter dem Ministerpräsidenten Giolitti begannen verstärkte Bemühungen, bisher ausgegrenzte Teile der Gesellschaft in das politische System zu integrieren. 1912 wurde das Wahlrecht für alle Männer über 30 eingeführt. Jüngere durften wählen, wenn sie Wehrdienst geleistet hatten. Damit hatte Italien nach vielen Jahrzehnten den Übergang vom oligarchischen zu einem demokratischen Parlamentarismus geschafft. Angesichts der tiefen Spaltungen, die die italienische Gesellschaft durchzogen, erwies sich auch das neue System letztlich als wenig stabil. 25