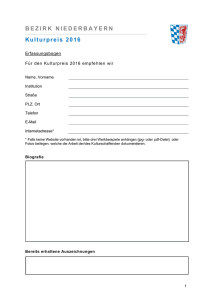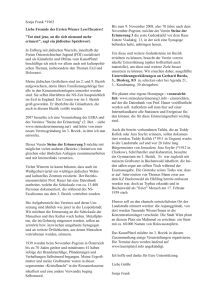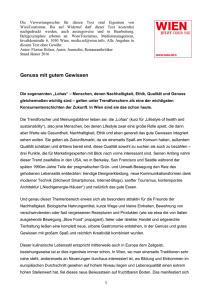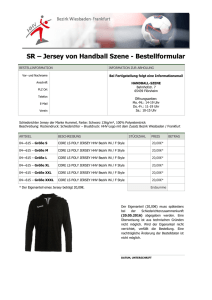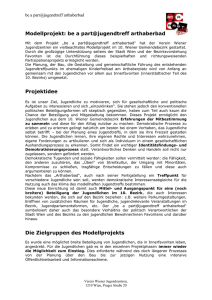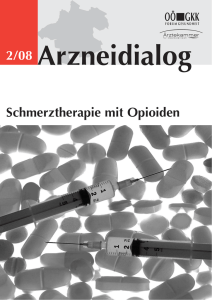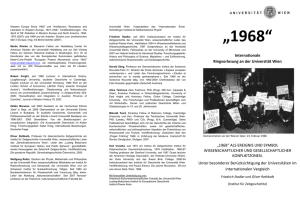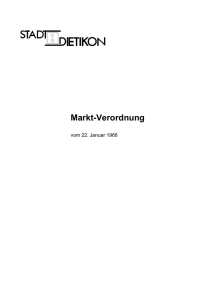Pacovská pahorkatina 1. GME-6, Hügelland, Hochland
Werbung
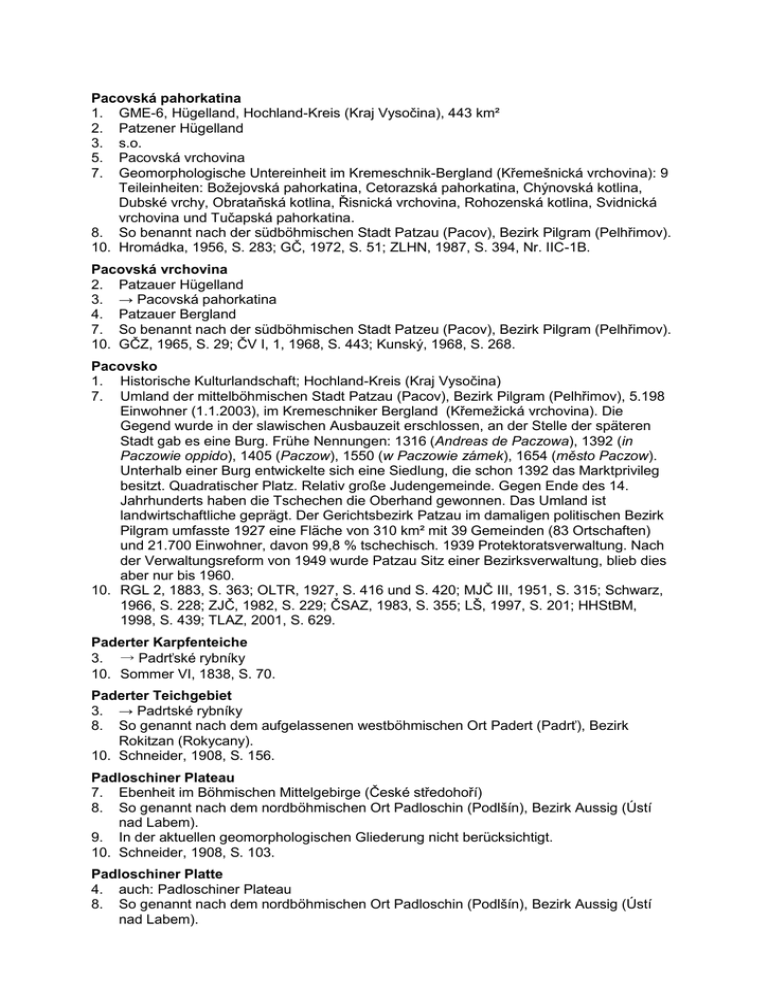
Pacovská pahorkatina 1. GME-6, Hügelland, Hochland-Kreis (Kraj Vysočina), 443 km² 2. Patzener Hügelland 3. s.o. 5. Pacovská vrchovina 7. Geomorphologische Untereinheit im Kremeschnik-Bergland (Křemešnická vrchovina): 9 Teileinheiten: Božejovská pahorkatina, Cetorazská pahorkatina, Chýnovská kotlina, Dubské vrchy, Obrataňská kotlina, Řisnická vrchovina, Rohozenská kotlina, Svidnická vrchovina und Tučapská pahorkatina. 8. So benannt nach der südböhmischen Stadt Patzau (Pacov), Bezirk Pilgram (Pelhřimov). 10. Hromádka, 1956, S. 283; GČ, 1972, S. 51; ZLHN, 1987, S. 394, Nr. IIC-1B. Pacovská vrchovina 2. Patzauer Hügelland 3. → Pacovská pahorkatina 4. Patzauer Bergland 7. So benannt nach der südböhmischen Stadt Patzeu (Pacov), Bezirk Pilgram (Pelhřimov). 10. GČZ, 1965, S. 29; ČV I, 1, 1968, S. 443; Kunský, 1968, S. 268. Pacovsko 1. Historische Kulturlandschaft; Hochland-Kreis (Kraj Vysočina) 7. Umland der mittelböhmischen Stadt Patzau (Pacov), Bezirk Pilgram (Pelhřimov), 5.198 Einwohner (1.1.2003), im Kremeschniker Bergland (Křemežická vrchovina). Die Gegend wurde in der slawischen Ausbauzeit erschlossen, an der Stelle der späteren Stadt gab es eine Burg. Frühe Nennungen: 1316 (Andreas de Paczowa), 1392 (in Paczowie oppido), 1405 (Paczow), 1550 (w Paczowie zámek), 1654 (město Paczow). Unterhalb einer Burg entwickelte sich eine Siedlung, die schon 1392 das Marktprivileg besitzt. Quadratischer Platz. Relativ große Judengemeinde. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts haben die Tschechen die Oberhand gewonnen. Das Umland ist landwirtschaftliche geprägt. Der Gerichtsbezirk Patzau im damaligen politischen Bezirk Pilgram umfasste 1927 eine Fläche von 310 km² mit 39 Gemeinden (83 Ortschaften) und 21.700 Einwohner, davon 99,8 % tschechisch. 1939 Protektoratsverwaltung. Nach der Verwaltungsreform von 1949 wurde Patzau Sitz einer Bezirksverwaltung, blieb dies aber nur bis 1960. 10. RGL 2, 1883, S. 363; OLTR, 1927, S. 416 und S. 420; MJČ III, 1951, S. 315; Schwarz, 1966, S. 228; ZJČ, 1982, S. 229; ČSAZ, 1983, S. 355; LŠ, 1997, S. 201; HHStBM, 1998, S. 439; TLAZ, 2001, S. 629. Paderter Karpfenteiche 3. → Padrťské rybníky 10. Sommer VI, 1838, S. 70. Paderter Teichgebiet 3. → Padrtské rybníky 8. So genannt nach dem aufgelassenen westböhmischen Ort Padert (Padrť), Bezirk Rokitzan (Rokycany). 10. Schneider, 1908, S. 156. Padloschiner Plateau 7. Ebenheit im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří) 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Padloschin (Podlšín), Bezirk Aussig (Ústí nad Labem). 9. In der aktuellen geomorphologischen Gliederung nicht berücksichtigt. 10. Schneider, 1908, S. 103. Padloschiner Platte 4. auch: Padloschiner Plateau 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Padloschin (Podlšín), Bezirk Aussig (Ústí nad Labem). 10. Engelmann, 1922, S. 48. Padrt Horní 2. Oberer Paderter Teich 3. → Horní Padrť rybník Padrťské rybník 2. Paderter Teichgebiet 3. → Horní Padrť rybník 10. Kunský, 1968, S. 168. Padrťské rybníky 1. Kleinlandschaft, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 2. Paderter Karpfenteiche; Paderter Teichgebiet 3. s.o. 7. Teichgebiet in Westböhmen 8. So genannt nach dem inzwischen aufgelassenen westböhmischen Ort Padert (Padrť), Bezirk Rokitzan (Rokycany). 10. HKK, 1960, S. 193; TLAZ, 2001, S. 629. Pahorkatiny České tabule 2. Hügelländer der Böhmischen Kreidetafel 9. Diese Gruppenbezeichnung wurde aus der Geomorphologischen Gliederung der Tschechischen Republik wieder gestrichen. 10. GČ, 1972, S. 76. Pálava CHKO 1. Landschaftsschutzgebiet, Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj) 2. Landschaftsschutzgebiet Pálava 7. Das geschützte Gebiet umfaßt das Nikolsburger Bergland (Mikulovská vrchovina) einschließlich der Pollauer Berge (Pavlovské vrchy) mit xerothermer Vegetation und bedeutenden vorgeschichtlichen Fundplätzen. Fläche 86 km² einschließlich 8 ha besonders geschützte Gebiete, 1976 eingerichtet. 10. NPR, 1977, S. 442; CHÚP, 1999, S. J8-J9; StR 2001, S. 81; TLAZ, 2001, S. 630; SZ, 2003, S. 129. Palom 2. Großer Polom 3. → Velký Polom 10. Kneifel II, 1804, S. 89. Pancíř 1. Berg, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 2. Panzer 3. s.o. 4. Panzerberg 7. Erhebung im Böhmerwald (Šumava), 1214 m hoch, Bezirk Klattau (Klatovy). 10. OLTR, 1927, S. 417; HKK, 1960, S. 159; GČZ, 1965, S. 49; ČV I, 1, 1968, S. 834; Kunský, 1968, S. 115; ČSAZ, 1983, S. 480; ZLHN, 1987, S. 395; Gorys, 1994, S. 230; Baedeker, 2000, S. 80; TLAZ, 2001, S. 632. Pánev chebská 2. Egerer Becken 3. → Chebská pánev 5. Chebská kotlina; Chebsko-falknovská kotlina 8. So benannt nach der westböhmischen Stadt Eger (Cheb), Bezirk Eger (Cheb). 10. OSN 6, 1893, S. 18; ČV 1, 1929, S. 372. Pánev falknovsko-loketská 2. Falkenauer Becken 3. → Sokolovská pánev 4. 8. Falkenau-Elbogener Becken So benannt nach den Städten Falkenau (Sokolov, früher Falknov nad Ohří) und Elbogen (Loket), Bezirk Falkenau (Sokolov). 10. ČV 1, 1929, S. 371. Pánev Kužvardská 2. Becken von Kuschwarda 8. So benannt nach dem südböhmischen Ort Kuschwarda (Strážný, früher Kužvart), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. OSN 6, 1893, S. 16. Pánev merklinská 2. Merkliner Furche 3. → Merklínská brázda 4. Merkliner Becken (wörtl.) 8. So genannt nach dem westböhmischen Ort Merklín, Bezirk Pilsen-Süd (Plzeň-jih). 10. Krejčí, 1876, S. 428. Pánev ostravsko-karvínská 2. Ostrauer-Becken 3. → Ostravská pánev 10. ČV 1, 1929, S. 288; Novák, 1947, S. 49. Pánev panonská 2. Panonisches Becken 3. → Panonská pánev 10. ČV 1, 1929, S. 11. Pánev plzeňská 2. Pilsener Becken 3. → Plzeňská pánev 8. So benannt nach der westböhmischen Stadt Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt (Pilzeňměsto). 10. Krejčí, 1876, S. 429. Pánev rakovnicko-slanská 2. Rakonitz-Schlaner Becken 3. → Rakovnická kotlina 10. Krejčí, 1876, S. 430. Pánev teplicko-duchcovská 2. Teplitzer Becken, Duxer Becken 3. → Duchcovská pánev; → Teplická pánev 4. Teplitz-Duxer Becken 8. So benannt nach den nordböhmischen Städten Teplitz-Schönau (Teplice v Čechách) und Dux (Duchcov), Bezirk Teplitz (Teplice). 10. ČV 1, 1929, S. 449. Pánev uničovská 2. Mährischneustädter Becken 3. → Uničovská kotlina 8. So benannt nach der nordmährischen Stadt Mährisch Neustadt (Uničov), Bezirk Olmütz (Olomouc). 10. ČV 1, 1929, S. 45. Pánev videňská 2. Wiener Becken 3. → Vídeňská pánev 6. Bassin de Vienne (franz.); Vienna Bassin (engl.); Viedenská kotlina (slow.) 8. So benannt nach der österreichischen Hauptstadt Wien, tschech. Exonym Vídeň. 10. ČV 1, 1929, S. 14. Pankrazer Paß 2. Gabeler Paß 3. → Jitravské sedlo 4. Freudenhöhe; Paß von Pankraz 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Deutsch Pankraz (Jitrava), Bezirk Reichenberg (Liberec). 10. Schneider, 1908, S. 186. Pannonian Basin 2. Pannonisches Becken 3. → Pánonská pánev 5. Subkarpatské pánve 6. Bassin de Pannonia (franz.); Panonská pánva (slow.) 9. Englische Bezeichnung. 10. VGJ, 1996, S. 44. Pannonisches Becken 3. → Panonská pánev 5. Subkarpatské pánve 6. Bassin de Pannonia (franz.); Pannonian Basin (engl.); Panonská pánva (slow.) 10. BS, 1962, S. 554; MKM Europa 3, 1972, S. 11; OTS, 1975, S. 41; Sperling, 1981, S. 42; VGJ, 1996, S. 44. Panonská nižina 3. → Panonská pánev 4. Pannonisches Tiefland 6. Panonská pánva (slow.) 10. Kunský, 1968, S. 104; OTS, 1975, S. 41. Panonská pánev 1. GME-2, Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj) / A-Niederösterreich / H / Slowakei / A, 965 km2 in der ČR 2. Panonisches Becken 5. Subkarpatské pánve 6. Bassin de Panonie (franz.); Panonian Basin (engl.) 7. Großregion (Subsystem) in Mitteleuropa. Es handelt sich um ein tektonisches Becken von Mitteleuropa, das zwischen den Karpaten im Norden, dem Siebenbürgischen Hochland im Osten, den Dinariden im Süden und den Alpen im Westen angeordnet ist. Die Auffüllung mit neogenen Sedimenten war im Miozän am stärksten. Auch klimatisch ist das Panonische Becken von seiner Umgebung abgehoben. Der größte Teil Ungarns liegt im Panonischen Becken, Österreich und die Tschechische Republik haben nur geringen Anteil und zwar mit dem Wiener Becken (Vídeňská pánev). 10. HKK, 1960, S. 32; MKM Europa 3, 1972, S. 11; ZLHN, 1987, S. 37; VGJ, 1996, S. 44. Pańska Góra 2. Panskerberg 3. → Panský vrch 9. Polnische Bezeichnung. 10. SGTS 14, 1992, S. 164. Panská skála 1. Naturdenkmal, Kreis Reichenberg (Liberecký kraj) 2. Herrenhausfelsen 3. s.o. 4. Gehörnhausfelsen 7. Geologische Besonderheit, 10-15 m hohe vier- bis sechskantige Basaltsäulen von grauschwarzer Farbe, deshalb auch „Basaltorgel“ oder „Teufelsorgel“ genannt bei Steinschönau (Kanenický Šenov), Bezirk Böhmisch Leipa (Česká Lípa). 10. HKK, 1960, S. 59; SLL, 1985, S. 195; ZLHN, 1987, S. 396; Gorys, 1994, S. 293. Panskerberg 3. → Panský vrch 6. Pańska Góra (poln.) 10. SGTS 14, 1992, S. 164. Panský vrch 1. Berg; Kreis Königgratz (Královehradecký kraj) 2. Panskerberg 3. s.o. 6. Pańska Góra 7. Erhebung im Adlergebirge (Orlické hory), 722 m hoch, nahe der Grenze zur Republik Polen gelegen. 10. ZLHN, 1987, S. 397; SGTS 14, 1992, S. 164. Panví Falknovsko-Karlovarské 2. Falkenauer Becken 3. → Sokolovská pánev 4. Falkenau-Karlsbader Becken 8. So genannt nach den westböhmischen Städten Falkenau (Sokolev, früher Falknov), Bezirk Falkenau (Sokolov), und Karlsbad (Karlovy Vary), Bezirk Karlsbad (Karlovy Vary). 10. Krejči, 1878, S. 692. Panzer 3. → Pancíř 4. Panzerberg 10. Sommer VIII, 1840, S. XI; WK, 1860, S. 45; MWB Böhmen I, 1884, S. 98; Beer, 1925, S. 59; OLTR, 1927, S. 417; Gorys, 1994, S. 230. Panzerberg 2. Panzer 3. → Pancíř 10. Willkomm, 1878, S. 9. Papajské sedlo 1. Paß; Kreis Zlin (Zlinský kraj) / Slowakei 5. Makyta průsmyk; Průsmyk Papajský 7. Paß im Javornik-Gebirge (Javorníky). 10. GČZ, 1965, S. 268; Kunský, 1968, S. 398. Paprč 1. Berg, Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj) 3. s.o. 5. Babáč 7. Erhebung im Drahaner Hochland (Drahanská vrchovina), 721 m hoch. 10. ČV I, 1, 1968, S. 453; Kunský, 1968, S. 275; AR, 1981, S. 131; ZLHN, 1987, S. 397. Paprsek Hostýnský 2. Russawa-Bergland 3. → Rusavská hornatina 10. OSN 17, 1901, S. 612. Paprsek Javornický 2. Jaworník-Rücken 3. → Javornický hřbet 5. Jaworník-Zug (wörtl.) 8. So benannt nach dem Großen Jaworník (Velký Javorník). 10. OSN 17, 1901, S. 237. Paprsek Jurikovský 10. OSN 17, 1901, S. 612. Paprsek Hostýnský 3. → Rusavská hornatina 8. So genannt nach dem 735 m hohen Berg Hostein (Hostýn). 10. ZLHN, 1987, S. 444, Nr. IXE-1A-a. Paprsek Ondřejovský 3. → Lukovská vrchovina 10. OSN 17, 1901, S. 612. Parchen 3. → Prácheň 4. Prachin; Prachyn; Prachyenberg 10. RBL, 1989, S. 160; HHStBM, 1998, S. 200. Parchen-Bergland 2. Parchen-Hügelland 3. → Prácheňská pahorkatina 5. Prácheňská vrchovina (wörtl.); Prácheňská podhoří; Prácheňské podhůří 8. So genannt nach dem 513 m hohen Parchen (Prácheň), Bezirk Klattau (Klatovy). Parchen-Hügelland 3. → Prácheňská pahorkatina 5. Prácheňská vrchovina; Prácheňská podhoří; Prácheňské podhůří 8. So genannt nach dem 513 m hohen Parchen (Prácheň), Bezirk Klattau (Klatovy). Parchen-Vorgebirgsland 2. Parchen-Hügelland 3. → Prácheňská pahorkatina 4. Parchenbergland 5. Prácheňská vrchovina; Prácheňská podhoří; Prácheňské podhůří (wörtl.) 8. So genannt nach dem 513 m hohen Parchen (Prácheň), Bezirk Klattau (Klatovy). Parchener Rücken 3. → Párcheňské hřbety 8. So genannt nach dem 513 m hohen Parchen (Prácheň), Bezirk Klattau (Klatovy). Pardubická kotlina 1. GME-6, Tafelland, Kreis Pardubitz (Pardubický kraj), 718 km2 2. Pardubitzer Becken 3. s.o. 4. Pardubitzer Ebene; Pardubitzer Kreidebecken 5. Pardubická pánev 7. Geomorphologische Untereinheit auf dem Tafelland an der östlichen Elbe (Východolabské tabule). 6 Teileinheiten: Bohdanečeská brána; Holická tabule; Kralovéhradecká kotlina; Kunětická kotlina; Sezemická brána und Sršská plošina. 8. So benannt nach der ostböhmischen Stadt Pardubitz (Pardubice), Bezirk Pardubitz (Pardubice). 10. BS, 1962, S. 186; GČZ, 1965, S. 12; ČV I, 1, 1968, S. 341; Kunský, 1968, S. 66; GČ, 1972, S. 79; OTS, 1975, S. 41; GeoKr, 1984, S. 156; ZLHN, 1987, S. 397, Nr. VIc-1c. Pardubická nižina 2. Pardubitzer Niederung 8. So benannt nach der ostböhmischen Stadt Pardubitz (Pardubice), Bezirk Pardubitz (Pardubice). 10. ČV 1, 1929, S. 344. Pardubická pánev 2. Pardubitzer Becken 3. → Pardubická kotlina 4. Pardubitzer Ebene; Pardubitzer Kreidebecken 8. So benannt nach der ostböhmischen Stadt Pardubitz (Pardubice), Bezirk Pardubitz (Pardubice). 10. ČV 1, 1929, S. 51; HKK, 1960, S. 59; ČV I, 1, 1968, S. 703. Pardubicko 1. Historische Kulturlandschaft, Kreis Pardubitz (Pardubický kraj) 7. Umland der Stadt Pardubitz (Pardubice), Bezirk Pardubitz (Pardubice), 89.725 Einwohner (1.1.2003), im östlichen Böhmen in der Elbniederung gelegen. Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt geht auf das Jahr 1295 zurück (Pardoby), dann wieder 1340 (Pordubycz cum civitate nova), 1392 (Pordubicze), 1421 (Thaboritae mon. Pardidub), 1493 (aby vyplatil mon. Pardubice mnichové), 1560 (zamek Pardubiczky). Die ersten Nennungen hängen mit den Aktivitäten des Cyriakusordens zusammen. An der Mündung der Chrudimka in die Elbe (Labe) entstand eine Wasserburg. Die Erhebung zur Stadt erfolgte zwischen 1332 und 1340. Seitdem war Pardubitz der Mittelpunkt der Herrschaft Pernstein. Die Niederungen im Umkreis wurden systematisch kultiviert, zahlreiche Fischteiche wurden angelegt. Pardubitz wurde zur Festung ausgebaut, was die Entfaltung des Gewerbes behinderte. Erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich mit der Entfaltung des Eisenbahnwesens die Industrialisierung durch, zunächst standen noch Nahrungs- und Genußmittelindustrie im Vordergrund (z. B. die bekannten Lebkuchen und Bier), dann landwirtschaftliche Maschinen und Chemie. Der politische Bezirk Pardubitz, bestehend aus den Gerichtsbezirken Holitz, Pardubitz und Prdanč, umfaßte 1927 eine Fläche von 786 km² mit 140 Gemeinden (183 Ortschaften) und 102.000 Einwohnern, davon fast 99% Tschechen. Die Gegend war fast rein tschechisch und gehörte von 1939 bis 1945 zum Protektorat. Nach dem Zweiten Weltkrieg Ausbau zur Bezirksverwaltungsstadt und weitere Industrialisierung. Durch die Verwaltungsreform 1949 wurde Pardubitz Kreishauptstadt (Pardubický kraj), jedoch wurde der Kreis 1949 wieder aufgelöst. Gleichzeitig wurde die Stadt Sitz einer Bezirksverwaltung für einen Stadt- und Landbezirk, diese wurden 1960 zusammengelegt und erweitert. 10. Schaller XI, 1790, S. 35; Sommer V, 1837, S. 48; Rieger 6, 1867, S. 105; RGL 2, 1883, S. 357; OSN 19, 1902, S. 219; OLTR, 1927, S. 418; MJČ III, 1951, S. 321; Šmilauer, 1960, S. 207; Schwarz, 1961, S. 160; Schwarz, 1966, S. 294; ČV I, 1, 1968, S. 150; Kunský, 1968, S. 212; ČV II, 2, 1969, S. 469; ZJČ, 1982, S. 230; ČSAZ, 1983, S. 356; RBL, 1989, S. 322; Gorys, 1994, S. 308; LŠ, 1997, S. 202; HHStBM, 1998, S. 436; Baedeker, 2000, S. 210; StR, 2001, S. 58; TLAZ, 2001, S. 634. Pardubický kraj 1. Verwaltungseinheit 2. Kreis Pardubitz (Pardubice) 7. Kreis (entspr. Regierungsbezirk) in Böhmen. Besteht aus den Bezirken Pardubitz (Pardubice), Wildenschwerdt (Ústí nad Orlicí), Zwittau (Svitavy) und Chrudim. Fläche 4.519 km2, 508.600 Bewohner, 43 Einwohner/km2, 453 Gemeinden. 10. StR 2001, S. 57. Pardubický okres 1. Verwaltungseinheit 2. Bezirk Pardubitz (Pardubice) 5. Pardubicko 7. Bezirk im gleichnamigen Kreis (Pardubický kraj). Fläche 889 km2, 161.300 Bewohner, 182 Einwohner/km2, 115 Gemeinden. 10. StR, 2001, S. 57. Pardubitzer Becken 3. → Pardubická kotlina 4. Pardubitzer Ebene; Pardubitzer Kreidebecken 5. Pardubická pánev 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Pardubitz (Pardubice), Bezirk Pardubitz (Pardubice). 10. Sydow, 1968, S. 141; OTS, 1975, S. 41. Pardubitzer Ebene 2. Pardubitzer Becken 3. → Pardubická kotlina 4. Pardubitzer Kreidebecken 5. Pardubická pánev 10. Engelmann, 1928, S. 46. Pardubitzer Kreidebecken 2. Pardubitzer Becken 3. → Pardubická pánev 4. Pardubitzer Ebene 5. Pardubická kotlina 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Pardubitz (Pardubice), Bezirk Pardubitz (Pardubice). 10. Sydow, 1868, S. 152. Pařez 1. Berg; Kreis Aussig (Ústecký kraj) 2. Klotzberg 3. s.o. 4. Glotzberg; Großer Klotzberg 7. Erhebung im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří), 736 m hoch, Bezirk Teplitz (Teplice). 10. ZLHN, 1987, S. 397. Pasmo Kněhyně 10. OSN 17, 1901, S. 610. Pasmo Smrku 10. OSN 17, 1901, S. 610. Passauer Weg 2. Goldener Steig 3. → Zlatá stezka 6. Via aurea, Via bohemica, Via semita aurea 10. Lippert I, 1896, S. 51. Passauer oder Prachatitzer Steig 2. Goldener Steig 3. → Zlatá stezka 10. Kloeden, 1875, S. 84. Paß am Jauersberg 2. Rosenkranzpaß 3. → Růzenec 6. Przełęcz Różaniec 10. Partsch I, 1896, S. 401. Paß bei Jakobsthal 2. Neue-Welt-Paß 3. → Novosvětský průsmyk 4. Proxenpaß 6. Przełęcz Sklavska (poln.) 9. So genannt nach Jakobsthal (Jakuszyce), einem Ortsteil von Schreiberhau (Szklavska Poręba). 10. Bach, 1989, S. 67. Paß von Aigen 9. So genannt nach dem oberösterreichischen Ort Aigen. 10. Friedrich, 1911, S. 8; Machatschek, 1927, S. 237. Paß von Buchwald 8. So genannt nach dem südböhmischen Ort Buchwald (Bučina), Bezirk Prachatice (Prachatitz). 10. Willkomm, 1878, S. 7; MWB Böhmen I, 1884, S. 100. Paß von Eisenstein 3. → Želenorudský průsmyk 5. Eisensteinský průsmyk 8. So genannt nach dem Grenzort Markt Eisenstein (Želežná Ruda), Bezirk Klattau (Klatovy). 10. Willkomm, 1878, S. 13; MWB Böhmen I, 1894, S. 98; Friedrich, 1911, S. 6; Moscheles, 1921, S. 68; Beer, 1925, S. 59; Machatschek, 1927, S. 237; OLTR, 1927, S. 2; Werdecker, 1957, S. 20. Paß von Jakobsthal 2. Neue Welt-Paß 3. → Novosvětský průsmyk 4. Neuwelter Sattel; Proxenpaß; Proxensattel 6. Przełęcz Sklarska (poln.) 10. Partsch I, 1896, S. 401. Paß von Kapellen 8. So genannt nach dem Ort Kapellen (Kapeln), Bezirk Krumau (Český Krumlov). 10. MWB Böhmen I, 1884, S. 106. Paß von Krautenwalde 2. Krautenwalder Paß 4. Landecker Paß 6. Pzelecz Lądecka (poln.) 8. So genannt nach dem nordmährischen Ort Krautenwalde (Travná, früher: Krutvald), Bezirk Mährisch-Schönberg (Šumperk). 10. Partsch I, 1896, S. 65; Sobotik, 1930, S. 14; Knebel, 1993, S. 111. Paß von Kuschwarda 3. → Kunžvartské sedlo 8. So genannt nach dem südböhmischen Ort Kuschwarda (Kunžvart, jetzt Strážný), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. WK, 1860, S. 77; Willkomm, 1878, S. 17; MWB Böhmen I, 1884, S. 100; Beer, 1925, S. 64; Werdecker, 1957, S. 20. Paß von Liebau 2. Liebauer Sattel 3. → Libavské sedlo 6. Przełecz Lubawska (poln.) 8. So genannt nach der schlesischen Stadt Liebau (Lubawka). 10. Friedrich, 1911, S. 9; Schwarz, 1965, S. 305. Paß von Lissa 2. Lissa-Paß 3. → Liský průsmyk 8. So genannt nach der schon in der Slowakei liegenden Siedlung Lysá pod Makytou. 10. Kloeden, 1875, S. 128. Paß von Wlar 2. Vlarapaß 3. → Vlarský průsmyk 8. So genannt nach dem Flüßchen Wlar (Vlára). 10. Kloeden, 1875, S. 128. Paß von Mittelwalde 3. → Mladkovské sedlo 5. 6. 8. 10. Proluka Mitwaldská Przełęcz Międzileska So genannt nach dem schlesischen Grenzort Mittelwalde (Międzilesie). Werdecker, 1957, S. 12; Bernatzky, 1988, S. 22; SGTS 14, 1992, S. 196; Knebel, 1993, S. 106; SGTS 16, 1993, S. 268. Paß von Nachod 2. Nachoder Sattel 3. → Náchodský průsmyk 4. Nachoder Steig; Polensteig 6. Przełęcz Polska Wrota (poln.) 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Náchod, Bezirk Náchod. 10. Schweitzer, 1846, S. 4; Friedrich, 1911, S. 8. Paß von Nepomuk 8. So genannt nach dem Ort Nepomuk, Bezirk Budweis (České Budějovice). 10. Sommer VII, 1839, S. III; ARCL 2, 1866, S. 891; MWB Böhmen I, 1884, S. 90. Paß von Neugedein 2. Kdyňský průsmyk 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Neugedein (Kdyně), Bezirk Taus (Domažlice). 10. Sommer VII, 1839, S. III; WK, 1860, S. 84; ARCL 2, 1866, S. 891; Willkomm, 1878, S. 50; MWB Böhmen I, 1884, S. 95. Paß von Neumarkt (Neumark) 2. Neumarker Paß 3. → Všerubský průsmyk 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Neumark (Všeruby), Bezirk Taus (Domažlice). 10. Kloeden, 1875, S. 83. Paß von Nollendorf 2. Nollendorfer Paß 3. → Nakléřovské sedlo 5. Tiské sedlo 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Nollendorf (Nakléřov), Bezirk Aussig (Ústí nad Labem). 10. Kloeden, 1875, S. 96. Paß von Pankraz 2. Gabeler Paß 3. → Jitravské sedlo 4. Freudenhöhe; Pankrazer Paß 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Deutsch-Pankraz (Jitrava), Bezirk Reichenberg (Liberec). 10. Sydow, 1868, S. 150; Engelmann, 1928, S. 12. Paß von Ramsau 2. Ramsauer Sattel; Spornhauer Sattel 3. → Ramzovské sedlo 8. So genannt nach dem Ortsteil Ramsau (Ramzova) von Oberlindewiese (Horní Lipowa), Bezirk Mährisch-Schönberg (Šumperk). 10. Hielscher, 1936, S. 1. Paß von Taus 3. → Domažlický průsmyk 4. Sattel von Taus 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Domažlice (Taus), Bezirk Taus (Domažlice). 10. Friedrich, 1911, S. 70; Schwarz, 1965, S. 352. Paß von Waldmünchen 8. So genannt nach dem bayerischen Ort Waldmünchen. 10. ADRE 2, 1843, S. 467. Paßgebiet von Gmünd 2. Senke von Gmünd 3. → Českovelenická pánev 4. Sattel von Gmünd 10. Werdecker, 1957, S. 47. Paßgebiet von Grulich 2. Grulich-Mittelwalder Senke 3. → Králická brázda 4. Grulicher Furche 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Grulich (Králický), Bezirk Wildenschwerdt (Ústí nad Orlicí). 10. Werdecker, 1957, S. 12. Paßlandschaften von Landeshut und Trautenau 6. Kotlina Kamiennogórská (poln.) 8. So genannt nach der schlesischen Stadt Landeshut (Kamienna Góra) und der ostböhmischen Stadt Trautenau (Trutnov), Bezirk Trautenau (Trutnov). 10. Sedlmeyer, 1941, S. 36. Patschkauer Berge 2. Patschkauer Vorbergland 3. Žulovská pahorkatina 4. Friedeberger Hügelland 6. → Przedgórze Paczkowskie (poln.) 8. So genannt nach der schlesischen Stadt Patschkau (Paczkow), PL-Woj. Dolnośląskie. 10. Wolny 1, 1846, S. XX. Patschkauer Vorbergland 3. → Žulovská pahorkatina 6. Przedgórze Paczkowskie (poln.) 8. So genannt nach der schlesischen Stadt Patschkau (Paczków), PL-Woj. Dolnośląskie. Patzauer Bergland 2. Patzauer Hügelland 3. → Pacovská pahorkatina 5. Pacovská vrchovina (wörtl.) 8. So genannt nach der südböhmischen Stadt Patzau (Pacov), Bezirk Pilgram (Pelhřimov). Patzauer Hügelland 3. → Pacovská pahorkatina 5. Pacovská vrchovina 8. So genannt nach der südböhmischen Stadt Patzau (Pacov), Bezirk Pilgram (Pelhřimov). Pausramer Koppen 3. → Pouzdřanské kopce 8. So genannt nach dem südmährischen Ort Pausram (Powzdřany), Bezirk Lundenburg (Břeclav). Pavlavské vrchy 2. Pollauer Berge 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Bergland; Pollauer Felsklippen; Pollauer Gebirge; Pollauer Hügel 10. MSN 1, 1925, S. 1049. Pavlovská vrchovina 2. Pollauer Berge 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Bergland (wörtl.); Pollauer Gebirge 8. So benannt nach dem südmährischen Ort Pollau (Pavlov), Bezirk Lundenburg (Břeclav). Pavlovské bradlo 2. Pollauer Berge 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Felsklippen (wörtl.); Pollauer Gebirge 8. So benannt nach dem südmährischen Ort Pollau (Pavlov), Bezirk Lundenburg (Břeclav). 10. ČV I, 1, 1968, S. 736; Kunský, 1968, S. 184. Pavlovské kopce 2. Pollauer Berge 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Bergland; Pollauer Felsklippen; Pollauer Gebirge; Pollauer Hügel (wörtl.) 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Bergland (wörtl.); Pollauer Gebirge 8. So benannt nach dem südmährischen Ort Pollau (Pavlov), Bezirk Lundenburg (Břeclav). 10. OSN 17, 1901, S. 614; ČV 1, 1929, S. 41. Pavlovské pohoří 2. Pollauer Berge 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Bergland; Pollauer Felsklippen; Pollauer Gebirge (wörtl.); Pollauer Hügel 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Bergland (wörtl.); Pollauer Gebirge 8. So benannt nach dem südmährischen Ort Pollau (Pavlov), Bezirk Lundenburg (Břeclav). 10. OLTR, 1927, S. 442; SLL, 1985, S. 350. Pavlovské vrchy 1. GME-6, Bergland, Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj) / A-Niederösterreich, 44 km2 in der ČR 2. Pollauer Berge 3. s.o. 4. auch: Polauer Berge; Pollauer Gebirge 5. Pavlovská vrchovina; Pavlovské bradlo; Pavlovské kopce; Polavské vrchy; Vrchy Pálavské 7. Geomorphologische Untereinheit im Nikolsburger Bergland (Mikulovská pahorkatina). Entsprechend dem geologischen Untergrund sind gut ausgebildete Karsterscheinungen zu beobachten. Weltbekannt sind die prähistorischen Fundstätten bei der Karsthöhle „Na Turoldu“. Landschaftsschutzgebiet mit neun Reservaten. 8. So benannt nach dem südmährischen Ort Pollau (Pavlov), Bezirk Lundenburg (Břeclav). 10. Koláček, 1934, S. 50; Kuchař, 1955, S. 62; Blažěk, 1959, S. 240; HKK, 1960, S. 30; BS, 1962, S. 329; GČZ, 1965, S. 236; Duden WGN, 1966, S. 485; NA, 1966, Kt. 10,2; Kunský, 1968, S. 184; ČSSt, 1971, S. 23; GČ, 1972, S. 84; OTS, 1975, S. 41; ZJČ, 1982, S. 232; ČSAZ, 1983, S. 309; TLCS, 1983, S. 170; GeoKr, 1984, S. 181; ZLHN, 1987, S. 399, Nr. IXA-1A; RBL, 1989, S. 340; LŠ, 1997, S. 202; Baedeker, 2000, S. 15; Stani-Fertl, 2001, S. 270; TLAZ, 2001, S. 936. Pec 1. Berg; Kreis Reichenberg (Liberecký kraj) 2. Petzberg 3. s.o. 7. Erhebung im Rollberg-Hügelland (Ralská pahorkatina), 451 m hoch, Bezirk BöhmischLeipa (Česká Lípa). 10. HKK, 1960, S. 91; ČV I, 1, 1968, S. 464; Kunský, 1968, S. 374; AR, 1981, S. 131; ČSAZ, 1983, S. 407; ZLHN, 1983, S. 400; TLAZ, 2001, S. 639. Pecný 1. Berg; Kreis Olmütz (Olomoucký kraj) 2. Backofen 3. s.o. 4. Backofenstein 7. Erhebung im Altvatergebirge (Hrubý Jeseník), 1338 m hoch, Bezirk Mährisch-Schönberg (Šumperk). 10. ČV I, 1, 1968, S. 417; Kunský, 1968, S. 280; ZLHN, 1987, S. 400. Pecný 1. Berg; Mittelböhmischer Kreis (Středočeský kraj) 3. s.o. 7. Erhebung im Beneschauer Hügelland (Benešovská pahorkatina), 546 m hoch, Bezirk Beneschau (Benešov). 10. ČV I, 1, 1968, S. 447; Kunský, 1968, S. 280; AR, 1981, S. 131; ZLHN, 1987, S. 400; TLAZ, 2001, S. 639. Pečsko 1. Historische Kulturlandschaft 7. Umgebung der mittelböhmischen Stadt Petschek (Pečký), Bezirk Nimburg (Nymburk), 4.333 Einwohner (1.1.2003), im Tafelland an der mitteleren Elbe (Středolabská tabule). Der Ort liegt im fast waldlosen Altsiedelland, das durch ertragreiche Böden ausgezeichnet ist. Belege: 1225 (Jan de Pecek), 1345 (Petzek), 1373 (Drslaus de Peczek), 1544 (w Peczkach), 1592 (dvůr ve vsi Pecžkach), 1650 (ves Peczky), 1790 (Petschka, Pecžek), 1835 (Peček, Pečka). Der Ort liegt abseits der Elbe und auch abseits der Staatsstraße von Prag nach Kolin und hat den Charakter eines Dorfes (ves!) bis ins 19. Jahrhundert bewahrt. Erst der Bau der Eisenbahn trug wesentlich zur Erschließung bei, während die Dörfer der Umgebung bis heute rein ländlich geblieben sind. Verschiedene Gewerbe, darunter zwei Zuckerfabriken, trugen dazu bei, dass sich auch eine Arbeiterschaft artikulierte. 1927 gehörte die Marktgemeinde Petschek zum politischen Bezirk und zum Gerichtsbezirk Poděbrad und hatte 3.858 tschechische und 13 deutsche Einwohner. 1939 Protektoratsverwaltung. Durch den Bau der Autobahn von Prag nach Poděbrad in den 80iger Jahren Lagevorteil. 10. Schaller XVI, 1790, S. 40; Sommer III, 1835, S. 68; Rieger 6, 1865, S. 198; RGL 2, 1883, S. 382; OSN 19, 1902, S. 310; OLTR, 1927, S. 420; MJČ III, 1951, S. 234; ZJČ, 1982, S. 232; ČSAZ, 1983, S. 360; LŠ, 1997, S. 203; SZ, 2003, S. 130. Pehemsteich, Pehemweg 2. Weitraer Steig 3. → Stežka česká 4. Böhmischer Weg 10. Friedrich, 1912, S. 83. Pekovské sedlo 8. So benannt nach dem ostböhmischen Ort Piekau (Pěkov), Bezirk Náchod. 10. GČZ, 1965, S. 105. Pelhřimovsko 1. Historische Kulturlandschaft; Hochland-Kreis (Kraj Vysočina) 7. Historisches Umland der südböhmischen Stadt Pilgram (Pelhřimov), Bezirk Pilgram (Pelhřimov), 16.537 Einwohner (1.1.2003), am westlichen Abfall der BöhmischMährischen Höhe (Českomoravská vrchovina) gelegen. Die Gegend liegt am Rande des böhmischen Altsiedellandes. Die Gegend war 1144 als eine Schenkung an das Prager Bistum gekommen und wurde auch von Prag aus kolonisiert, so daß man von der slawischen Ausbauphase sprechen kann, die dann in die deutsche Ostkolonisation überging. Ursprüngliches Zentrum der Herrschaft aber war Rothřečitz (Červená Řečice), wo ein slawischer Burgwall nachgewiesen werden konnte. Bald wurde das Verwaltungszentrum nach Pilgram verlegt. Erste Nennungen: 1389 (Pilgrimov, cum spolio Pilgrimonensi), 1293/95 (Palgrimov, Pilgrimov), 1325 (in Pilgrimis), 1349 (Pilgrons), 1352 (decan Reszicz.: Pilgrens), 1362 (Pilgram), 1375 (judicum in Pilgremss alias in Pelhrzimow), 1379 (in Pelhrzimow; distr. Reczicz, Pilgreims civ.), 1390 (Antiqua Piligrams), 1401 (pleb. in Pelhrzimow), 1545 (v Pelrzimowie náležici), 1654 (Stary Peldržimow), 1790 (Pilgram; Peldržimow Trhowy; Pelhržimow; Alt Pilgram, Stary Pelhržimow). Der Altpilgramer Markt wurde 1250 um 3 km an das Flüßchen Biela (Bíla) verlegt, wo sich die 1236 geweihte Veitskirche befand. Nach 1290 wurde die neue Stadt errichtet, eine befestigte Anlage mit rechteckigem Marktplatz, nachdem die Stadterhebung bereits 1280 erfolgt war. Damals waren die Bürger noch überwiegend Deutsche, was von den Dörfern der Umgebung nicht unbedingt behauptet werden kann. 1596 erfolgte die Erhebung zur königlichen Stadt. Trotz schwerer kriegerischer Wirren sind bedeutende Baudenkmäler erhalten geblieben. Die Grundrisse der Dörfer im Umland, das bis zur Gegenwart landwirtschaftlich orientiert geblieben ist, entsprechen der frühen Ausbauzeit (Straßen-, Platzdörfer). Die Funktion als Bezirksstadt mit Bezirksgericht und Realgymnasium sicherte Pilgram eine gewisse Zentralität. Durch die Verwaltungsreform 1949 wurde Pilgram wieder Sitz einer Bezirksverwaltung und blieb dies auch nach 1960, als der Bezirk wesentlich erweitert wurde. In dieser Zeit ging die Führung der Kommune an die tschechische Nationalbewegung über. War ursprünglich nur das Tuchmachergewerbe bedeutend, so stellten sich mit der Entfaltung des Eisenbahnwesens weitere Industrien ein. Der politische Bezirk Pilgram, bestehend aus den Gerichtsbezirken Patzau und Pilgram, umfaßte 1927 eine Fläche von 729,5 km² mit 93 Gemeinden (187 Ortschaften) und 52.300 Einwohnern, davon 99,8% Tschechen. Nunmehr weit abgelegen von der Sprachgrenze kam Pilgram 1939 zum Protektorat, nach 1945 weitere Maßnahmen zur Stärkung der Zentralität. 10. Schaller XIV, 1790, S. 73 u. S. 80; Sommer X, 1842, S. 142; Rieger 6, 1867, S. 215; RGL 2, 1883, S. 393; OSN 19, 1902, S. 424; OLTR, 1927, S. 422 u. 428; MJČ III, 1951, S. 338; Šmilauer, 1960, S. 104; Schwarz, 1961, S. 190; Schwarz, 1966, S. 225; ČV I, 1, 1968, S. 278; Kunský, 1968, S. 165; ZJČ, 1982, S. 233; ČSAZ, 1983, S. 360; RBL, 1989, S. 329; LŠ, 1997, S. 203; HHStBM, 1998, S. 445; StR, 2001, S. 580; TLAZ, 2001, S. 642. Pelhřimovský okres 1. Verwaltungseinheit 2. Bezirk Pilgram (Pelhřimov) 5. Pelhřimovsko 7. Bezirk (entspr. Landkreis) im Hochland-Kreis (Kraj Vysočina). Fläche 1.290 km², 73.600 Bewohner, 57 Einwohner/km², 120 Gemeinden. 10. StR, 2001, S. 57. Pernsteiner Bergland 3. → Pernštejnská vrchovina 8. So genannt nach dem südmährischen Ort Pernstein (Pernštejn), Bezirk Saar (Žďár nad Sázavou). Pernštejnská vrchovina 1. GME-7, Bergland; Hochland-Kreis (Kraj Vysočina) 2. Pernsteiner Bergland 3. s.o. 7. Teileinheit im Nedwieditzer Hügelland (Nedvědicka vrchovina). 8. So benannt nach dem südmährischen Ort Pernstein (Pernštejn), Bezirk Saar (Žďár nad Sázavou). 10. Hromádka, 1956, S. 283; ČV I, 1, 1968, S. 445; Kunský, 1968, S. 183; ZLHN, 1987, S. 401, Nr. IIc-4B-g. Pěnínský 1. Teich; Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 5. Dřevo Fischteich im Wittingauer Becken (Třeboňská pánev), 75 ha Fläche, beim Dorf Oberbaumgarten (Horní Pěna), Bezirk Neuhaus (Jindřichův Hradec), gespeist von der Naser (Nežarka). 10. Novotný, 1972, S. 48. 7. Perkunie 2. Erzgebirge 3. → Krušné hory 6. Fergunna (hist.); Mirquidi (hist.) 9. Alter Name, nicht nur für das Erzgebirge. 10. Duden GND, 1993, S. 93. Perucká tabule 1. GME-7, Tafelland, Kreis Aussig (Ústecký kraj) 2. Perutzer Tafelland 3. s.o. 4. Tafelland von Perutz 7. Geomorphologische Teileinheit im Tafelland an der unteren Eger (Dolnoohařská tabule). 8. So benannt nach dem nordböhmischen Ort Perutz (Peruc), Bezirk Laun (Louny). 10. GČZ, 1965, S. 176; ČV I, 1, 1968, S. 458; Kunský, 1968, S. 317; OTS, 1975, S. 41; ZLHN, 1987, S. 401, Nr. VIB-1B-e. Perutzer Tafelland 3. → Perucká tabule 4. Tafelland von Perutz 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Perutz (Peruc), Bezirk Laun (Louny). Pešava 1. Berg; Kreis Pardubitz (Pardubický kraj) 3. s.o. 7. Erhebung im Eisengebirge (Železné hory), 697 m hoch, Bezirk Chrudim. 10. ČV I, 1, 1968, S. 676; ČSAZ, 1983, S. 71; TLČS, 1983, S. 262; ZLHN, 1987, S. 401; VGJ, 1996, S. 21. Pešava-Bergland 2. Bergland von Seč 3. → Sečská vrchovina 5. Pešavská vrchovina (wörtl.) 7. So genannt nach dem Berg Pešava, 697 m hoch, Bezirk Chrudim. Pešavská vrchovina 2. Bergland von Seč 3. → Sečská vrchovina 4. Pešava-Bergland 8. So benannt nach dem Berg Pešava, 697 m hoch, Bezirk Chrudim. 10. Kunský, 1968, S. 267. Petersburger Hügelland 3. → Petrohradská pahorkatina 4. Baba-Gebirge 8. So genannt nach dem Ort Petersburg (Petrohrad), Bezirk Laun (Louny). Peterstein 3. → Petrovy kameny 10. Cotta, 1854, S. 399; Kořistka, 1881, S. 38; Partsch I, 1896, S. 60; MWB MS, 1897, S. 30; Schneider, 1908, S. 147; Werdecker, 1957, S. 43; Knebel, 1993, S. 394. Pětipeská kotlina 1. GME-7, Becken, Kreis Aussig (Ústecký kraj) 2. Wernsdorf-Fünfhundener Mulde 3. s.o. 4. 7. 8. Fünfhundener Becken Geomorphologische Teileinheit im Saazer Becken (Žatecká pánev). So benannt nach dem nordböhmischen Ort Fünfhunden (Pětipsy), Bezirk Komotau (Chomoutov). 10. ZLHN, 1987, S. 401, Nr. IIIB-3A-b. Petrohradská pahorkatina 1. GME-7, Hügelland, Kreis Aussig (Ústecký kraj) 2. Petersburger Hügelland 3. s.o. 4. Baba-Gebirge 7. Geomorphologische Untereinheit im Rakonitzer Hügelland (Rakovnická pahorkatina), Bezirk Laun (Louny). 8. So benannt nach dem westböhmischen Ort Petersburg (Petrohrad), Bezirk Laun (Louny). 10. ZLHN, 1987, S. 402, S. VB-1B-a. Petrovy kameny 1. Berg, Mährisch-Schlesischer Kreis (Moravskoslezský kraj) 2. Peterstein 3. s.o. 7. Erhebung im Glatzer Schneegebirge (Kralický Sněžník), 1448 m hoch, Bezirk Freudenthal (Bruntál). 10. HKK, 1960, S. 220; ČV I, 1, 1968, S. 728; Kunský, 1968, S. 174; ZLHN, 1987, S. 402. Petschauer Bergland 2. Petschauer Höhen 3. → Bečovská vrchovina 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Petschau (Bečov nad Teplou), Bezirk Karlsbad (Karlovy Vary). Petschauer Höhen 3. → Bečovská vrchovina 4. Petschauer Bergland 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Petschau (Bečov nad Teplou), Bezirk Karlsbad (Karlovy Vary). 10. Schneider, 1908, S. 64. Pfahl, der Pfahl 2. Böhmischer Pfahl 3. → Český křemenný val 10. Cotta, 1854, S. 426; Pierer 3, 1857, S. 26; WK, 1860, S. 86; ARCL 2, 1866, S. 903; Krejčí, 1876, S. 281; Kozenn/Jireček ŠA, 1886, Kt. 3; Sueß, 1903, S. 9; Schneider, 1908, S. 30; Beer, 1925, S. 8; Duden WGN, 1966, S. 492. Pfahlsenke 10. Machatschek, 1927, S. 28; Sedlmeyer, 1941, S. 13. Pferderücken 3. → Mokry hřbet 10. Knebel, 1993, S. 107. Pfraumberg 3. → Přimda 4. Schloßberg; Frauenberg (veraltet) 9. 1174 „Prienberg“ genannt 10. Sommer III, 1839, S. II; ARCL 2, 1866, S. 903; Kloeden, 1875, S. 83; Willkomm, 1878, S. 5; Schneider, 1908, S. 46; Machatschek, 1927, S. 102; OLTR, 1927, S. 425; LŠ, 1997, S. 217. Pfraumberg-Wald 3. → Přimdský les 4. Pfraumberg-Gebirge 5. Přimdské pohoří 8. So genannt nach dem 848 m hohen Pfraumberg (Přimda), Bezirk Tachau (Tachov). Pfraumberger Gebirgsrücken 3. → Přimdský les 4. Pfraumberg-Wald 5. Přimdské pohoří 10. Sommer VI, 1838, S. 175. Pfraumberger Riegel 8. So genannt nach dem 848 m hohen Pfraumberg (Přimda), Bezirk Tachau (Tachov). 10. Schneider, 1908, S. 46. Pfraumberger Senke 8. So genannt nach dem 848 m hohen Pfraumberg (Přimda), Bezirk Tachau (Tachov). 10. Schneider, 1908, S. 46. Philippsreuther Paß 10. ADRE 2, 1843, S. 468. Piémont des Beskides Occidentales 2. Vorland der Westbeskiden 3. → Západobeskydské podhůří 4. Westbeskiden-Vorgebirge; Westbeskidisches Gebirgsvorland 6. Western Beskyds Piedmont (engl.) 9. Französische Bezeichnung. 10. VGJ, 1996, S. 42. Piémont des Monts des Géants 2. Riesengebirgsvorland, Vorland des Riesengebirges 3. → Krkonošské podhůří 4. Vorberge des Riesengebirges; Vorgebirge des Riesengebirges 9. Französische Bezeichnung 10. VJG, 1996, S. 28. Pilgramer Gebirge 7. Kleinlandschaft im Kremeschniker Bergland (Kremešnická vrchovina). 8. So genannt nach der mittelböhmischen Stadt Pilgram (Pelhřimov). 10. Sommer X, 1842, S. VIII. Pilsen-Rakonitzer Ebenen 3. → Plzeňská kotlina 8. So genannt nach dem westböhmischen Städten Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt (Pilzeň-město), und Rakonitz (Rakovník), Bezirk Rakonitz (Rakovník). 10. Schneider, 1908, S. 10. Pilsener Becken 3. → Plzeňská kotlina 4. Pilsener Ebene; Pilsener Flachland; Talkessel von Pilsen 5. Plzeňská pánev 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Pilsen (Plzeň). 10. MWB Böhmen I, 1894, S. 4; Sueß, 1903, S. 165; Moscheles, 1921, S. 79; Hassinger, 1925, S. 58; Machatschek, 1927, S. 9; Sedlmeyer, 1941, S. 17; Spreitzer, 1941, S. 434; KB-Kt, 1943; Werdecker, 1957, S. 27; Schwarz, 1965, S. 86; ČSSt, 1971, S. 22; StaniFertl, 2001, S. 270. Pilsener Berg- und Hügelland 2. Pilsener Hügelland 3. 5. 8. → Plzeňska pahorkatina Plzeňská vrchovina a pahorkatina (wörtl.); Vrchy Plzeňské So genannt nach der westböhmischen Stadt Pilsen (Plzeň). Pilsener Ebene 2. Pilsener Becken 3. → Plzeňská kotlina 4. Pilsener Flachland 5. Plzeňská kotlina 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Pilsen (Plzeň). 10. MWB Böhmen I, 1884, S. 88. Pilsener Flachland 2. Pilsener Becken 3. → Plzeňská kotlina 4. Pilsener Ebene 5. Plzeňská pánev 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Pilsen (Plzeň). 10. Pierer 3, 1857, S. 12. Pilsener Höhen 2. Pilsener Hügelland 3. → Plzeňská pahorkatina 4. Pilsener Bergland 5. Vrchy Plzeňské (wörtl.) 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Pilsen (Plzeň). Pilsener Hügelland 3. → Plzeňská pahorkatina 4. Pilsener Ebene; Pilsener Flachland 5. Vrchý Plzeňské 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Pilsen (Plzeň). 10. OTS, 1975, S. 42. Pinifer 2. Fichtelgebirge 3. → Smrčiny 4. Viechtelberg 9. Von den Humanisten gebrauchter lat. Name für das Fichtelgebirge. 10. Hoffmann, 1993/94, S. 139. Pirkener Becken 3. → Březenská pánev 5. Březenská kotlina 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Pirken (Březenec), Bezirk Komotau (Chomoutov). Pirnitzer Bergland 3. → Brtnická vrchovina 8. So genannt nach der südmährischen Stadt Pirnitz (Brtnice), Bezirk Iglau (Jihlava). Pisarecká kotlina 1. GME-7, Becken 10. GČZ, 1965, S. 137; ZLHN, 1987, S. 404, Nr. IID-2B-h. Pisecká pahorkatina 1. GME-6, Hügelland, 1.146 km², Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 2. Piseker Hügelland 3. s.o. 5. Pisecké hory 7. Geomorphologische Untereinheit im Taborer Hügelland (Tabórská pahorkatina). 6 Teileinheiten: Bechyňská pahorkatina, Mehelnická vrchovina, Milevská pahorkatina, Ševětínská vrchovina, Týnská pahorkatina, Zvíkovská pahorkatina. 8. So benannt nach der südböhmischen Stadt Písek, Bezirk Písek. 10. ZLHN, 1987, S. 404, S. IIA-3A. Pisecké hory 2. Piseker Hügelland 3. → Pisecká pahorkatina 4. Piseker Gebirge (wörtl.) 10. ČSAZ, 1983, S. 364. Pisecko 1. Historische Kulturlandschaft, Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 7. Historisches Umland der südböhmischen Stadt Písek (Bezirk Písek), 29.823 Einwohner (1.1.2003), gelegen an der Wottawa (Otava), wo man den goldhaltigen Sand auswusch, daher der Name „na Pisku“, d.h. Auf dem Sande. Später entstand an dieser Stelle ein Marktort mit einer dem Hl. Wenzel geweihten Kirche sowie eine gotische Burg. Ältere Nennungen: 1254 (civitati nostrae Pieze), 1264 (D. apud Pyezkam), 1268 (D. in Pezka), 1316 (in Piesca), 1352 (Arena [= Sand]), 1369/85 (Pieska), 1469 (purkr. na Piesku), 1790 (Pisek). König Přemysl Otakar II. begründete hier um 1254 eine ummauerte Stadt mit einer Münzstätte. Schon in der Gründungsphase entstanden bedeutende Baudenkmäler, auch eine steinerne Brücke über die Wottawa, die älteste in Böhmen. Die Zentralität wurde weiter gesteigert durch die vorteilhafte Lage am „Goldenen Steig“ und den Salzhandel. Unter Karl IV. errang die Stadt weitere Vorteile. Nach den Wirren der Hussitenzeit und des Dreißigjährigen Krieges wurde die Stadt gewaltsam rekatholisiert; der Rang einer königlichen Stadt blieb unter den Habsburgern erhalten. Písek entwickelte sich zu einer Schul- und Kulturstadt (1778 Gymnasium von Klattau nach hier verlegt, 1858 „Wottauer Bote“). Die tschechische Nationalbewegung war vertreten mit den Vereinen „Sokol“, „Beseda“ und „Literární jednota“, dazu Bibliothek, Museum und weitere Aktivitäten. Der Prachiner Kreis (Prachenský kraj) mit Sitz in Písek bestand schon 1751 bis 1850; dieser bestand aus 79 Gütern und Herrschaften mit 291.073 Einwohnern (1807). Der Anschluß an die Eisenbahn erfolgte schon 1875, danach auch etwas Industrie. Der politische Bezirk Pisek, bestehend aus den Gerichtsbezirken Mirowitz, Písek und Wodňan, umfaßte 1927 eine Fläche von 973 km² mit 116 Gemeinden (215 Ortschaften) und 79.100 Einwohnern, davon 99,4% Tschechen. 1939 kam Písek zum Protektorat und wurde am 6. Mai 1945 von USTruppen befreit. Durch die Verwaltungsreform von 1949 wurde Písek wieder Sitz einer Bezirksverwaltung und blieb dies auch 1960, als der Bezirk wesentlich erweitert wurde. Die tschechische Umgebung ist landwirtschaftlich bestimmt, die Siedlungsstruktur kolonialzeitlich, dazu attraktive Naherholungsgebiete. Heute gibt es neben Nahrungsund Genußmittelindustrie auch Geräte- und Werkzeugmaschinenbau, Handschuhfabrikation. 10. Schaller III, 1790, S. 9; Sommer VIII, 1840, S. 6; Rieger 6, 1867, S. 385; RGL 2, 1883, S. 397; OSN 19, 1902, S. 778; OLTR, 1927, S. 430; MJČ III, 1951, S. 362; Schwarz, 1965, S. 382; ČV I, 1, 1968, S. 327; ZJČ, 1982, S. 235; ČSAZ, 1983, S. 364; RBL, 1989, S. 333; LŠ, 1997, S. 204; HHStBM, 1998, S. 452; StR, 2001, S. 57; TLAZ, 2001, S. 649. Pisecký okres 1. Verwaltungseinheit 2. Bezirk Písek 5. Písecko 7. Bezirk (entspr. Landkreis) im Südböhmischen Kreis. Fläche 1.138 km², 70.300 Bewohner, 62 Einwohner/km², 76 Gemeinden. 10. StR, 2001, S. 56. Písek 1. Berg; Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 3. s.o. 7. Erhebung im Brdywald (Brdy), 691 m hoch, Bezirk Rokitzan (Rokycany). 10. StR, 1957, S. 25; HKK, 1960, S. 162; Kunský, 1968, S. 38; AR, 1981, S. 131. Piseker Hügelland 3. → Pisecká pahorkatina 6. Pisecké hory 8. So genannt nach der südböhmischen Stadt Písek, Bezirk Písek. Piskovce Labského údoli 2. Elbedurchbruch 3. → Labský kaňon 10. Krejči, 1876, S. 287. Piskovcé pohoří 2. Elbsandsteingebirge 3. → Děčínské stěny 4. Sandsteingebirge (wörtl.) 10. Stadlerová / Travniček, 1958, S. 303. Piskovcé pohoří Děčínské 2. Elbsandsteingebirge 3. → Děčínská vrchovina 4. Teschener Sandsteingebirge (wörtl.) 5. Děčínské stěny 10. Rieger 2, 1862, S. 321. Piskovcová oblast východomoravská 2. Flyschkarpaten 3. → Piskovcová Karpaty 4. Ostmährisches Sandsteingebiet (wörtl.) 10. Koláček, 1934, S. 257. Piskovcové Karpaty 2. Sandsteinkarpaten 4. Flyschkarpaten 10. MSN 1, 1925, S. 1049. Piskové Karpaty 2. Äußere Westkarpaten 3. → Vnější Západní Karpaty 4. Flyschkarpaten; Sandsteinkarpaten (wörtl.) 5. Flyšové Karpaty 10. MSN 1, 1925, S. 1049. Pivoňské hory 1. GME-7, Bergland, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 2. Stockauer Gebirge 3. s.o. 7. Geomorphologische Teileinheit im Oberpfälzer Wald (Český les). 8. So benannt nach dem Ort Stockau (Pivoň), Bezirk Taus (Domažlice). 10. ČV I, 1, 1968, S. 452; ZLHN, 1987, S. 405, Nr. IA-1A-c. Plaine Basse de l‚Europe Centrale 2. Mitteleuropäisches Tiefland 3. → Středoevropská nížina 6. Central European Lowland (engl.); Niż Środkowoeuropejski (poln.) 7. Berührt das Territorium der Tschechischen Republik randlich 9. Französische Bezeichnung. 10. VGJ, 1996, S. 36. Plaine Basse de la Silesie 2. Schlesisches Tiefland 3. → Slezská nížina 6. Nizína Śląska (poln.); Silesian Lowland (engl.) 7. Berührt das Territorium der Tschechischen Republik randlich. 9. Französische Bezeichnung. 10. VGJ, 1996, S. 37. Plaines Basses de la Pologne Centrale 2. Mittelpolnische Tiefländer 3. → Středopolské nížiny 6. Central Polish Lowlands (engl.); Niziny Środkowopolskie (poln.); Plaines Basses de la Pologne Centrale (franz.) 9. Französische Bezeichnung. 10. VGJ, 1996, S. 37. Plaines Basses Epihercyniennes 2. Epiherzynische Tiefländer 3. → Epiherzynské nížiny 6. Epihercynian Lowlands (engl.) 9. Französische Bezeichnung. 10. VGJ, 1996, S. 36. Plaňanská tabule 2. Planauer Tafelland 3. s.o. 8. So benannt nach dem mittelböhmischen Ort Plaňan (Plaňany), Bezirk Kladno. 10. ČV I, 1, 1968, S. 700. Plancker Wald 2. Blansker Wald 3. → Blanský les 4. Plansker Wald 10. RGL 1, 1883, S. 206. Pláně Kochanovské 2. Kocheter Hochfläche 3. → Kochanovské pláně 8. So benannt nach dem Ort Kochet (Kochánov), Bezirk Klattau (Klatovy). 10. Hromádka, 1956, S. 28; GČZ, 1965, S. 49. Pláně Kvildské 2. Außergefilder Hochfläche 3. → Kvildská pláně 8. So genannt nach dem Ort Außergefild (Kvilda), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. Hromádka, 1956, S. 284; GČZ, 1965, S. 49. Pláně šumavské 2. Böhmerwald-Hochfläche 3. → Šumavské pláně 10. MSN 1, 1925, S. 1048; GČZ, 1965, S. 49. Planer Hügelland 3. → Planská pahorkatina 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Plan (Planá), Bezirk Tachau (Tachov). Plánická vrchovina 1. GME-7, Bergland; Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 2. Planitzer Bergland 3. s.o. 5. Nepomucká vrchovina (gelegentlich) 7. Geomorphologische Teileinheit im Nepomuker Bergland (Nepomucká vrchovina), gelegentlich synonym mit diesem gebraucht. 9. So benannt nach dem westböhmischen Ort Planitz (Planice), Bezirk Klattau (Klatovy). 10. Hromádka, 1956, S. 283; BS, 1962, S. 136; GČZ, 1965, S. 38; ČV I, 1, 1968, S. 447; Kunský, 1968, S. 168; ZLHN, 1968, S. 405, Nr. IIA-4B-b; OTS, 1975, S. 41. Planicko 1. Historische Kulturlandschaft; Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 7. Umgebung der südwestböhmischen Kleinstadt Plánitz (Plánice), Bezirk Klattau (Klatovy), 1.666 Einwohner (1.1.2003) im Blatnaer Hügelland (Blatenská pahorkatina). Die Gegend wurde im Zuge des slawischen Landesausbaus erschlossen und ist noch relativ stark bewaldet. Belege: 1397 (Planycz), 1418 (z Plánice, v Plánici), 1551 (v Planiczy). Bei der Gründung am Anfang des 14. Jahrhunderts waren Zisterziensermönche des Klosters Nepomuk beteiligt. Von Anbeginn wurde der Ort als „městecko“ (Städchen) bezeichnet; die Stadtrechte wurden 1397 verliehen. Die deutsche Kolonisation hat die Gegend zu keinem Zeitpunkt erreicht, schon im 14. Jahrhundert überwiegen die tschechischen Namen. Im 14. Jahrhundert schwere Verwüstungen durch die Hussiten, der Ort konnte seine zentralen Funktionen weiter bewahren. Im 16. Jahrhundert wurde in der Nähe auf Silber, Zinn und Blei geschürft. 1720 wurde hier eine der ältesten Baumwollmanufakturen Böhmens gegründet, allerdings fiel diese bald einem Brand zum Opfer. Die Umgebung war stets landwirtschaftlich bestimmt; es handelt sich um Kleinsiedlungen (Weiler, Hofgruppen) mit unregelmäßigen Grundrissen. Der Gerichtsbezirk Planitz als Teil des politischen Bezirkes Klattau umfaßte 1927 212 km² mit 38 Gemeinden (53 Ortschaften) und 16.526 fast ausschließlich tschechischen Einwohnern. Da hier und im gesamten Umland kein Bahnanschluß bestand, folgte die Erschließung erst durch Erholungssuchende, also entstand eine Sommerfrische. Moderne Industrien (Textil, Holz) kamen erst nach 1945 auf. 10. Rieger 6, 1867, S. 422; RGL 2, 1883, S. 399; OSN 19, 1902, S. 837; OLTR, 1927, S. 431; MJČ III, 1951, S. 370; Schwarz, 1965, S. 373; ZJČ, 1982, S. 235; RBL, 1989, S. 335; LŚ, 1997, S. 205; HHStBM, 1998, S. 455. Planina 1. Berg; Kreis Königgratz (Královéhradecký kraj) 2. Planur; Plattenberg 3. → Zadní planina 5. Přední Planina 7. Erhebung im Riesengebirge (Krkonoše / Karkonosze), 1196 m hoch, Bezirk Trautenau (Trutnov). 10. OLTR, 1927, S. 431; GČZ, 1965, S. 96; ČSAZ, 1983, S. 231. Planine Jičínská 2. Jitschiner Hügelland 3. → Jičínská pahorkatina 4. Jitschiner Hochebene (wörtl.) 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Jitschin (Jičín), Bezirk Jitschin (Jičín). 10. Kozenn/Jireček ŠA, 1878, Kt. 11. Planiny okolo Kvildy a Modrého 2. Außergefilder Hochfläche 3. → Kvildská pláně 4. Maderer Hochfläche 5. Modravská pláň 8. So benannt nach den Orten Außergefild (Kvildá) und Mader (Modra), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. OSN 6, 1893, S. 15. Planitzer Bergland 3. → Planická vrchovina 4. 8. Planitzer Hochland So genannt nach der westböhmischen Stadt Planitz (Planice), Bezirk Klattau (Klatovy). Planitzer Hochland 2. Planitzer Bergland 3. → Planicka vrchovina 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Planitz (Planice), Bezirk Klattau (Klatovy). 10. OTR, 1975, S. 41. Planská pahorkatina 1. GME-7; Hügelland; Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 2. Planer Hügelland 3. s.o. 7. Geomorphologische Teileinheit im Vorhügelland des Oberpfälzer Waldes (Podčeskoleská pahorkatina). 8. So benannt nach der westböhmischen Stadt Plan (Planá), Bezirk Tachau (Tachov). 10. ZLHN, 1987, S. 405, NR. I A-2A-d. Plansker Gebirge 2. Blansker Wald 3. → Blanský les 4. Krumauer Gebirge; Plansker Wald 10. Sommer IX, 1841, S. IX. Plansker Wald, Planskerwald 2. Blansker Wald 3. → Blanský les 4. Plancker Wald, Krumauer Gebirge 10. Sommer IX, 1841, S. IX; Pierer 3, 1857, S. 25; Willkomm, 1878, S. 44; RGL 1, 1883, S. 206; MWB I, 1884, S. 108; Sueß, 1903, S. 60; Schneider, 1908, S. 27; Beer, 1925, S. 76; Machatschek, 1927, S. 131; OLTR, 1927, S. 431; Werdecker, 1957, S. 23; Schwarz, 1965, S. 388; Duden WGN, 1966, S. 498; Gorys, 1994, S. 168; Baedeker, 2000, S. 117; Stani-Fertl, 2001, S. 270; SZ, 2003, S. 130. Plansko 1. Historische Kulturlandschaft; Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 7. Umland der westböhmischen Stadt Plan (Planá), Bezirk Tachau (Tachov), 5.443 Einwohner (1.1.2003), im Vorhügelland des Oberpfälzer Waldes (Podčeskoleská pahorkatina). Es handelt sich um eine Gegend, die schon von der tschechischen Binnenkolonisation erreicht worden ist. Die strategisch günstige Lage in der Tachauer Furche (Tachovská brázda) war bei der Gründung ein wichtiger Gesichtspunkt, ebenso die von Eger (Cheb) nach Süden führende Straße. Frühe Nennungen: 1219 (Plan), 1251 (Wenc. rex monio Waltsass., jus patr. in Plan confert), 1281 (pleb. in Plana), 1315 (per abtatem in Waltsachsen et par. in Plan), 1343 (de Plana), 1379 (oppidum Plana), 1410 (Henr. de Elsterberg et de Pane), 1460 (na Plane), 1527/1542 (v Plane zámku a města), 1574 (Plana, zámek a město), 1665 (Plan). Bei der Gründung, die auch der Christianisierung diente, waren auch Mönche aus Waldsassen und Tepl (Teplá) beteiligt. Zur Stadtwerdung trugen auch die in der Umgebung gewonnen Bodenschätze (Silber, Blei) bei. Neben dem Dorf wurde eine mehr städtische Siedlung mit einer regelmäßigen Straßenmarktanlage gegründet, die 1379 als „oppidum“ in den Quellen erscheint und mit dem Pilsener Stadtrecht begabt wurde. Reste der Stadtbefestigung sind bis heute erhalten. Der wirtschaftliche Aufstieg sicherte der Stadt die Vorherrschaft über eine ganze Reihe von Dörfern in der Umgebung, die sich durch Plangrundrisse (Platzdorf, Angerdorf) auszeichnen, beispielsweise Hinterkotten (Zádní Chodov). Es gab sogar eine Münze (Planer Taler). Im 19. Jahrhundert bescheidene Industrialisierung, Eisenbahnanschluss 1872. Der politische Bezirk Plan, bestehend aus den Gerichtsbezirken Weseritz und Plan, umfasste 1927 eine Fläche von 561 km² mit 87 Gemeinden (120 Ortschaften) und 19.800 Einwohnern, davon 99,3 % deutscher Nationalität. 1938 Abschluss an den Sudetengau, 1945/46 Vertreibung der Deutschen. Die Entwicklung zur Sommerfrische, die schon in der Zwischenkriegszeit eingesetzt hatte, fand zunächst ein Ende durch den Eisernen Vorhang. Heute Tagestourismus, auch aus dem benachbarten Bayern. 10. Schaller IX, 1790, S. 175; Rieger 6, 1867, S. 420; RGL 2, 1883, S. 399; OSN 12, 1902, S. 833; OLTR, 1927, S. 431; MJČ III, 1951, S. 366; Schwarz, 1961, S. 353; Schwarz, 1965, S. 124; ZJČ, 1982, S. 235; ČSAZ, 1983, S. 365; SLL, 1985, S. 346; RBL, 1989, S. 334; LŠ, 1997, S. 205; HHStBM, 1998, S. 454; TLAZ, 2001, S. 650. Plaská pahorkatina 1. GME-5, Hügelland, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj), 2180 km2 2. Plasser Hügelland 3. s.o. 7. Historische Haupteinheit im Pilsener Hügelland (Plzeňská pahorkatina): 4 Untereinheiten. Kaznauer Hügelland (Kaznejovská pahorkatina), Mieser Hügelland (Střibrská pahorkatina), das Pilsener Becken (Plzeňska kotlina) und das Kralowitzer Hügelland (Králowická pahorkatina). 8. So benannt nach der westböhmischen Stadt Plaß (Plasy), Bezirk Pilsen-Nord (Plzeňsever). 10. Hromádka, 1956, S. 286; GČZ, 1965, S. 152; GČ, 1972, S. 74; GeoKr, 1984, S. 59; ZLHN, 1987, S. 406, Nr. VB-2; VGJ, 1996, S. 34; TLAZ, 2001, S. 651. Plasser Hügelland 3. → Plaská pahorkatina 5. auch: Plasská pahorkatina 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Plaß (Plasy), Bezirk Pilsen-Nord (Plzeňsever). Plassko 1. Historische Kulturlandschaft; Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 7. Umland der westböhmischen Stadt Plaß (Plasy), Bezirk Pilsen-Nord (Plzeň-sever), 2.549 Einwohner (1.1.2003), im gleichnamigen Hügelland (Plaská pahorkatina). Die sehr frühe Besiedelung kam durch Mönche aus der Gegend von Bamberg herein, die zahlreiche Siedlungen gründeten und das Land kolonisierten. Frühe Nennungen: 1146 (predicim Plaz), 1177 (cum Maingero, abbate Plazensi), 1185 (fratribus in Plaze), 1189 (abbas de Plass), 1224 (in Plâz), 1358 (mon. in Plaz), 1425 (abbacie Plassensis), 1520 (všcho konventu klaštera plazskeho). Das Zisterzienserkloster entwickelte sich so vorteilhaft, dass ihm schließlich 70 Dörfer unterstanden. Es wurde sogar Wein angebaut. In der Hussitenzeit wurde das Kloster zerstört, die Gegend verwüstet. In der Zeit der Gegenreformation wirtschaftliche Erholung und Wiederaufbau als großartige barocke Anlage. 1826 erwarb Clemens Lothar Wenzel Fürst von Metternich das Schloss und gründete eine Eisenhütte. In der Wenzelskirche auf dem Klosterfriedhof wurde er beigesetzt. 1927 gehörte Plaß zum politischen Bezirk und zum Gerichtsbezirk Kralowitz. Plaß liegt im tschechischen Sprachgebiet und kam 1939 zum Protektorat Böhmen und Mähren. Nach der Verwaltungsreform von 1949 wurde Plaß wieder Sitz einer Bezirksverwaltung, blieb dies aber nur bis 1949. 10. Schaller I, 1785, S. 149; Sommer VI, 1838, S. 316; Rieger 6, 1867, S. 425; RGL 2, 1883, S. 400; OSN 1902, S. 847; OLTR, 1927, S. 432; MJČ III, 1951, S. 371; Schwarz, 1961, S. 294; Schwarz, 1966, S. 128; ZJČ, 1982, S. 236; ČSAZ, 1983, S. 366; RBL, 1989, S. 336; LŠ, 1997, S. 366; HHStBM, 1998, S. 455; Baedeker, 2000, S. 219; TLAZ, 20001, S. 652. Plateau der Gefilde 2. Außergefilder Hochfläche 3. → Kvildské pláň (planě) 4. die Gefilde; Gefilder Plateau; Hochfläche von Mader; Maderer Hochfläche 10. Willkomm, 1878, S. 28; Friedrich, 1911, S. 6. Plateau der Oderquellen 2. Koslauer Bergland 3. → Kozlovská vrchovina 10. Kořistka, 1861, S. 44. Plateau der Prebischtorwände 2. Prebischtorplateau 8. So genannt nach dem Prebischtor (Pravčická brana), Bezirk Tetschen (Děčín). 10. Moscheles, 1920, S. 119. Plateau des Fichtling 2. Fichtlicher Plateau 10. Kořistka, 1861, S. 38. Plateau von Brschezina 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Pirk (Březina). 10. Schneider, 1908, S. 204. Plateau von Dauba 2. Rollberg-Hügelland 3. → Ralská pahorkatina 4. Plattenlandschaft von Dauba 8. So genannt nach der nordböhmischen Stadt Dauba (Dubá), Bezirk Böhmisch-Leipa (Česká Lípa). 10. Sydow, 1868, S. 155. Plateau von Dobřiš und Knin 3. → Dobříšská pahorkatina 10. KB-Kt., 1943. Plateau von Drahan 2. Drahaner Bergland 3. → Drahanská vrchovina 4. Drahaner Hochland; Drahaner Plateau; Hanna-Hochland 5. Drahanská vysočina; Plošina Drahanská 8. So genannt nach dem südmährischen Ort Drahan (Drahany), Bezirk Proßnitz (Prostějov). 10. Kořistka, 1861, S. 61; Hassinger, 1914, S. 22; Machatschek, 1927, S. 333; Werdecker, 1957, S. 55. Plateau von Lány 2. Lanaer Hügelland 3. → Lánská pahorkatina 8. So genannt nach der mittelböhmischen Stadt Lana (Lány), Bezirk Rakonitz (Rakovník). 10. OTS, 1975, S. 31. Plateau von Mader 2. Maderer Hochfläche 3. → Kvildské pláně 4. Hochfläche von Mader 8. So genannt nach dem Ort Mader (Modra), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. Willkomm, 1878, S. 15; MWB Böhmen I, 1894, S. 98; Friedrich, 1911, S. 6; Werdecker, 1957, S. 21. Plateau von Weißwasser 2. Weißwasser-Tafel 3. → Bělská tabule 4. Tafelland von Weißwasser 8. So genannt nach der nordböhmischen Stadt Weißwasser (Bělá pod Bezdězem), Bezirk Jungbunzlau (Mladá Boleslav). 10. Blume, 1943, S. 27. Plateau von Wigstadtl und Hrabin 2. Wigstadtler Bergland 3. → Vitkovská vrchovina 8. So benannt nach den nordmährischen, früher sudetenschlesischen Orten Wigstadtl (Vítkov) und Hrabin (Hrabyň), Bezirk Troppau (Opava). 10. Kořistka, 1861, S. 45. Plateau zwischen Saaz und Theresienstadt 2. Tafelland an der unteren Eger 3. → Dolnooharská tabule 8. So genannt nach den nordböhmischen Städten Saaz (Žatec), Bezirk Laun (Louny), und Theresienstadt (Terezín), Bezirk Leitmeritz (Litoměřice). 10. Pierer 3, 1857, S. 12. Plattenberg 3. → Zadní Planina 10. Sommer III, 1835, S. 183; Schweitzer, 1846, S. 275; Schneider, 1908, S. 107; OLTR, 1927, S. 432; Bach, 1989, S. 67. Plattenberg 10. Sommer VII, 1839, S. IV; Rieger 2, 1862, S. 326; ARCL 2, 1866, S. 859; Willkomm, 1878, S. 5; Schneider, 1908, S. 46; OLTR, 1927, S. 432. Plattenberg 3. → Blatenský vrch 4. Großer Plattenberg; Plattnerberg 5. Velký Plattenberg 10. Sommer, 1847, S. III; OZA, 1924, Kt. 17; Cotta, 1954, S. 320; Rieger 2, 1862, S. 321; ARCL 2, 1866, S. 891; Kloeden, 1875, S. 95; RGL 1, 1883, S. 502; Sueß, 1903, S. 183; Schneider, 1908, S. 46. Plattenhausenberg 3. → Blatný vrch 4. Plattenhauser Berg 10. OSN 6, 1893, S. 15. Plattenhauser Berg 3. → Blatný vrch 4. Plattenhausenberg 10. Willkomm, 1878, S. 16. Plattenlandschaft von Dauba 2. Rollberg-Hügelland 3. → Ralská pahorkatina 4. Daubaer Hügelland; Daubaer Platte; Daubaer Plattenlandschaft; Daubaer Quaderplatte; Daubaer Tafelland 8. So genannt nach der nordböhmischen Stadt Dauba (Dubá), Bezirk Böhmisch-Leipa (Česká Lípa). 10. OLTR, 1927, S. 432. Plattnerberg 2. Großer Plattenberg 3. → Blatenský vrch 5. Velký Plattenberg 10. Schneider, 1908, S. 73; OLTR, 1927, S. 150. Platz-Göttersdorfer Hügelland 2. Göttersdorfer Bergland 3. → Bolebořská vrchovina 4. Platz-Göttersdorfer Stufe 5. Místsko-bolebořská pahorkatina (wörtl.); Místsko-bolebořský stupeň 8. So genannt nach den nordböhmischen Orten Platz (Místo) und Göttersdorf (Boleboř), Bezirk Komotau (Chomoutov). Platz-Göttersdorfer Stufe 2. Göttersdorfer Bergland 3. → Bolebořská vrchovina 4. Platz-Göttersdorfer Hügelland 5. Místsko-bolebořská pahorkatina; Místsko-bolebořský stupeň 8. So genannt nach den nordböhmischen Orten Platz (Místo) und Boleboř (Göttersdorf), Bezirk Komotau (Chomoutov). Platzenberger Paß 3. → Kladské sedlo 6. Przełęcz Ploszina (poln.) 8. So genannt nach dem heute polnischen Ort Platzenberg (Płosko), PL-Woj. Donośląskie. 10. SGTS 16, 1993, S. 269. Plechkamm 2. Blechkamm 3. → Plěsivec 5. Plěšín 10. Partsch I, 1896, S. 99. Plechý 1. Berg, Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 2. Oplešny; Plöckenstein 3. s.o. 4. Böhmischer Blöckenstein; Seestein 5. Oplešny; Plöckenštejn 7. Höchste Erhebung im Böhmerwald (Šumava), 1378 m hoch, Bezirk Prachatitz (Prachatice), an der Staatsgrenze zur Bundesrepublik Deutschland gelegen. 9. Frühe Nennungen: 1346 (Plechensteyn), 1604 (Plecknsstayn), im 19. Jahrhundert noch die tschechisierte Form (Plöckenštejn), der tschechische Name kommt erst im 20. Jahrhundert auf. 10. SSJ, 1920, S. 156; MSN 1, 1925, S. 1048; StR, 1957, S. 25; HKK, 1960, S. 68; SLL, 1965, S. 348; Duden WGN, 1966, S. 498; HKK, 1966, S. 68; ČV I, 1, 1968, S. 449; Kunský, 1968, S. 204; ČSSt, 1971, S. 20; AR, 1981, S. 131; ČSAZ, 1983, S. 367; ČSAZ, 1983, S. 481; TLČS, 1983, S. 29; GeoKr, 1984, S. 81; ZLHN, 1987, S. 406; Gorys, 1994, S. 11, S. 178; VGJ, 1996, S. 18; LŠ, 1997, S. 205; Baedeker, 2000, S. 79; Stallhofer, 2000, S. 39; Stani-Fertl, 2001, S. 270; TLAZ, 2001, S. 652. Pleckensteinwald 2. Plöckensteingebirge 3. → Plechská hornatina 10. Bodemüller, 1971, S. 18. Plekenštejnská skupina 2. Plöckenstein-Gebirge 3. → Plešská hornatina 4. Höckersteingebirge; Plöckenstein-Gruppe (wörtl.) 5. Plešský hřbet 10. MSN 1, 1925, S. 1048. Plekenštejnské jezero 2. Plöckensteinsee 3. → Plešné jezero 10. ČV 1, 1929, S. 107; Kunský, 1968, S. 207. Pleknštejn, Plekenštejn 2. Plöckenstein 3. → Plechý 9. Veraltete tschechische, vom deutschen Namen abgeleitete Form. 10. Lippert I, 1896, S. 179; Sueß, 1903, S. 44; SSJ, 1920, S. 156; MSN 1, 1925, S. 1048; ČV 1, 1929, S. 135; Werdecker, 1957, S. 20; Stani-Fertl, 2001, S. 270. Pleschen 3. → Plešivec 10. WK, 1860, S. 69; OSN 6, 1893, S. 17; Lippert II, 1898, S. 381. Plěšín 2. Blechkamm 3. → Plešivec 4. Plechkamm 10. OLTR, 1927, S. 433. Plěšívec 1. Berg; Kreis Karlsbad (Karlovarský kraj) 2. Blechkamm 3. s.o. 4. Plechkamm 5. Plěšín 7. Bergrücken im Riesengebirge (Krkonosze), bis 1028 m hoch, Bezirk Karlsbad (Karlovy Vary). 10. Gorys, 1994, S. 320; Kunský, 1998, S. 350. Plešivec 1. Berg; Kreis Aussig (Ústecký kraj) 2. Pleßberg 3. s.o. 7. Erhebung im Erzgebirge (Krušné hory), 510 m hoch, Bezirk Leitmeritz (Litoměřice). 10. HKK, 1960, S. 75; ČV I, 1, 1968, S. 696; Kunský, 1968, S. 326; AR, 1981, S. 131; ZLHN, 1987, S. 406. Plesná 2. Lakaberg 3. → Plechý 10. OLTR, 1927, S. 433; ČV 1, 1929, S. 135; StR, 1957, S. 25; HKK, 1960, S. 75; ČV I, 1, 1968, S. 571; Kunský, 1968, S. 170. Plešné jezero 1. See, Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 2. Plöckensteinsee 3. s.o. 4. Lakasee 5. Jezero Pleso 7. Bergsee im Böhmerwald (Šumava), 7,48 ha Fläche, 47 m tief, Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. GČZ, 1965, S. 54; Duden WGN, 1966, S. 499; ČV I, 1, 1968, S. 449; Kunský, 1968, S. 53; AR, 1981, S. 131; ČSAZ, 1983, S. 481; GeoKr, 1984, S. 84; ZLVTN, 1984, S. 218; Gorys, 1994, S. 180; Baedeker, 2000, S. 83. Plešné pohoří 2. Dreisesselgebirge 3. → Plešská hornatina 4. Blöckensteingebirge 5. Plešný hřbet; Trojmezné pohoří 8. So genannt nach dem Plöckenstein (Plechý), 1378 m hoch. 10. Hromádka, 1956, S. 284; ČV I, 1, 1968, S. 449; Kunský, 1968, S. 288. Plešný 3. → Trojmezna 10. ČV I, 1, 1968, S. 377; Kunský, 1968, S. 53. Plešný hřbet 2. Plöckenstein-Bergland 3. → Plešská hornatina 4. Plöckenstein-Rücken (wörtlich) 8. So genannt nach dem Plöckenstein (Plechý), 1378 m hoch, Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. ČV I, 1, 1968, S. 448. Pleßberg 3. → Plešivec 10. Schneider, 1908, S. 46; SSJ, 1920, S. 73; OLTR, 1927, S. 433; Werdecker, 1957, S. 24. Plešská hornatina 1. GME-7, Bergland, Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 2. Plöckensteingebirge 3. s.o. 4. Dreisesselgebirge; Dreisesselwald; Höckersteingebirge 5. Pleckenštejnská skupina 7. Geomorphologische Teileinheit im Böhmerwald (Šumava), Naturschutzgebiet, Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. ZLHN, 1987, S. 407, Nr. IB-1c-b. Plöckelstein 2. Plöckenstein 3. → Plechý 4. Böhmischer Blöckenstein; Seestein 10. WK, 1860, S. 1; Rieger 2, 1862, S. 320; Hercík ŠA, 1874, Kt. 2; Kloeden, 1875, S. 84; Krejčí, 1876, S. 281; Kozenn/Jireček ŠA, 1878, S. Kt. 11. Plöckelsteiner Grenzrücken 2. Plöckensteingebirge 3. → Plechská hornatina 4. Höckersteingebirge 10. WK, 1860, S. 71. Plöckenstein 3. → Plechý 4. Blöckenstein (veraltet); Böhmischer Blöckenstein; Seestein 5. Plöckenštejn (veraltet) 9. 1346 „Plechensteyn“; 1604 „Pleknstayn“; die heutige tschechische Form ist sehr jung. Erstmals erwähnt 1346 (Plechensteyn), 1604 (Pleckensstayn). Der tschechische Name kam erst im 20. Jahrhundert auf. 10. Sommer VIII, 1840, S. XXVI; ADRE 2, 1843, S. 467; Pierer 3, 1857, S. 26; ARCL 2, 1866, S. 891; Willkomm, 1878, S. 21; RGL 1, 1883, S. 256; Kozenn/Jireček ŠA, 1886, Kt. 3; OSN 6, 1893, S. 16; Lippert I, 1896, S. 175; Moscheles, 1921, S. 65; Hassinger, 1925, S. 54; Blau, 1927, S. 24; Machatschek, 1927, S. 237; Koláček, 1934, S. 18; Spreitzer, 1941, S. 434; Werdecker, 1957, S. 20; Schwarz, 1965, S. 388; Duden WGN, 1966, S. 499; ČSSt, 1971, S. 20; SLL, 1985, S. 77; Gorys, 1994, S. 11, S. 180; LŠ, 1997, S. 205; Baedeker, 2000, S. 79; Stani-Fertl, 2001, S. 270. Plöckensteingebirge 2. Dreisesselgebirge 3. → Plešská hornatina 4. Höckersteingebirge 8. So genannt nach dem Plöckenstein (Plechý), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. Kloeden, 1875, S. 84; Willkomm, 1878, S. 20; OSN 6, 1893, S. 15. Plöckensteiner Rücken 2. Plöckensteingebirge 3. → Plešská hornatina 4. Höckersteingebirge 10. WK, 1860, S. 14. Plöckensteiner See 2. Plöckensteinsee 3. → Plešné jezero 4. Lakasee 5. Plekenštejnské jezero 8. So genannt nach dem Plöckenstein (Plechý), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. Sommer IX, 1841, S. XXIII; KW, 1860, S. 89; Willkomm, 1878, S. 21; Hassinger, 1925, S. 55; Werdecker, 1957, S. 15; Gorys, 1994, S. 180. Plöckensteinsee 3. → Plešné jezero 4. Lakasee 5. Plekenštejnské jezero 8. So genannt nach dem Plöckenstein (Plechý), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. Kloeden, 1875, S. 84; Willkomm, 1878, S. 21; RBL, 1989, S. 337. Plöckensteinské jezero 2. Plöckensteinsee 3. → Plešné jezero 4. Lakasee 8. So benannt nach dem Plöckenstein (Plechý), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. Koláček, 1934, S. 39. Plöckenštejn 2. Plöckenstein 3. → Plechý 10. SLL, 1985, S. 348; RBL, 1989, S. 337. Ploschkowitzer Berge 7. Teillandschaft im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří). 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Ploschkowitz (Ploškovice), Bezirk Leitmeritz (Litoměřice). 9. In neueren geomorphologischen Gliederungen nicht ausgewiesen. 10. Sommer I, 1833, S. 348. Plošina Drahanská 2. Drahaner Bergland 3. → Drahanská vrchovina 4. Drahaner Hochfläche (wörtl.); Hanna-Hochland; Mittelmährisches Plateau; Plateau von Drahan. 5. Drahanská plošina; Drahanská vysočina 8. So benannt nach dem mittelmährischen Ort Drahan (Drahany), Bezirk Proßnitz (Prostějov). 10. OZA, 1924, Kt.17. Ploučnice 1. Fluß; Kreis Reichenberg (Liberecký kraj), Kreis Aussig (Ústecký kraj) 2. Polzen 3. s.o. 4. Pulsnitz 5. Plznice 7. Rechter Nebenfluß der Elbe (Labe), 106,2 km lang, Einzugsgebiet 1194 km2, entspringt am Südhang des Jeschken-Gebirges (Ještěd), Mündung bei Tetschen-Bodenbach (Děčín). 9. Erste Nennung: 1226 (Pulsnice), wieder 1411 (Pulsenicz), aber auch 1228 (Polsniza), 1375 (Plucznice), 1532 (Polssnitz), 1713 (Pulsnitz), 1828 (Poltznitz). Ähnliche Namen kommen auch anderswo vor, beispielsweise die Pulsnitz bei Bischofswerda. 10. Rieger 2, 1862, S. 329; Hercík ŠA, 1874, Kt. 2; Vavra ŠA, 1886, Kt. 13; OSN 6, 1893, S. 44; SSJ, 1920, S. 78; OLTR, 1927, S. 434; ČV 1, 1929, S. 116; Koláček, 1934, S. 78; HKK, 1960, S. 83; Schwarz, 1961, S. 259; BS, 1962, S. 8; GČZ, 1965, S. 8; Duden WGN, 1966, S. 500; ČV I, 1, 1968, S. 352; Kunský, 1968, S. 40; MEZS, 1976, S. 375; AR, 1981, S. 131; Schwarz, 1981, S. 282; ČSAZ, 1983, S. 368; TLČS, 1983, S. 173; ZJČ, 1983, S. 237; GeoKr, 1984, S. 134; ZLVTN, 1984, S. 218; SLL, 1985, S. 350; RBL, 1989, S. 341; LŠ, 1997, S. 206; Stani-Fertl, 2001, S. 270. Plumenauer Senke 3. → Plumlovská sníženina 8. So genannt nach der mittelmährischen Stadt Plumenau (Plumlov), Bezirk Proßnitz (Prostějov). Plumlovská sníženina 1. GME-7; Senke; Kreis Olmütz (Olomoucký kraj) 2. Plumenauer Senke 3. s.o. 7. Geomorphologische Teileinheit im Drahauer Bergland (Drahanská vrchovina). 8. So benannt nach der mittelmährischen Kleinstadt Plumenau (Plumlov), Bezirk Proßnitz (Prostějov). 10. ZLHN, 1987, S. 407, Nr. IID-3c-c. Plumlovsko 1. Historische Kulturlandschaft, Kreis Olmütz (Olomoucký kraj) 7. Umgebung der mittelmährischen Stadt Plumenau (Plumlov), Bezirk Proßnitz (Prostějov), 2334 Einwohner (1.1.2003), am Rande des oberen Marchbeckens (Hornomoravský úval) gelegen. Die Gegend liegt am Rande des Altsiedellandes und dürfte der ältesten Ausbauperiode zuzurechnen sein. Belege: 1347 (castrum cum suburbio Plumbnaw), 1354 (domino de Plumbnaw), 1373 (Plumnaw), 1384 (castrum Plumnaw cum civitate Plumlow), 1391 (in Plumnaw), 1405 (in Plumlow), 1550 (k zámku Plumlowu), 1590 (městečko Plumlovec), 1602 (hrad Plumlow), 1681 (Blumlau), 1751 (Plumenau), 1872 (Plumenau, Plumlov). Die Siedlung entstand unterhalb einer Burg; aus der Unterburg entwickelte sich ein Städtchen, das Zentrum einer umfangreichen Grundherrschaft wurde. Der deutsche Einfluss war gering. Bei einer wechselvollen Geschichte mit zahlreichen Brandschatzungen und Katastrophen blieb die Wirtschaft der Stadt auf das Handwerk und einige Gewerbe beschränkt, die Umgebung war stets durch die Landwirtschaft geprägt. Der Gerichtbezirk Plumenau im damaligen politischen Bezirk Proßnitz umfasste 1927 eine Fläche von 472 km² mit 32 Gemeinden (40 Ortschaften) mit 11.500 Einwohnern, davon 68,4 % tschechisch. 1939 Protektoratsverwaltung. Nach 1945 Entwicklung zur Touristik, zwei Campingplätze an Teichen. 10. Rieger 6, 1867, S. 461; RGL 2, 1883, S. 404; OLTR, 1927, S. 434; Schwarz, 1966, S. 102; Hosák/Šrámek II, 1980, S. 257; ZJČ, 1982, S. 237; ČSAZ, 1983, S. 368; RBL, 1989, S. 337; LŠ, 1997, S. 206; HHStBM, 1998, S. 458; TLAZ, 2001, S. 656. Plzeňská kotlina 1. GME-6, Becken, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj), 284 km2 2. Pilsener Becken 3. s.o. 5. Plzeňská pánev 7. Geomorphologische Untereinheit im Plasser Hügelland (Plaská pahorkatina). 3 Teileinheiten: Dobřanská kotlina, Nyřanská kotlina und Touškovská kotlina. 8. So benannt nach der westböhmischen Stadt Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt (Pilzeňměsto). 9. Abgrenzung des Pilsener Beckens bei früheren Autoren sehr unterschiedlich. 10. Hromádka, 1956, S. 286; GČZ, 1965, S. 12; ČV I, 1, 1968, S. 355; Kunský, 1968, S. 39; GČ, 1972, S. 75; OTS, 1975, S. 42; BS, 1962, S. 16; ČSSt, 1971, S. 22; ZLHN, 1987, S. 407, Nr. VB-2c; VGJ, 1996, S. 33; Stani-Fertl, 2001, S. 270. Plzeňská pahorkatina 1. GME-4, Hügelland, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj), 4.607 km2 2. Pilsener Hügelland 3. s.o. 5. Plzeňská vrchovina a pahorkatina; Vrchy Plzeňské 7. Gruppe geomorphologischer Haupteinheiten bzw. Gebiet im Beraun-System (Berounská soustava). 3 Haupteinheiten: Jechnitzer Hügelland (Jesenická pahorkatina), Plasser Hügelland (Plaská pahorkatina) und Schwihauer Bergland (Švihoská vrchovina). 8. So benannt nach der westböhmischen Stadt Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt (Pilzeňměsto). 10. Hromádka, 1956, S. 286; HKK, 1960, S. 59; GČZ, 1965, S. 70; NA, 1966, Kt. 10,2; ČV I, 1968, S. 454; Kunský, 1968, S. 308; GČ, 1972, S. 73; AR, 1981, S. 131; GeoKr, 1984, S. 59; ZLHN, 1987, S. 408, Nr. VB. Plzeňská pánev 2. Pilsener Becken 3. → Plzeňská kotlina 8. So benannt nach der westböhmischen Stadt Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt (Pilzeňměsto). 10. OSN 6, 1893, S. 24; ČV, 1930, S. 23; Koláček, 1934, S. 38; Novák, 1947, S. 36; Kuchař, 1955, S. 62; HKK, 1960, S. 59; Šmilauer, 1960, S. 102; OTS, 1975, S. 42; AR, 1981, S. 131. Plzeňská vrchovina a pahorkatina 2. Pilsener Hügelland 3. → Plzeňská pahorkatina 4. Pilsener Berg- und Hügelland 5. Vrchy Plzeňske 8. So benannt nach der westböhmischen Stadt Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt (Pilzeňměsto). 10. Novák, 1947, S. 24f. Plzeňsko 1. Historische Kulturlandschaft, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 7. Historisches Umland und Einzugsbereich der westböhmischen Stadt Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt (Pilzeň-město), 164.703 Einwohner (1.1.2003), vorgezeichnet durch den Rand des Pilsener Beckens (Plzeňská kotlina). Diese fruchtbare und reiche Gegend nahe der früheren Sprachgrenze kann zu den böhmischen Altsiedellandschaften gerechnet werden. Die spätere Stadt entstand da, wo sich die Flüsse Mies (Mze), Radbusa (Radbuza), Angel und Uslawa (Úslava) zur Beraun (Berounka) vereinigen. Hier kreuzten sich schon in vorgeschichtlicher Zeit mehrere Handelswege; einer davon ist der von Prag über Taus (Domažlice) nach Regensburg. Zum Schutze des Übergangs über die Uslawa entstand in der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts eine Burg, später erst die Stadt. Erste urkundliche Nennungen 1300 (Noua Pilzna), 1330 (in civit. Pilzeni), 1366 (Plzně Nového), 1428 (z Nowehoplzenie), 1531 (města Noweho Plzenie), im Unterschied zu Altpilsen (Starý Plzenec), das schon 976 (Pilisin) und 1390 (de Antiqua Pilzena) bezeugt ist. Die Neue Stadt entstand auf einer Fläche von 20 ha, so hatte der als „dux plzniensis et Gudyssiniensis“ bezeichnete König Václav II dem Lokator Heinrich den Befehl erteilt. Das regelmäßige Straßengitter umschließt einen eindrucksvollen Zentralmarkt, der auch heute noch den Mittelpunkt der Stadt bildet. Vier Stadttore ermöglichten den Zugang. Die ländliche Umgebung ist geprägt von größeren und kleineren Dörfern, die überwiegend in der slawischen Ausbauzeit entstanden sind. Die Stadt hatte eine bewegte Geschichte und entwickelte sich zunehmend zum Mittelpunkt Westböhmens, was auch in ihren Verwaltungsfunktionen zum Ausdruck kommt. Der Anteil deutscher Bevölkerung ging nach den Hussitenkriegen zunehmend zurück, schließlich saßen auch keine deutsche Bürger mehr in den kommunalen Gremien. Die Tradition des Bierbrauens geht bis in das Mittelalter zurück und war durch bestimmte Privilegien abgesichert. Seit 1842 besteht das Bürgerliche Brauhaus, dessen Bekanntheit mit dem Namen „Pilsener Urquell“ (Plzeńský Prazdroj) Weltgeltung erlangte. Ein Pilsener Kreis (Plzeňský kraj) bestand schon von 1751 bis 1850; dieser umfaßte 54 Herrschaften und Güter mit 237.637 Einwohnern (1847). Die eigentliche Industrialisierung, die Pilsen zur zweitgrößten Stadt Böhmens machte, setzte erst relativ spät ein. Anstöße dazu gaben die Kohleförderung in der nahen Umgebung der Stadt und der Anschluß an die Prager Westbahn (1876), der Pilsen zu einem wichtigen Bahnknotenpunkt machte. Schon einige Jahre zuvor waren die Sedletzer Eisenwerke des Grafen Waldstein gegründet worden, diese wurden 1879 durch den Ingenieur Emil Škoda übernommen, der sie zur größten Waffenschmiede der Habsburgermonarchie entwickelte. Der politische Bezirk Pilsen, bestehend aus den Gerichtsbezirken Blowitz und Pilsen, umfaßte 1927 eine Fläche von 660 km² mit 103 Gemeinden (119 Ortschaften) und 156.000 Einwohnern, davon 1.200 Tschechen. In der Protektoratszeit weiterer Ausbau der Rüstungsindustrie. Außerdem hat man hier eine Reihe von wissenschaftlichen und kulturellen Kapazitäten konzentriert, sowie den Denkmalschutz gefördert, so daß auch ein bescheidenes Maß von Fremdenverkehr (Städtetourismus) zu beobachten ist. Bei der Verwaltungsreform des Jahres 1949 wurde Pilsen Sitz eines Kreises (Plzeňský kraj) und blieb dies nach einigen weiteren Reformen bis in die Gegenwart. Ebenfalls eingerichtet wurde ein Stadtbezirk Pilsen (Plzeň-město) und ein Bezirk Pilsen-Land (Plzeň-věnkov). Heute gibt es neben dem Stadtbezirk die Bezirke Pilsen-Nord (Plseň-sever) und Pilsen-Süd (Plzeň-jih). 10. Schaller IX, 1790, S. 7; Sommer VI, 1838, S. 1; Rieger 6, 1867, S. 465; RGL 2, 1883, S. 394; OSN 19, 1902, S. 963; OLTR, 1927, S. 428; ČV 1, 1929, S. 26; Koláček, 1934, S. 90; MJČ III, 1951, S. 301; HKK, 1960, S. 42; Schwarz, 1961, S. 160; BS, 1962, S. 13; Schwarz, 1965, S. 144; ČV I, 1, 1968, S. 77; Kunský, 1968, S. 18; ZJČ, 1982, S. 237; ČSAZ, 1983, S. 369; TLČS, 1983, S. 174; GeoKr, 1984, S. 103; GeoČS, 1985, S. 96; SLL, 1985, S. 344; RBL, 1989, S. 330; Gorys, 1994, S. 217; LŠ, 1997, S. 207; HHStBM, 1998, S. 445; Baedeker, 2000, S. 216; StR, 2001, S. 58; TLAZ, 2001, S. 656. Plzeňský kraj 1. Verwaltungseinheit 2. Kreis Pilsen (Plzeň) 7. Kreis (entspr. Regierungsbezirk) in Westböhmen. Besteht aus den Bezirken Klattau (Klatovy), Pilsen-Nord (Plzeň-sever), Pilsen-Stadt (Plzeň-město), Pilsen-Süd (Plzeň-jih), Rokytzan (Rokycany), Tachau (Tachov) und Taus (Domažlice). Fläche 7.561 km2, 551.300 Bewohner. 10. StR, 2000, S. 56. Plzeňský (jih) okres 1. Verwaltungseinheit 2. Bezirk Pilsen-Süd (Plzeň-jih) 5. Plzeňsko 7. Bezirk (entspr. Landkreis) im Kreis Pilsen (Plzeňský kraj). Fläche 1.080 km2, 68.000 Bewohner, 63 Einw./km², 100 Gemeinden. 10. StR, 2001, S. 56. Plzeňský (město) okres 1. Verwaltungseinheit 2. Bezirk Pilsen-Stadt (Plzeň-město) 5. Plzeňsko 7. Selbständiger Stadtbezirk im Kreis Pilsen (Plzeňský kraj). Fläche 125 km2, 166.800 Bewohner. 10. StR, 2001, S. 56. Plzeňský (sever) okres 1. Verwaltungseinheit 2. Bezirk Pilsen-Nord (Plzeň-sever) 5. Plzeňsko 7. Bezirk (entspr. Landkreis) im Kreis Pilsen (Plzeňský kraj). Fläche 1.323 km2, 73.200 Bewohner, 55 Einwohner/km², 102 Gemeinden. 10. StR, 2001, S. 56. Poberounská soustava (subprovincie) 1. GME-3, Berg- und Hügelland, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj), Mittelböhmischer Kreis (Středočeský kraj), 8.045 km2 2. Beraun-System 3. s.o. 5. Vrchovina Berounky 7. Geomorphologisches System (Subprovinz). 2 Untersysteme (Gebiete, oblast): das Brdywald-Untersystem und das Pilsener Hügelland (Brdská podsoustava und Plzeňská pahorkatina). 8. So benannt nach dem Fluß Beraun (Berounka). 10. NA, 1966, Kt. 10,1; GČ, 1972, S. 71; OTS, 1975, S. 42; GeoKr, 1984, S. 43; ZLHN, 1987, S. 36. Poberounská subprovincie 2. Beraun-Subprovinz 6. Berounka Subprovincie (engl.); Sous-province de la Berounka (franz.) 9. Neuere Bezeichnung. 10. VGJ, 1996, S. 32. Poberounská vrchovina 2. Beraun-System 3. → Poberounská soustava (subprovincie) 4. Beraun-Bergland (wörtl.) 8. So benannt nach dem Beraun-Fluß (Berounka). 10. Kunský, 1968, S. 30. Pobeskydí 2. Vorhügelland der Beskiden 3. → Podbeskydská pahorkatina 4. Hügelvorland der Westbeskiden; Vorbeskiden 10. ČV I, 1, 1968, S. 517; Kunský, 1968, S. 112. Poběžovická kotlina 1. GME-7, Becken, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 2. Ronsperger Becken 3. s.o. 7. Geomorphologische Teileinheit im Vorland des Oberpfälzer Waldes (Podčeskoleská pahorkatina). 8. So benannt nach dem westböhmischen Städtchen Ronsperg (Poběžovice), Bezirk Taus (Domažlice). 9. Teil des historischen Chodenlandes (Chodsko). 10. ZLHN, 1987, S. 408. Poběžovicko 1. Historische Kulturlandschaft; Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 7. Umgebung des westböhmischen Städtchens Ronsperg (Poběžovice), Bezirk Taus (Domažlice), 1.732 Einwohner (1.1.2003), im Vorhügelland des Oberpfälzer Waldes (Podčeskoleská pahorkatina). Man wird annehmen dürfen, dass diese Gegend vom slawischen Landesausbaus zuerst erreicht worden ist. Belege: 1359 (Sdenconem de Pobiehonicz), 1379 (villa Pobiezowicz), 1396 (Pobyessowicz), 1398 (Pobyezewes), 1409 (in Pobiezowicz), 1459 (v Poběžovicích ... mčko ... Dobrohostvi z Ronsperga), 1470 (hejtman na Novém Ronšperce), 1488 (de Ronssperk), 1502 (Ronspergk), 1507 (her uff Ronnspergk), 1650 (vff Ronsperg), 1654 (městys Ronsperg). Die Seidlung entstand im Gebiet der Choden, die hier als Grenzwächter eingesetzt worden waren, und wurde 1424 als „Städtchen“ bezeichnet, 1502 zur Stadt erhoben. Eine Burg und die Stadtbefestigung unterstrichen die Bedeutung. Die deutsche Sprache setzte sich zunehmend durch, die deutsch-tschechische Sprachgrenze festigte sich im 17. Jahrhundert weiter östlich. Judengemeinde mit Synagoge und Judenfriedhof. Bedeutende Gewerbe entwickelten sich nicht, wurde aber bekannt als Sitz der Grafen Coudenhove-Kalergi und deren Bautätigkeit. Der Gerichtsbezirk Ronsperg im damaligen politischen Bezirk Bischofteinitz umfasste 1927 eine Fläche von 140 km² mit 24 Gemeinden (43 Ortschaften) und 12.200 Bewohnern, davon 98,5 % deutscher Nationalität. 1938 kamen Stadt und Bezirk zum Sudetengau, nach 1945 Vertreibung der deutschen Bevölkerung, heute Defizite durch die abseitige Lage. 10. Schaller XII, 1789, S. 198; Sommer VII, 1839, S. 145; Rieger 7, 1868, S. 651; RGL 2, 1883, S. 514; OSN 19, 1902, S. 180; OLTR, 1927, S. 484; MJČ III, 1951, S. 386; Schwarz, 1965, S. 143; ZJČ, 1982, S. 238; ČSAZ, 1983, S. 370; SLL, 1985, S. 375; RBL, 1989, S. 376; LŠ, 1997, S. 207; HHStBM, 1998, S. 523; TLAZ, 2001, S. 658. Počatecký vrch 1. Berg; Kreis Karlsbad (Karlovarský kraj) 2. Ursprung-Berg 3. s.o. 7. Erhebung im westlichen Erzgebirge (Krusné hory), Bezirk Falkenau (Sokolov), 821 m hoch, nahe der Staatsgrenze. 10. AR, 1981, S. 131. Počátsko 1. Historische Kulturlandschaft; Hochland-Kreis (Kraj Vysočina) 7. Umgebung der mittelböhmischen Landstadt Počatek (Počátky), Bezirk Pilgram (Pelhřimov), 2.746 Einwohner (1.1.2003), auf der Böhmisch-Mährischen Höhe (Českomoravská vrchovina) nahe der europäischen Hauptwasserscheide. Im Zuge des hochmittelalterlichen Landesausbaus wurde die Gegend planmäßig erschlossen und hier eine Siedlung angelegt. Frühe Erwähnungen: 1285/90 (apud Pochatek), 1303 (super bona, qui dicuntur Potschatek), 1405 (Poczatek), 1654 (město Pocziatky), 1927 (Počatek, Počatky). Schon Ende des 14. Jahrhunderts wurde der Ort zur Stadt erhoben und erlebte trotz seiner Abgelegenheit eine wechselvolle Geschichte. Nach mehreren Stadtbränden wurde Počatky wieder aufgebaut und barockisiert. Neben den Ackerbürgern gab es Tuchmacher und Weber, so dass sich doch ein städtisches Leben entwickeln konnte. Im Umland ausschließlich relativ kleine ländliche Siedlungen, Anwanderungsgebiet. In der Stadt entstand im 19. Jahrhundert eine Tuchfabrik. Der Gerichtsbezirk Počatek im damaligen politischen Bezirk Kamnitz an der Linde umfasste 1927 eine Fläche von 160 km² mit 25 Gemeinden (29 Ortschaften) und 14.200 fast ausschließlich tschechischen Einwohnern. Abgesehen von einigen Baudenkmälern, die den katholischen Barockpatriotismus repräsentieren, gibt es in der Umgebung lohnende Ausflugsziele. 10. Schaller XIV, 1790, S. 92; Rieger 6, 1867, S. 482; RGL 2, 1883, S. 405; OSN 19, 1902, S. 987; OLTR, 1927, S. 434; Profous III, 1951, S. 389; Schwarz, 1961, S. 150; Schwarz, 1966, S. 234; ZJČ, 1982, S. 238; ČSAZ, 1983, S: 371; RBL, 1989, S: 343; LŠ, 1997, S. 208; HHStBM, 1998, S. 459; TLAZ, 2001, S. 659. Počernická tabule 2. Putschirner Tafelland 8. So benannt nach dem westböhmischen Ort Putschirn (Počerny), Bezirk Karlsbad (Karlovy Vary). 9. In der aktuellen geomorphologischen Gliederung nicht berücksichtigt. 10. Hromádka, 1956, S. 287; GČZ, 1965, S. 165; ČV I, 1, 1968, S. 456. Podbělka 1. Berg, Kreis Olmütz (Olomoucký kraj) 3. s.o. 7. Erhebung im Glatzer Schneegebirge (Králický Sněžník), 1307 m hoch, Bezirk MährischSchönberg (Šumperk). 10. ZLHN, 1987, S. 409. Podbeskydská brázda 2. Betschwa-Graben 3. → Rožnovská brázda 4. Rosenauer Furche; Vorbeskidische Furche (wörtl.) 10. ČV I, 1, 1968, S. 399; Kunský, 1968, S. 401. Podbeskydská pahorkatina 1. GME-5, Hügelland, Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj), Kreis Zlin (Zlinský kraj) / PL-Woj. Śląskie, 1.508 km2 in der ČR 2. Hügelland vor den Beskiden; Vorhügelland der Beskiden 3. s.o. 4. Beskidenvorland 5. Podbeskydské pahorkatiny; Podbeskydy 6. Pogórzé Ślaskie (poln.) 7. Geomorphologische Haupteinheit im Beskidenvorland (Zapadobeskydské podhůrí). 7 Untereinheiten: Keltscher Hügelland (Kelčská pahorkatina), Malenik, Frankstädter Hügelland (Frenstatská pahorkatina), Freiburger Hügelland (Přiborská pahorkatina), Stramberger Hügelland (Štramborská pahorkatina), Teschener Hügelland (Těšínská pahorkatina) und Trzinetzer Furche (Třinecká brázda). 10. NA, 1966, Kt. 10,2; Kunský, 1968, S. 175; GČ, 1972, S. 87; OTS, 1975, S. 42; GeoKr, 1984, S. 205; ZLHN, 1987, S. 409, Nr. IXD-1; VGJ, 1996, S. 42. Podbeskydská sníženina 2. Betschwa-Graben 3. → Rožnovská brázda 4. Rosenauer Furche; Vorbeskidische Furche; Vorbeskidische Senke (wörtl.) 10. BS, 1962, S. 392. Podbeskydské pahorkatiny 2. Vorhügelland der Westbeskiden 3. → Podbeskydská pahorkatina 4. Hügelländer vor den Beskiden 5. Podbeskydy 10. Hromádka, 1956, S. 273; HKK, 1960, S. 56; GČZ, 1965, S. 246; ČV I, 1, 1968, S. 399. Podbeskydy 2. Vorhügelland der Beskiden 3. → Podbeskydská pahorkatina 4. Beskiden-Vorland; Hügelländer vor den Beskiden 10. BS, 1962, S. 386. Podbořanská tabule 2. Podersamer Tafel 8. So benannt nach der westböhmischen Stadt Podersam (Podbořany), Bezirk Laun (Louny). 10. ČV I, 1, 1968, S. 720. Podbořansko 1. Historische Kulturlandschaft, Kreis Aussig (Ústecký kraj) 2. Goldbachland 7. Umland der nordböhmischen Stadt Podersam (Podbořany), Bezirk Laun (Louny), 6.132 Einwohner (1.1.2003). Die Gegend liegt im böhmischen Altsiedelland und war schon früh erschlossen; zur slawischen Frühbesiedelung kam im Mittelalter die deutsche Einwanderung. Im 14. Jahrhundert gründeten die Benediktiner ein Kloster. Frühe Nennungen: 1369/99 (Podwarzan), 1400 (ecclesia s. Petri in Podberizan); 1405 (Podworzan), 1400 (in Podborizan), 1787 (Podersam, Podbořany, Podworžan). In der Umgebung wurde der Hopfenanbau gepflegt, es wurde Bier gebraut, einige Kaolingruben trugen zum Wohlstand bei. Eine deutschsprachige Schule trug nach dem Dreißigjährigen Krieg dazu bei, den deutschen Charakter der Stadt zu festigen. Der politische Bezirk Podersam, bestehend aus den Gerichtsbezirken Jechnitz und Podersam, umfaßte 1927 eine Fläche von 579 km² mit 92 Gemeinden (105 Ortschaften) mit 43.800 Einwohnern, davon 96,6% deutscher Nationalität. 1938 kam der Bezirk zum Sudetengau, nach 1945 wurde die deutsche Bevölkerung vertrieben. Durch die Verwaltungsreform von 1949 wurde Podersam wieder Sitz einer Bezirksverwaltung, blieb dies allerdings nur bis 1960. 10. Schaller VIII, 1787, S. 162; Sommer XIV, 1846, S. 265; Rieger, 1867, S. 485; RGL 2, 1883, S. 406; OSN 19, 1902, S. 917; OLTR, 1927, S. 436; MJČ III, 1951, S. 392; HKK, 1960, S. 49; Schwarz, 1961, S. 346; BS, 1962, S. 148; Schwarz, 1965, S. 178; ČV I, 1, 1968, S. 358; Kunský, 1968, S. 62; ZJČ, 1982, S. 239; ČSAZ, 1983, S. 371; GeoKr, 1984, S. 131; GeoČS, 1985, S. 160; SLL, 1985, S. 348; RBL, 1989, S. 338; LŠ, 1997, S. 208; HHStBM, 1998, S. 461. Podbrdsko 2. Brdywald-Vorland 10. Kunský, 1968, S. 227; GeoKr, 1984, S. 110. Podčeskoleská pahorkatina 1. GME-5, Hügelland, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj), 746 km2 2. Hügelland vor dem Oberpfälzer Wald 3. s.o. 4. Vorland des Oberpfälzer Waldes 5. Chodský úval; Předhoří Českcho lesa 7. Geomorphologische Haupteinheit mit Hügellandcharakter, dem Oberpfälzer Wald (Český les) östlich vorgelagert. 2 Untereinheiten: die Tachauer Furche (Tachovská brázda) und das Choden-Hügelland (Chodská pahorkatina). 10. GČ, 1972, S. 44; GeoKr, 1984, S. 104; ZLHN, 1987, S. 409, Nr. IA-2; VGJ, 1996, S. 17; Stallhofer, 2000, S. 39. Poděbradská blata 2. Podiebrader Sumpfniederung 8. So benannt nach der mittelböhmischen Stadt Bad Podiebrad (Poděbrady), Bezirk Nimburg (Nymburk). 9. Wurde nicht in die geomorphologische Nomenklatur aufgenommen. 10. ČV I, 1, 1968, S. 704. Poděbradsko 1. Historische Kulturlandschaft, Mittelböhmischer Kreis (Středočeský kraj) 7. Umland der mittelböhmischen Stadt Bad Podiebrad (Poděbrady), Bezirk Nimburg (Nymburk), 13.072 Einwohner (1.1.2003). Der Ort liegt in einer fruchtbaren Niederung im Elbebecken und zwar am linken Ufer der Elbe (Labe), wo ein alter Handelsweg eine Furt als Übergang diente. Es handelt sich um Altsiedelland, das schon in altslawischer Zeit relativ dicht besiedelt war. Ein befestigter Adelssitz, der später zum Schloß umgebaut wurde, läßt auf ein frühslawisches Zentrum schließen. Erstmals wurde Podiebrad 1199 erwähnt (de Podiebrad), dann wieder 1223 (de Podiebrad), 1405 (Podyebrad), 1790 (Podiebrad) bis 1835 (Poděbrad). Die Erhebung der Marktsiedlung zur Stadt erfolgte erst im 15. Jahrhundert durch den hier geborenen König Georg von Podiebrad (Jiří Poděbrady). Die ursprünglich bescheidene Siedlung dehnte sich im 14./15. Jahrhundert erheblich aus. In der Stadtmitte liegt ein länglich geformter Marktplatz. Eine Reihe bedeutender und zum Teil bis heute erhaltener Baudenkmäler gibt Zeugnis von der bewegten Geschichte der Stadt, die königliche Burg liegt am Rande des Marktes. Durch den Handel und die Landwirtschaft in der Umgebung konnte die Stadt ihren Reichtum mehren. Der eigentliche Aufstieg ist den um 1900 entdeckten Mineralheilquellen zu verdanken, was einen lebhaften Kurbetrieb und Neubauten im Jugendstil zur Folge hatte. Der politische Bezirk Poděbrad, bestehend aus den Gerichtsbezirken Königsstadtl, Nimburg und Poděbrad, umfaßte 1927 eine Fläche von 694 km² mit 107 Gemeinden (136 Ortschaften) und 82.600 Einwohnern, davon 99,6% Tschechen. Poděbrad hat stets seinen tschechischen Charakter bewahrt und kam 1939 zum Protektorat Böhmen und Mähren. Durch die Verwaltungsreform von 1949 wurde Podiebrad wieder Sitz einer Bezirksverwaltung, blieb dies allerdings nur bis 1960. 10. Schaller XVI, 1790, S. 32; Sommer III, 1835, S. 59, 52; Rieger 6, 1867, S. 488; RGL 2, 1883, S. 406; OSN 19, 1902, S. 1001; OLTR, 1927, S. 435; MJČ III, 1951, S. 393; Schwarz, 1965, S. 74; ČV I, 1, 1968, S. 631; ZJČ, 1982, S. 239; ČSAZ, 1983, S. 371; RBL, 1989, S. 338; LŠ, 1997, S. 208; HHStBM, 1998, S. 459; Baedeker, 2000, S. 162; StR, 2001, S. 58; TLAZ, 2001, S. 659. Podersamer Tafel 3. → Podbořanská tabule 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Podersam (Podbořany), Bezirk Laun (Louny). Podesedek rybník 1. Teich; Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 7. Fischteich im Wittingauer Becken (Třeboňská pánev), 107 ha Fläche, bei Luttau (Lutova), Bezirk Neuhaus (Jindřichův Hradec), gespeist von der Luschnitz (Lainsitz). 10. Kunský, 1968, S. 307; Novotný, 1972, S. 47. Podhorn, Podhorner Berg 3. → Podhorní vrch 10. Sommer VI, 1838, S. 248; Schneider, 1908, S. 66; OLTR, 1927, S. 436; Werdecker, 1957, S. 28. Podhorní vrch 1. Berg; Kreis Karlsbad (Karlovarský kraj) 2. Podhorn 3. s.o. 4. Podhorner Berg 7. Erhebung auf dem Tepler Hochland (Tepelská vrchovina), 847 m hoch, Bezirk Eger (Cheb). 10. SSJ, 1920, S. 177; ČV I, 1, 1968, S. 459; Kunský, 1968, S. 325; ZLHN, 1987, S. 409. Podhostýnská pahorkatina 2. Keltscher Hügelland 3. → Kelčská pahorkatina 4. Hügelland vor dem Hostein 8. So benannt nach dem 735 m hohen Berg Hostein (Hostýn), Bezirk Kremsier (Kroměříž). 10. Hromádka, 1956, S. 273; ČV I, 1, 1968, S. 474; Kunský, 1968, S. 392. Podhůří Krkonoš 2. Riesengebirgs-Vorland 3. → Krkonošské podhůří 4. Vorbergzone des Riesengebirges 5. Jižné podhoří; Krkonošské podhoří; Podkrkonoší 10. GČ, 1972, S. 64. Podhůří Moravskoslezských Beskid 2. Vorland der Westbeskiden 3. → Západobeskidské podhůří 4. Vorland der Mährisch-Schlesischen Beskiden (wörtl.); Westbeskidisches Gebirgsvorland 5. Postbeskydy 10. Kuchař, 1955, S. 62; Hromádka, 1956, S. 273. Podhůří Novohradské 2. Gratzener Gebirgsvorland 3. → Novohoradské podhůří 5. Novohradská vrchovina; Podhůří Novohradských hor; Novohradské pohoří; Novohradská pahorkatina 8. So benannt nach der südböhmischen Stadt Gratzen (Nové Hrady), Bezirk Budweis (České Budějovice). 10. GČZ, 1965, S. 48. Podhůří Novohradských hor 2. Gratzener Gebirgsvorland 3. → Novohradské podhůří 4. Vorland des Gratzener Berglandes (wörtl.) 5. Podhůří Novohradské 8. So benannt nach der südböhmischen Stadt Gratzen (Nové Hrady), Bezirk Budweis (České Budějovice). 10. NRB nach GČ, 1972, S. 47. Podhůrí Orlických hor 2. Adlergebirgs-Vorland 3. → Podorlická pahorkatina 4. Vorhügelland des Adlergebirges 5. Orlické podhoří; Orlické podhůří; Podorlicí 6. Pogórze Orlickie 10. Novák, 1947, S. 24. Podhůří šumavské 2. Böhmerwald-Vorland 3. → Šumavské podhůří 4. Vorland des Böhmerwaldes; Vorgebirge des Böhmerwaldes 5. Podhůří Šumavy; Pošumaví; Šumavská předhoří 10. GČZ, 1965, S. 37. Podhůří Šumavy 2. Böhmerwald-Vorland 3. → Šumavské podhůří 4. Vorberge des Böhmerwaldes; Vorgebirge des Böhmerwaldes 10. NRB nach GČ, 1972. Podiebrader Sumpfniederung 3. → Poděbradská blata 8. So genannt nach der mittelböhmischen Stadt Bad Podiebrad (Poděbrady), Bezirk Nimburg (Nymburk). Podivínsko 1. Historische Kulturlandschaft; Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj) 7. Umgebung der südmährischen Landstadt Kostel (Podivín), Bezirk Lundenburg (Břeclav), 2.845 Einwohner (1.1.2003), im unteren Marchbecken (Dolnpmoravská úval) am nördlichen Ufer der Thaya (Dyje), wo das Gaya-Hügelland (Kyjovská pahorkatina) ansteigt. Belege: 1067 (castrum situm in media aqua zuartka nomine Podiuin), 1099 (castrum Podiuin, Podywin, Podywym, Podwin), 1121 (Podwin, Podiwin, Podinin castrum), 1144 (de castello Podewin), 1174 (castellanus de Podiwin), 1222 (ecclesie de Podiwin), 1248 (de Koztel), 1297 (judex de Koztell), 1297 (scabini de Costel), 1353 (in Gostel), 1422 (Costel/Podivín), 1522 (v městečku jeho Podiwinjne), 1522 (na hrad a město Podiwin), 1604 (na městu Podiwinu), 1718 (Kostel), 1846 (Kostl, Podiwin). Wie ein roter Faden zieht sich die Burg durch die Erwähnungen. Die deutsche Bezeichnung „Kostel“ taucht erst nach der Stadtwerdung auf. 1533 bildete sich eine Gemeinde der Böhmischen Brüder, 1538 ein Stützpunkt der Wiedertäufer. Außerdem gab es eine starke Judengemeinde. Mehrere Rückschläge durch Stadtbrände. Das wirtschaftliche Leben war vorwiegend von der Landwirtschaft bestimmt; Zuckerfabrik, Nahrungsmittelverarbeitung, Holzindustrie. Die Stadtgemeinde Podivin gehörte 1927 zum politischen Bezirk Göding und hatte zusammen mit der Israeliten-Gemeinde Kostel (Podivin obec Židovská) 2.809 Einwohner, überwiegend tschechisch; die Judengemeinde davon 407 Angehörige, 222 deutscher und 177 tschechischer Nationalität. 1939 Protektoratsverwaltung. 10. RGL 1, 1883, S. 835; OLTR, 1927, S. 437; Schwarz, 1961, S. 80; Schwarz, 1966, S. 175; Hosák/Šrámek II, 1980, S. 262; ČSAZ, 1983, S. 372; HHStBM, 1998, S. 292. Podkarpacie Półocne 2. Nördliche Außenkarpten-Repressionen 3. → Severní Vnějkarpatske sníženiny 4. Nördliche Außenkarpatische Senken 6. Depressions Carpathiques Exterieurs Septentrionaux (franz.); Northern Outer Carpathian Depressions (engl.) 10. Kondracki, 1988, S. 243; NGRP, 1991, S. 737. Podkarpacie Północne 2. Nördliche Außenkarpatische Senken 3. → Severní Vněkarpatské sníženiny 9. Polnische Nomenklatur. 10. Kondracki, 1988, S. 243; NGRP, 1991, S. 737. Podkrkonoší 2. Riesengebirgs-Vorland 3. → Krkonošské podhůří 4. Vorbergzone des Riesengebirges; Vorgebirge des Riesengebirges 5. Jižné podhoří; Krkonošské podhoří; Podhůří Krkonoš 6. Giant Mountains Piedmont (engl.); Piémont des Monts des Géants (franz.) 10. ČV 1, 1929, S. 24; Koláček, 1934, S. 243; Novák, 1947, S. 24; HKK, 1960, S. 34; ČV II, 1, 1963, S. 563; ČV I, 1, 1968, S. 340; Kunský, 1968, S. 18. Podkrkonošská pahorkatina 1. GME-6; Hügelland; Kreis Reichenberg (Liberecký kraj), Kreis Königgratz (Královéhradecký kraj) 2. Hügelland vor dem Riesengebirge, 753 km2 3. s.o. 4. Vorbergzone des Riesengebirges; Vorgebirge des Riesengebirges 7. Geomorphologische Untereinheit im Riesengebirgs-Vorland (Krkonošské podhůří), Westsudeten (Zapadní Sudety). 8 Teileinheiten: Lomnická vrchovina, Staropacká vrchovina, Novopacká vrchovina, Hostinská pahorkatina, Trutnovská pahorkatina, Mladobucká vrchovina, Vlčická kotlina, Rtyňská brázda 10. Hromádka, 1956, S. 291; GČZ, 1965, S. 87; GČ, 1972, S. 64; OTS, 1975, S. 42; ZLHN, 1987, S. 410, Nr. IVA-8B; TLAZ, 2001, S. 421. Podkrušnohoří 2. Südabfall des Erzgebirges 3. → Podkrušnohorská oblast 4. Egergraben; Land vor dem Erzgebirge (wörtl.); Südliches Erzgebirgsvorland 10. Koláček, 1934, S. 74; ČV I, 1, 1968, S. 631; Kunský, 1968, S. 39; GeoKr, 1984, S. 21. Podkrušnohorská kotlina 2. Erzgebirgische Becken 3. → Podkrušnohorská oblast podsoustava 4. Südliches Erzgebirgsvorland; Südabfall des Erzgebirges 10. ČV I, 1, 1968, S. 459. Podkrušnohorská oblast 2. Vorerzgebirge-Region 3. auch: → Podkrušnohorská podsoustava 4. 6. 9. 10. Gebiet vor dem Erzgebirge; Südabfall des Erzgebirges Ore Mountains Piedmont Region (engl.), Région du Piémont des Monts Metallifères Neue Nomenklatur VGJ, 1996, S. 24. Podkrušnohorská pánev 2. Egergraben 3. → Podkrušnohorská podsoustava 4. Südliches Erzgebirgsvorland; Südabfall des Erzgebirges 5. Podkrušnohorské pánve 10. ČV I, 1, 1968, S. 635; Förster, 1978, S. 47; Král, 1999, S. 105. Podkrušnohorská podsoustava (oblast) 1. GME 4, Bergländer und Becken, Kreis Karlsbad (Karlovarský kraj), 1688 km2 2. Südliches Erzgebirgsvorland 3. s.o. 4. Gebiet vor dem Erzgebirge; Südabfall des Erzgebirges 7. Es handelt sich im Rahmen des Erzgebirgischen Systems um ein Untersystem von Becken und vulkanischen Mittelgebirgen. 5 Haupteinheiten: Egerer Becken (Chebská pánev), Falkenauer Becken (Sokolovská pánev), Brüxer Becken (Mostecká panev), Duppauer Gebirge (Doupovské hory) und Böhmisches Mittelgebirge (České středohoří). 10. ZLHN, 1987, S. 35, Nr. IIIB. Podkrušnohorské kotliny 2. Erzgebirgsbecken 3. → Podkrušnohorské pánve 4. Becken vor dem Erzgebirge; Egergraben, Erzgebirgische Senke; Erzgebirgsvorlandbecken 10. Kunský, 1968, S. 336. Podkrušnohorské pánve 2. Erzgebirgsbecken 3. → Podkrušnohorská oblast podsoustava 4. Becken vor dem Erzgebirge; Egergraben; Südliche Erzgebirgsvorlandbecken; Südabfall des Erzgebirges; Böhmische Landsenke 5. Podkrušnohorské kotliny 6. Ore Mountain Basins (engl.) 7. Man verstand darunter das Egerer Becken (Chebská pánev), das Falkenauer Becken (Sokolovská pánev) und das Brüxer Becken (Mostecká kotlina). Jetzt mit den vulkanischen Bergländern (Podkrušnohorské vulkanické hornatiny) zu einem neuen „oblast“ zusammengelegt. 9. Der Begriff (GME-4) war Teil des älteren Gliederungssystems und wurde durch den obigen ersetzt. 10. GČ, 1972, S. 59; Förster, 1978, S. 47. Podkrušnohorské vulkanické hornatiny 2. Südliches Erzgebirgsvorland 3. → Podkrušnohorská oblast podsoustava 4. Erzgebirgsvorland-Vorhügelländer 7. Man verstand darunter das Duppauer Gebirge (Doupovské hory) und das Böhmische Mittelgebirge (České středohoří). Jetzt mit den Beckenlandschaften vor dem Erzgebirge (Podkrušnohorské pánve) zu einem neuen „oblast“ zusammengelegt. 10. GČ, 1972, S. 60; Förster, 1978, S. 49. Podlysohorská pahorkatina 2. Teschener Hügelland 3. → Těšínská pahorkatina 4. Hügelland vor der Lysa Hora 10. Hromádka, 1956, S. 273; ČV I, 1, 1968, S. 374; Kunský, 1968, S. 392. Podlysohorská pahorkatina 2. Teschener Hügelland 3. → Těšínská pahorkatina 4. Vorhügelland der Lysa Hora (wörtl.) 10. Hromádka, 1956, S. 273; ČV I, 1, 1968, S. 374; Kunský, 1968, S. 392. Podoler Hochfläche 3. → Podolská plošina 8. So genannt nach dem westböhmischen Ort Podol (Podolí), Bezirk Klattau (Klatovy). Podolská plošina 2. Podoler Hochfläche 8. So benannt nach dem westböhmischen Ort Podol (Podolí), Bezirk Klattau (Klatovy). 10. Hromádka, 1956, S. 283. Podorlicí 2. Adlergebirgs-Vorland 3. → Podorlická pahorkatina 4. Vorhügelland des Adlergebirges 5. Orlické podhoří; Orlické podhůří 10. ČV I, 1, 1968, S. 340. Podorlická pahorkatina 1. GME-5, Hügelland, Kreis Königgratz (Královéhradecký kraj), Kreis Pardubitz (Pardubický kraj), 1115 km2 in der ČR 2. Adlergebirgs-Vorland; Vorland des Adlergebirges 3. s.o. 4. Böhmisch-Mährisches Zwischengebirge; Voradlergebirge 5. Ceskomoranské mezihoří; Orlické podhůrí; Orlické pohoří; Podhůrí Orlikých hor; Podorlicí 6. Pogórze Orlickie (poln.) 7. Geomorphologische Haupteinheit in den Mittelsudeten (Střední Sudety / Sudety Środkowe). 3 Untereinheiten: Mährischtrübauer Hügelland (Moravskotřebovská pahorkatina), Nachoder Bergland (Náchodská vrchovina), Senftenberger Hügelland (Žamborská pahorkatina). Fortsetzung in Polen. 10. GČ, 1972, S. 66; GeoKr, 1984, S. 155; ZLHN, 1987, S. 410, Nr. IVB-3; Potocki, 1994, S. 191; VGJ, 1996, S. 29. Podradhošťská pahorkatina 2. Neutitscheiner Hügelland 3. → Novojčínská pahorkatina 4. Hügelland unter dem Radhoscht 8. So benannt nach dem Berg Radhoscht oder Radegast (Radhošť), Bezirk Neutitschein (Nový Jičín). 10. Hromádka, 1956, S. 283; ČV I, 1, 1968, S. 474. Podřípsko 2. Georgsberg-Tafelland 3. → Řípská tabule 4. Land unter dem St. Georgsberg (wörtl.); Říp-Tafelland; Tafelland am Říp 8. So benannt nach dem St. Georgsberg (Říp), Bezirk Leitmeritz (Litoměřice). 10. HKK, 1960, S. 186; BS, 1962, S. 85; ČV I, 1, 1968, S. 359; Kunský, 1968, S. 323; NRB nach GČ, 1972, S. 78. Podsoustava Šumavy 2. Böhmerwald-Bergland 3. → Šumavská hornatina 4. Untersystem des Böhmerwaldes 10. GČZ, 1965, S. 47; NA, 1966, Kt. 10,2. Podsudeti 2. Vorland der Sudeten; Sudetenvorland 3. Krkonošsko-jesenické podhůří 4. Vorsudeten 6. Przedgórze Sudeckie 10. Koláček, 1934, S. 103; Kunský, 1968, S. 315. Pogórze Izerskie 2. Vorland des Isergebirges 3. → Frýdlantská pahorkatina 4. Friedländer Hügelland (in der ČR) 9. Bezeichnet das in Polen anschließende Gebiet. 10. Walczak, 1968, S. 9; Kondracki, 1988, S. 38; NGRP, 1991, S. 696; Potocki, 1994, S. 190; VGJ, 1996, S. 27. Pogórze Orlickie 2. Adlergebirgs-Vorland 3. → Podorlická pahorkatina 4. Vorhügelland des Adlergebirges 10. Kondracki, 1988, S. 255; NGRP, 1991, S. 371. Pogórze Śląskie 2. Schlesisches Gebirgsvorland; Vorhügelland der Beskiden 3. → Podbeskydská pahorkatina; → Těšínská pahorkatina 4. Beskidenvorland; Hügelland vor den Beskiden; Schlesisches Gebirgsvorland (wörtl.) 7. Es handelt sich um die Fortsetzung auf polnischem Territorium. 9. Polnische Bezeichnung. 10. Kondracki, 1988, S. 407; NGRP, 1991, S. 761; VGJ, 1996, S. 42. Pogórze Zachodniobeskidzkie 2. Vorland der Westbeskiden 3. → Západobeskydské podhůří 4. Vorland der Mährisch-Schlesischen Beskiden; Westbeskidisches Gebirgsvorland 5. Podbeskydské pahorkatina 6. Piémond des Beskides Occidentales (franz.); Western Beskyds Piedmont (engl.) 10. Kondracki, 1988, S. 383; NGRP, 1991, S. 776. Pohledecká hornatina 3. → Pohledeckoskalská vrchovina 8. So benannt nach dem mährischen Ort Pohledetz (Pohledec), Bezirk Saar (Žďár nad Sázavou). 10. ČV I, 1, 1968, S. 444; Kunský, 1968, S. 267. Pohledecká skála 1. Berg; Hochland-Kreis (Kraj Vysočina) 3. s.o. 7. Erhebung auf dem Bergland an der oberen Swratka (Hornosvratecká vrchovina), 812 m hoch. 8. So benannt nach dem mährischen Ort Pohledetz (Pohledec), Bezirk Saar (Žďár nad Sázavou). 10. GČZ, 1965, S. 30; ČV I, 1, 1968, S. 445; Kunský, 1968, S. 267; AR, 1981, S. 132; ZLHN, 1987, S. 411. Pohledeckoskalská vrchovina 1. GME-7, Bergland; Hochland-Kreis (Kraj Vysočina) 3. s.o. 7. Geomorphologische Teileinheit im Bergland an der oberen Swratka (Hornosvratecká vrchovina). 8. So benannt nach dem 812 m hohen Berg Pohledecká skála, Bezirk Saar (Žďár nad Sázavou). 10. ZLHN, 1987, S. 411, Nr. IIC-4A-b. Pohledecká hornatina 3. → Pohledecká skála 8. So benannt nach dem mährischen Ort Pohledetz (Pohledec), Bezirk Saar (Žďár nad Sázavou). 10. Kunský, 1968, S. 267. Pohořelicko 1. Historische Kulturlandschaft; Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj) 7. Umland der südmährischen Stadt Pohrlitz (Pohořelice), Bezirk Lundenburg (Břeclav), 4.333 Einwohner (1.1.2003), in der Thaya-Schwarza-Senke (Dyskosvratecký úval) am rechten Ufer der Iglawa (Jihlava) gelegen. Klimagunst und gute Böden trugen dazu bei, dass die Gegend früh besiedelt worden ist. Frühe Nennungen: 1222 (Bohorlicz, Borlitz), 1240 (Pohoreliz), 1244 (in Poorlicz), 1278 (Pohorlicze), 1349 (prope Poherlicz), 1371 (Pohrlicz), 1372 (prope civitatem Pohrlicz), 1378 (civitas in Pohorlicz), 1414 (Poherlitz), 1442 (in Poherlicz), 1445 (Boherlitz), 1514 (městečko Pohorzelicze), 1588 (bliž města Pohorželicz), 1673 (Pohrlitz), 1846 (Pohrlitz, Pohořelice). Im 13. Jahrhundert schon als „Stadt“ genannt, 1885 wurden die Stadtrechte erneuert. Die landwirtschaftliche Umgebung (Zuckerrübenanbau, Weinbau, Fischteiche) bestimmt das wirtschaftliche Profil des Landstädtchens, das nur wenig industrialisiert ist. Der Gerichtsbezirk Pohrlitz im damaligen politischen Bezirk Nikolsburg umfasste 1927 eine Fläche von 190 km² mit 19 Gemeinden und 16.000 Einwohnern, davon 95,4 % deutscher Nationalität. 1938 wurden Stadt und Umland dem Reichsgau Niederdonau angeschlossen. Im Mai 1945 endete hier der sog. Brünner Todesmarsch, eine dramatische Ausweisungsaktion der Brünner Deutschen. 10. RGL 2, 1883, S. 410; OLTR, 1927, S. 440; Schwarz, 1961, S. 332; Schwarz, 1966, S. 165; Hosák/ Šrámek II, 1980, S. 269; ZJČ, 1982, S. 240; ČSAZ, 1983, S. 374; SLL, 1985, S. 349; LŠ, 1987, S. 259; HHStBM, 1998, S. 462; TLAZ, 2001, S. 604. Pohoří Abersbašské 2. Adersbacher Gebirge 3. → Adršpašské skály 4. Adersbacher Felsen, Adersbacher Felsenlabyrinth, Adersbacher Sandsteingebirge, Adersbacher Sandsteinklippen, Adersbacher Wände. 5. Adršpašské stěny 10. Kozenn / Jireček ŠA, 1886, Kt. 3. Pohoří Brdské 2. Brdywald-Bergland 3. → Brdská vrchovina 4. Brdy-Gebirge (wörtl.); Brdywald-Hochland 10. Rieger 2, 1862, S. 323. Pohoří česko-moravské 2. Böhmisch-Mährische Höhe 3. → Českomoravská vrchovina 4. Böhmisch-Mährisches Bergland; Böhmisch-Mährisches Gebirge (wörtl.) 5. Českomoravská vsyočina 10. Kozenn / JirečekŠA, 1888, Kt. 17. Pohoří Heidlovo nebo Broumovské 2. Heidelgebirge 3. → Javoří hory 4. Braunauer Grenzgebirge; Braunauer Porphyrgebirge; Steine-Gebirge; Südliches Waldenburger Bergland 6. Góry Suche (poln.) 10. OSN 6, 1893, S. 23. Pohoří Lužické 2. Lausitzer Gebirge 3. → Lužické hory 5. Lužické pohoří 10. Kozenn / Jireček ŠA, 1878, Kt. 11. Pohoří Oderské 2. Odergebirge 3. → Oderská vrchovina 4. Oderbergland 5. Oderské vrchy 8. So benannt nach der Oder (Odra), die hier entspringt. 10. OSN 17, 1901, S. 609. Pohoří Orlickie 2. Adlergebirge 3. → Orlické hory 6. Góry Orlickie (poln.) 10. Kozenn / Jireček ŠA, 1886, Kt. 3. Pohoří Rehornské 2. Rehorngebirge 3. → Rychory 4. Rehorn 5. Pohoří Rýchorní 8. So benannt nach dem 1.033 m hohen Rehornberg (Rychory), Bezirk Trautenau (Trutnov). 10. OSN 6, 1893, S. 22. Pohoří Reichensteinské 2. Reichensteiner Gebirge 3. → Rychlebské pohoří 5. Góry Złote 8. So benannt nach der schlesischen Bergstadt Reichenstein (Góry Złote, tschech. Exonym Rychleby). 10. Rieger 8, 1897, S. 535. Pohoří Rychorné 2. Rehorngebirge 3. → Rýchory 4. Rehorn 8. So benannt nach dem 1.033 m hohen Rehornberg (Rychory), Bezirk Trautenau (Trutnov). 10. OSN 6, 1893, S. 22. Pohoří Třemošenké 2. Třemošna-Gebirge 3. → Třemošenská vrchovina 4. Böhmisches Schiefergebirge 8. So benannt nach dem 779 m hohen Berg Velká Třemošna, Bezirk Přibram. 10. Krejčí, 1876, S. 423. Pohořska hornatina 1. GME-6, Bergland, Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 2. Bucherser Bergland 3. s.o. 7. Untereinheit im Gratzener Bergland (Novohradské hory). 3 Teileinheiten: Leopoldská vrchovina, Žofinská hornatina und Pohořská kotlina 8. So benannt nach dem Ort Buchers (Pohoří na Šumavě), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. ZLHN, 1987, S. 411, Nr. IB-3A. Pohraníčí 2. Grenzgebiet 3. → pohraníční území 9. Das „an der Grenze gelegene Gebiet“. 10. Urban, 1964, S. 2. Pohraniční hřeben 2. Kolbenkamm 3. → Pomezní hřeben 4. Grenzkamm (wörtl.) 6. Grzbiet Lasocki (poln.) 10. Bach, 1989, S. 69. Pohraniční území 1. Gebietskategorie 2. Grenzgebiet 5. Pohraničí 7. Es handelt sich um die grenznahen Gebiete entlang der deutschen und österreichischen Grenze, also um die ehemals sudetendeutschen Gebiete. Im Dekret Nr. 121 des Präsidenten der Republik Dr. Beneš vom 25. Oktober 1945 sind sie definiert und zwar als das „Gebiet, das 1938 von einer fremden Macht besetzt wurde“, d.h. auch Gebiete an der polnischen und ungarischen Grenze. Durch eine Bekanntmachung vom 6. Juni 1946 wurde der Gebietszuschnitt dahingehend abgeändert und präzisiert, dass jeweils ganze Bezirke dazu gehörten oder nicht dazu gehörten, beispielsweise überwiegend tschechische Gemeinden, wenn sie in einem überwiegend deutsch gewesenen Bezirk gelegen waren. Bei den insgesamt über 2,8 Mio. Bürgern deutscher Nationalität, die in den Sudetenländern gelebt hatten, waren die sudetendeutschen Landstriche im besten Sinne Übergangsgebiete. „Die sudetendeutsche Bevölkerung sprach nicht etwa einen eigenen sudetendeutschen Dialekt, sondern die Mundarten der anrainenden Bayern, Oberfranken, Obersachsen, Schlesier und Niederösterreicher. Die Vertreibung (odsun), die über 2,6 Mio. überwiegend Deutschstämmiger betraf, erreichte Mitte 1946 ihren Höhepunkt. Es gab zahlreiche Verluste durch rohe Gewalt, Seuchen, Kälte, Hunger, Entkräftung und Suizide. Aus Innerböhmen, Innermähren und selbst aus Wolhynien strömten Tschechen, Slowaken, Roma und weitere Gruppen herein, beispielsweise auch Griechen, die durch den Bürgerkrieg heimatlos geworden waren. Bei den restlichen Deutschen, die zurückgeblieben waren, handelte es sich um Facharbeiter, Antifaschisten mit politischen Verdiensten, Personen, die in Mischehen lebten oder Zweisprachige, die sich vom Deutschtum abgewendet hatten. Der Übergangscharakter ging nicht nur verloren durch den Abschub der Deutschen, sondern auch durch die Absperrung der Staatsgrenze, die schließlich Teil des Eisernen Vorhangs werden sollte. Die Ankömmlinge bemächtigten sich der Häuser, Grundstücke, Wohnungen, Werkstätten und Produktionsanlagen und nahmen an sich, was nicht niet- und nagelfest war. Man nannte sie die „zlatokopci“ (Goldgräber), weil sie nach raschem Gewinn weiterzogen und keinen Beitrag zum Wiederaufbau leisteten. In den Städten wurde der alte Bevölkerungsstand nach einiger Zeit erreicht und sogar überschritten, in den ländlichen Gebieten, die zunehmend dem Verfall ausgesetzt waren, leben zum Teil heute noch weniger Menschen als vor dem Zweiten Weltkrieg. Da ein raumordnerisches Konzept fehlte und viele Menschen nicht bereit oder nicht in der Lage waren, eine bürgerliche Existenz aufzubauen, nahm die Verwahrlosung beängstigende Züge an. Es entstand eine amorphe Gesellschaft, die nicht in der Lage war, Belastungen zu ertragen, Perspektiven zu entwickeln, das Leben durch Bildung und Kultur zu verschönern. Nach der politischen Wende 1990/91 wirkte sich dies verhängnisvoll aus. Gewaltkriminalität, Prostitution, Menschenhandel, Korruption und illegale Wirtschaftspraktiken erzeugen ein negatives Bild; dennoch gibt es einige Gegenden, wo Fremdenverkehr, Kulturbetrieb und Ferienhäuser daran erinnern, dass das Sudetenland früher eine gepflegte und blühende Kulturlandschaft war. 10. Urban, 1964, S. 2; Sperling, 1981, S. 114. Pojizeří 1. Flußgebiet; Kreis Reichenberg (Liberecký kraj), Mittelböhmischer Kreis (Středočeský kraj) 2. Isergebiet 7. Einzugsgebiet der Iser (Jizera), eines rechten Nebenflusses der Elbe (Labe). Bei einer Länge von 170 km hat die Iser einen Einzugsbereich von 2.193 km2 in Nord- und Mittelböhmen. Der bedeutendste Nebenfluß ist die von rechts zufließende Mohelnice. 10. ČV 1, 1929, S. 52; HKK, 1960, S. 165; Šmilauer, 1960, S. 90; ČV I, 1, 1968, S. 355; Kunský, 1968, S. 131; MEZS, 1976, S. 218; GeoKr, 1984, S. 59. Pokrušnohoří 7. Das um das Erzgebirge gelegene Gebiet. 10. Koláček, 1934, S. 101. Polabí 2. Elbe-Tafelland 3. → Střední Polabí 4. Gebiet an der mittleren Elbe; Elbegebiet (wörtl.); Elbe-Niederung; Tafelland an der Elbe 5. Kotlina Polabská 10. Krejčí, 1876, S. 273; Koláček, 1934, S. 34; Novák, 1947, S. 39; Kuchǎr, 1955, S. 62; BS, 1962, S. 23; OTS, 1975, S. 43; SZ, 2003, S. 131. Polabská nížina 2. Elbeniederung; Elbniederung 3. → Střední Polabí 4. Elbe-Ebene; Elbebecken 5. Polabská kotlina; Polabská pánev 9. Der Begriff wurde in die aktuelle Nomenklatur nicht aufgenommen. 10. SSJ, 1920, S. 113; ČV I, 1, 1968, S. 436; GeoKr, 1984, S. 33; SZ, 2003, S. 131. Polabská pánev 3. → Střední Polabí 4. Elbe-Ebene; Elbebecken (wörtl.); Elbeniederung 5. Kotlina Labska; Labská rovina; Polabská nižina; Polabskí kotlina; Středolabská tabule 10. ČV I, 1, 1968, S. 475. Polabská rovina 2. Elbebecken 3. → Střední Polabí 4. Elbe-Ebene (wörtl.); Elbeniederung 5. Kotlina Polabská; Polabská nižina; Polabská pánev 10. SSJ, 1920, S. 113. Polabské tabule 2. Elbe-Tafelland 3. → Středolabská tabule 4. Elbebecken; Gebiet an der Mittleren Elbe; Mittleres Elbegebiet; Tafelland an der Elbe 5. Polabí; Polabská pánev 7. In älteren Gliederungsschema war es eine Gruppe von Haupteinheiten („oblast“); dazu gehörten 3 geomorphologische Haupteineiten: Tafelland an der Iser (Jizerská tabule); Tafelland an der unteren Eger (Dolnooharská tabule) und Tafelland an der mittleren Elbe (Středolabská tabule). 8. So benannt nach der Elbe (Labe). 10. GČ, 1972, S. 77. Polauer Berge 2. Pollauer Berge 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Bergland; Pollauer Felsklippen; Pollauer Gebirge; Pollauer Hügel 8. So genannt nach dem südmährischen Ort Pollau (Pavlov), Bezirk Lundenburg (Břeclav). 10. Kořistka, 1861, S. 64; Kloeden, 1875, S. 108; MWB MS, 1897, S. 4. Polavské hory 2. Pollauer Berge 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Bergland; Pollauer Felsklippen; Pollauer Gebirge; Pollauer Hügel 5. Pavlovské bradlo 8. So genannt nach dem südmährischen Ort Pollau (Pavlov), Bezirk Lundenburg (Břeclav). 10. Hercík ŠA, 1874, Kt. 2; Rieger 5, 1886, S. 457. Polavské vrchy 2. Pollauer Berge 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Bergland; Pollauer Felsklippen; Pollauer Gebirge; Pollauer Hügel 5. Pavlovské bradlo 8. So genannt nach dem südmährischen Ort Pollau (Pavlov), Bezirk Lundenburg (Břeclav). 10. Rieger 5, 1886, S. 457. Polední hora 2. Mittagsberg 3. → Poledník 10. Kozenn/Jireček ŠA, 1878, Kt. 11; OLTR, 1927, S. 441. Polední kámen 2. Mittagsstein 3. → Poledník 4. Teufelsstein 6. Slonecznik (poln.) 10. MSN 1, 1925, S. 1049; SGTS 3, 1993, S. 185. Polědnik 1. Berg; Kreis Königgratz (Královéhradecký kraj) 2. Mittagsstein 3. s.o. 4. Teufelsstein 5. Polední kámen 6. Słonecznik (poln.) 7. Erhebung auf dem Kamm des Riesengebirges (Krkonoše / Karkonosze), Bezirk Trautenau (Trutnov), 864 m hoch, unmittelbar an der tschechisch-polnischen Staatsgrenze. 10. OSN 6, 1893, S. 20; AR, 1981, S. 132; ZLHN, 1987, S. 412; TLAZ, 2001, S. 665. Poledník 1. Berg, Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 2. Mittagsberg 5. Polední hora 8. Erhebung im südlichen Böhmerwald (Šumava), 1315 m hoch, Bezirk Prachatitz (Prachatice), nahe der Staatsgrenze. 10. Kozenn/Jireček ŠA, 1886, Kt. 3; OSN 6, 1893, S. 15; MSN 1, 1925, S. 1048; OLTR, 1927, S. 441; CV 1, 1929, S. 135; StR, 1957, S. 25; HKK, 1960, S. 68; Duden WGN, 1966, S. 561; ČV I, 1, 1968, S. 317; Kunský, 1968, S. 53; ZLHN, 1987, S. 412; Stallhofer, 2000, S. 39. Polehraditzer Bergland 3. → Boleradická vrchovina 8. So genannt nach dem südmährischen Ort Polehraditz (Boleradice), Bezirk Lundenburg (Břeclav). Polensteig 2. Nachoder Sattel 3. → Náchodský průsmyk 4. Landespforte von Nachod; Nachoder Steig; Polensteig 5. Politzer Stufenland (wörtl.) 6. Polska Wrota (poln.); Przeľęcz Polska Wrota 10. Friedrich, 1911, S. 91. Polenstraße 2. Nachoder Sattel 3. → Náchodský průsmyk 10. Lippert I, 1896, S. 73. Polepp-Libocher Platte 4. Libocher Platte 8. So benannt nach den Orten Polep (Polepy), Bezirk Leitmeritz (Litoměřice) und Liboch (Liběchovice), Bezirk Laun (Louny). 10. Schneider, 1908, S. 175. Polická cuestová pahorkatina 3. → Polická stupňovina 4. Falkengebirge; Politzer Stufenland (wörtl.) 5. Polická kvestová pahorkatina 8. So benannt nach der ostböhmischen Stadt Politz (Police nad Metují), Bezirk Náchod. 10. Hromádka, 1956, S. 291. Polická kvestová vrchovina 2. Falkengebirge 3. → Polická stupňovina 5. Polická cuestová pahorkatina 8. So benannt nach der ostböhmischen Stadt Politz (Police nad Metují), Bezirk Náchod. 10. ČV I, 1, 1968, S. 725. Polická pahorkatina 2. Politzer Bergland 3. → Polická vrchovina 4. Politzer Hügelland (wörtl.) 8. So benannt nach der ostböhmischen Stadt Politz (Police nad Metují), Bezirk Náchod. 10. ČV I, 1, 1968, S. 462. Polická pánev 1. GME-7, Becken, Kreis Königgratz (Královéhradecký kraj) 2. Politzer Becken 3. s.o. 7. Geomorphologische Teileinheit im Braunauer Bergland (Broumovské vrchovina) 8. So benannt nach der Stadt Politz an der Mettau (Police nad Metují), Bezirk Náchod. 10. ČV I, 1, 1968, S. 624; ZLHN, 1987, S. IVB-1B-d. Polická stupňovina 1. GME-7, Stufenland, Kreis Königgratz (Královéhradecký kraj) 2. Faltengebirge 3. s.o. 7. Geomorphologische Teileinheit im Braunauer Bergland (Broumovská vrchovina) 8. So benannt nach der ostböhmischen Stadt Politz (Police nad Metují), Bezirk Náchod. 10. ZLHN, 1987, S. 413, Nr. IVB-1B-a. Polická vrchovina 1. GME-6, Stufenland, Kreis Königgratz (Královéhradecký kraj) / PL-Woj. Dolnośląskie, 218 km² in der ČR 2. Politzer Bergland; Politzer Sandsteingebirge 3. 5. 7. s.o. Polická cuestová pahorkatina; Polická kvestová pahorkatina Geomorphologische Untereinheit als Teil des Braunauer Berglandes (Broumovská vrchovina), Westliche Sudeten (Střední Sudety), ein für Wanderer und Kletterer sehr attraktives Reiseziel im tschechisch-polnischen Grenzgebiet. 5 Teileinheiten: Adřšpašsko teplické skály, Broumovské stěny, Polická pánev, Polická stupňovina, Stolové hory 8. So benannt nach der böhmischen Stadt Politz (Police nad Metují), Bezirk Náchod. 10. ČV I, 1, 1968, S. 724; GČ, 1972, S. 65; OTS, 1975, S. 44; ZLHN, 1987, S. 413, Nr. IVB1B. Polické stěny 2. Falkengebirge 3. → Polická vrchovina 4. Faltengebirge; Politzer Sandsteingebirge; Politzer Wände (wörtl.) 5. Stěny u Police 8. So benannt nach der ostböhmischen Stadt Politz (Police nad Metují), Bezirk Náchod. 10. OSN 6, 1893, S. 23; OLTR, 1927, S. 442; ČV I, 1, 1968, S. 344. Policko (nad Metuji) 1. Historische Kulturlandschaft, Kreis Königgratz (Královéhradecký kraj) 7. Umland der ostböhmischen Stadt Politz (Police nad Metuji), Bezirk Náchod, 4.355 Einwohner (1.1.2003) im Braunauer Bergland (Broumovská vrchovina). Die Gründung der Stadt steht im Zusammenhang mit der Rodungstätigkeit der Benediktiner in diesem Gebiet. 1253 wurde hier ein Kloster gegründet, gleichzeitig erlangte die in der Nähe gelegene Siedlung den Status eines Städtchens. Erste urkundliche Nennung 1213 (circuitum, qui Policz vulgaritas appelatur). Weiter 1251 (in locum Policz transferendi), 1405 (oppidum Policz). Die Stadterhebung erfolgte endgültig um 1601. Das Rathaus befindet sich an einem quadratischen Platz. Im deutschbesiedelten Umland zahlreiche Waldhufendörfer. Der Gerichtsbezirk Politz im damaligen politischen Bezirk Braunau umfaßte 1927 eine Fläche von 89 km² mit 18 Gemeinden (28 Ortschaften) und 13.200 Einwohnern, davon 98,8% Tschechen. 1939 kam die Stadt zum Protektorat. Nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmender Fremdenverkehr. 10. Schaller XV, 1790, S. 135; Sommer IV, 1836, S. 187; Rieger 6, 1867, S. 538; RGL 2, 1882, S. 412; OSN 20, 1903, S. 93; OLTR, 1927, S. 442; ČV 1, 1929, S. 40; MJČ III, 1951, S. 426; Šmilauer, 1960, S. 234; Schwarz, 1961, S. 92; ČV II, 1, 1963, S. 574; Schwarz, 1965, S. 347; HKK, 1966, S. 42; ZJČ, 1982, S. 241; ČSAZ, 1983, S. 374; RBL, 1989, S. 340; LŠ, 1997, S. 209; HHStBM, 1998, S. 464; Baedeker, 2000, S. 103; TLAZ, 2001, S. 666. Poličská pahorkatina 2. Politschkaer Tafelland 3. → Poličská tabule 4. Tafelland von Politschka 5. Politschkaer Hochfläche; Politschkaer Hügelland (wörtl.) 8. So benannt nach der ostböhmischen Stadt Politschka (Polička), Bezirk Zwittau (Svitavy). 10. ČV I, 1, 1968, S. 699. Poličská plošina 2. Politschkaer Tafelland 3. → Poličská tabule 4. Politschkaer Hochfläche; Potlischkaer Hügelland 5. Poličská pahorkatina 8. So benannt nach der ostböhmischen Stadt Politschka (Polička), Bezirk Zwittau (Svitavy). 10. ČV I, 1, 1968, S. 463. Poličská tabule 1. GME-7, Hochebene, Kreis Pardubitz (Pardubický kraj) 2. Politzer Tafelland 3. 4. 7. 8. 10. s.o. Politschkaer Hochfläche; Politschkaer Hügelland Geomorphologische Teileinheit im Zwittauer Hügelland (Svitavská pahorkatina). So benannt nach der ostböhmischen Stadt Politschka (Polička), Bezirk Zwittau (Svitavy). ZLHN, 1987, S. 413, Nr. VIC-3B-d. Poličsko 1. Historische Kulturlandschaft, Kreis Pardubitz (Pardubický kraj) 7. Historisches Umland der ostböhmischen Stadt Politschka (Polička), Bezirk Zwittau (Svitavy), 9.196 Einwohner (1.1.2003), am westlichen Rand des Zwittauer Hügellandes (Svitavská pahorkatina). Das Gebiet liegt im Grenzbereich von Böhmen und Mähren am Kreuzungspunkt wichtiger Verkehrswege, gehört aber nicht eigentlich zu den Altsiedellandschaften Böhmens und Mährens. 1165 siedelten Prämonstratenser an dieser Stelle, die Gründungsurkunde wurde von König Přemsyl Otakar ausgestellt. Erste Nennungen: 1167 (cum pratis quae vocantur Napolickach), zugleich ein Hinweis auf die hier anwesenden Slawen, und 1265 (novella plantatio nostrae civitatis in Policzek), 1269 (abbas de bonis Poliska cessit), 1285 (civitatem Policz), 1307 (Policz), 1350 (in oppido Policska), 1450 (město Polička). Die Stadt bildet eine ovale Anlage mit regelmäßigem Grundriß, sie erhielt das Magdeburger Recht und war damit typisch für die deutsche Ostkolonisation. Die Siedler des Umlandes, wo Waldhufenfluren vorherrschen, kamen vornehmlich aus dem norddeutschen Raum. Doch schon im 14. Jahrhundert gerieten die Deutschen in der Stadt in die Minderheit; diese Sprachgrenzsituation hielt bis in die nahe Gegenwart an. 1350 ist die Stadt als Leibgedingestadt der böhmischen Königin erwähnt. Im Dreißigjährigen Krieg litt die Stadt sehr, der wirtschaftliche Aufschwung wurde durch das Tuchmacherhandwerk gefördert. Im 19. Jahrhundert Industrialisierung und Modernisierung der Landwirtschaft. Der politische Bezirk Polička umfaßte 1927 eine Fläche von 320 km² mit 33 Gemeinden (60 Ortschaften) und 34.700 Einwohnern, davon 71,7% Tschechen. 1939 kam Politschka mit seiner weitgehend tschechischen Bevölkerung (1900 nur noch 19 Deutsche) zum Protektorat, die Orientierung auf Böhmen ist auch nach 1945 geblieben. Durch die Verwaltungsreform von 1949 wurde Politschka wieder Sitz einer Bezirksverwaltung, blieb dies aber nur bis 1960. 10. Schaller XI, 1790, S. 166; Sommer V, 1837, S. 211; Rieger 7, 1868, S. 540; RGL 2, 1883, S. 412; OSN, 1903, S. 104; OLTR, 1927, S. 442; MJČ III, 1951, S. 427; HKK, 1960, S. 27; Schwarz, 1961, S. 214; Schwarz, 1965, S. 215; Schwarz, 1966, S. 263; ZJČ, 1982, S. 241; ČSAZ, 1983, S. 375; RBL, 1989, S. 339; LŠ, 1997, S. 209; HHStBM, 1998, S. 463; TLAZ, 2001, S. 666. Politschkaer Hochfläche 2. Politschkaer Tafelland 3. → Poličská tabule 4. Politschkaer Hügelland 5. Poličská plošina (wörtl.) 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Politschka (Polička), Bezirk Zwittau (Svitavy). Politschkaer Hügelland 2. Politschkaer Tafelland 3. → Poličská tabule 4. Politschkaer Hochfläche 5. Poličská pahorkatina (wörtl.); Poličská plošina 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Politschka (Polička), Bezirk Zwittau (Svitavy). Politschkaer Tafelland 3. → Poličská tabule 4. Politschkaer Hügelland; Politschkaer Tafelland 5. Poličská pahorkatina; Poličská plošina 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Politschka (Polička), Bezirk Zwittau (Svitavy). Politzer Becken 3. → Polická pánev 8. So genannt nach der nordböhmischen Stadt Politz an der Mettau (Police nad Metují), Bezirk Náchod. Politzer Bergland 2. Falkengebirge 3. → Polická vrchovina 4. Politzer und Adersbacher Gebirge 5. Polická cuestová pahorkatina; Polická kvestová pahorkatina; Polické stěny 8. So genannt nach der nordböhmischen Stadt Politz (Police nad Metují), Bezirk Náchod. 10. OTS, 1975, S. 44. Politzer Felsberge 2. Falkengebirge 3. → Polické stěny 4. Faltengebirge; Politzer Sandsteingebirge; Politzer Wände 5. Stěny u Police 8. So genannt nach der nordböhmischen Stadt Politz (Police nad Metují), Bezirk Náchod. 10. Schweitzer, 1846, S. 3. Politzer Gebirge 2. Falkengebirge 3. → Polická vrchovina 4. Pölitzer Felsen; Politzer Sandsteingebirge; Politzer und Adersbacher Gebirge 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Politz (Police nad Metují), Bezirk Náchod. 10. Sommer IV, 1836, S. XVIII. Politzer- oder Faltengebirge 2. Politzer Bergland 3. → Polická vrchovina 4. Politzer und Adersbacher Gebirge 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Politz (Police nad Metuji), Bezirk Náchod. Politzer und Adersbacher Gebirge 2. Politzer Bergland 3. → Polická vrchovina 8. So genannt nach den ostböhmischen Orten Politz (Police nad Metuji) und Adersbach (Adršpach), Bezirk Náchod. 10. Sommer IV, 1836, S. XVIII; Sydow, 1868, S. 145. Pölitzer Felsen 2. Falkengebirge 3. → Polické stěny 5. Stěny u Police 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Politz (Police nad Metují), Bezirk Náchod. 10. ADRE 2, 1843, S. 461. Politzer Hügelland 2. Politzer Bergland 3. → Polická vrchovina 4. Politzer Sandsteingebirge; Politzer und Adersbacher Gebirge 5. Polická pahorkatina 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Politz (Police nad Metují), Bezirk Náchod. Politzer Kamm 2. Falkengebirge 3. → Polické stěny 4. Politzer Sandsteingebirge 10. Kloeden, 1875, S. 90. Politzer Sandsteingebirge 2. Falkengebirge 3. → Polické stěny 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Politz (Police nad Metují), Bezirk Náchod. 10. Sommer IV, 1836, S. XIII. Politzer Stufenland 3. → Polická stupňovina 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Politz (Police nad Metují), Bezirk Náchod. Pollauer Berge 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Bergland; Pollauer Felsklippen; Pollauer Gebirge 5. Pavlovské brádlo; Vrchy Pálavské 8. So genannt nach dem südmährischen Ort Pollau (Pavlov), Bezirk Lundenburg (Břeclav). 10. Wolny III, 1837, S. X; ČSSt, 1971, S. 23; Kloeden, 1875, S. 128; RGL 2, 1883, S. 105; Hassinger, 1914, S. 9; Blau, 1927, S. 27; Machatschek, 1927, S. 11; Moscheles, 1941, S. 113; KB-Kt., 1943; Blažek, 1959, S. 240; BS, 1962, S. 560; Duden WGN, 1966, S. 502; Schwarz, 1966, S. 129; ČSSt, 1971, S. 23; OTS, 1975, S. 41; SLL, 1985, S. 350; RBL, 1989, S. 340; Baedeker, 2000, S. 15; Stani-Fertl, 2001, S. 270. Pollauer Berggruppe 2. Pollauer Berge 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Bergland; Pollauer Felsklippen; Pollauer Gebirge 8. So genannt nach dem südmährischen Ort Pollau (Pavlov), Bezirk Lundenburg (Břeclav). 10. Wolny I, 1846, S. II. Pollauer Bergland 2. Pollauer Berge 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Felsgebirge; Pollauer Gebirge 5. Pavlovské bradlo 8. So genannt nach dem südmährischen Ort Pollau (Pavlov), Bezirk Lundenburg (Břeclav). Pollauer Felsklippen 2. Pollauer Berge 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Bergland; Pollauer Gebirge; Pollauer Hügel 5. Pavlovské bradlo (wörtl.) 8. So genannt nach dem südmährischen Ort Pollau (Pavlov), Bezirk Lundenburg (Břeclav). Pollauer Gebirge, auch Nikolsburger Gebirge 2. Pollauer Berge 3. → Pavlovské vrchy 4. Pollauer Bergland; Pollauer Felsklippen 8. So genannt nach den südmährischen Orten Pollau (Pavlov), Bezirk Lundenburg (Břeclav), und Nikolsburg (Mikulov), Bezirk Lundenburg (Břeclav). 10. OLTR, 1927, S. 442. Pollerskirchener Hügelland 3. → Úsobská pahorkatina 8. So genannt nach dem ostböhmischen Ort Pollerskirchen (Úsobí), Bezirk Deutschbrod (Havličkův Brod). Polna 1. Historische Kulturlandschaft; Hochland-Kreis (Kraj Vysočina) 7. Umland der ostböhmischen Stadt Polna, Bezirk Iglau (Jihlava), 4.959 Einwohner (1.1.2003), auf der Böhmisch-Mährischen Höhe (Českomoravská vrchovina) gelegen. Es handelt sich um Kolonisationsland im böhmisch-mährischen Grenzgebiet. Frühe Nennungen: 1242 (in Polna), 1282 (eccl. in Polna), 1318 (Wikardus de Polne), 1405 (Polna), 1542 (hrad Polnau), 1547 (Polnau hrad), 1654 (město Polna). Schon im 13. Jahrhundert entwickelte sich Polna zur Stadt und zum Mittelpunkt einer kleinen Region. Das zeigt auch der große Platz in der Mitte der Stadt, wo die Märkte abgehalten worden konnten. Die Zuwanderer waren zum Teil aus Deutschland gekommen, doch schon zum Beginn der Neuzeit hatte sich das tschechische Element weitgehend durchgesetzt. Außerdem gab es eine starke Judengemeinde. Bei den Dörfern im Umland handelt es sich meist um relativ kleine Gassendörfer, deren Gründung schon in die Zeit des slawischen Landesausbaus fallen dürfte. Die Lage im böhmisch-mährischen Grenzgebiet war verbunden mit einer wechselvollen Geschichte, dennoch sind einige bemerkenswerte Baudenkmäler bis heute erhalten geblieben. Im 19. Jahrhundert Textilund Holzverarbeitung. Der Gerichtsbezirk Polna im damaligen politischen Bezirk Deutschbrod umfasste 1927 eine Fläche von 100 km² mit 13 Gemeinden (14 Ortschaften) und 8.700 Einwohnern, davon 99,9 % tschechisch. 1939 wurde Polna unter Protektoratsverwaltung gestellt. Holz-, Textil- und Nahrungsmittelindustrie. 10. RGL 2, 1883, S. 413; OLTR, 1927, S. 442 und 443; MJČ III, 1951, S. 428; Schwarz, 1966, S. 222; ČSAZ, 1983, S. 375; RBL, 1989, S. 340; HHStBM, 1998, S. 465; TLAZ, 2001, S. 668. Polnische Pforte 2. Nachoder Sattel 3. → Náchodský průsmyk 4. Nachoder Steig; Polnischer Steig 6. Polskie Wrota (poln.) 10. SGTS 13, 1992, S. 191. Polnischer Steig, Polensteig 2. Nachoder Sattel 3. → Nachodský průsmyk 4. Landespforte von Nachod; Nachoder Steig 6. Polskie Wrota (poln.) 10. Kloeden, 1875, S. 90; Machatschek, 1927, S. 296; SLL, 1985, S. 35. Polnisches Tor 2. Nachoder Sattel 3. → Náchodký průsmyk 4. Landespforte von Nachod; Polnische Pforte 6. Polskie Wrota (poln.) 10. Schneider, 1908, S. 119; Partsch II, 1912, S. 42. Polom 1. Berg, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 2. Fallbaum-Berg 3. s.o. 7. Erhebung im Böhmerwald (Šumava), 1295 m hoch, Bezirk Klattau (Klatovy). 10. Kunský, 1968, S. 289; ČSAZ, 1983, S. 480; ZLHN, 1987, S. 414. Polom II 2. Großer Polom 3. → Velký Polom 10. Kneifel II, 1804, S. 89. Polomené hory 1. GME-7, Bergland, Kreis Reichenberg (Liberecký kraj) 3. s.o. 4. Widimer Höhe 5. Dubská nebo Polomené hory 7. Geomorphologische Teileinheit im Rollberg-Hügelland (Ralská pahorkatina). 9. Der Name ist, wie man an den Belegen erkennt, erst nach 1945 aufgekommen. 10. Novák, 1947, S. 38; Hromádka, 1956, S. 288; HKK, 1960, S. 51; GČZ, 1965, S. 180; ČV I, 1, 1968, S. 344; Kunský, 1968, S. 67; ČSAZ, 1983, S. 407; ZLHN, 1987, S. 414, Nr. VIA-1A-a. Polska Góra 2. Haferplan 3. → Mravenčí vrch 9. Polnische Bezeichnung 10. SGTS 9, 1996, S. 144. Polská hora 1. Berg; Kreis Olmütz (Olomoucký kraj) / PL-Woj. Dolnośląskie 2. Rote Sümpfe 3. s.o. 4. Rote Sümpfe 6. Rudawiec 7. Erhebung im Glatzer Schneegebirge (Kralický Sněžník / Masyw Śnieżnika), 1079 m hoch, Bezirk Mährisch-Schönberg (Šumperk), liegt an der tschechisch-polnischen Staatsgrenze. 10. NGRP, 1991, S. 746; SGTS 16, 1993, S. 290. Polskie Wrota 2. Nachoder Sattel 3. → Náchodský průsmyk 4. Polnische Pforte; Polnischer Steig 9. Polnische Bezeichnung 10. Walczak, 1968, S. 30; SGTS 13, 1992, S. 191. Polský hřeben 2. Hauptkamm (des Riesengebirges) 3. → Slezský hřbet 4. Preußischer Kamm; Schlesischer Kamm 5. Slezský hřbet hlavní 6. Glowni Grzbiet (poln.); Grzbiet Śla,ski (poln.) 10. Koláček, 1934, S. 53. Polzen, die Polzen 3. → Ploučnice 4. Pulsnitz 10. Schaller V, 1787, S. 14; Sommer I, 1833, S. XXII; ADRE 2, 1843, S. 460; Pierer 3, 1857, S. 13; ARCL 2, 1866, S. 892; Sydow, 1868, S. 150; MWB Böhmen I, 1884, S. 58; Lippert I, 1896, S. 14; Schneider, 1908, S. 102; Moscheles, 1920, S. 24; Machatschek, 1927, S. 32; OLTR, 1927, S. 443; Blume, 1943, S. 21; Werdecker, 1957, S. 34; Schwarz, 1961, S. 259; BS, 1962, S. 539; Schwarz, 1965, S. 199; Duden WGN, 1966, S. 503; SLL, 1985, S. 350; RBL, 1989, S. 341; Baedeker, 2000, S. 106; Stani-Fertl, 2001, S. 270; SZ, 2003, S. 132. Polzenbecken 3. → Českolipská kotlina 8. So genannt nach dem Polzenfluß (Ploučnice). 10. Blume, 1943, S. 27. Polzenland 3. → Českolípsko 7. Land am Polzen (Ploužnice), Mittelpunkt Böhmisch-Leipa (Česká Lípa), Bezirk Böhmisch-Leipa (Česká Lípa). 9. So genannt nach dem Polzen (Ploužnice). 10. Werdecker, 1957, S. 36. Pomezní hřeben 1. Bergrücken; Kreis Königgratz (Královéhradecký kraj) 2. Kolbenkamm 3. s.o. 4. Grenzkamm 6. Grzbiet Lasocki 7. Teil des Hauptkamms bzw. des Schlesischen Kamms (Sleszký hřbet), Bezirk Trautenau (Trutnov). 10. GČZ, 1965, S. 96; Bach, 1989, S. 70. Pomezní sedlo 1. Paß; Kreis Königgratz (Královéhradecký kraj) / PL-Woj. Dolnośląskie 2. Grenzbauden, Grenzbauden-Paß 3. s.o. 5. Pomezní Boudy; Sedlo u Pomezních Boud 6. Okraj; Przełęcz Graniczna (poln., früher); Przełęcz Okraj (poln.) 7. Paß im Riesengebirge (Krkonosze / Karkonosze) auf dem auf dem Kolbenkamm (Pomezní hřeben / Lasocki Grzbiet), bis 1046 m hoch, Straße von Trautenau (Trutnov), Bezirk Trautenau (Trutnov), nach Schmiedeberg (Kowary), an der tschechischpolnischen Staatsgrenze. 10. ČV I, 1, 1968, S. 463. Pomezní sedlo 1. Paß; Kreis Olmütz (Olomoucký kraj) 2. Gemärke; Am Gemärke 3. → Na pomezí 5. Sedlo Na Pomezí 7. Gebirgssattel am Reichensteiner Gebirge (Rychlebské hory / Góry Złote), bis 625 m hoch, Straße und Bahn nach Jauernig (Javorník). 9. Am Gemärke (Na Pomezí) ist ein Ortsteil von Nieder-Lindewiese (Dolní Lipová), Bezirk Freiwaldau (Jeseník). 10. ČV I, 1, 1968, S. 463. Pomoraví 1. Gebiet; Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj), Kreis Olmütz (Olomoucký kraj), Mährisch-Schlesischer Kreis (Moravskoslezský kraj), Kreis Zlin (Zlinský kraj) / Slowakei / A 2. March-Gebiet 7. Einzugsgebiet der March (Morava), insgesamt 26.580 km2, überwiegend in Mähren. Rechte Nebenflüsse sind die Thaya (Dyje), die Hanna (Haná), Valová, Blatna, die Zohse (Třebůvka) und die Mährische Sassau (Moravská Sázava), linksseitig die Myava, Olšava, Betschwa (Bečva), Bystřice, Oskava, Teß (Desná), Branná und Krupá. 10. HKK, 1960, S. 14; ČV I, 1, 1968, S. 463; Kunský, 1968, S. 230. Ponědražský rybník 1. Teich; Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 7. Fischteich im Wittingauer Becken (Třeboňská pánev), 165 ha Fläche, beim südböhmischen Ort Poniedrasch (Ponědraž), Bezirk Neuhaus (Jindřichův Hradec). 10. OSN 6, 1893, S. 90; Kunský, 1968, S. 164; Novotný, 1972, S. 46. Ponikva 2. Punkwa 3. → Punkva 9. Veralteter Name. 10. OLTR, 1927, S. 461; ZJČ, 1982, S. 251; LŠ, 1993, S. 218. Poodří 1. Gebiet, Mährisch-Schlesischer Kreis (Moravskoslezský kraj) / PL-Woj. Opolskie 2. Oder-Gebiet 7. Das Einzugsgebiet der Oder (Odra), die bei Stettin (Szrzerzin) in die Ostsee mündet, erstreckt sich über drei Staatsgebiete: Deutschland, Polen und Tschechien, insgesamt 118.600 km2, davon 5.831 km² in der ČR. Bedeutende Nebenflüsse auf dem tschechischen Gebiet sind linksseitig die Oppa (Opava) und die Ostrawitza (Ostravice), rechtsseitig die Olsa (Olše), die teilweise die Staatsgrenze gegen Polen bildet. 10. BS, 1962, S. 370; ČV I, 1, 1968, S. 769; Kunský, 1968, S. 135; ČSAZ, 1983, S. 338; GČS, 1985, S. 74. Poodří CHKO 1. Landschftsschutzgebiet, Mährisch-Schlesischer Kreis (Moravskoslezský kraj) / PL-Woj. Śląskie / D 2. Landschaftsschutzgebiet Oderniederung 7. Das geschützte Gebiet liegt oberhalb von Mährisch-Ostrau (Ostrava) und umfaßt eine Auenlandschaft mit seltenen Arten. Fläche: 79 km² mit drei km² besonders geschützten Gebieten. 1991 unter Schutz gestellt. 10. CHÚP, 1999, M6; StR 2001, S. 81; TLAZ, 2001, S. 670. Poopavská nižina 1. GME-6, Tiefland, Mährisch-Schlesischer Kreis (Moravskoslezský kraj) / PL-Woj. Opolskie, 131 km2 in der ČR 2. Oppa-Tiefland 3. s.o. 5. Poopavská tabule 7. Geomorphologische Untereinheit im Troppauer Hügelland (Opavská pahorkatina). 4 Teileinheiten: Kravařská rovina, Komarovská nížina, Opavsko-moravická niva und Otická nížina. 8. So benannt nach dem Fluß Oppa (Opava). 10. GČZ, 1965, S. 133; ČV I, 1, 1968, S. 465; GČ, 1972, S. 80; GeoKr, 1984, S. 202; ZLHN, 1987, S. 414, Nr. VIIA-1B. Poopavská tabule 2. Oppa-Tiefland 3. → Poopavská nižina 5. Oppa-Tafelland (wörtl.) 8. So benannt nach dem Fluß Oppa (Opava). 10. Kunský, 1968, S. 382. Pootaví 10. Kunský, 1968, S. 61. Pootavský kras 2. Wottawa-Karst 8. So benannt nach der Otava (Wottawa). 10. ČV I, 1, 1968, S. 347. Pořičská kotlina 10. ČV I, 1, 1968, S. 725. Porta Bohemica 1. Taleinschnitt, Kreis Aussig (Ústecký kraj) 2. Elbedurchbruch 3. → Labský kaňon 7. Cañonartig verengtes Flußtal der Elbe (Labe) nördlich von Lobositz (Lovosice), Bezirk Leitmeritz (Litoměřice). Die Gegend ist reich an Weingärten. 10. OTS, 1975, S. 44; ČSAZ, 1983, S. 248; SLL, 1985, S. 351; Baedeker, 2000, S. 173. Porta Moravica 2. Mährische Pforte 3. → Moravská brána 6. Moravian Gate (engl.); Porte de Moravie (franz.) 9. Lateinische, historische Bezeichnung. 10. OTS, 1975, S. 44. Porte de Moravie 2. Mährische Pforte 3. → Moravská brána 6. Brama Moravska (poln.); Moravian Gate (engl.) 9. Französische Bezeichnung. 10. VGJ, 1996, S. 39. Porubská brána 2. Pforte von Poruba 8. So benannt nach dem Ostrauer Stadtbezirk Poruba (Ostrava-město 4), Bezirk MährischOstrau (Ostrava-město). 10. GČZ, 1965, S. 14; ČV I, 1, 1968, S. 378; Kúnský, 1968, S. 43. Porubská plošina 1. GME-7, Hochfläche, Mährisch-Schlesischer Kreis (Moravskoslezský kraj) 2. Hochfläche von Poruba 7. Geomorphologische Teileinheit im Ostrauer Becken (Ostravská pánev). 8. So benannt nach dem Ostrauer Stadtbezirk Poruba (Ostrava-město 4), Bezirk MährischOstrau (Ostrava-město). 10. ZLHN, 1968, S. 415, Nr. VIIIB-1-f. Posázaví 1. Hydrographische Region, Hochland-Kreis (Kraj Vysočina) 2. Sazawa-Gebiet 7. Einzugsgebiet der Sazawa (Sazava), insgesamt ein Gebiet von 4.349 km². 10. Koláček, 1934, S. 34; HKK, 1960, S. 146; ČV I, 1, 1968, S. 521; Kunský, 1968, S. 32. Postberg 10. Kloeden, 1875, S. 84; Willkomm, 1878, S. 29. Postelberger Platte 8. So genannt nach der nordböhmischen Stadt Postelberg (Postoloprty), Bezirk Laun (Louny). 10. Engelmann, 1922, S. 21. Postoloprtsko 1. Historische Kulturlandschaft; Kreis Aussig (Ústecký kraj) 7. Umland der nordmährischen Stadt Postelberg (Postoloprty), Bezirk Laun (Louny), 4.897 Einwohner (1.1.2003), liegt im Saazer Becken (Žatecká pánev). Der Ort liegt im Altsiedelland des Saazer Hopfenanbaugebietes und wird schon in der Chronik des Cosmas erwähnt. Frühe Erwähnungen: Cosmas (Porta Apostolorum), 1125 (novam urbem nomine Dragus super ripam fluvis Ogre iuxta paqum Postolopirth), 1147 (abbas Postolopertensis), 1219 (de Pozilliporf), 1251 (abbas Portae Aposolorum), 1386 (kl. Postoloprskeho), 1420 (closter von Costlpurck), 1425 (auf den klostern Postelbůrg und Ossek), 1454 (Kostoloprty), 1559 (mčko Kostoloprthy), 1613 (na Postoloprtech), 1787,1846 (Postelberg, Postoloprty). Unterhalb der Stadt an der Eger (Ohře) liegt die slawische Burgstätte Draguš, die von den Přemysliden errichtet worden war. Die wertvolle Bibliothek des Klosters wurde durch die Hussiten zerstört. Zunächst profilierte sich die Siedlung als Marktort. Im 19. Jahrhundert näherte sich der Bergbau der Stadt. Der Gerichtsbezirk Postelberg im damaligen politischen Bezirk Saaz umfasste 1927 eine Fläche von 128 km² mit 22 Gemeinden (27 Ortschaften) und 12.300 Einwohnern, darunter 83,4 % deutsch. Südlich der Stadt verlief die deutsch-tschechische Sprachgrenze, in Postelberg gab es eine starke tschechische Minderheit. 1938 wurde Postelberg dem Sudetengau zugeteilt. 10. Schaller VII, 1787, S. 31; Sommer XIV, 1846, S. 69; Rieger 7, 1868, S. 719; RGL 2, 1883, S. 425; OSN 20, 1903, S. 309; OLTR, 1927, S. 446; MJČ III, 1951, S. 442; Schwarz, 1961, S. 87; Schwarz, 1965, S. 178; ZJČ, 1982, S. 242; ČSAZ, 1983, S. 377; SLL, 1985, S. 351; RBL, 1989, S. 342; LŠ, 1997, S. 210; HHStBM, 1998, S. 467. Posudetí 7. Das um die Sudeten gelegene Land, eigentlich „Sudetenland“, aber nicht im Sinne des historisch gewordenen Terminus für den sog. Reichsgau Sudetenland. 10. Koláček, 1934, S. 96. Pošumaví 2. Böhmerwald-Vorland 3. → Šumavské podhůří 4. Vorberge des Böhmerwaldes; Vorgebirge des Böhmerwaldes 10. Koláček, 1934, S. 71; HKK, 1960, S. 14; ČV I, 1, 1968, S. 380; Kunský, 1968, S. 57; NRB nach GČ, 1972, S. 46; GeoKr, 1984, S. 86. Potěšil 1. Teich; Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 7. Fischteich im Wittingauer Becken (Třeboňská pánev), 78 ha Fläche, beim Dorf Kletz (Klec), Bezirk Neuhaus (Jindřichův Hradec), gespeist von der Luschnitz (Lužnice). 10. Kunský, 1968, S. 307; Novotný, 1972, S. 48. Potok Třebovka 2. Triebe 3. → Třebovka 4. Tribowka; Trübauer Bach 10. OLTR, 1927, S. 447. Pottensteiner Bergplatte 8. So genannt nach dem ostböhmischen Ort Pottenstein (Potštejn), Bezirk Reichenau an der Kněžna (Rychnov nad Kněžnou). 10. Sydow, 1868, S. 152. Pottensteiner Gebirge 8. So genannt nach dem ostböhmischen Ort Pottenstein (Potštejn), Bezirk Reichenau an der Kněžna (Rychnov nad Kněžnou). 10. Sommer V, 1837, S. IX. Pouzdřanské kopce 2. Pausramer Kuppen 8. So benannt nach dem südmährischen Ort Pausram (Pouzdřany), Bezirk Lundenburg (Břeclav). 10. Kunský, 1968, S. 230. Povodínské kameny 10. ČV I, 1, 1968, S. 701. Požarer Gebirge 10. Sommer XVI, 1849, S. II. Prachatická hornatina 1. GME-6, Bergland, Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj), 489 km2 in der ČR 2. Prachatitzer Bergland 3. s.o. 4. Gebirge von Prachatitz; Innerer Wald; Prachatitz-Krumauer Gebirge 5. Prachaticko-českokrumlovské podhůří; Prachatické předhoří; Prachatické podhoří; Prachatická vrchovina 7. Untereinheit des Böhmerwald-Vorlandes (Šumavské podhůří). 6 Teileinheiten: Libínská hornatina; Žernovická vrchovina, Lhenická brázda, Blanský les, Křemežská kotlina und Chvalšinská kotlina. 8. So benannt nach der südböhmischen Stadt Prachatitz (Prachatice), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. GČ, 1972, S. 47; GeoKr, 1984, S. 81; ZLHN, 1987, S. 418, Nr. IB-2D. Prachatická vrchovina 2. Prachatitzer Bergland 3. → Prachatická hornatina 4. Gebirge von Prachatitz; Prachatitz-Krumauer Gebirge 5. Prachaticko-českokrumlovské podhůří; Prachatické předhoří; Prachatické podhoří; Prachatická vrchovina 8. So genannt nach der südböhmischen Stadt Prachatitz (Prachatice), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. GČZ, 1965, S. 51; ČV I, 1, 1968, S. 449; Kunský, 1968, S. 290. Prachatické podhoří 2. Prachatitzer Bergland 3. → Prachatická hornatina 4. Gebirge von Prachatitz; Prachatitz-Krumauer Gebirge 5. Prachatická vrchovina 8. So benannt nach der südböhmischen Stadt Prachatitz (Prachatice), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. Hromádka, 1956, S. 284; Kunský, 1968, S. 166. Prachatické podhůří 2. Prachatitzer Vorbergland 8. So benannt nach der südböhmischen Stadt Prachatitz (Prachatice), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. ČV I, 1, 1968, S. 450. Prachatické předhoří 2. Prachatitzer Bergland 3. → Prachatická hornatina 4. Prachatitzer Gebirgsvorland (wörtl.) 8. So benannt nach der südböhmischen Stadt Prachatitz (Prachatice), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. Kuchař, 1955, S. 62; OTS, 1975, S. 44. Prachaticko 1. Historische Kulturlandschaft, Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 7. Umgebung der südböhmischen Bezirksstadt Prachatitz (Prachatice), 11.827 Einwohner (1.1.2003). Die Stadt selbst liegt am Fuße des Böhmerwaldes und zeichnet sich auch heute noch durch große Attraktivität aus. Sie liegt an einem alten Handelsweg, dem „Goldenen Steig“, wo im Mittelalter das Salz eingeführt wurde. Die Siedlung ist seit der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts sicher nachgewiesen. Frühe Nennungen 1088 (Prahaticik); 1323 (oppidum Prachaticz). Der politische Bezirk Prachatitz, bestehend aus den Gerichtsbezirken Netolitz, Prachatitz, Wallern und Winterberg, umfaßte 1927 eine Fläche von 1.094 km² mit 106 Gemeinden (242 Ortschaften) und 74.100 Einwohnern, davon 51% tschechisch und 48,8% deutsch. Seit der Hussitenzeit blieb die Stadt, unmittelbar an der Sprachgrenze gelegen, überwiegend in tschechischer Hand, die Umgebung aber blieb deutsch, so daß der Kreis 1938 zum Sudetengau kam. 1945/46 Ausweisung der deutschen Bevölkerung. Durch die Verwaltungsreform von 1949 wurde Prachatitz Sitz einer Bezirksverwaltung und blieb dies auch nach 1960, als der Bezirk wesentlich erweitert wurde. Mit ihren schönen Gebäuden und der anmutigen Umgebung zieht die Stadt alljährlich viele Fremde an. 10. Schaller III, 1790, S. 132; Sommer VIII, 1840, S. 361; Rieger 7, 1868, S. 854; RGL 2, 1882, S. 429; OSN 20, 1903, S. 532; OLTR, 1927, S. 448; MJČ III, 1951, S. 453; Schwarz, 1965, S. 377; Kunský, 1968, S. 295; ZČJ, 1982, S. 245; ČSAZ, 1983, S. 387; TLČS, 1983, S. 178; SLL, 1985, S. 352; RBL, 1989, S. 344; Gorys, 1994, S. 182; HHStBM, 1997, S. 468; LŠ, 1997, S. 213; Baedeker, 2000, S. 82; StR, 2001, S. 59; TLAZ, 2001, S. 694. Prachaticko-českokrumlovské podhůří 2. Prachatitzer Bergland 3. → Prachatická vrchovina 4. Prachatitz-Böhmischkrumauer Vorbergland (wörtl.) 8. So benannt nach den Bezirksstädten Prachatitz (Prachatice) und Krumau (Český Krumlov). 10. NRB nach GČ, 1972, S. 47. Prachatický okres 1. Verwaltungseinheit 2. Bezirk Prachatitz (Prachatice) 5. Prachaticko 7. Bezirk (entspricht Landkreis) im Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj). Fläche 1.375 km2, 51.300 Bewohner, 37 Einwohner/km2, 65 Gemeinden. 10. StR, 2001, S. 56. Prachatitz-Krumauer Gebirge 2. Prachatitzer Bergland 3. → Prachatická hornatina 8. So benannt nach den Bezirksstädten Prachatitz (Prachatice) und Krumau (Český Krumlov). 10. WK, 1860, S. 14; Willkomm, 1878, S. 43; MWB I, 1884, S. 108. Prachatitz-Krumauer Vorbergland 3. → Prachaticko-českokrumlovské podhůrí 7. So genannt nach den südböhmischen Bezirksstädten (Prachatice) und Krumau (Český Krumlov). Prachatitzer Bergland 3. → Prachatická pahorkatina 5. Prachaticko-českokrumlovské podhůří; Prachatické předhoří; Prachatická podhoří; Prachaticka vrchovina 8. So genannt nach der südböhmischen Stadt Prachatitz (Prachatice), Bezirk Prachatitz (Prachatice). Prachatitzer Gebirge 3. → Prachatická hornatina 4. Innerer Wald 8. So genannt nach der südböhmischen Stadt Prachatitz (Prachatice), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. WK, 1860, S. 68; Schneider, 1908, S. 27; OLTR, 1927, S. 448. Prachatitzer Straße 2. Goldener Steig 3. → Zlatá stezka 4. Passauer Weg 8. So benannt nach der südböhmischen Stadt Prachatitz (Prachatice), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 9. Erstmals 1088 als „Prachaticih via“ urkundlich erwähnt. 10. Lippert I, 1896, S. 87; Stallhofer, 2000, S. 45. Prachatitzer Vorgebirge 2. Prachatitzer Bergland 3. → Prachatická hornatina 5. Prachatická předhoří (wörtl.); Prachatické podhůří 8. So genannt nach der südböhmischen Stadt Prachatitz (Prachatice), Bezirk Prachatitz (Prachatice). 10. OTS, 1975, S. 44. Prácheň 1. Berg, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 2. Parchen 3. s.o. 4. Parchynberg 7. Berg im Vorland des Böhmerwaldes (Šumavské podhůří), 513 m hoch, Bezirk Klattau (Klatovy). 10. ČV I, 1, 1968, S. 450; ZLHN, 1987, S. 419; TLAZ, 2001, S. 695. Prácheňská pahorkatina 1. GME-7, Hügelland, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 2. Parchen-Hügelland 7. Geomorphologische Teileinheit im Vorland des Böhmerwaldes (Šumava) 8. So benannt nach dem 513 m hohen Parchen (Pracheň), Bezirk Klattau (Klatovy). 10. GČZ, 1965, S. 51; CV I, 1, 1968, S. 449; ZLHN, 1987, S. 419, Nr. IB-2F-b. Prácheňská vrchovina 2. Winterberger Bergland 3. → Vimperská vrchovina 8. So benannt nach dem 513 m hohen Párchen (Prácheň), Bezirk Klattau (Klatovy). 10. ČV I, 1, 1968, S. 449. Prácheňské hřbety 2. Parchener Rücken 8. So benannt nach dem 513 m hohen Parchen (Prácheň), Bezirk Klattau (Klatovy). 10. ČV I, 1, 1968, S. 717. Prácheňské podhoří 2. Winterberger Bergland 3. → Vimperská vrchovina 8. So benannt nach dem 513 m hohen Parchen (Prácheň), Bezirk Klattau (Klatovy). 10. Hromádka, 1956, S. 284; Kunský, 1968, S. 166. Prácheňské podhůří 2. Parchen-Hügelland 3. → Prachenská pahorkatina 4. Parchen-Bergland; Parchen-Vorgebirge (wörtl.) 5. Prácheňská podhoří; Prácheňská vrchovina 8. So benannt nach dem 513 m hohen Parchen (Prácheň), Bezirk Klattau (Klatovy). 10. ČV I, 1, 1968, S. 450. Prachin 2. Parchen 3. → Prácheň 4. Prachyn; Prachynberg 10. Sommer VIII, 1840, XIII. Prachometský kopec 1. Berg, Kreis Karlsbad (Karlovarský kraj) 7. Erhebung im Tepler Hochland (Tepelská plošina), 780 m hoch. 8. So benannt nach dem anliegenden Ort Prachomuth (Prachomety), Bezirk Karlsbad (Karlovy Vary). 10. GČZ, 1965, S. 780; ZLHN, 1987, S. 419. Prachovské skály 1. Felsenstadt, Kreis Königgratz (Královéhradecký kraj) 3. → Prachower Felsen 7. Felsgebilde im Jitschiner Bergland (Jičínská pahorkatina), Bezirk Jitschin (Jičín), gehört zum Landschaftsschutzgebiet Böhmisches Paradies (Český raj). 8. So benannt nach dem ostböhmischen Ort Prachow (Prachov), Bezirk Jitschin (Jičín). 10. Krejčí, 1876, S. 445; OZA, 1924, Kt. 17; MSN 1, 1925, S. 1048; ČV 1, 1929, S. 90; Koláček, 1934, S. 42; HKK, 1960, S. 42; BS, 1962, S. 249; GČZ, 1965, S. 189; ČV I, 1, 1968, S. 341; Kunský, 1968, S. 62; TLČS, 1983, S. 179; GeoKr, 1984, S. 172; ZLHN, 1987, S. 419, Nr. VIA-2A-b; RBL, 1989, S. 346; Gorys, 1994, S. 314; Baedeker, 2000, S. 94; TLAZ, 2001, S. 696. Prachower Felsen 3. → Prachovské skály 8. So genannt nach dem ostböhmischen Ort Prachow (Prachov), Bezirk Jitschin (Jičín). 10. Sommer III, 1835, S. 111; Hassinger, 1925, S. 66; RBL, 1989, S. 346; Gorys, 1994, S. 314; Baedeker, 2000, S. 94. Prachyn, Prachynberg 2. Parchen 3. → Prácheň 4. Prachin 10. Willkomm, 1878, S. 48. Pracká pahorkatina 1. GME-6, Hügelland, Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj), 289 km2 2. Pratzer Hügelland 3. s.o. 5. Pratecká plošina 7. Geomorphologische Untereinheit im Südmährischen Becken (Dysko-svratecký úval). 6 Teileinheiten: Cezavská niva, Moutnická pahorkatina, Slapanická pahorkatina, Tuřanská plošina, Uherčická sníženina und Výhon. 8. So benannt nach dem südmährischen Ort Pratze (Prace), Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj). 10. GČ, 1972, S. 82; ZLHN, 1987, S. 417, Nr. VIIIA-1F. Praděd 1. Berg, Mährisch-Schlesischer Kreis (Moravskoslezský kraj) 2. Altvater 3. s.o. 4. Vaterberg, Mährischer Schneeberg 6. Pradziad (poln.) 7. Höchste Erhebung im Gesenke (Hrubý Jeseník), 1491 m, Bezirk Freudenthal (Bruntál), beliebtes Ausflugsziel an der oberen Waldgrenze, Wintersportgebiet, ausgezeichneter Rundblick vom Fernsehturm. 9. Erste Nennung 1377 (Keylichter Schneeberg). Weiter im 18. Jahrhundert Neisser Schneeberg, Wiesenberská Sněžka, daneben 1497 Altvater, 1810 Alt-Vater, 1841/46 Altvater nebo Vaterberg, 1848 Praděd, d. h. die tschechische Form für den alten Vater bzw. Großvater. 10. Merklasa / Zap ŠV, 1846, Kt. 5; OSN 17, 1901, S. 607; MSN 1, 1925, S. 1049; OLTR, 1927, S. 448; ČV 1, 1929, S. 12; Koláček, 1934, S. 45; Hromádka, 1956, S. 292; StR, 1957, S. 26; HKK, 1960, S. 67; BS, 1962, S. 349; GČZ, 1965, S. 120; Duden WGN, 1966, S. 508; ČV I, 1, 1968, S. 377; Kunský, 1968, S. 55; OTR, 1975, S. 44; AR, 1981, S. 132; Kozenn / Jireček ŠA, 1882, Kt. 11; ZJČ, 1982, S. 243; ČSAZ, 1983, S. 379; ZLHN, 1987, S. 417; RBL, 1989, S. 23; VGJ, 1996, S. 29; LŠ, 1997, S. 211; Baedeker, 2000, S. 73; Stani-Fertl, 2001, S. 259; TLAZ, 2001, S. 675; SZ, 2003, S. 132. Praděd NPR 1. Naturschutzgebiet, Mährisch-Schlesischer Kreis (Moravskoslezský kraj) 2. Naturschutzgebiet Altvater 7. Besonders geschütztes Gebiet innerhalb des Landschaftsparks Gesenke (Jeseník CHko). 10. ČSAZ, 1983, S. 329; GeoKr, 1984, S. 205; CHÚP, 1999, K 4. Pradědská hornatina 1. GME-6, höheres Bergland, 209 km2, Mährisch-Schlesischer Kreis (Moravskoslezský kraj) 2. Altvaterbergland 3. s.o. 5. Les Pradědův; Skupina Praděda 7. Geomorphologische Untereinheit im Altvatergebirge (Hrubý Jeseník), Ostsudeten (Vychodní Sudety). 4 Teileinheiten: Desenská hornatina, Karlovská vrchovina, Pradědský hřbet, Vysokoholský hřbet. 8. So benannt nach dem Hauptberg, dem Altvater (Praděd), 1491 m hoch, Bezirk Freudenthal (Bruntál). 10. GČ, 1972, S. 72; ZLHN, 1987, S. 417, Nr. IVC-7C. Pradědsko-keprnická oblast 2. Altvater-Kepernik-Gebiet 8. So benannt nach dem Altvater (Praděd) und dem Kepernik (Keprník). 9. Die Bezeichnung kommt in der aktuellen geomorphologischen Gliederung nicht mehr vor. 10. GČZ, 1965, S. 120. Pradědský hřbet 1. GME-7, Gebirgsrücken 2. Altvaterkamm 3. s.o. 4. Altvater-Hauptrücken; Altvaterzug 7. Gebirgskamm im Altvatergebirge (Hrubý Jeseník), Ostsudeten (Vychodní Sudety). 8. So benannt nach dem Hauptberg, dem 1491 m hohen Altvater (Praděd), Bezirk Freudenthal (Bruntál). 10. ZLHN, 1987, S. 418. Prager Gau 3. → Pražsko 10. Lippert I, 1896, S. 327. Prager Becken 3. → Pražská kotlina 8. So genannt nach der Hauptstadt Prag (hl. m. Praha). Prager Hochfläche 3. → Pražská plošina 4. Prager Tafelland; Schlan-Prager Hochfläche 5. Pražská tabule 8. So genannt nach der Hauptstadt Prag (hl. m. Praha). 10. Sedlmeyer, 1941, S. 28; OTS, 1975, S. 45; Stani-Fertl, 2001, S. 271. Prager Kreis 2. Hauptstadt Prag 3. → Hlavní město Praha 7. Das Stadtgebiet der Hauptstadt Prag wurde aus dem Mittelböhmischen Kreis (Středočeský kraj) ausgekreist und damit einem Kreis (kraj) sowie später auch einer NUTS-2-Region (oblast) gleichgestellt. Prager Moldautal 2. Prager Becken 3. → Pražská kotlina 8. So genannt nach der Hauptstadt Prag (hl. m. Praha). 10. KB-Kt., 1943. Prager Region 2. Region Prag 3. 7. → Praha (oblast) Die NUTS-2-Region ist identisch mit der kreisfreien Hauptstadt Prag (hl. m. Praha), also nicht Teil des Mittelböhmischen Kreises (Středočeský kraj). Prag-Pilsener Silurfurche 2. Böhmische Silurmulde 10. Spreitzer, 1941, S. 434. Praha 1. Berg, Mittelböhmischer Kreis (Středočeský kraj) 7. Erhebung im Brdywald-Bergland bzw. Mittelböhmischen Waldgebirge (Brdská vrchovina), 863 m hoch, Bezirk Přibram. 10. MWB Böhmen I, 1894, S. 87; Schneider, 1908, S. 156; MSN 1, 1925, S. 1048; OLTR, 1927, S. 449; Novák, 1947, S. 36; Werdecker, 1957, S. 47; ČV I, 1, 1968, S. 696; Kunský, 1968, S. 311; ČSSt, 1971, S. 22. Praha (oblast) 1. NUTS-2-Region 2. Region Prag 5. Praha hl.m. 7. Die Region Prag ist identisch mit der Hauptstadt Prag (hl. m. Praha), die aus dem Mittelböhmischen Kreis (Středočeský kraj) ausgekreist ist und eine eigene Verwaltungseinheit auf Kreisebene darstellt. Sie hat einen Fläche von 789 km² mit 1,184 Mio. Einwohnern. 10. StR, 2001, S. 724. Praha hl. m. 2. Hauptstadt Prag 3. → Hlavní město Praha 7. Das Territorium der Hauptstadt ist in zehn Stadtbezirke eingeteilt, deren Einteilung und Benennung sich im Zuge der Eingemeindungen mehrfach geändert hat. Ein Stadt bezirk (oBezirk Lundenburg (Břeclav)d) entspricht in der Hierarchie einem Bezirk (okres) in einem Flächenkreis und nimmt im Zuge der Kommunalverwaltung gewisse Selbstverwaltungsaufgaben wahr. Es handelt sich um folgende Stadtbezirke: Praha 1 mit Hradčany (Hradschin, bzw. Burgbezirk), Malá Strana (Kleinseite), Josefov (Josefstadt) und Staré Město (Altstadt); Praha 2 mit Nové Město (Neustadt), Vyšehrad (Wyschehrad) und einem Teil der Weinberge (Vinohrad); Praha 3 mit Žižkov und dem anderen Teil der Weinberge (Vinohrad); Praha 4 mit Nusle, Pankrác (Pankraz), Podolí (Podol), Braník, Michle, Spořilov, Krč, Hodkovičky, Komořany, Točna, sowie Kunratice, Libuš, Modřany und Pisnice; Praha 5 mit Smíchov, Košíře, Motol, Jinonice, Zlichov, Radlice, Hlubočepy, Zadní Kopanina, sowie Velká Chuchle, Zličín, Řeporye, Slivenec, Radotín, Zbraslav (Königsaal), Lochkov; Praha 6 mit Dejvice, Bubeneč, Sedlec, Liboc, Ruzyně, Veleslavín, Vokovice, Břevnov, Střešovice, sowie řepy, Suchdol, Přední Kopanina; Praha 7 mit Holešovice, Bubny, Troja; Praha 8: Bobnice, Čimice, Kobylisy, Libeň, Karlín sowie Dablice; Praha 9 mit Prosek, Vysočany, Hloubětin, Hrdlořezy, Třeboradice sowie Letňany, Čakovice, Kbely, Vinoř, Běchovice, Klánovice und Praha 10 mit Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběblice, Hostivař sowie Petrovice Štěrboholy und Ubříněves. Pramenáč 1. Berg, Kreis Aussig (Ústecký kraj) 2. Bornhau 3. s.o. 7. Erhebung im Erzgebirge (Krušné hory), 911 m hoch, Bezirk Teplitz (Teplice). 10. AR, 1981, S. 132; ZLHN, 1987, S. 420. Prášilské jezero 1. See, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 2. Stubenbacher See Karsee im Böhmerwald (Šumava), Bezirk Klattau (Klatovy), in 1079 m Höhe gelegen, 3,72 ha Fläche, 14,9 m tief. 10. ČV 1, 1929, S. 135; OLTR, 1929, S. 450; HKK, 1960, S. 70; GČZ, 1965, S. 54; Duden WGN, 1966, S. 509; ČV I, 1, 1968, S. 377; Kunský, 1968, S. 53; AR, 1981, S. 132; ZLVTN, 1984, S. 224; TLAZ, 2001, S. 698. 7. Pratecká plošina, früher Pratec 2. Pratzer Hügelland 3. → Pracká pahorkatina 4. Pratzer Hochfläche 8. So benannt nach dem südmährischen Ort Pratze (Prace). 10. ČV I, 1, 1968, S. 737. Pratzer Hochfläche 2. Pratzer Hügelland 3. → Pracká pahorkatina 5. Pratecká plošina 8. So genannt nach dem südmährischen Ort Pratze (Prace, früher Pratec). Pratzer Hügelland 3. → Pracká pahorkatina 4. Pratzer Hochfläche 5. Pratecká plošina 8. So genannt nach dem südmährischen Ort Pratze (Prace, früher Pratec). Pravčická brána 1. Felsgebilde, Kreis Aussig (Ústecký kraj) 2. Prebischtor 3. s.o. 4. Reinwartsthor 5. Brána; Pravčická skalní brána; Prebišská brána; Velká brána 7. Felsgebilde im Elbsandsteingebirge (Děčínské stěny), großes natürliches Felsentor, beliebtes Ausflugsziel, Naturschutz, Bezirk Tetschen (Děčín). 10. Koláček, 1934, S. 43; HKK, 1960, S. 80; GČZ, 1965, S. 74; ČV I, 1, 1968, S. 343; ZLHN, 1987, S. 420; Gorys, 1994, S. 289; Baedeker, 2000, S. 126. Pravčická skalní brána 2. Prebischtor 3. → Pravčická brána 4. Prebisch-Felsentor (wörtl.) 10. Kunský, 1968, S. 332. Pražská kotlina 1. GME-7, Becken, Mittelböhmischer Kreis (Středočeský kraj) 2. Prager Becken 3. s.o. 4. Prager Moldautal 7. Geomorphologische Teileinheit in der Prager Hochfläche (Pražská plošina). 8. So benannt nach der Hauptstadt Prag (Hlavní Město Praha). 10. Hromádka, 1956, S. 286; HKK, 1960, S. 74; GČZ, 1965, S. 166; ČV I, 1, 1968, S. 497; Kunský, 1968, S. 112; GeoKr, 1984, S. 43; ZLHN, 1987, S. 420, Nr. VA-2A-d; TLAZ, 2001, S. 700. Pražská plošina 1. GME-5, Hochfläche, 1.126 km2, Mittelböhmischer Kreis (Středočeský kraj) 2. Prager Hochfläche 3. s.o. 4. Prager Tafelland; Schlan-Prager Hochfläche 5. Pražská tabule 7. Geomorphologische Haupteinheit im Brdywald-Untersystem (Brdská podsoustava). 2 Untereinheiten: Ritschaner Hochfläche (Říčanská plošina) und Kladnoer Tafelland (Kladenska tabule). 8. So benannt nach der Hauptstadt Prag (hl. m. Praha), Hauptstadt Prag (hl. m. Praha). 10. Novák, 1947, S. 247; Kuchař, 1955, S. 62; Hromádka, 1956, S. 286; HKK, 1960, S. 59; GČZ, 1965, S. 37; NA, 1966, Kt. 10,2; ČV I, 1, 1968, S. 359; Kunský, 1968, S. 230; ČSSt, 1971, S. 22; GČ, 1972, S. 71; OTS, 1975, S. 45; GeoKr, 1984, S. 43; ZLHN, 1987, S. 421, Nr. VA-2; VGJ, 1996, S. 32; Stani-Fertl, 2001, S. 271; TLAZ, 2001, S. 701. Pražská tabule 2. Prager Hochfläche 3. s.o. 4. Prager Tafelland (wörtl.), Schlan-Prager Hochfläche 8. So benannt nach der Hauptstadt Prag (Hlavní Město Praha). 10. ČV I, 1, 1968, S. 456. Pražsko 1. Historische Kulturlandschaft 4. Prager Gau 5. Hlavní Město Praha, Hauptstadt Prag (hl. m. Praha) 7. Es handelt sich um das historische Umland der tschechischen Hauptstadt Prag (Hlavní Město Praha), Hauptstadt Prag (hl. m. Praha), 1,181 Mio. Einwohner (2000), bzw. um das heutige städtisch verbaute Territorium Prags, seiner Vororte und Satellitenstädte mit Einzugsgebiet. Die exponierte Lage Prags im Zentrum des Landes trug wesentlich zu seiner Entwicklung zu einer europäischen Metropole bei. Die ersten Spuren menschlicher Besiedelung reichen bis in die Steinzeit zurück; im nordwestlichen Teil des Stadtgebietes befindet sich ein neolithischer Siedlungsplatz, der in das 4. Jt. zurückreicht. Die keltischen Bojer errichteten im 4. Jahrhundert v. Chr. einen mächtigen Burgwall am heutigen Stadtrand (Hradiště bei Zawist / Závisť). In diesem Bereich entwickelten sich die Ansiedlungen aus dem später Prag entstand. Das Becken (Pražská kotlina) inmitten einer Hochfläche (Pražská plošina) zeichnete den Gang der Besiedlung vor. Den Kelten folgten germanische Stammesverbände, die Markomannen, auch Thüringer und Langobarden. Die ersten Slawen drangen im 6. Jahrhundert in das Prager Becken ein und übten in der fruchtbaren Beckenlandschaft eine ackerbauliche Tätigkeit aus. Zwischen den Burgen Hradschin (Hradčany) und Wischegrad (Vyšehrad) sollen sich 40 Höfe befunden haben. Beschleunigt wurde die Entwicklung durch die Christianisierung. 973 wurde hier das Bistum für Böhmen gegründet. Fürst Bořivoj aus dem Haus der Přemysliden und ein Vasall des Großmährischen Königs Svatopluk empfing hier seine Taufe und errichtete die erste christliche Kirche. Die Ansiedlung im Suburbuim glich sich Burg an und erwuchs zum „romanischen Prag“, über das der jüdisch-arabische Kaufmann Ibrahîm Ibn Jukûb 965 zu berichten wußte, daß die Stadt „aus Stein und Kalk“ erbaut war. An weiteren Zeugnissen fehlt es nicht: 929 (Henricus rex ... Pragam adiit cum omni exercitu ... ), 967/85 (Pragam, Boemiae civitatem), 993 (ad civitatem Pragam) bis hin zu 1318 (Die richter vnd scheffen von Prag ... in vnser stat ze Prag). 1334 (datum in Pragis), 1375 (na pazye), 1414 (w prazie). 9. An der slawischen Herkunft des Namens dürften keine Zweifel bestehen, doch ist die Interpretation durchaus unterschiedlich. Die einen leiten es von einer Schwelle (práh) im Untergrund der Moldau (Vltava) ab, andere bringen es mit „rösten“ (pražití) in Verbindung. Hauptsitz des přemyslidischen Feudalstaates war die eine Funktion, Handelsstadt die andere, wozu die deutsche Kaufmannskolonie an der Teynkirche nicht wenig beitrug. Schon unter den Přemysliden entwickelte sich die Stadt günstig, wozu auch einige Ordensniederlassungen beitrugen. Die Altstadt (Staré Město) war das erste Zentrum. 1257 gründete König Přemysl Otakar II. am Fuße der Burg (Hradčany) eine neue Stadt, die später Minor civitas Pragensis (Kleinere Stadt, Kleinseite) genannt wurde. Hier galt im Unterschied zur Altstadt das Nürnberger Recht. Auch die jüdische Siedlung hatte den Charakter einer eigenen Gemeinde und war entsprechend privilegiert. Den stärksten Entwicklungsschub erfuhr Prag im 14. Jahrhundert in der Regierungszeit Karls IV., der Prag zum Mittelpunkt seines Reiches und zu einer Metropole von europäischem Format erhob. Vor allem die planmäßige Anlage der Neustadt (Nové Město) muß hier genannt werden. Die beiden Plätze, der Viehmarkt (Václavské náměstí) und der Karlsplatz (Karlovovo náměstí) müssen hier genannt werden, denn auch die Karlsbrücke (Karlův most), die Peter Prler erbaute. 1348 wurde in Prag die erste Universität nördlich der Alpen gegründet. Alles zusammen war dies die gotische Stadt, das „goldene Prag“. Mit 35.000 bis 50.000 Einwohnern war Prag am Ende des Mittelalters eine Großstadt, in der drei Nationen auskömmlich miteinander lebten, Tschechen, Deutsche und Juden. Gleichwohl ist es nicht möglich, die Nationalitätenverhältnisse zu berechnen, vielmehr kann man nur die jeweilige Bedeutung ermessen, wobei man feststellen muß, daß die deutschen Familien sehr einflußreich waren, die Tschechen aber an Bedeutung stetig zunahmen. Diese Tendenz wird verstärkt durch die Hussiten, die auf Grund des ihnen zugefügten Unrechts dem Deutschenhaß den Weg bereiteten. Einen zweiten Höhepunkt (das „silberne“ Prag) erlebte die Stadt unter Kaiser Rudolf II., dessen Hof im Stil der Renaissance zu einem Anziehungspunkt für Künstler und Gelehrte aus ganz Europa wurde. Auch die Bautätigkeit hörte nie auf. Die Anhänger der Lehre Luthers gewannen im 16. Jahrhundert zunehmend Einfluß. Mit der 2. Prager Defenestration (Fenstersturz) begann 1618 der Dreißigjährige Krieg, der Böhmen ein neues Gesicht gab. Zahlreiche nichtkatholische Familien mußten in die Emigration gehen, andere fielen Epidemien zum Opfer, der Hof einschließlich der Böhmischen Hofkanzlei zog um nach Wien. Die Rekatholisierung ging einher mit der Barockisierung. 1284 erließ Kaiser Josef II. ein Patent, das alle vier bislang noch getrennten Prager „Städte“ zu einer einheitlich verwalteten Stadt verband. Wenn auch Prag jetzt eine österreichische Provinzhauptstadt war, so erfolgte nun ein neuer wirtschaftlicher Aufschwung durch die einsetztende Manufakturperiode. Im Vorfeld der barocken Befestigungsanlagen entstanden neue Vorstädte und Produktionsanlagen. Prag war der natürliche Eisenbahnmittelpunkt Böhmens, die Großindustrie wuchs stürmisch, eine massenhafte Zuwanderung erfolgte. Die bürgerliche Revolution des Jahres 1848 ermunterte das patriotische tschechische Bürgertum, die Stadt in ihrem Sinne zu modernisieren. Repräsentative Monumentalbauten wie das Nationaltheater, Nationalmuseum, Rudolfinum u.a.m. gaben dem gewandelten gesellschaftlichen Leben das äußere Gepräge. Mit der Industrialisierung ging die Tschechisierung einher. Nach der Jahrhundertwende fiel der Anteil der Prager Deutschen auf 6,1 % zurück, etwa ein Viertel dann waren Juden. Gleichwohl war Prag Zentrum auch einer deutschen Kultur. Die bauliche Gestaltung der einzelnen Stadtquartiere zeigt eine große Spannweite zwischen eintönigen Mietskasernen bis zu vornehmen Geheimratsvierteln. Die Verstädterung ergriff auch das gesamte Umland, zahlreiche Verkehrsmittel mußten die Pendelwanderer einschließlich der Fahrschüler in die Innenstadt und wieder zurück in ihre Wohngemeinden transportieren. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges war Prag zu einer der größten Städte der österreichisch-ungarischen Monarchie angewachsen. Am 14. Oktober 1918 wurde unter dem Jubel der Prager Bevölkerung die tschecho-slowakische Republik ausgerufen, Prag wurde Hauptstadt und Tomáš G. Masaryk erster Präsident der Republik. Um 1940 wurde die Millionen-Grenze erreicht; vor allem Beamte und weitere staatliche Funktionsträger zogen zu. Durch eine Verwaltungsreform wurde Groß-Prag geschaffen und der gesamte Siedlungsraum neu organisiert. Auch die Republik und die Wirtschaft waren bestrebt, ihre Bedeutung durch neue repräsentative Bauwerke zu unterstreichen. Im März 1939 wurde Prag Opfer der hitlerschen Expansionspolitik, und mit dem Eintreffen der ersten Verbände der deutschen Wehrmacht wurde das Protektorat Böhmen und Mähren errichtet, dessen Verwaltung hier ihren Sitz nahm. Unter schweren Luftangriffen mußte Prag nicht leiden, dafür verursachte die Demütigung der tschechischen Bevölkerung, namentlich der Intelligenz, eine Stimmung, welche die Austreibung der deutschen Bevölkerung 1945 beschleunigte und das Verhältnis zwischen den Völkern für Generationen belastete. Nach der Befreiung durch die Sowjetarmee im Mai 1945 wurde Prag wiederum Hauptstadt der Republik, die sich bald als eine „sozialistische Republik“ darstellte. Neue Siedlungen (Plattenbauten) waren die Folgen weiteren Zuzugs, verursacht durch Konzentration der Industrie und der Verwaltungsfunktionen. Weitere Eingemeindungen wurden vorgenommen. Der „Prager Frühling“ im Jahre 1968 war nicht in der Lage, den „Sozialismus mit dem menschlichen Gesicht“ zu erzeugen. Gleichzeitig mit der Revolution in Ostdeutschland 1989/90 schüttelten auch die tschechischen Intellektuellen und Arbeiter das sozialistische Zwangsjoch ab. Mit dem Beginn des Jahres 1993 zerfiel die Doppelrepublik und zwei neue Staaten - die Tschechische Republik und die Slowakische Republik - traten ins Leben. Prag wurde Hauptstadt der Tschechischen Republik und Sitz der obersten Staatsorgane, Václav Havel wurde zum ersten Präsidenten gewählt. Der Fall des Eisernen Vorhangs und die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft machten Prag zu einer Metropole von neuem Format, die einen wichtigen Beitrag zur europäischen Kultur leistet. 10. Schaller X, 1788, S. 76; Rieger 7, 1868, S. 770; OSN 20, 1903, S. 317; OLTR, 1927, S. 448; MJČ III, 1951, S. 452; Schwarz, 1961, S. 290; Kunský, 1968, S. 115; Sperling, 1981, S. 288; TLČS, 1983, S. 179; ZJČ, 1983, S. 244; SLL, 1985, S. 353; RBL, 1989, S. 346; Gorys, 1994, S. 39; LŠ, 1997, S. 212; HHStBM, 1998, S. 470; Baedeker, 2000, S. 219; StR, 2001, S. 56; TLAZ, 2001, S. 676. Pražský (východ) okres 1. Verwaltungseinheit 2. Bezirk Prag-Ost (Praha-východ) 5. Pražsko 7. Bezirk (entspr. Landkreis) im Mittelböhmischen Kreis (Středočeský kraj). Fläche 584 km2, 94.600 Bewohner, 162 Einwohner/km², 91 Gemeinden. 10. StR, 2001, S. 56. Pražský (západ) okres 1. Verwaltungseinheit 2. Bezirk Prag-West (Praha-západ) 5. Pražsko 7. Bezirk (entspr. Landkreis) im Mittelböhmischen Kreis (Středočeský kraj). Fläche 586 km2, 81.100 Bewohner, 136 Einwohner/km², 80 Gemeinden. 10. StR, 2001, S. 56. Prebischtor 3. → Pravčická brána 5. Pravčická skalní brána; Prebišová brána; Prebišská brána 10. ARCL 2, 1866, S. 891; Krejčí, 1878, S. 443; OSN 6, 1893, S. 20; WWB Böhmen I, 1894, S. 90; Sueß, 1903, S. 176; Schneider, 1908, S. 189; SSJ, 1920, S. 197; Machatschek, 1927, S. 278; OLTR, 1927, S. 450; Gorys, 1994, S. 289; Baedeker, 2000, S. 126. Prebischtorplateau 7. Teileinheit im Elbsandsteingebirge (Děčínské stěny) 10. Moscheles, 1920, S. 54. Prebišová brána 2. Prebischtor 3. → Pravčická skalní brána 4. Reinwartstor 10. Krejči, 1878, S. 443. Prebišská brána 2. Prebischtor 3. → Pravčická brána 10. OSN 6, 1893, S. 20. Předhoří Českeho lesa 2. Hügelland vor dem Oberpfälzer Wald 3. → Podčeskoleská pahorkatina 4. Vorland des Oberpfälzer Waldes 5. Chodský úval 10. Kuchař, 1955, S. 62; Blažek, 1959, S. 240; OTS, 1975, S. 45. Přední Žalý 1. Berg; Kreis Reichenberg (Liberecký kraj) 2. Heidelberg 3. s.o. 7. Erhebung im Riesengebirge (Krkonoše / Karkonosze). 1019 m hoch, Bezirk Semil (Semily). 10. KR, 1985, S. 156; ZLHN, 1987, S. 423; Baedeker, 2000, S. 264; TLAZ, 2001, S. 708. Přehradní nádrž Brno 2. Brünner Talsperre 3. → Brněnská přehradní nádrž 8. So benannt nach der mährischen Landeshauptstadt Brünn (Brno), am Fluß Swratka (Svratka). Přehradní nádrž Ejpovice 2. Eipowitzer Talsperre 3. → Ejpivická přehradní nádrž 8. So benannt nach dem westböhmischen Ort Eipowitz (Ejpovice), Bezirk Rokitzan (Rokycany). 10. Fričová, 1974/75, S. 308. Přehradní nádrž Fláje 2. Fleyher Stausee 3. → Flájská přehradní nádrž 8. So benannt nach dem nordböhmischen Ort Fleyh (Fláje), Bezirk Brüx (Most). 10. Fričová, 1974/75, S. 308; TLAZ, 2001, S. 193. Přehradní nádrž Horka 2. Berger Stausee 3. → Horská přehradní nádrž 8. So benannt nach dem westböhmischen Ort Berg (Horka), Bezirk Karlsbad (Karlovy Vary). 10. Fričová, 1994/95, S. 308. Přehradní nádrž Hrachokusky 2. Raklouser Talsperre 3. → Hracholuská přehradní nádrž 8. So benannt nach dem westböhmischen Ort Raklous (Hracholusky), Bezirk Pilsen-Nord (Plzeň-sever). 10. Fričová, 1974/75, S. 308; ČSAZ, 1983, S. 141; TLAZ, 2001, S. 249. Přehradní nádrž Jesenice 2. Graßnitzer Stausee 3. → Jesenická přehradní nádrž 8. So benannt nach dem westböhmischen Ort Graßnitz (Jesenice), Bezirk Eger (Cheb). 10. ČSAZ, 1983, S. 176; Baedeker, 2000, S. 121; TLAZ, 2001, S. 708. Přehradní nádrž Jirkov 2. Görkauer Stausee 3. → Jirkovská přehradní nádrž 8. So benannt nach der nordböhmischen Stadt Görkau (Jirkov), Bezirk Komotau (Chomoutov). 10. Fričová, 1974/75, S. 308. Přehradní nádrž Kadaň 2. Kadener Stausee 3. → Kadaňská přehradní nádrž 5. Vodní nádrž Kadaň 8. So benannt nach der nordböhmischen Stadt Kaden (Kadan), Bezirk Komotau (Chomoutov). 10. Fričová, 1974/75, S. 308. Přehradní nádrž Kličava 2. Klíčava-Talsperre 3. → Klíčavská přehradní nádrž 8. So benannt nach dem Ortsteil Klíčava, Bezirk Rakonitz (Rakovník). 10. Fričová, 1974/75, S. 308. Přehradní nádrž Kamýk n.V. 2. Wildberger Talsperre 3. → Kamýcká přehradní nádrž 8. So benannt nach dem mittelböhmischen Ort Wildberg (Kamýk nad Vltavou), Bezirk Přibram. 10. Fričová, 1974/75, S. 308. Přehradní nádrž Křimov 2. Krima-Stausee 3. → Křimovská přehradní nádrž 8. So benannt nach dem nordböhmischen Ort Krima (Křimov), Bezirk Komotau (Chomoutov). 10. Fričová, 1954/55, S. 308. Přehradní nádrž Křižanovice 2. Křižanowitzer Talsperre 3. → Přehradní nádrž Křižanovice 8. So benannt nach dem ostböhmischen Ort Křizanovitz (Křižanovice), Bezirk Neuhaus (Jindřichův Hradec). 10. Fričová, 1974/75, S. 308. Přehradní nádrž Kružberk 2. Kreuzberger Stausee 3. → Kružberská přehradní nádrž 10. Fričova, 1974/75, S. 308; TLAZ, 2001, S. 430. Přehradní nádrž Lipno 2. Lippener Stausee 3. → Lipenská přehradní nádrž 4. Moldau-Stausee 10. Fričová, 1974/75, S. 308. Přehradní nádrž Moravka 2. Morawka-Stausee 3. → Moravská přehradní nádrž 8. So benannt nach dem Flüßchen Moravka, Bezirk Friedek-Mistek (Frýdek-Místek). 10. Fričová, 1974/75, S. 309. Přehradní nádrž Mostišťě 2. Mostischter Talsperre 3. → Mostišťská nádrž přehradní 5. Mostišťská údolní nádrž 8. So benannt nach dem ostböhmischen Ort Mostischt (Mostišť), Bezirk Saar (Žďár nad Sázavou). 10. Fričová, 1974/75, S. 309. Přehradní nádrž Nechranice 2. Negranitzer Stausee 3. → Nechranická přehradní nádrž 8. So benannt nach dem nordwestböhmischen Ort Negranitz (Nechranice), Bezirk Komotau (Chomoutov). 10. Fričová, 1974/75, S. 308; TLAZ, 2001, S. 568. Přehradní nádrž Nýrsko 2. Neuerner Stausee 3. → Nýrská přehradní nádrž 8. So benannt nach der westböhmischen Stadt Neuern (Nyrsko), Bezirk Klattau (Klatovy). 10. Fričová, 1974/75, S. 308. Přehradní nádrž Olešna 2. Olešna-Stausee 3. → Olešenská přehradní nádrž 8. So genannt nach dem Flüßchen Olešna, Bezirk Friedek-Mistek (Frýdek-Místek). 10. Fričová, 1974/75, S. 309. Přehradní nádrž Přísečnice 2. Preßnitzer Stausee 3. → Přísenická přehradní nádrž 8. So benannt nach dem untergegangenen westböhmischen Ort Presnitz (Přísečnice), Bezirk Karlsbad (Karlovy Vary). 10. Fričová, 1974/75, S. 308. Přehradní nádrž Šance 2. Stausee Šance (Schanze) 3. → Šancký přehradní nádrž 10. Fričová, 1974/75, S. 308. Přehradní nádrž Seč 2. Sečer Talsperre 3. → Sečská přehradní nádrž 5. Vodní nádrž Seč 8. So benannt nach dem ostböhmischen Ort Seč, Bezirk Neuhaus (Jindřichův Hradec). Přehradní nádrž Skalka 2. Steiner Egerstausee 3. → Skalská přehradní nádrž 8. So genannt nach dem westböhmischen Ort Stein (Skalka), Bezirk Eger (Cheb). 10. Fričová, 1974/75, S. 308; TLAZ, 2001, S. 778. Přehradní nádrž Slapy 2. Slapy-See 3. → Slapská přehradní nádrž 8. So benannt nach dem mittelböhmischen Ort Slap (Slapy), Bezirk Prag-West (Prahazápad). 10. Fričova, 1974/75, S. 308. Přehradní nádrž Suchomasty 2. Suchomaster Talsperre 3. → Suchomastský přehradní nádrž 8. So benannt nach dem mittelböhmischen Ort Suchomast (Suchomasty), Bezirk Beraun (Beroun). 10. Fričová, 1974/75, S. 308; TLAZ, 2001, S. 833. Přehradní nádrž Těrlicko 2. Terlitzer Stausee 3. → Terlická přehradní nádrž 8. So benannt nach dem Ort Terlitz (Terlicko), Bezirk Karwin (Karviná). 10. Fričová, 1974/75, S. 309. Přehradní nádrž Vír (I + II) 2. Wührer Talsperre 3. → Vírská přehradní nádrž Vodní nádrž Vír So benannt nach dem südmährischen Ort Wühr (Vír), Bezirk Saar (Žďár nad Sázavou), am Fluß Swratka (Svratka). 10. Fričova, 1974/75, S. 308; ČSAZ, 1983, S. 533. 5. 8. Přehradní nádrž Vranov nad Dyjí 2. Thaya-Talsperre 3. → Vranovská přehradní nádrž 5. Vodní nádrž Vranov nad Dyjí 8. So benannt nach der südmährischen Stadt Frain (Vranov nad Dyje), Bezirk Znaim (Znojmo). 10. Fričova, 1974/75, S. 308; ČSAZ, 1983, S. 542. Přehradní nádrž Žermanice 2. Žermanitzer Stausee 3. → Žermanická přehradní nádrž 8. So benannt nach dem nordmährischen Ort Žermanitz (Žermanice), Bezirk FriedekMistek (Frýdek-Místek). 10. Fričová, 1974/75, S. 309. Přehradní nádrž Žlutice 2. Luditzer Stausee 3. → Žlutická přehradní nádrž 8. So benannt nach der westböhmischen Stadt Luditz (Žlutice), Bezirk Karlsbad (Karlovy Vary). 10. Fričova, 1974/75, S. 308. Přeloučsko 1. Historische Kulturlandschaft, Kreis Pardubitz (Pardubický kraj) 7. Umgebung der ostböhmischen Stadt Přelauč (Přelouč), Bezirk Pardubitz), 8.806 Einwohner (1.1.2003), liegt am linken Ufer der Elbe (Labe) im Pardubitzer Becken (Pardubická kotlina). Es handelt sich um früh besiedeltes Gebiet im slawischen Altsiedelland, das letzten Endes auch wegen seiner Verkehrslage von Interesse war. Frühe Nennungen: 1073 (Priluche villam), 1229 (Przellucssie dedimus monio Opatowic.), 1261 (civitatem Bredlucz hodie Przelaucz), 1318 (Sczepan de Przieluczie), 1357 (Hroch de Przyelucz), 1377 (de Przelucz), 1380 (Jacobus presb. de Przieluczie), 1463 (mčko Přelučie), 1494 (mčko Přeloučí), 1654 (Przelaucž). Die Gründung muss in Verbindung mit Benediktinerkloster Opatowitz (Opatovice) gesehen werden. König Přemysl Otakar II. verlieh 1261 das Stadtprivileg mit dem Magdeburger Recht. Wechselvolle Geschichte in der Hussitenzeit. Im 17. und 18. Jahrhundert wirtschaftliche Stagnation. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Přelouč dank seiner Lage an der Eisenbahnlinie von Prag nach Olmütz (Olomouc) zu einem bedeutenden Wirtschaftszentrum ausgebaut. Verschiedene Fabriken nutzten die günstigen Standortqualitäten: Landmaschinen, Zement, Zuckerfabrik. Der Gerichtsbezirk Přelauč im damaligen politischen Bezirk Prachatitz umfasste 1927 eine Fläche von 220 km² mit 46 Gemeinden (62 Ortschaften) und 23.500 Einwohnern, davon 99,5 % Tschechen. 1939 Protektoratsverwaltung. Nach dem Zweiten Weltkrieg weitere Industrialisierung. 10. RGL 2, 1883, S. 432; OSN 20, 1902, S. 624; OLTR, 1927, S. 452; MJČ, 1951, S. 465; Schwarz, 1966, S. 294; ZJČ, 1982, S. 247; ČSAZ, 1983, S. 393; LŠ, 1997, S. 215; HHStBM, 1998, S. 491; TLAZ, 2001, S. 709. Přerovsko 1. Historische Kulturlandschaft, Kreis Olmütz (Olomoucký kraj) 7. Historisches Umland der mittelmährischen Stadt Prerau (Přerov), Bezirk Prerau (Přerov), 47.582 Einwohner (1.1.2003). Die Siedlung entstand da, wo ein wichtiger Handelsweg das Tal der Betschwa (Bečva) quert. Im nahen Předmostí wurden beachtliche altsteinzeitliche Funde geborgen. Erste Nennungen: 12. Jh. (Prerov), 1131 (ad Prerouensem ecclesiam), 1174 (de Prerou), 1222 (castellanus Prerouiensis), 1256 (in Prerow), 1550 (z města Przerowa), usw. Beispielsweise wirkte Johann Amos Comenius (Komenský) an der dasigen Lateinschule, der von den Herren von Žerobín gefördert wurde. Schon 1841 erreichte die Kaiser-Ferdinands-Nordbahn die Stadt, wo sich alsdann ein bedeutender Bahnknotenpunkt entwickelte. Nach dem Zwischenspiel im Protektorat Böhmen und Mähren entwickelte sich Přerov nach 1945 zu einer recht bedeutenden Industriestadt. Durch die Verwaltungsreform von 1949 wurde Prerau wieder Sitz einer Bezirksverwaltung und blieb dies auch nach 1960, wobei der Bezirk erheblich vergrößert wurde. Der politische Bezirk Prerau, bestehend aus den Gerichtsbezirken Kojetein und Prerau, umfaßte 1927 eine Fläche von 450 km² mit 85 Gemeinden (92 Ortschaften) mit 78.200 Einwohnern, davon 96,7% tschechisch. 10. Wolny I, 1835, S. 398; Rieger 7, 1868, S. 920; RGL 2, 1882, S. 433; OSN 20, 1903, S. 637; OLTR, 1927, S. 452; ČV 1, 1929, S. 46; Schwarz, 1961, S. 341; Schwarz, 1966, S. 111; ČV I, 1, 1968, S. 662; ZJH, 1982, S. 248; ČSAZ, 1983, S. 394; TLČS, 1983, S. 184; LŠ, 1987, S. 215; RBL, 1989, S. 355; HHStBM, 1998, S. 492; StR, 2001, S. 58; TLAZ, 2001, S. 709. Přerovský okres 1. Verwaltungseinheit 2. Bezirk Prerau (Přerov) 7. Bezirk (entspr. Landkreis) im Kreis Olmütz (Olomouc). Fläche 884 km2, 136.300 Bewohner, 154 Einwohner/km², 104 Gemeinden. 10. StR 2000, S. 57. Přesauer Platte 7. Verebnung am Rande des Brüxer Beckens (Mostecká pánev). 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Presau (Přeskaky), Bezirk Komotau (Chomoutov). 10. Engelmann, 1922, S. 29. Přesauer Rücken 3. → Přeskacký hřbet 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Přesau (Přeskaky), Bezirk Komotau (Chomoutov). Preseka 1. Historischer Grenzverhau; Hochland-Kreis (Kraj Vysočina) 7. Die Preseka war eine historische Grenzanlage, die am Westrand der BöhmischMährischen Höhe (Českomoravská vrchovina) verlief und die Länder Böhmen und Mähren voneinander trennte. Im Unterholz der Wälder wurden die Zweige des Unterholzes geknickt und miteinander verflochten, so daß ein undurchdringliches Dihischt mit nur wenigen kontrollierbaren Durchlässen entstand. Seit dem 13. Jahrhundert schritt die Kolonisation voran und beide Länder näherten sich einander an, so daß die Grenzanlage überflüssig wurde. 8. Der Name ist abgeleitet von tschechisch „přesekati“ (= entzwei-, zer-, aushauen, roden). 10. Kuller, 1975, S. 12. Přeskacké vrchy 2. → Přesauer Rücken 8. So benannt nach dem nordböhmischen Ort Přesau (Přeskaky), Bezirk Komotau (Chomoutov). 10. ČV I, 1, 1968, S. 720. Přeskacký hřbet 2. Přesauer Rücken 3. s.o. 4. Přesauer Berge (wörtl.) 5. Přeskacké vrchy 8. So benannt nach dem nordböhmischen Ort Přesau (Přeskaky), Bezirk Komotau (Chomoutov). 10. ČV I, 1, 1968, S. 720. Přeštická kotlina 2. Přestitzer Becken 8. So benannt nach der westböhmischen Stadt Přestitz (Přestice), Bezirk Pilsen-Süd (Plzeň-jih). 10. GČZ, 1965, S. 150. Přešticko 1. Historische Kulturlandschaft; Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 7. Umland der westböhmischen Stadt Přestitz (Přeštice), Bezirk Pilsen-Süd (Plze-jih), 6.360 Einwohner (1.1.2003), im Schwihauer Bergland (Švihovská vrchovina). Die Siedlung entwickelte sich als Marktsiedlung am Ufer der Angel (Úhlava), wo ein wichtiger Handelsweg von Pilsen (Plzeň) nach Süden führt. Frühe Nennungen: 1226 (Zwatobor de Pressic), 1233 (Suatobor de Preseich ... Zvatoborius de Prestitz), 1238 (pro circuitu Prezchic), 1239 (Preschic), 1360 (eccl. in Prziesticz), 1405 (Prziesstycz), 1460 (v Przessticzich), 1654 (miesta Pržessticze). Der Ort liegt im Gebiet des slawischen Ausbaus am Rande des Altsiedellandes, noch im 19. Jahrhundert prägte die Landwirtschaft das wirtschaftliche Leben. Eine ansehnliche, 1750/75 erbaute Barockkirche zeugt von dem Reichtum, der sich hier angesammelt hatte. Erst in dieser Zeit erhielt Přeštitz endgültig den Status einer Stadt. Der politische Bezirk Přestitz, bestehend aus den Gerichtsbezirken Nepomuk und Přestitz, umfaßte 1927 eine Fläche von 518 km³ mit 103 Gemeinden (125 Ortschaften) und 45.300 Einwohnern. Die Mehrheit der Bewohner bekannte sich stets zur tschechischen Nationalität, so daß Přestitz 1939 zum Protektorat kam. Durch die Verwaltungsreform von 1949 wurde Přeštitz wieder Sitz einer Bezirksverwaltung, blieb dies aber nur bis 1960. 10. RGL 2, 1883, S. 434; OSN 20, 1903, S. 654; OLTR, 1927, S. 453; MJČ III, 1951, S. 471; Schwarz, 1965, S. 148; ČSAZ, 1983, S. 395; GeoKr, 1984, S. 123; TLAZ, 2001, S. 710. Přestitzer Becken 3. → Přestická kotlina 5. Dobřanská kotlina 8. So genannt nach der westböhmischen Stadt Přestitz (Přestice), Bezirk Pilsen-Süd (Plzeň-jih). Preßnitzer Bergland 3. → Přísečnická hornatina 5. Přísečnická planina; Přísečnické pohoří 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Preßnitz (Přísečnice), Bezirk Komotau (Chomoutov). Preßnitzer Gebirge 2. Preßnitzer Bergland 3. → Přísečnická hornatina 5. Přísečnická planina; Přísečnické pohoří (wörtl.) 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Preßnitz (Přísečnice), Bezirk Komotau (Chomoutov). Preßnitzer Hochfläche 2. Preßnitzer Bergland 3. → Přísečnická hornatina 5. Přísečnická planina (wörtl.); Přísečnické pohoří 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Preßnitz (Přísečnice), Bezirk Komotau (Chomoutov). Preßnitzer Paß 1. Ehemaliger Paß; Kreis Aussig (Ústecký kraj) / D-Sachsen 7. Übergang über das Erzgebirge (Krušné hory) in 815 m Höhe, seit 1945 geschlossen. 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Preßnitz (Přísečnice), Bezirk Komotau (Chomoutov). 10. Friedrich, 1912, S. 88. Preßnitzer Stausee 3. → Přísečnická přehradní nádrž 5. → Vodní nádrž Přísenčnice 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Preßnitz (Přísečnice), Bezirk Komotau (Chomoutov). Preußischer Kamm 2. Hauptkamm (des Riesengebirges) 3. → Slezský hřbet 4. Schlesischer Kamm 6. Grzbiet Głowni (poln.); Grzbiet Śląski (poln.) 10. OLTR, 1927, S. 479. Příborská pahorkatina 1. GME-6, Hügelland, Mährisch-Schlesischer Kreis (Moravskoslezský kraj), 355 km2 2. Freiberger Hügelland 3. s.o. 7. Geomorphologische Untereinheit im Vorhügelland der Beskiden (Podbeskydská pahorkatina). 8 Teileinheiten: Helštýnska vrchovina, Hluzovská pahorkatina, Libhošťská pahorkatina, Novojčínská pahorkatina, Palačovská brázda, Palkovické podhůří, Stařičská pahorkatina, Valašskomeziřicská kotlina. 8. So benannt nach der nordmährischen Stadt Freiberg (Příbor), Bezirk Neutitschein (Nový Jičín). 10. GČZ, 1965, S. 224; ČV I, 1, 1968, S. 744; ČSSt, 1971, S. 23; GČ, 1972, S. 87; ZLHN, 1987, S. 424, Nr. IXD-1C. Příborsko 1. Historische Kulturlandschaft; Mährisch-Schlesischer Kreis (Moravskoslezský kraj) 7. Umland der nordmährischen Stadt Freiberg (Příbor), Bezirk Neutitschein (Nový Jičín), im Vorland der Beskiden (Podbeskydská pahorkatina), 8.750 Einwohner (1.1.2003). Es handelt sich um eine typische Stadt der deutschen Ostkolonisation. Frühe Nennungen: 1251 (in Vriburch), 1294 (de Fryburk), 1297 (de Briburch, de Vriburch), 1307 (de Prsybor), 1327 (in Freiburg), 1359 (oppidum Vreyburg), 1360 (Marquard de Przibor), 1400 (Freyberg), 1403 (in Prziebor), 1520 (faráři prziborskemu), 1581 (město Pržibor), 1593 (z města Przybora), 1617 (Stadt Freiberg), 1633 (Freiberg, Přibor), 1720 (Freyberg, Przibor), 1846 (Freiberg, Přibor). Freiberg gilt als die älteste Stadt Nordmährens; sie wurde 1250 nach Leobschützer Recht, also von Schlesien her gegründet. Der rechteckige Ringplatz zeigt gotische Züge und wurde im 17. Jahrhundert durch Laubengänge barockisiert. Hussitische und brüderische Elemente wurden bald unterdrückt. Das ländliche Umland mit regelhaften Waldhufensiedlungen wurde durch die Industrialisierung schon im 19. Jahrhundert überformt. Mit seinem Piaristenkolleg blieb Freiberg Bildungsmittelpunkt für ein größeres Umland, im 18. Jahrhundert galt Freiberg als Zentrum der mährischen Aufklärung. Im 19. Jahrhundert bahnte sich die Entwicklung zur Industriestadt an. Es gab Strumpf- und Hutmanufakturen sowie Metallverarbeitung, namentlich in Verbindung mit dem nahen Nesselsdorf (Kopřivnice). Berühmte Söhne der Stadt sind die Historiker Gregor Wolny und Berthold Bretholz sowie der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud, welcher der nicht unbedeutenden jüdischen Gemeinde entstammte. Vor den Weltkriegen war das Umland fast rein deutsch, in der Stadt gab es eine tschechische Mehrheit. Der Gerichtsbezirk Freiberg im damaligen politischen Bezirk Chotěboř umfasste 1927 eine Fläche von 141 km² mit 23 Gemeinden (28 Ortschaften) und 25.700 Einwohnern, davon 72 % tschechisch. Nach der Besetzung durch die Deutsche Wehrmacht im Oktober 1938 kamen Stadt und Umland zum Sudetengau. 10. Wolny I, 1835, S. 171; RGL 1, 1883, S. 557; OLTR, 1927, S. 454; Schwarz, 1961, S. 285; Schwarz, 1966, S. 415; Hosák/ Šrámek II, 1980, S. 323; ZJČ, 1982, S. 249; ČSAZ, 1983, S. 396; TLČS, 1983, S. 185; GeoKr, 1984, S. 211; RBL, 1989, S. 114; LŠ, 1997, S. 216; Baedeker, 2000, S. 200; TLAZ, 2001, S. 711. Příbramer Erzrevier 3. → Přibransko 8. So genannt nach der Stadt Pibranz (Přibram), Bezirk Přibram. 10. Moscheles, 1921, S. 74. Pribramer Hügelland 3. → Příbramská pahorkatina 8. So genannt nach der mittelböhmischen Stadt Příbram, Bezirk Přibram. Příbramská kotlina 2. Pribramer Becken 10. BS, 1962, S. 156. Příbramská pahorkatina 1. GME-6, Hügelland, Mittelböhmischer Kreis (Středočeský kraj), 169 km2 2. Pribramer Hügelland 3. s.o. 5. Příbramská podhoří; Příbramská podhůří 7. Geomorphologische Untereinheit im Brdywald-Gebiet (Brdská podsoustava). 2 Teileinheiten: Pičínská pahorkatina und Třebská pahorkatina. 8. So benannt nach der mittelböhmischen Stadt Příbram, Bezirk Přibram. 10. ČV I, 1, 1968, S. 447; GČ, 1972, S. 73; ZLHN, 1987, S. 424, Nr. VA-5C. Příbramské podhoří 2. Pribramer Hügelland 3. → Příbramská pahorkatina 4. Příbramer Gebirge (wörtl.) 10. Kunský, 1968, S. 308; TLAZ, 2001, S. 67. Příbramské podhůří 2. Přibramer Hügelland 4. Pribramer Hügelland 10. GČZ, 1965, S. 224. Přibramsko 1. Historische Kulturlandschaft, Mittelböhmischer Kreis (Středočeský kraj) 7. Historisches Umland der mittelböhmischen Stadt Přibram, Bezirk Přibram, 35.508 Einwohner (1.1.2003), die gelegentlich auch „Pibrans“ oder „Pribans“ genannt worden ist. Die Stadt gewann ihre Bedeutung durch den Bergbau, der am Fuße des erzführenden Brdywaldes im Mittelalter zu hoher Blüte kam und wahrscheinlich schon in urgeschichtlicher Zeit betrieben worden ist. Erste urkundliche Nennungen 1216 (Pribram) und 1227 (circuitus, qui dicitur Pribram), dann auch durch König Přemysl Otakar II undatiert (de Bribrano), 1290 (locus forensis dicitus Pribram) und schließlich 1367 und 1369 (Pribrams und Przibram) Přibram wurde 1579 zur königlichen Bergstadt erhoben und mit besonderen Privilegien ausgestattet. Der Bergbau bestimmte zu allen Zeiten das Gesicht der Stadt und ihrer Umgebung. Hier wurde 1849 eine der ältesten Montanistischen Hochschulen gegründet, der 1875 niedergebrachte Adalbert-Schacht (Vojtěch) war damals der tiefste der Welt. Der Reichtum und die mit dem Bergbau zusammenhängende religiöse Folklore wie Wallfahrten und Feste hatten eine Konzentration von Kunstdenkmälern zur Folge. Im 19. Jahrhundert kamen weitere Schachtanlagen (Buntmetalle), nach 1945 wurde Přibram das Zentrum des Uranerzbergbaus in der damaligen Tschechoslowakei. Leichtindustrie wie Konfektionsund Lebensmittelverarbeitung bietet den Frauen der Bergleute angemessene Arbeitsplätze. Hier im Zentrum Böhmens gab es immer eine tschechische Mehrheit. Durch die Verwaltungsreform 1949 wurde Přibram wieder Sitz einer Bezirksverwaltung; 1960 behielt die Stadt diesen Status und der Bezirk wurde erheblich erweitert. Der politische Bezirk Přibram, bestehend aus den Gerichtsbezirken Dobřiš und Přibram, umfaßte 1927 eine Fläche von 708 km² mit 88 Gemeinden (158 Ortschaften) und 67.400 Einwohnern, fast ausschließlich tschechisch. 10. Schaller VI, 1787, S. 116; Schaller VIII, 1787, S. 114; Rieger 7, 1868, S. 936; RGL 2, 1883, S. 437; OSN 20, 1903, S. 667; OLTR, 1927, S. 454; Šmilauer, 1960, S. 272; Schwarz, 1961, S. 192; Schwarz, 1965, S. 58; ČV I, 1, 1968, S. 141; Kunský, 1968, S. 14; ZJČ, 1982, S. 249; ČSAZ, 1983, S. 396; TLČS, 1983, S. 185; GeoKr, 1984, S. 63; GeoČS, 1985, S. 158; RBL, 1989, S. 356; Gorys, 1994, S. 118; LŠ, 1997, S. 216; HHStBM, 1998, S. 495; Baedeker, 2000, S. 216; StR, 2001, S. 58; TLAZ, 2001, S. 712. Přibramský okres 1. Verwaltungseinheit 2. Bezirk Přibram 5. Přibramsko 7. Bezirk im Mittelböhmischen Kreis (Středočeský kraj). Fläche 1.628 km2, 107.500 Bewohner, 66 Einwohner/km², 120 Gemeinden. 10. StR, 2001, S. 56. Přibyslauer Hügelland 3. → Přibyslavská pahorkatina 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Přibyslau (Přibyslav), Bezirk Deutschbrod (Havličkův Brod). Přibyslavská pahorkatina 1. GME-7; Hügelland, Hochland-Kreis (Kraj Vysočina) 2. Přibyslauer Hügelland 3. s.o. 7. Geomorphologische Teileinheit im Hügelland an der oberen Sazawa (Hornosazavská pahorkatina). 8. So benannt nach der ostböhmischen Stadt Přibyslau (Přibyslav), Bezirk Deutschbrod (Havličkův Brod). 10. ZLHN, 1987, S. 424, Nr. II C-2C-b. Přibyslavská pahorkatina 1. GME-7, Hügelland, Hochland-Kreis (Kraj Vysočina) 2. Přibyslauer Hügelland 3. s.o. 4. Příbislavsko-ledečské pasmo 7. Geomorphologische Teileinheit im Hügelland an der oberen Sazawa (Hornosázavská pahorkatina). 8. So benannt nach der mittelböhmischen Kleinstadt Přibyslau (Přibyslav), Bezirk Deutschbrod (Havličkův Brod). 10. ZLHN, 1987, S. 424, Nr. IIc-2c-b. Přibyslavsko 1. Historische Kulturlandschaft; Hochland-Kreis (Kraj Vysočina) 7. Umgebung der ostböhmischen Stadt Přibyslau (Přibyslav), Bezirk Deutschbrod (Havličkův Brod), 3.983 Einwohner (1.1.2003), im Hügelland an der oberen Sazawa (Hornosazavská pahorkatina), also dem westlichen Abfall der Böhmisch-Mährischen Höhe (Českomoravská vrchovina). Das Gebiet wurde im Zuge des slawischen Landesausbaus erschlossen. Frühe Nennungen: 1257 (in ... Priemeczlaves), 1265 (in Primizlaus), 1272 (de Primislaus), 1283 (fratres de Przemislabe), 1314 (Primizlaus), 1424 (dobyti hradu Přibyslavě ), 1542 (hrad Przibislaw), 1675 (Pržibyslaw). Anlass der Gründung einer Siedlung hier am rechten Ufer der Sazawa war die Förderung von Silbererzen, wie es in der Quelle von 1257 beschrieben wird. Schon vor 1381 mit dem Stadtrecht begabt entwickelte sich das Städtchen unterhalb einer Burg zu einem Mittelpunkt für die ganze Gegend. In der Frühzeit waren ein Viertel der Bürger der Stadt Deutsche, doch ging deren Bedeutung bald kontinuierlich zurück, so dass sie nur im 16. Jahrhundert eine Mehrheit waren. Wechselvolles Schicksal in der Hussitenzeit. Im landwirtschaftlich orientierten Umland meist nur kleine Dörfer. Im 19. Jahrhundert nur bescheidene Industrialisierung. Der Gerichtsbezirk Přibyslau im damaligen politischen Bezirk Chotěboř umfasste 1927 eine Fläche von 214 km² mit 27 Gemeinden (31 Ortschaften) und 16.500 Einwohnern, davon 98,4 % tschechisch. 1939 Protektoratsverwaltung, heute typischer peripherer Raum mit Erholungsfunktion. Nach 1945 einige Betriebe der Nahrungsgüterproduktion. 10. RGL 2, 1883, S. 437; OLTR, 1927, S. 454; MJČ III, 1951, S. 474; Schwarz, 1961, S. 191; Schwarz, 1966, S. 220; ZJČ, 1982, S. 249; ČSAZ, 1983, S. 397; LŠ, 1987, S. 217; HHStBM, 1998, S. 497; TLAZ, 2001, S. 713. Přibislavsko-ledečské pasmo 2. Pribislauer Hügelland 3. → Přibyslavská pahorkatina 4. Přibislau-Ledečer Zug (wörtl.) 8. So benannt nach den mittelböhmischen Kleinstädten Ledeč und Přibyslau (Přibyslav), beide Bezirk Deutschbrod (Havličkův Brod). 10. ČV I, 1, 1968, S. 675. Přibyslauer Hügelland 3. → Příbyslavská pahorkatina 8. So benannt nach der mittelböhmischen Kleinstadt Přibyslau (Přibyslav), Bezirk Deutschbrod (Havličkův Brod). Příčný vrch 1. Berg, Mährisch-Schlesischer Kreis (Moravskoslezský kraj) 2. Querberg 3. s.o. 7. Erhebung im Zuckmanteler Bergland (Złatohorská vrchovina), 975 m hoch, Bezirk Freudenthal (Bruntál). 10. Kunský, 1968, S. 374; ZLHN, 1987, S. 424; RBL, 1989, S. 361; VGJ, 1996, S. 31; König, 1997, S. 123; TLAZ, 2001, S. 713. Přihrazer Wände 2. Přiharzer Felsen 3. → Príharzké skály 5. Příhrazke stěny (wörtl.) 8. So genannt nach dem nordböhmischen Ort Přihraz (Příhrazy), Bezirk Jungbunzlau (Mladá Boleslav). Příhrazké skály 2. Přihrazer Felsen 3. s.o. 4. Příhrazer Wände 5. Příhrazké stěny 7. Vielbesuchtes Naturdenkmal, gehört zum Böhmischen Paradies (Český raj). 8. So benannt nach dem nordböhmischen Ort Přihraz (Příhrazy), Bezirk Jungbunzlau (Mladá Boleslav). 10. ČV I, 1, 1968, S. 344; Kunský, 1968, S. 67; ČSAZ, 1983, S. 398. Příhrazké stěny 2. Přihrazer Felsen 3. → Příhrazké skály 4. Přihrazer Wände (wörtl.) 8. So benannt nach dem nordböhmischen Ort Přihraz (Příhrazy), Bezirk Jungbunzlau (Mladá Boleslav). 10. GČZ, 1965, S. 189; TLAZ, 2001, S. 147. Příkra strán 1. Schichtrippe, Kreis Königgratz (Královéhradecký kraj) 2. Schindels Lehne 7. Schichtrippe in Fortsetzung des Falkengebirges (Polická stupovňa) Přimda 1. Berg, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 2. Pfraumberg 3. s.o. 4. Schloßberg (veraltet); Frauenberg (veraltet) 8. Erhebung im Oberpfälzer Wald (Český les), 848 m hoch, Bezirk Tachau (Tachov), weiter Rundblick. 9. Frühe Nennungen 1126 (sclavice Przimda), 1174 (Primberg), dazu paßt der Name des Baches Pfreimd. 10. Rieger 2, 1862, S. 321; Krejčí, 1876, S. 283; OSN 6, 1893, S. 18; SSJ, 1920, S. 176; OLTR, 1927, S. 455; StR, 1957, S. 25; ČV I, 1, 1968, S. 695; Kunský, 1968, S. 167; AR, 1981, S. 132; ZJČ, 1982, S. 249; ZLHN, 1987, S. 425; LŠ, 1997, S. 217; TLAZ, 2001, S. 715. Přimdské pohoří 2. Pfraumberg-Wald 3. → Přimdský les 4. Pfraumberg-Bergland (wörtlich) 8. So benannt nach dem 848 m hohen Pfraumberg (Přimda), Bezirk Tachau (Tachov). 10. ČV I, 1, 1968, S. 452. Přimdsko 1. Historische Kulturlandschaft; Kreis Pilsen (Plzeňský kraj) 7. Umgebung des westböhmischen Städtchens Pfraumberg (Přimde), Bezirk Tachau (Tachov), 1.347 Einwohner (1.1.2003), am östlichen Abfall des Oberpfälzer Waldes (Český les). Die weithin sichtbare Grenzburg schützte einen Handelsweg, der von Nürnberg über das Grenzgebirge nach Prag führte. Schon 1121 hat Cosmas über diese Burg berichtet. Weitere Belege: 1126 (eodem tempore quasdam munitimes Bohemi reaedificaverunt quae solavice Przimda, Yzeorelik, Tachow appelantur), 1148 (castrum Primda), 1150 (de carcere Prinda erasit), 1174 (Sturmonem, castellanum de Primberg), 1233 (Nostup, purcravius de Primda), 1234 (Nostup de Frinbere), 1337 (Pfrinberge), 1256 (Urimberg, Primda), 1262 (Pfrimberg, Primda, Phrinberhe), 1330 (castrum Przimda alias Phrimberg), 1331 (prope Pfrimberch, in Pfriemberg), 1346 (sub castro Przimda), 1388 (in Przimda), 1416 (z Přimdy), 1444 (Przymda, dewcz Ffreienbergk), 1569 (k zámku Przindie), 1654 (městys Przinda). Die Vielzahl der tschechischen und deutschen Benennungen deutet an, dass der Gebirgskamm hier von beiden Seiten mehr oder weniger gleichzeitig erreicht worden ist, wobei von böhmischer Seite eine ältere Verteidigungsanlage reaktiviert worden ist. Die Stadtprivilegien des Kaisers Maximilian wurden 1567 noch tschechisch verfasst, die erweitere Fassung von Rudolf II. 1592 dagegen deutsch. Endgültig wurde das Stadtrecht für die kleine Siedlung unterhalb der Burg erst 1615 gewährt. Die vollständige Eindeutschung erfolgte erst nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die wirtschaftliche Entwicklung blieb wegen der Abgelegenheit bescheiden, die Bahn erreichte gerade einmal die im Vorbergland liegende Stadt Haid (Bor). Immerhin bahnte sich schon vor dem Ersten Weltkrieg die Entwicklung zur Sommerfrische an. Immerhin nahm das Bezirksgebiet hier seinen Sitz. Der Gerichtsbezirk Pfraumberg als Teil des politischen Bezirkes Tachau umfasste 1927 eine Fläche von 302 km² mit 41 Gemeinden (57 Ortschaften) und 17.900 Einwohnern, davon 99,6 % deutscher Nationalität. 1938 Anschluß an das Reich, 1945/46 Zwangsaussiedlung. Die Grenzlage am Eisernen Vorhang behinderte den wirtschaftlichen Aufschwung, wenngleich die Fernstraße von Pilsen (Plzeň) nach Rozvadov/ Waidhaus einige Belebung brachte. Nach der Fertigstellung der Autobahn E 50 von Nürnberg nach Prag, die dieser Trasse folgt, bieten sich hier ideale Bedingungen für den Tagestourismus. Die Burg wurde zum nationalen Kulturdenkmal erklärt. 10. Schaller IX, 1788, S. 157; Sommer VI, 1838, S. 167; Rieger 7, 1868, S. 952; RGL 2, 1883, S. 386; OSN 20, 1903, S. 690; OLTR, 1927, S. 427; MJČ III, 1951, S. 479; Schwarz, 1961, S. 280; Schwarz, 1965, S. 130; ZJČ, 1982, S. 249; ČSAZ, 1983, S. 398; SLL, 1985, S. 343; RBL, 1989, S. 329; LŠ, 1997, S. 217; HHStBM, 1998, S. 443; TLAZ, 2001, S. 715. Přimdský les 1. GME-6, Bergland, Kreis Pilsen (Plzeňský kraj), 330 km2 2. Pfraumberg-Wald 3. s.o. 4. Přimdské pohoří 7. Teil des Oberpfälzer Waldes (Český les): 4 Teileinheiten: Málkovská vrchovina, Plešivecká vrchovina, Havranská vrchovina, Rozvadovská pahorkatina. 8. So benannt nach dem Pfraumberg (Přimda), 848 m hoch, Bezirk Tachau (Tachov). 10. Hromádka, 1956, S. 284; GČ, 1972, S. 44; GeoKr, 1984, S. 104; ZLHN, 1987, S. 425, Nr. IA-1C; TLAZ, 2001, S. 144. Přísečnická hornatina 1. GME-7, Bergland, Kreis Aussig (Ústecký kraj) 2. Preßnitzer Bergland 3. s.o. 4. Preßnitzer Gebirge; Preßnitzer Hochfläche 5. Přísečnická planina; Přísečnické pohoří 7. Geomorphologische Teileinheit im Erzgebirge (Krušné hory). 8. So benannt nach dem nordböhmischen Ort Preßnitz (Přísečnice), Bezirk Komotau (Chomoutov). 10. ZLHN, 1987, S. 425, Nr. IIIA-2B-a. Přísečnická planina 2. Preßnitzer Bergland 3. → Přísečnická hornatina 4. Preßnitzer Gebirge, Preßnitzer Hochfläche (wörtl.) 8. So benannt nach dem nordböhmischen Ort Preßnitz (Přísečnice), Bezirk Komotau (Chomoutov). 10. ČV I, 1, 1968, S. 458. Přísečnická přehradní nádrž 1. Stauwerk; Kreis Karlsbad (Karlovarský kraj) 2. Preßnitzer Stausee 5. Vodní nádrž Přísečnice 7. Aufstauung des gleichnamigen Baches im Erzgebirge (Krušné hory), 1975 vollendet. Fläche 364 ha, 54,8 Mio. m³ Inhalt, Staumauer 50,3 m hoch. Dient ausschließlich der Wasserwirtschaft. 8. So benannt nach der untergegangenen westböhmischen Stadt Preßnitz (Přísečnice), Bezirk Karlsbad (Karlovy Vary). 10. Fričová, 1974/75, S. 308; ZLVTN, 1984, S. 227; RBL, 1989, S. 356. Přísečnické pohoří 2. Preßnitzer Bergland 3. → Přísečnická hornatina 4. Preßnitzer Gebirge (wörtl.) 8. So benannt nach dem nordböhmischen Ort Preßnitz (Přísečnice), Bezirk Komotau (Chomoutov). 10. ČV I, 1, 1968, S. 458. Přísečnicko 1. Historische Kulturlandschaft; Kreis Aussig (Ústecký kraj) 7. Umgebung der aufgelassenen Stadt Preßnitz (Přísenice), heute Bezirk Komotau (Chomoutov), im mittleren Erzgebirge (Krušne hory). Der Ort entstand an einem Weg, der von Annaberg-Buchholz über das Gebirge nach Laun führte. Der Bergbau war ein weiterer Anlass, sich hier niederzulassen. Frühe Nennungen: 1335 (via, quae ducit de opp. Presnitz ad civit. Lunensem), 1341 (Bergwerke zu Chutten und zu der Bresnitz … argrentifodinae in Brzesnicz), 1352 (Presnitz), 1384/99 (Priesnicz), 1405 (Brosnicz), 1379 (in Brziesnitz), 1401 (von Bresnicz vor die stat Cadan bis Sacz), 1422 (in Brissenicz), 1543 (w Przesecznicze mčko), 1616 (heitm. na Přísečnici). Der Bergbau bezog sich auf Silber, schon 1342 gab es eine Münzstätte. Die eigentliche Blüte fällt in das 16. Jahrhundert; 1546 wurde Preßnitz zur königlichen Bergstadt erhoben. Die Zerstörungen der Hussitenzeit waren bald beseitigt, die Reformation erfasste die Bevölkerung nachhaltig. Bestimmend für die weitere Entwicklung der Stadt wurde der Bau von Musikinstrumenten (Harfen) und die Musikschule. Musikanten aus Preßnitz zogen in die ganze Welt und übten großen Einfluss auf das Musikleben aus. Der politische Bezirk Preßnitz, bestehend aus den Gerichtsbezirken Preßnitz und Weipert, umfasste 1927 eine Gesamtfläche von 151 km² mit 20 Gemeinden (31 Ortschaften) und 31.500 Einwohnern, davon 97,6 % deutscher Nationalität. 1938 Sudetengau, 1945/46 massenhafte Vertreibung der Deutschen. Die Stadt wurde nicht wieder aufgesiedelt, weil man hier eine Talsperre geplant hatte, die „Přísečnická vodní nádrž“. Bevor diese in den siebziger Jahren geflutet wurde, benutzte man die verfallenden Gebäude als Filmkulisse. Die Gegend ist für die Erholung partiell gut geeignet, allerdings haben die Umweltschäden in den höheren Teilen des Gebirges der touristischen Attraktivität erheblichen Abbruch getan. 10. Schaller VII, 1787, S. 168; Sommer I, 1833, S. 214; Sommer XIV, 1846, S. 163; Rieger 7, 1868, S. 968; RGL 2, 1883, S. 433; OSN 20, 1903, S. 707; OLTR, 1927, S. 458; MJČ III, 1951, S. 482; Schwarz, 1965, S. 162; ZJČ, 1982, S. 250; SLL, 1985, S. 356; RBL, 1989, S. 355. Proluka Hranická 2. Mährische Pforte 3. → Moravská brana 4. Weißkirchener Senke (wörtl.) 8. So benannt nach der nordmähirschen Stadt Mährisch-Weißkirchen (Hranice), Bezirk Proßnitz (Prostějov). 10. Kozenn / Jireček ŠA, 1886, Kt. 3. Projestovský okres 1. Verwaltungseinheit 2. Bezirk Proßnitz (Prostějov) 7. Bezirk (entspr. Landkreis) im Kreis Olmütz (Olomoucký kraj). Fläche 770 km2, 110.000 Bewohner, 143 Einwohner/km², 95 Gemeinden. 10. StR 2000, S. 57. Proluka Mitwaldská 2. Mittelwalder Senke 3. → Mladkovské sedlo 4. Mittelwalder Pforte 6. Przełęcz Międzileska (poln.) 8. So benannt nach dem in Schlesien liegenden Ort Mittelwalde (Miedzilesie), PL-Woj. Dolnośląskie. 10. Kozenn / Jireček ŠA, 1886, Kt. 3. Proluka Třešňovická 2. Kerschbaumer Sattel 3. → Dvorišťské průsmyk 5. Třešňovické sedlo 8. So benannt nach dem oberösterreichischen Ort Kerschbaum, tschech. Exonym Třešňov. 10. Kozenn/Jireček ŠA, 1886, Kt. 3. Proluka Všerubská 2. Neumarker Paß 3. → Všerubský průsmyk 4. Neumarker Senke (wörtl.) 10. Kozenn/Jireček ŠA, 1886, Kt. 3. Propast 2. Gevatterloch 3. → Hranická propast 5. Macuška 10. Kořistka, 1861, S. 55; GČZ, 1965, S. 253; TLAZ, 2002, S. 703. Proschwitzer Becken 3. → Prosečská kotlina 8. So genannt nach der Stadt Proschwitz an der Neiße (Proseč nad Nisou), Bezirk Gablonz (Jablonec nad Nisou). Proschwitzer Rücken 3. → Prosečský hřeben 8. So benannt nach der Stadt Proschwitz an der Neiße (Proseč nad Nisou). Prosečská kotlina 2. Proschwitzer Becken 3. s.o. 8. So benannt nach der Stadt Proschwitz an der Neiße (Proseč nad Nisou), Bezirk Gablonz (Jablonec nad Nisou). 10. ČV I, 1, 1968, S. 722. Prosečsko 1. Historische Kulturlandschaft; PDkr 7. Umland der ostböhmischen Stadt Prosetsch (Proseč), Bezirk Chrudim, im Zwittauer Hügelland (Svitavská pahorkatina) am Nordrand des Saarer Berglandes (Žďárské vrchy), 2.095 Einwohner (1.1.2003). Es handelt sich um Jungsiedelland, das durch den slawischen Landesausbau erschlossen worden ist. Belege: 1349 (Prossiecz), 1368 (versus opp. Prossiecz, t.), 1559 und 1563 (mčko Prosecz), 1927 (Proseč, Prosetsch). Der Name deutet auf das Rodungsgeschäft hin. Der Ort scheint als städtischer Mittelpunkt gegründet worden zu sein, hat seine städtischen Privilegien aber wieder verloren. In der Umgebung waldhufenähnliche Siedlungen. Wegen seiner Abgelegenheit kein wirtschaftliches Fortkommen, Kleingewerbe (Pfeifen, Gürtlerei), kein Bahnanschluß. 1927 gehörte die Marktgemeinde Proseč zum politischen Bezirk Hohenmauth und zum Gerichtsbezirk Skutsch und hatte ca. 1.100 tschechische Einwohner. Gedenkstätte für Thomas Mann, dem als Nobelpreisträger und Emigrant hier das Heimatrecht zugebilligt wurde. 10. Rieger 7, 1868, S. 1002; RGL 2, 1883, S. 441; OSN 20, 1903, S. 777; OLTR, 1927, S. 457; MJČ III, 1951, S. 491; Schwarz, 1961, S. 255; Kuller, 1975, S. 117; ČSAZ, 1983, S. 389; RBL, 1989, S: 358. Prosečský hřeben 1. GME-7, Berg, Kreis Reichenberg (Liberecký kraj) 7. Bergrücken im Zittauer Becken (Žitavská pánev), bis 593 m hoch. 8. So benannt nach der Stadt Proschwitz an der Neiße (Proseč nad Nisou), Bezirk Gablonz (Jablonec nad Nisou). 10. ČV I, 1, 1968, S. 722; ZLHN, 1987, S. 421. Prosetscher Gebirge 8. So genannt nach der ostböhmischen Stadt Prosetsch (Proseč), Bezirk Chrudim. 10. Sommer X, 1842, S. VIII. Prosmyk Jablunkovský 2. Jablunka-Paß 3. → Jablunkovský průsmyk 10. Kozenn / Jireček ŠA, 1886, Kt. 3. Prosmyk Nkoleřovské 2. Nollendorfer Paß 3. → Nahleřovský průsmyk So benannt nach dem nordböhmischen Ort Nollendorf (Nahleřov), Bezirk Aussig (Ústí nad Labem). 10. Kozenn / Jireček ŠA, 1886, Kt. 3. 8. Proßnitzer Hügelland 3. → Prostějovská pahorkatina 4. Hügelländer der Hanna 8. So genannt nach der mährischen Stadt Proßnitz (Prostějov), Bezirk Proßnitz (Prostějov). Prostějovská pahorkatina 1. GME-6, Hügelland, Kreis Olmütz (Olomoucký kraj), 542 km2 2. Proßnitzer Hügelland 3. s.o. 7. Geomorphologische Untereinheit im Oberen Marschbecken (Hornomoravský úval). 5 Teileinheiten: Blatská niva, Hanácká niva, Kojetinská pahorkatina, Křelovská pahorkatina und Romžská niva. 8. So benannt nach der mährischen Stadt Proßnitz (Prostějov), Bezirk Proßnitz (Prostějov). 10. GČ, 1972, S. 83; ZLHN, 1987, S. 421, Nr. VIIIA-3A. Prostějovsko 1. Historische Kulturlandschaft; Kreis Olmütz (Olomoucký kraj) 7. Umland der Stadt Proßnitz (Prostejov), Bezirk Proßnitz (Prostějov), 47.678 Einwohner (1.1.2003), in der fruchtbaren Landschaft Hanna. Die Stadt wurde errichtet an der Stelle einer älteren slawischen Siedlung; ihre Gründung ist im Rahmen der mittelalterlichen Binnenkolonisation zu sehen, als man das gesamte Steuer- und Abgabewesen neu organisierte. Frühe Nennungen: 1131 (Prosteiouicih), 1213 (Prosteyow), 1255 (Prostei), 1258 (de Prosteys), 1301 (circa Prosteys), 1345 (Nicolaus de Prostays), 1365 (medietatem oppidi Prosteygow), 1405 (in Prostano), 1426 (de Prostano), 1468 (ex Prostiegow), 1518 (Prostanensis), 1533 (na zámku jeho Prostiegowie), 1623 (zu Proßnitz), 1681 (Prostnitz), 1718 (Prossnitz), 1846 (Prossnitz; Prostnitz; Prostěgow; lat.: Prostano). Die Altstadt entstand in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts um die Marienkirche, dann erfolgte die Erbauung der Neustadt. Seit 1390 ist ein Jahrmarkt bezeugt, später Proßnitz mit Olmützer Recht privilegiert. Eine Stadtbefestigung war ebenfalls vorhanden, ist aber zum Teil abgetragen worden. Die landwirtschaftlich bestimmte Umgegend ist eine Kornkammer Mährens, sie wird als Hanna oder Hannakei bezeichnet, die Bewohner als Hannaken. In der Stadt dominierte bis zum 14. Jahrhundert das deutsche Element. In Proßnitz ließen sich zahlreiche in der Hussitenzeit aus Olmütz vertriebene Juden nieder, die in einem Ghetto lebten und zuletzt über zwei Synagogen verfügten. Im 15. Jahrhundert entstand auch eine Siedlung der Böhmischen Brüder. Nachdem die Stadt 1599 an die Herren von Liechtenstein gekommen war, wurde die Bevölkerung im Zuge der Gegenreformation gewaltsam rekatholisiert. Der Dreißigjährige Krieg entvölkerte die Stadt und verursachte schwere Zerstörungen. Die Wirtschaft der Stadt war bestimmt durch die Lage an einem wichtigen Handelsweg und das örtliche Handwerk, voran die Tuchmacherei, aber auch die Bierbrauerei und die Schnapsbrennerei. Der erste Bahnanschluß erfolgte 1870 an die Linie von Brünn (Brno) nach Olmütz (Olomouc). Die Industrialisierung begünstigte weiterhin die Textilindustrie (Konfektionswaren), daneben traten die Nahrungsmittelverarbeitung und die Landmaschinenindustrie. In dieser Zeit der Prosperität entstanden mehrere Repräsentationsbauten wie das Neue Rathaus und das Theater (Jugendstil!). Proßnitz entwickelte sich zur Schulstadt und zum kulturellen Mittelpunkt und blieb trotz tschechischer Umgebung zweisprachig. Der politische Bezirk Proßnitz, bestehend aus den Gerichtsbezirken Plummaux und Proßnitz, umfaßte 1927 eine Fläche von 472 km² und 72 Gemeinden (85 Ortschaften) und 81.500 Einwohnern, davon 96,3% tschechisch. 1939 Protektorat, nach 1945 weiterer Ausbau der industriellen Komponente. Durch die Verwaltungsreform von 1960 wurde Proßnitz wieder Sitz einer Bezirksverwaltung, blieb dies aber nur bis 1960. 10. Rieger 7, 1868, S. 1005; RGL 2, 1883, S. 441; OSN 20, 1903, S. 783; OLTR, 1927, S. 458; Schwarz, 1961, S. 193; Schwarz, 1966, S. 102; ČV I, 1, 1968, S. 662; Hosák / Šrámek II, 1980, S. 309; ZJČ, 1982, S. 246; ČSAZ, 1983, S. 389; TLČS, 1983, S. 186; RBL, 1989, S. 358; LŠ, 1997, S. 213; HHStBM, 1998, S. 499; StR, 2001, S. 58; TLAZ, 2001, S. 703. Protektorat Böhmen und Mähren 1. Historisches Territorium 3. Protektorát Čechy a Morava 4. Reichsprotektorat Böhmen und Mähren 7. Nachdem der Ersten Tschechoslowakischen Republik durch das Münchener Abkommen im September 1938 weite Gebiete entrissen worden waren (Südsudetenland), kam das Land nicht mehr zur Ruhe. Zwar schien die „sudetendeutsche Frage“ durch die Abtretung der deutschbesiedelten Gebiete gelöst zu sein, doch regte sich nun in der Slowakei die Abneigung gegen die immer noch tschechisch dominierte Zentralregierung in Prag, wobei die Stimmung nicht zuletzt auch von außen geschürt wurde. Hitler hatte ohnehin unverblümt angekündigt, die „Rest-Tschechei zu erledigen“, obwohl die Wehrmachtsführung aus guten Gründen zögerte, einen Angriffskrieg vom Zaun zu brechen. Die den Slowaken zugesagte Autonomie war der Anlaß für weitere Querelen, die zum völligen Bruch zwischen Prag und Pressburg führten. Am 14./15. März rückte die Deutsche Wehrmacht kampflos in die Tschecho-Slowakei ein und erreichte schon am ersten Tag die Hauptstadt Prag, wo Hitler noch vor dem in Berlin zurückgehaltenen Staatspräsidenten Dr. Emil Hácha eintraf; slowakische Gebiete wurden von der Besetzung (noch) nicht berührt; gleichzeitig nahmen polnische Streitkräfte das 1920 strittige Olsa-Land (Teschener Land) in Besitz und gliederten es dem polnischen Staat an. Unmittelbar nach dem Einmarsch der deutschen Truppen ließen sich auch die Orgne der SS, der Staatspolizei, des Sicherheitsdienstes und diverse wirtschaftliche Einrichtungen im besetzten Gebiet nieder. Innerhalb kürzester Zeit kam es dann zur Errichtung des Reichsprotektorats Böhmen und Mähren mit der Hauptstadt Prag. Zum Reichsprotektor wurde Konstantin Frhr. von Neurath ernannt, Staatspräsident blieb Dr. Emil Hácha, eine aus tschechischen Fachleuten bestehende Regierung (mit eingeschränkten Funktionen) stand unter der Leitung von General Alvis Eliaš. Das Protektoratsgebiet hatte eine Fläche von 48.901 km², davon entfielen auf Böhmen 31.340 km² und auf Mähren 17.561 km². Der Bevölkerungsbestand betrug 7.396 Mio. Einwohner, fast ausschließlich Tschechen. Alle protektoratsangehörigen Deutschen erhielten die deutsche Staatsbürgerschaft, während die Tschechen weiterhin als Ausländer angesehen wurden. Das Gebiet wurde in die Oberlandratsbezirke Prag (Praha), Königgrätz (Hradec Králove), Pilsen (Plzeň), Budweis (České Budějovice), Brünn (Brno), Mährisch-Ostrau (Ostrava) und Iglau (Jihlava) eingeteilt, die Hauptstadt bildete einen eigenen Verwaltungssprengel. Die herkömmlichen Bezirksgrenzen blieben weitgehend erhalten. Die wirtschaftliche Entwicklung verlief zufrieden stellend, zumal hier erhebliche Ressourcen für die deutsche Kriegswirtschaft genutzt werden konnten. Auch die Versorgung der Bevölkerung war in der Regel besser als im Reich. Der Widerstand der tschechischen Bevölkerung entzündete sich an der Judenfrage, an der Unverhältnismäßigkeit des Besatzungsregimes, am Verhalten der Kollaborateure und wurde schließlich auch noch durch die Auslandsemigration geschürt. Als im Mai 1945 die sowjetischen und US-amerikanischen Streitkräfte das Protektoratsgebiet besetzten und sich auf der Linie Budweis (České Budějovice) – Pilsen (Plzeň) – Karlsbad (Karlovy Vary) begegneten, kam es zu einem Aufstand in Prag und furchtbaren Bluttaten in der Hauptstadt und im ganzen Land, unter denen vor allem Wehrmachtsangehörige und deutsche Zivilisten, aber auch tschechische Kollaborateure zu leiden hatten. Mit der Wiedererrichtung des neuen tschechoslowakischen Staates ist das Protektorat Böhmen und Mähren gegenstandslos geworden. 10. Spreitzer, 1941, S. 429; SL, 1954, S. 94; SDZ, 1959, S. 194; Slapnicka, 1960, S. 145; Hoensch, 1966, S. 108; HGBL IV, 1970, S. 116; Sedlmeyer, 1973, S. 175; Bohmann, 1975, S. 327; Pokorný, 1994, S. 22; Hoensch, 1997, S. 431; Habel, 1998, S. 79; Stich, 2001, S. 16. Protektorát Čechy a Morava 2. → Protektorat Böhmen und Mähren 4. Reichsprotektorat Böhmen und Mähren 5. Čechy a Morava 10. ČV II, 2, 1969, S. 530; GeoČS, 1985, S. 18; Stich, 2001, S. 16. Protivínsko 1. Historische Kulturlandschaft; Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 7. Umgebung der südböhmischen Stadt Protiwin (Protivín), Bezirk Písek, 4.987 Einwohner (1.1.2003), am Rande des Budweiser Beckens (Českobudějovická pánev) gelegen. Die Siedlung entstand am westlichen Ufer des Flusses Blanitz (Blanice), die hier von der Landstraße von Písek nach Budweis (České Budějovice) gequert wird. Belege: 1282 (in Protiwins), 1334 (villas inter Budywois et Prothwius castrum situatas), 1348 (castrum Protiwia), 1406 (in Protiwin), 1519 (Petr z Pohnání a na Protivině), 1562 (s tvrzí Protivinem). Das Dorf unter der Burg war im 14. Jahrhundert zu deutschem Recht ausgesetzt. Die Bewohner dürften überwiegend Tschechen gewesen sein. Neben einigen gewerblichen Betrieben gibt es eine bekannte Bierbrauerei. 1927 gehörte Protiwin zum politischen Bezirk Písek und zum Gerichtsbezirk Wodnaň und hatte 3.131 Einwohner, davon 19 deutscher Nationalität. Nach dem zweiten Weltkrieg neue Industrien, Bauwirtschaft. Protiwin wurde in der Literatur bekannt durch die Anabasis des braven Soldaten Schwejk, den Jaroslav Hašek durch diese Gegend marschieren lässt. 10. Rieger 7, 1868, S. 1009; RGL 2, 1883, S. 441; OSN 20, 1903, S. 800; OLTR, 1927, S. 459; MJČ, 1951, S. 494; Schwarz, 1965, S. 385; ZJČ, 1982, S. 247; ČSAZ, 1983, S. 391; RBL, 1989, S. 358; LŠ, 1997, S. 214; HHStBM, 1998, S. 502; TLAZ, 2001, S. 704. Provincia Bilinensis 3. → Bilinsko 8. Es kann sich um einen alten Slawengau handeln. 10. Lippert I, 1896, S. 35. Provincia Boleslavensis 3. → Boleslavsko 10. Lippert I, 1896, S. 40. Provincia Egrensis 2. Egerland 3. → Chebsko 6. Terra Egrensis 9. 1218 so genannt. 10. OSN 12, 1897, S. 103, H. Sturm in: HGBL II, 1974, S. 18. Provinz Deutsch-Südböhmen 1. Vorübergehendes Territorium 3. → Šumavská župa 4. Böhmerwaldgau 7. Angesichts des Zusammenbruchs der Österreichisch-ungarischen Monarchie und des Machtswechsels in Prag im Jahre 1918 gab es bei den Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien Bestrebungen, im Rahmen des Selbstbestimmungsrechts der Völker einen besonderen Status zu erlangen oder sich der Republik Deutsch-Österreich anzuschließen. So kam es zur Gründung des Böhmerwaldgaus mit dem Hauptort Krumau (Český Krumlov). Es handelte sich um ein Gebiet mit einer Fläche von 3.281 km², das große Teile des Böhmerwaldes (Šumava) und einen Streifen in Südböhmen einschloss. Das Gebiet hatte 183.200 Einwohner, darunter 3,3% Tschechen. Schon nach wenigen Wochen marschierten tschechische Truppen ein, so dass ein Anschluß an Oberösterreich nicht realisiert werden konnte. 1938 wurde das Gebiet dem Reichsgau Oberdonau zugeteilt, 1945 wurde die historische Grenze wiederhergestellt. 10. SDZ, 1959, S. 7; Hönsch, 1966, S. 30; HGBL III, 1968, S. 391; Bohmann, 1975, S. 43. Provinz Deutsch-Südmähren 1. Vorübergehendes Territorium 4. Deutsch-Südmähren 7. Beim Zusammenbruch der Österreichisch-ungarischen Monarchie 1918 und angesichts der Gründung eines tschechoslowakischen Staates versuchten die deutschen Bevölkerungsteile in Böhmen, Mähren und Schlesien, ihr Selbstbestimmungsrecht durch Gründung eigener Provinzen durchzusetzen. Im Rahmen dieser Bestrebungen entstanden die Provinzen Deutschböhmen und Sudetenland sowie der Böhmerwaldgau; gleichzeitig entstand auch in den deutsch besiedelten Gebieten Südmährens eine solche Provinz, die den Anschluss an Deutsch-Österreich suchte. Das Territorium hatte eine Fläche von 3.226 km² mit fast 195.000 Einwohnern, darunter 6,3% Tschechen. Es erstreckte sich von der unteren March (Morava) entlang der niederösterreichischen Grenze bis nach Südböhmen, wo der Bezirk Neubistritz (Nový Bystřice) noch dazu gehörte. Hauptort war Znaim. Der Bestand der Provinz war nur von kurzer Dauer, denn nachdem sich die regulären österreichischen Truppen zurückgezogen hatten, war es für die tschechischen Organ leicht, das Gebiet unter Kontrolle zu bringen. In der Tat kam das gesamte Gebiet nach dem Münchener Abkommen 1938 zu Österreich bzw. zum Reichsgau Niederösterreich. 1945 wurde die historische Grenze wiederhergestellt. 10. SDZ, 1959, S. 7; HGBL, III, 1968, S. 391; Hoensch, 1966, S. 30; ČV II, 2, 1969, S. 404; Bohmann, 1975, S. 43. Provinz Sudetenland 1. Vorübergehendes Territorium 2. Sudetenland 3. Sudetská župa 7. Der Zusammenbruch des Habsburgerreiches und die Ausrufung einer tschechischslowakischen Republik, welche die gesamten Sudetenländer in ihren historischen Grenzen beanspruchte. Da die Alliierten das Selbstbestimmungsrecht der deutschstämmigen Bevölkerung nicht beachtet hatte und entsprechende Selbstverwaltungsorgane nicht zuließen, kam es zu Unruhen und politischen Reaktionen. Es kam zur spontanen Gründung der Provinzen Sudetenland, Deutschböhmen, Böhmerwaldgau und Deutsch-Südmähren in den vorwiegend deutsch besiedelten Randgebieten, die sich der Republik Deutsch-Österreich zugehörig fühlten, wogegen die neuen tschechoslowakischen Organe erheblich Widerstand leisteten und schließlich obsiegten. Die Provinz Sudetenland mit der Hauptstadt Troppau (Opava) bestand aus Gebietsteilen Sudetenschlesiens, einem großen Teil Nordmährens und einem Streifen ostböhmischer Gemeinden entlang des Adlergebirges, insgesamt hatte die Provinz einen Gebietsumfang von 6.534 km². Hier lebten 1910 rd. 679.000 Menschen, darunter etwa 25.000 Tschechen. Landeshauptmann wurde Dr. Robert Freißler. Schon im November 1918 begannen tschechische Verbände das Gebiet zu besetzen und nahmen am 18. Dezember Troppau und am 18. Februar 1919 Jägerndorf (Krnov). Damit waren vollendete Tatsachen geschaffen worden, die durch die Grenzfortsetzung in den Friedensverträgen von Versailles und St. Germain bestätigt wurden. 10. SDZ, 1959, S. 106; Urban, 1964, S. 1; Hoensch, 1966, S. 30; HGBL III, 1968, S. 391; Bohmann, 1975, S. 43. Proxenpaß 2. Neue-Welt-Paß 3. → Novosvetský průsmyk 4. Paß bei Jakobsthal; Proxensattel 5. Novosvětské sedlo 6. Przeľęcz Szklarska (poln.) 10. Werdecker, 1957, S. 40. Proxensattel 2. Neue-Welt-Paß 3. → Novosvětský průsmyk 4. 5. 6. 10. Neuwelt-Sattel; Paß bei Jakobsthal; Proxenpaß Novosvětské sedlo Przełęcz Szklarska (poln.) Machatschek, 1927, S. 284. Průlom Labe 2. Durchbruchstal der Elbe 3. → Labský kaňon 10. Kozenn / Jireček ŠA, 1888, Kt. 17. Průplav Opatovický 2. Opatowitzer Kanal 3. → Opatovický kanál 8. So benannt nach dem ostböhmischen Ort Opatowitz (Opatovice), Bezirk Pardubitz (Pardubice). 10. Rieger 2, 1862, S. 324. Průsmyk Domažlický 2. Tauser Senke 3. → Domažlický Průsmyk 8. So benannt nach der westböhmischen Stadt Taus (Domažlice), Bezirk Taus (Domažlice). 10. Krejčí, 1876, S. 283; MSN 1, 1925, S. 1048. Průsmyk Jablunkovsky 2. Jablunkauer Paß 3. → Jablunkovský průsmyk 8. So benannt nach der nordmährischen, früher schlesischen Stadt Jablunkau (Jablunkov), Bezirk Friedek-Mistek (Frýdek-Místek). 10. MSN 1, 1925, S. 1029. Průsmyk Kraslický 2. Graslitzer Paß 3. → Kraslický průsmyk 8. So benannt nach dem westböhmischen Ort Graslitz (Kraslice), Bezirk Falkenau (Sokolov). 10. MSN 1, 1925, S. 1048. Průsmyk Libavský 2. Liebauer Sattel 3. → Libavské sedlo 4. Liebauer Paß 8. So benannt nach der schlesischen Stadt Liebau (Lubawka, tschech. Exonym Libava), PL. 10. MSN 1, 1925, S. 1049. Průsmyk Myjavský 10. MSN 1, 1925, S. 1049. Průsmyk Naklerovský 2. Nollendorfer Paß 3. → Nakléřovský průsmyk 5. Tiské sedlo 8. So benannt nach dem nordböhmischen Ort Nollendorf (Nakléřov), Bezirk Aussig (Ústí nad Labem). 10. OAZ, 1924, Kt. 17. Průsmyk Papajský 3. → Papajské sedlo 5. Makyta průsmyk 10. MSN 1, 1925, S. 1049. Průsmyk u Dvořiště 2. Kerschbaumer Sattel 3. → Dvořištské sedlo 5. Prolouka Třešňovická 8. So benannt nach dem südböhmischen Ort Ober-Haid (Horní Dvořiště), Bezirk Krumau (Český Krumlov). 10. MSN 1, 1925, S. 1047. Průsmyk u Horní Dvořistě 2. Kerschbaumer Sattel 3. → Dvořišťské sedlo 4. Linzer Steig 5. Průsmyk u Dvořiště, Prolouka Třešňovická 8. So benannt nach dem südböhmischen Ort Ober-Haid (Horní Dvořišťĕ), Bezirk Budweis (České Budějovice). 10. HKK, 1960, S. 68. Průsmyk Žacléřský 2. Schatzlarer Paß 3. → Žacléřský průsmyk 9. So benannt nach dem ostböhmischen Städtchen Schatzlar (Žacléř), Bezirk Trebitsch (Trebíč). 10. MSN 1, 1925, S. 1049. Průsmyk Želenorudský 2. Paß von Eisenstein 3. → Želenorudský průsmyk 8. So benannt nach dem Dorf Eisenstein (Železná Ruda, jetzt Špičák), Bezirk Klattau (Klatovy). 10. MSN 1, 1925, S. 1048. Przedgórze Paczkowskie 2. Zuckmanteler Bergland 3. → Zlatohorská vrchovina 4. Patschkauer Vorbergland 7. Gebietszipfel der Tschechischen Republik, der in das schlesische Gebirgsvorland hineinreicht. 8. So benannt nach der schlesischen Stadt Parzków (Patschkau), PL-Woj. Opolskie. 10. Walczak, 1970, S. 397; Kondracki, 1988, S. 255; NGRP, 1991, S. 733; SGTS 17, 1993, S. 12. Przedgórze Sudeckie 2. Sudetenvorland 3. → Sudetské podhůří 4. Vorland der Sudeten 5. Krkonošsko-jesenické podhůří 9. Polnische Bezeichnung. 10. Walczak, 1968, S. 9; Kondracki, 1988, S. 32; NGRP, 1991, S. 757; Potocki, 1994, S. 191. Przełęcz Graniczna 2. Grenzbauden; Grenzbauden-Paß 3. → Pomezní sedlo 5. Pomezní Boudy; Sedlo u Pomezních Boud 9. Analog zur deutschen und tschechischen Bezeichnung nur vorübergehend in Gebrauch. 10. SGTS 3, 1993, S. 167. Przełęcz Karkonoska 2. Spindlerpaß 3. → Slezské sedlo 5. 6. 9. 10. Špindlerovské sedlo Przełęcz Szpindlerowska Polnische Bezeichnung. Walczak, 1968, S. 24; Bach, 1989, S. 70; NGRP, 1991, S. 701; SGTS 3, 1993, S. 165; Malerek, 1996, S. 12. Przełęcz Lądecka 2. Krautenwalder Paß 3. → Travenské sedlo 4. Landecker Paß 8. So benannt nach Bad Landeck (Lądecki Zdrój), PL-Woj. Dolnośląskie. 10. SGTS 17, 1993, S. 181. Przełęcz Lubawecka 2. Königshainer Paß 3. → Libavské sedlo 4. Mittelwalder Pforte; Mittelwalder Senke 5. Královecké sedlo; Proluka Mitwaldská (alt) 10. NGRP, 1991, S. 713; SGTS 9, 1996, S. 163; SGTS 14, 1992, S. 192. Przełęcz Lubawska 2. Königshaner Paß 3. → Královecké sedlo 5. Libavské sedlo 8. So benannt nach dem schlesischen Ort Liebau (Lubawska), PL-Woj. Dolnośląskie. 10. NGRP, 1991, S. 713; SGTS 9, 1996, S. 93. Przełęcz Międzileska 2. Paß von Mittelwalde 3. → Mladkovské sedlo 8. So benannt nach dem schlesischen Grenzort Mittelwalde (Międzilesie). 9. Polnische Bezeichnung. 10. NGRP, 1991, S. 722; Walczak, 1968, S. 22; SGTS 16, 1993, S. 268. Przełęcz Okraj 2. Grenzbauden-Paß 3. → Sedlo u Pomezních Boud 5. Pomezní sedlo 9. Polnische Bezeichnung. 10. Bach, 1989, S. 70; NGRP, 1991, S. 729; SGTS 3, 1993, S. 167; Malerek, 1996, S. 12. Przełęcz Płoszyna 2. Platzenberger Paß 3. → Kladské sedlo 4. Spieglitzer Sattel 5. Spiklické sedlo 6. Morawska Przełęcz (poln.) 8. So benannt nach dem polnischen Ort Płoska (Platzenberg), PL-Woj. Dolnośląskie. 9. Polnische Bezeichnung. 10. Walczak, 1968, S. 31; NGRP, 1991, S. 737; SGTS 16, 1993, S. 269. Przełęcz pod Śnieżka 2. Koppenpaß 9. Polnische Bezeichnung. 10. SGTS 3, 1993, S. 169. Przełęcz Polska Wrota 2. Nachoder Sattel 3. → Náchodský průsmyk 4. Landespforte von Nachod; Nachoder Steig; Reinerzer Sattel 9. Polnische Bezeichnung. 10. Walczak, 1968, S. 30. Przełęcz Różaniec 2. Rosenkranz-Paß 3. → Růženec 4. Paß am Jauersberg 9. Polnische Bezeichnung. 10. Walozak, 1968, S. 31; NGRP, 1991, S. 695; SGTS 17, 1993, S. 183. Przełęcz Szklarska 2. Neue-Welt-Paß 3. → Novosvětský průsmyk 4. Neuwelter Sattel; Paß von Jakobsthal; Proxenpaß; Proxensattel 9. Polnische Bezeichnung. 10. Walczak, 1968, S. 23; Kondracki, 1988, S. 20; Bach, 1989, S. 70; NGRP, 1991, S. 729; Karkonose, 1993, S. 170. Przełęcz Szpindlerowska 2. Spindlerpaß 3. → Slezské sedlo 5. Spindlerowské sedlo 6. Przełęcz Karkonoska 9. Polnische Bezeichnung. 10. SGTS 3, 1993, S. 165. Przibramer Erzrevier 3. → Přibramsko 10. Sueß, 1903, S. 121. Pschaner oder Chlumčaner Berge 8. So benannt nach den nordböhmischen Orten Pschan (Blšany), Bezirk Laun (Louny) und Chlumčany. 10. Sommer XIV, 1846, S. IX. Pšovaní 1. Historische Kulturlandschaft; Kreis Reichenberg (Liberecký kraj) 2. Pšowanen 7. Slawengau in Nordböhmen 10. Lippert I, 1896, S. 29; ŠAČD, 1959, S. 2; AČD, 1965, Kt. 3b; Schwarz, 1965, S. 199; Hoensch, 1997, S. 39. Pteč 1. Berg; Mittelböhmischer Kreis (Středočeský kraj) 3. s.o. 7. Erhebung im Beneschauer Hügelland (Benešovská pahorkatina), 633 m hoch, Bezirk Beneschau (Benešov). 10. ČV I, 1, 1968, S. 447; Kunský, 1968, S. 280; AR, 1981, S. 132; ZLHN, 1987, S. 426. Pulčínská hornatina 1. GME-6, Bergland, Kreis Zlin (Zlinský kraj) / Slowakei, 80 km2 in der ČR 2. Pultschiner Bergland 3. s.o. 7. Geomorphologische Untereinheit im Jawornikgebirge (Javorníky). 3 Teileinheiten: Makytská hornatina, Strelenecká vrchovina und Zděchovská kotlina. 8. So benannt nach dem Ort Pultschin (Pulčín), Bezirk Wsetin (Vsetín). 10. GČ, 1972, S. 91; ZLHN, 1987, S. 426, Nr. IXC-3B. Pulsnitz 2. Polzen 3. → Ploučnice 5. Plznice 9. 1226 Pulsnice genannt, 1411 Pulsenicz, 1868 Pulsnitz oder Polzen. 10. Schaller IV, 1790, S. 8; Sommer I, 1833, S. XXII; ADRE 2, 1843, S. 460; SSJ, 1920, S. 78; Schwarz, 1961, S. 279; ARCL 2, 1866, S. 892; Sydow, 1868, S. 150; Schwarz, 1961, S. 259; ZJČ, 1982, S. 237; ZJČ, 1983, S. 237; LŠ, 1997, S. 206. Pultschiner Bergland 3. → Pulčínská hornatina 8. So genannt nach dem Ort Pultschin (Pulčín), Bezirk Wsetin (Vsetín). Punkevní jeskyně 1. Höhle, Naturdenkmal, Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj) 2. Punkwa-Höhle 6. Punkva caves (engl.) 7. Bekannteste und größte Tropfsteinhöhle im Mährischen Karst (Moravský kras), rd. 30 km lang, weit verzweigtes Labyrinth mit schönen Tropfsteinbildungen, bemerkenswert ist der sog. Masaryk-Dom. Teil des Landschaftsparks Mährischer Karst. Seit 1723 ist die Höhle bekannt. Die Höhle ist erschlossen und ganzjährig geöffnet. 10. CV 1, 1929, S. 291; Koláček, 1934, S. 46; HKK, 1960, S. 44; ČV I, 1, 1968, S. 348; Kunský, 1968, S. 46; AR, 1981, S. 133; ČSAZ, 1983, S. 400; TLČS, 1983, S. 188; GeoKr, 1984, S. 179; RBL, 1989, S. 359; Gorys, 1994, S. 362; Baedeker, 2000, S. 183; TLAZ, 2001, S. 717. Punkva 1. Fluß; Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj) 2. Punkwa 5. auch Ponikva 7. Linker Nebenfluß der Zwittawa (Svitava), 25,6 km lang, Mündung bei Blansko. Bekannt als unterirdischer Fluß im Mährischen Karst (Moravský kras), touristische Attraktion. 10. Wolny II, 1, 1836, S. III; OSN 17, 1901, S. 628; MSN 1, 1925, S. 1049; ČV 1, 1929, S. 120; HKK, 1960, S. 44; GČZ, 1965, S. 139; Kunský, 1968, S. 46; OLTR, 1927, S. 461; ČSSt, 1971, S. 22; AR, 1981, S. 133; ZČJ, 1982, S. 251; ČSAZ, 1983; TLČS, 1983, S. 188; GeoKr, 1984, S. 179; ZLVTN, 1984, S. 228; Gorys, 1994, S. 362; LŠ, 1997, S. 218; Baedeker, 2000, S. 183; TLAZ, 2001, S. 719. Punkva-Bach 2. Punkwa 3. → Punkva 4. Ponikwa 10. MWB MS, 1897, S. 12. Punkva caves 2. Punkwa-Höhle 3. → Punkevní jeskyně 9. Englische Bezeichnung 10. Demek, 1971, S. 52. Punkwa 3. → Punkva 4. Ponikwa 10. Wolny II, 1, 1836, S. III; Machatschek, 1927, S. 339; OLTR, 1927, S. 461; Werdecker, 1957, S. 54. Punkwa-Höhle(n) 3. → Punkevní jeskyně 10. RBL, 1989, S. 359; Gorys, 1994, S. 362; Baedeker, 2000, S. 183. Pürglitzer Bergland 3. → Křivoklátská vrchovina 4. Rokitzan-Pürglitzer Porphyrzug; Pürklitzer Wald 5. 8. Křivoklatský les; Les Křivoklátská So benannt nach der mittelböhmischen Stadt Pürglitz (Křivoklát), Bezirk Rakonitz (Rakovník). Pürglitzer Gebirge 2. Pürglitzer Bergland 3. → Křivoklátská vrchovina 4. Berauner Gebirge; Pürglitzer Wald 5. Křivoklatský les; Les Křivoklátská 8. So genannt nach der mittelböhmischen Stadt Pürglitz (Křívoklát), Bezirk Rakonitz (Rakovník). 10. Sommer III, 1845, S. II; Schneider, 1908, S. 11; OLTR, 1927, S. 461. Pürglitzer Hochfläche 2. Pürglitzer Bergland 3. → Křivoklátská vrchovina 4. Pürglitzer Gebirge; Pürglitzer Wald 5. Křivoklatský les 8. So genannt nach der mittelböhmischen Stadt Pürglitz (Křívoklát), Bezirk Rakonitz (Rakovník). 10. Sedlmeyer, 1941, S. 28; OTS, 1975, S. 29. Pürglitzer Hochland 2. Pürglitzer Bergland 3. → Křivoklátská vrchovina 4. Pürglitzer Wald 5. Křivoklatský les 10. Werdecker, 1957, S. 29. Pürglitzer Wald 2. Pürglitzer Bergland 3. → Křivoklátská vrchovina 4. Pürglitzer Hochfläche 5. Les Křivoklátská (wörtl.); Křivoklatský les (wörtl.) 8. So genannt nach der mittelböhmischen Stadt Pürglitz (Křivoklát), Bezirk Rakonitz (Rakovník). 10. KB-Kt., 1943. Purkrabský 1. Teich; Südböhmischer Kreis (Jihočeský kraj) 7. Fischteich im Budweiser Becken (Českobudějovická pánev), 83 ha Fläche, beim Dorf Chlum, Bezirk Böhmisch-Leipa (Česká Lípa), durchflossen von der Moldau (Vltava). 10. Novotný, 1972, S. 48. Pustý zámek 1. Berg; Kreis Karlsbad (Karlovarský kraj) 2. Oedschloß 3. s.o. 4. Dunkelsberg 7. Erhebung im Duppauer Gebirge (Doupovské hory), 928 m hoch, Bezirk Karlsbad (Karlovy Vary). 9. Der Name deutet auf ein wüstes Schloß hin. 10. Rieger 2, 1862, S. 826; OAZ, 1924, Kt. 17; HKK, 1960, S. 78; GČZ, 1965, S. 78; ČV I, 1, 1968, S. 758; ZLHN, 1987, S. 427. Pustý zleb 1. Trockental; Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj) 2. Ödes Tal 3. s.o. 7. Cañonartiges Tal im Mährischen Karst (Moravský kras). 10. HKK, 1960, S. 72; GČZ, 1965, S. 146; ČV I, 1968, S. 348; Kunský, 1968, S. 46; RBL, 1989, S. 360; TLAZ, 2001, S. 720. Pustý žleb 1. Naturmerkwürdigkeit; Südmährischer Kreis (Jihomoravský kraj) 2. Oedes Tal 3. s.o. 7. Trockental im Mährischen Karst (Moravský kras). 10. Kunský, 1968, S. 46.