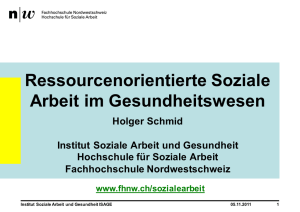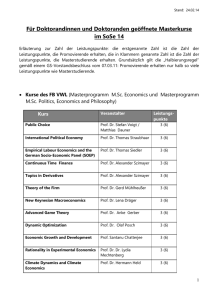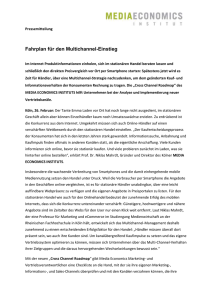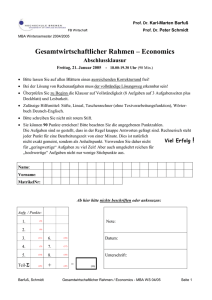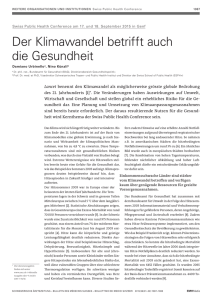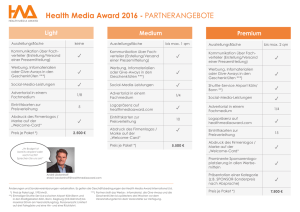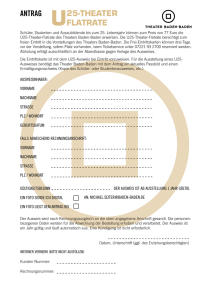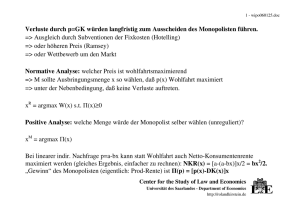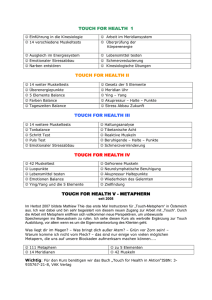Eisen - Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Werbung
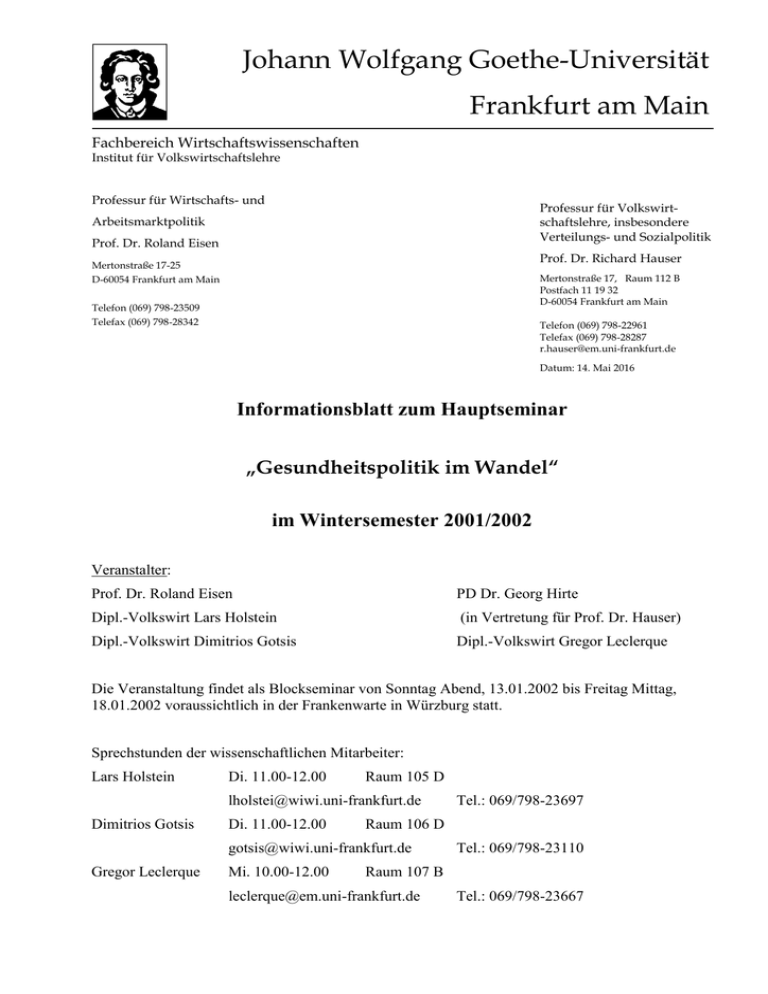
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Institut für Volkswirtschaftslehre Professur für Wirtschafts- und Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Verteilungs- und Sozialpolitik Arbeitsmarktpolitik Prof. Dr. Roland Eisen Prof. Dr. Richard Hauser Mertonstraße 17-25 D-60054 Frankfurt am Main Mertonstraße 17, Raum 112 B Postfach 11 19 32 D-60054 Frankfurt am Main Telefon (069) 798-23509 Telefax (069) 798-28342 Telefon (069) 798-22961 Telefax (069) 798-28287 [email protected] Datum: 14. Mai 2016 Informationsblatt zum Hauptseminar „Gesundheitspolitik im Wandel“ im Wintersemester 2001/2002 Veranstalter: Prof. Dr. Roland Eisen PD Dr. Georg Hirte Dipl.-Volkswirt Lars Holstein (in Vertretung für Prof. Dr. Hauser) Dipl.-Volkswirt Dimitrios Gotsis Dipl.-Volkswirt Gregor Leclerque Die Veranstaltung findet als Blockseminar von Sonntag Abend, 13.01.2002 bis Freitag Mittag, 18.01.2002 voraussichtlich in der Frankenwarte in Würzburg statt. Sprechstunden der wissenschaftlichen Mitarbeiter: Lars Holstein Di. 11.00-12.00 Raum 105 D [email protected] Dimitrios Gotsis Di. 11.00-12.00 Raum 106 D [email protected] Gregor Leclerque Mi. 10.00-12.00 Tel.: 069/798-23697 Tel.: 069/798-23110 Raum 107 B [email protected] Tel.: 069/798-23667 2 Die Teilnahme an dem Seminar ist nur nach erfolgreich abgelegter Zwischenprüfung möglich. Voraussetzung für den Erwerb eines Seminarscheins (6 Kreditpunkte) sind neben der Seminarteilnahme zwei mit mindestens „ausreichend“ bewertete Teilleistungen. Diese setzen sich zusammen aus: - Referat (inkl. Vortrag) 60% - Abschlussklausur 40% Eine erste Vorbesprechung einschließlich der Vergabe der Referatsthemen findet am Donnerstag, dem 12.7.2001 um 12.00 Uhr ct in Raum 320C statt. Eine spätere Anmeldung für das Seminar ist bis zum Beginn des Wintersemesters möglich. Bei einer ausreichenden Anzahl von Plätzen ist die Teilnahme auch für Studierende möglich, die einen AVWL-Schein erwerben möchten. Für die Teilnahme an dem Seminar muss bis spätestens 22.10.2001 eine verbindliche Anmeldung durch Unterschrift erfolgt sein. Ein späterer Rücktritt ohne Berücksichtigung als Prüfungsleistung ist nicht mehr möglich (§8 NPO des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften). Dies hätte dann einen Malus-Punkt zur Folge. Die Referate sollen einen Umfang von etwa 15 Seiten zuzüglich Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Anhang und Literaturverzeichnis aufweisen und in dreifacher Ausfertigung (eine davon kleinkopiert) eingereicht werden. Zur Gestaltung der Referate beachten Sie bitte die Anmerkungen auf den hinteren Seiten. Der Abgabetermin für die Referate ist Montag, 6. Januar 2002. Dieser Abgabetermin ist verbindlich, das heißt, verspätet abgegebene Referate können nicht berücksichtigt werden. Als allgemeine einführende Literatur werden empfohlen: Breyer, F. Zweifel, P. Gesundheitsökonomie, 3. Auflage, Heidelberg et al. 1999. Feldstein, P. Health Care Economics, 4. Auflage, Albany 1994 Gäfgen, G., Gesundheitsökonomie: Grundlagen und Anwendungen, Baden-Baden 1990. McGuire, A., Henderson, J., Mooney, G. The Economics of Health Care, London et al. 1988 Money, G., Economics, Medicine and Health Care, Cambridge 1992. Newhouse, Joseph R.: The Economics of Medical Care, Cambridge/Mass., 1978. 3 Themenübersicht: Referatsnummer Thema Professur Ansprechpartner 1 Das Gut Gesundheit: Definition, Charakteristika, Messung Eisen Gotsis 2 Die Nachfrage nach Gesundheit Hauser/ Althammer Leclerque 3 Determinanten der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen Hauser/ Althammer Leclerque 4 Alter und Gesundheit: Das Sisyphus-Problem Hauser/ Althammer Leclerque 5 Arzt und Patient: Verschiedene Dimensionen des Sachwalter-Problems Eisen Gotsis 6 Zur Theorie optimaler Krankenversicherungsverträge Eisen Gotsis 7 Das Krankenhaus in der ökonomischen Theorie Eisen Gotsis 8 Anreizwirkungen der dualistischen versus Anreizwirkungen der monistischen Finanzierung im Krankenhaussektor Hauser/ Althammer Leclerque 9 Die Anreizwirkungen verschiedener Vergütungssysteme im ambulanten Sektor Hauser/ Althammer Leclerque 10 Rationierung oder Rationalisierung als Instrument zur Ausgabenbegrenzung Eisen Holstein Eisen Holstein Hauser/ Althammer Leclerque 11 12 Managed Care: Die Health Maintenance Organization als Organisationsform der medizinischen Versorgung Reformansätze im Rahmen des bundesdeutschen Risikostrukturausgleichs und im Rahmen des Schweizer Risikoausgleichs 4 Literatur zu den einzelnen Referatsthemen. 1. Das Gut Gesundheit: Definition, Charakteristika, Messung Klarman, H.E. (1965): The Economics of Health, Columbia University Press, New York, London, S. 1-19. Pedroni, G./Zweifel, P. (1990): Wie misst man Gesundheit?, Studien zur Gesundheitsökonomie 14, Pharma Information, Basel Culyer, A. J. (1971): The nature of the Commodity ‘Health Care’ and its efficient Allocation, in: Oxford Economic Papers 23, S. 189-211. 2. Die Nachfrage nach Gesundheit Grossman, M. (1972): On the Concept of Health Capital and the Demand for Health, in: Journal of Political Economy 80/2, S. 223-255 Leu, P.E./Gerfin, M. (1992): Die Nachfrage nach Gesundheit – Ein empirischer Test des Grossman-Modells, in: Peter Oberender (Hrsg.), Steuerungsprobleme im Gesundheitswesen, Baden-Baden, S. 61-78 Muurinen, J.-M. (1982): Demand for Health: A Generalised Grossman Model, in: Journal of Health Economics 1, S. 5-28 3. Determinanten der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen Breyer, Friedrich/Ulrich, Volker (2000): Gesundheitsausgaben, Alter und medizinischer Fortschritt: Eine Regressionsanalyse, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 220/1, S. 117. Buchner Florian/Wasem Jürgen (2000): Versteilerung der alters- und geschlechtsspezifischen Ausgabenprofile von Krankenversicherern, Diskussionspapier 1/00, Greifswald Hansen, Paul/King, Alan (1996): The determinants of health care expenditure: A cointegration approach, in: Journal of Health Economics 15, S. 127-137 4. Alter und Gesundheit: Das Sisyphus-Problem Erbsland, Manfred/Ried, Walter/Ulrich, Volker (1999): Die Auswirkungen der Bevölkerungsstruktur auf Ausgaben und Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung, in: Entwicklung und Perspektiven der Sozialversicherung: Beiträge zum ZEW-Symposium: Ansätze zur Reform des Steuer- und Sozialversicherungssystems am 10. und 11. März 1997 in Mannheim, S. 173197. Wasem, Jürgen (1997): Die „Alterungsproblematik“ als Herausforderung für die Absicherung des Krankheitskostenrisikos, in: Schulenburg, J.-M. von der (Hrsg.), Allokation der Ressourcen bei Sicherheit und Unsicherheit, Baden-Baden, S. 65-92. Zweifel, P. and M. Ferrari (1992), Is there a Sisyphus Syndrome in Health Care?, in Zweifel,P. and Frech,H.E. III (eds.), Health Economics Worldwide, Boston: Kluwer, 311-330. 5. Arzt und Patient: Verschiedene Dimensionen des Sachwalter-Problems Labelle, R./Stoddart, G./Rice, T. (1994): A Re-Examination of the Meaning and Importance of Supplier-Induced Demand, in: Journal of Health Economics 13, S. 347-368 5 Pauly, M. V. (1980): Doctors and their Workshops: Economic Models of Physician Behavior, Chicago, London. Reinhardt, U.E. (1985): The Theory of Physician-Induced Demand: Reflections after a Decade, in: Journal of Health Economics 4, S. 187-193 Scott, Anthony (2000): Economics of General Practice, in: Handbook of Health Economics, hrsg.v. Anthony J. Culyer und Joseph P. Newhouse, Amsterdam u.a.O., S. 1175-1200 Zweifel, Peter (1982): Ein ökonomisches Modell des Arztverhaltens, Berlin 6. Zur Theorie optimaler Krankenversicherungsverträge Arrow, K.J. (1963): Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, in: American Economic Review 53, S. 941-973. Breyer, F. (1984): Moral Hazard und der optimale Krankenversicherungsvertrag. Eine Übersicht, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 140, S. 288-307. Eisen, R. (1979): Theorie des Versicherungsgleichgewichts, Duncker & Humblot, Berlin, insbesondere Kapitel 5. Pauly, M.V. (1974): Overinsurance and Public Provision of Insurance: The Role of Moral Hazard and Adverse Selection, in: Quarterly Journal of Economics 88, S. 44-62. 7. Das Krankenhaus in der ökonomischen Theorie Breyer, F. (1985): Die Fallpauschale als Vergütung von Krankenhausleistungen – Ideen, Formen und vermutete Auswirkungen, in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Heft 6, S. 743-767. Eichhorn, S. (1979): Betriebswirtschaftliche Ansätze zu einer Theorie des Krankenhauses, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Heft 3, S. 173-191. Gäfgen, G. (1982): Die Allokationswirkungen verschiedener Eigentumsrechte im Krankenhauswesen, in: Herder-Dorneich, Ph. u.a. (Hrsg.), Wege zur Gesundheitsökonomie II, Beiträge zur Gesundheitsökonomie, Bd. 2, Gerlingen (Bleicher) S. 101-157. Harris, J. E. (1977): The Internal Organisation of Hospitals: Some Economic Implication, in: BellJournal of Economics 8, S. 467-482. Pauly, M.V./Redisch, M. (1973): The Not-For-Profit Hospital as a Physicians’ Cooperative, in: American Economic Review 63, S. 87-99. 8. Anreizwirkungen der dualistischen versus Anreizwirkungen der monistischen Finanzierung im Krankenhaussektor Andreas, Heike (1994): Problemgeschichte der Gesundheitsökonomik in der Bundesrepublik Deutschland: die ökonomische Steuerung von Angebot und Nachfrage im Gesundheitswesen von der Kostenexplosion bis zum Gesundheitsstrukturgesetz, Diss, Köln Gäfgen, Gérard (1984): Effizienz- und Wettbewerbswirkungen der Krankenhausbedarfsplanung, Konstanz Heeß, Monika (1988): Formen der Krankenhausvergütung. e. mikroökonom. Analyse alternativer Systeme, Bern u.a.O. Hermann, Christopher (1999): Die zukünftige Rolle der Länder in der Krankenhauspolitik - ein Beitrag zur Diskussion um die GKV-Gesundheitsreform 2000, in: Arbeit und Sozialpolitik 53, S. 16-24 6 http://www.krankenhaus-gutachten.de/ Neubauer, G. (1984): Reform der Krankenhausfinanzierung – Ein dringliches Problem, in: Wirtschaftsdienst, 64 Jg., Heft II, S. 83-86 Pfaff, Martin/Wassener, Dietmar (1995): Das Krankenhaus im Gefolge des GesundheitsStruktur-Gesetzes 1993: Finanzierung, Leistungsgeschehen, Vernetzung, Baden-Baden Burger, Stephan (1999): Diagnostic Related Groups: Instrument zur Einführung einer leistungsorientierten Vergütung im Krankenhaus, in: Arbeit und Sozialpolitik 53, S. 24-31 Custer, W.S./Moser, J.W./Musacchio, R.A./Willeke, R.J. (1986): Hospital and Physician Behaviour under Medicare´s Prospective Payment System. Theory and Evidence, Discussion Paper 8617, American Medical Association, Chicago Geil, Peter (1996): Economic incentives and hospitalization in Germany, München Heeß, Monika (1988): Formen der Krankenhausvergütung. e. mikroökonom. Analyse alternativer Systeme, Bern u.a.O. Kehres, Erich (1994): Kosten und Kostendeckung der ambulanten Behandlung im Krankenhaus, Essen, Braunschweig, Diss. Klein, M. (1988): Diagnosis Related Groups, Landsberg/München MacClellan, Mark B. (1997): Hospital reimbursement incentives : an empirical analysis, in: The industrial organization of health care 6, S. 91 - 128 Million, Andreas/Zimmermann, Klaus F./Rotte,Ralph/Geil, Peter (2000): Economic Incentives and Hospitalization in Germany 9. Die Anreizwirkungen verschiedener Vergütungssysteme im ambulanten Sektor Custer, W.S./Moser, J.W./Musacchio, R.A./Willeke, R.J. (1986): Hospital and Physician Behaviour under Medicare´s Prospective Payment System. Theory and Evidence, Discussion Paper 8617, American Medical Association, Chicago Graf Schulenburg, J.-Matthias (1981): Systeme der Honorierung frei praktizierender Ärzte und ihre Allokationswirkungen, Tübingen Krauth, Christian et al. (1996): Zur Weiterentwicklung des Vergütungssystems in der ambulanten ärztlichen Versorgung, Diskussionspapier Nr. 9, Forschungsstelle für Gesundheitsökonomie und Gesundheitssystemforschung, Hannover Schwarze, Johannes (1999): Hausarztmodell und Praxisnetze : Zustimmung der Versicherten zu integrierten Versorgungsformen erkennbar, in: DIW-Wochenbericht 66, S. 187-191 Scott, Anthony (2000): Economics of General Practice, in: Handbook of Health Economics, hrsg.v. Anthony J. Culyer und Joseph P. Newhouse, Amsterdam u.a.O., S. 1175-1200 10. Rationierung oder Rationalisierung als Instrument zur Ausgabenbegrenzung Breyer, F./Kliemt, H. (1995): Solidargemeinschaften der Organspender: Private oder öffentliche Organisation? in: Oberender, P. (Hrsg.): Transplantationsmedizin, Gesundheitsökonomische Beiträge 23, Nomos-Verlag, Baden-Baden, S.135-215. Daniels, N. (1998): Rationing Medical Care – a philosopher’s perspective on outcomes and process. Symposium on the Rationing of Health Care 2, in: Economics and Philosophy, vol. 14, S. 27-50. Kopetsch, Thomas (2001): Zur Rationierung medizinischer Leistungen: Ein Modell für die Gesetzliche Krankenversicherung, in: Sozialer Fortschritt 1, Jg. 50, S. 20-28 Oberender, Peter/Giehl, Hermann (1995): Gesundheitswesen zwischen Rationalisierung und Rationierung 7 Tietzel, Manfred (1998): Ökonomische Theorie der Rationierung Wille, Eberhard (2000): Rationalisierungsreserven im deutschen Gesundheitswesen 11. Managed Care: Die Health Maintenance Organization als eine Organisationsform der medizinischen Versorgung Boetius, J. (2000): Zukunftssichere Finanzierung der Gesundheitsversorgung unter Berücksichtigung von Managed Care-Konzepten, Karlsruhe. Getzen, T. (1997): Health Economics, New York, Kapitel 10. Glied, S. (1999): Managed Care, NBER Working Paper 7205, in: http://www.nber.org/papers/w7205. Zweifel, P., Eisen, R. (2000): Versicherungsökonomie, Berlin, Abschnitt 7.2. 12. Reformansätze im Rahmen des bundesdeutschen Risikostrukturausgleichs und im Rahmen des Schweizer Risikoausgleichs Beek, K. van der/D. Cassel (1997): Funktionsbedingungen und Funktionsprobleme des Wettbewerbs im System der deutschen Krankenversicherung, in: K. von Delhaes/U. Fehl (Hrsg.), Dimensionen des Wettbewerbs. Schriften zu Ordnungsfragen der Wirtschaft, Band 52, Stuttgart, S. 285-320. Cassel, D. (1992): Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen von Wahlmodellen in der Gesetzlichen Krankenversicherung, Baden-Baden Cassel, D./Janßen, J. (1997): Äquivalenzprinzip, Wettbewerb und Risikostrukturausgleich in der sozialen Krankenversicherung, in: J.-M. v.d. Schulenburg/M. Balleer/S. Hanekopf (Hrsg.), Allokation der Ressourcen bei Sicherheit und Unsicherheit, Baden-Baden Cassel, D./Janßen, J. (1999): GKV-Wettbewerb ohne Risikostrukturausgleich? Zur wettbewerbssichernden Funktion des RSA in der Gesetzlichen Krankenversicherung, in: E. Knappe, (Hrsg.), Wettbewerb in der Gesetzlichen Krankenversicherung, Baden-Baden, S. 11-49. Jacobs, Klaus/Reschke, Peter/Cassel, Dieter/Wasem, Jürgen (2001): Zur Wirkung des Risikostrukturausgleichs in der gesetzlichen Krankenversicherung. Eine Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, in: http://www.rsf.uni-greifswald.de/bwl/gesundheit/_private/Wasem/RSA-Gutachten.pdf Lauterbach, Karl W./Wille, Eberhard (2001): Modell eines fairen durch den Risikostrukturausgleich. Sofortprogramm „Wechslerkomponente und solidarische Rückversicherung“ unter Berücksichtigung der Morbidität http://www.vdak.de/download/endgutachten_rsa.pdf. Müller, J. / W. Schneider (1998): Entwicklung der Mitgliederzahlen, Beitragssätze, Versichertenstrukturen und RSA-Transfers in Zeiten des Kassenwettbewerbs, in: Arbeit und Sozialpolitik, 52, S. 10-32. Oberender, P. / T. Ecker (1998), Der Risikostrukturausgleich in der GKV: eine ordnungsökonomische Analyse, in: E. Knappe, (Hrsg.), Wettbewerb in der Gesetzlichen Krankenversicherung, Baden-Baden, S. 51-60. Wynand, P. M. u.a. (1996), Risikoausgleich in einem wettbewerblich strukturierten Krankenversicherungsmarkt: Reichen Alter und Geschlecht aus?, in: P. Oberender, (Hrsg.), Alter und Gesundheit, Baden-Baden, S. 175-198. Beck, Konstantin (1998): Kann der Risikoausgleich unterlaufen werden? Analyse der schweizerischen Ausgleichsformel, in: Fairness, Effizienz und Qualität in der Gesundheitsversorgung, Berlin, S. 99 – 146 8 Felder, Stefan/Beck, Konstantin/Knappe, Eckhard (1999): Risikoausgleich und Managed Care, in: Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung: Tagungsband des Gesundheitsökonomischen Ausschusses, S. 65-78 http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.112.1.de.pdf. Zweifel, Peter/Lambelet, Jean-Christian/Zeltner, Thomas (1997): Swiss health policy, in: Economic policy in Switzerland, Basingstoke, Hampshire, S. 152 – 179 9 Hinweise zur Abfassung des Referats a) Literatursuche Zu Beginn steht natürlich die Suche nach relevanter Literatur. Für den Einstieg in die Thematik sollten Sie die angegebene Grundlagenliteratur beachten, sowie Texte aus dem „Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaften“ und gegebenenfalls des Sachverständigenrates und der sechs Wirtschaftsforschungsinstitute. Literatur finden Sie auf folgenden Wegen: Zeitschriften: Sie können relevante Zeitschriften nach Artikeln zu Ihrem Thema durchschauen. Zeitschriften gibt es in der Universitätsbibliothek, in der Fachbereichsbibliothek und bei den Lehrstuhlbibliotheken. Welche Zeitschriften relevant sind, erfahren Sie vom Bibliothekspersonal bzw. am Lehrstuhl. Semesterapparat: In der Fachbereichsbibliothek ist der Semesterapparat aufgebaut. Dort steht zu jeder Veranstaltung relevante Literatur. In der Regel handelt es sich dabei um allgemeinere Literatur zu dem Thema des Seminars. Diese Literatur kann als Ansatzpunkt für weitere Literatursuche dienen. Literaturdatenbank auf CD-ROM: In der Universitätsbibliothek gibt es Literaturdatenbanken auf CD-ROM. Dabei handelt es sich um Datenbanken, die neben Bücher auch Zeitschriftenaufsätze enthält. In einigen Datenbanken gibt es zu den Titel sogenannte Abstracts, das sind kurze Zusammenfassungen. Sie können nach Autoren, Titeln, Schlagwörtern u.a. suchen. In der Fachbereichsbibliothek - in der Nähe der Semsterapparate - gibt es auch einen zugänglichen Computer mit einem ausschließlichen Anschluß ans "Infonetz" (ION), mit dem Sie in diesen Literaturdatenbanken recherchieren können. In der Stadt- und Universitätsbibliothek werden Einführungen in das ION gemacht. Bibliothekskataloge: In den Bibliotheken befinden sich Bibliothekskataloge, zum Teil auf Computern, zum Teil auf Karteikarten, mit denen Sie ähnlich wie mit den CD-ROM Datenbanken nach Literatur, die sich in den entsprechenden Bibliotheken befinden, suchen können. Bei Fragen wenden Sie sich am besten wieder an das Bibliothekspersonal. Weitersuchen anhand von Literaturlisten: Wenn Sie schon einen oder mehrere Titel gefunden haben, sollten Sie sozusagen nach dem Schneeballsystem weitersuchen. Schauen Sie das Literaturverzeichnis nach weitererer zu Ihrem Thema gehöriger Literatur durch. Das Problem dabei ist, dass die Literatur, die Sie dadurch finden, immer älter wird. Sie können aber die Angaben im Literaturverzeichnis auch dafür verwenden, um herauszufinden, nach welchen Stichwörter oder auch Autoren sie sonst noch suchen können, z.B. in den Literaturdatenbanken oder in den Bibliothekskatalogen. Weitere Vorschläge zur Literatursuche können Sie dem Studienführer entnehmen. Sollten Sie trotzdem nicht weiterkommen, fragen Sie zunächst das Personal der entsprechenden Bibliothek. 10 b) Konzept und Gliederung Nachdem Sie Literatur für Ihr Thema gefunden haben, sollten Sie sich ein Konzept und eine Gliederung für Ihre Seminararbeit überlegen. Mit diesem Konzept und dem Ergebnis Ihrer Literatursuche kommen Sie dann möglichst bald in die Sprechstunde der wissenschaftlichen Mitarbeiter, um mit ihnen das weitere Vorgehen abzusprechen und abzuklären, ob Sie wichtige Literatur bzw. wichtige inhaltliche Punkte übersehen haben. c) weitere Hinweise Abkürzungen: Aus Gründen der Lesbarkeit sollten Sie es möglichst vermeiden, Abkürzungen zu verwenden. Die Abkürzungen, die Sie verwenden, sind in jedem Fall beim ersten Auftauchen im Text zu erläutern (auch dann, wenn es ein Abkürzungsverzeichnis gibt). Variablennamen, die in Gleichungen etc. verwendet werden, sind im Zusammenhang mit der Gleichung jedesmal wieder zu erklären. Im Text verwenden Sie zu den Variablennamen auch die entsprechende Bezeichnung. Beispiel: "Wenn der Lohnsatz w steigt, erhöht sich das Einkommen Y" statt " Wenn w steigt, erhöht sich Y". Werden viele Abkürzungen verwendet, kann ein Abkürzungs- und/oder Symbolverzeichnis sinnvoll sein. Tabellen und Abbildungen: Tabellen und Abbildungen sind so zu gestalten, daß sie "für sich sprechen", also verstanden werden können, ohne daß der dazugehörige Text gelesen wird. Dazu gehört in jedem Fall eine Überschrift und dass Spalten und Zeilen bzw. Achsen beschriftet werden. In Fußnoten unter den entsprechenden Tabellen bzw. Abbildungen sind Variablen, Datengrundlage, Quellen etc. (kurz) zu erläutern. Ein Tabellen- bzw. Abbildungsverzeichnis ist sinnvoll, wenn viele Tabellen bzw. Abbildungen in der Arbeit enthalten sind. Literaturverzeichnis: In jedem Fall ist ein Literaturverzeichnis zu erstellen. Die einzelnen Titel sind alphabetisch nach Autoren und dann nach Erscheinungsjahr zu ordnen. Gibt es zu einem Autor mehrere Titel in einem Jahr sind die Erscheinungsjahre mit a, b, c usw. zu versehen, z.B. 1996a, 1996b etc., um sie bei den Literaturverweisen im Text unterscheiden zu können. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die Literaturhinweise im Literaturverzeichnis aussehen können. Wichtig ist, daß sie sich für eine Möglichkeit entscheiden, und diese konsequent durchhalten. Außerdem müssen immer folgende Informationen enthalten sein: 1. Name aller Autoren inkl. Vornamen, die abgekürzt sein können, 2. Titel und evtl. Untertitel und 3. Erscheinungsjahr. Außerdem kommt bei Zeitschriftenaufsätzen hinzu der Name, Jahrgang und Ausgabe der Zeitschrift sowie die Seitenzahlen des Aufsatzes. Bei Beiträgen in Sammelbänden kommt nach dem Titel bzw. Untertitel "in:" dann folgen die Autoren - in Klammern folgt dann "(Hrsg.)", der Titel und der Erscheinungsort des Sammelbandes sowie die Seitenzahlen des Beitrags. Bei Büchern folgt nach dem Titel der Erscheinungsort. Mittlerweile wird neben dem Erscheinungsort häufig auch der Verlag 11 erwähnt. Dies ist aber nicht unbedingt nötig. Das Erscheinungsjahr ist entweder nach den Autoren oder am Ende des Literaturhinweises platziert. Im Literaturverzeichnis müssen alle Beiträge erwähnt sein, die verwendet wurden. Auch Originalquellen, die aus Sekundärliteratur zitiert werden, sind aufzuführen. Literatur, die zwar von Ihnen gelesen, aber nicht im Text erwähnt wurde, gehört dagegen nicht hinein. Literaturverweise im Text: Auch für die Literaturverweise im Text gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir schlagen vor, daß Sie Informationen über die Quellen in einer Fußnote unterbringen. Auch hierbei gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder erwähnen Sie nur den Namen und die Jahreszahl (Bsp.: Franz (1996), S. XXX), oder Sie zitieren entsprechend dem Studienführer (Bsp.: vgl. Franz, Wolfgang: Arbeitsmarktökonomik, 3. Auflage, Berlin u.a. 1996, S. XXX bei Wiederholung der Quelle: Franz, Wolfgang, a.a.O., S. XXX). Das Kürzel vgl. (vergleiche) ist bei sinngemäßen Zitaten zu verwenden, bei wörtlichen dagegen wegzulassen. Wortwörtliche Zitate sollten sich aber nicht über mehrere Zeilen erstrecken und sind nur dann sinnvoll, wenn es auf die exakte Formulierung ankommt (z.B. bei Definitionen). Bei beiden Zitierweisen ist es wichtig, daß Sie die Seitenangaben nicht vergessen. Ebenfalls wichtig ist, daß Sie sich für eine Variante entscheiden und diese konsequent im Text durchhalten. Weitere Hinweise zum Zitieren gibt der Studienführer (hier besonders die 5. Auflage von 1990, die in der Fachbereichsbibliothek steht). Formatierung Hinsichtlich der Formatierung gelten folgende Vorgaben: - Schriftgröße 12 für den Text; Fußnoten können Schriftgröße 10 besitzen - Zeilenabstand anderthalbzeilig - linker oder rechter Rand mindestens 4cm (für Anmerkungen). In allen Zweifelsfällen schauen Sie bitte im Studienführer nach oder fragen Sie - wie auch bei allen anderen Problemen bezüglich der Abfassung der Arbeit - in der Sprechstunde nach. Die Berücksichtigung dieser Formvorschriften inklusive der Beachtung der korrekten Rechtschreibung wird vorausgesetzt. Schwerwiegende Mängel können nicht nur eine deutliche Abwertung bei der Notengebung zur Folge haben, sondern können auch zu einer mangelhaften Bewertung führen.