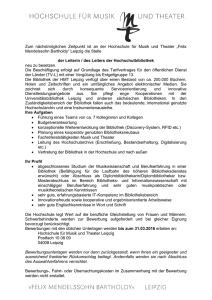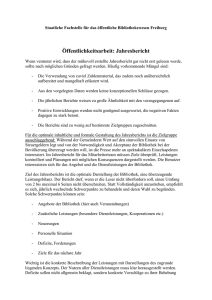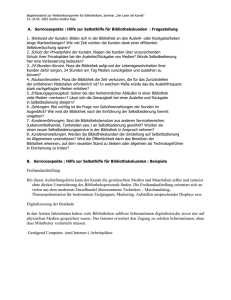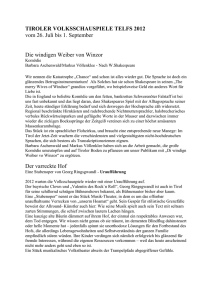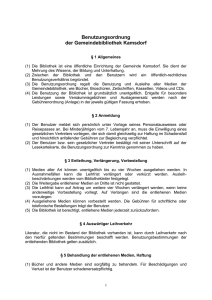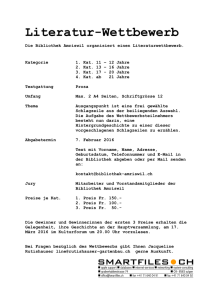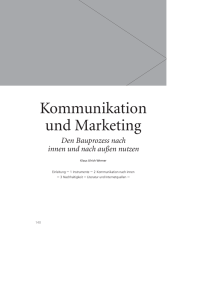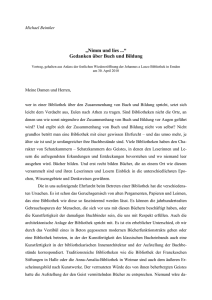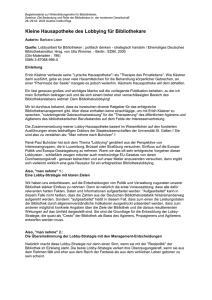Österreichische Bildungspolitiken - von Maria Theresia bis Elisabeth
Werbung

Cin Ali Lernklub - Bibliothek Eine Feldforschung zur Erhebung und zum Abbau der Bildungsbarrieren von Einwandererfamilien aus der Türkei unter besonderer Berücksichtigung der Frauen Bibliothek und Projekte wurden gefördert von: Kulturabteilung des Landes Tirol Integrationsabteilung des Landes Tirol Monika Himsl, Projektleiterin 1 Inhalt Vorwort: „….. allerdings auf Türkisch und somit erfolglos.“ ……………………………………. 3 1. Projekt-Beschreibung……………………………………………………………………........... 5 2. Dokumentation und Evaluation des Pilotprojektes …………………..………………......... 14 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Projektbeschreibung………………………………………………………….……….... 14 Dokumentation und Evaluation..…………………………………………….……….... 16 Entlehntätigkeit und –bilanz und Leseanimation……………………………………... 18 Türkisch/deutsche Märchenstunden…………………………………………………… 20 Mutter-Kind-Kurse und familiäre Lernhilfe ……………………………………………. 22 Öffentlichkeitsarbeit und Interaktionen……………………………………………….... 25 Zusammenfassung……………………………………………………………………..... 29 3. Dokumentation und Evaluation des Familien-Lernhilfe-Projektes………………………... 33 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Die Projektbeschreibung…………………………………………………………………. 33 Die Evaluation…………………………………………………………………………….. 35 Die Ergebnisse……………………………………………………………………………. 37 Die Schlussfolgerungen………………………………………………………………….. 40 Die Nebenergebnisse…………………………………………………………………….. 41 4. Schlusswort…………………………………………………………………………………...... 44 5. Literatur………………………………………………………………………………………..... 45 Anhang A: Humankapitaltheorie von Pierre Bourdieu…………………………………...… 46 Anhang B: Vorgängerprojekte……………………………………………………………….. 48 Anhang C: Erstes Konzept eines möglichen Folgeprojektes……………………………… 49 Anhang D: Mensana …………………………………………………………………………. 50 2 „… allerdings auf Türkisch und somit erfolglos.“ „Drei Türkinnen lagen in der Grazer Frauenklinik einen Tag lang im gleichen Zimmer - das war die Ausgangssituation für die Verwechslung. Als am Abend eine Frau, die schon in der 40. Woche schwanger war, zu einer Untersuchung aufgerufen wurde, wurde der Name vermutlich falsch ausgesprochen. Türkin hat sich verhört Eine andere - eher stämmige - Frau, die erst in der 28. Woche schwanger war, meldete sich und erhielt dadurch eine falsche Krankenakte, sagt Günther Bergmann der ärztliche Leiter des LKH. Die Frau wurde in den Kreißsaal gebracht und die Wehen eingeleitet. Die Türkin versuchte noch, die Ärzte und Schwestern auf den Irrtum hinzuweisen, allerdings auf Türkisch und somit erfolglos.“ ORF-Online, 9.7.2004 „Wie konnte das passieren?“ dachte ich mir, als ich diese Schlagzeilen las. Seit den frühen Sechzigerjahren leben und arbeiten türkischsprachige Menschen in Österreich. Seit den frühen Siebzigerjahren holen diese Menschen ihre Familien nach – Männer und Frauen, Eltern und Kinder. Die Kinder besuchen die österreichischen Schulen und die Frauen bringen in österreichischen Kliniken ihre Kinder zur Welt. Behörden, Bildungseinrichtungen und Krankenhäuser hatten drei Jahrzehnte lang Zeit, sich auf diese stetig wachsende Bevölkerungsgruppe einzustellen. Und da wurde nun mitten im Jahre 2004 eine Frau an einer österreichischen Geburtenstation gegen ihren Willen drei Monate zu früh entbunden, obwohl sie sich in ihrer türkischen Muttersprache verständlich zu machen und einen Dolmetscher zu bekommen versuchte, der die Verwechslung hätte aufklären können. Warum sprach diese Frau nicht Deutsch? Warum sprach das Klinikpersonal den Namen der Frau nicht richtig aus? Warum verstand an dieser Geburtenstation, an der doch offensichtlich sehr viele türkische Frauen gebären, das Personal nicht so viel Türkisch, dass es ein heftiges NEIN und das Verlangen nach einem Dolmetsch verstand? Nun, diese Fragen-Konstellation war symptomatisch für den Stand der Integration türkischer Frauen in der österreichischen Gesellschaft im Projektszeitraum. Meine Fragen waren indessen nur rhetorisch. Den Antworten hatte ich mich nämlich damals durch ein Projekt und seine wissenschaftliche Begleitung schon ziemlich angenähert: die Cin Ali Lernklub Bibliothek war als mehrteiliges Pilot-Projekt ca. ein Jahr bevor diese folgenschwere Grazer Verwechslung in den Schlagzeilen erschien entstanden. Ziel der Sonderbibliothek war es gewesen, genau Fragen wie diese beantworten zu helfen und Lösungsmöglichkeiten zu erforschen. Der Entstehungsort der Projekt-Idee war Mieming, ein 3000-Seelen Dorf in Tirol, in dem ich als eine der Initiatorinnen bereits zweimal über einen längeren Zeitraum türkischsprachigen Kindern freiwillige Lernhilfe erteilt hatte, wie ich es davor auch schon in Wien getan hatte (siehe Anhang B). Die dörflichen Strukturen lassen soziale Hierarchien transparenter erscheinen als städtische, daher fiel mir ein eklatanter Unterschied zwischen den überschaubar wenigen zweisprachigen Familien des Dorfes auf. Zweisprachige Familien, in denen ein Elternteil vom englischen oder französischen Sprachraum kam, während der andere österreichisch war, hatten ein unvergleichlich höheres Sozial- aber auch Sprachprestige als Familien von denen beide 3 Elternteile türkisch oder türkisch/kurdischsprachig waren, Familien also, die aufgrund der nichtdeutschen Muttersprache(n) und der deutschen Landessprache zwei- oder dreisprachig waren. Vor allem für die Schulkinder bedeutet dies eine sehr unterschiedliche Ausgangsposition. Die englisch/deutsch- oder französisch/deutschsprachigen Kinder hatten durch ihre familiäre nichtdeutsche Muttersprache einen schulischen Vorteil, da Englisch aber auch Französisch als Schulfach oder Freifach im Lehrplan der österreichischen Schulen vorgesehen ist, während die Kinder von aus der Türkei stammenden Eltern doppelt benachteiligt waren, da sie oft erst mit dem Kindergarteneintritt deutschsprachig wurden und darüber hinaus ihre Erstsprache(n) und die gesamte zugehörige Kultur (Wortschatz, traditioneller Geschichtenschatz, Literatur, Liedergut) in der Schule kaum verwerten konnten. (siehe Bourdieu, 2001) Das hatte auch einen Niederschlag in den Stundenplänen. Zwar gibt es grundsätzlich die Möglichkeit eines muttersprachlichen Unterrichts in türkischer Sprache, doch in keiner der drei Mieminger Schulen fand dieser im Projektzeitraum statt, vor allem weil zu wenig Kinder von ihren Eltern angemeldet wurden. Der Vergleich mit den Schulen der umliegenden Orte zeigte den Initiatorinnen aber, dass durchaus auch in kleineren Orten und Schulen diese muttersprachliche Förderung in türkischer Sprache möglich war. (Beispiel: Mötz). Kinder mit kurdischer Muttersprache wiederum kamen im Schuljahr 2002/2003 in ganz Österreich nicht in den Genuss eines schulischen Unterrichts in ihrer Muttersprache da sie nicht (mehr) unterrichtet wurde1. Das erschien insofern bemerkenswert, als die Erkenntnisse der Sprachwissenschaftler bezüglich der Vorteilhaftigkeit des muttersprachlichen Unterrichts für das Erlernen weiterer Fremdsprachen, unter anderem auch der deutschen Unterrichtssprache als Zweitsprache seit 1998 als den österreichischen Lehrpersonen bekannt vorausgesetzt werden konnte (vgl. Dr. Rudolf de Cillia, 1998) und auch, weil bereits Anfang der 1990er Jahre das Unterrichtsprinzip „interkulturelles Lernen“ in Österreichs Schulen eingeführt worden war. Noch krassere Unterschiede als bei den Kindern waren bei den fremdsprachigen Eltern, insbesondere bei den Müttern zu beobachten. Während Französinnen oder Frauen aus dem englischsprachigen Raum sehr gut integriert schienen, waren die türkisch- oder kurdischsprachigen Mütter sichtlich am Rande der Gesellschaft verortet. Sie traten bei Elternabenden oder -versammlungen oder Schulausflügen viel weniger in Erscheinung, während die französisch- oder englischsprachigen Mütter eher überdurchschnittlich engagiert waren, was mir vor allem bei der Durchführung eines Englisch-KinderbibliotheksProjektes und in der Zeit des Beginns der Kommunalpartnerschaft Miemings mit dem Ort französischen Ort Limas aufgefallen war. Angeregt durch die Arbeiten an meiner Diplomarbeit aus Politikwissenschaft zum Thema Bildungspolitik wollte ich aufbauend auf die Kulturkapitaltheorie nach Pierre Bourdieu (siehe Anhang A) eine eigenständige Forschungsarbeit begleitend zu diesem Projekt schreiben, um diesen Unterschieden auf den Grund zu gehen. Einerseits sollten die alltäglichen Umstände dieser Benachteiligung mit der Methode der teilnehmenden Beobachtung erforscht werden - im Sinne einer „individuellen Forschung“, wie sie Johann Galtung2 auch für die Friedens- und Konfliktforschung angeregt hatte. Andrerseits sollten – eventuell im Rahmen der Kinderfreunde-Organisation, der ich damals angehörte - Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden, die diese auch in der Verbandsarbeit und in der Erwachsenenbildung bemerkbaren und sich verstärkenden strukturellen Benachteiligungen3 sichtbar und dadurch auch überwindbar machen könnten. Monika Himsl, Mieming, Juli 2006 1 Informationsblätter des Referates für interkulturelles Lernen Nr.5/2003, S. 6 Galtung: Strukturelle Gewalt, 1975, S. 98 3 Braun, ea: Lernort Kinderfreunde, 1998, S. 43 ff 2 4 1) Projekt-Beschreibung Das Forschungs-Projekt Cin Ali Lernklub wurde im Juni 2003 von den Recherchen zu der Diplomarbeit4 der Projektinitiatorin inspiriert, die Studentin der Politikwissenschaft an der Leopold Franzens Universität Innsbruck ist. Sie wollte damit einerseits die Kulturkapitaltheorie von Pierre Bourdieu (siehe Anhang A) praktisch erproben und gleichzeitig Konzepte für niederschwellige Bildungsangebote für eine bildungspolitisch extrem benachteiligte Bevölkerungsgruppe entwickeln (siehe Anhänge C und D), indem sie die offensichtlichen Bildungsbarrieren der Kinder und Mütter von türkischsprachigen Familien im ländlichen Tiroler Oberland und in fallweise auch in Innsbruck zu erforschen und zu überwinden versuchte. Dabei konnte sie auf frühere Erfahrungen mit Deutsch-Nachhilfe für türkische und türkisch-kurdische Schul-Seiteneinsteiger sowie vormalige Bibliotheksprojekte aufbauen (siehe Anhang B). Die geringe Mobilität der türkischen bzw. kurdischen Frauen und die soziokulturellen Besonderheiten ihrer Gesellschaft (Trennung der Gesellschaft in eindeutige Männer- und Frauenbereiche) sollten in diesen Versuchen ausdrücklich berücksichtigt, sowie die nichtdeutschen Familiensprachen als gleichwertige Sprache anerkannt werden. Der Name Cin Ali5 sollte dabei vor allem die Mütter an die eigene Schulzeit erinnern und einen direkten und emotionalen Bezug zur ihren eigenen Lese- und Sprachsozialisationen herstellen bzw. mit Hilfe einer mehrsprachigen Kinderbibliothek daran anknüpfen. Der Cin Ali Lernklub bezweckte darüber hinaus bewusst, zusätzliche soziale Trennungen zu überwinden sowohl die Trennung zwischen österreichischer Schul- und türkischer Familienwelt als auch die zwischen türkischer bzw. kurdischer und österreichischer Frauenwelt. Dazu sollten Bücher in mehreren Sprachen regelmäßig auch von den Frauen und Kindern in den Familien gemeinsam mit einer Österreicherin gelesen werden. Dieser Ansatz wurde durch Berichte von großen Untersuchungen im angelsächsischen Sprachraum6 angeregt. Später sollten dann türkische (und als Fernziel kurdische) Kinderbücher und Alphabet-Tafeln auch in der Schule und in der öffentlichen oder der Schulbibliothek Eingang finden und vor allem die weiblichen deutschsprachigen Schul- und Gemeindepartner in Kontakt mit der türkischen und kurdischen Sprache treten. Dafür wurde über die Verwendung der neuen Medien der Kontakt zu türkischen/kurdischen Vereinen, Verlagen und Bücherspendern in Österreich, in Deutschland und der Türkei gesucht. Das Projekt sollte in der Folge auch eine eigene Homepage erhalten, zu Beginn war es auf Unterseiten der persönlichen Homepages der Projektleiterin7 präsentiert. Nach der Aufnahme der kleinen Sonderbibliothek in den Verein Bibliotheksverband Österreichs wurde der Webspace des BVÖ-Servers genutzt. Eine Vernetzung via Internet mit ähnlichen Projekten in anderen Ländern sollte dadurch möglich werden. Eine abschließende Evaluationsstudie sollte die einzelnen Projektbestandteile dokumentieren, die gewonnenen Daten elektronisch erfassen, auswerten und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse in ein konkretes Folgeprojekt umformulieren. Durch die außerordentlich interessanten Erkenntnisse wurde der ursprüngliche Projektplan mehrfach abgeändert. Nach dem Ablauf von drei Jahren muss nun ein vorläufiger Abschluss gemacht werden. „Österreichische Bildungspolitiken – von Maria Theresia bis Elisabeth Gehrer – und wieder zurück?“ noch nicht abgeschlossen. 5 Die zehnteilige Cin Ali Serie war eine Leselernreihe die das Alltagsleben von Cin Ali, einem StrichmännchenBuben in sehr einfachen, bebilderten Texten in Großdruck beschrieb. 6 z. B. Tizard, J., e. a.: Collaboration between Teachers and Parents in Assisting Children’s Reading. In: British Journal of Educational Psychology, vol. 52, Nr. 1 1982, S. 1-15, zitiert in: Krumm, Volker, 1996, S. 275 7 www.monikahimsl.at und http://homepage.uibk.ac.at/homepage/csac/csac4763/ 4 5 Das insgesamt dreijährige Feldforschungsprojekt gliedert sich rückblickend in zwei Abschnitte, für die teilweise die Tiroler Landesorganisation der Kinderfreunde die rein formelle Trägerschaft übernommen hatte (2004-2005): 1.1) 1.2) Phase: Pilotprojekt (erste Evaluierung) Phase: mehrere vertiefende Folgeprojekte (eine weitere Evaluierung) Ad Phase 1.1) Pilotprojekt (siehe Evaluation Punkt 2 ab Seite 14) Ziele des Pilot-Projektes: Kurzfristige Ziele: Aufbau einer kleinen mehrsprachigen Wanderbibliothek mit Stammleserkreis Erhebung der Lernbedingungen und des Lernumfeldes der Projektteilnehmer Kulturaustausch und Kulturtransfer für Kinder und Frauen auf der Grundlage der Kulturkapitaltheorie von Pierre Bourdieu8. Bewusstwerden der Vorteile der Mehrsprachigkeit auch bei Sprachen mit niedrigem Sprachprestige Die Sensibilisierung für die grundsätzliche und auch vom Ministerium und vom EUAktionsplan 2004 - 2006 anerkannte Gleichwertigkeit der Sprachen und die Selbstverständlichkeit des Rechtes auf das schulische Erlernen der Muttersprache neben zwei weiteren Sprachen von frühester Kindheit an Sensibilisierung für die Diskriminierung der türkischen und/oder kurdischen Muttersprache bei den Betroffenen, ihrer Umgebung und den zuständigen Behörden Langfristiges Ziel: der sukzessive Aufbau einer großen mehrsprachigen Kinderbibliothek mit Leseanimation und Lernhilfe für Kinder und Frauen an einem zentralen Standort, um darauf aufbauend ähnliche Projekte und Angebote an anderen Orten anregen und mit einem entsprechenden Angebot an Büchern unterstützen zu können. Mittel der Zielerreichung im Pilotprojekt-Zeitraum: Die projektierte Förderung der Lese- und Sprachkompetenz und Aufwertung der Mehrsprachigkeit sollte durch regelmäßiges mehrsprachiges Vorlesen in den türkischen bzw. türkisch/kurdischen Familien durch Muttersprachler aus Büchern einer erst zu schaffenden Wander-Bibliothek erreicht werden. Die für den Bibliotheksaufbau nötigen Interaktionen zu verschiedensten Personen, Institutionen und Betrieben sollten dabei gleichzeitig auch schon der Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung für die Thematik dienen. Pilotprojekt-Zeitraum: Juni 2003 bis August 2004 Projektphasen: a) Vorbereitung: Juni 2003: an 5 Treffen der beiden Initiatorinnen (Projektleiterin und eine türkischsprachige Mutter des selben Ortes) entstand der deutsche Text des ersten Cin Ali Heftes. Zehn erste Exemplare des zweisprachigen Büchleins wurden hergestellt und verschiedenen Personen übermittelt. 29 türkische Bücher, die großteils von einem früheren Projekt 9 der österreichischen Initiatorin stammten, wurden aus der Bibliothek Telfs längerfristig ausgeliehen. Die türkische Initiatorin versprach, im Urlaub in Ankara mehr und vor allem leseleichtere türkische Kinderbücher zu besorgen. b) Durchführung: 4. September 2003 bis 10. Juli 2004 Aufbauphase: Aufbau der Wanderbibliothek. September 2003 bis Februar 2004. 8 Bourdieu, Pierre: 1983, 2001 Willy Black Library – eine Sammlung von zuerst nur englischen später aber auch französischen, italienischen und türkischen Kinderbüchern zum Zweck des Verleihs an Familien, in denen diese Sprachen gelernt oder gesprochen werden. Projektdauer 1998-2001. Siehe auch Anhang B. 9 6 Neben dem sukzessiven Ankauf, Binden, Einbinden und provisorischen Katalogisieren der Bücher, begann der Verleihbetrieb am 4. September 2003. Ab 7. November 2003 bis 28. Jänner 2004 gab es ein erstes außerschulisches kulturelles Angebot in der Bibliothek Mötz: die türkisch/deutschen Märchenstunden. Eine Gruppe von acht Kindern lernte nach einem komparativen Ansatz gleichzeitig mit türkischen und deutschen Büchern und Wörterbüchern arbeiten. Familienphase: Neukonzeption nach der Semesterpause. Februar/März bis Juli 2004. Auf Antrag der Projektleiterin übernahm die Kinderfreunde-Landesorganisation Tirol die Trägerschaft. Dadurch konnten verschiedene Subventionsansuchen und Wettbewerbs-Beteiligungen in Angriff genommen werden. Gleichzeitig lief das eigentliche Pilotprojekt IN den sieben Familien an, die sich im Laufe dieser Zeit durch Mundpropaganda dazu anmeldeten. Aufgrund von Öffentlichkeitsarbeit und laufender Evaluation und Dokumentation war es möglich, offizielle Anerkennung durch erste Subventionen (Integrationsabteilung des Landes Tirol, Kulturabteilung des Landes Tirol) zu erhalten und am 26. Juni 2004 konnten zwei Projektkinder in Linz den Kinderrechtspreis 2004 für das Projekt entgegennehmen, der nicht nur eine weitere Publikations-Möglichkeit und somit Bekanntheit bedeutete, sondern ebenfalls durch Buchgutscheine eine Erweiterung der Bibliothek ermöglichte. c) Nachbereitung: Juli und August 2004: In der geplanten Nachbereitungsphase erfolgten Buchbestellungen aufgrund der einmaligen Beihilfe der Kulturabteilung und der Buchgutscheine des Kinderrechtspreises 2004, Projektabrechnung sowie die computerunterstützte Projektevaluation. Damit war das Pilotprojekt abgeschlossen gewesen. Da die Leiterin noch im August 2004, und somit vor Beginn des neuen Schul- und Kursjahres von Bildungsministerin Elisabeth Gehrer über die Verleihung des Europasiegels für innovative Sprachprojekte 2004 informiert und zudem vom Büchereiverband Österreichs als Mitglied mit der Büchereiordnungszahl 70209 003 818 aufgenommen wurde, schien das inzwischen konzipierte Folgeprojekt in greifbare Nähe gerückt zu sein (siehe Anhang C). An einem geeigneten Standort (ursprünglich Telfs) sollte ein Lernzentrum mit integrierter mehrsprachiger Bibliothek eingerichtet werden. Bis zur Realisierung sollte ein kleineres Folgeprojekt die inzwischen entstandenen Konzepte konkretisieren und praktisch erproben. Ad Phase 1.2) Mehrere vertiefende Folgeprojekte Im Wesentlichen gab es vier Folgeprojekte: a) b) c) c) Familien-Lernhilfe-Projekt Alfabem – Alphabetisierung am Küchentisch und im Gebetshaus Bilinguale Leseanimation LARA – Lernen - ARbeiten - Ausleihen Im Herbst 2004 begann die Vorbereitung der Bibliothekserrichtung in Telfs (projektierter Zeitpunkt Jänner/Februar 2005) durch Trägersuche, Anmeldung zu den nötigen Schulungen durch den Büchereiverband (Bibliothekskurs Block 1) sowie der Anmeldung zum Gründungswettbewerb Adventure X, mit dessen Hilfe ein „Businessplan“ für die neu einzurichtende Bildungseinrichtung erarbeitet werden sollte. Mit dem Preisgeld des Europasiegels, das am 19. November 2004 im Bildungsministerium überreicht wurde, sowie mit privaten Spenden konnten weitere 207 türkische, kurdische und zweisprachige Kinderbücher für die Bibliothek angekauft werden. Damit all diese Bücher und Erkenntnisse bis zur endgültigen Einrichtung der Räume in Telfs weiter genutzt würden, beantragte die Projektleiterin für ein „Familien-LernhilfeProjekt“ eine weitere Landes-Subvention, die auch gewährt wurde. Mit dieser Unterstützung konnten nun auch Lernspiele und besondere Vorschul-Materialien für die teilnehmenden Kindergarten-Kinder ohne Lesekenntnisse, sowie Fördermaterialien für die erstmals teilnehmenden Haupt- und Politechnik-Schüler angeschafft werden. 7 a) Familien-Lernhilfe-Projekt (siehe Evaluation Punkt 3) ab Seite 33): Inhalt des Projektes: 1) Die Fortsetzung der Lese- und Sprachkompetenz-Förderung türkisch/kurdischen Familien durch regelmäßiges Vorlesen von türkischen, englischen und zweisprachigen Kinderbüchern aus der Cin Ali Lernklub wöchentlich mit einem sozial-integrativen Bibliotheksangebot10 in die kommt. IN türkischen bzw. kurdischen, deutschen, Bibliothek, die einmal zwölf Projekt-Familien 2) Kontrolle und Kommunikation der Zielerreichung durch die laufende und abschließende Dokumentation und Berichte an Träger und Förderer. 3) Begleitende sozialwissenschaftliche Feldforschung durch die Methode der teilnehmenden Beobachtung, um das Projekt zu evaluieren und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse dem Träger und dem Subventionsgeber zugänglich zu machen. Projektphasen: Vorbereitungsphase: Von 30. August bis 3. Oktober wurde ein Konzept erstellt. Zwölf interessierte Familien wurden nach einer Probezeit als Projektfamilien aufgenommen und Förderungen beantragt. Durchführungsphase (das ist der Förderzeitraum): Die Durchführung des Projekts mit regelmäßigen wöchentlichen Besuchen in den Projekt-Familien dauerte von 4. Oktober 2004 bis 4. Februar 2005. In und unmittelbar nach diesem Zeitraum werden die anfallenden Daten aus der teilnehmenden Beobachtung erfasst. In einem Zwischenbericht und in weiteren Korrespondenzen wurden die Anliegen der Zielgruppe im Sinne eines Vermittlungskreislaufes11 dem Träger e. a. zur Kenntnis gebracht. Nachbereitungsphase: Das Projekt wurde nach Abschluss der Arbeiten ab 15. Februar 2005 evaluiert. Die Evaluationsstudie wurde für die beteiligten Institutionen vervielfältigt, und auch an andere Kontaktpersonen versandt. Nachdem die Verhandlungen mit potentiellen Trägern (Kinderfreunde, ÖGB) ergebnislos verliefen und das ursprünglich anvisierte Telfer Objekt für die Unterbringung der Bibliothek nicht angemietet werden konnte, wollte die Projektleiterin das Projekt einstweilen abschließen, um endlich ihre inzwischen weit verschleppte Diplomarbeit abzuschließen und das Studium zu beenden, um danach als Erwachsenenbildnerin ein selbstständiges Lerninstitut für diese Zielgruppe einzurichten, zumal sich im Familien-Lernhilfe-Projekt interessante weitere Konzepte ergeben hatten. Da kam die Benachrichtigung über die Verleihung eines weiteren Preises: Sozialmarie 2005. Die Überreichung sollte am 1. Mai 2005 erfolgen, und mit dem Preisgeld von Euro 1000,- konnte die die Bibliothek weiter ausgebaut werden, sowie die manuelle Produktion einer ersten Serie der inzwischen entwickelten zweisprachigen Sprachlernmaterialien ins Auge gefasst werden. Inspiriert durch ein Integrationstreffen in der Bezirkshauptstadt Imst wurde kurzfristig ein weiteres Folgeprojekt konzipiert, für das ebenfalls eine Förderung beantragte und erhalten wurde: 10Bibliotheksleitbild des Büchereiverbandes Österreichs: „Öffentliche Bibliotheken entwickeln daher Sonderformen bibliothekarischer Versorgung – zum Beispiel Patientinnenbibliotheken, Seniorenbibliotheken, Gefängnisbibliotheken. Sie bringen die Bücher zu den Menschen und übernehmen dort die mediale Betreuung von körperlich gehandicapten Menschen oder gesellschaftlichen Randgruppen. Im Zusammenwirken mit Kooperationspartnern widmen sie sich Zielgruppen der sozial-integrativen Bibliotheksarbeit wie MigrantInnen, Arbeitslosen, Behinderten, Informations-Armen und Sekundäranalphabeten. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration von Zuwanderern und von ethnischen Minderheiten indem sie Bücher, Zeitschriften und audiovisuelle Medien in deren Sprache zur Verfügung stellen, und zwar in den Bibliotheken ihrer Wohngebiete.“ Quelle: www.bvoe.at 11 Thaler/Voggensberger, „Gutes besser tun – aber wie?“, 2004: Seite 71f: „Der Vermittlungskreislauf (z.B. Reporting, Berichte, Analysen, Interviews, Gespräche, systematischer Perspektivewechsel) ist dann von Nutzen, wenn es der Nonprofit-Organisation gelingt, erfolgreich zwischen der Welt ihrer Kundinnen und Kunden und jener der Spendenden (oder auch der öffentlichen Hand als Auftraggeberin) zu übersetzen und zu vermitteln. So lernen die Auftraggebenden die Bedürfnisse und Probleme ihrer Klientinnen und Klienten, die von einem Leistungsauftrag profitieren, kennen.“ 8 b) Alfabem – Alphabetisierung am Küchentisch und im Gebetshaus (noch nicht fertig evaluiert) Ziele dieses Projektes Mehrsprachige Alphabetisierung und Lese- und Sprachanimation für türkischsprachige Frauen mithilfe von türkischen, kurdischen, deutschen, englischen und zweisprachigen Kinderbüchern aus der Cin Ali Lernklub - Bibliothek, die einmal wöchentlich wieder mit einem sozial-integrativen Bibliotheksangebot in die beteiligten Familien bzw. das alevitische Gebetshaus der Oberländer Gemeinde Tarrenz kommt. Projektzeitraum: 15. April bis 23. Dezember 2005 Projektphasen: Vorbereitungsphase: 7. April 2005 bis 14. April, erstes Kennenlernen und erste Besuche sowie Konzeptentwicklung und Stellen des Förderantrages an die Abteilung JUFF-Integration des Landes Tirol Durchführungsphase: Die Durchführung des Projekts war konzipiert mit EINEM regelmäßigen wöchentlichen Besuch in Tarrenz. Sie startete am 15. April und sollte bis 23. Dezember 2005 dauern. In dieser Phase sollten im Oberländer Ort Tarrenz, ausgehend von der ersten Frau und ihren Küche, sukzessive weitere Frauen und Lernorte erreicht werden (Weitere Lernorte wären: weitere Küchen und Wohnzimmer, das alevitische Gebetshaus Tarrenz, die Öffentliche Bibliothek Tarrenz, und in der Folge „normale“ Kursorte, wie etwa Schulen, das Bfi oder das WIFI in Imst oder auch Innsbruck). Nachbereitungsphase: Ab dem 27. Dezember sollten die durch teilnehmende Beobachtung entstandenen Daten (entlehnte und vorgelesene Bücher, Besuchshäufigkeit und Dauer, Art der Lernhilfe und Lernorte, die Lernfortschritte, die Aktionsradiuserweiterung und die Entwicklung von Selbstorganisation der Frauen) erfasst, codiert und evaluiert werden, um Erkenntnisse zu gewinnen, die durch eine Vermittlung der Evaluation an Interessierte und Integrations-Netzwerke verbreitet werden. Dieses Projekt entwickelte sich jedoch völlig anders als erwartet. Die Zusammenarbeit mit dem Alevitischen Zentrum Tarrenz endete mit Anbruch der Schönwetter-Phase im Juni nach nur fünf Besuchen. Statt eines Kurses für mehrere Frauen im Zentrum ergaben sich wieder sehr zeitaufwändige Mutter-Kind-Kurse auf Hausbesuchsbasis was zu weiteren neuen Sichtweisen und Konzepten führte, die ebenfalls in das geplante Lernzentrum einfließen sollten. Die geplante Evaluation des infolge des heftigen Wintereinbruchs Ende November etwas vorzeitig beendeten Projektes ist noch nicht abgeschlossen, da noch immer einige Medien nicht retourniert sind. Parallel zu diesem Projekt begann wie erwähnt auch die manuelle Produktion zweisprachiger Materialien, Arbeitstitel dieses Projektes war c) Bilinguale Leseanimation Ziel war hier: Die Produktion von je zehn Exemplaren von insgesamt fünf verschiedenen Türkisch/Deutsch Boxen (TD-Box), die in der Folge von interessierten Schulen getestet und deren Konzept in Zusammenarbeit mit den Akteuren der Bildungspolitik bis hin zur Marktreife konkretisiert werden sollte. Hier gab es zwar auch einen konkreten Zeitplan, der aber durch verschiedene persönliche Faktoren und die viel zeitaufwändigere Gestaltung des Alfabem-Projektes nicht eingehalten werden konnte. Bis Jahresende 2005 wurden jedenfalls nur von zwei der vorgesehenen fünf Boxen je 14 Exemplare hergestellt und teils zu Werbezwecken versandt, teils jedoch schon an interessierte Bildungseinrichtungen zu Testzwecken verliehen und je drei sogar schon an Bildungseinrichtungen verkauft. Gegen Ende des Jahres 2005 war die ehrenamtliche Projektleiterin zum dem Schluss gekommen, dass eine weitere Fortführung des Projektes in der bisherigen, ehrenamtlichen 9 Form nicht mehr möglich war. Die Grenzen des Ehrenamtes waren schon längst überschritten worden (siehe unten, Tabelle 2). Da inzwischen die Mieterin der kleinen Eigentumswohnung der Projektleiterin in Innsbruck gekündigt hatte, schien auch das Raumproblem für ein eigenes Lernzentrum vorerst gelöst. Mit dem formellen Träger (Kinderfreunde Tirol) war schon Monate zuvor vereinbart worden, dass die Trägerschaft mit einer Änderung der Organisationsform beendet würde und als offizielles Abschluss-Datum bot sich nun der 31. Dezember 2005 an. Nach der Gesamtevaluation und der Adaptierung der Räumlichkeiten (und möglichst auch nach dem Studienabschluss der Projektleiterin!!!) sollte im Laufe des Jahres 2006 in Innsbruck das Lernzentrum MENSANA (siehe Anhang D) mit der integrierter Cin Ali Lernklub-Kinderbibliothek in Betrieb gehen, wo die entwickelten Konzepte dann praktisch umgesetzt werden können. Erste Anläufe haben bereits begonnen, wobei sehr bald ein neues Konzept der Erwachsenenbildung für besonders schwer integrierbare ältere türkische Mütter entstand, das bis jetzt allerdings nur mit einer Frau ansatzweise erprobt werden konnte: d) LARA – Lernen - ARbeiten - Ausleihen Grundidee des Konzeptes: Ein Teil der aus der Türkei eingewanderten Frauen gilt als nur schwer integrierbar. Ihnen wird vorgeworfen, in einer Parallelkultur zu leben und sich nicht in die österreichische Gesellschaft integrieren zu wollen. Dieser Eindruck mag zwar grundsätzlich zutreffen, verkennt aber gänzlich die Situation dieser Frauen. Eine Auswanderung einer Frau der ländlichen Türkei nach Österreich bedeutet eine ziemlich unsanfte, geradezu schockartige Veränderung der gesamten Lebenssituation der Betroffenen, die einer Entwurzelung gleichkommt. Das Leben in Österreich ist in keiner Weise „parallel“. Die Frauen haben in der türkischen Gesellschaft einen anderen Stellenwert als in der österreichischen. Sie leben auch in der Türkei in einer eigenen Frauenwelt, was aber für orientalische Gesellschaften durchaus üblich ist. Diese Frauenwelt, deren TEIL sie ja sind, die auch ein Teil von ihnen ist, tradieren sie nach Österreich. Die Frauen sind für die Familien im Inneren zuständig - für Essen, Kleidung, Reinigung, Kindererziehung und das gesamte Sozialleben. Oft müssen sie in der Migration auch noch – zumindest temporär - die Aufgabe der Familienerhalterin übernehmen, wenn z.B. der Mann arbeitslos oder krank wird. Trotzdem sind türkische Frauen den Männern der Familien traditionell streng hierarchisch untergeordnet - viel mehr als das in den zeitgenössischen österreichischen Familien der Fall ist. Dafür bringt ihre neue Umgebungsgesellschaft zu Recht wenig Verständnis auf, gelten hier doch längst andere Standards. Diese Frauen stehen durch die zwei aufeinander prallenden Wertesysteme unter einem sehr hohen Stressdruck, vor allem wenn sie noch relativ kurz in Österreich leben, sich an das Klima noch nicht angepasst haben und vielleicht sogar unter starkem Heimweh leiden. Dass darunter auch ihre Integrationsmotivation leidet, ist verständlich. Anstatt ihnen aber Vorwürfe zu machen und sie permanent mit dem Abschieben zu bedrohen, sollten ihnen die helfende Hand gereicht werden. Eine solche Handreichung stelle das Projekt LARA dar. Ziele: In mehrteiligen Lern-und-Arbeits-Blöcken sollen türkische Frauen einen ersten Einblick in die Struktur der deutschen Sprache und Kultur und in das Bibliothekswesen bekommen, und zwar durch Mitarbeit in einer mehrsprachigen Kinderbibliothek und bei der Produktion von bilingualen Leseund Sprachanimations-Materialien. Durch die aktive Mitarbeit in der Bibliothek, im Buchhandel und in der Produktion der Lehrmaterialien sind die Frauen gezwungen, den relevanten Wortschatz dauernd zu wiederholen und die Realien hinter den Begriffen und Vokabeln „begreifen“ zu lernen. Daneben lernen sie auch die zeitgenössische türkische und deutsche Kinderliteratur kennen Außerdem werden sie ermuntert für sich und ihre eigenen sowie verwandten und bekannten Kinder lustige Bücher in mehreren Sprachen auszuleihen und ihren Kleinkindern türkische Bilderbücher vorzulesen oder sich von ihren Schulkindern deutsch Kinderbücher vorlesen zu lassen. Dadurch ergibt 10 sich nicht nur ein möglichst ganzheitliches Lernen auch außerhalb des Kurses, sondern wird auch gleichzeitig für die Bibliothek ein neuer Leserkreis gewonnen. Kursaufbau könnte in etwa so aussehen: Ein 10-Arbeitsstunden-Block würde sich aus vier dreistündigen Einheiten zusammensetzen mit je: 45 Minuten Deutsch-Lerneinheit 135 Minuten Mitarbeit in der Bibliothek und bei der Produktion von TD-Boxen. Kosten: Für die Mitarbeit in der Bibliothek bekommen die Frauen einen Stundensatz von 5,- Euro (ist 50,- Euro pro Block). Die Sozialversicherung, der Deutschkurs und das Kursbuch sollte mit öffentlichen Subventionen (etwas aus dem Integrationsfond) finanziert werden. Aufgrund der beiden Wahlen (Innsbrucker Gemeinderatswahl 2006 und Nationalratswahl 2006) deren Wahlkämpfe ganz im Zeichen der Ausländerfeindlichkeit standen bzw. stehen, wurden die Aktivitäten am neuen Standort Innsbruck ab Februar 2006 zugunsten von Bildungsangeboten der politischen Erwachsenenbildungen (zwei Internet-Workshops in den Monaten vor den beiden Wahlen) reduziert und schließlich vorläufig unterbrochen. Was ist nun im gesamten Projektzeitraum ehrenamtlich geschehen? 1) Aufbau der Kinderbibliothek Mit privaten Geldmitteln der Projektinitiatorin, einer Landesförderung, den drei Preisgeldern und diversen Geld und Buchspenden konnte innerhalb von ca. drei Jahren ein interessanter Medienbestand aufgebaut werden. Die Projektbibliothek wurde als Mitglied in den Österreichischen Bibliotheksverband (BVÖ) und in den ÖBG-Bibliotheks-Service aufgenommen. Auf dem Server des BVÖ richtete die Leiterin eine Bibliotheks-Homepage ein, allerdings noch ohne Online-Katalog, da noch keine Bibliothekssoftware angekauft werden konnte. Die für die weitere Bibliotheksförderung notwendige Bibliothekarsausbildung wurde 2005 begonnen. Bücherstand Ende Juni 2006 Türkischsprachige Deutschsprachige Englischsprachige Kurdischsprachige Italienische Dt. Austauschbücher in Ankara Zweisprachige Bosnisch/Serbokroatisch Zeitschriften D Lernspiele TD-Boxen Lehrmittel DVD Summe Anzahl 537 339 117 24 17 14 105 3 21 67 27 3 1 1275 Tabelle 1: Der insgesamt erfasste Medienbestand mit Stand Ende Juni 2006 2) Erprobung verschiedener Angebote Nach den ersten Versuchen als von Schwelle zu Schwelle wandernde zweisprachige KinderBibliothek wurden in den Räumen einer befreundeten Bibliothek Türkisch-deutsche Märchenstunden angeboten, in deren Rahmen auch die muttersprachlichen Bücher von den Kindern ausgeliehen werden konnten. Dabei wurde klar, dass die Kinder einen großen Lernhilfebedarf hatten. In der Folge wurden mit mehreren Konzepten experimentiert: Mutterkind-Kurse, familiäre Lernhilfe und bilinguale Leseanimation. In deren Verlauf erkannte die Projektleiterin, dass die Eltern sehr wenig Wissen über die landesüblichen 11 Lern- und Sprachfördermethoden besaßen. So wurden spezielle Materialien entwickelt, die ihnen einen komparativen Zugang dazu erschließen konnten. 3) Entwicklung verschiedener Materialien und Konzepte Zwei Serien dieser zweisprachigen Materialien (TD-Boxen) produzierte die Projektleiterin in der Folge manuell, um das Konzept den Pädagogen und Schulpolitikern anschaulicher präsentieren zu können. Schon vor der eigentlichen Produktion waren die Materialien auf einer eigenen Projektshomepage auf dem Server des Österreichischen Bibliotheksverbandes online publiziert. Ebendort sind auch die verschiedenen, im Rahmen der Projekte entstandenen Konzepte zu finden: www.bilila.bvoe.at 4) Evaluationen Für die Subventionsgeber und Preisverleiher wurden bis jetzt zwei Evaluationen angefertigt. Weitere sollen noch folgen. Die Evaluationen dienten nicht nur der internen Auswertung, der Ausformulierung der neuen Konzepte und der Definition von Folgeprojekten, sondern auch der externen Informationspolitik des Projektes und der Öffentlichkeitsarbeit. Die Evaluationen sind auch im Internet zu finden, allerdings auf der Studenten-Homepage der Projektleiterin, da sie eingenständige bildungspolitische Feldforschungen als Nebenprodukt der Recherchen für die Diplomarbeit darstellen. 5) Informationspolitik und Öffentlichkeitsarbeit Neben den Evaluationen und den zwei einfachen Homepages wurde auch durch zahlreiche Interaktionen (Gespräche, Telefonate, Emails, Briefe, Postings in Internetforen, Einträgen in Internet-Gästebüchern) verschiedene Personengruppen über das Projekt und die einzelnen Unterprojekte informiert. Einen wichtigen Bereich der Informationspolitik bildete vor allem auch das Berichtswesen. An die Fördergeber, Unterstützer und Träger wurden regelmäßige Berichte geschickt. Um diese Berichtstätigkeit zu vereinfachen und die Informationen interessanter und auch für einen weiteren Personenkreis hinaus lesbarer zu machen, entstand schließlich die Idee einer einfachen Projektzeitung (inzwischen 3 verschiedene Ausgaben die auch online sind), die im Folgeprojekt dann auf eine breitere Basis gestellt werden soll, um über interessante Neuerscheinungen und neue Erkenntnisse, Studien und Aktivitäten zu informieren. 6) Bildungspolitik Im Zuge der vielen Interaktionen baute die Projektleiterin auch zahlreiche Kontakte zu Akteuren der österreichischen Bildungspolitik auf verschiedenen Ebenen auf. An sie wurden nicht nur sachliche Anfragen oder bildungspolitische Forderungen gestellt, sondern auch Informationen weitergeleitet (Evaluationen, Konzepte, Bibliothekszeitung) und auch einzelne Exemplare der entwickelten Materialien. Das stellte in nuce auch bereits eine Form des politischen Lobbyings für die Zielgruppe dar, das allerdings durch die sehr polarisierenden ausländerfeindlichen Wahlkämpfe unterbrochen werden musste. Die Projektleiterin verweigerte sich damit der Opferung von Menschen- und Kinderrechten in Wahlkämpfen zum Zweck der populistischen Stimmenmaximierung. 7) Bildungsarbeit Neben den vorgenannten Punkten auf einer oftmals mehr theoretischen und/oder politischen Ebene war ein wesentlicher Anteil des Projektes auch simple praktische Bildungsarbeit, die hier ehrenamtlich geleistet wurde und die Datenbasis für die Evaluationen und das Vehikel der teilnehmenden Beobachtung wurde. Der Umfang dieser Bildungsarbeit ist der folgenden Tabelle zu entnehmen: Jahr 2003 2004 2005 Summe Bildungsarbeit mit Kindern und/oder Erwachsenen Stunden Km Entlehnungen Erwachsene 45 384 317 60 372 2554 590 183 357,61 3212 485 345 774,61 6150 1392 588 12 Kinder 121 490 389 1000 Tabelle 2: Diese Tabelle veranschaulicht eine doch erhebliche Anzahl von Stunden, in denen mit Kindern (mehr als 1000 Einzelkontakte) und Erwachsenen (mehr als 588 Einzelkontakte) gelernt bzw. wichtige Dinge besprochen oder auch Exkursionen bzw. auch Kinobesuche oder ein Schwimmnachmittag durchgeführt wurden. Die Leistungen am Standort Innsbruck in der ersten Jahreshälfte 2006 sind hier noch nicht erfasst. In dieser Tabelle sind also nicht die Bibliothekarsarbeiten (Buchimport und Ankauf, Einbinden und katalogisieren der Bücher) oder Büro- und Interaktionsarbeiten enthalten. Überhaupt nicht erfasst wurde der Zeitaufwand der Forschung und Evaluierung. All diese Dinge wurden auch ehrenamtlich erledigt. Die eingebrachten Fahrtkilometer wurden teilweise durch die Subventionen mit dem amtlichen Kilometergeld abgegolten. Gesamt-Einnahmen/Ausgaben Jahr Einnahmen Ausgaben 2003 84,66 1.017,78 2004 4.477,48 3.076,16 2005 2.002,24 5.013,23 Summe 6.564,38 9.107,17 Links: Tabelle 3: Durch das Projekt entstanden der Projektleiterin erhebliche Kosten, die nur zum Teil durch Subventionen, Wettbewerbspreise, Spenden und auch Einnahmen aus Dienstleistungen (Nachhilfe, Kursbeiträge) und Produkte (TD-Boxen) abgedeckt wurden. Auch hier sind die Daten des ersten Halbjahres 2006 noch nicht enthalten. Im Folgenden sollen die beiden bisher erstellten Evaluationen die Vorgehensweise sowie die Ergebnisse und Erkenntnisse aber auch Schlussfolgerungen aus dem Pilotprojekt und dem Familien-Lernhilfe-Projekt schildern. 13 2 ) Evaluation des Pilotprojektes – Zusammenfassung des 1.Projektjahres: 2.1 Projektbeschreibung: Ziele des Pilot-Projektes: Kurzfristige Ziele: Aufbau einer kleinen mehrsprachigen Wanderbibliothek mit Stammleserkreis Erhebung der Lernbedingungen und des Lernumfeldes der Projektteilnehmer Kulturaustausch und Kulturtransfer für Kinder und Frauen auf der Grundlage der Kulturkapitaltheorie von Pierre Bourdieu12. Bewusstwerden der Vorteile der Mehrsprachigkeit auch bei Sprachen mit niedrigem Sprachprestige Die Sensibilisierung für die grundsätzliche und auch vom Ministerium und vom EUAktionsplan 2004 - 2006 anerkannte Gleichwertigkeit der Sprachen und die Selbstverständlichkeit des Rechtes auf das schulische Erlernen der Muttersprache neben zwei weiteren Sprachen von frühester Kindheit an Sensibilisierung für die Diskriminierung der türkischen und/oder kurdischen Muttersprache bei den Betroffenen, ihrer Umgebung und den zuständigen Behörden Langfristiges Ziel: der sukzessive Aufbau einer großen mehrsprachigen Kinderbibliothek mit Leseanimation und Lernhilfe für Kinder und Frauen an einem zentralen Standort, um darauf aufbauend ähnliche Projekte und Angebote an anderen Orten anregen und mit einem entsprechenden Angebot an Büchern unterstützen zu können. Mittel der Zielerreichung im Pilotprojekt-Zeitraum: Die projektierte Förderung der Lese- und Sprachkompetenz und Aufwertung der Mehrsprachigkeit sollte durch regelmäßiges mehrsprachiges Vorlesen in den türkischen bzw. türkisch/kurdischen Familien durch Muttersprachler aus Büchern einer erst zu schaffenden Wander-Bibliothek erreicht werden. Die für den Bibliotheksaufbau nötigen Interaktionen zu verschiedensten Personen, Institutionen und Betrieben sollten dabei gleichzeitig auch schon der Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung für die Thematik dienen. Pilotprojekt-Zeitraum: Juni 2003 bis August 2004 Projektphasen: a) Vorbereitung: Juni 2003: an 5 Treffen der beiden Initiatorinnen entstand der deutsche Text des ersten Cin Ali Heftes. Zehn erste Exemplare des zweisprachigen Büchleins wurden hergestellt und verschiedenen Personen übermittelt. 29 türkische Bücher, die großteils von einem früheren Projekt13 der österreichischen Initiatorin stammten, wurden aus der Bibliothek Telfs längerfristig ausgeliehen. Die türkische Initiatorin versprach, im Urlaub in Ankara mehr und vor allem leseleichtere türkische Kinderbücher zu besorgen. b) Durchführung: 4. September 2003 bis 10. Juli 2004 Phase 1: Aufbau der Wanderbibliothek. September 2003 bis Februar 2004. Neben dem sukzessiven Ankauf, Binden, Einbinden und provisorischen Katalogisieren der Bücher, begann der Verleihbetrieb am 4. September 2003. Ab 7. November 2003 bis 28. 12 Bourdieu, Pierre: 1983, 2001, siehe auch Anhang A Willy Black Library – eine Sammlung von zuerst nur englischen später aber auch französischen, italienischen und türkischen Kinderbüchern zum Zweck des Verleihs an Familien, in denen diese Sprachen gelernt oder gesprochen werden. Projektdauer 1998-2001. Siehe auch Anhang B. 13 14 Jänner 2004 gab es ein erstes außerschulisches kulturelles Angebot in der Bibliothek Mötz: die türkisch/deutschen Märchenstunden. Eine Gruppe von acht Kindern lernte nach einem komparativen Ansatz gleichzeitig mit türkischen und deutschen Büchern und Wörterbüchern arbeiten. Phase 2: Neukonzeption nach der Semesterpause. Februar/März bis Juli 2004. Auf Antrag der Projektleiterin übernahm die Kinderfreunde-Landesorganisation Tirol die Trägerschaft. Dadurch konnten verschiedene Subventionsansuchen und WettbewerbsBeteiligungen in Angriff genommen werden. Gleichzeitig lief das eigentliche Pilotprojekt IN den sieben Familien an, die sich im Laufe dieser Zeit durch Mundpropaganda dazu anmeldeten. Aufgrund von Öffentlichkeitsarbeit und laufender Evaluation und Dokumentation war es möglich, offizielle Anerkennung durch erste Subventionen (Integrationsabteilung des Landes Tirol, Kulturabteilung des Landes Tirol) zu erhalten und am 26. Juni 2004 konnten zwei Projektkinder in Linz den Kinderrechtspreis 2004 für das Projekt entgegennehmen, der nicht nur eine weitere Publikations-Möglichkeit und somit Bekanntheit bedeutete, sondern ebenfalls durch Buchgutscheine eine Erweiterung der Bibliothek ermöglichte. c) Nachbereitung: Juli und August 2004: Buchbestellungen aufgrund der einmaligen Beihilfe der Kulturabteilung und der Buchgutscheine des Kinderrechtspreises 2004, Projektabrechnung, computerunterstützte Evaluation und Dokumentation, Pläne für die Umsetzung der Ergebnisse in konkreten Angeboten im folgenden Schuljahr, verschiedene Erweiterungen infolge der Pressearbeit zum Kinderrechtspreis, Vermittlung eines Projektkindes mit Lernschwierigkeiten an die Heilpädagogischen Familien. Zum theoretischen Hintergrund: Im Zuge ihrer Diplomarbeit aus Politikwissenschaft zum Thema Österreichische Bildungspolitiken stieß die Projektleiterin auf die Humankapitaltheorie von Pierre Bourdieu (siehe Anhang A). Der französische Philosoph und Sozialwissenschaftler forschte auch zur Bildungspolitik und wies - wie andere Sozialwissenschaftler - auf die zentrale Rolle der Bildung und des Bildungssystems in den modernen Nationalstaaten hin. (vgl. Graf, Lamprecht,1991). Dabei deckte er die Mechanismen der kulturellen Vererbung auf. Bildung wird demnach auch in den modernen Nationalstaaten nicht ausschließlich im institutionalisierten staatlichen Bildungssystem erworben, sondern wie eh und je von Geburt an in einem verborgenen Prozess in der Familie „vererbt“. Und diese Bildung ist umso gewinnbringender für das spätere soziale, ökonomische und politische Leben eines Individuums, je früher sie einsetzt und je intensiver sie vorangetrieben wird, denn sie ebnet den Weg zu höheren Bildungsabschlüssen, die die Berufs- und Lebenschancen bestimmen. Aber nicht nur Dauer und Intensität der innerfamiliären Kulturvererbung sind ausschlaggebend, sondern auch die Anerkennung der jeweiligen Familienkultur in Gesellschaft und Schulwesen. Die Sozial- und Sprachwissenschaftler (vgl. auch De Cillia, 1998) wiesen im Zuge der Sprachbarrierendiskussion schon um 1970 nach, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen in den modernen Nationalstaaten mit Schulpflicht und differenzierten staatlichen Bildungssystemen vom Schulsystem schon allein dadurch bevorzugt sind, dass ihre Muttersprache, die Mittelschichtsprache, auch zugleich die Unterrichtssprache und nach Bourdieu vielfach auch die Familiensprache der Lehrpersonen ist. Das heißt: das öffentliche Schulsystem anerkennt ihre vor- und außerschulisch erworbene Bildung und belohnt sie mit gutem Schulerfolg, während es zugleich die vor- und außerschulisch erworbene kulturelle Bildung der anderen Kinder entwertet, speziell die der Kinder sozial benachteiligter Gruppen mit starkem Dialekt und/oder mit anderer Muttersprache. Die Bildungsvorteile der Kinder der so genannten bildungsnahen Schichten beruhen daher vorwiegend auf der strukturellen Anerkennung ihrer Vorbildung gegenüber der der Kinder der bildungsfernen Schichten und weniger auf ihrer individuellen Begabung. 15 Diese Theorie der Bildungsbenachteiligung von Kindern mit schulisch nichtnutzbaren Muttersprachen erklärt das in der PISA-Studie festgestellte schlechte schulische Abschneiden von Einwandererkindern in Österreich. Bei Kindern aus dem türkischen bzw. kurdischen Kulturkreis kommen zur schulischen Benachteiligung aufgrund ihrer Muttersprache noch die vom Schulland stark abweichende Sozialstruktur und die Ferne zum Herkunftsort hinzu. Das stellt sie zusätzlich etwa gegenüber den Flüchtlingskindern aus dem ehemaligen Jugoslawien schlechter, die seit den Balkankriegen (im Jahrzehnt zwischen 1989 und 1999) vermehrt in Österreichs Schulen unterrichtet werden - und mit denen sie in der schulischen und gesellschaftlichen Praxis häufig verglichen werden. Ihnen gegenüber gibt es auch eine ökonomische und psychologische Schlechterstellung: Flüchtlinge erhalten von ihrem Aufnahmeland anfangs Unterkunft, ein gewisses Einkommen und Starthilfen für die Eingliederung. Von den Arbeitskräften aus der Türkei und ihren nicht freiwillig nachgezogenen Familienmitgliedern14 wird hingegen eine aktive und selbstständige Integration gefordert, obwohl sie einerseits bewusst als „Wirtschaftsflüchtlinge“ bezeichnet werden, ihnen aber andrerseits keine „Flüchtlingshilfe“ gewährt wird. Die seit 1. Jänner 2003 verpflichtenden Deutschkurse für Einwanderer15 können für diese Bevölkerungsgruppe nicht als vergleichbare Hilfestellung betrachtet werden, zumal diese zu mindestens 50 Prozent kostenpflichtig sind. 2.2 Dokumentation und Evaluation Im Folgenden sollen die einzelnen Projektphasen dargestellt und evaluiert werden. 1) Vorbereitungsphase Auf der Suche nach geeigneten Aktivitäten für den Aufbau einer Kinderfreunde-Ortsgruppe im Tiroler Dorf Mieming erinnerte sich die Stützpunktleiterin an ihr früheres Projekt (EnglischBibliothek für Kinder mit den Ansätzen eines türkischen Zweiges, siehe Anhang B) und an ihre ehemaligen Lernhilfe-Aktivitäten. Sie nahm mit einer türkischsprachigen Bekannten Kontakt auf und stellte ihr die Idee dar. Sie gefiel der Mutter zweier Söhne so gut, dass sie sich sofort bereit erklärte mit zu machen. Sie suchte die alten Cin Ali Heftchen, die sie von der späteren Projektleiterin für ihren älteren Sohn vor Jahren erhalten hatte und umgehend begannen die beiden Frauen, das Heft Nummer 1 zweisprachig zu gestalten und - versehen mit den Daten der Initiatorinnen und einer kleinen Wörterliste - an interessierte Familien und an verschiedene Institutionen und Subventionsgeber zu verschenken (insgesamt ca. 65 Stück). Die meisten der türkischsprachigen Frauen, die noch in der Türkei die Schule besuchten, kennen die Reihe und wissen auf diese Weise nach nur wenigen erklärenden Worten, worum es beim Cin Ali Lernklub im Wesentlichen geht. 2) Aufbau der Bibliothek Zuerst gab die Projektleiterin der türkischsprachigen Mitinitiatorin die 26 Bücher eines Vorgängerprojektes, die zwei Jahre in der Bibliothek Telfs eingestellt waren, sowie drei Telfer Bücher und vier Titel der Bibliothek Innsbruck zur Ansicht. Nachdem die ersten modernen, zum Ankauf ausgewählten Bücher in der Stadtbibliothek Innsbruck entdeckten worden waren, und die Bibliothek berichtete, die Bücher direkt von Türkischlehrern übernommen zu haben, zeigte sich bei der Nachfrage im Buchhandel, dass trotz der vorhandenen 14 vgl. Kymlicka, zitiert in Bauböck: Gesellschaftspolitische Zielsetzungen des Muttersprachenunterrichts, in Çinar, 1998, Seite 303 15 Mit der Fremdenrechtsnovelle 2002 wurde die so genannte Integrationsvereinbarung ins Fremdengesetz eingefügt. Darin ist geregelt, wer die Integrationsvereinbarung eingehen muss und welche Sanktionen es gibt. Die Integrationsvereinbarung sieht den verpflichtenden Erwerb von Sprachkenntnissen innerhalb eines Zeitraumes von maximal 4 Jahren vor. 16 internationalen Buchnummern die Bestellung nicht möglich war. Damit wurde bereits in der Vorbereitungsphase die Schwierigkeit sichtbar, Bezugsquellen für moderne türkische Kinderbücher zu finden. Die Projektleiterin kannte Probleme mit Buchbestellungen aus dem ferneren Ausland bereits vom Vorgängerprojekt, das viele amerikanische Kinderbücher enthielt. Damals schufen private und Internetkontakte Abhilfe. Auch diesmal schickte eine Bücherspenderin aus Ankara, die die Projektleiterin über einen Yahoo-Klub kennen gelernt hatte, einige bestellte Bücher unbürokratisch per Post. Im Austausch erhielt sie deutschsprachige Kinderbücher für ihr zweisprachiges Kind, womit ein erster viel versprechender internationaler Austausch begann. Schon zuvor besorgte die türkischsprachige Mitinitiatorin im Urlaub einige aktuelle Erstlesereihen und Einzeltitel, wodurch die Wanderbibliothek nach den Ferien mit vorerst ca. 80 Heften und Büchern (einschließlich einiger deutschsprachiger Erstlesebücher) die Arbeit aufnehmen konnte. Eine Reihe von leichtlesbaren Märchenbüchern wurde weiters von der Mutter eines Projektkindes anlässlich einer Hochzeit in der Türkei für die Projektleiterin eingekauft und mitgebracht. Sie führten direkt zum Märchenprojekt. Hilfe kam auch von den Kindern selbst: zwei der ersten Leserinnen der neuen Bibliothek liehen der Projektleiterin ihre türkischen Schulbücher, woraufhin diese via Internet mit dem Anadolu-Schulbuchverlag16 in Deutschland Kontakt aufnahm und zwei erste Schulbücher und dessen reichhaltigen Katalog bestellte. So fand sie einen verlässlichen und unkomplizierten Bücherlieferanten. Im Laufe der Zeit wurden dann weitere deutsche, türkische und zweisprachige Kinder- und Schulbücher angekauft bzw. deutsche Sachbücher von der Projektleiterin in die Bibliothek eingebracht. Weiters meldete sich umgehend nach Projektstart ein Türkischlehrer, dem eine Schülerin vom Projekt erzählt hatte, und stellte ein Schulbuch, ein Kinderbuch und zwei zweisprachige Wörterbücher zur Verfügung, was ebenfalls sehr hilfreich war. Schwierigkeiten tauchten erst wieder auf, als eine Förderung des Landes Tirol für den Ankauf von Büchern und die Information über eine türkische populärwissenschaftliche Jugend- und Kinderbuchserie17 im Yahoo-Klub sowie die Sendung von vier Exemplaren durch die Bücherspenderin aus Ankara, offensichtlich werden ließ, wie schwierig und nur sehr teuer speziellere Bücher-Wünsche durch den Buchhandel zu erfüllen waren. Wieder erwies sich der Anadolu-Verlag als überaus verlässlicher Ansprechpartner. So konnte die Bücherei - allen Schwierigkeiten zum Trotz und mit den vereinten Kräften der Beteiligten in Österreich, der Türkei und Deutschlands - bis zum Pilotprojektabschluss am 11. August 2004 auf 324 zum Teil sehr leseleichte Titel erweitert werden. Durch den Kinderrechtepreis und die Subvention der Kulturabteilung des Landes Tirol kamen 104 weitere türkische und zweisprachige Bücher hinzu. Mit den 11 Büchern in kurdischer Sprache (davon eines zweisprachig: türkisch/kurdisch) - aus dem Bestand der Projektleiterin sowie vom Bildungsministerium und der Bibliothek des kurdischen Kulturvereins Linz gespendet – und 36 englischen Medien für die Hauptschüler war folgender Bücherstand erreicht: Dabei fiel auf, dass im türkischen Sprachraum mehrteilige leseleichte Kinderbuchserien mit sechs bis zehn Titeln je Reihe in einheitlichem Design sehr verbreitet sind. Sie werden auch von aus dem türkischen Sprachraum ausgewanderten Kindern gerne gelesen, wenn sie für sie erreichbar sind. Es gibt dabei durchaus auch sehr moderne Reihen, wie etwa: uzaylı çocuk masalları – Weltraumkinder-Märchen - von Aytül Akal18 erschienen im UçanbalıkVerlag19, sowie reizende Bilder- und Jugendbücher, die bald auch von den Projektkindern sehr gerne ausgeliehen und gelesen wurden, und die problemlos beim Anadolu-Schulbuchverlag bestellbar sind. Rein optisch auffallend war die Form der Bindung. Durchwegs handelt 16 http://www.anadolu-verlag.de/ http://www.kitap.tubitak.gov.tr/ 18 http://www.aytulakal.com/ 19 http://www.ucanbalik.com.tr/ 17 17 es sich bei den in der Türkei produzierten Büchern um kleinformatige Broschüren. Der Grund dafür wurde im Laufe des Projektes klar, nachdem wiederholt Mütter den Kindern das gleichzeitige Entlehnen von mehreren großen Büchern untersagt hatten. In vielen türkischen Wohnungen und Haushalt-Budgets ist wenig bis gar kein Raum für Bücher vorgesehen. Sie müssen daher so Platz und Geld sparend wie möglich sein. Die deutschsprachigen Kinderbücher und vor allem Kinderfachbücher sind üblicherweise Hardcovers, häufig im A 4 Format. Die Spende einiger Pixi- und Beltz-Mini-Bücher einer weiteren Yahoo-GruppenFreundin aus Berlin zeigte, dass die Kinder, wenn sie die Wahl haben, physisch leichte und kleine Büchlein bevorzugten, die problemlos in der Schultasche aufbewahrt werden konnten. Daraufhin wurden gezielt Broschüren-Reihen (Lesemaus-Bücher) und kleinformatige Taschenbuch-Ausgaben etwa von Erwin Moser e. a. angekauft. Das einzige bosnisch/serbokroatische (BSK) Buch der Bibliothek ist der BSK-Zusatzband der interkulturellen Fibel Hand in Hand (Schulbuchliste) und wurde von dem bosnischen Projektkind der 2. Phase sehr gerne ausgeliehen. Das Kind, das angab, selbst nicht bosnisch lesen zu können, verlangte nach mehr Büchern in seiner Sprache, nachdem es realisiert hatte, dass die türkischsprachigen Schulkolleginnen Kinderbücher in ihrer Muttersprache ausleihen konnten. Im Projektzeitraum wurden bewusst keine weiteren bosnischen Bücher angekauft, jedoch verschiedene offizielle Informationsbroschüren in dieser Sprache an die Familie weitergegeben. Sie waren dort noch unbekannt und wurden interessiert gelesen. In einem Folgeprojekt sollten daher auch serbokroatisch/bosnische Bücher zum Einsatz kommen. Nur bei den Sachbüchern gab es mehr deutsche (D=21, T=4), da erst am Ende die ersten vier Tübitak-Sachbücher aus der Türkei ankamen. Sie konnten nur mehr kurz entlehnt werden, aber die Resonanz bei den Kindern und Müttern war überaus positiv, was letztlich zur Entscheidung führte, die drei Buch-Reihen komplett anzukaufen. Dadurch stieg der Türkischanteil weiter - bei den Sachbüchern war das Verhältnis nun D=21 zu T=49. Die Bücher die im Zuge des Austausches zur Projektpartnerin in Ankara geschickt wurden, blieben bewusst in der Bibliothek aufgelistet. Durch die englischen und kurdischen Medien konnte das Projekt mit 475 Titeln in sechs Sprachen am 30. August das zweite Jahr beginnen. 2.3) Entlehntätigkeit und –bilanz und Leseanimation Der Entlehnbetrieb startete am 4. September 2004. Zuerst warb die Projektleiterin in Mieming, Mötz und Innsbruck Teilnehmerfamilien an und verteilte die erste Serie der Lesepässe. Als die ersten Kinder nach etwa drei Monaten die 24 Entlehnungen auf den Bücherpässen eingetragen hatten, wurden Belohnungen ausgegeben: Kinogutscheine für die Innsbrucker Kinder20. Ein Mieminger Kind und sieben Mötzer Leser besuchten gemeinsam mit beiden Projektinitiatorinnen den Film „Findet Nemo“ im Innsbrucker Metropolkino und machten anschließend einen Rundgang durch die Altstadt und den Christkindlmarkt und besichtigten dabei die „Märchenstraße“ der Innsbrucker Kaufmannschaft. Diese Kinder bekamen weitere Lesepässe und verblieben im Projekt. Durch den Wegfall der Innsbrucker Kinder, das Umfangreicherwerden der Bibliothek und die kürzer werdenden Tage samt Herbstwetter beschloss die Projektleiterin, das „Wandern“ der Bibliothek von Familie zu Familie im Dorf Mötz zugunsten eines wöchentlichen Treffens der Projektteilnehmer in der Öffentlichen Bibliothek abzuschaffen. Das bot sich an, da die insgesamt acht Projektkinder von Mötz fleißige Bibliotheksbesucher waren und zudem muttersprachlichen Unterricht erhielten. „Gewandert“ wurde nur noch in Mieming, wo von den vier Familien nur ein Schulkind, der Sohn der Mitinitiatorin, regelmäßig las und nur eine Familie mit Kleinkind weiter an der Teilnahme interessiert war. Es fiel bereits zu diesem Zeitpunkt auf, dass laufend türkische Familien von Mieming abwanderten oder abwandern wollten (siehe Punkt 2.7). 20 Die Projektleiterin renovierte in der Anfangsphase des Projektes ihre Wohnung in Innsbruck und dadurch konnten ohne großen Aufwand auch die interessierten vier Kinder des achtstöckigen Wohnhauses teilnehmen. Sie schieden aber nach Abschluss der Sanierung aus dem Projekt aus. 18 Da dem Türkischlehrer das Projekt sehr gefiel, konnte er motiviert werden, eine Büchergruppe für seine Klasse an der Volksschule in Nassereith zu übernehmen. Die zwölf teilnehmenden Nassereither Kinder erhielten nach drei Monaten ebenfalls Kinogutscheine für ihren Leseeifer. Sie hatten auch wunderschöne Zeichnungen über ihre Lieblingsbücher angefertigt. Diese Volksschulgruppe hätte gerne einen weiteren Büchersatz ausgeliehen und das Leseprojekt fortgesetzt, aber der Lehrer war leider aufgrund von Spannungen an „seinen“ Schulen in diesem Bezirk und gegen ihn gerichteter, letztlich nicht haltbarer Vorwürfe – und zum großen Bedauern der Projektleiterin - nicht mehr bereit, das Projekt hier fortzusetzen. Dafür entlehnte er für seine Hauptschulklasse in Reutte einen Büchersatz. Die Reuttener Bücher verblieben nach Projektabschluss einstweilen an der Schule, Daten über ihre Leser sind derzeit nicht bekannt. Bereits in der ersten Projektphase bot die Projektleiterin im Rahmen der Wanderbibliothek erste Leseanimationen an. Sie las spontan einzelne Geschichten auf Deutsch vor, mit der Absicht, auf das Lesen mit dem Grundwortschatz in einfachen Großdruck-Texten mit möglichst vielen bunten Bildern Lust zu machen. Erst im Rahmen der türkisch/deutschen Märchenstunden in der Bibliothek Mötz (siehe Punkt 2.4) wurde ein direkter Vergleich von Texten in türkischer und deutscher Sprache möglich. In der zweiten Projektphase endeten nach dem „Wandern“ der Bibliothek auch die Büchereistunden in Mötz, denn nun sollten in einem weiteren Versuchsangebot (siehe Punkt 2.5) endlich auch die Mütter mehr in das Projekt einbezogen werden. Damit änderte sich der Entlehnbetrieb grundlegend. Statt einer größeren Büchermenge wurde eine kleinere, auf die Lesebedürfnisse der einzelnen Projekt-Familien abgestimmte Anzahl in die Besuchsfamilien mitgenommen und dort gemeinsam gelesen und nach Bedarf auch verliehen. Dadurch und weil in der zweiten Phase weniger Kinder und zudem weniger Schulkinder dafür aber mehr Klein- und Kindergartenkinder am Projekt teilnahmen sanken zwar die Entlehnmengen, die Vorleseintensität stieg aber deutlich an. Das Projekt war nun auch in Stams und Telfs vertreten. Ein durch eine bekannte Lehrerin vermitteltes, bezahlendes Nachhilfekind (Seiteneinsteiger) sorgte für erste regelmäßige Projekt-Einkünfte. Gegen Abschluss des Projektes kamen über eine bekannte Studentin erste Teilnehmer in Imst dazu, die für den Nachhilfeunterricht sechs Bücher ausliehen. Nicht in der Statistik enthalten sind 128 türkische und zweisprachige Bücher, die eine Bibliothekarin (Haiming), als Entscheidungshilfe für den Ankauf türkischer Bibliotheksbücher entlehnte. Insgesamt wurden mit den 50 Entlehnungen der beiden Lehrpersonen (Türkischlehrer: 48 Bücher, Lehrerin des Nachhilfekindes: zwei Bücher) an 87 Entlehntagen 619 Entlehnungen registriert, einschließlich der 15 Entlehnungen von Büchern der Bibliothek Mieming (8), der Bibliothek Telfs (4) und der Initiatorin selbst (3). In der Vorbereitungsphase entlehnte die türkische Mitinitiatorin zur Ansicht Bücher aus den Bibliotheken Innsbruck (4) und Telfs (29), von letzteren gingen dann 26 Bücher vom Standort Telfs in den Besitz der neuen Bibliothek über, da sie in der Bibliothek Telfs kaum ausgeliehen wurden. Aktive Entlehner waren 32 von 33 teilnehmenden Kinder aus 19 Familien (569 Entlehnungen, davon 554 aus der projekteigenen Bibliothek) und 2 Lehrpersonen (50 Entlehnungen). Das ergibt durchschnittlich 17 Bücher pro Kind ohne Berücksichtigung von Lesealter und Teilnahmedauer und Intensität. Das Kind mit den meisten Entlehnungen nahm auch an allen Aktivitätsarten teil. Die Zahl der Entlehnungen pro Kind schwankte von null bis 64. Die Entlehnstatistik nach Sprachen sowie nach Angeboten zeigt eindeutig, dass die Kinder, obwohl ihre türkische bzw. bosnische Lesekompetenz wegen des wenigen oder ganz fehlenden muttersprachlichen Unterrichts gering war, ganz selbstverständlich auch zu (sehr leseleichten!) Kinderbüchern in ihrer Muttersprache griffen, nachdem solche angeboten wurden. Dabei ist zu bedenken, dass die Projektleiterin selbst kaum Türkisch oder Bosnisch sprach und somit für diese Sprachen keine aktive Leseanimation bieten konnte. 19 Weiters ist zu erkennen, dass die Kinder türkische Bücher nicht häufiger als deutsche entlehnten. Es kam also zu keiner Verdrängung des deutschen Lesens durch ein zweisprachiges Bücherangebot. Die Entlehnungen im Rahmen der Märchenstunden zeigen keinen Gewichtungs-Unterschied zur Gesamtstatistik. Bei den Entlehnungen im Rahmen der Familienbesuche war hingegen – bedingt durch das familiäre Deutschlernen und die Lernhilfe - der Anteil deutscher Bücher größer. Fazit: die teilnehmenden Kinder entlehnten auch ohne spezielle muttersprachliche Animation gerne ansprechende Bücher in ihrer Muttersprache, da sie solche zur Auswahl hatten und diese Bücher als den deutschen vollkommen gleichwertig präsentiert wurden. Eine Auswertung der Entlehnhäufigkeit der einzelnen Bücher war in der Pilotprojektphase nicht sinnvoll, da die Bibliothek erst im Aufbau war und der Transport aller Bücher mit steigendem Bibliotheksumfang nicht mehr möglich war, was die freie Auswahl beschränkte. 2.4) Türkisch/deutsche Märchenstunden Nach dem Erfolg der ersten Aufbauphase wurde das Angebot eines zweckfreien außerschulischen und außerfamiliären Bildungsangebotes21 in Form von „Türkisch/deutschen Märchenstunden“ in der Bibliothek Mötz ins Auge gefasst. Anlass dazu war die Tatsache, dass die acht Projektteilnehmer von Mötz einerseits sehr eifrige Besucher der Öffentlichen Bibliothek Mötz waren. Andrerseits nahmen sie an der unverbindlichen Übung „Muttersprachlicher Unterricht – Türkisch“ teil. Traurigerweise war im laufenden Schuljahr 2003/2004 dieser muttersprachliche Unterricht von zwei Stunden in den beiden Vorjahren auf nur mehr eine Stunde gekürzt worden. Diese spezielle Stundenkürzung traf eine ohnehin benachteiligte Schülergruppe über das durchschnittliche Ausmaß der im Schuljahr 2003/2004 erstmals wirksamen, allgemeinen Stundenkürzung22. Das zweckfreie Bibliotheksangebot sollte diese Ungerechtigkeit kompensieren helfen, indem die Kinder einerseits animiert wurden, in der Bibliothek türkischsprachige Märchenbücher zu lesen und andererseits dieselben Märchen in Deutsch zu erzählen und ebenfalls zu lesen. Ziel war dabei, den Teilnehmern durch das Lesen von jeweils einem Märchen in beiden Sprachen den internationalen Märchenschatz zu erschließen und die Besonderheiten beider Kulturkreise im Spiegel der Märchen und der Illustrationen bewusst zu machen. Hand in Hand damit ging eine Wortschatzerweiterung, das Üben des Wörterbuchgebrauchs und das Führen eines Vokabelheftes. Auch auf den Gebrauch der „türkischen Handschrift“ (Druckschrift) wurde hingewiesen. Zur Vertiefung wurden die Märchen auch gezeichnet. An einem Probenachmittag am 7. November lasen fünf teilnehmende Kinder das teilweise zweisprachige Büchlein „Die Reisemaus in der Türkei“ abwechselnd vor, besprachen es gemeinsam auf Deutsch und zeichneten anschließend eine Szene aus dem Buch. Sie suchten gemeinsam mit der Projektleiterin erste Wörter in beiden Sprachen und freuten sich sehr, dass in einem deutschen Bibliotheksbuch türkische Wörter und Sätze standen, und dass Moscheen ganz selbstverständlich behandelt wurden. Das hatte eine besondere Bedeutung, da gerade Ramadan war. So standen beim Zeichnen denn auch die Moscheen und der Muezzin im Zentrum, wobei zwei Türkeibücher der Bibliothek als Zeichenvorlagen dienten. Ab da fanden 15 weitere wöchentliche Bibliotheksnachmittage23 statt - wobei ursprünglich nur 12 Nachmittage bis zu den Semesterferien geplant waren. 21 Zweckfrei bedeutete in diesem Zusammenhang, dass dieses Angebot auf eine Kompensation des diesen Kindern fehlenden, zweckfreien familiären Kulturangebotes in deutscher Sprache abzielte, und somit nicht die Verbesserung der Schulnoten durch Lernhilfe oder die Betreuung der Hausaufgaben bezweckte. 22 Die Schülerentlastungsverordnung 2003 des Kabinetts Schüssel II sah die Kürzung einer halben Stunde pro Woche im Volksschulbereich vor. 23 Zwei der Nachmittage fanden in anderen Örtlichkeiten, aber nach demselben Prinzip statt, da erst die Raumfrage geklärt werden musste. Die Lösung war ein Extranachmittag NUR für dieses Angebot, damit die Kinder auch die anderen Bibliotheksangebote (Spielnachmittag, normale Entlehntage) weiterhin nutzen konnten und die Märchen-Arbeit durch den normalen Bibliotheksbetrieb nicht gestört wurde. 20 Im Rahmen dieser Bibliotheksstunden wurde aus insgesamt 25 Büchlein gelesen, davon waren acht Bücher von der Bibliothek Mötz und eines von der Projektleiterin. Nach dem Buch „Die Reisemaus in der Türkei“ wurden Aschenputtel, Rotkäppchen, Alice im Wunderland, Frau Holle, Die Bremer Stadtmusikanten, Dornröschen und die Prinzessin auf der Erbse, Schneewittchen, Des Kaisers neue Kleider sowie der Stuwwelpeter und der bitterböse Friederich gelesen, aber auch die Geschichte des Filmes „Findet Nemo“ in der Folge des ersten Kinonachmittages. Nach der Besprechung des damit verbundenen Stadtrundgangs und des Besuches der Märchenstraße nahmen die Kinder am Märchenstraßen-Mal-Wettbewerb teil. Die Bilder wurden im Rahmen eines Bibliotheksnachmittages angefertigt, wobei da das Märchenlesen entfiel. Der Zeichenwettbewerb brachte Kinokarten für den Film „Dobby – der Weihnachtself“ für alle Kinder und zwei Begleitpersonen. Eine ältere Schwester von zwei Teilnehmerinnen wurde als Begleitperson eingeladen, und wurde so in der zweiten Projektphase ebenfalls Teilnehmerin. Zwei Kinder nahmen ohne rechtzeitige Abmeldung nicht am Kinonachmittag teil, sodass ihre Karten leider verfielen. Die meisten Märchen wurden, so ein Buch vorhanden war, zuerst auf Türkisch gelesen und mündlich ins Deutsche übertragen. Immer wurden die Geschichten auf Deutsch besprochen, und fast zur Hälfte auch gezeichnet. Die in den Bibliotheksstunden verwendeten Bücher aus der Projektbibliothek konnten gemeinsam mit vielen anderen anschließend auch entlehnt werden, nicht aber die Bücher der Bibliothek Mötz, das ging nur zu den regulären Öffnungszeiten der Bibliothek Mötz. Im Zuge der 16 Bibliotheksnachmittage wurden von den acht Kindern 202 Entlehnungen und 81 Teilnahmen registriert. Siebenmal entlehnten sie außerdem im Rahmen von Besprechungen in den Familien, diese Entlehnungen werden in der Statistik den Märchenstunden zugerechnet. Dreimal kam kurz eine Mutter in der Bibliothek vorbei (es war immer dieselbe, während die anderen drei Mütter kein Interesse an den Geschehnissen in der Bibliothek zeigten). Auch der Türkischlehrer der Kinder kam einmal kurz zu Besuch. Die anderen Lehrpersonen der Kinder suchten keinen Kontakt, obwohl sie teilweise vom Dorf waren und die Bücherei Mötz eng mit der Schule zusammenarbeitete (Büchereibesuche in der Schule, jährliche Schülerzeitung). Einmal besuchte die Projektleiterin die VolksschulDirektorin der Kinder, um sie nach dem Ausmaß ihrer Deutschförderstunden zu fragen. Sie zeigte sich über „ein Angebot“ in der Bibliothek informiert. Gegen Semesterende zeichnete sich ein vermehrter Lern-, Hausaufgaben- und Nachhilfebedarf ab. Zur Test- und Schularbeitenzeit baten die Kinder nämlich um Hilfe, um noch rasch ihre Noten zu verbessern. Da die Bibliotheksnachmittage als ein zweckfreies und die kulturelle Benachteiligung kompensierendes Angebot im Sinne von Bourdieu konzipiert wurden, wurde die Hilfe insgesamt dreimal aber nur im Anschluss an die Märchenarbeit gewährt, was zu einer erheblichen zeitlichen Verlängerung führte. Es war absehbar, dass der offensichtliche Lernhilfe-Bedarf nicht dauerhaft im Rahmen der Märchennachmittage befriedigt werden konnte. Des weiteren zeichnete sich ein Dauer-Konflikt zwischen den kleineren und größeren Teilnehmern ab, sodass eine Teilung der Gruppe sinnvoll erschien, was bereits dreimal geschah. Den zwei Kleinen wurden dabei Bilderbücher aus der Bibliothek vorgelesen und anschließend mit ihnen besprochen. Bevor jedoch endgültige organisatorische Änderungen fixiert werden konnten, endete das Angebot in der Bibliothek aufgrund des zunächst unerklärlichen Teilnehmerrückganges und wurde in die Wohnung der Familie verlegt, die an der weiteren Fortführung der Förderung interessiert war. Wie sich herausstellte, war die steigende Unruhe in der Gruppe und der Teilnehmerschwund vor allem durch äußere Faktoren bedingt: eine Teilnehmerin übersiedelte kurzfristig nach Graz, hielt aber brieflich den Kontakt zu Projektleiterin und Gruppe; ein Kind bekam ein Geschwisterchen worauf die Besuchstätigkeit der befreundeten Familien kurzfristig anstieg und fünf Kinder schließlich der Bibliothek fern blieben, um das Frühlings-Wetter zu Spaziergängen mit dem Neugeborenen zu nutzen. Dadurch wurde offensichtlich, dass die Arbeit mit Kindern dieses Kulturkreises sehr von spezifischen familiären, sozialen und kulturellen 21 Ereignissen beeinflusst wird (Bevorstehen einer Geburt, Neugeborenenphase, Planung einer Übersiedlung, Streitigkeiten und Rivalitäten zwischen den einzelnen Familien, religiöse Feierlichkeiten wie Ramadan, Zuckerfest, Schaffest, oder auch der Konflikt zwischen Sunniten und Aleviten und anderen in der Türkei vertretenen Glaubensbekenntnissen). Da ursprünglich die Bibliotheksnachmittage nur bis zu Semesterschluss projektiert waren und zudem Kinder fortziehen sollten, gab es zur Belohnung für die vier fleißigsten Teilnehmerinnen zu Semesterschluss einen Schwimmnachmittag mit der Projektleiterin im Telfer Hallenbad24. Die Verlängerung des Angebotes nach den Semesterferien sollte zu einer allmählichen Umwandlung in eine Lern- und Hausaufgabenhilfe in zwei Gruppen führen, was aber scheiterte. 2.5) Mutterkind-Kurse und familiäre Lernhilfe In der zweiten Projektphase wurde nach dem reinen Wanderbibliotheksbetrieb und dem Bibliotheksangebot eine dritte Möglichkeit des interkulturellen Kulturaustausches erprobt: Lese- und Lernförderung mit Entlehnmöglichkeit für Mütter und Kinder im Rahmen regelmäßiger Besuche der Projektleiterin in den Familien. Dieses Angebot zielte bewusst darauf ab, die Mütter, Großmütter und Geschwister im Umfeld der Kinder in das Lerngeschehen einzubinden und so das regelmäßige gemeinsame Lesen und Sprachenlernen anzuregen, denn aufgrund der bisherigen Erfahrungen und Beobachtungen schien der Projektleiterin nur die Einbindung der Mütter und anderen Familienmitglieder eine nachhaltige Lernmotivation zu ermöglichen. Die Mütter sollten einerseits durch teilnehmende Beobachtung mit der vom österreichischen Schulsystem vorausgesetzten Lese- und Hausaufgabenhilfe vertraut gemacht werden und andrerseits dadurch auch selbst besser Deutsch lernen. Verschiedene ein- und zweisprachige Bilderwörterbücher, sowie die Schulbücher des muttersprachlichen Unterrichts und des besonderen Förderunterrichts für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache sollten den Müttern einen niederschwelligen Zugang zur deutschen Sprache ermöglichen. Noch mehr lustige Erstlesebücher in türkischer und deutscher Sprache sowie zweisprachige Bilderbücher sollten Groß und Klein Lust aufs gemeinsame Lesen machen. Diese wöchentlichen Besuche in mehreren Projektfamilien über einen Zeitraum von vier Monaten waren vorhersehbar zeitintensiver als die bisherige Projektarbeit. Auch war die Notwendigkeit des Ankaufs von weiteren deutschen Lehrbüchern für Kinder und Erwachsene absehbar, sodass die Projektleiterin die Kinderfreunde Landesorganisation um die Übernahme der Trägerschaft ersuchte, um besseren Zugang zu Fördermitteln zu erhalten. Nach der Zustimmung durch den Landesvorstand und der Besprechung mit ersten interessierten Familien, stellte die Leiterin weitere Förderanträge und bewarb sich an Wettbewerben, um eventuell Geldpreise zur Erhöhung der Eigenmittel zu gewinnen. Ein bezahlender Nachhilfeschüler brachte erste laufende Projekteinnahmen, die Besuche bei ihm wurden aber dem Familienprojekt zugeordnet. Er war ein Seiteneinsteiger mit großem Lernhilfebedarf, dessen hochschwangere Mutter ebenfalls nach dem Projektkonzept mitlernte, sofern der Haushalt und ihr Zustand das erlaubte. Die letztlich sieben teilnehmenden Familien waren in drei Gruppen einzuordnen: eine Familie mit einem Vorkindergarten-Kind und einem Neugeborenen, drei Familien mit Kindergartenkindern und einem Vorschüler und drei Familien mit ein bis drei Schulkindern. Vier teilnehmende Kinder von vier weiteren Familien wurden zeitweise mit erreicht. Das Familienangebot teilte sich in zwei Teile, den Vorschul- und den Schulbereich. 24 Der Schwimmnachmittag wurde von einem Kind als zweite Belohnung vorgeschlagen. Da die türkischen Frauen dabei als Begleitpersonen ausfielen, konnten nur vier Kinder im Auto der Projektleiterin mitgenommen werden. Das führte zu einer schärferen Auslese der Teilnehmerinnen, was zu heftigsten Protesten zweier Kinder führte, obwohl diese zwei Kinder die Kriterien ohnehin nicht erfüllt hätten. Entgegen den eigenen Angaben konnte auch keines der mitkommenden Kinder schwimmen, noch hatte auch nur eines Schwimmbehelfe mit. Aber auch so machte das Plantschen viel Spaß, stellte aber hohe Anforderungen an die Aufsichtspflichtige. 22 a) Lernhilfe: Unter Rücksicht auf die Lernbedürfnisse der Schulkinder erfolgte Hausaufgabenhilfe oder –Kontrolle (Deutsch und Rechnen), Nichtverstandenes wurde erarbeitet und zum Sachunterricht ergänzende Literatur gelesen. Wann immer Zeit blieb, wurde wechselseitig aus den leseleichten Büchern vorgelesen (Kinder, Projektinitiatorin und auch fallweise die Mütter, die aus türkischen Büchern vorlasen). Die Kinder wurden animiert Bücher auszuleihen und zu lesen. Das Nachhilfekind wurde entgeltlich mehrmals in der Woche besucht, die zwei anderen SchülerFamilien nur einmal pro Woche unentgeltlich. b) Mutter-Kind-Kurse: Bei den Familien mit Klein- und Kindergartenkindern und dem Vorschulkind wurden die Mütter animiert die ausgeliehenen Bücher vorzulesen. Diese vier Familien wurden unentgeltlich besucht, drei davon regelmäßig einmal in der Woche, die Familie mit dem Vorkindergarten-Kind konnte nicht so regelmäßig besucht werden, da erstens auf einen Säugling Rücksicht genommen werden musste, und zweitens die Mutter mit den Kindern im Projektzeitraum eine kurze Reise in die Türkei machte und die Familie danach nach Telfs übersiedeln wollte, was in Summe zu erheblicher Unruhe und Nervosität führte und ein effizientes Lernen verunmöglichte. In den vier Monaten der zweiten Projektphase fanden abzüglich der organisatorischen Besuche in den sieben Familien 96 Familienbesuche statt. 156 volle Stunden verbrachte die Projektleiterin damit aus 164 Medien durchaus auch wiederholt vorzulesen, die Inhalte zu besprechen, Schreib-, Lese- und Sprechübungen mit Kindern und Müttern zu machen und auch insgesamt 154 Bücher zu verleihen. Dabei wurden dankenswerterweise auch Bücher der Bibliothek Mieming benutzt, ohne Bibliotheksgebühren entrichten zu müssen. Die Mediennutzung der Familien war durchaus unterschiedlich, wobei ja auch ganz unterschiedliche und jeweils unterschiedlich viele (1 bis 4) Kinder beteiligt waren. Der Nachhilfeschüler hatte einen besonders hohen Lernbedarf. Bei ihm lag der Akzent vor allem auf der Verbesserung des Hörverständnisses und des verstehenden Lesens, aber auch des Sprechens sowie auf der Sprachlehre. Trotz des bereits zweijährigen Schulbesuchs in Österreich wurde von vorne begonnen mit einem Schulbuch für Seiteneinsteiger der 3. und 4. Schulstufe (Meine neue Sprache 2, Schulbuchliste) und dem ersten Lesebuch des Sohnes der Projektleiterin (Frohes Lernen, Lesebuch, Schulbuchliste). Zusätzlich zu den eigenen Schulbüchern des Schülers kaufte die Projektleiterin für dieses Kind eine Reihe von Lehrbüchern und Erstlesebüchern extra an, wobei besonders die Interessen des Kindes entscheidend waren (Fußball, Landwirtschaft, Tiere), und verwendete ein eigenes Mathematik-Lernspiel und Materialien die zum Stoff passten (Tourismusprospekte vom Ort und von Innsbruck, einschließlich Stadtplan). Erst später wurde zu unbekannteren Themen gelesen - etwa Detektivgeschichten. Passend zum Stoff (Haustiere), motivierte die Leiterin das Kind zum Schluss auch, wöchentlich ein kleines türkisches Büchlein zu lesen. An 35 Nachmittagen wurden so 52 Büchlein gemeinsam und oft auch wiederholt gelesen, wobei beim Lesen abgewechselt wurde. 17 Bücher lieh sich das Kind auch aus. Am Ende las der Schüler sehr gerne und freute sich immer auf neue Bücher. Zweimal war der Vater für einige Zeit anwesend. An 17 von 35 Nachmittagen war die Mutter teilweise im Raum anwesend und wurde öfters in das Lesen und Lernen eingebunden. Dreimal war auch der bosnische Nachbarsjunge einige Zeit anwesend und las mit, wurde aber nicht als Projektteilnehmer erfasst. Nur mit diesem Nachhilfekind konnte ungestört, ganz gezielt und intensiv gelernt werden - vermutlich weil die Stunden für den Sohn bezahlt wurden und deshalb für wertvoll genug erachtet wurden, sie nicht durch Besucher stören zu lassen. In den beiden andern Familien mit Schulkindern konnte mit nur einem – unentgeltlichen Besuch pro Woche und zwischen ein und fünf jeweils anwesenden Kindern und teilweise hoher Fluktuation nicht intensiv und ungestört gearbeitet werden. Gemeinsame Aktivitäten und Einzelbetreuung wechselten sich flexibel ab. Es wurde in beiden Familien gemeinsam gelesen, auf Prüfungen oder Tests gelernt, Leseaufgaben geübt, Rechen- und Deutsch23 aufgaben betreut und in beiden Familien wurden für den Heimatkundeunterricht je eine kleine spontane Exkursion gemacht, um etwa Informationsmaterial beim Telfer Tourismusbüro zu besorgen oder Stift Stams und den Eichenwald zu besuchen. In einer Familie waren zuerst nur zwei Kinder, später aber oft vier zum Lernen da, was aufgrund des Altersunterschiedes (eine Schwester der 2. Klasse Hauptschule gesellte sich zu den drei Volksschulkindern) und der sich so vergrößernden Niveauunterschiede zu Problemen führte. Auch wurde in der Zeugnisnoten-Entscheidungszeit wieder ein vermehrter und störender Leistungsdruck festgestellt. In der dritten Familie hatte ein Kind erhebliche Lernprobleme (Sonderschülerin), sodass es meistens einige Zeit allein betreut wurde. Außerdem kam in diese Familie aufgrund der zentralen Lage sehr häufig Besuch mit Kindern, die nach Möglichkeit bewusst in die Leseaktivitäten eingebunden wurden. In der Folge wurden drei weitere Familien Projektteilnehmer. Alle beteiligten Schulkinder schienen eine geringe Aufgaben- und Lernmoral zu haben, was aber vor dem Hintergrund der Raumknappheit und des reichen Soziallebens sehr verständlich ist. Leider führte das dazu, dass wiederholt die von der Projektleiterin nachgefragten Schulhefte und –bücher (auch!) an den Lernklubtagen nicht in der Schultasche waren, so dass nicht damit gelernt werden konnte. Im Falle des Nachhilfeschülers konnte der gute Kontakt zur Lehrerin das kompensieren. Mit ihr gab es insgesamt acht Kontakte, dabei wurde auch nachgefragt, welcher Stoff gerade behandelt würde. Bei den beiden anderen Familien war das nicht möglich, da die Lehrpersonen der Kinder nicht bekannt waren. In keiner der drei Familien war ein Schreibtisch oder ein eigenes Bücherregal vorhanden, um die in der Schule nicht benötigten Schulsachen sachgerecht aufzubewahren. Die Lernaktivitäten fanden entweder auf dem Boden oder auf dem Sofa am Wohnzimmertisch statt, was in vielen Kulturkreisen aber nichts Außergewöhnliches25 ist, und für die ethnologisch ausgebildete Projektleiterin kein Problem darstellte. Die Situation in den vier Familien mit Vorschul- und Kindergartenkindern war gänzlich anders. Erstens war noch kein direkter Lerndruck zu spüren, obgleich die Mutter eines Kindergartenkindes seitens des Kindergartens nachdrücklich zum Deutschlernen mit dem Kind aufgefordert wurde. Zweitens hatten drei Mütter ein Kind unmittelbar vor dem Schuleintritt bzw. in der Vorschule und waren sehr motiviert, beim Schulstart zu helfen und auch selbst Deutsch zu lernen. Dasselbe galt für die Mutter deren größeres Kind unmittelbar vor dem Kindergarteneintritt stand. Diese Mütter liehen einerseits gerne türkische Bilderbücher und Märchenbücher als Gute-Nacht-Geschichten aus. Andrerseits liebten sie die ein- und zweisprachigen Bilderwörterbücher, mit denen sie mit den Kindern spielerisch erste deutsche Wörter üben konnten. Leseleichte Kinderbücher, in denen immer wieder Bilder die Hauptwörter ersetzen (Rettich, e. a.) fanden in den Besuchsstunden begeisterte Zuhörer bei Jung und Alt. Auch textlose Bilderwörterbücher und Kleinkinder-Sachbücher kamen zum Einsatz, sie wurden von der Projektinitiatorin gestellt oder von der Bibliothek Mieming ausgeliehen. Die bunten und lustigen Bilder boten viele Such-, wurden vor allem von den kleineren Geschwistern mit den schönen Buntstiften und Zeichenblocks Benjamin Blümchenheft mit Puzzle und bunten Familien, bis es irgendwo vergessen wurde…. Zeige- und Sprechgelegenheiten. Gerne die mitgebrachten Puzzles gespielt, oder gemalt oder auch gebastelt. Auch ein Rätseln sorgte für viel Freude in den Zwei Mütter äußerten den Wunsch nach Erwachsenen-Lehrbüchern für Deutsch. Die im Handel erhältlichen einsprachigen Deutschlehrbücher sagten ihnen aber dann nicht zu, da in ihnen erstens kein türkisches Glossar vorhanden war und andererseits diese Bücher inhaltlich nicht auf junge Mütter in der Migrationsituation zugeschnitten waren. Sie wollten Vgl: Zukunftsministerium: Den ersten Schritt gehen wir gemeinsam, Wien 2002, Seite 48: „Wussten Sie, dass …. in etlichen Kulturen der Tisch ausschließlich zum Essen benützt werden darf – und Kinder keinesfalls darauf die Hausaufgaben schreiben dürfen?“ 25 24 einen praktischen Wortschatz aus ihrer Lebenswelt lernen: Körperteile und Krankheiten, (Kinder)Arztbesuche, Kindergarten- und Schulsituationen, Alltagskonversation zwischen Müttern, Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen. WIE begründet dieser Wunsch war, zeigte erst nach Abschluss der zweiten Projektphase der im Vorwort zitierte Vorfall im Grazer Landeskrankenhaus. Mit diesen Müttern wurden dann verschiedene deutsche Kinderbücher erarbeitet, und Lese- und Sprechübungen durchgeführt. Zwei Mütter bestellten über die Projektleiterin diese Schulbücher für Seiteneinsteiger, aus denen sie umgehend selbstständig zu lernen begannen, da sie ihre Wortschatz- und Gesprächsbedürfnisse am besten befriedigten. Die gesamten Entlehnungen der 17 teilnehmenden Kinder der zweiten Phase zeigen ganz unterschiedliche Präferenzen, wobei der Deutschanteil mit der Sprachbeherrschung und dem Lerndruck stieg. Das Nachhilfekind lieh sich deutsche Bücher in der Regel weniger aus, da sie ja schon in den Besuchsstunden intensiv gemeinsam gelesen wurden. In dieser zweiten Projektphase ging es - außer beim Nachhilfekind - nicht in erster Linie um die gezielte Lernhilfe für Schüler oder ein möglichst effizientes Deutschlernen in Familien mit Kindergartenkindern. Vielmehr stand das spielerische Kennenlernen des Bibliothekswesen und der Idee des Lernklubs im Vordergrund. Alle Besuchsfamilien kamen regelmäßig mit dem Bibliothekswesen in Kontakt und konnten so hoffentlich Bücher und das Vorlesen als hilfreiche Freunde beim (Sprachen-)Lernen für sich entdecken. Die vielen Störungen durch Besuche oder spontan einbezogene Kinder wurden dabei bewusst in Kauf genommen, da so allmählich die Diskussion über die Idee des Cin Ali Lernklubs innerhalb der türkischen und türkisch/kurdischen Gemeinschaft in Gang kommen würde. Diese Mundpropaganda funktionierte und ein Umdenken wurde spürbar. Neben dem Ziel, eine Projekt-Bibliothek aufzubauen, den Entlehnbetrieb zu starten und neue Modelle sozial-integrativer Bibliotheksarbeit26 zu entwickeln, hatte das Pilotprojekt vom ersten Tag an auch die Absicht, für die Thematik diskriminierte Mehrsprachigkeit bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu sensibilisieren und die anfangs vermuteten und letztlich nachgewiesenen Benachteiligungen bewusst, sichtbar und hörbar zu machen. Dies geschah durch Öffentlichkeitsarbeit und Interaktionen. 2.6) Öffentlichkeitsarbeit und Interaktionen Das Projekt verstand sich in erster Linie als Vermittler zwischen den verschiedenen Kulturen: der österreichisch/deutschen auf der einen Seite und der türkischen und türkisch/kurdischen (fallweise bosnischen) auf der anderen Seite. Dafür wurde durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinn und durch bewusste Interaktionen ein Vermittlungskreislauf 27 in Gang gesetzt. Öffentlichkeitsarbeit in diesem weitesten Sinn war also nicht auf die Werbung um neue Teilnehmerfamilien und die herkömmliche Pressearbeit beschränkt. Alle Interaktionen, die über den reinen Kulturaustausch hinausgingen, wurden bewusst als eine Form der Bibliotheksleitbild des Büchereiverbandes Österreichs: „Öffentliche Bibliotheken entwickeln daher Sonderformen bibliothekarischer Versorgung – zum Beispiel Patientinnenbibliotheken, Seniorenbibliotheken, Gefängnisbibliotheken. Sie bringen die Bücher zu den Menschen und übernehmen dort die mediale Betreuung von körperlich gehandicapten Menschen oder gesellschaftlichen Randgruppen. Im Zusammenwirken mit Kooperationspartnern widmen sie sich Zielgruppen der sozial-integrativen Bibliotheksarbeit wie MigrantInnen, Arbeitslosen, Behinderten, Informations-Armen und Sekundäranalphabeten. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration von Zuwanderern und von ethnischen Minderheiten indem sie Bücher, Zeitschriften und audiovisuelle Medien in deren Sprache zur Verfügung stellen, und zwar in den Bibliotheken ihrer Wohngebiete.“ Quelle: www.bvoe.at 27 Thaler/Voggensberger, „Gutes besser tun – aber wie?“, 2004: Seite 71f: „Der Vermittlungskreislauf (z.B. Reporting, Berichte, Analysen, Interviews, Gespräche, systematischer Perspektivewechsel) ist dann von Nutzen, wenn es der Nonprofit-Organisation gelingt, erfolgreich zwischen der Welt ihrer Kundinnen und Kunden und jener der Spendenden (oder auch der öffentlichen Hand als Auftraggeberin) zu übersetzen und zu vermitteln. So lernen die Auftraggebenden die Bedürfnisse und Probleme ihrer Klientinnen und Klienten, die von einem Leistungsauftrag profitieren, kennen.“ 26 25 Öffentlichkeitsarbeit gepflegt - wenn auch manchmal in sehr spezifischen Teilöffentlichkeiten. Das heißt, jede Kommunikation wurde nicht nur zu ihrem offensichtlichen Zweck getätigt, wie etwa Informationen zu sammeln, für ein Kind zu intervenieren, Trägern zu berichten oder Geld zu beantragen, sondern immer auch um beim Interaktionspartner auf die Probleme der Zielgruppe hinzuweisen, um auf das Thema der diskriminierten Mehrsprachigkeit aufmerksam zu machen, um es zur Diskussion zu stellen und möglicherweise schon im Projektzeitraum Änderungen oder Verbesserungen zu erwirken. Formen der Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne waren dabei: Teilnehmerwerbung durch das Erstellen und Verteilen der Werbebroschüre Verhandlungen mit Institutionen (verschiedene öffentliche Bibliotheken) bzgl. der Mitbenutzung ihrer Infrastruktur, Räume und Medien für das Projekt, Gespräche oder Email- bzw. Postkorrespondenz mit Kinderfreunde-Funktionären, Eltern, Lehrern, Direktoren, Schul- und Landesbehörden, Politikern und Vereinsfunktionären, um auf das Projekt oder einzelne Probleme aufmerksam zu machen Folder, Presseaussendungen und die Mitarbeit an speziellen Medien (klasseMagazin des Dachverbandes der Elternvereine an Pflichtschulen, Dorfzeitung von Mieming) Web-Präsentation auf Unterseiten der Homepage der Projektinitiatorin samt Vernetzung mit interessierten Partnern Diskussionsbeiträge auf Veranstaltungen (Präsentation von Klasse Zukunft in Innsbruck) oder in Internetforen (Klasse:Zukunft, Ganztagsschule, www.schule.at, aber auch von Elternvereinen, Parteien oder Medien, und in einer Yahoo-Gruppe) Subventionsansuchen (Land Tirol [zwei Abteilungen], Arbeiterkammer Tirol, SPÖFrauen Tirol, Gemeinde Mieming) Wettbewerbsbeteiligungen: Kinderrechtepreis 2004, Interkulturpreis 2004, Europasiegel für innovative Sprachprojekte 2004 und Dixi-Kinderliteraturpreis (es wurde das Manuskript für ein Kinderbuch zu der Problematik eingereicht, Teilnahme war leider nicht möglich, die Buchidee wird aber später weiterverfolgt) Verhandlungen mit Buchhändlern, Verlagen, Kinos und Banken, um Preisnachlässe bzw. Bibliotheksrabatt für eine Sonderbibliothek im Aufbau oder günstige Kontobedingungen oder Unterstützung zu erwirken (beantragte) Vereinsbeitritte (Frauen aus allen Ländern, Kinderliteraturhaus, Büchereiverband Österreichs, Multikulturell), Bibliotheksbeitritte (Mötz, Mieming, Telfs…. ) Abschlussberichte oder laufende Berichte und Statistiken an Kooperationspartner, den Träger oder die Subventionsgeber. Veröffentlichung der Evaluationsstudie und des ersten zweisprachigen Cin Ali Heftes auf der Universitätshomepage der Projektleiterin sowie Anmeldung der Studie auf der Drehscheibe Bildungsforschung28 Durch diese formal und inhaltlich breit gestreute Öffentlichkeitsarbeit wurde bewusst eine „Vernetzung der Nonprofit-Organisation (Kinderfreunde, Cin Ali Lernklub-Projekt) mit Wirtschaft, Gesellschaft und staatlicher Ordnung“29 angestrebt, indem zwischen den potentiellen Leistungsbezüglern und Leistungsermöglichern eines Folgeprojekten bereits in der Pilotphase vermittelt wurde. Das laufende Protokollieren und Evaluieren der Aktionen und Geldbewegungen erwies sich dabei als doppelt zweckdienlich. Einmal fand eine ständige Kontrolle des Projektes statt. Abweichungen vom geplanten Verlauf wurden erkannt und die Konsequenzen daraus umgehend gezogen. Gutes wurde weiter verfolgt, Fehlentwicklungen beobachtet, analysiert 28 Die Drehscheibe Bildungsforschung (www.dbf.at ) 29 Thaler/Voggensberger, „Gutes besser tun – aber wie?“, 2004: Seite 70 26 und dann korrigiert. Laufende Berichte und Kopien der Presseaussendungen, Folder und Presseausschnitte an das Kinderfreunde-Büro bereiteten eine günstige Stimmung für die Übernahme der Trägerschaft vor und waren darüber hinaus auch für einige Subventionsgeber eine überzeugende Entscheidungshilfe. Die dadurch erhaltenen Förderungen und der Kinderrechtepreis 2004 wurden wiederum durch Öffentlichkeitsarbeit kommuniziert, was nach innen und nach außen ermunterte, das Projekt weiter zu unterstützen. Da für Projekte im Nonprofitbereich ein funktionierender Vermittlungskreislauf besonders wichtig ist, um eine möglichst große Anerkennung und Förderung für die betreute Zielgruppe zu erreichen, wurde im Rahmen dieser Evaluation eine Analyse der wichtigsten 516 Interaktionen vorgenommen, die sich unterschieden in projektinterne Interaktionen zwischen der Projektleiterin und den Teilnehmern und projektexterne Interaktionen zwischen der Projektleiterin und Außenstehenden, wie etwa die Mitarbeiter und Leiterinnen von anderen Bibliotheken, des Bildungswesens und der Bildungspolitik, verschiedenen Beratungsstellen, einigen Gemeinden als Schulträgern und anderen Vereinen mit ähnlicher Zielsetzung, aber auch der Wirtschaft. Die Interaktionen wurden am Computer erfasst und sowohl hinsichtlich der Partner als auch der Art in verschiedene Kategorien eingeteilt. Die zeitliche Verteilung der Interaktionen zeigt gleich vorweg, dass die Häufigkeit erheblich schwankte. Am Beginn und gegen Ende der zwei großen Projektphasen waren mehr Interaktionen zu verzeichnen (September/Dezember und März/Juli) als in den Vor- und Nachbereitungsphasen (Juni/Jänner-Februar und Februar/Juli-August). Grund dafür waren einerseits die Belohnungen oder ein Wettbewerbsgewinn bzw. eine Förderung zum weiteren Buchankauf, wie der interaktionsreichste Monat (Juli) deutlich zeigt: eine Steigerung um 33 Interaktionen vom Höchstwert der ersten Phase (Dezember = 56) auf 89 im Juli. Gründe waren: Die komplizierten Buchbestellungen einer kompletten Buch-Reihe in der Türkei oder von türkischen Büchern über eine bestimmte Buchhandlung, von der die Buchgutscheine des Gewinnes stammten. Die Entgegennahme des Kinderrechtepreises durch zwei Projektkinder im Rahmen der Kidsparade in Linz und die folgende Pressearbeit, samt dem Weiterleiten der Presseausschnitte, der Web-Präsentation des Preises und der teilweisen Vernetzung mit den anderen Wettbewerbsteilnehmern. Ein weiterer Grund für vermehrte Interaktionen unmittelbar nach Projektabschluss war die Notwendigkeit, ein Projektkind der Betreuung durch den Verein Heilpädagogische Familien zuzuführen, samt zugehöriger Terminkoordination und Amtsbegleitung, sowie der Beschaffung von Kopien der Klinik-Befunde. Interaktionsarten gliederten sich in persönliche Besprechungen, Telefonate, Email- und Briefkorrespondenz sowie die Diskussion in Internetforen oder –gruppen. Mit 62 Prozent überwog die mündliche Kommunikation, gegenüber der schriftlichen mit 38 Prozent. Wenn auch die mündlichen Formen überwogen, so zeigt die Analyse, dass das Internet eine beachtliche Rolle für das Projekt spielte. Die erfassten 109 Emails und 20 Forumsinteraktionen sind jedoch nur eine Untergrenze. Es wurden nur die einleitenden Emails eines Emailwechsels erfasst, bzw. Presseaussendungen via Email (9). Bei den Forumsinteraktionen30 wurden nur die erfasst, die eine Reaktion auf einen Forumsbeitrag der Projektleiterin darstellten und in der Folge zu einem mehrmaligen Gedankenaustausch und 30 NEWS-Forum, Forum von www.schule.at, Forum der Elternvereins-Dachverbands-Homepage, eine YahooGruppe 27 eventuell auch zu einer längeren Email-Korrespondenz oder zu einem Briefwechsel führten. Die 65 Briefe hingegen waren entweder herkömmliche Förderansuchen, Berichte oder Anträge an den Träger bzw. verschiedene seiner Mitarbeiter, Wettbewerbsanmeldungen, Briefe an Vertreter der Schulaufsicht und Verwaltung, potentielle Unterstützer und Multiplikatoren oder eben auch Büchersendungen nach Ankara. Die meisten der einzelnen Interaktionspartner waren dem Bildungssystem zuzuordnen. Dabei ist zu bemerken, dass hier auch die größte Bandbreite an Akteuren zu finden war, die in folgendes Kategorieschema einzuteilen sind: Akteure Eltern oder andere Erziehungsberechtigte Vorschulkinder, SchülerInnen, Lehrer, PädagogInnen, Professoren Träger Verwaltung und Aufsicht Erwachsenenbildung: Bibliotheken Summe Interak- Prozent tionen 96 34 % 9 3% 55 18 20 % 6% 49 17 % 55 282 20 % 100 % Tabelle 4: Eltern waren die häufigsten Interaktionspartner, was auch daraus zu erklären ist, dass sich das Projekt als Eltern- bzw. Elternbildungsinitiative verstand. Die KinderfreundeOrganisation als Familienorganisation der Sozialdemokratischen Partei Österreichs ist häufig in der Elternbildung aktiv. Interaktionen mit Pädagogen erfolgten gleich häufig wie mit Partnern aus dem Bibliothekswesen (je 20 Prozent). Träger, Schulaufsicht und Verwaltung wurden auf allen Politikebenen: Gemeinden, Bezirk, Land und Bund (Ministerium) kontaktiert. Die vielen Interaktionen mit den Vertretern des Bildungssystems (Eltern, Lehrer, Direktoren, Gemeindebedienstete und Beamte sowie Bibliothekare31) und mit den Vertretern des Trägers, der Kinderfreunde-Landesorganisation, waren für die Durchführung des Projektes nahe liegend und notwendig. Darüber hinaus wurde aber – gleichsam als Lobbying - auch zu (vorwiegend SPÖ-)Politikern Kontakt gesucht, in der Zeit des BundespräsidentenWahlkampfes auch mit den zwei Präsidentschafts-Kandidaten32, um auf das Thema aufmerksam zu machen und auf lange Sicht für die Anliegen der Zielgruppe auch politische Unterstützung zu erhalten. Die Interaktionen zur Wirtschaft waren vor allem für den Bücherankauf bzw. die Bücherbestellungen nötig, aber auch bzgl. der Verhandlungen um den Büchereirabatt, der zumeist gewährt wurde, aber bei einer Buchhandlung letztlich wieder gestrichen wurde mit der Begründung, dass es sich bei der Cin Ali Lernklub – Bibliothek nicht um eine „öffentliche Bibliothek“ handle. Daraufhin wurde beschlossen, keine weiteren deutschsprachigen Bücher anzukaufen, bis die Aufnahme in den Büchereiverband Österreichs und somit die offizielle Anerkennung als Sonderbibliothek erreicht sein würde. Aber auch mit der örtlichen Bank wurde öfters verhandelt, um günstige Kontobedingungen und eventuell eine Unterstützung zu erhalten – mit Teilerfolgen. Bei den kontaktierten Vereinen handelte es sich um die Vereine Multikuturell, Frauen aus allen Ländern, Heilpädagogische Familien, den Verband der kurdischen Vereine Österreichs, 31 Kooperiert wurde mit drei öffentlichen Bibliotheken über deren Leiterinnen: Mötz, Telfs und Mieming. Und mit fünf weiteren Bibliotheks-MitarbeiterInnen gab es Einmalkontakte: mit zwei weiteren Mitgliedern der Bibliothek Mötz, und je einem Mitglied der Arbeiterkammer-Bibliothek Innsbruck, der Stadtbibliothek Innsbruck, der Bibliothek der Pädagogischen Akademie Stams und der Bibliothek des kurdischen Kulturvereins in Linz. Eine Mitarbeiterin der Bibliothek Haiming meldete sich nach Projektabschluss aufgrund des Presseberichtes zum Kinderrechtepreis 2004 und übernahm leihweise 128 Büchlein der Projektsbibliothek zur Ansicht. Einige Interaktionen ergaben sich auch anlässlich des Beitrittsgesuches der Bibliothek an den Büchereiverband Österreichs. 32 Am 25. April stellten sich Dr. Benita Ferrero-Waldner und Dr. Heinz Fischer der Wahl zum Bundespräsidenten Österreichs. Erstere trat mit dem Slogan an, dass sie mit 101 Staatsoberhäuptern in deren Sprache sprechen könne. Das legte natürlich nahe, hier auch für den Einsatz hinsichtlich der muttersprachlichen Förderung der neuen Österreicher mit türkischer und kurdischer Muttersprache zu werben. 28 Jugendliteratur, einen Lernhilfeverein, das Zentrum für MigrantInnen in Innsbruck(ZEMIT) und das Freiwilligenzentrum Innsbruck. 2.7) Zusammenfassung Das Pilotprojekt hatte alle seine Ziele erreicht. Aufbau einer kleinen mehrsprachigen Projektbibliothek; der Entlehnbetrieb wurde erprobt und evaluiert. Darauf aufbauend wurden verschiedene Kinderfreunde-Angebote für die Zielgruppe entwickelt, erprobt und evaluiert, und zwar sowohl für Kinder als auch für Kinder und Mütter gemeinsam. Die Gesamtheit der Aktivitäten wurde am Computer erfasst und ausgewertet und auf Grund dieser Ergebnisse wurde ein Folgeprojekt definiert. Die konsequente Öffentlichkeitsarbeit im erweiterten Sinn und die bewussten Interaktionen mit Akteuren innerhalb des Projektes und mit Akteuren verschiedener gesellschaftlicher Subsysteme (Bildungssystem, Bildungspolitik und Politik, Vereine und Institutionen) führten zu einer gesteigerten Sensibilität für das Thema und zu ersten Subventionen und zu symbolischer Anerkennung durch den Wettbewerbspreis. In ökonomischer Hinsicht schuf das Projekt so nicht nur einen Mehrwert durch die Gründung einer neuen Sonderbibliothek, sondern auch einen neuen ökonomischen Faktor im Raum. Die Barausgaben der Projektleiterin in der Höhe von € 2.264,69 zeigen die Verflechtung eines Kultur-Projektes dieser Art mit der Wirtschaft auf. Die betroffenen Branchen waren (Schul)Buch- und Bürowarenhandel sowie Post und Bank (nur Kontoführungsspesen, die weiteren Spesen wurden erlassen), sowie Freizeiteinrichtungen wie Kinos und das Schwimmbad Telfs. Bezüglich des Buchhandels konnten bei der Gelegenheit große Probleme beim Bezug türkischer Kinderbücher im deutschsprachigen Raum transparent gemacht werden. In Anbetracht des erheblichen und stetig steigenden Anteils an türkischsprachigen Menschen33 alleine in Österreich ließe sich durch eine Liberalisierung des Buchhandels mit der Türkei ein ganzer Kulturmarkt erschließen, für den sich derzeit niemand zu interessieren scheint. Die Barausgaben des Pilotprojektes (24 Prozent der Gesamtsumme von € 10.273,63) verteilen sich auf Buchhandel (67 Prozent), Büromaterial (einschließlich Porto und Bucheinbandfolie, 25 Prozent) Aktivitäten (Kino und Schwimmen, 7 Prozent) und Parkplatzbewirtschaftung (1 Prozent) Durch die buchhalterische Verrechnung der ehrenamtlichen Arbeitszeit34 der Projektleiterin mit € 15,- pro Stunde und der Verrechnung des amtlichen Kilometergeldes35 von 36 Cent für jeden für das Projekt gefahrenen Kilometer als neben den reinen Barausgaben eingebrachte 33 Die Statistik Austria berichtete, dass alleine im Jahre 2003 30,6 Prozent (13.665) der 44.694 in Österreich Eingebürgerten aus dem Herkunftsland Türkei stammten. 34 Darin sind neben dem bloßen Zeitaufwand für die verschiedensten Tätigkeiten (Büro- und Büchereiarbeit, Webdesign, Vorlesen, Deutschkonversation und Sprachvermittlung, Erstellen von Broschüren und Berichten, Öffentlichkeitsarbeit, Interaktionen mit Projektaußenstehenden, Recherche für die Evaluation) auch die Benutzung des Büros und der Geräte (Telefon, Computer, Software, Webspace) sowie anteilig die Krankenversicherung der Projektinitiatorin enthalten. Nicht darin enthalten ist die Arbeit an der Evaluation (Protokollierung der teilnehmenden Beobachtung, Codierung und Evaluation der Daten, Verfassen der Dokumentation, Veröffentlichung in Print- und Webform) 35 „Eine Pauschalabgeltung für alle Kosten, die durch die Verwendung des privaten Kraftfahrzeuges (Pkw, Kombi oder Motorrad) für Dienstfahrten anfallen. Wird vom Arbeitgeber für die Verwendung eines arbeitnehmereigenen Kraftfahrzeuges als Kostenersatz gemäß § 26 Z 4 lit. a EStG 1988 das amtliche Kilometergeld verrechnet, können zur Vermeidung zusätzlicher Administrationskosten bei der Lohnverrechnung die Beträge gemäß § 10 Abs. 3 und 4 der Reisegebührenvorschrift auf volle Cent aufgerundet werden. Zum Beispiel kann daher für die Verwendung eines arbeitnehmereigenen PKW ein steuerfreier Kostenersatz in Höhe von 0,36 EUR pro Kilometer ausgezahlt werden („Kurzsatz"). Dieser Kurzsatz beträgt für den Projektzeitraum: € 0,36.“ Quelle: www.oeamtc.at 29 Eigenmittel wurde der Marktwert der im Projekt geleisteten Arbeit sichtbar gemacht: insgesamt Euro 7.808,94, das sind 76 Prozent des so errechneten Projekt-Gesamtwertes. Die als Eigenmittel in das Projekt eingebrachten ehrenamtlich geleisteten Stunden und gefahrenen Kilometer konzentrieren sich vor allem auf die sehr zeitintensive Phase 2. Das Gewicht des Zeitfaktors machte klar, dass diese Angebote teilweise nur auf freiwilliger und/oder ehrenamtlicher Basis geschehen können, weshalb die Projektleiterin die Initiative auch schon in der Pilotprojektphase beim Freiwilligenzentrum der Caritas in Innsbruck angemeldet hatte. Für diese für die friedliche Koexistenz verschiedener Volksgruppen so notwendige kulturelle Integrationsarbeit können allerdings nur entsprechend (aus)gebildete, sehr offene und flexible Freiwillige herangezogen werden, was die Einbindung von Projekten dieser Art in die pädagogische Ausbildung (außerschulisches Praktikum) aber auch in die Studienpläne einiger sozialwissenschaftlicher Studienrichtungen nahe liegend erscheinen ließe. Neben dem ökonomischen Wert erzielte das Projekt jedoch auch einen Erkenntniswert. Die Analyse der Schüler- und Bevölkerungsdaten und die Reaktionen der Akteure des Bildungswesens auf die Fragen der Projektleiterin zur Fördersituation zeigten, dass zwischen Gesellschaft bzw. Schule und der neuen Bevölkerungsgruppe noch viel Vermittlungsarbeit geleistet werden muss, da der Informationsstand auf allen Seiten noch teilweise unzulänglich ist, was besonders die erst während der Evaluationsphase begonnene Beratungsarbeit im Fall der teilnehmenden Sonderschülerin zeigte. Durch die verschiedenen Interaktionen mit der Schulverwaltung und -aufsicht und dem Bildungsministerium wurde offensichtlich, dass diese Schülergruppe in Summe tatsächlich diskriminiert wurde, indem die möglichen Förderungsstunden sowohl in der Muttersprache als auch in der Zweitsprache nicht voll ausgeschöpft wurden. Im Gespräch mit Schuldirektoren und verschiedenen Lehrpersonen entstand generell der Eindruck, dass alleine den Kindern und deren Eltern das Verschulden für einen etwaigen schlechten Schulerfolg angelastet wurde. Zuwenig Förderunterricht und Bücher, die eventuell fehlende SpezialAusbildung der Lehrpersonen bezüglich „Deutsch als Fremdsprache“ und vor allem das Fehlen der muttersprachlichen Unterstützung beim Eintritt in das österreichische Schulsystem als Grund für das Scheitern wurden nicht in Erwägung gezogen. Auf den Hinweis auf das höchstmögliche Förderausmaß wurden stets als Gegenargumente die finanziellen und Stunden-Kürzungen bzw. die durch sie verursachten knappen Stundenkontingente erwähnt und die Konkurrenz dieser speziellen Förderstunden zu anderen Förderangeboten für die Gesamtheit der Schüler einer Schule wurde offensichtlich. Die Förder-Situation schien insgesamt in Telfs bzw. in dem Ort mit einer Flüchtlingsbetreuungseinrichtung (Mötz) günstiger zu sein, was aber nicht bei allen Kindern zu besseren Deutschkenntnissen führte. Warum das so ist, müsste untersucht werden. Der Grund für die intensivere Förderung in Telfs und Mötz dürfte im höheren Anteil der Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache zu suchen sein. 30 Kinder der Jahrgänge 1988 - 2002 Kinder der Jahrgänge 1988 - 2002 Jahrgang: Mai.03 22.07.2004 Min. Plus Jahrgang: 01.07.2002 01.01.2004 01.07.2004 Plus 04 Plus 02/04 1988 46 45 -1 1988 185 196 200 4 15 1989 40 39 -1 1989 182 194 203 9 21 1990 39 40 1990 160 168 173 5 13 1991 44 41 -3 1991 176 187 195 8 19 1992 42 39 -3 1992 194 203 207 4 13 1993 44 44 1993 189 195 197 2 8 1994 40 40 1994 182 188 193 5 11 1995 48 47 1995 180 185 190 5 10 1996 39 39 1996 192 206 208 2 16 1997 51 47 -4 1997 199 211 215 4 16 1998 44 43 -1 1998 175 179 184 5 9 1999 35 35 1999 163 165 174 9 11 2000 42 45 3 2000 156 164 170 6 14 2001 41 42 1 2001 155 162 164 2 9 2002 35 34 2002 (*)0 2488 157 2760 168 2841 11 (*)0 ( * ) 185 Summe 630 620 1 -1 -1 -15 5 Summe 81 Tabelle 5: Die Jahrgänge 1988 bis 2002 verzeichnen in Mieming ein Minus von 10, während in Telfs allein im Jahr 2004 eine Zuwanderung von 81 Personen dieser Jahrgänge zu verzeichnen war. Die Telfer Bilanz zwischen 1. Juli 2002 und 1. Juli 2004 (zwei Jahre) für die Jahrgänge 1988 bis 2003( * ) zeigt ein Plus von 185 Personen. Datenquelle: Meldeämter Mieming und Telfs, Bearbeitung Himsl. Im Zusammenhang damit wurde eine schon länger anhaltende Wanderbewegung der türkischen Familien des Projektraumes in die Marktgemeinde Telfs festgestellt. Direkt im Projektzeitraum wanderten zwei der kontaktierten Familien ab. Das, und das große Interesse der vier Telfer Projekt-Familien sowie Anmeldungen von zwei weiteren Telfer Familien ließ die Verlegung des Projektstandortes und eine dauerhafte Etablierung der Angebote in Telfs sehr nützlich erscheinen. Ein Vergleich der Bevölkerungszahlen der Jahrgänge 2002 (2003) bis 1988 von Mieming und Telfs zeigt, dass die beobachtete Abwanderung von Kindern von Mieming und anderen Gemeinden sich in den Volksschülerzahlen von Telfs bereits deutlich niederschlug. Die Schülerzahlen der Volksschulen im Projektraum vom Schuljahr 2002/2003 und dem Schuljahr 2003/2004 ergeben ein Plus von 36 Schülern in beiden Volksschulen von Telfs (VS Schweinester und VS August Thielmann). Nach Muttersprachen: Serbokroatisch plus 15, Türkisch plus 21, sonstige minus 8. Eine Kategorie türkisch/kurdisch gibt es nicht. Die sieben für Herbst 2004 für das Projekt bereits angemeldeten Telfer Familien sind jedoch alle türkisch/kurdisch. Daraus ergibt sich die Frage: werden ihre Kinder unter türkisch oder sonstige erfasst? Es trifft für diese Kinder natürlich zu, dass sie auch Türkisch sprechen, aber sie verfügen darüber hinaus über aktive bzw. passive Kurdischkenntnisse36 und wären mit ihrer familiären Zweisprachigkeit eigentlich unter sonstige einzuordnen. Eine Erhebung aller aktiven und passiven Sprachen der Kinder im Rahmen eines Sprachenportfolios37 bereits im Kindergarten-, Vor- und Volksschulbereich wäre hier dringend zu empfehlen. „Das Türkische ist die verfassungsmäßige Staatssprache der Republik Türkei, in der unterschiedlich große Bevölkerungsgruppen Kurdisch, Arabisch, Tscherkessisch, Lasisch usw. sprechen, ohne dass diese Sprache als Minderheitssprachen anerkannt sind. Anerkannt sind lediglich die Sprachen der griechischen und der armenischen Minderheit.“, Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Türkisch, München 1997, S. 15 37 „Das EUROPÄISCHE SPRACHENPORTFOLIO als Lernbegleiter in Österreich ist ein vom Europarat entwickeltes Instrument zur individuellen Präsentation sprachlicher und interkultureller Lernerfahrungen. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur wurde am Österreichischen SprachenKompetenz-Zentrum im Februar 2002 eine nationale Portfolio-Arbeitsgruppe eingerichtet, um das Europäische Sprachenportfolio (ESP) auch in Österreich als pädagogisches Arbeitsinstrument und Lernbegleiter für SchülerInnen zu entwickeln.“ Quelle: http://www.sprachen.ac.at/bereich.php?bereich=1&tree=3&root=0 36 31 Aussagekräftig wäre auch eine Erforschung der Drei- und Viersprachigkeit und ihres Einflusses auf den Schulerfolg der Kinder dieses Raumes. Die durch das Pilotprojekt Cin Ali Lernklub gewonnenen Erkenntnisse lassen in ihrer Summe die Realisierung des Folgeprojektes in Telfs geradezu notwendig erscheinen (siehe Anhang C). Darüber hinaus sind aber im nächsten Abschnitt noch weitere Schlussfolgerungen zu ziehen. 32 3. Dokumentation und Evaluation des Familien-Lernhilfe Projektes 3.1 Die Projektbeschreibung Aufbauend auf die Ergebnisse der Pilotversuche der vorangegangenen Jahre38 versucht die Projektleiterin im Wintersemester 2005/2006 konkrete Kursangebote für das Konzept der bilingualen Familien-Lernhilfe zu entwickeln. Inhalt des Projektes: 1) Die Fortsetzung der Lese- und Sprachkompetenz-Förderung IN türkischen bzw. türkisch/kurdischen Familien durch regelmäßiges Vorlesen von türkischen, kurdischen, deutschen, englischen und zweisprachigen Kinderbüchern aus der Cin Ali Lernklub Bibliothek, die einmal wöchentlich mit einem sozial-integrativen Bibliotheksangebot39 in die zwölf Projekt-Familien kommt. 2) Kontrolle und Kommunikation der Zielerreichung durch die laufende und abschließende Dokumentation und Berichte an Träger und Förderer. 3) Begleitende sozialwissenschaftliche Feldforschung durch die Methode der teilnehmenden Beobachtung, um das Projekt zu evaluieren und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse dem Träger und dem Subventionsgeber zugänglich zu machen. Projektphasen: Vorbereitungsphase: Von 30. August bis 3. Oktober wurde ein Konzept erstellt. Zwölf interessierte Familien wurden nach einer Probezeit als Projektfamilien aufgenommen und Förderungen beantragt. Durchführungsphase (das ist der Förderzeitraum): Die Durchführung des Projekts mit regelmäßigen wöchentlichen Besuchen in den ProjektFamilien dauerte von 4. Oktober 2004 bis 4. Februar 2005. In und unmittelbar nach diesem Zeitraum werden die anfallenden Daten aus der teilnehmenden Beobachtung erfasst. In einem Zwischenbericht und in weiteren Korrespondenzen wurden die Anliegen der Zielgruppe im Sinne eines Vermittlungskreislaufes40 dem Träger e. a. zur Kenntnis gebracht. 38 Nach dem Aufbau und der Erprobung einer mehrsprachigen Wanderbibliothek wurden im Schuljahr 2003/2004 mehrere Pilotprojekte für die Entwicklungen von Konzepten für die familiäre Leseund Sprachförderung durchgeführt: einmal türkisch/deutsche Märchenstunden in der öffentlichen Bibliothek Mötz, und zum anderen Mutter-Kind-Angebote und häusliche Lernhilfe für Kinder von sieben und später zwölf regulären Familien. 39 Bibliotheksleitbild des Büchereiverbandes Österreichs: „Öffentliche Bibliotheken entwickeln daher Sonderformen bibliothekarischer Versorgung – zum Beispiel Patientinnenbibliotheken, Seniorenbibliotheken, Gefängnisbibliotheken. Sie bringen die Bücher zu den Menschen und übernehmen dort die mediale Betreuung von körperlich gehandicapten Menschen oder gesellschaftlichen Randgruppen. Im Zusammenwirken mit Kooperationspartnern widmen sie sich Zielgruppen der sozial-integrativen Bibliotheksarbeit wie MigrantInnen, Arbeitslosen, Behinderten, Informations-Armen und Sekundäranalphabeten. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration von Zuwanderern und von ethnischen Minderheiten indem sie Bücher, Zeitschriften und audiovisuelle Medien in deren Sprache zur Verfügung stellen, und zwar in den Bibliotheken ihrer Wohngebiete.“ Quelle: www.bvoe.at 40 Thaler/Voggensberger, „Gutes besser tun – aber wie?“, 2004: Seite 71f: „Der Vermittlungskreislauf (z.B. Reporting, Berichte, Analysen, Interviews, Gespräche, systematischer Perspektivewechsel) ist dann von Nutzen, wenn es der NonprofitOrganisation gelingt, erfolgreich zwischen der Welt ihrer Kundinnen und Kunden und jener der Spendenden (oder auch der öffentlichen Hand als Auftraggeberin) zu übersetzen und zu 33 Nachbereitungsphase: Das Projekt wurde nach Abschluss der Arbeiten ab 15. Februar 2005 Evaluationsstudie wurde für die beteiligten Institutionen vervielfältigt. evaluiert. Die Methoden, Materialzugang Unter diesen Vorannahmen wurden mit der Methode der teilnehmenden Beobachtung in zwölf Projektfamilien in einer fünfmonatigen Feldforschung spezielle Angebote für diese zwei- bis viersprachige Schülergruppe erarbeitet und erprobt. Die Integrationsabteilung des Landes Tirol stellte für die Durchführung des Projektes Fördermittel in der Höhe von € 2000,zur Verfügung. Weitere Subventionsansuchen wurden an die Arbeiter- und Wirtschaftskammer gestellt aber abgelehnt. Das ist interessant, würde doch gerade bei diesen beiden Pflichtkörperschaften ein reges Interesse an der besseren Integration ihrer Klienten erwartet. Arbeitsplan Die zwölf Familien mit ca. 20 teilnehmenden Kindern sollten ein Semester lang ein bis zweimal wöchentlich von der mehrsprachigen Wanderbibliothek besucht werden und Leseund Lernanimation erhalten. Die dabei entstehenden Daten (entlehnte und vorgelesene Bücher, Besuchshäufigkeit und Dauer, Art der Lernhilfe, Auswirkungen auf den Schulerfolg) sollen durch teilnehmende Beobachtung und offene Befragungen erfasst und anschließend evaluiert werden. 12 Familien Familie 1 Familie 2 Familie 3 Familie 4 Familie 5 Familie 6 Familie 7 Familie 8 Familie 9 Familie 10 Familie 11 Familie 12 Summen Teiln. Ort Kinder Telfs Mötz Telfs Telfs Telfs Mieming Mötz Stams Telfs Telfs Telfs Mötz Personen Pers. im Kinder insg. insg. Haushalt 2 2 4 3 3 5 2 2 4 3 5 7 2 2 4 1 2 4 1 5 3 1 2 4 1 3 5 1 2 4 2 3 5 1 2 4 20 33 53 Tabelle 6: Teilnehmende Familien am Projektbeginn: 4 8 4 6 4 4 3 4 5 4 5 4 55 Die am Familien-Lernhilfe-Forschungsprojekt teilnehmenden 12 Familien haben insgesamt 33 Kinder, von denen aber nur 20 direkt teilnahmen. Mehrere ältere Geschwister sind bereits verheiratet und leben nicht mehr im elterlichen Haushalt, kommen aber oft mit ihren Familien zu Besuch. Ein älterer arbeitender Bruder wohnte noch im elterlichen Haushalt. Zwei ältere Brüder (Hauptschule und Handelsakademie) wollen nicht teilnehmen. Vier Kinder sind noch Kleinstkinder. Ein Kind ist noch nicht im Kindergarten, nimmt aber mit Bilder- und Vorlesebüchern bereits teil und kommt im Laufe des Projektzeitraumes in den Kindergarten. Im Laufe des Projektes kam eine Reihe von Personen – darunter die Kinder von zwei neuen Projekt-Familien - zu diesen Teilnehmern hinzu, sodass am Projektende 49 Teilnehmer (davon fünf Erwachsene) aus insgesamt 31 Familien gezählt wurden, die aktiv lernten, bzw Bücher ausliehen, bzw. einbezogen wurden. Eine der Projektmütter wurde ebenfalls als Teilnehmerin der Lernanimation aufgenommen, da sie verschiedene Medien auslieh und vermitteln. So lernen die Auftraggebenden die Bedürfnisse und Probleme ihrer Klientinnen und Klienten, die von einem Leistungsauftrag profitieren, kennen.“ 34 verwendete. Die vier weiteren Erwachsenen kamen im Rahmen der Paralleleprojekte Virtueller Sprachkurs und Bilinguale Leseanimation als Leser dazu. Ein Kind kam im Laufe des Projektes in den Kindergarten. Einige der kleinen Geschwister wurden auch „Leser“ von ersten Bilderbüchern bzw. waren im Rahmen der Lernhilfe öfters anwesend und wurde nach Möglichkeit mit einbezogen, wie auch Besuchskinder stets mit einbezogen wurden und an den Aktivitäten teilnehmen konnten. 3.2 Die Evaluation Die Arbeit verlief im eigentlichen Durchführungszeitraum ruhig und weitgehend ungehindert, was die Kinder betraf. In manchen Familien gab es in der Zeit Turbulenzen etwa durch vorübergehende Arbeitslosigkeit zweier Väter, einen Todesfall, eine durchgeführte und zwei geplante Übersiedlungen, eine Gerichtsverhandlung, einen Kuraufenthalt einer Mutter, einen Unfall eines Vaters und eine Verletzung eines Kindes. Zwei der zwölf ursprünglichen Projektmütter waren ständig berufstätig. Eine andere Mutter suchte Arbeit und absolvierte mehrere kurze Arbeitsverhältnisse. Drei Mütter traten in die Fahrschule ein und eine Mutter besuchte einen Deutschkurs. Für verschiedene Ausfälle sorgten der islamische Fastenmonat Ramadan, die Herbst- und Weihnachtsferien und die Wienreise der Projektleiterin anlässlich der Verleihung des Europasiegels für innovative Sprachenprojekte 2004 an das Trägerprojekt „Cin Ali Lernklub“. Kontakt zu Schulen bzw. Lehrern gab es nur dreimal, zweimal noch vor oder am Beginn der Durchführungsphase und einmal danach. Öfters wurde den Müttern jedoch geholfen, Entschuldigungen zu schreiben oder die Nachrichtenzettel der Lehrer zu verstehen. Ansonsten wurde versucht die Kinder und Eltern zu verstärkten Kommunikation mit der Schule und den Lehrer zu ermuntern, um selbst ihre Anliegen einzubringen. Die Beobachtungen bezüglich der Vorgänge in den dritten Leistungsgruppen waren sehr ernüchternd für die Projektleiterin. Die dritten Leistungsgruppen sind für die Kinder oft frustrierend. Das Leistungsvolumen im gesamten Projektszeitraum war wie in der folgen Tabelle aufgelistet. Monatsweise Abrechnung der Stunden und Kilometer - Gesamt Monat Stunden Km Entlehnt Kinder Erwach. Euro - h Euro - Km 9,72 August 2,00 27 23 5 2 30,00 125,64 September 46,00 349 111 73 21 690,00 135,72 Oktober 65,75 377 123 81 28 986,25 133,20 November 63,75 370 78 84 21 956,25 113,40 Dezember 50,88 315 96 67 18 763,20 123,48 Jänner 53,75 343 56 93 18 806,25 39,24 Februar 11,25 109 6 26 13 168,75 Summe 293,38 1890 493 429 121 4400,70 680,40 Besprechungen 5,86 87,90 Summe 299,24 4488,60 Gesamte Stunden und Kilometeranzahl Monat Stunden Km Entlehnt Kinder Erwach. Euro - h Euro - Km Vor/NachFörderzeit 53,86 376 134 78 23 807,90 135,36 Förderzeitraum 245,38 1514 359 351 98 3680,70 545,04 Summe 299,24 1890 493 429 121 4488,60 680,40 Die Förderung der Integrations-Abteilung des Landes Tirol umfasste die Monate Oktober, November, Dezember, Jänner und die ersten zwei Wochen des Februar. 35 Um den Wert der erbrachten Leistungen besser fassbar zu machen, wurden die Projektstunden (60 Minuten) mit einem Stundensatz von € 15,- und die gefahrenen Kilometer mit dem amtlichen Kilometersatz (Kurzsatz) von € 0,36 multipliziert. Die 235 Familienbesuche im Projektzeitraum fanden in den Wohnungen von 14 Familien statt. Dabei wurde eine Nachbarsfamilie nur einmal zu einer Besprechung besucht. Das jüngste Kind dieser Familie nahm jedoch öfters an den Förderungen teil. Die anderen Familien wurden mindestens vier bis höchstens 32-mal besucht, viermal war niemand da oder das Projektkind war nicht da. Darüber hinaus fanden 27 Besprechungen in den Familien oder telefonisch statt. 44-mal waren Kinder bzw. Kinder und Erwachsene einzelner Familien bei anderen Projektfamilien während der Projektdurchführung zu Besuch. Im Rahmen von sechs Besuchen in der öffentlichen Bibliothek Telfs nahmen auch die Kinder von vier Familien teil (insgesamt 12 Kinderbesuche in der Bibliothek) Nicht Familie Besuche KIBB Bespr. Auswärts da Fam 1 19 5 3 2 Fam 2 25 4 Fam 3 17 1 1 Fam 4 32 1 2 Fam 5 15 3 Fam 6 18 1 Fam 7 11 1 6 Fam 8 30 2 2 Fam 9 19 5 1 2 Fam 10 14 4 1 Fam 11 13 2 Fam 12 4 7 Fam 16 4 1 Fam 19 9 1 Fam 20 1 4 And 21 231 12 27 44 Tabelle links: 2 1 1 235-mal wurden Familien besucht. Vier mal davon war niemand oder nicht das Projektkind anwesend. Ein Besuch fand in einer Nachbarsfamilie statt, deren jüngstes Kind insgesamt viermal auch an den Lernaktivitäten in zwei anderen Familien teilnahm. Zwölfmal nahmen Kinder von vier Projektfamilien an den KIBBBibliotheksbesuchen* in Telfs teil. (* KIBB - Kinder BRAUCHEN Bücher – Konzept für Bibliothekpatenschaften) 4 Im Rahmen des Projektes wurden insgesamt 44 Kinder insgesamt 435 mal kontaktiert. 30 Kinder wurden mindestens dreimal in das Geschehen einbezogen. 21 Kinder nahmen mit mindestens neun Lerneinheiten wirklich regelmäßig am FamilienLernhilfe-Projekt teil. Bei den verschiedenen Projektaktivitäten (Familienbesuche, Bibliotheksbesuche und Besprechungen) waren insgesamt auch 129 Eltern-Kontakte zu verzeichnen. Dabei waren vor allem die drei Mütter der eben eingeschulten Kinder am aktivsten. Sie waren fast immer anwesend und verfolgten mehr oder weniger konzentriert das Lerngeschehen. Ebenso die Mütter der Kindergarten oder Vorkindergartenkinder, die noch keine Schulkinder hatten. Die Väter waren aufgrund der Berufstätigkeit meist nicht präsent, aber bekannt, und je nach Beschäftigungsart (Schichtbetrieb, Nachtdienst) doch auch öfters anwesend. Besprechungen erfolgten sowohl mit Müttern als auch mit Vätern. Ein Vater war siebenmal im Kontakt. Der zeitliche Aufwand vor allem bei den Familienbesuchen war vom Alter und Lernbedarf der Kinder abhängig. Je älter die Kinder und je höher die Schulstufe, desto mehr Zeit wurde investiert und je weniger waren die Eltern eingebunden. 36 Die insgesamt in den Familien zuhause oder in der Bibliothek verbrachten rund 293 Stunden verteilten sich auf die 22 Wochen recht unterschiedlich. Der Stundendurchschnitt betrug in den 16 eigentlichen Durchführungswochen 15, 25 Wochen-Stunden, in den sechs Vor und Nachbereitungs-Wochen etwas über acht Wochen-Stunden. Im Rahmen der Besuche durch die Projektleiterin fanden dann verschiedene Aktivitäten statt. In Familien mit Kindergartenkindern wurde mit den mitgebrachten Lern-Spielen (Puzzles und Memories, aber auch erste Rechenspiele) gespielt und mit Bilderbüchern gearbeitet. Erstklassler wurden bei den Lese- und Schreibaufgaben unterstützt und zusätzlich wurden Erstlesebücher und Spiele eingesetzt um das Lesen und Sprechen zu üben. In diesen Familien war ein Elternteil fast immer zugegen und beobachtete das Geschehen oder machte aktiv mit oder half beim Übersetzen – bei Spielen oder beim Lesen und Sprechen. Die größeren SchülerInnen hatten natürlich einen sehr unterschiedlichen Hausaufgaben- und Lernhilfebedarf, den sie im Laufe der Zeit immer besser und nachdrücklicher zu formulieren lernten. Darüber hinaus konnten die Kinder die verwendeten aber vor allem auch muttersprachliche Bücher, Spiele und auch MC’s und CDs oder auch CD-Rom’s ausleihen, fallweise sogar mit einem Abspielgerät. Einer Familie wurde eine gute Tischlampe samt Verlängerungskabel geliehen. Insgesamt entlehnten die Kinder so 479 Einheiten. Die im Projekt extra erfassten Erwachsenen (eine Mutter und die vier entlehnenden Teilnehmer der Parallelprojekte entlehnten zusätzlich 38-mal. Die folgende Tabelle zeigt, dass die deutschen Bücher natürlich überwogen, aber auch die türkische Gruppe stark nachgefragt wurde. Wobei es den Teilnehmern leider nicht möglich war, aus allen vorhandenen Büchern auszuwählen, weil immer nur ein kleiner Teil der Bücher mitgebracht werden konnte. Pro Familientyp ein kleines Sortiment. 2Entlehnungen Türkisch Deutsch Englisch Bosnisch Sprachig Spiele Geräte Gesamt Kinder 145 209 61 1 29 29 5 479 Erwachsene 18 16 0 0 3 0 0 38 Summe 163 225 61 1 32 29 5 517 Das leseeifrigste Kind entlehnte 51 Einzelmedien in drei einzelnen Sprachen sowie Zweisprachige. 32 Kinder entlehnten insgesamt, vier davon nur ein Büchlein es waren die kleinsten Teilnehmer, die so ihre ersten Erfahrungen mit dem Medium „Buch“ machten – mit Kleinkinderbüchern. 3.3 Die Ergebnisse Das Familien-Lernhilfe-Projekt wollte nicht primär einigen Kindern und Erwachsenen für einige Zeit nach einem fixen Konzept Lernhilfe erteilen, sondern sollte ermitteln, welche Unterstützung von den Betroffenen selbst als am wichtigsten erachtet wurde. Dabei wurden vor allem die Kinder als Experten in den Mittelpunkt gestellt. Sie selbst sollten herausfinden können, was ihnen am meisten beim Lernen hilft, nachdem sie aus verschiedenen Unterstützungsarten wählen konnten. Zu Beginn wurden vor allem verschiedene Angebote gemacht. Bunte Bilderbücher, Erstlesebücher in großer Schrift und vor allem auch in der Muttersprache, zweisprachige Bücher und 37 bei den Hauptschülern vor allem auch englische Bücher sowie CD’s und handelsübliche Zusatzmaterialien zu den im Unterricht verwendeten Büchern und zusätzliche Schulbücher und Literatur zu bestimmten Stoffgebieten der Lernfächer. Im Laufe der Zeit bildeten sich unterschiedliche Szenarien heraus, je nach Alter der einzelnen Kinder und nach Anzahl der Kinder. a) Vorkindergarten und Kindergartenbereich: Ein Kindergartenkind (es kannte die Projektleiterin bereits vom Sommersemester und aus seiner Vorkindergartenzeit) war soeben nach Telfs übersiedelt und in den Kindergarten eingetreten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schien es sich dort gut eingewöhnt zuhaben und genoss die wöchentliche Stunde um allein, ohne all die anderen Kinder mit einem Erwachsenen Puzzles und Memories zu spielen, zu zeichnen und Bilderbücher anzuschauen. Dabei wurde von der Projektleiterin viel gesprochen und auch das Kind machte sich mit seinem noch geringen Wortschatz und vielen Gesten und Bewegungen sehr gut verständlich. Notfalls konnte ein anwesender Elternteil vermitteln. Ansonsten beschränkten sich die Erwachsenen auf das Anwesendsein und die Beaufsichtigung des zweiten Kindes der Familie, des Babys. Mehrmals waren zwei Mütter mit je einem Vorkindergartenkind zu Besuch. Diese Kinder wollten natürlich mitmachen. Das Kind des Hauses reagierte unruhig und eine gezielte Sprachförderung war so nicht mehr möglich. Sehr bald kamen die Besuche deshalb am vereinbarten Wochentag nicht mehr. Die kleine Schwester wuchs indessen während der Durchführungszeit zu einem immer aktiveren Kleinkind heran, wurde mobil und sehr kontaktfreudig und wollte natürlich auch mitmachen, sofern es wach war. Es wurde wiederholt mit einbezogen. Die Eltern, das Baby, die Besucherkinder und ihre Mütter hatten so einen ersten Kontakt zu dieser Form des Sprachlernens mit Kindern zuhause. Außer in dieser Familie waren fünf weitere Kindergartenkinder im Projekt. Ein Nachbarskind und ein kleiner Bruder großer Projektkinder waren sporadisch in Kontakt und hörten vor allem beim Vorlesen zu und spielten fallweise mit. Drei kleinere Geschwister der frisch eingeschulten Taferlklassler nützten - während das Schulkind Aufgaben machte - die Gelegenheit, die prallen Taschen der Projektleiterin auf mitgebrachte Spiele, Farben und Zeichenblöcke zu durchforsten und sich selbst eine Beschäftigung zu suchen, bis am Ende der Lerneinheit ein gemeinsames Spiel gespielt wurde. Für diese Kinder wurden im Laufe des Projektzeitraums gezielt geeignete Beschäftigungsmaterialien angekauft, die sehr intensiv zum Einsatz kamen. b) Schulanfänger In den Familien der drei Schulanfänger war fast immer die Mutter da und half und lernte auch fleißig mit. Hier war eine intensive Hilfe nötig, da die Mütter erkannten, dass die Kinder alleine eigentlich nicht der Anforderung der fremdsprachlichen Alphabethisierung gewachsen waren. Eine Mutter drückte das so aus: „Die anderen Kinder habe es leicht. Sie müssen nur Lesen und Schreiben lernen. Mein Kind muss auch noch Deutsch lernen!“ In der Tat war eine der verwendeten Fibeln gerade am Beginn für NichtDeutschsprachige sehr schwierig zu verwenden. Die Hauptwörter wurden gänzlich ohne Artikel angeführt, die Zeitwörter wurden durch Striche oder Zeichnungen ersetzt und die Mütter, die selbst die Verbformen nicht hundertprozentig beherrschten tappten völlig im Dunkeln, wie die wöchentlichen Leseaufgaben wohl lauten könnten. 38 Hier wurde dann der Volltext geliefert und speziell mit einer Mutter auch durchgearbeitet, bis die Texte im Buch dann vollständig ausgeschrieben wurden. Ganz offensichtlich dachte keiner der Autoren oder der Lehrpersonen daran dass das dies gewissen Schülern und Eltern Probleme machen könnte, obwohl der Anteil an Kindern mit einer anderen Muttersprache als die Unterrichtsprache auch in Österreich ständig steigt. Gerade bei diesen Müttern musste auch beim Verständnis der verschiedenen Elternbriefe der Lehrpersonen geholfen werden oder mit dem Verfassen von Entschuldigungen. Sehr positiv fiel in diesen drei Familien die Einbindung der kleineren Geschwister auf (siehe Punkt a) ). Sie erhielten so schon viel früher eine häusliche Sprachförderung als ihre älteren Geschwister. Auch von der Möglichkeit, vor allem türkische Vorlese- und Bilderbücher ausleihen zu können machten diese Familien mit Abstand am meisten Gebrauch. Kinder und Mütter freuten sich regelmäßig auf die mitgebrachten Neuheiten. Es konnten auch schon erste Liebhabereien festgestellt werden – in beiden Sprachen. Müttern gefielen vor allem die zweisprachigen Kinderbücher mit vielen Bildern. c) Volksschüler Bei den größeren Volksschülern (2., 3. und 4. Klasse) wurde in der Regel hauptsächlich gelesen und je nach Bedarf bei den Deutsch- und MathematikHausaufgaben geholfen. Für sie wurden im Rahmen des Konzeptes KIBB (Kinder brauchen Bücher – Bibliothekspatenschaften) zusätzliche deutsche Kinderbücher und fallweise auch Lernspiele von drei örtlichen Bibliotheken von der Projektleiterin ausgeliehen und in den einzelnen Familien dann mit den Kindern gelesen und gespielt. In Telfs wurden die Kinder vermehrt auch von der Projektleiterin im Rahmen des Familienlernhilfeprojektes direkt zur öffentlichen Bibliothek begleitet, für sie die Bibliotheksgebühren im Rahmen der Bibliotheksmitgliedschaft des Projektes übernommen und auch Entlehn- und Überzugsgebühren bezahlt. Auf diese Weise lernten sie die Funktionswiese der öffentlichen Bibliotheken kennen. Die Zeit reichte nicht aus, um auch dabei die Eltern einzubinden. d) Hauptschüler/Polytechnische Schule Anders als im Vorjahresprojekt der Cin Ali Lernklub – Bibliothek, war nun auch Hauptschüler und eine Schülerin des Polytechnischen Lehrganges in Betreuung. Sie erwiesen sich als viel anspruchsvoller als die Kleinen. Zwei Mädchen der ersten Klasse wurden vor allem in Englisch sehr begleitet. Hier wurden Audio-CD’s und MC’s (wenn ein Computer vorhanden auch die CD-Roms) und die üblichen Zusatzübungsmaterialien (Smile, Übungsheft) bereitgestellt. Der Akzent lag dabei vor allem auf der Aussprache, dem Hörverständnis und dem regelmäßigen Vokabellernen- und –wiederholen. Die Kinder glaubten anfangs wirklich, dass man ein Vokabel nicht mehr zu wiederholen braucht, sobald der betreffende Vokabeltest positiv bestanden ist41. Die Schultexte wurden oft gemeinsam und mit verteilten Rollen gelesen und bei Hausaufgaben geholfen. Auch Mathematik und Deutsch sowie Testlernen waren gefragt (3. und 4. Klasse). Es wurden auch Sachbücher auf Deutsch und leseleichte englische Kinderbücher der öffentlichen Bibliothek Mieming verwendet. Deutschnachhilfe erschien den Kindern in der Regel nicht so wichtig. Die Diese Beobachtung deckt sich mit dem Zitat der Informantin aus Ankara (Seite 3: „Auswendiglernen und wieder vergessen.“) und lässt erkennen, dass das andere Lernumfeld der Türkei auf das Lernen der Kinder in Österreich noch sehr lange nachwirken kann, obwohl die Familie vielleicht längst eingebürgert ist. 41 39 türkische Sprache hatte gänzlich an Relevanz verloren. Es wurde klar, dass die Kinder diese Sprachkenntnisse in keiner Weise schulisch nutzen konnten, da das Sachwissen so angestiegen war, dass entsprechende Texte in der schriftlichen Muttersprache von ihnen nicht mehr verstanden wurden. Nur eine Schülerin der ersten Klasse las gerne türkische Leichtlesebücher oder zweisprachige Bücher. Die Eltern der Hauptschüler spürten, dass ihre Sprachkenntnis nun nicht mehr ausreichten um den Kindern behilflich zu sein. Dafür sorgten sie in der Regel mehr für ein störungsfreies Lernen als die Eltern der kleinen Projektkinder. Der Lernbereich war nun vom übrigen Familienbereich getrennt. Zur Zeit des Ramadan war das natürlich nicht immer machbar, wenn kein beheiztes Kinderzimmer vorhanden war. Erfolge Da schon während der gesamten Laufzeit ein ständiges positives Feedback der Kinder erfolgte, wurden auf eine abschließende Befragung aus Kapazitätsgründen verzichtet. Das regelmäßige Lernen und der Möglichkeit, Unverstandenes mindestens einmal pro Woche individuell erklärt zu bekommen, hatten zur Wirkung, dass Hausaufgaben öfter und besser gemacht wurden und der Lernstoff schon länger vor Tests wiederholt wurde. Zusätzliche Literatur aus den vier beteiligten Bibliotheken (Öffentliche Bibliotheken von Mötz, Mieming und Telfs, Cin Ali Lernklub – Bibliothek) in mehreren Sprachen sowie wiederholtes Lesen der Leseaufgaben in den beteiligten Sprachen in den Lernhilfeeinheiten aber auch in der Familie hatten eine klare Auswirkung. Einzelne der über 450 entlehnten Bücher blieben sogar über längere Zeiträume in der Schule und wurden auch von Lehrern benutzt. Die Kinder zeigten der Projektleiterin besonders am Anfang aufgeregt ihre (ungewohnten???) Erfolge: hier ein Plus für eine gute Aufgabe, dort ein Sehrgut oder Gut im Test oder in der Schularbeit. Nichtgenügend gab es selten, es kam aber auch vor wenn etwa ein Termin verschwitzt und der Test nicht ausreichend vorbereitet wurde. Der schmerzliche Zusammenhang wurde aber in der Regel unumwunden eingestanden und sofort an der Verbesserung gearbeitet. Im Fall der größeren Schüler gab es vereinzelt vertiefende Elternabschlussgespräche. Eine Mutter sagte dabei: „Früher hat es immer schlechte Noten gegeben, aber jetzt nicht mehr. Das Kind macht jetzt sogar immer die Aufgaben.“ 3.4 Die Schlussfolgerungen Der Ausspruch von Dr. Kurt Scholz, „Wer früher fördert, fördert besser.“, wird durch die Erfahrungen aus diesem Projekt verifiziert. Das Fazit ist daher: Je früher die häusliche Förderung und Lernhilfe - sowohl in der Muttersprache als auch in der Unterrichtssprache - erfolgen, desto mehr profitieren die Kinder vom schulischen und außerschulischen Bildungssystem und desto geringer ist der zeitliche Aufwand pro Woche und das vor allem in späteren Schuljahren. Auch die Zusammenarbeit mit den Müttern und Vätern erfolgt umso effizienter, je früher sie beginnt. Im Idealfall wäre das sofort nach der Geburt, oder besser noch während der Schwangerschaft. Die Einbindung der Mütter und Väter im Rahmen von zweisprachigen Eltern-Kind-Zentren, und das Angebot von frühen zweisprachigen Mutter-Kind-Angeboten zum Deutschlernen aber auch zum Kennenlernen von landesüblichen Frühförderspielen wären zur Kindergarten- und Schulvorbereitung sehr dienlich. Zweisprachige Elternvereine und Spielgruppen sowie außerschulische Freizeitangebote mit Elterneinbindung während der gesamten Pflichtschulzeit wären geeignet, die selbstbewusste Zweisprachigkeit der Einwandererfamilien aus der Türkei soweit zu entwickeln, dass auch die Beherrschung der 40 Muttersprache in Wort und Schrift erhalten bleibt und ein eventuelle spätere Rückkehr leichter möglich ist. Allerdings war im Rahmen des Projektes auch sehr klar zu erkennen, dass die junge Generation der Eltern (von Kindern bis zu 15 Jahren), von denen oft ein Ehepartner schon in Österreich aufgewachsen war, ein Ehepartner jedoch (fast) immer aus der Türkei „eingeheiratet“ wurde, in der Regel keine Rückkehrabsicht haben. In dieser Gruppe herrscht offensichtlich die Überzeugung vor, dass vor allem die Kinder gut und rasch Deutsch lernen sollten, damit sie hier eine gute Ausbildung und Arbeitsstelle finden. Die Eltern stellen ihre persönlichen Ambitionen daher zurück, was auch erklärt, warum gerade viele Frauen am Deutschlernen kein Interesse zu haben scheinen. Anstatt Interesselosigkeit ist das eher als eine andere Prioritätensetzung zu betrachten. Eine erschütternde Erkenntnis aus diesem Projekt ist jedoch die gravierende Unwissenheit der türkisch- gleich wie der deutschsprachigen Erwachsenen bezüglich des Sprachenlernens im Allgemeinen und die türkisch/deutsch/englische Dreisprachigkeit der Einwandererkinder aus der Türkei im Besonderen. Eine wesentliche Verbesserung der pädagogischen Ausbildung auf diesem Gebiet (Deutsch als Fremdsprache, Muttersprachlicher Unterricht) und zweisprachige Elternbildung erscheinen daher für die Zukunft unerlässlich, wenn sich die PISAErgebnisse dieser Schülergruppe nachhaltig verbessern sollten. Nur 3.5 eine verstärkte Leseförderung allein ist e i nde uti g zuwenig! Die Nebenergebnisse Das Familien-Lernhilfe-Projekt ist nicht losgelöst vom Gesamtprojekt, der Cin Ali Lernklub – Bibliothek zu betrachten. Während der Vorbereitung des Projektes sowie parallel zur Durchführung erfolgte der Weiterausbau der Bibliothek auf derzeit über 830 Medien, die Überreichung des Europasiegels für innovative Sprachenprojekte 2004 sowie die langfristige Planung der Errichtung eines auch räumlich zugänglichen Lernzentrums in der Marktgemeinde Telfs, das gleichzeitig dann auch der öffentliche Standort der Bibliothek werden soll. Im Zuge der Projektdurchführung wurde auch das Konzept KIBB - Bibliothekspatenschaften vertieft und es entstanden weitere flankierende Projekte, wie der „virtuelle Sprachkurs“ und die „bilinguale Leseanimation“, die im Folgenden kurz näher beschrieben werden sollen. 1. KIBB – Kinder brauchen Bücher – Die Bibliothekspatenschaft Das Konzept KIBB- Kinder BRAUCHEN Bücher – Bibliothekspatenschaften war schon im Pilotprojekt erprobt worden, insofern als zwischen dem Cin Ali Lernklub und drei Öffentlichen Bibliotheken eine Kooperation eingegangen wurde. Dabei wurden von der Projektleiterin von den Bibliotheken Mieming, Mötz und Telfs Bücher entlehnt, die dann entweder im Rahmen der Leseanimation in den Familien vorgelesen wurden oder auch an Kinder weiter verliehen wurden. Dabei übernahm der Cin Ali Lernklub die Gebühren für die Bücher und sorgte für die rechtzeitige Rückgabe. Diese Praxis wurde im Rahmen des Familien-Lernhilfe-Projektes ergänzt durch regelmäßige Bibliotheksbesuche mit einigen Projektkindern in Telfs. Dabei übernahm wieder die Projektleiterin die Gebühren, sofern sie nicht von den Bibliotheken erlassen wurden, bezahlte die Mahngebühren, die aufgrund verschiedener Tatsachen wiederholt anfielen, und sorgte ansonsten für eine rechtzeitige gemeinsame Rückgabe. 41 Um die Zusammenarbeit mit den Bibliotheken in die Wege zu leiten und aufrecht zu halten waren Interaktionen nötig: Dabei wurde offensichtlich, dass die Kommunikation mit den Bibliotheken umständlich war, weil das grundsätzliche Vorgehen zwar mit den Bibliotheksleiterinnen jeweils persönlich geklärt wurde, diese Informationen offensichtlich jedoch nicht an alle Bibliotheksmitarbeiterinnen weitergeleitet werden konnten. So waren bei allen drei Bibliotheken mehrere in diesem Sinne eigentlich „überflüssige“ Interaktionen nötig, was sich als sehr störend erwies. Besonders die ausgehandelte Gebührenbefreiung sowohl bei der Jahres- als auch bei der Einzelbuchgebühr oder etwa bei den Mahngebühren, die ja in diesem Falle nicht nötig gewesen wären, wurde nicht immer eingehalten. Die Projektleiterin entschloss sich schließlich anstelle des ständigen Einforderns der Gebührenbefreiung samt Projekterklärung zu der Praxis, die Gebühren jeweils zu bezahlen und in die Projektabrechnung mit einzubeziehen, um damit diese Kommunikationsprobleme sichtbar und messbar zu machen. 2. Der virtuelle Sprachkurs – Türkisch/Deutsch Angeregt durch bereits bestehende Internetkontakte und die Einladung in eine neue Yahoo-Gruppe entstand die Idee eines virtuellen Sprachklubs, indem türkischsprachige und deutschsprachige Partner voneinander via Internet lernen konnten. Die Grundidee dabei war, dass jeder Teilnehmer als Lehrer und Schüler gleichzeitig in einem virtuellen Klassenzimmer arbeiten konnte. Zu jedem Interessenten wurden in Form von Arbeitaufgaben zweisprachige Unterseiten auf der Bibliothekshomepage eingerichtet, die Informationen über den jeweiligen Teilnehmer enthielten. Beruf, Herkunftsort und Gründe für das Erlernen der jeweiligen Zielsprache wurden so sichtbar. Gleichzeitig wurde die Kommunikation in der neuen Sprache geübt und eine Vernetzung mit ähnlichen Seiten in Internet vorgenommen. Mit diesem Angebot sollten zwei Ziele erreicht werden. Einmal sollte das Angebot der Cin Ali Lernklub – Bibliothek um eine Onlineschiene für Erwachsene erweitert werden was dem modernen Bibliotheksleitbild entspricht. Andrerseits sollte mit der Kommunikation mit Personen, die das Sprachenpaar Deutsch/Türkisch in ihrem Sprachenportfolio haben mehr Informationen über die soziokulturellen Hintergründe der Zielgruppe des Familien-Lernhilfe-Projektes und der Sonderbibliothek ergeben. Wie die Interaktionsanalyse zu diesen Unterprojekt zeigt, fand sehr viel Kommunikation zwischen den sechs Teilnehmern statt. 59 Prozent der Interaktionen waren Email-Wechsel, aber auch andere Formen der Internetkommunikation, wie die Web-Publikationen, Forums- und Guestbook-Einträge und acht Chats. Die zwei Telefonate und zehn Postsendungen zeigten, dass dabei auch herkömmliche Kommunikationsmittel benutzt wurden. Die drei Besprechungen waren Gespräche mit den zwei Müttern des Lernhilfe-Projektes über den virtuellen Kurs, bzw. Übersetzungen und Korrekturen für die Projektleiterin, die ja nur sehr wenig Türkisch kann. Die Informationen, die auf diese Weise vor allen durch den Emailverkehr und durch die Chats gewonnen werden konnten, waren überaus wertvoll, da einige Hintergründe so erhellt werden konnten, die seitens der Projekt-Familien wegen der Sprachbarriere nicht ausgedrückt werden konnten, z.B die Schulsituation in der Türkei, die Lernkultur, die Möglichkeiten Deutsch zu lernen. 3. Die bilinguale Leseanimation 42 Im Rahmen der Familien-Lernhilfe wurde in den Familien mit Kindergartenkindern und Schulanfängern immer deutlicher sichtbar, dass bestimmte Spiele in den türkischsprachigen Familien nicht allgemein gebräuchlich sind. Puzzles, Memories, Lese-, Mathematik- und Würfelspiele, die die Projektleiterin anfangs zur Beruhigung der kleineren Geschwister der Schulanfänger mitbrachte zogen sofort auch die Aufmerksamkeit der Schulkinder und der Mütter auf sich. Die anfangs spürbare Skepsis der Mütter, ob denn Kinder auf diese Weise Deutsch lernen könnten, wich bald interessierter Neugier und die Frage wurde mehrmals geäußert: „Ich möchte für meine Kinder auch solche Spiele kaufen. Wo bekommt man sie? Ich habe sie nie im Geschäft gesehen!“ Diese Beobachtungen sowie die eifrigen Diskussionen mit den Teilnehmern des virtuellen Sprachkurses und die Verleihung der durch Preise42 und durch Spenden neu angekauften türkischen und zweisprachigen Kinderbücher führten in summa zum Konzept der bi l ingua l e n Le se a nima ti on . Dabei sollen zu beliebten Kinderbüchern Übersetzungen und Rätselhefte, sowie Sprach-Puzzles und Memories produziert werden, die von den Familien entlehnt werden können. Diese liefern der Familie zahlreiche Lese-, Sprech- und Schreibmöglichkeiten und fördern so das komparative Herangehen an das Sprachenlernen und –üben. Durch die Aktivierung vieler verschiedener Lernkanäle und die Eingebundenheit in den familiären Kontext kann ein spielerisch-leichtes Sprachenlernen auch bei den Erwachsenen erzielt werden, die ja besonders die kleineren Kinder noch zum Vorlesen und Anspielen brauchen. Schon die Erfahrungen mit den extra angekauften handelsüblichen Puzzles und Memories sowie mit den zweisprachigen Büchern ließen das Konzept sehr Erfolg verheißend erscheinen. So nahm die Projektleiterin mit einer der Autorinnen und Verlagsleiterinnen in Istanbul, Aytül Akal, Kontakt auf um die Genehmigung für die ersten Versuch und einige Freiexemplare zu bitten. Beides wurde sofort gewährt und der Sohn wurde gegen geringes Entgelt beauftragt, erste Flash-Sprach-Memories und ein Puzzle zu gestalten. Die viersprachigen Onlinespiele und je zwei zweisprachige E-Books wurden dann auf die Homepage der Bibliothek veröffentlicht, neben einem Lebenslauf der Autorin und verschiedenen Informationen zum Bibliothekswesen und Deutschlernen in der Türkei. Die Produktion von realen Prototypen wurde für das Sommersemester 2005 ins Auge gefasst. An der Analyse der Entwicklung dieses Konzeptes kann schön nachgewiesen werden, dass durch die ständige Interaktion und den persönlichen Kontakt mit Betroffenen sowie die teilnehmende Beobachtung und die laufende Evaluierung sehr brauchbare Konzepte entstehen können. Die Interaktionsanalyse außerhalb der Familien-Lernhilfe im Zweitraum von 29. Oktober 2004 und 14. Februar 2005 zeigt folgendes: Auch hier war das Internet dominierend. Der Kontakt zur Autorin Aytül Akal und zu Gleichgesinnten – vorwiegend Müttern von zweisprachigen Kindern - in Internetforen sowie ein Link im Guestbook zur Innsbrucker Partnerorganisation Phönix in Tirol , wo derzeit 240 türkische, deutsche und zweisprachige Bücher der Sonderbibliothek stehen, sorgten für eine rege Diskussion des Konzeptes außerhalb des Lernhilfeprojektes. 17 der 36 Emails gingen an die Autorin, die sich sehr über die vorerst noch sehr fehlerhafte Online-Schiene freute. Das Pilotprojekt „Cin Ali Lernklub“ erhielt zwei Preise: den Kinderrechtepreis 2004 und das Europasiegel für innovative Sprachenprojekte 2004“, insgesamt € 1000,- . 42 43 Diese drei Konzepte, KIBB – Bibliothekspatenschaften, der virtuelle Sprachkurs und die bilinguale Leseanimation hätten sich nicht losgelöst voneinander und vom Familien-Lernhilfe-Projekt entwickeln können. 5) Schlusswort Drei spannende Projektjahre ehrenamtlich mit einer von der Bildungspolitik extrem vernachlässigten und doch zugleich in den Wahlkämpfen der letzten Monate im Zentrum des öffentlichen politischen Diskurses stehenden Zielgruppe der Erwachsenenbildung gearbeitet zu haben, erweitert nicht nur den persönlichen Horizont. Nein, es hat auch Tradition in Österreich, sich mit Haut und Haaren als ehrenamtliche Bibliothekarin sprich als klassische Erwachsenenbildnerin in ein bildungspolitisch ziemlich brachliegendes „Feld“ vorzuwagen und dort einen der Leitsätze des Bibliothekswesens, hier eben den der sozialintegrativen Bibliotheksarbeit, zielgruppengerecht umzusetzen. Die Projektarbeiten der Bibliothekarslehrgänge beschreiben wohl viele ähnliche Vorhaben. Mit der gegenständlichen Forschungsarbeit sind die Vorarbeiten zu einer weiteren solchen Projektarbeit abgeschlossen, die die Projektleiterin Ende August im zweiten Teil ihrer Bibliothekarsausbildung im Erwachsenenbildungsinstitut Strobl konzipieren wird. Hoffentlich wird diese Projektarbeit trotz der widrigen persönlichen Umstände im ersten Halbjahr 2007 auch umgesetzt werden können, sodass ein weiterer Mosaikstein in der bunten österreichischen Bibliotheks-Projekt-Landschaft eingefügt werden kann. 44 6) Literatur: Bourdieu, Pierre: „Das politische Feld : zur Kritik der politischen Vernunft“, Aus dem Franz. von Roswitha Schmid. - Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2001, (Édition discours ; 29) Bourdieu, Pierre: „Wie die Kultur zum Bauern kommt : über Bildung, Schule und Politik“, Hrsg. von Margareta Steinrücke. - Hamburg : VSA-Verl., 2001. (Schriften zu Politik & Kultur / Pierre Bourdieu ; 4) Bourdieu, Pierre:, „Kulturelles Kapital, soziales Kapital und politisches Kapital“, 1983, In Kreckel, Reinhard [Hrsg.] : Soziale Ungleichheiten / hrsg. von Reinhard Kreckel. - Göttingen : Schwartz, 1983, (Soziale Welt : Sonderband ; 2) Braun, Karl-Heinz / Dobesberger, Bernd / Rammer, Gernot / Weber, Konstanze (Hrsg.): „Lernort Kinderfreunde – Modernisierungsprozesse in einem Kinder- und Jugendverband“, Obladen, 1998 Çınar, Dilek (Hg.): „Gleichwertige Sprachen? Muttersprachlicher Unterricht für die Kinder von Einwanderern“, Innsbruck-Wien, 1998 De Cillia, Rudolf: „Spracherwerb in der Migration“, Informationsblätter des Referats für Interkulturelles Lernen Nr. 3, Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, Wien 1998 Fleck, Elfriede: „Der muttersprachliche Unterricht“, in : „Erziehung und Unterricht – die österreichische pädagogische Zeitschrift“, November/Dezember 9-10/02, Seiten 1110 – 1124, Galtung, Johan: „Strukturelle Gewalt - Beiträge zur Friedens und Konfliktforschung“, Reinbek bei Hamburg, 1975 (Ausgabe 1982) Graf, Martin / Lambrecht, Markus: „Der Beitrag des Bildungssystems zur Konstruktion von sozialer Ungleichheit“, In: Bornschier, Volker, Hrsg.: Das Ende der sozialen Schichtung, Zürich 1991 Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.): „Sprachenvielfalt – Babylonische Sprachverwirrung oder Mehrsprachigkeit als Chance?“, Innsbruck-Wien-München-Bozen, 2003 Krumm, Volker: „Schulleistung – auch eine Leistung der Eltern“, in: Specht, Werner / Thonhauser, Josef (Hrsg.)“Schulqualität – Entwicklungen Befunde Perspektiven“, Innsbruck, 1996, S. 256-290Lambrecht, Markus: Schulische Chancengleichheit. In: BORNSCHIER, Volker, Hrsg.: Das Ende der sozialen Schichtung, Zürich 1991 Schmölzer-Eibinger, Sabine: „Lernen in der Zweitsprache. Ein Forschungsprojekt zur Entwicklung von Textkompetenz im Unterricht in mehrsprachigen Klassen“, in: Portmann-Tselikas, P. R. / Krumm, H.-J. (Hrsg.): „Theorie und Praxis Jahrbuch 2003 - Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache“, Innsbruck 2003, S. 219-228 Thaler, Gregor Oliver/Voggensperger, Ruth C.: “Gutes besser tun – aber wie?” in: Voggensperger, Ruth C./ Bienek, Hubert J./ Schneider, Jürg / Thaler, Gregor Oliver (Hrsg.): Gutes besser tun – Corporate Governance in Nonprofit-Organisationen, Bern, 2004, S. 61 - 96 Informationsblätter: Informationsblätter des Referats für interkulturelles Lernen Nr.1/2003: Gesetzliche Grundlagen schulischer Maßnahmen für SchülerInnen mit einer anderen Erstsprache als Deutsch – Gesetze und Verordnungen, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Wien, 2003 Informationsblätter des Referats für interkulturelles Lernen Nr.2/2004: „Schülerinnen mit einer anderen Erstsprache als Deutsch Statistische Übersicht Schuljahre 1996/97 bis 2002/03, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Wien, 2004 Informationsblätter des Referats für Interkulturelles Lernen Nr. 3: „Spracherwerb in der Migration“, Rudolf de Cillia, Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, Wien 1998 Informationsblätter des Referats für Interkulturelles Lernen Nr. 4/2003: Auszug aus der Schulbuchliste für das Schuljahr 2003/04 – Deutsch als Zweitsprache – Muttersprachlicher Unterricht – Zweisprachige Wörterbücher für den muttersprachlichen Unterricht. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Wien 2003 45 Anhang A: Humankapital-Theorie von Pierre Bourdieu43 Während die Humankapital-Schule der Ökonomen nur das in Geld bezifferbare oder direkt in Geld konvertierbare Humankapital (Erziehungsinvestitionen, Studienkosten, das finanzielle Äquivalent für die zum Studium verwendete Zeit) in Rechnung stellen, berücksichtigt der Ansatz von Bourdieu darüber hinaus auch die „am besten verborgene und sozial wirksamste Erziehungsinvestition, nämlich die Transmission kulturellen Kapitals in der Familie“44. Dabei unterscheidet Bourdieu neben dem kulturellen Kapital noch zwei andere Humankapitalformen, das soziale und das politische Kapital. Sie stehen zum ökonomischen Humankapital in einem doppelten Gegensatz. Einerseits, weil sie nicht so einfach und sichtbar von einer Generation zur anderen vererbbar sind, wie das ökonomische Kapital. Andrerseits, weil sie nicht ausschließlich und unmittelbar monetär zu bemessen sind, wenngleich das ökonomische Kapital eine Bedingung für ihre Akkumulierung ist. Die Generierung der drei personengebundenen Humankapitalformen sieht Bourdieu nämlich mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden, der erst durch ökonomisches Kapital ermöglicht wird, also durch die zeitliche Arbeits-Freistellung der akkumulierenden Individuen. Der Erwerb von Bildung sowie die Pflege von sozialen oder politischen Beziehungen benötigen nämlich vor allem den Einsatz von viel Zeit und Mühe, die es kostet, diese Kapitalformen zu akkumulieren. In einer späteren Lebensphase können diese Kapitalformen darüber hinaus wieder in ökonomisches Kapital umgewandet werden, wobei der „Wechselkurs“ schwanken kann und die Gefahr der Entwertung besteht. Wie die Tabelle zeigt, eignen sich die einzelnen Kapitalformen zur sozialen Institutionalisierung. Die Kapitalform… ….eignet sich besonders zur Institutionalisierung in Form von Ökonomisches Kapital Eigentumsrechten Kulturelles Kapital schulischen Titeln und damit verknüpften Berechtigungen und Berufspositionen Soziales Kapital Adelstiteln oder privilegierten Positionen in der sozialen Hierarchie Politisches Kapital politischen Funktionen und Posten Tabelle 5: Kapitalformen und ihre Institutionalisierung nach Bourdieu Das kulturelle Kapital, die Bildung eines Menschen, sieht Bourdieu als das Ergebnis eines (lebens)lang andauernden Prozesses der Akkumulation45, und er unterscheidet es in Inkorporiertes kulturelles Kapital: Wissen, Fähigkeiten, Kenntnisse und kultureller Lebensstil, die in einem länger andauernden Prozess von einer Person inkorporiert werden. Diese werden zum körpergebundenen Kapital, das mit der Person die es verinnerlichte, untergeht. Wobei die Übertragung dieses Kapitals im Gegensatz zur Übertragung von (objektiviertem kulturellem) Kapital in der Familie „immer im Verborgenen geschieht und häufig ganz unsichtbar bleibt“. Objektiviertes kulturelles Kapital: materiell übertragbares kulturelles Kapital in Form von juristischem Eigentum (z.B. Schriften, Gemälde, Instrumente, usw.), das allerdings vom Eigentümer nach der materiellen Aneignung auch selbst oder durch Delegation symbolisch angeeignet werden muss, wenn es genutzt werden sollte. Institutionalisiertes kulturelles Kapital: das ist in Form von gesellschaftlich anerkannten Titeln objektiviertes inkorporiertes kulturelles Kapital. Durch das Ablegen von standardisierten Prüfungen nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip wird das einfache Kulturkapital zur institutionell anerkannten und garantierten Kompetenz mit ökonomischem Wechselkurs und Markwert. Als soziales Kapital bezeichnet Bourdieu die „Beziehungen“ eines Menschen, sein Beziehungsnetz, seine Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen. Auch dieses Kapital ist Produkt eines fortlaufenden Akkumulationsprozesses: der Beziehungs- oder Institutionalisierungsarbeit. Es Bestandteil der Diplomarbeit der Projektinitiatorin, Monika Himsl: „Österreichische Bildungspolitiken – von Maria Theresia bis Elisabeth Gehrer – und wieder zurück?“, Leopold Franzens Universität Innsbruck, voraussichtlich 2004, Betreuerin: Univ.-Prof. Dr. Erika Thurner. 44 Bourdieu, 2001; S 112 45 Bourdieu, 2001; S. 113ff 43 46 ist ein ständiges, wechselseitiges Verausgaben von Zeit und Geld in mehr oder weniger delegierter Form, eine zeitliche und ständige Abfolge von Austauschakten, deren Äquivalenz-Maß die Arbeitszeit im weitesten Sinne ist. Die lange Dauer drängt den ökonomischen Aspekt der Beziehungsarbeit in den Hintergrund: sie erscheint so als kostenlose Verausgabung von Zeit, Aufmerksamkeit, Sorge und Mühe. Das politische Kapital stellt eine Spezialform des sozialen Kapitals dar, und ist unterscheidbar in Persönliches politisches Kapital: es ist an die Person gebunden und Ergebnis einer langsamen und stetigen Akkumulation oder ein „charismatisches Produkt“ einer Handlung in einer Krisensituation. Delegiertes politisches Kapital: es geht von „einer Organisation und der Gesamtheit der Handlungen ihres politischen Personals“ aus, und ist in Form von Posten institutionalisiert. Beide Arten des politischen Kapitals werden miteinander kombiniert, sodass das politische Kapital einer Person einerseits vom politischen Gewicht ihrer Partei im politischen Feld 46 und andererseits von ihrem eigenen Gewicht innerhalb ihrer Partei abhängt. Die Akkumulation des politischen Kapitals erfolgt nach einer eigenen Logik sowohl (gegenüber den Mitpolitikern) innerhalb als auch (gegenüber den Laien) außerhalb des politischen Feldes. Jeder Akteur der (Bildungs-)Politik und des Bildungswesens (und auch Einwanderer und ihre Kinder zählen dazu) verfügt über Teile dieser vier Humankapitalformen (kulturelles, soziales, ökonomisches und politisches Kapital), und zwar in einem bestimmten, individuellen Mischungsverhältnis, wobei jede dieser vier Kapitalformen wiederum in vierfacher Ausformung zu beobachten ist: als persönlich gebundenes Kapital, als objektiviertes in Form von materiellen Objekten, als institutionalisiertes bzw. delegiertes in Form von Titeln und Berufs- oder Funktions-Bezeichnungen, aber auch als symbolisches Kapital, das nur in einem mystischen oder magischen Akt der Anerkennung oder des Kredits (Glaubens) besteht. Diese vier Kapitalarten sind in der Realität oft miteinander verbunden bzw. scheinbar verschmolzen und können ineinander transformiert werden. Einwandererkinder in Österreich haben in diesem Kapitalformenschema eine eher schwache Position, zumal die Ausprägung der einzelnen Kapitalformen je nach Gesellschaft unterschiedlich konstruiert ist und somit auch von der jeweiligen Normierung und Anerkennung abhängt. Ökonomisches K. persönlich gebundenes Soziales Kapital Beziehungen Kulturelles K. Bildung Politisches K Berufliches oder persönliches Einkommen Familie, Schicht, Persönliche Netze Fähigkeiten Kenntnisse Sprachen politische Beziehungen und Erfahrung, Charisma Besitz, Firmen, Beteiligungen, Aktien Materielle Zuwendungen aufgrund von Beziehung Musikinstrumente, Bücher, Bilder, Computer/ Software Objektivierter Parteibesitz und Posten institutionalisiertes bzw. delegiertes Wirtschaftsverbände, Lobbys Institutionalisierte Gruppenzugehörigkeit (Vereine) Schulische Abschlüsse, Titel Gewählte ehrenamtliche Funktionen, Mandate symbolisches „Anerkennung“ „Kredit“ Status-Symbole des Ökonomischen Kapitals, Habitus, Lifestyle Gesellschaftliche Anerkennung durch Gruppenzugehörigkeit Ehrentitel oder gesellschaftliche Anerkennung Symbolisches politisches Kapital durch Anerkennung objektiviertes Tabelle 6 : Kategorienschema Humankapital-Theorie von Pierre Bourdieu nach Himsl 46 vgl. Bourdieu, Pierre,2001: « Das Politische Feld. » Das Feldkonzept von Bourdieu ist stark an das der Physik angelehnt. Sein Feldbegriff definiert ein dem physikalischen analoges, geschlossenes soziales „Kräftefeld“ und zugleich „ein Kampffeld, in dem um die Bewahrung der Struktur der Kräfteverhältnisse gekämpft wird“. 47 Anhang B: Vorgängerprojekte 4.2) Verschiedene Nachhilfeprojekte (1980-1997) Erste Nachhilfe-Erfahrungen machte die deutschsprachige Initiatorin 1980 mit ihren Neffen. Im Zuge ihres Studiums der Politikwissenschaft und Ethnologie in Wien begann sie mit Solidaritätsarbeit im Rahmen der Gesellschaft für Bedrohte Völker (Arbeitsgruppe Kurdistan, Vorstand). Dabei wurde sie 1985 von einem Türkischlehrer kontaktiert um zwei Seiteneinsteigern Nachhilfe zu geben. Das war der Beginn einer mehrjährigen freiwilligen Betätigung auf diesem Gebiet (Wien 1985-1987: zwei Geschwister, Seiteneinsteiger, 109 Nachhilfenachmittage; Mieming 1989-1990: zwei Geschwister, in Österreich eingeschult, 47 Nachhilfenachmittage; Mieming 1996-1997: ein Kind, Seiteneinsteigerin, 60 Nachhilfenachmittage). Dabei lernte sie die Probleme des Spracherwerbs dieser Kinder kennen. Soweit die Kinder Türkisch lesen konnten (Seiteneinsteiger) vermittelte sie fallweise auch türkische Kinderliteratur und ließ ein Kind verschiedene Bildgeschichten auch auf Türkisch schreiben, bzw. ein anderes Kind Geschichten aus dem Türkischen ins Deutsch übertragen. 4.3) My First Library – Klassenbibliothek und Klassenzeitung (1998/99) Für die Mitschüler ihres Sohnes führte die Freie Journalistin in der 4. Klasse Volksschule das Projekt My First Library samt Klassenbibliothek und Klassenzeitung durch. Ausgehend von 12 englischen und 21 deutschen Kinderbüchern zu Schulbeginn wurde mit den Büchern der Kinder eine Klassenbibliothek aufgebaut. Begleitend dazu wurde gemeinsam mit den Kindern eine Klassenzeitung in fünf Ausgaben gestaltet. Für die fleißigsten Mitarbeiter gab es einen Kinonachmittag, gesponsert vom Innsbrucker Metropolkino und privaten Spendern. Das Einjahresprojekt war für alle Beteiligten eine interessante Erfahrung. Die Initiatorin sammelte dabei erste Erfahrungen mit dem Sponsoring und Projektmanagement. 4.4) Willy Black Library und Moki Duck – Kinderpressedienst (1998 – 2000) Noch während des Klassenprojektes entstanden zwei weitere Projekte: der Moki Duck – Kinderpressedienst und die Willy Black Library. Unter dem Kürzel Moki schrieb die Initiatorin in ihrer Funktion als Lokaljournalistin kinderspezifische Beiträge in den Zeitungen ihrer Verlags-Partner und finanzierte mit den Honoraren daraus mit der Hilfe weiterer Sponsoren den Aufbau der Willy Black Library. Diese Wanderbibliothek mit englischsprachigen Kinderbüchern aus Großbritannien, Australien und den USA baute auf den 12 ursprünglichen englischen Titeln der Klassenbibliothek auf. Sie hatte zum Ziel, das Konzept des Englischlernens mithilfe von englischsprachigen Kinderbüchern auch anderen Schulen der Umgebung zugänglich zumachen. In der Bibliothek waren auch bereits erste 26 türkische Titel integriert, mit denen 2000 ein erstes Ferienprojekt in Mötz durchgeführt wurde. Während die Wanderbibliothek nach über zwei Jahren auf verschiedene Bibliotheken und Volksschulen aufgeteilt und somit aufgelöst wurde, existierte der Moki Duck Kinderpressedienst auch nach Beendigung der Tätigkeit als Lokaljournalistin und der Wiederaufnahme des Studiums fort, indem damit gelegentlich Presseaussendungen zu aktuellen Themen oder zum Projekt Cin Ali Lernklub an die Presse geleitet wurden. Nach Studienabschluss ist eine Intensivierung dieser Pressearbeit geplant, vor allem um dem Thema Kinderrechte mehr Publizität zu verleihen. 4.5) KIBB – Kinder brauchen Bücher Aus den schon genannten Projekten entwickelte sich das Konzept Kinder brauchen Bücher, das für Kinder mit besonders erschwertem Zugang zur Welt der Bücher freiwillige „Bibliothekspaten“ vorsieht, die sich zur Aufgabe machen, längerfristig gemeinsam mit den begünstigten Kindern die örtliche Bibliothek zu besuchen, dort mit den Kindern Bücher anzuschauen, anzulesen und auszuleihen. Die Bibliothekspaten tragen die Bibliotheksgebühren, die noch immer einen gewissen Teil der Kinder von den Bibliotheken fernhalten, und sorgen für die rechtzeitige Rückgabe der Bücher. Dieses Projekt wurde erst für einen relativ kurzen Zeitraum im privaten Rahmen erprobt, zeigte aber schöne Erfolge. 48 Anhang C: Das ursprüngliche Konzept eines Folgeprojektes Cin Ali Lernklub – Telfs Mutter-Kind-Zentrum mit Bibliothek und Beratungsmöglichkeit Beim Abschluss des Cin Ali Lernklub – Pilotprojektes wünschten sich die vier Telfer Familien, sowie eine Mieminger Familie, die in der Evaluationsphase nach Telfs übersiedelte, dass das Angebot der häuslichen Mutter-Kind-Kurse und Lernhilfe im Herbst fortgesetzt würde. Zwei weitere Familien hatten darüber hinaus bereits ihr Interesse bekundet. In Anbetracht der großen Nachfrage (sieben Familien mit bis zu 17 Kindern) sind die Grenzen der häuslichen Betreuung für eine Person erreicht. Da eine der Telfer Familien in eine größere Wohnung übersiedeln wollte, bestand die Aussicht auf günstige Räume, da das Haus im Besitz der untereinander verwandten Familien ist. Die Eröffnung eines Projekt-Standortes in Telfs lag also nahe. Vorteile: Mit einem Standort in Telfs würde es möglich, die Projekt-Bibliothek als Öffentliche Bibliothek zu führen und somit die üblichen Bibliotheksvorteile zu lukrieren (Büchereirabatt im Buchhandel, Bibliotheks-Software, -Ausbildung und -Förderungen). Durch die räumliche Nähe des Objektes zu den Schulen aber auch zum Einkaufs- und dem Ortszentrum wäre eine gute Besucherfrequenz garantiert. Vormittags könnten in den Räumen Angebote für junge Mütter und ihre Kleinkinder, nachmittags Angebote für Kindergarten- und Schulkinder geschaffen werden. Bücher, Spiel- und Bastelwaren, Computer- und Internetzugang könnten besonders für die Schulkinder leichter zugänglich gemacht werden. Die Küche könnte als Frauencafé und als Mittags-Essraum für Schulkinder mit Nachmittagsunterricht und weit entfernter Wohnung eingerichtet werden, und ein kleiner Extraraum könnte stundenweise an Beratungseinrichtungen vermietet werden, die den Familien bzgl. Erziehung, Förderbedarf und Schullaufbahn Beratung, psychologische und juristische Hilfestellung gewähren könnten. Projekt-Zeitraum: September 2004 bis Juli 2005 Ziel: Einrichtung eines Cin Ali Lernklub –Zentrums Telfs Vorbereitung: Bis Oktober 2004 Abklärung mit der Kinderfreunde-Landesorganisation bzgl. weiterer Trägerschaft und organisatorischer Unterstützung, Kinderfreunde-Stützpunktgründung bzw. Ortsgruppengründung Konzepterstellung und Projektdefinition, Anmeldung beim Österreichischen Büchereiverband und zur Bibliothekarsausbildung Finanzierungsplan und Förderansuchen Durchführung: Oktober bis zur Eröffnung des Zentrums im März 2005: Durchführung der üblichen Projekttätigkeiten (häusliche Mutter-Kind-Kurse und Lernhilfe) bei den sieben Telfer Familien. Sondierungsgespräche bezüglich der Wohnung oder Alternativen, Vertragsverhandlungen Planung der Einrichtung des Zentrums einschließlich der Bibliothek. Planung erster Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Familien, einschließlich Bedarfserhebung. Einrichtung mit dem Freiwerden der Wohnung im März Eröffnung und erste Leseförderaktionen in der Bibliothek Ende März. Umsetzen des Programms für das erste Semester Abschlussfest Anfang Juli Sommerprogramm im Juli Nachbereitung: Projektabschluss und Evaluierung im Juli 2005 49 Anhang D: Das aktuelle Konzept des Folgeprojektes MENSANA – Lern- und Kompetenzzentrum Innsbruck - (Höttinger Au 82/84, 6020 Innsbruck) (Auszug aus dem Geschäfts-Plan, zur Vorlage für die Initiative Frauen Gründen der Universität Innsbruck, der Wirtschaftskammer Tirol und des Europäischen Sozial Fonds) MENSANA ist als Bildungseinrichtung mit eingeschlossener Bibliotheks-, Buchhandels- und Verlagsschiene vorerst als Einzelunternehmen konzipiert. MENSANA entwickelt, testet, produziert und vermarktet Dienstleistungen und Produkte auf dem Gebiet der bilingualen Lese- und Sprachanimation mittels schulischer Lernassistenz, Früh- und Begabungsförderung, Kompetenzstärkung und Beschäftigung für Kinder und Frauen aus vorwiegend türkischen Einwandererfamilien im Raum Innsbruck. Als sozialpädagogischer und sozialökonomischer Betrieb will MENSANA auch geförderte EU-Projekte initiieren. Durch laufende Evaluierung und Dokumentation sollen die durchgeführten Maßnahmen und Projekte publiziert werden und somit auch Forschungs-, Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Lobbying zu den Themen Integrations-, Sprach-, Sozial- und Bildungspolitik geleistet werden. Dabei wird gemeinsam mit internationalen Wirtschafts-Partnern (Verlagswesen, Buchhandel, Tourismus) der Kultur- und Wirtschaftsaustausch zwischen den Herkunftsländern (vor allem der Türkei) und Österreich forciert. Mit den Angeboten des Lern- und Kompetenz-Zentrums MENSANA soll mehr Bewusstsein für die Zweisprachigkeit der Einwanderer aus der Türkei erreicht werden. Als Anreiz für die Zielgruppe, sich auf ein Konzept der ausgewogenen Bilingualität einzulassen, soll die Qualifizierungs-Schiene dienen. Dabei können Frauen durch eine geringfügige Bezahlung selbst an der Produktion und später der Entwicklung der Arbeitmaterialien, im Buchhandel und Bibliothekswesen mitarbeiten und gleichzeitig Deutsch lernen und ideale Lese- und Sprachförder-Materialien für ihre eigene und bekannte Familien kennen lernen und ausleihen. Der Produkt- und Dienstleistungsmix von MENSANA hilft dabei also dreifach Indem es zweisprachige Leseanimation und spezielle Büchersortiments sowie Lernspiele und Lehrmittel auf bibliothekarischer Fernleihebasis in die Familien, aber auch in verschiedenste Bildungseinrichtungen bringt. Indem es ein stark familien- und frauenzentriertes flexibles, kostengünstiges und niederschwelliges Informations- und Bildungsangebot für eine stark wachsende Gruppe von Bildungsnachfragenden ist. Indem es vor allem Frauen und Mädchen aktiviert und motiviert, selbst mitzuarbeiten und so auch Qualifizierung und Beschäftigung ermöglicht. MENSANA spezialisiert sich im Rahmen der Trainings-, Bibliotheks- und Buchhandelsarbeit im Lernzentrum auf den Import und Export geeigneter Kinderbücher aus der oder in die Türkei, die Adaptierung der Bücher für den mehrsprachigen bibliothekarischen Gebrauch, sowie die Entwicklung und Herstellung von begleitenden Sprach- und Lese-Lernspielen zum Einsatz in der bilingualen Leseanimation in Familien und verschiedensten Bildungseinrichtungen und Institutionen sowie im Internet 50