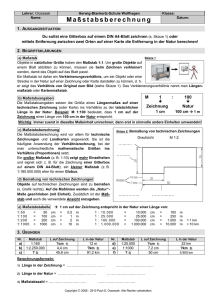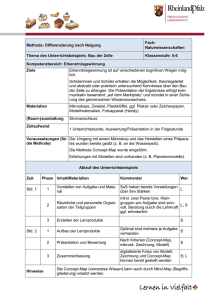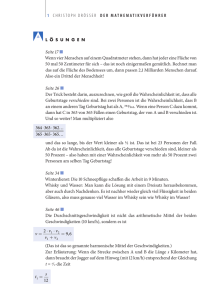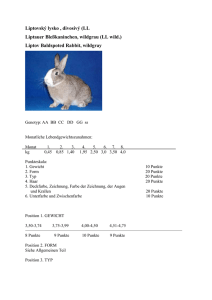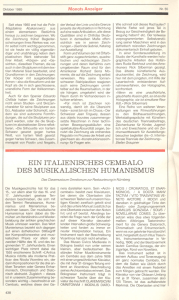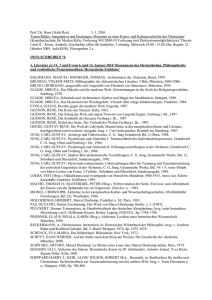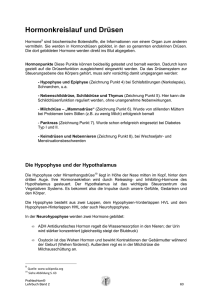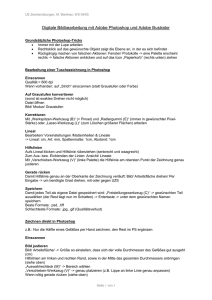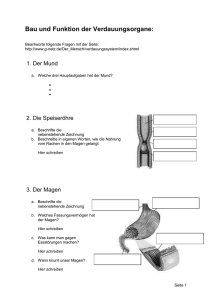emslander
Werbung

Reißlinien Vom Zugriff der Zeichnung auf die Wirklichkeit Fritz Emslander Marcel déchiravit Entlang der Kante einer Schablone fertigt Marcel Duchamp sein einziges Selbstporträt (Abb. 1). Er legt die Schablone auf Buntpapier, um nach ihrer Maßgabe Positiv von Negativ, einen bezeichneten von einem unbezeichneten Teil zu scheiden. (1) Die Grenze zwischen beiden wird nicht grafisch markiert, sie wird vielmehr als Trennung materiell vollzogen. Duchamp teilt das Papier in zwei Stücke. Vor der kontrastierenden Folie eines weiteren Papiers erkennen wir eines der beiden Fragmente als das Bezeichnete, ein Gesicht im Profil: „Marcel hat es gerissen“. (2) Die Legende ist offensichtlich ironischer Kommentar auf das in Signaturen häufig dem Künstler(vor)namen beigefügte „delineavit“, das in der Druckgrafik die Urheberschaft der einem Werk zugrunde liegenden Zeichnung ausweist. Das „delineavit“ unterscheidet dort den Zeichner vom ausführenden Kupferstecher („sculpsit“). So spielt Duchamps Signatur indirekt auf das Verständnis vom Zeichnen als ideeller Entwurfsleistung, auf die Tradition der (Alt)Meisterzeichnung sowie auf den damit verbundenen Kult der persönlichen Handschrift an. Doch genau besehen ist das von Duchamp signierte Werk nicht mehr als eine Reproduktion mittels einer technischen Zeichenhilfe. Der Kopiervorgang ist an die ausführende Hand delegiert und im Prinzip unendlich wiederholbar, (3) wenn auch der Prozess des Reißens von Papier einem gewissen Zufallsmoment unterliegt. Das Ergebnis ist abhängig von der Kunstfertigkeit der Hand, die Entstehung des Werks weit mehr taktil denn optisch gesteuert. Bedarf es denn unbedingt der Augen beim Zeichnen? Claude Heath, einer der in der Ausstellung Gegen den Strich vertretenen Künstler, würde im Sinne Duchamps optimistisch mit dem Hinweis auf die im Laufe des 20. Jahrhunderts erforschten Qualitäten eines ‚inneren Auges‘, auf eine mögliche Öffnung des Prozesses der Visualisierung, also mit „Nein“ antworten.(4) 1 Bereits im 17. Jahrhundert wollte Roger de Piles das Zeichnen als einen vom Sehen abgetrennten Vorgang aufgefasst wissen, um die Zeichnung gegenüber der farbigen Malerei zu diskreditieren. (5) Mit dem von de Piles angeführten Beispiel des Blinden, (6) der allein mittels des Tastsinns vollkommene Porträts aus Wachs schuf, hätte sich Duchamp, der radikale Ansätze immer wieder aus seinem Antagonismus zur augenfixierten Malerei entwickelte und Herausgeber der dadaistischen Zeitschrift The Blind Man (1917) war, durchaus identifizieren können. (7) Die Kunsttheorie des 17. Jahrhunderts versuchte jedoch mit ihrer Verneinung dieser Frage die Zeichnung auf eine Funktion zu beschränken: das Äußere der Dinge zu umreißen. Ihre Position ging damit auf jenen grundlegenden Vorbehalt zurück, den Platon gegenüber den mutmaßlichen Anfängen der Zeichnung im Schattenriss geäußert hatte: War die erste Kopie eines von natürlicher Quelle erzeugten Schattenbildes nicht eigentlich eine kunstlose Nachahmung, die prinzipiell auch ein Blinder hätte bewerkstelligen können? (8) Legendäre Schattenrisse: Vom Ursprung der Zeichnung In der Teutschen Academie (1675–1680) veranschaulicht Joachim von Sandrart auf einer Tafel zwei in der späteren kunsttheoretischen Rezeption rivalisierende Berichte vom Ursprung der Zeichnung. (Abb. 2, 3) Die obere Illustration bezieht sich auf den Bericht des Quintilian, die untere auf Plinius. (9) Die ersten Erfinder der Zeichenkunst, nach Quintilian ägyptische Hirten, hätten, so Sandrart, „von dem Schatten derer, so in der Sonne stunden, die äußerste Linie abgezeichnet, wie Quintilian schreibet und das mit Lit.B. bezeichnete und hie beygefügte Kupferblat weiset“. (10) In der illustrierenden Darstellung wird die Leistung des Hirten jedoch gemindert durch die undifferenzierte Gestalt des nachgezeichneten Schattenbildes sowie durch das Verhalten der Tiere, die wie der Schäfer ebenfalls ihren Schatten betrachten und mit den Hufen im Sand scharren, wie er es mit seinem Stab tut. Im Gegensatz dazu wird Plinius’ Erzählung von der korinthischen Töpferstochter, „die aus Liebe zu einem jungen Mann, der in die Fremde ging, bei Lampenlicht an der Wand den Schatten seines Gesichtes mit Linien umzog“, (11) komplex inszeniert. (12) Die Illustration soll Sandrarts Argument stützen, dass in dem von frühen Hirten in den Sand geschriebenen Schattenriss wohl der überlieferte Ursprung zeichnerischer Tätigkeit gesehen werden müsse, der mit Kohle gezeichnete, daher dauerhaftere und zudem mit dem Vorsatz der eigenen Erinnerung entstandene Umriss aber als der eigentliche Beginn der Zeichnung gelten könne. 2 Die Kluft, die in der Darstellung zwischen den Liebenden aufreißt, indem die junge Frau sich zur Fertigung des Schattenrisses von ihrem Geliebten abkehrt und damit dessen Abreise symbolisch vorwegnimmt, verweist bereits auf die grundlegende semiotische Problematik der Zeichnung: die Differenz zwischen Bezeichnetem und Bezeichnung. Indem der gezeichnete Kontur den reinen Naturzustand des Bildes als Schattenbild in Richtung auf eine vom Schatten unabhängige, ihn überdauernde Zeichnung überschreitet, führt er zugleich das Auseinanderdriften von Original und Abbild vor Augen. Mithilfe einer raffinierten Lichtregie scheinen sich die Liebenden im Schattenbild zwar noch ein letztes Mal zu umarmen, doch die Kunst kann die reale Trennung des Paares nur in der Funktion eines Surrogats überwinden. Die vermeintliche Unmittelbarkeit des als ‚Abdruck der Natur‘ verstandenen Schattenrisses wird desillusioniert. Mit Nicola Suthor lässt sich „der Riß, der sich bildlich fassbar im Stich von Sandrart als ‚Sprung‘ im Bild ausbildet und die wesentliche Inkongruenz im Verhältnis von Urbild und Abbild bestimmt“, als Ursprung der Porträtkunst in der Zeichnung begreifen. (13) Dieser Bildriss setzt sich durch die Geschichte der Porträtkunst fort und ist in Duchamps Selbstporträt in mehrfacher medialer Brechung – über den Umweg einer Fotografie Man Rays (wie Plinius’ Schattenbild durch das Licht gezeichnet) und der darauf basierenden Schablone – ins Werk gesetzt. (14) „Reißen“: Zur Begriffsgeschichte Die in Sandrarts Kunsttraktat agierenden Erfinder der Zeichenkunst verfolgen mit ihrem Tun nicht nur verschiedene Zwecke, sie markieren auch zwei grundverschiedene mediale Alternativen der Zeichnung: Traditionellerweise verstehen wir unter „Zeichnen“ das Abreiben eines weicheren Mediums wie der Kohle (des Grafits, der Kreide etc.) auf einem härteren Medium wie der Wand (dem Papier etc.). (15) Als Abrieb bleibt das Weichere in oder auf dem Härteren erhalten. Der Begriff des „Reißens“ hingegen, der im 15. bis 17. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum weitaus gebräuchlicher war als der des „Zeichnens“, (16) meinte ursprünglich den umgekehrten Vorgang: Ein weicheres Medium wird von einem härteren ‚gezeichnet‘. Das härtere Medium prägt oder ritzt sich in das weichere ein und verformt es. Schere oder Skalpell schneiden das weiche Papier – wie bei Katharina Hinsberg, in deren Arbeiten erst das Heraustrennen der Linie und die dadurch entstehende Leerstelle die endgültige Zeichnung definieren. (17) Jeppe Heins 360° Presence wiederum – um ein anderes Beispiel aus der Ausstellung Gegen den Strich zu nennen – verbindet das so verstandene „Reißen“ mit dem „Zeichnen“: Hin und wieder bricht eine Metallkugel eigendynamisch und 3 mit Gewalt in den Mauerverbund ein. Die entstehenden Löcher unterbrechen eine ansonsten kontinuierlich gezogene und erst allmählich durch den Abrieb des Metalls an den Wänden sich formierende Linie. (18) Eine der ältesten Bedeutungen von „reißen“ (althochdeutsch rīzan), das Ziehen von Linien im Feldbau, entspricht letztlich dem, was Sandrarts selbstverliebter Schäfer tut. Im Mittelhochdeutschen stand „reißen“ (rīzen) vor allem für das Einritzen von Runen oder sonstigen Zeichen und Bildern in Holz, Stein oder Metall und wurde in der Folge zum Synonym für „zeichnen“. (19) Unter „Riss“ verstand man im 16. Jahrhundert zwar auch schon eine lineare Handzeichnung, ein „Reißer“ war jedoch zumeist ein Zeichner, der Bilder – vor allem Porträts – auf Holztafeln oder Kupferplatten „gerissen“, das heißt aus ihnen herausgerissen hat. (20) Der Begriff wurde nun in der Kunsttheorie mit dem durch Plinius überlieferten Schattenriss als der ersten, primitiven Form des Zeichnens in Verbindung gebracht, die der Malerei und Bildhauerei vorausgegangen sei und auf der die anderen Künste aufbauten. (21) Die Herleitung des gemalten Bildes vom Schattenriss trug dem klassischen Postulat der Naturnachahmung Rechnung: ars imitatur naturam. Dabei fußte die frühe Überzeugung, dass sich im Umriss die Wahrheit der Form mit dem klaren Lineament des einfassenden Konturs verbinde, zum Teil noch auf einer – wie Merleau-Ponty es nannte – „prosaische[n] Auffassung der Linie als positives Attribut“, als seiende Hülle der Dinge: „der Umriß des Apfels oder die Abgrenzung des Ackers und der Wiese [werden] als in der Welt gegenwärtig gehalten; der Bleistift oder der Pinsel brauchen die Perforierung nur noch nachzuziehen.“ (22) Sieht man von der konstruierten Situation der im Schattenbild projizierten und verfügbar gemachten Linie ab, so deutet das „Reißen“ in seiner materiellen Drastik, mit der Konnotation des mehr oder weniger gewaltsamen Entreißens, auf einen Eingriff des Zeichners, der im Verständnis des 16. Jahrhunderts das Wesen von Kunst ausmachte. Die durch den Künstler vorgenommene Bezeichnung der Dinge gleicht demnach einem „Reißen“ – auch an ihnen. Albrecht Dürer spitzte dieses Ringen mit den Dingen, das mehr sein sollte als das bloße Nachziehen mit der Reißfeder, (23) in einem Satz zu: „Denn wahrhaftig steckt die Kunst in der Natur, wer sie heraus kann reißen, der hat sie.“ (24) Einschnitte in das Fleisch der Dinge 4 Während den legendären Erfindern der Zeichenkunst erste Linienzeichnungen im Fund des natürlichen Schattenbildes regelrecht zufielen, ist Dürers Sprachbild vom „Herausreißen“ das eines Kampfes, eines Raubes. Es korrespondiert mit der Vorstellung, dass sich die Natur dem Zugriff des Künstlers entziehe beziehungsweise dass nur der Künstler dieses Widerstreben der Dinge durch seine Kunst brechen könne. Martin Heidegger zitiert in Der Ursprung des Kunstwerks Dürers Satz im Sinne eines Plädoyers gegen die Reduktion der Kunst auf ihre Abbildhaftigkeit, gegen die Instrumentalisierung des Kunstwerks als Werkzeug der Naturnachahmung. „Herausreißen“ heiße bei Dürer „Herausheben, aber in der Weise des Zeichnens“. (25) Die Fähigkeit des Zeichners, der Natur ihre Wahrheit zu entreißen, läge demnach in einem Ziehen von Linien, das an den Dingen der Natur das hervorhebt, was an ihnen „wahrhaftig“ und eigentümlich ist, was ihr Ding-Sein konstituiert. Mit der Gewalt eines Einschnitts in das „Fleisch der Dinge“ (Merleau-Ponty) entreißt der Zeichner die Natur ihrem Rückzug. (26) Der bezeichnende „Riss“ öffnet die Dinge dem Blick, er bringt zum Vorschein, was in den Gegenständen bereits angelegt ist, aber ansonsten verschlossen bliebe. Diese Fähigkeit des Heraushebens begründet die konstituierende Kraft der Linie, wie sie das 20. Jahrhundert postuliert. „Denn fortan, wie Klee sagt, imitiert sie [die Linie] nicht mehr das Sichtbare, sie ‚macht sichtbar‘, sie ist der Aufriss einer Genese der Dinge.“ (27) Als Aufriss erschafft die Linie, was sie an den Dingen freilegt und was sich durch sie offenbart. Spätestens in der Nachfolge der klassischen Moderne hat sich die Linie von der Verpflichtung zur Naturnachahmung gelöst. Die Zeichnung entwickelte ein starkes Selbstverständnis als autonome, zunehmend auch selbstreferenzielle Gattung, die in den Experimenten der 60er und 70er Jahre sämtliche konzeptionellen und materiellen Grenzen sprengte. (28) Als multiple Manufaktur markierte Duchamps Selbstporträt von 1958 in diesem Prozess nicht nur eine klare Absage an die optisch-mimetische Nachahmung, die Verabschiedung von der individuellen Handzeichnung und die Öffnung der (Porträt-)Zeichnung für eine Reihe anderer Medien wie Fotografie und Schablonentechnik. Mit dem Rückgriff auf die reduzierte Konturzeichnung des Schattenrisses (29) öffnete Duchamp sein gezeichnetes Porträt vor allem auch auf den Betrachter hin. Ihm hatte Duchamp in einem wegweisenden Statement von 1957 einen wesentlichen Beitrag am schöpferischen Akt zugestanden. (30) Des Töpfers/Bildhauers, der bei Plinius den Umriss mit einem Porträtrelief füllt und somit erst zu 5 einem Kunstwerk vervollständigt, bedarf es nicht mehr. Die Zeichnung hat sich nun zweifellos aus ihren traditionellen Hilfsfunktionen befreit. Ob und wie zeichnerische Strategien heute, nach den grundlegenden Revisionen der Gattung in den letzten Jahrzehnten, der aus der frühen Medien- und Begriffsgeschichte überlieferten Auffassung der Zeichnung als „Riss“, des Zeichnens als „Reißen“ neue Aspekte abgewinnen, sei im Folgenden an einigen Positionen der Ausstellung Gegen den Strich erläutert. Ist der Riss (das Auf- und Herausreißen im Sinne Klees) als Metapher für das Erkenntnispotenzial der Zeichnung weiterhin paradigmatisch? Oder anders formuliert: Ziehen Künstler weiterhin jene Risse, an deren Verlauf sich das Wesen der bezeichneten Dinge offenbart? Unter die Haut 1994 erregte Daniele Buetti großes Aufsehen mit seinen Zeichnungen von Markennamen internationaler Konzerne, die er New Yorker Passanten als temporäre „Tattoos“ anbot. Die Platzierung direkt auf die Haut gleicht einem Branding – dem ursprünglichen Brandmarken von Tieren, das heute zugleich einem Körperkult und einem Marketinginstrument den Namen gibt – und löst frappierende Erkenntnisse darüber aus, wie stark wir in unserem Alltag von Markenprodukten dominiert werden. Zugleich scheint die Zeichnung das an die Oberfläche dringen zu lassen, was sich mithilfe der Werbung längst in unserem (Unter-)Bewusstsein festgesetzt hat und was wir zum Teil auch als Lebensmittel oder Medikamente wortwörtlich internalisieren. (Abb. 4) In zwei weiteren Werkgruppen verwendet Buetti dann Model-Fotografien, die er von hinten punktuell bearbeitet oder auf Leuchtkästen anbringt und durchsticht, um Narben zu reißen in perfekte Körperoberflächen, die die Schönheitsindustrie zu Projektionsflächen gemacht hat. Die mit dem Kugelschreiber eingeprägte ‚Tätowierung‘ von Firmennamen ist ein subkutaner Eingriff am Bild idealer Schönheit. Anders als bei Santiago Sierra, der eine Tätowierung auf den Rücken gekaufter Personen als gewaltsame und in der Ausübung von Gewalt aufschlussreiche Aktion realiter vollzieht, (31) fließt bei Buetti kein Blut. Und doch assoziieren wir die Male, die seine Verletzungen an der Bildoberfläche hinterlassen, unweigerlich mit den Spuren des Chirurgenmessers, das zur Umsetzung eines Schönheitsideals zunehmend eingesetzt wird. So muss der eigenartige Umstand nicht mehr erstaunen, dass die Vernarbungen in der Glamour-Ästhetik der Magazinfotografien aufgehen. Im Übertragenen legt Buetti den Zeichenstift in eine 6 verborgene Wunde unserer Gesellschaft und bringt sie dadurch zum Vorschein: Er „markiert präzise [die] Schnittstelle zwischen kollektiver Vereinnahmung und individualistischer Selbstbehauptung“. (32) (De)Montagen Um den revelatorischen Charakter des Zeichnens bildhaft zu umschreiben, hat Merleau-Ponty von der Zeichnung als einer „bestimmten Bohrung“ gesprochen, „die im An-Sich durchgeführt wird“. (33) Mittlerweile wurde das Repertoire der zeichnerischen Techniken durchaus um die Bohrmaschine erweitert – man denke an Craig Woods oder Martin Schmids „wall tattoos“. (34) Stefan Sous greift zunächst zum Schraubenzieher. Bei seinen Installationen geht er von so genannten Explosionsdarstellungen aus dem Bereich der technischen Zeichnung aus. Explosionszeichnungen demonstrieren in Montage- oder Reparaturanleitungen den Aufbau von Maschinen. Die fiktive Explosion verläuft so kontrolliert, dass sich alle Einzelteile an vorgegebenen Achsen und gemäß ihrer Einbaulage und -reihenfolge ausrichten. Mit dem technischen Geschick des Monteurs demontiert Sous einen Fön (Abb. 5) oder eine Kaffeemaschine, um sie sodann mit den Augen des Zeichners in dreidimensionale Installationen zu überführen, die uns überraschende Einblicke in das Innenleben von Alltagsgegenständen gewähren. Nicht mit dem spitzen Stift, sondern im wörtlichen Sinne und fachgerecht seziert er die Dinge, um ihre Einzelteile in ein räumliches Koordinatensystem von Fäden einzuspannen. Die gebremste Dynamik dieses explosiven Aufrisses belässt die Dinge in einem Zustand der Schwebe, des Nicht-mehr- oder Noch-nicht-(wieder-)Ganzen. So zieht sich ein Riss durch unsere Wahrnehmung scheinbar vertrauter technischer Geräte, die in bisher ungesehener Komplexität und Fragilität erscheinen. Mit der Desintegration der Dinge korrespondiert der Zerfall unseres Bildes von ihnen, und Sous fordert den Betrachter auf, für sich die Konsequenzen zu ziehen: Reparatur oder Entsorgung? Perforierungen Während Stefan Sous’ Dekompositionen an den Dingen selbst ansetzen, vollzieht sich in Jochen Flinzers Stickarbeiten der Bildriss im Prozess der Einschreibung in ein Trägermaterial, 7 die Oberfläche eines gespannten Stoffes, die er systematisch mit Nadel und Faden durchsticht. Flinzer hintergeht damit die klassische Bildfläche und fügt einer streng formalen und stringent angelegten Vorderseite eine Rückseite hinzu, auf der sich eigendynamisch ein Subtext entspinnt. So reiht er in seiner jüngsten Arbeit Billy Budd (2004) auf zwei von drei Teilen eines Paravents die Figuren der gleichnamigen Oper von Benjamin Britten in einer langen, bildfüllenden Kette von Namen auf, die die Reihenfolge der Auftritte wiedergibt. (35) Der Sprech- bzw. Gesangstext ist jedoch unterschlagen, die Figuren bleiben stumm. Dagegen suggeriert das sich zunehmend verdichtende und nur bedingt formal kontrollierbare Liniengeflecht der Rückseiten ein unterschwellig verzeichnetes Psychogramm der Oper. Die Linien aber klären sich nicht zu einem Tableau der Figurenkonstellation. Vielmehr addieren sie sich zu einem verwirrenden Gespinst auf, das in seiner synästhetischen Anmutung an einen Cluster aller Gesangspartien denken lässt. Ohne den Entstehungsprozess oder die Aufführung einer Oper abbilden zu wollen (oder auch nur zu können), legt Flinzers Visualisierung doch wesentliche Strukturen frei: An zwei Tafeln des Paravents erscheinen die auf die lineare Abfolge des schriftlichen Notats reduzierte Handlung vorne (Libretto) und das angedeutete Klangbild sich überlagernder Stimmen hinten (Musik) in ihrer Abhängigkeit voneinander als komplexes Gefüge, das auf der dritten Tafel durch bildliche Darstellungen des handelnden Personals vervollständigt wird. (Abb.6) Das ‚Casting‘ für seine ‚Opernaufzeichnung‘ hat der Künstler mittels Google vorgenommen. (36) Auch wenn Flinzers Personenumrisse auf Vorlagen basieren, die der medial vermittelten Welt des Internets entnommen sind, stehen sie letztlich in der Tradition ihrer legendären Vorläufer, der Schattenrisse. Indem Flinzer aber die Lichtbilder nicht auf den Stoffgrund projiziert, sondern sie ‚frei Hand‘ stickend umsetzt, legt er stillschweigend eine lange gewonnene Erkenntnis zugrunde: Der Umriss ist weniger getreues Abbild der Wirklichkeit als grafische Abstraktionsform. Als Abbreviatur aber ist der Umriss eine offene Form, die der Betrachter zu füllen aufgefordert ist. Bewusst öffnet der Zeichner hiermit das auf Perfektion angelegte Gesamtkunstwerk Oper und ermöglicht dem inspirierten Betrachter eine eigenständige Re-Inszenierung. Filmrisse Wenn Alexander Roob sich im Rahmen seines CS-Projekts (37) mit bestimmten Orten auseinander setzt, wenn er seine Seheindrücke in der offenen Form der sequenziellen Zeichnung aneinander reiht, erfasst er Umrisse in klarer, verknappter Lineatur, ohne die 8 Dinge damit fixieren zu wollen. Von der Imitatio der aus dem Schattenriss hergeleiteten (Nach)Zeichnung hebt er sich ausdrücklich ab. Roob geht es gerade nicht um einen peniblen Nachvollzug der Welt. Das zeichnerische Abtasten des Randes, der die Dinge umgibt, der sie als Begrenzung von den anderen Dingen trennt und sie zugleich zu ihnen in Beziehung setzt, dient der Überführung „scheinbar starre[r] Dinge in fließende, rhythmische Vorgänge. Es ist ein nahezu blinder, tastender und musikalischer Vorgang, der absieht von Substanziellem und hinsieht auf Relationales“. (38) Wie die Umrisslinie weniger die Dinge selbst als deren Beziehungen und die sich öffnenden Zwischenräume erforscht, so ergibt sich aus der Zusammenschau der einzelnen Bilder nicht eine lineare Geschichte, sondern vielmehr ein Feld vieler möglicher Erzählungen, die sich zwischen den Bildern entwickeln. (39) (Abb. 7) Obwohl Roobs Herangehensweise mit Recht in die Nähe des Films und seiner Mittel – Zoom, Schwenk, Überblendung, Montage – gerückt wurde, unterscheidet sich das Prinzip seines „Bildromans“ doch wesentlich von der „Einsinnigkeit“ und Zielgerichtetheit des Films. Produktion wie Rezeption des Bildromans passieren „im Gehen“. Wenn Roob sich mit seinem Verfahren der ungerichteten Aufmerksamkeit dem situativen Gesamtzusammenhang eines Ortes ausliefert und in einen Fluss der Wahrnehmung eintaucht, aus dem er verschiedene „Partikel“ herausgreift, hat er nicht das Ziel, eine folgerichtige Story zu liefern. Er betrachtet diese „Verflüssigung“ von Situationen als Alternative zur filmischen Wirklichkeitserfassung, die nur zu Erstarrung führe. Mit seiner fixen Folge von Einzelbildern könne der Film nur eine mechanische „Illusion temporaler Kontinuität“ erzeugen, erläutert Roob 1997 in seiner Theorie des Bildromans. Während der Film den Betrachter paralysiere, versetze ihn der in Ausstellungen räumlich ausgebreitete Bildroman in Bewegung und ermögliche es ihm, den eigenen Standpunkt sowie Richtung und Tempo der Wahrnehmung selbst zu bestimmen. (40) Die eigene, subjektiv bedingte Rhythmik der Wahrnehmung, insbesondere der Wahrnehmung von zeitlichen Abläufen, thematisiert Francis Alÿs in seiner filmischen Installation Time is a Trick of the Mind von 1998. (41) In der Geschwindigkeit, mit der ein Stock an die Latten eines Zauns schlägt, verketten sich die gezeichneten Einzelbilder additiv zur Filmstrecke. Nun läuft der auf diese Metapher vom linearen Voranschreiten der Zeit konzentrierte Zeichentrickfilm aber in zwei Kopien. Beide werden zwar morgens zeitgleich gestartet, doch selbst zwei baugleiche Abspielgeräte garantieren keine perfekte Synchronizität. Der von Alÿs inszenierte Riss im Kontinuum der apparativ getakteten Zeit ist kein abrupter Schnitt. Anfangs nur ein Haarriss, öffnet er sich im Verlauf eines Ausstellungstages zum 9 beunruhigenden Spalt: Die Dissonanz des nun versetzt wiederholten Rhythmus stört die Aufnahme des Taktes durch den Rezipienten. So lenkt diese irritierende Differenz die Aufmerksamkeit auf die eigene Wahrnehmung, die ihrerseits durch die rhythmischen Grundkonstanten des eigenen Körpers bedingt ist und ein subjektives Zeitgefühl ausprägt. Ob wir uns einem vorgegebenen Rhythmus anvertrauen oder selbst die Rolle des Taktgebers übernehmen: Zeit ist eine Illusion des Geistes. Mit einer vergleichbaren Zeitverschiebung irritiert Rachel Lowe in Carousel (1999) unsere visuelle Wahrnehmung. Achtzig Dias, die eine Lebenszeit von achtzig Jahren dokumentieren, laufen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf zwei Diaprojektoren. Alle ursprünglich auf den Vorlagen abgebildeten Figuren hat Lowe geschwärzt und damit entindividualisiert. Wir beginnen sehr bald, uns und unsere eigenen Erinnerungen in diese Schattenrisse – Falltore des persönlichen Gedächtnisses – hineinzuprojizieren, bemerken aber, dass sich mit der zeitlich versetzten Wiederkehr derselben Dias immer wieder neue, andere erinnerte Bilder und mögliche Geschichten einstellen. (42) In einer früheren Arbeit verfolgt Rachel Lowe mit schnellem Strich auf dem Monitor das Bild des Mannes, der in John Cassavetes’ Film The Killing of a Chinese Bookie (1976) den Mord begeht. (Abb. 8) Indem sie ihrer Arbeit die Schlüsselszene des Films zugrunde legt, gibt Lowe im wörtlichen Sinne einen knappen Abriss der Handlung: A Rough Outline of the Plot (1996). Der Titel verweist darüber hinaus auf die Erstellung einer Umrisszeichnung, die nur skizzenhaft sein kann, da ihr Gegenstand sich in Bewegung befindet: Der Umriss ist bemüht, eine handelnde Person zu erfassen und ihre Entwicklung aufzuzeigen. Im Loop des Films kehrt die Mordszene zyklisch wieder; Lowe bricht die lineare Chronologie. Das die Filmbilder überlagernde Lineament blendet nun einzelne Phasen der Handlung, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ineinander (43) und visualisiert damit die Pointe des Films: Der durch seine Spielschulden erpressbar gewordene Protagonist erfüllt mit der Mordtat letztlich die im Plot für ihn vorgesehene Bestimmung, die er anfangs selbst noch nicht kannte. Im Gegensatz zu Plinius’ Umrisslinie, die die Erinnerung an einen Mann – so wie er war – festhalten sollte, zeigt Lowes Outline an einem Mann den Mörder, der er sein wird. Rachel Lowes zyklische Stauchung der Zeit, Francis Alÿs’ Spalt im Zeitkontinuum brechen mit linearen Handlungs- und Zeitverläufen. Alexander Roob verflüssigt erlebte Situationen und vermeidet bewusst eine klare Story-Line, um mit seinen Zeichnungen Zwischenräume 10 und damit eine Dynamik in der Beziehung der dargestellten Dinge und Personen freizusetzen. Als Risse verstanden, machen Lowes zeichnerische Eingriffe Handlung durchlässig, indem sie verschiedene Schichten einer dargestellten Figur freilegen. Wie Buettis Tätowierungen überziehen sie als Menetekel das Gesicht der Figur, um auf ein fremdbestimmtes Inneres zu verweisen. So gleichen Lowes wie Roobs Umrisslinien ebenso wie Stefan Sous’ Fäden, an denen entlang sich Alltagsgeräte entfalten, Vektoren: Sie lösen die Dinge aus ihrer Verfugung und deuten damit eine Vielzahl möglicher Sichtweisen an. Ihr Impuls richtet sich gegen den einen bezeichnenden Strich, der die Dinge auf ein Abbild fixiert. Dieser Abwendung von der einen Zeit und der einen Perspektive entspricht eine Hinwendung zu den subjektiven Komponenten der Wahrnehmung. Bei aller Expansion, durch neue Medien und in praktisch alle Gattungen hinein, lässt sich in den verschiedenen Verfahren des Reißens und deren metaphorischer Übertragung auf einzelne Inhalte doch ein Grundanliegen heutiger Zeichnung erkennen. Ob mit Stift und Papier oder mittels Fotografie, umgesetzt in Videoarbeiten oder Installationen, gestochen oder perforiert, in der Demontage eines dreidimensionalen Körpers oder als Schnitt durch die Zeit: Als Eingriff in ein intaktes Ganzes erschließt der Riss Blicke auf die Innen- und Kehrseiten der Personen und Dinge, an denen er ansetzt. Die Karriere, die der Riss als zeichnerisches Werkzeug der Naturnachahmung begonnen hat, setzt er als Instrument der Erforschung des unter der sichtbaren Oberfläche der Dinge Verborgenen fort. Dieser investigative Ansatz untersucht auch die Art der Darstellung der Dinge in der Kunst. Buettis Entstellungen fotografierter Hochglanz-Images (die nochmals fotografiert und so in das Medium Fotografie integriert werden), Lowes zeichnerische Überlagerungen von als Video präsentierten Filmszenen oder Flinzers Übertragung einer Oper in eine janusgesichtige Stick-Zeichnung setzen sich nur einesteils mit den Inhalten der künstlerischen Vorlagen auseinander. Ein anderer, zentraler Aspekt der Arbeit dieser Zeichner besteht darin, die inneren Gesetze des jeweiligen Ausgangsmediums sichtbar zu machen: seine Bedingtheiten und seine je spezifische Konstruktion von Wirklichkeit. Aus ihrer einstigen Vorläuferfunktion für die anderen bildenden Künste, der lange ein dienendes Moment anhaftete, hat sich die Zeichnung damit in die Rolle des Impulsgebers und Reflexionsmediums aufgeschwungen. 11 (1) Zum Unterscheiden und (Be)Zeichnen als den Grundoperationen des Zeichnens: Hans Dieter Huber: Draw a distinction. Ansätze zu einer Medientheorie der Handzeichnung. In: zeichnen. Der Deutsche Künstlerbund in Nürnberg 1996. 45. Jahresausstellung. Ausst.-Kat. Germanisches Nationalmuseum Nürnberg 1996, S. 8–21, bes. S. 12–14. (2) Autoportrait de profil, New York 1958, Buntpapier, handgerissen nach Schablone, montiert auf schwarzem Papier, 14,9 14,9 cm; als Frontispiz für die Vorzugsausgabe von: Robert Lebel: Sur Marcel Duchamp. Paris/London 1959; vgl. auch als Siebdruck: Plakatentwurf zur Ausstellung Sur Marcel Duchamp, abgebildet in: SchattenRisse. Silhouetten und Cutouts. Hrsg. von Helmut Friedel. Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus München –Kunstbau, Ostfildern-Ruit 2001, S. 188, Kat.-Nr. 99. (3) Einige der vielen Varianten in andersfarbigem Papier in: Marcel Duchamp. Respirateur. Hrsg. von Kornelia von Berswordt-Wallrabe. Ausst.-Kat. Staatliches Museum Schwerin, Stuttgart 1995, S. 175, 213. (4) Vgl. S. . (5) Vgl. Françoise Dastur: Die Zeichnung und die Geburt der Dinge. In: Zeitlichkeiten. Hrsg. von Jeanne Vervoort. Berlin 1998, S. 204–224, hier S. 212f. (6) Vgl. dazu Peter Bexte: Einleitung. In: Blinde Seher. Wahrnehmung von Wahrnehmung in der Kunst des 17. Jahrhunderts. Dresden 1999. (7) Dem „junge[n] Künstler von morgen“ riet Duchamp in seinem Text Where do we go from here (1960), „durch den Spiegel der Netzhaut hindurchzugehen, um zu einem tieferen Ausdruck vorzudringen“. Serge Stauffer (Hg.): Marcel Duchamp. Die Schriften. Bd. 1: Zu Lebzeiten veröffentlichte Texte. Zürich 1981, S. 241f.; hier zit. nach Ausst.-Kat. Marcel Duchamp 1995 (wie Anm. 3), S. 191f. (8) So Platons Kritik des Schattenrisses (Skiagraphia) in Politeia. Der Staat. Buch X. 599c; vgl. Nicola Suthor: Caius Plinius Secundus d. Ä.: Trauerarbeit – Schatten an der Wand (77 n. Chr.). In: Rudolf Preimesberger, Hannah Baader, Nicola Suthor (Hg.): Porträt. [Geschichte der klassischen Bildgattungen in Quellentexten und Kommentaren, Bd. 2] Berlin 1999, S. 117–126, hier S. 120. (9) Beide Illustrationen nach Vorlagen von Georg Andreas Wolfgang. Zur Diskussion der Sandrartschen Tafel: Victor I. Stoichita: A short history of the shadow. London 1997 [dt. Eine kurze Geschichte des Schattens. München 1999], S. 11–20, 124f.; vgl. auch Dastur 1998 (wie Anm. 5), S. 213f.; David Rosand: Drawing Acts. Studies in Graphic Expression and Representation. Cambridge 2002, S. 4–8. 12 (10) Joachim von Sandrart: L’Academia Todesca della architectura, scultura & pittura oder Teutsche Academie der edlen Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste. 2 Bde. Nürnberg 1675–1680. Bd. 1, II. Theil, S. 2. (11) Gaius Plinius Secundus d. Ä.: Naturalis Historiae. Liber XXXV, 151; zit. nach Ders.: Naturkunde. Lateinisch-Deutsch. Buch XXXV: Farben Malerei Plastik. Hrsg. und übers. von Roderich König. Darmstadt 1978, S. 109: „Mit einem Erzeugnis des gleichen Erdmaterials erfand in Korinth der Töpfer Butades aus Sikyon als erster ähnliche Bilder aus Ton zu formen, und zwar mit Hilfe seiner Tochter, die aus Liebe zu einem jungen Mann, der in die Fremde ging, bei Lampenlicht an der Wand den Schatten seines Gesichtes mit Linien umzog; den Umriß füllte der Vater mit daraufgedrücktem Ton und machte ein Abbild, das er mit dem übrigen Tonzeug im Feuer brannte und ausstellte […]“ (12) Zur Ikonografie dieses Motivs im 18. und 19. Jahrhundert: Hans Wille: Die Erfindung der Zeichenkunst. In: Beiträge zur Kunstgeschichte. Festschrift für Heinz Rudolf Rosemann. München 1960, S. 279–300. (13) Vgl. Suthor 1999 (wie Anm. 8), S. 124. (14) Die Vorlage der von Duchamp verwandten Schablone ist in einer Fotografie zu sehen: Man Rays in einem entsprechenden Ausschnitt um 1923 gefertigtes Porträt von Duchamp (1923 entschloss sich Duchamp, mit der Kunst aufzuhören und nur mehr seiner zweiten Passion, dem Schachspielen, zu folgen); dem Schattenriss gegenübergestellt abgebildet in art. Das Kunstmagazin, 1, Januar 1999, S. 12–13; vgl. auch Man Rays Fotografie von Duchamp beim Schachspiel von 1921, abgebildet in Ausst.-Kat. Marcel Duchamp 1995 (wie Anm. 3), S. 208. (15) Ein funktionaler Medienbegriff wird zugrunde gelegt, der als „Medium“ ein Material bezeichnet, das zu einem bestimmten Zweck benutzt wird: vgl. Hans Dieter Huber 1996 (wie Anm. 1), S. 10, 17. (16) Hanspeter Landolt: „Zeichnen“ und „Reißen“. In: Justus Müller Hofstede, Werner Spies (Hg.): Festschrift für Eduard Trier zum 60. Geburtstag. Berlin 1981, S. 81–87, hier S. 82. (17) Von Hinsbergs so genannten Découpagen zeigt die Ausstellung Diaspern (2004); vgl. S. – und Abb. S. – in diesem Katalog. (18) Vgl. S. – und Abb. S. – in diesem Katalog. (19) Vgl. die Artikel Reißen in: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Hrsg. von Wolfgang Pfeifer. Bd. 2. 2. Aufl. Berlin 1993, S. 1109f.; Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 8 [Leipzig 1893]. NA München 1984, S. 754–763. 13 (20) So etwa in Jost Ammans Ständebuch von 1568; vgl. Christian Rümelin: Terminologische Überlegungen zum Begriff Riß. In: Ausst.-Kat. SchattenRisse 2001 (wie Anm. 2), S. 54–59, hier S. 55. (21) Vgl. ebd. zur Karriere des Begriffs in der deutschen Kunstliteratur des 16. bis 18. Jahrhunderts. (22) Maurice Merleau-Ponty: Das Auge und der Geist. In: Ders.: Das Auge und der Geist. Philosophische Essays. Hamburg 2003, S. 275–317, Zitat S. 306. (23) „Zeichnen“ und „Reißen“ werden von Dürer synonym verwandt; vgl. Rümelin 2001 (wie Anm. 20), S. 55, der zu bedenken gibt, dass Differenzierungen zwischen den beiden Begriffen zum Teil auch auf dialektale Einfärbungen zurückzuführen sind. (24) Aus Albrecht Dürers Ästhetischem Exkurs zur Proportionslehre (1528) zitiert nach Dastur 1998 (wie Anm. 5), S. 216. (25) Martin Heidegger: Der Ursprung des Kunstwerks [1936/37]. In: Ders.: Holzwege. Gesamtausgabe Bd. 5. Frankfurt/M. 1950, S. 1–74, hier S. 27ff., 51ff; Zitat S. 58. (26) Ich folge hier der Argumentation von Dastur 1998 (wie Anm. 5), S. 214–218, der Heideggers Definition von Kunst vom Paradigma der Gravur aus kommentiert. (27) Merleau-Ponty 2003 (wie Anm. 22), S. 307f. (28) Vgl. den Beitrag von Markus Heinzelmann S. – in diesem Katalog. (29) Die gerissene Schwarzweißzeichnung impliziert auch eine Verortung des passionierten Spielers und Denkers Duchamp in der Welt des Schachs; vgl. oben Anm. 14. (30) Vgl. Marcel Duchamp: The Creative Act. Zuerst in: Art News, 56, 4, Sommer 1957; wiederabgedruckt in: Marcel Duchamp. Ausst.-Kat. Museum Jean Tinguely Basel 2002, S. 43. (31) Vgl. S. –, Abb. – sowie S. – im Beitrag von Markus Heinzelmann in diesem Katalog. (32) Vgl. Christoph Doswald: Magic Moments. In: Daniele Buetti. Ausst.-Kat. Kunstverein Freiburg, Helmhaus Zürich, Fonds Régional d’Art Contemporain Marseille, Ostfildern-Ruit 2003, S. 23–28, Zitat S. 27, Abbildungen S. 105–168. (33) Merleau-Ponty 2003 (wie Anm. 22), S. 309. (34) Zu Craig Wood: Institut für Moderne Kunst Nürnberg e. V. (Hg.): Grenzgänge der Zeichnung. Jahrbuch 1996 des Instituts für moderne Kunst. Nürnberg 1997, S. 158f., 164f. Die Wandarbeiten von Martin Schmid wurden 2003 in Schapp – Der Effektenraum, Stuttgart, ausgestellt. 14 (35) Nach der gleichnamigen Erzählung Herman Melvilles aus dem Jahr 1797 entstanden, handelt die Seemanns-Tragödie in der Zeit der Koalitionskriege gegen Frankreich auf einem Kriegsschiff; vgl. die Abbildungen auf S. f. in diesem Katalog. (36) Die Internet-Suchmaschine bietet einen Bildersuchdienst an: Als Treffer werden diejenigen Bilder angezeigt, die im Dateinamen den Suchbegriff tragen. Flinzer hat nach den Namen der Opernfiguren gesucht und jeweils den ersten Treffer ausgewählt. (37) „CS“ ist zunächst in Anlehnung an die englische Phonetik als „Sieh es“ zu lesen; als Abkürzung kann es einige weitere Bedeutungen haben. Vgl. dazu S. in diesem Katalog. (38) Andreas Bee, Alexander Roob: Über die Kunst des Zeichnens. Gerhard Richter und Bernard Buffet. Ein Gespräch. In: Andreas Bee (Hg.): Richter zeichnen. Ausst.-Kat. Museum für Moderne Kunst Frankfurt, Frankfurt/M./Köln 2001, S. 209–220, hier S. 216. (39) Vgl. Stephan Berg: Die Zerstreuungen des Zeichners. Alexander Roobs Bildroman. In: Kunstforum International, 142, Oktober–Dezember 1998, S. 260–269. (40) Alexander Roob: Theorie des Bildromans. Hrsg. von der Villa Massimo, Rom. Köln 1997, Zitate S. 107, 115. Vgl. auch Gunhild Brandler: Alexander Roob. Theorie des Bildromans. In: Neue Bildende Kunst, 2, 1998, S. 93;Clemens Krümmel: Notizen zur sequentiellen Bilderzählung in Alexander Roobs „Theorie des Bildromans“. In: Alexander Roob. CS–VI. Bildroman. Darmstadt 1998, S. 13–27, hier S. 16f. (41) Vgl. S. – in diesem Katalog. (42) Vgl. Jeremy Millar: Thoughts Towards a Happy Ending. In: Rachel Lowe. 18-9-59. Ausst.-Kat. The Showroom London 2001, S. 7–31, hier 19–23; vgl. zu Rachel Lowe auch S. –, Abb. S. – sowie S. – im Beitrag von Markus Heinzelmann in diesem Katalog. (43) Jeremy Millar (ebd., S. 18) spricht in Anlehnung an Gilles Deleuze von einer „multiplen Gegenwart“ und sieht in Lowes Arbeiten experimentelle Zeitreisen. 15