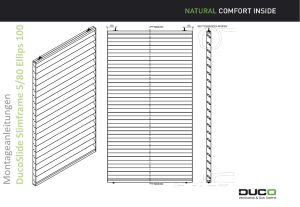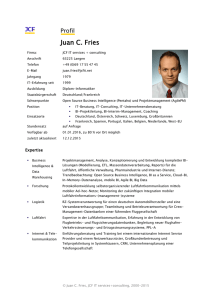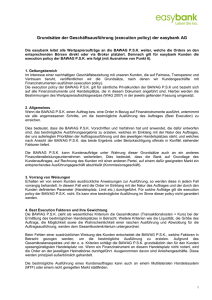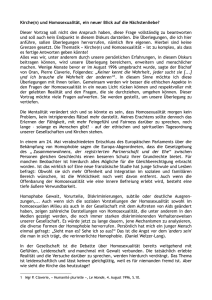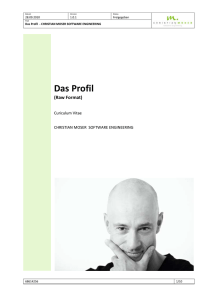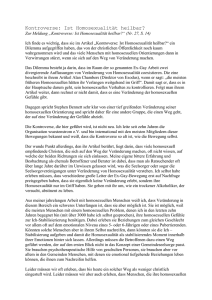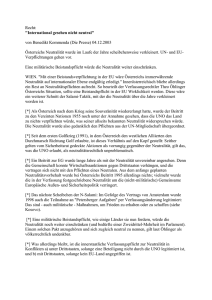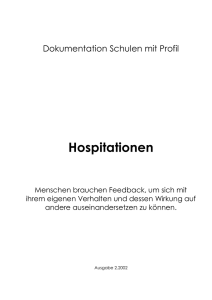Beide Thesen halten jedoch
Werbung

Im aktuellen PROFIL profil 47/05 » zur PROFIL Startseite Eigentum braucht Kontrolle Das Refco-Debakel und der Rücktritt des Bawag-Chefs machen deutlich, dass der ÖGB ein denkbar schlechter Eigentümer von Wirtschaftsunternehmen ist. Ein Unternehmen versenkt hunderte Millionen, weil das Management leichtgläubig und überhastet agiert hat, worauf der Vorstandsvorsitzende und die verantwortlichen Vorstände gefeuert werden. Kommt auf der ganzen Welt gelegentlich mal vor. Ein Unternehmen versenkt hunderte Millionen, weil das Management leichtgläubig und überhastet agiert hat, worauf der Chef des Ladens und die zuständigen Manager ihre Rücktritte anbieten, welche vom Aufsichtsrat erleichtert angenommen werden. Kommt auch immer wieder vor. Ein Unternehmen versenkt hunderte Millionen, weil das Management leichtgläubig und überhastet agiert hat, worauf der Generaldirektor seinen Rücktritt nicht nur anbietet, sondern sein Amt definitiv niederlegt, die ebenfalls verantwortlichen Vorstände ihre Funktionen aber behalten und der Aufsichtsratschef den Eindruck erweckt, als sei er ehrlich betrübt, dass es ihm nicht gelungen ist, den amtsmüden und glücklosen Chef, der die Verantwortung für ein wirtschaftliches Debakel übernimmt, von seiner Demission abzubringen. Kommt nur bei der Bawag vor. Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass der Österreichische Gewerkschaftsbund als Eigentümer von Wirtschaftsunternehmen gänzlich ungeeignet ist, dann hätten ihn die Affäre um den Refco-Blitzkredit der Bawag sowie die bemerkenswerten Begleitumstände des Rücktritts von Bawag-Chef Johann Zwettler eindrücklich geliefert. Die Bawag ist das Paradebeispiel eines Unternehmens, das immer wieder in Kalamitäten gerät, weil es von einem inkompetenten Eigentümer kontrolliert wird – oder, präziser formuliert, nicht kontrolliert wird. Die Führung des ÖGB versteht vom Bankgeschäft eher wenig. Das ist den Gewerkschaftsführern nicht vorzuhalten. Dass sie es aber angesichts eines solchen eklatanten Mangels an Expertise – immer noch – als geeignete Vermögensveranlagung betrachten, ein größeres Kreditinstitut zu betreiben, überschreitet die Grenze der Fahrlässigkeit signifikant. Schon als De-facto-Eigentümer des Konsum hat der ÖGB versagt, bis der Handelskonzern schließlich ein Fall für den Konkursrichter war. Letzteres Schicksal droht der Bawag keineswegs. Doch das Institut geriet nicht zum ersten Mal wegen seltsamer Geschäftspraktiken, großzügiger Auslegung bankrechtlicher Bestimmungen oder seltsamer persönlicher Naheverhältnisse zu defraudanten Kunden in die Schlagzeilen. Ein solches Missgeschick kann in jedem Unternehmen vorkommen. Geschieht Derartiges allerdings wiederholt, dann sind mangelnde Aufsicht, ungeeignete Geschäftsordnungen und falsche Personalentscheidungen die Ursache. Und für diese trägt der Eigentümer die Verantwortung. Der ÖGB ist freilich keineswegs der einzige Eigentümer, der für die Rolle als Eigentümer größerer Unternehmen konstitutionell ungeeignet ist. Ähnliches gilt für die öffentliche Hand, wie etwa die Desaster der verstaatlichten Industrie eindrücklich vor Augen geführt haben. Die ehemals verstaatlichten Unternehmen florierten erst dann, als sie zunehmend in die Freiheit entlassen und damit der Kontrolle der Kapitalmärkte übergeben wurden. Und für de facto eigentümerlose Unternehmen wie Sparkassen und Genossenschaften gilt dem Grunde nach Ähnliches. Auch die Erste Bank florierte beispielsweise erst dann wirklich, als sie sich dem Erfolgsdruck, aber auch der Kontrolle des Kapitalmarkts aussetzte. Vereine, politische Parteien, Interessenvertretungen, Gebietskörperschaften und Genossenschaften versagen als Eigentümer großer Unternehmen überdurchschnittlich oft. Und tun sie es nicht, dann vor allem deshalb, weil in den verantwortlichen Positionen glücklicherweise unternehmerisch begabte Personen am Werk sind. Große Unternehmen brauchen kompetente Eigentümer, die Richtlinien und Kompetenzen festlegen, die wichtige Investitionsentscheidungen sachkundig beurteilen, die geeignete Manager auswählen und ungeeignete zeitgerecht abberufen. Existiert ein solcher Eigentümer nicht in Form einer Person, einer Konzernholding oder einer versierten Investmentgesellschaft, bleibt immer noch der Gang an die Börse. Wäre die Bawag ein börsenotiertes Unternehmen, dann hätten Aktienanalysten und Fondsmanager längst auf der Festschreibung einer klaren Geschäftsordnung insistiert, hätten bei der Vergabe von Großkrediten auf striktere Regeln und auch deren Einhaltung bestanden und hätten wohl auch bereits früher ihre Zweifel daran geäußert, ob Johann Zwettler wirklich der beste Mann an der Spitze des Instituts ist. Und die von ihnen ausgewählten Aufsichtsräte hätten, wäre dennoch ein geschäftlicher Betriebsunfall in Dimensionen des Refco-Blitzkredits passiert, vermutlich schon wenige Tage nach Auffliegen der Affäre personelle Konsequenzen – auch bezüglich der ebenfalls involvierten weiteren Vorstandsmitglieder – gefordert, anstatt dem Management wochenlang die Mauer zu machen und sich dann von der Demission des Vorstandsvorsitzenden überraschen zu lassen. Der ÖGB sollte daher ehebaldigst seine Bawag-Aktien zur Gänze oder jedenfalls großteils abgeben, den Verkaufserlös professionellen Vermögensverwaltern zur Veranlagung anvertrauen und sich mit der Tatsache abfinden, dass es im 21. Jahrhundert nicht mehr Aufgabe von Gewerkschaften ist, ein Kreditinstitut zu betreiben. * Artikel schicken * Artikel drucken Profil # » Aboservice # » Covergalerie # » Inhaltsverzeichnis # » Cartoongalerie # » Webdownload # » MAGAZIN AWARD Meinungen ·Leitartikel: Stefan Janny Eigentum braucht Kontrolle ·Elfriede Hammerl Wunschkinder ·Georg Hoffmann-Ostenhof Der Fall Irving ·Peter Michael Lingens War der Irak-Krieg doch berechtigt? ·Rainer Nikowitz Und – bamm! profil 47/05 ·Ende der Debatte: Andersrum? Natürlich! Homosexualität ist biologisch determiniert ·Bank für Arglosigkeit und Wegschauen Warum Zwettlers Rücktritt die Krise nicht entschärft ·Die oberen Sechzigtausend: Umverteilung Wie müsste gerechte Steuerpolitik aussehen? ·Wohnungseinbruch: Auf Biegen & Brechen Die Polizei bläst zur Jagd auf Einbrecherbanden ·Neues Deutschland: Hofübergabe in Berlin Diese Woche beginnt eine neue politische Ära ·Interview: „Der Wille zur Auslöschung“ André Glucksmann über sein neues Buch „Hass“ ·Der Foltergeist: US-Regierung in Bedrängnis Die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt TOPNEWS auf networld.at21.11.2005 09:11 Uhr ·ÖGB gibt heute neuen BAWAG-Chef bekannt Nach Refco-Affäre trat Johann Zwettler zurück ·Knalleffekt: Ariel Sharon gründet neue Partei Verlässt nach Scheitern der Regierung Likud-Block ·Liga-Krimi nach GAK-Triumph über Salzburg Top 5-Vereine nur durch vier Pünktchen getrennt ·Moshammer-Mord: Heute Urteil erwartet! Täter hat gestanden: War es Mord oder Totschlag? ·"Werde mit 50 noch auf der Bühne stehen" Christina Stürmer im großen TV-MEDIA-Talk! zurück zur Startseite 1995-2005 © News Networld Internetservice AG | Impressum | AGB | Jobs @ News | Tarife Online | Tarife – Print Im aktuellen PROFIL profil 47/05 » zur PROFIL Startseite Wunschkinder Ein Fernsehspot der Regierung suggeriert uns paradiesische Zustände. Unsere gegenwärtige Regierung gibt viel Geld für Werbekampagnen aus, die uns suggerieren sollen, dass wir ihrem segensreichen Wirken ein paradiesisches Leben verdanken (auch wenn wir bisher nichts davon gemerkt haben, aber eben deshalb muss es uns ja gesagt werden). Zum Beispiel führt uns ein TV-Spot zurzeit vor Augen, dass Kinderreichtum super problemlos ist und spielend vereinbar mit Berufstätigkeit, weil es ja Kindergeld und – begrenzte – Zuverdiensterlaubnis gibt. Der Spot zeigt ein perfekt gestyltes junges Elternpaar in schickem Ambiente, das entspannt Zeitung liest, während perfekt gestylte Kinder, fünf an der Zahl, es dekorativ umlagern. „Bin ich ein Wunschkind?“, fragen die Kinder nacheinander, und die Mutter antwortet jedesmal gütig: „Ja, du bist unser Wunschkind!“ Danach Schnitt und Szenenwechsel ins Berufsleben: Mutter sitzt jetzt entspannt an einem Schreibtisch, die Kinderschar lächelt ihr von einem Foto zu. So einfach ist das heutzutage. Fragt sich nur: was eigentlich? Die Vereinbarkeit von Reichtum und Kinderreichtum? Die war noch nie ein Problem. Soll heißen: Bestimmt gibt es da und dort tatsächlich fünffache Eltern, die sorglos ein entspanntes Familienleben genießen sowie interessanten Berufstätigkeiten nachgehen können – mit einem entsprechenden Vermögen im Hintergrund lässt sich vieles delegieren, managen, zukaufen, lösen. Aber uns einreden zu wollen, dass derartiger Wohlstand von Kindergeld und Zuverdiensterlaubnis kommt, ist verwegen. Ich schreibe bewusst Zuverdiensterlaubnis statt Zuverdienstmöglichkeit, denn an der Möglichkeit des Verdienens hapert es allenthalben. Rundum im Land fehlen Arbeitsplätze, Kindergärten, Ganztagsschulen. Jeder Mensch, der auch nur ein Kind zu versorgen hat, weiß, was Zahnregulierungen, Skikurse, Musikstunden oder Sprachferien kosten und wie eine zeitgemäße elektronische Grundausstattung zu Buche schlägt, die von Schulen zunehmend als Arbeitserfordernis vorausgesetzt wird. Gleichzeitig steigt die Zahl der Armen in Österreich, die mangels verfügbarer Mittel ausgeschlossen sind von der Teilnahme am üblichen gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Diese Armen finden sich vermehrt unter Alten und – Kindern. Nun kann man durchaus darüber diskutieren, in welchem Ausmaß ein Staat verpflichtet und in der Lage ist, die Realisierung von Kinderwünschen zu ermöglichen. Müssen alle Leute jederzeit sorglos beliebig viele Kinder kriegen können, oder darf die Gesellschaft verlangen, dass künftige Eltern ihre Fortpflanzungspläne auf ihren jeweiligen Ausbildungs- und Einkommensstatus abstimmen, und wenn ja, in welchem Umfang? Darauf wird es je nach politischem Standort unterschiedliche Anworten geben. Aber was ist von einer Politik zu halten, die einerseits unter dem Stichwort Eigenverantwortung jedes Lebensrisiko privatisieren will und gleichzeitig Kinderreichtum propagiert, mit der – unwahren – Behauptung, er sei durch staatliche Maßnahmen finanziell abgesichert, und zwar so sehr, dass ein entspanntes Luxusleben dabei herausschaut? Welche Zielgruppe soll damit für blöd verkauft werden? Eltern, damit sie ihre finanziellen Engpässe ab sofort nur mehr ihrem persönlichen Unvermögen zuschreiben? Mütter, damit sie ihre Erschöpfung von jetzt an als Wahrnehmungsstörung katalogisieren? Jungwählerinnen, damit sie schnell schwanger werden, ehe sie draufkommen, dass Kinder keine sprechenden Puppen sind? Und wem würde es helfen, wenn es plötzlich Kinderscharen gäbe, die, im Vertrauen auf falsche Versprechungen in die Welt gesetzt, nun doch nicht versorgt werden könnten? Dass Regierungen ihre Maßnahmen schönreden wollen, ist nicht neu. Doch die Diskrepanz zwischen behaupteten Errungenschaften und der Realität nimmt inzwischen eine Dimension an, die das Maß des Erträglichen übersteigt. Was kommt als Nächstes? Vielleicht das: „Mama, stimmt es, dass ich nie mehr krank werden kann?“ „Ja, mein Schatz, die e-card bedeutet Gesundheit und ewiges Leben!“ Und apropos Wahrnehmung: Einige Zeitungen veröffentlichten kürzlich eine Liste der Berufe, die unter die Schwerarbeiterregelung fallen sollten. Die Berufsbezeichnungen: großteils männlich, für Tätigkeiten, die vorwiegend Männer ausüben (Eisenbieger), aber auch für solche, die Männer und Frauen ausüben (Landarbeiter, Küchengehilfen, Winzer), und sogar für Tätigkeiten, die vorwiegend Frauen ausüben (Chemischputzer, Wäscher); weiters geschlechtsneutral für Tätigkeiten, die vorwiegend Frauen ausüben (Krankenpflegefachdienst, Intensivpflege, Reinigungspersonal); und sowohl männlich wie auch weiblich für eine einzige Berufsgruppe: Kellner/in. Was lernen wir daraus? Dieses: Schwerarbeit ist männlich. Frauen erbringen gerade noch als bierkrügelschleppende Kellnerinnen schweißtreibende Leistungen, aber ansonsten sind sie fein heraus und geben sich luftigen, leichten Beschäftigungen hin, während sich Männer als Wäscher und Intensivpfleger plagen. So werden Vorurteile perpetuiert. Nein, das ist keine Haarspalterei, sondern eine Frage des Sehenwollens. Bierkrügel heranschleppende Kellnerinnen will Mann offenbar sehen. Sogar beim Erstellen von Berufslisten. * Artikel schicken * Artikel drucken Profil # » Aboservice # » Covergalerie # » Inhaltsverzeichnis # » Cartoongalerie # » Webdownload # » MAGAZIN AWARD Meinungen ·Leitartikel: Stefan Janny Eigentum braucht Kontrolle ·Elfriede Hammerl Wunschkinder ·Georg Hoffmann-Ostenhof Der Fall Irving ·Peter Michael Lingens War der Irak-Krieg doch berechtigt? ·Rainer Nikowitz Und – bamm! profil 47/05 ·Ende der Debatte: Andersrum? Natürlich! Homosexualität ist biologisch determiniert ·Bank für Arglosigkeit und Wegschauen Warum Zwettlers Rücktritt die Krise nicht entschärft ·Die oberen Sechzigtausend: Umverteilung Wie müsste gerechte Steuerpolitik aussehen? ·Wohnungseinbruch: Auf Biegen & Brechen Die Polizei bläst zur Jagd auf Einbrecherbanden ·Neues Deutschland: Hofübergabe in Berlin Diese Woche beginnt eine neue politische Ära ·Interview: „Der Wille zur Auslöschung“ André Glucksmann über sein neues Buch „Hass“ ·Der Foltergeist: US-Regierung in Bedrängnis Die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt Im aktuellen PROFIL profil 47/05 » zur PROFIL Startseite Der Fall Irving Wie gefährlich ist der in Österreich verhaftete britische Nazi-Historiker wirklich? Am 10. April 2000 verkündete der britische Richter Justice Gray: „David Irving hat aus ideologischen Gründen bewusst die historischen Fakten manipuliert. Er hat Hitler in ein günstiges Licht gerückt, insbesondere was dessen Verantwortung für den Genozid an den Juden betrifft. Herr Irving ist ein aktiver Holocaust-Leugner, antisemitisch und rassistisch eingestellt und steht in Verbindung mit neonazistischen Rechtsextremisten.“ Der britische Geschichtswissenschafter David Irving hatte die US-Historikerin Deborah Lipstadt geklagt, weil sie ihn beschuldigt hatte, die Judenvernichtung im Dritten Reich abgestritten und in seinen Büchern die Geschichte gefälscht zu haben. In einem spektakulären 62-tägigen Prozess wurde Irving genau das minutiös nachgewiesen und in einer 334 Seiten langen Urteilsbegründung seine Klage abgeschmettert. Die Reputation jenes Mannes, der lange Zeit als seriöser Historiker gegolten hatte, war endgültig zerstört. Er musste die Gerichtskosten von zwei Millionen britischen Pfund zahlen, privaten Bankrott anmelden und sein Luxus-Apartment im Londoner Nobelviertel Mayfair aufgeben. Nun sitzt er in einem Wiener Gefängnis. Die Handschellen klickten, als er vergangene Woche von der Steiermark aus nach Wien fahren wollte, um bei der Burschenschaft Olympia einen Vortrag über Adolf Eichmann zu halten. Ihm drohen mehrere Jahre Haft. Irving wurde aufgrund eines österreichischen Haftbefehls aus dem Jahr 1989 wegen des Verdachts der Wiederbetätigung festgenommen. Er hatte im Parkhotel Schönbrunn einen Vortrag gehalten und gegenüber der damaligen „AZ“-Redakteurin Christa Zöchling (jetzt profil) in einem Interview den Massenmord an den Juden als „Hirngespinst“ bezeichnet. Daraufhin war die Staatsanwaltschaft aktiv geworden. Kein Zweifel, die Tatsache, dass dieser Nazi-Oberungustl hinter Schloss und Riegel sitzt, erweckt freudige Gefühle. Nicht nur bei Antifaschisten, auch bei ganz gewöhnlichen Patrioten. So oft kommt ja Österreich nicht in die internationalen Schlagzeilen. Und normalerweise scheint unser Land meist nur dann in den Weltmedien auf, wenn wieder einmal bewiesen wird, dass da die Beziehung zur dunklen Vergangenheit gestört ist, oder antisemitische oder rechtsradikale Sprüche von Repräsentanten des Staates losgelassen werden. Österreich machte durch die Waldheim-Affäre Furore. Jörg Haider mit seinen einschlägigen Ausrutschern wurde in seiner Aufstiegsphase zum global anerkannten Bösewicht. Die Bildung der schwarz-blauen Regierung schien das negative Österreich-Image zu bestätigen. Und selbst die Kampls, Gudenusse, Straches und Stadlers sind noch gut für süffige kleine Meldungen in den Kurz-notiert-Spalten der ausländischen Zeitungen. Die Irving-Verhaftung in Österreich, die nun von Chile bis Kanada, von Ungarn bis zu den USA und von Bangladesch bis Belgien kolportiert wird, ist durchaus dazu angetan, Österreich in der Weltöffentlichkeit ein wenig zu rehabilitieren. In den Artikeln über das Ereignis schwingt meist Respekt davor mit, dass diese oft als „Nazi-Land“ karikierte mitteleuropäische Republik nun den gefährlichen Neonazi-Agitator dingfest gemacht hat. Aber wie gefährlich ist David Irving wirklich? Abstoßender könnte wohl kaum jemand sein als einer, der meint, Hitler hätte nichts von der Ermordung der Juden gewusst, der behauptet, dass es „kein bisschen Evidenz“ für die „Endlösung der Judenfrage“ gebe, dass die Gaskammern von Auschwitz nicht existiert hätten. Es ist auch sicher, dass das nicht bloße Falschaussagen über die Geschichte sind, sondern dass sie als ganz bewusste rechtsradikale Agitation gewertet werden müssen. Aber wer glaubt denn diesen „revisionistischen“ Unsinn? Besteht wirklich die Gefahr, dass solche Ideen irgendwo in breiteren Teilen der Bevölkerung Fuß fassen. Vielleicht ist das zu optimistisch: Aber zumindest in unseren Breiten ist die historische Tatsache des Holocaust ungefähr so fest im allgemeinen Bewusstsein verankert wie die Erkenntnis, dass die Erde eine Kugel und keine Scheibe ist. Die Vertreter der „Auschwitzlüge“ sind maximal kleine verrückte rechtsradikale Sekten, die aber ohne großen Einfluss bleiben. Vergleichbar mit jenen obskuren Kreisen, die der festen Überzeugung sind, dass die Mondlandung der Amerikaner nie stattgefunden habe, sondern in der Wüste Nevada inszeniert worden sei. Oder den Verrückten, die zu wissen glauben, der 11. September sei ein Werk der CIA oder des Mossad gewesen. Gewiss: Gerade in Österreich, dessen Gerichte noch in den sechziger Jahren wirkliche Kriegsverbrecher und Massenmörder laufen ließen, wo eine FPÖ des Jörg Haider Ende der neunziger Jahre fast zur stärksten Partei wurde und dessen Wiedergänger heute nicht gänzlich erfolglos sind, ist es angezeigt, besonders wachsam zu sein, wenn es um Nazi-Ideologie geht. Es ist beruhigend, dass etwa ein Narr wie John Gudenus Angst vor dem Kriminal haben muss. Und es ist den jetzt schon greisen Überlebenden der Konzentrationslager geschuldet, dass jene, die ihr Leiden verleugnen, nicht fröhlich und ungestraft herumlaufen können. Trotzdem werden früher oder später die Fragen gestellt werden müssen, ob wie auch immer bös motivierte Behauptungen über die Geschichte wirklich mit mehreren Jahren Kerker bestraft werden müssen, ob das dem allgemeinen Rechtsempfinden entspricht und ob in gefestigten Demokratien der Kampf gegen barbarische Ideologien nicht eher politisch als gerichtlich geführt werden sollte. Die Fragen müssen erlaubt sein, gerade in einer Zeit, in der die Bürgerrechte unter dem Vorwand des „Kriegs gegen den Terrorismus“ allüberall in der westlichen Welt zunehmend eingeschränkt werden. * Artikel schicken * Artikel drucken Profil # » Aboservice # » Covergalerie # » Inhaltsverzeichnis # » Cartoongalerie # » Webdownload # » MAGAZIN AWARD Meinungen ·Leitartikel: Stefan Janny Eigentum braucht Kontrolle ·Elfriede Hammerl Wunschkinder ·Georg Hoffmann-Ostenhof Der Fall Irving ·Peter Michael Lingens War der Irak-Krieg doch berechtigt? ·Rainer Nikowitz Und – bamm! profil 47/05 ·Ende der Debatte: Andersrum? Natürlich! Homosexualität ist biologisch determiniert ·Bank für Arglosigkeit und Wegschauen Warum Zwettlers Rücktritt die Krise nicht entschärft ·Die oberen Sechzigtausend: Umverteilung Wie müsste gerechte Steuerpolitik aussehen? ·Wohnungseinbruch: Auf Biegen & Brechen Die Polizei bläst zur Jagd auf Einbrecherbanden ·Neues Deutschland: Hofübergabe in Berlin Diese Woche beginnt eine neue politische Ära ·Interview: „Der Wille zur Auslöschung“ André Glucksmann über sein neues Buch „Hass“ ·Der Foltergeist: US-Regierung in Bedrängnis Die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt TOPNEWS auf networld.at21.11.2005 09:11 Uhr ·ÖGB gibt heute neuen BAWAG-Chef bekannt Nach Refco-Affäre trat Johann Zwettler zurück ·Knalleffekt: Ariel Sharon gründet neue Partei Verlässt nach Scheitern der Regierung Likud-Block ·Liga-Krimi nach GAK-Triumph über Salzburg Top 5-Vereine nur durch vier Pünktchen getrennt ·Moshammer-Mord: Heute Urteil erwartet! Täter hat gestanden: War es Mord oder Totschlag? ·"Werde mit 50 noch auf der Bühne stehen" Christina Stürmer im großen TV-MEDIA-Talk! zurück zur Startseite 1995-2005 © News Networld Internetservice AG | Impressum | AGB | Jobs @ News | Tarife Online | Tarife – Print Im aktuellen PROFIL profil 47/05 » zur PROFIL Startseite War der Irak-Krieg doch berechtigt? Die Wiener Konferenz über den Islam in einer pluralistischen Welt vermittelt ein anderes Bild als die täglichen Terrormeldungen. Bis vor Kurzem habe ich meine vor zwei Jahren mit Gerd Bacher eingegangene Wette bereits verloren gegeben: Ich war der Meinung, die Intervention der USA habe dem Irak letztlich genutzt, er vertrat den Standpunkt, sie habe die Verhältnisse in Wirklichkeit zum Schlechteren gewendet. Die nicht enden wollende Serie von Attentaten schien ihm Recht zu geben. Aber am Ende der Wiener Konferenz über den „Islam in einer pluralistischen Welt“ zweifle ich, dass er auf lange Sicht Recht behält: Denn dass nach den 8,5 Millionen, die trotz des Terrors an den ersten Wahlen teilgenommen haben, mittlerweile 10,5 Millionen Iraker der neuen Verfassung zugestimmt haben, ist mehr als nur ein Silberstreifen am Horizont. Vor allem aber ist den Männern, die auf dieser Konferenz für den Irak gesprochen haben – der Präsident des Irak und Vorsitzende der patriotischen Union Kurdistans, Jalal Talabani, und der stellvertretende Präsident der irakischen Nationalversammlung, Hussain al Shahristani –, sehr wohl zuzutrauen, dass sie dieses überwältigende Votum der Bevölkerung nutzen können, um den Irak tatsächlich zu befrieden. Ich weiß nicht, ob uns die tägliche Berichterstattung über explodierende Autobomben und über explodierende Bush-Lügen nicht doch die Sicht auf die historische Entwicklung des Irak verstellt. Ja, die für die amerikanischen Wähler entscheidende Begründung für diesen Krieg – die Existenz von „Massenvernichtungswaffen“ und die Verbindungen Saddam Husseins zur alQa’ida – war erstunken und erlogen; ja, Bushs Vorbereitungen für die dem Waffengang folgende Befriedung des Irak waren ungenügend bis dilettantisch; ja, George Bushs Rhetorik im „Kampf gegen den Terror“ ist unerträglich. Aber kann man deshalb vom Tisch wischen, dass Talabani im „Standard“ erklärt: „Dieser Krieg war die einzige – wenn auch vielleicht nicht die beste – Methode, dem Leiden des irakischen Volkes ein Ende zu machen.“? Muss man nicht doch, wie das in Österreich einzig mein Kollege Christian Ortner getan hat, die laufenden Terrortoten des Irak in ein Verhältnis zu Talabanis glaubwürdiger Darstellung der Ära Saddam Husseins setzen? „Jährlich wurden tausende getötet. Das kurdische Volk war einer gezielten genozidalen Verfolgung ausgesetzt. Die Schiiten erlitten ebenso wie Turkmenen und Christen systematische Repression. Oppositionelle Sunniten wurden verfolgt, sobald sie die Stimme gegen Hussein erhoben. Das Baath-Regime war nicht nur eine Gefahr für die eigene Bevölkerung, sondern auch für die Welt: Hussein hat drei Kriege vom Zaun gebrochen und war bereit, noch weitere zu führen, um seine Macht zu erhalten.“ Es funktioniert nicht, Jalal Talabani als US-Marionette abzutun, die die Vergangenheit schlecht- und die Gegenwart schönzureden sucht: 8,5 Millionen Iraker haben diesen Mann unter Lebensgefahr gewählt. Man muss sich zumindest fragen, ob Bush, wenn auch ungeschickt, wenn auch aus den falschen Motiven und unter falschem Vorwand, nicht vielleicht doch das historisch Richtige getan hat. Dass dies möglich sein könnte, bestärkt auch die Wortmeldung des stellvertretenden Parlamentspräsidenten Shahristani, den man seit dem Votum für die neue Verfassung auch schwerlich als US-Marionette abtun kann: Er sei überzeugt, dass die Iraker zum vorgesehenen Zeitpunkt an den ersten Wahlen gemäß der neuen Verfassung teilnehmen würden – die Sunniten, die die bisherigen Wahlgänge boykottiert haben, stellten derzeit bereits Kandidaten auf. Zwar würde der Terror sich möglicherweise bis zum Wahlgang noch weiter verstärken – weil die Terroristen ihn mit allen Mitteln verhindern wollen –, aber die Bevölkerung würde sich auch dadurch nicht abhalten lassen, an die Urnen zu gehen und dem Irak seine erste demokratisch gewählte, verfassungskonforme Regierung zu geben. Der Ausbau der eigenen Streitkräfte und der Polizei mache trotz des Terrors Fortschritte – in etwa einem Jahr würden sie die Sicherheit des Landes aus eigener Kraft garantieren können. Auch das ist nicht ganz so unmöglich, wie es klingt, wenn man die Worte des afghanischen Präsidenten Hamid Karzai auf der Wiener Konferenz zu Grunde legt: Auch in Afghanistan hat der Terror die jüngsten, nach Ansicht internationaler Beobachter korrekten Wahlen nicht verhindern können. Und immerhin haben sie in einem Land, in dem Frauen noch bis vor Kurzem wie Sklavinnen behandelt wurden, 71 weibliche Abgeordnete in ein Parlament mit 249 Sitzen befördert. Die Regierung hat noch immer nicht alle Teile des Landes unter Kontrolle – aber ihr Einfluss ist trotz terroristischer Übergriffe stetig gewachsen. Zweifellos ist es ein erheblicher Vorteil, dass die Europäer den USA dort bei der Befriedung des Landes zu Hilfe gekommen sind. Ich glaube, dass sie ihre verweigernde Haltung gegenüber dem Irak nicht zuletzt im Lichte der Wiener Konferenz überdenken sollten: Auch wenn man George Bush, wie Gerd Bacher, eine massive politische Niederlage wünscht, sollte man darüber nicht vergessen, dass seine Kriegslüsternheit den Menschen im Irak eine historische Chance eröffnet hat und dass sie unser aller Hilfe verdienen, sie erfolgreich wahrzunehmen. * Artikel schicken * Artikel drucken Profil # » Aboservice # » Covergalerie # » Inhaltsverzeichnis # » Cartoongalerie # » Webdownload # » MAGAZIN AWARD Meinungen ·Leitartikel: Stefan Janny Eigentum braucht Kontrolle ·Elfriede Hammerl Wunschkinder ·Georg Hoffmann-Ostenhof Der Fall Irving ·Peter Michael Lingens War der Irak-Krieg doch berechtigt? ·Rainer Nikowitz Und – bamm! profil 47/05 ·Ende der Debatte: Andersrum? Natürlich! Homosexualität ist biologisch determiniert ·Bank für Arglosigkeit und Wegschauen Warum Zwettlers Rücktritt die Krise nicht entschärft ·Die oberen Sechzigtausend: Umverteilung Wie müsste gerechte Steuerpolitik aussehen? ·Wohnungseinbruch: Auf Biegen & Brechen Die Polizei bläst zur Jagd auf Einbrecherbanden ·Neues Deutschland: Hofübergabe in Berlin Diese Woche beginnt eine neue politische Ära ·Interview: „Der Wille zur Auslöschung“ André Glucksmann über sein neues Buch „Hass“ ·Der Foltergeist: US-Regierung in Bedrängnis Die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt TOPNEWS auf networld.at21.11.2005 09:11 Uhr ·ÖGB gibt heute neuen BAWAG-Chef bekannt Nach Refco-Affäre trat Johann Zwettler zurück ·Knalleffekt: Ariel Sharon gründet neue Partei Verlässt nach Scheitern der Regierung Likud-Block ·Liga-Krimi nach GAK-Triumph über Salzburg Top 5-Vereine nur durch vier Pünktchen getrennt ·Moshammer-Mord: Heute Urteil erwartet! Täter hat gestanden: War es Mord oder Totschlag? ·"Werde mit 50 noch auf der Bühne stehen" Christina Stürmer im großen TV-MEDIA-Talk! zurück zur Startseite 1995-2005 © News Networld Internetservice AG | Impressum | AGB | Jobs @ News | Tarife Online | Tarife – Print Im aktuellen PROFIL profil 47/05 » zur PROFIL Startseite Und – bamm! Ewald Stadler und Heinz-Christian Strache besuchen den Lifeball, um homosexuelle und andere perverse Partnerschaften zu studieren. Stadler: Sie da! Sie Perversling! Nein, der andere! Wenn Ihre Mutter wüsste, was Sie da treiben, die gäb glatt ihr Kreuz zurück! Strache: Was war des, was der da anghabt hat? Stadler: I weiß nit genau. Ausgschaut hat’s wie eine Feldmaus. Strache: Des a no! Schwul und a Sodamit! Stadler: Sodomit. Strache: Ah so? Na ja. Du hast des Hirn, i des Gsicht. Stadler: Ich könnt’s ja no verstehen, wenn’s a fescher deutscher Schäferhund wär. Aber eine Maus … Strache: Was is eigentlich aus dem gesunden, sauberen Sex unserer Jugend worden? Du fragst eine, ob sie deinen Säbel sehen will, schleppst sie auf die Bude, füllst sie ab und – bamm! Stadler: Und dass diese Kranken überhaupt kein natürliches Schamgefühl haben. I mein, anständige Leut drehen ja sogar zu Haus das Licht ab, wenn … na, du weißt schon. Strache: Na ja, a net immer, oder? Stadler: Also i war da immer konsequent. Alle fünfmal. Strache: Schau, is des dort, glaubst, a Lesben? De is so schiach. Stadler: Nein. Das isch doch der Hilmar mit seiner Biene-Maja-Perücke. Weißt eh, der Undercover-Sicherheitscheck! Strache: Ah ja! Äh …, is das eine Pfauenfeder in seinem … dings? Stadler: Also …, das isch ja … In die muss er irgendwie reingerannt sein, der Arme. Wie damals in die Torte. Strache: Da – der Häupl. Und is des net der Elton John neben ihm? Stadler: Na, des trifft sich ja ausgezeichnet. Sie da! Sie Perversling! Nein, der andere! * Artikel schicken * Artikel drucken Profil # » Aboservice # » Covergalerie # » Inhaltsverzeichnis # » Cartoongalerie # » Webdownload # » MAGAZIN AWARD Meinungen ·Leitartikel: Stefan Janny Eigentum braucht Kontrolle ·Elfriede Hammerl Wunschkinder ·Georg Hoffmann-Ostenhof Der Fall Irving ·Peter Michael Lingens War der Irak-Krieg doch berechtigt? ·Rainer Nikowitz Und – bamm! profil 47/05 ·Ende der Debatte: Andersrum? Natürlich! Homosexualität ist biologisch determiniert ·Bank für Arglosigkeit und Wegschauen Warum Zwettlers Rücktritt die Krise nicht entschärft ·Die oberen Sechzigtausend: Umverteilung Wie müsste gerechte Steuerpolitik aussehen? ·Wohnungseinbruch: Auf Biegen & Brechen Die Polizei bläst zur Jagd auf Einbrecherbanden ·Neues Deutschland: Hofübergabe in Berlin Diese Woche beginnt eine neue politische Ära ·Interview: „Der Wille zur Auslöschung“ André Glucksmann über sein neues Buch „Hass“ ·Der Foltergeist: US-Regierung in Bedrängnis Die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt TOPNEWS auf networld.at21.11.2005 09:11 Uhr ·ÖGB gibt heute neuen BAWAG-Chef bekannt Nach Refco-Affäre trat Johann Zwettler zurück ·Knalleffekt: Ariel Sharon gründet neue Partei Verlässt nach Scheitern der Regierung Likud-Block ·Liga-Krimi nach GAK-Triumph über Salzburg Top 5-Vereine nur durch vier Pünktchen getrennt ·Moshammer-Mord: Heute Urteil erwartet! Täter hat gestanden: War es Mord oder Totschlag? ·"Werde mit 50 noch auf der Bühne stehen" Christina Stürmer im großen TV-MEDIA-Talk! zurück zur Startseite 1995-2005 © News Networld Internetservice AG | Impressum | AGB | Jobs @ News | Tarife Online | Tarife – Print Im aktuellen PROFIL profil 47/05 » zur PROFIL Startseite Debatte: Ist Homosexualität angeboren oder Produkt besonderer Lebensumstände? * Seriöse Wissenschafter sind sich heute einig: * Die sexuelle Orientierung ist biologisch determiniert [Bild: AP/ZAK] mehr zur Story ·„Anbiederung an den Zeitgeist“ Interview mit Volksanwalt Ewald Stadler, FPÖ Ist Homosexualität angeboren oder ein Produkt besonderer Lebensumstände? Seriöse Wissenschafter sind sich heute einig: Gleichgeschlechtliche Neigungen sind biologisch determiniert – auch wenn es kein Schwulen-Gen oder Lesben-Hormon gibt. Jakob ist vier Jahre alt und wäre lieber ein Mädchen. „Wegen der schönen Kleider, die sie haben“, sagt er. Das Batman-Kostüm seines Freundes findet er fad. Aber wenn seine sechsjährige Schwester Lena bunte Tücher und Prinzessinnengewänder aus der Verkleidungskiste holt, will Jakob auch Prinzessin sein. Die Eltern sehen es gelassen: Wenn Jakob Buntes lieber hat, so meinen sie, dann soll er Buntes tragen. Auch im Kindergarten. Auch auf dem Spielplatz. Die Lockerheit von Jakobs Eltern ist nicht selbstverständlich, denn die Vorstellungen darüber, wie sich Buben und Mädchen „richtig“ zu verhalten haben, sind noch immer sehr strikt. Viele Eltern befürchten, dass ihr Sohn einmal schwul oder ihre Tochter lesbisch werden könnte. Und tatsächlich ist es erwiesen, dass so genannte „Sissy-Boys“ wie Jakob – und extrem burschikose Mädchen desgleichen – mit einer vielfach höheren Wahrscheinlichkeit später homosexuell leben – ein Horrorszenario etwa für den freiheitlichen Volksanwalt Ewald Stadler, der sich vergangene Woche nachdrücklich gegen die Anerkennung von „homosexuellen und anderen perversen Partnerschaften“ aussprach. Über die Wurzeln der homosexuellen Orientierung herrscht bereits seit einem Jahrhundert ein erbitterter Streit zwischen den wissenschaftlichen Lagern. Im Groben stehen sich zwei Ansichten gegenüber: Die biologisch-medizinische Richtung sucht nach Angeborenem – körperlichen Merkmalen wie Genen oder frühen Hormoneinflüssen, die das sexuelle Empfinden prägen. Die soziologisch-kulturwissenschaftliche Fraktion stellt das gesellschaftliche und familiäre Umfeld, durch das Verhalten, Gefühle und Meinungen jedes Menschen geformt werden, in den Vordergrund. Konsequenz dieser These waren viele verzweifelte Selbstanklagen wegen „Erziehungsfehlern“ und teils grausame Versuche, dieses Verhalten zu ändern und die „fehlgeleiteten“ erotischen Gefühle in einem Umerziehungslager wieder in die „rechten“ Bahnen zu lenken. Noch heute finden sich radikale Vertreter dieser These wie beispielsweise die deutsche Medizinerin Christl Vonholdt, Vorsitzende des fundamental-christlich orientierten „Instituts für Jugend und Gesellschaft“. Der Salzburger Weihbischof Andreas Laun etwa hält Vonholdt für die „kompetenteste und beste Kennerin der Homosexualität“. Deren Ursachen, so die Medizinerin, lägen tief in der Kindheit verborgen. „Homosexuell empfindende Männer sind in ihren frühen männlichen Beziehungen zum Vater verletzt worden und ziehen sich in Folge von der Männlichkeit zurück“, erklärt Vonholdt. Auch die Mütter bekommen ihr Fett ab: „Sie vermitteln den Jungen ein negatives Bild von Männlichkeit, nehmen sie emotional gegen den Vater ein und können ihre Söhne nicht loslassen.“ Psychoknick. Diese klassischen Thesen vom „abwesenden Vater“ und der „überfürsorglichen Mutter“ gehen auf Sigmund Freud zurück. Hätte er Recht gehabt, müssten Buben, deren Väter sich psychisch und körperlich distanzieren, mit höherer Wahrscheinlichkeit schwul werden. Auch für lesbische Empfindungen hält die Psychoanalyse nach Freud gewagte Theorien parat: Demnach führt der Wunsch, auch einen Penis zu haben, so wie Vater oder Bruder, zu einer überpositiven Besetzung der Männlichkeit und einer inneren Rebellion gegen die weibliche Rolle. Folgerichtig müssten Frauen mit Brüdern öfter lesbisch werden. „Beide Thesen halten jedoch der Wirklichkeit nicht stand“, schreibt der britische Sexualpsychologe Glenn Wilson in seinem eben erschienenen Buch „Born Gay“ (Peter Owen Publishers, 2005): „Man kann die psychoanalytischen Thesen zur Homosexualität getrost als eine Art Partytrick ansehen, unterhaltsam wie Kartenlesen – aber jenseits aller Wissenschaft.“ Unmittelbar aus diesem Gedankengut wird auch gern die Fama von der Gefahr der Verführung zur Homosexualität abgeleitet: dass ein Kontakt zu einem älteren Sexualpartner genüge, um ansteckend zu wirken – eine Art Dracula-Effekt. Laut Vonholdt „wird der ungestillte ‚Vaterhunger des Kindes von älteren Männern missbraucht und führt geradewegs in die Homosexualität“. Mit solchen drastischen Thesen wurde auch in Österreich jahrzehntelang das Schutzalter der Burschen gerechtfertigt, das bis vor Kurzem noch bei 18 Jahren lag, vier Jahre über jenem der Mädchen. Wie wenig fundiert diese Theorie war und ist, zeigen beispielsweise jene Kulturen, in denen frühe gleichgeschlechtliche Kontakte durchaus üblich sind, der Anteil homosexueller Erwachsener jedoch trotzdem nicht höher liegt als anderswo. Das Klischee von der prinzipiellen Widernatürlichkeit homosexueller Praktiken hält einer seriösen biologischen Betrachtung nicht stand: Der in Seattle lebende Wissenschafter Bruce Bagemihl trug die Materialien ganzer Generationen von Tierbeobachtern zusammen und förderte ein gewaltiges Panoptikum homosexueller Liebesspiele zutage. Bei den von ihm beschriebenen 450 Tierarten sind sämtliche Paarungsmöglichkeiten dokumentiert: Männchen treiben es mit Männchen, Weibchen mit Weibchen, die meisten bi durcheinander, ein paar wenige exklusiv, jedenfalls viele eindeutig homosexuell. Warum es diese Neigungen überhaupt gibt, bleibt für Evolutionsgläubige freilich bis heute ein Rätsel. Ein Verhalten, das so offensichtlich nicht der Verbreitung der eigenen Gene dient, müsste dem landläufigen Verständnis nach aus einer zweckorientierten, fortpflanzungsfixierten Natur doch längst verschwunden sein. Biologen argumentieren nun, dass es in der Evolution eben weniger um das „survival of the fittest“ geht, wie Darwins Jünger meinten, sondern um das Erbgut der ganzen Sippe. Schwule und Lesben könnten demnach einen Überlebensvorteil für die Familie bringen, weil sie – selbst oft kinderlos – ihre Brüder und Schwestern bei der Aufzucht des Nachwuchses unterstützen; oder indem sie in Kriegs- und Krisenzeiten den Zusammenhalt gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften intensivieren. Dadurch hätten die Gene der eigenen Gruppe größere Überlebenschancen. Hirnforschung. Aber auch konkretere biologische Ansätze haben bislang nur wenig zur Erklärung der sexuellen Präferenzen bei Tieren und Menschen beigetragen. Ausgiebig wurden körperliche Merkmale vermessen, um einen Zusammenhang zur Homosexualität herzustellen: Penisgrößen und Fingerlängen, „schwule“ Innenohren und „lesbische“ Fingerabdrücke. Traditionell eine starke Rolle bei den biologischen Erklärungsversuchen spielt die Hirnforschung. Der US-Neurobiologe Simon LeVay sezierte die Gehirne von 35 verstorbenen Männern – 19 von ihnen schwul – und sechs heterosexuellen Frauen und verglich Größe und Zellenanzahl eines winzigen Teils des vorderen Hypothalamus, INAH 3 genannt. LeVay fand heraus, dass diese Region bei den schwulen Männern im Durchschnitt nur ein Drittel so groß war wie bei den untersuchten Gehirnen der Hetero-Männer. Damit entsprachen sie in etwa der durchschnittlichen Größe der weiblichen Areale. Er publizierte seine Studie Anfang der neunziger Jahre im renommierten Wissenschaftsjournal „Science“ – mit großem medialem Echo: Das Konzept vom homosexuellen, im Grunde also ‚weiblichen‘ Gehirn war geboren. In Fachkreisen jedoch stießen LeVays Erkenntnisse zunächst auf wenig Resonanz. Seine Studie wurde von niemandem wiederholt, und ihre methodischen Schwachstellen nährten Kritik. Von der Begrenztheit des Samples einmal abgesehen, wichen die Daten beispielsweise im Einzelnen von den Durchschnittsaussagen ab: Manche der schwulen Männer auf LeVays Seziertisch hatten deutlich größere INAH-3-Regionen als einige der heterosexuellen Männer und umgekehrt. Vor Kurzem bekam LeVay jedoch Rückenwind. Eine Forschergruppe aus Oregon zerlegte die Gehirne von toten Schafböcken, einer Tierart mit hohem Homosexuellen-Anteil: Fast zehn Prozent der Böcke verkehren sexuell ausschließlich mit anderen Männchen. Die Wissenschafter vermaßen eine Hypothalamus-Zellgruppe, die von ihrer Lage dem menschlichen INAH 3 entspricht, und erkannten, dass sie bei den Homo-Tieren tendenziell kleiner war als bei den Mutterschafen zugeneigten Böcken. Welche Schlüsse können aus solchen Studien gezogen werden? Dass die sexuelle Orientierung im Gehirn verankert ist – schon immer dort verankert war? Die Neurologin Sigrid Schmitz von der Uni Freiburg verweist auf die Plastizität des Gehirns: „Wir wissen heute, dass die Hirnstruktur von Erwachsenen keine vorgegebene Konstante ist.“ Das Gehirn verändert sich vielmehr das ganze Leben hindurch, vergleichbar mit einem Wegenetz: Wichtige Routen werden ausgebaut zu richtigen Autobahnen; daneben gibt es weniger befahrene Seitenstraßen und schmale Pfade. Unbenutzte Strecken verfallen. Selbst wenn in den Gehirnen Erwachsener also Unterschiede geortet werden, bleibt doch weiterhin ungeklärt, was zuerst da war: das „homosexuelle Gehirn“, das die Orientierung geprägt hat, oder umgekehrt ein Lebensstil, der die Hirnstruktur geformt hat. Wesentlich einfacher klang da die Erklärung, die 1993 weltweit Aufsehen erregte. Der amerikanische Genetiker Dean Hamer hatte das Schlagwort von dem „Schwulen-Gen“ geprägt – sehr zur Verwunderung des deutschen Sexualwissenschafters Martin Dannecker. „Seit über hundert Jahren glauben Homosexuelle, dass der gesellschaftliche Konflikt verschwindet, wenn sie nachweisen können, dass Homosexualität angeboren ist.“ Dahinter stehe das simple Erklärungsmuster: „Sieh her, ich kann nicht anders – es ist alles Veranlagung!“ Blutsbande. Es waren schließlich Studien an Zwillingen, die dem biologischen Ansatz doch den Weg ebneten. Eineiige Zwillinge sind natürliche Klone: Sie stimmen in ihren Erbanlagen zu 100 Prozent überein. Was an Eigenschaften durch Gene bestimmt wird, muss also auch bei beiden zum Vorschein kommen. Die bekanntesten Zwillingsstudien zum Thema stammen von Michael Bailey und Richard Pillard. Die Amerikaner befragten Zwillinge und Adoptivgeschwister zu ihren sexuellen Neigungen und stellten einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Nähe der Blutsbande und dem Sexualverhalten fest. War von eineiigen Zwillingsbrüdern einer schwul, fühlte sich in mehr als der Hälfte der Fälle auch der andere Bruder zu Männern hingezogen. Bei zweieiigen Zwillingsbrüderpaaren waren es dagegen 22 Prozent; war der Bruder adoptiert, gar nur elf Prozent. Ähnlich präsentierten sich die Erkenntnisse bei den Frauen: Bei 48 Prozent der Lesben mit eineiiger Zwillingsschwester war auch die Schwester lesbisch – im Vergleich zu gerade mal 16 Prozent unter zweieiigen Zwillingsschwestern. Damit gilt eine genetische Prädisposition für Homosexualität heute weithin als gesichert. Doch reicht sie als alleinige Erklärung nicht aus – sonst müssten eineiige Zwillinge immer die gleichen sexuellen Vorlieben haben wie ihre Brüder und Schwestern. Die meisten Wissenschafter stimmen heute darin überein, dass es sich nicht um ein einzelnes verantwortliches Gen handelt, sondern um wesentlich kompliziertere Regelkreise. „Stress spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Geschlechtshormone“, erklärt Wilson. In Tierstudien wurde gezeigt, dass sich die Wahrscheinlichkeit für homosexuellen Nachwuchs erhöht, je nachdem in welchen Entwicklungsstadien des Fötus die verschiedenen Einflüsse auftreten. „Man ist jedoch noch meilenweit davon entfernt, diese Prozesse tatsächlich zu verstehen, und niemand kann sie derzeit gezielt steuern.“ Die über so viel Biologie in der öffentlichen Wahrnehmung stark ins Abseits geratenen kultursoziologischen Wissenschaften tragen heute wesentlich zum Verständnis der Homosexualität in der Gesellschaft bei. Das beginnt schon bei der Deklaration der eigenen Sexualität. Hier gibt es allerdings viele Grauzonen: Bei einem persönlichen Interview fällt es vielen Menschen schwer, ehrlich zu antworten. Deshalb haben Wissenschaftler alle möglichen Kniffe entwickelt, um den Wahrheitsgehalt der Angaben zu objektivieren. Bei Männern gelingt dies relativ leicht, weil das Sexualorgan selbst vermessen werden kann. Den Probanden werden dabei diverse Bilder eindeutig homo- beziehungsweise heterosexuellen Inhalts gezeigt und mit dem Schwellvolumen des Penis korreliert. Wenn dieses dann auch noch zur Selbsteinschätzung passt, so erscheint die Antwort verlässlich. Verdrängung. Dabei ergaben sich auch überraschende Einsichten: Bei einer berühmt gewordenen Untersuchung von Henry Adams, Sexualwissenschafter an der Universität Georgia, wurde etwa die Einstellung zur Homosexualität abgefragt. Gerade jene Männer, die sich am feindseligsten dazu äußerten, zeigten bei den schwulen Bildern einen wesentlich stärkeren erektilen Impuls als Männer, die ein entspanntes Verhältnis zur Homosexualität pflegten. Damit wurde klar bewiesen, dass bei aggressiver Schwulenschelte auch eine Art Verdrängungsmechanismus mitschwingt. Bei Frauen sind objektive Messungen schwieriger, weil die Erregung nicht nach einem derart einfachen Muster zu bewerten ist und sich Parameter wie die „vaginale Durchblutung“ als höchst unzuverlässig erwiesen haben. Die meisten seriösen Studien verwenden deshalb eine Kombination der verschiedenen Messmethoden und versuchen, dadurch zu gültigen Aussagen zu kommen. Und hier zeigt sich quer durch alle Kulturen, dass der Anteil der gleichgeschlechtlichen Ausrichtung überraschend konstant ist. Bei einer Zufallsbefragung unter 5000 Norwegern im Alter von 18 bis 49 Jahre fand die Sexualwissenschafterin Bente Træen von der Universität Tromsø einen exklusiven Homosexuellen-Anteil von 3,3 Prozent bei Männern. Bei Frauen deklariert sich gerade eine von hundert eindeutig als Lesbe. Einen noch geringeren Anteil fand eine 2003 veröffentlichte Erhebung unter rund 900 Bewohnern der neuseeländischen Universitätsstadt Dunedin, die zum Zeitpunkt der Befragung allesamt 26 Jahre alt waren. Männer deklarieren sich eher mit eindeutigen Präferenzen, Frauen zeigen hingegen einen Hang zur Bisexualität. Immerhin jede zehnte Norwegerin und jede siebte Frau aus dem neuseeländischen Sample gaben an, dass sie im Lauf des vergangenen Jahres zumindest ein lesbisches Erlebnis gehabt hatten. Nicht einmal halb so viele Männer berichten Ähnliches. Und bei der Selbstdefinition als bisexuell herrscht unter Männern überhaupt Ebbe. Paradoxerweise hat gerade das Erstarken der Schwulenbewegung diesen Effekt verstärkt. Statt den ganzen Regenbogen der sexuellen Ausdrucksmöglichkeiten zu öffnen, hat die sexuelle Liberalisierung das strikte Entweder-oder eher zementiert. Lagerdenken. Noch 1970 gaben fast 20 Prozent der 16- und 17-jährigen Burschen an, schon einmal ein sexuelles Erlebnis mit einem anderen Jungen gehabt zu haben. Heute sind es angeblich gerade einmal zwei Prozent. „Jugendliche etikettieren heute gleichgeschlechtliche Erlebnisse sehr schnell als ‚schwul‘“, so der Hamburger Sexualwissenschafter Gunter Schmidt: Und als schwul will niemand gelten. „Früher hatte das ,Rumwichsen‘ nach dem Sport was völlig Normales“, bestätigt Christian Högl, Obmann der HOSI-Wien. „Heute weiß hingegen schon jeder 13-Jährige, dass das eine schwule Handlung ist.“ Wer sich dann aber trotzdem deklariert, steht vor einem weiteren Problem: Rund um die schwierige Entscheidung des Coming-out ist Eindeutigkeit besonders wichtig – und wird von der Community der Lesben und Schwulen auch regelrecht gefordert. „Klar hatten wir da ein sehr kritisches Auge drauf, wenn eine nach dem Outing wieder hetero wurde“, beschreibt die lesbische grüne Nationalratsabgeordnete Ulrike Lunacek diesen Zwiespalt. „Da kommen dann rasch Vorwürfe wie: ‚Sie hält dem Druck nicht stand‘ oder ‚Sie macht es sich einfach.‘“ – „Und es stimmt ja auch“, assistiert Christian Högl. „Heterosexualität ist ganz eindeutig bequemer.“ Die Selbstbeschreibung als bisexuell hat hingegen gar keinen guten Ruf. „Das gilt oft als zaghafter erster Schritt in die Szene“, sagt Högl. „Dann aber wird erwartet, dass man sich klar deklariert und dazu steht.“ Homosexualität gilt inzwischen unter allen seriösen Wissenschaftern als durch Therapie nicht veränderbar. Trotzdem wird das Selbstwertgefühl von Kindern, die ein wenig anders sind als die anderen, nach wie vor systematisch untergraben. Die Folgen sind dramatisch. Depressionen und Selbstmordversuche kommen bei homosexuellen Jugendlichen mindestens doppelt so häufig vor wie bei gleichaltrigen heterosexuellen. Vor allem die „weiblichen“ Männer sind gefährdet. Der kanadische Soziologe Pierre Trembley, der sich seit Jahren mit Suizid-Auslösern bei jungen Menschen beschäftigt, hat herausgearbeitet, dass mehr als die Hälfte der Selbstmordversuche von früheren „Sissy-Boys“ verübt werden. Wenn man diesen Menschen das Gefühl gibt, sie seien widernatürlich oder gar „pervers“ veranlagt, löst man sicher kein Problem – schon gar nicht jenes der Homosexualität, die von Natur aus gar kein Problem wäre, aber immer noch viel zu oft dazu gemacht wird. Nicht nur von Ewald Stadler. Mitarbeit: Thomas Hanifle Von Verena Ahne und Bert Ehgartner * Artikel schicken * Artikel drucken Profil # » Aboservice # » Covergalerie # » Inhaltsverzeichnis # » Cartoongalerie # » Webdownload # » MAGAZIN AWARD Meinungen ·Leitartikel: Stefan Janny Eigentum braucht Kontrolle ·Elfriede Hammerl Wunschkinder ·Georg Hoffmann-Ostenhof Der Fall Irving ·Peter Michael Lingens War der Irak-Krieg doch berechtigt? ·Rainer Nikowitz Und – bamm! profil 47/05 ·Ende der Debatte: Andersrum? Natürlich! Homosexualität ist biologisch determiniert ·Bank für Arglosigkeit und Wegschauen Warum Zwettlers Rücktritt die Krise nicht entschärft ·Die oberen Sechzigtausend: Umverteilung Wie müsste gerechte Steuerpolitik aussehen? ·Wohnungseinbruch: Auf Biegen & Brechen Die Polizei bläst zur Jagd auf Einbrecherbanden ·Neues Deutschland: Hofübergabe in Berlin Diese Woche beginnt eine neue politische Ära ·Interview: „Der Wille zur Auslöschung“ André Glucksmann über sein neues Buch „Hass“ ·Der Foltergeist: US-Regierung in Bedrängnis Die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt TOPNEWS auf networld.at21.11.2005 09:11 Uhr ·ÖGB gibt heute neuen BAWAG-Chef bekannt Nach Refco-Affäre trat Johann Zwettler zurück ·Knalleffekt: Ariel Sharon gründet neue Partei Verlässt nach Scheitern der Regierung Likud-Block ·Liga-Krimi nach GAK-Triumph über Salzburg Top 5-Vereine nur durch vier Pünktchen getrennt ·Moshammer-Mord: Heute Urteil erwartet! Täter hat gestanden: War es Mord oder Totschlag? ·"Werde mit 50 noch auf der Bühne stehen" Christina Stürmer im großen TV-MEDIA-Talk! zurück zur Startseite 1995-2005 © News Networld Internetservice AG | Impressum | AGB | Jobs @ News | Tarife Online | Tarife – Print Im aktuellen PROFIL profil 47/05 » zur PROFIL Startseite Affäre: Bank für Arglosigkeit und Wegschauen Warum der Rücktritt von Johann Zwettler die Krise der Bawag nach dem Refco-Debakel keineswegs entschärft. Johann Zwettler war der Erste, der aufstand: mit einer Attitüde, die so gar nicht zu ihm passen wollte. Zwettler – das war seit jeher der archetypische Bankbeamte gewesen. Daran hatte sich auch nichts geändert, als er vor nunmehr drei Jahren zum Generaldirektor der Bawag avanciert war, mithin zum Chef des nach der Bilanzsumme fünftgrößten Kreditinstituts in Österreich. Unscheinbar, harmlos, ein bisschen blässlich – so leitet der nunmehr 64-Jährige das Geldhaus. Aber plötzlich, am Donnerstag vergangener Woche, diese martialischen Worte: „Granat- und Atomfeuer“ sah Zwettler auf die Gewerkschaftsbank niederprasseln. So, als sei die Wiener Innenstadt rund um die Bawag-Zentrale zum Schauplatz eines Großkrieges geworden. So, als gebe es nur eine Rettung – den Helden, der aus der Deckung geht, um den Beschuss auf sich zu ziehen und sich für alle anderen zu opfern. Diesen Part übernahm nunmehr Johann Zwettler. „Ich habe mich nie einer Verantwortung entzogen“, sprach der Bankchef und sprang aus dem virtuellen Schützengraben. „Ich werde mein Vorstandsmandat mit 31. Dezember 2005 unwiderruflich zurücklegen. Ich möchte bewirken, dass die Bank aus dem Trommelfeuer herauskommt.“ Es war eine einsame Entscheidung, die für alle überraschend kam. Sogar für den Aufsichtsrat, der am Donnerstag bereits zum zweiten Mal außerordentlich zusammengetreten war, um die Folgen der so genannten Refco-Affäre für die Bawag zu erörtern: die Vergabe eines Blitzkredits in Höhe von 350 Millionen Euro an Gesellschaften von Phillip Bennett, den ExChef des mittlerweile insolventen US-Brokerhauses Refco Inc. (profil berichtete mehrfach, siehe auch Kasten Seite 44). Das Geld ist vorderhand futsch. Kaum war der stattliche Betrag am 10. Oktober überwiesen worden, gestand Refco substanzielle wirtschaftliche Schwierigkeiten ein und schlitterte wenig später in den Konkurs. Krise. Der Rücktritt von Zwettler, der Druck von der im Alleineigentum des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) stehenden Bank nehmen soll, entschärft die Krise der Bawag freilich nur oberflächlich. Noch immer läuft ein Ermittlungsverfahren der Finanzmarktaufsicht (FMA). Noch ist unklar, ob der Vorstand bei der Kreditvergabe gegen das österreichische Bankwesengesetz verstoßen hat. Und noch ist längst nicht abzusehen, welche Schadenersatzforderungen dem Institut von Refco-Aktionären in den USA drohen. Da nutzen alle gegenteiligen Beteuerungen von Bawag-Aufsichtsratspräsident Günter Weninger nicht viel. ÖGB-Finanzchef Weninger war, wie auch die gesamte Gewerkschaftsspitze, darauf eingeschworen, den Bawag-Vorstand mit allen Mitteln zu stützen, als er am frühen Donnerstagabend zur Sitzung des Aufsichtsrats kam – direkt von intensiven Beratungen der ÖGB-Eigentümervertreter, in denen die Verteidigungslinie festgelegt worden war: die Bank als Opfer eines konzertierten Betrugs, den Bennett in Tateinheit mit einer Reihe weiterer Refco-Manager so hinterlistig ausgeführt habe, dass man die Absicht dahinter nicht erkennen konnte. Personelle Konsequenzen für Zwettler oder seine Vorstandskollegen Christian Büttner (Internationales Geschäft) und Peter Nakowitz (Treasury und Großkredite), die den Kredit mitverantworten müssen? Undenkbar. Es sollte ein wenig anders kommen. Um 16 Uhr eröffnet Weninger im 4. Stock der Bawag-Zentrale die Sitzung. Er beginnt mit einer wörtlichen Lesung jenes mehrere Dutzend Seiten umfassenden Prüfberichts, den die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) im Auftrag der FMA über die Causa Refco erstellt hat. Die Rezitation dauert fast eine Stunde, befriedigt einige Mitglieder des Gremiums aber nicht wirklich. Casinos-Austria-Chef Leo Wallner und Siemens-General Albert Hochleitner wollen erst einmal wissen, welche Schritte die Bawag seit Bekanntwerden der Affäre gesetzt hat. Weninger referiert die sowohl in Wien als auch in New York gegen Bennett und Refco eingebrachten Klagen. Anschließend präsentiert er eine Stellungnahme der Bank für die Prüfer der OeNB und die darin enthaltenen Schlüsse der Bawag: Es gebe keine Hinweise auf strafrechtlich relevante Tatbestände, der Kreditvergabe sei auch kein schwer wiegender Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten oder andere Bestimmungen des Bankwesengesetzes vorangegangen. Ein Vorratsbeschluss, der noch unter Zwettlers Vorgänger Helmut Elsner gefasst worden war, sei weit reichend genug formuliert gewesen, um die Entscheidung zu decken. Es habe bloß an den internen Kontrollmechanismen gehapert, aber das könne rasch repariert werden. Die Sitzung wird mehrmals unterbrochen, der Vorstand aus dem Raum geschickt. Schließlich taucht die Frage auf, ob sich die optimistische Einschätzung des Aufsichtsrats auch mit jener der FMA decke. Jetzt ist Bawag-Staatskommissär Martin Brandl am Wort. Er befürchtet, dass die Finanzmarktaufsicht im Gegensatz zur Bank selbst durchaus davon ausgehe, dass rechtliche Normen verletzt worden sein könnten – etwa durch die Tatsache, dass der BawagVorstand über keine klare Geschäftsordnung verfüge und generelle Kredithöchstgrenzen unzureichend festgelegt seien. Weninger muss einräumen, dass die FMA noch keine Entwarnung gegeben hat. Es ist inzwischen halb sieben. Zwettler und Weninger ziehen sich zu einem Vieraugengespräch zurück. Als sie wieder hereinkommen, ist Weninger noch etwas graugesichtiger als sonst. Zwettler scheide aus dem Vorstand aus, sagt er. Der Generaldirektor habe rundweg seinen Rücktritt erklärt. „Wir haben nichts Unrechtes gemacht“, wird Zwettler von einem Sitzungsteilnehmer zitiert. „Aber irgendjemand muss jetzt die politische Verantwortung übernehmen.“ Einige Bawag-Betriebsräte brechen daraufhin in Tränen aus. Gegen sieben Uhr ist die Sitzung beendet. Jetzt gilt es, Zeit zu schinden, um nicht schon in der „ZiB 1“ eine Stellungnahme abgeben zu müssen. Um 19.39 Uhr, die ORF-Nachrichtensendung läuft gerade, treten Weninger und Zwettler vor die Presse. Zwettler weiß vermutlich ebenso gut wie sein Aufsichtsrat, dass die Angelegenheit mit seinem Abgang nicht ausgestanden ist. Aus dem Prüfbericht der OeNB einen Persilschein abzuleiten, wie es Aufsichtsratspräsident Weninger vergangenen Donnerstag getan hat, wäre tatsächlich etwas kühn. Der Report stellt in erster Linie eine nüchterne Auflistung von Fakten dar, enthält aber keine rechtliche Würdigung der Vorgänge. Die ist vielmehr der FMA vorbehalten. Und wie die dortigen Prüfer die Angelegenheit bewerten, wird sich erst im Lauf der nächsten Wochen erweisen. Das Papier der OeNB ist jedenfalls nur eines unter vielen Dokumenten, die von der FMA als Grundlage für ihre Entscheidung herangezogen werden. Ungemach. Gleichzeitig braut sich in New York Ungemach zusammen. Während die Bawag bemüht ist, sich als Opfer von Bennett und Refco darzustellen, wärmen sich ein gutes Dutzend US-Anwaltskanzleien gerade erst für die bevorstehende gerichtliche Auseinandersetzung auf. Sie vertreten Refco-Geschädigte, die Schadenersatzansprüche anmelden wollen. Ihnen geht es darum, die Insolvenzmasse von Refco, aus der ihre Klienten letztlich abgefunden werden sollen, möglichst hoch anzusetzen. Sie wird umso größer, je mehr finanzkräftige Institutionen als Komplizen des mutmaßlichen Betrügers Bennett entlarvt und infolgedessen zu Schadenersatzleistungen herangezogen werden können. Dabei könnte auch die Bawag unter erheblichen Druck geraten. Immerhin dürfte mittlerweile feststehen, dass Bennett die Refco-Bilanzen über Jahre hinweg frisiert hat. Und zwar offenbar auch unter Zuhilfenahme von Geldmitteln der Bawag. Der ehemalige Refco-Chef dürfte die millionenschweren Kreditforderungen, welche Refco gegenüber Bennetts privater Holding aufgebaut hat (die jene Holding aus Eigenem nicht mehr auszahlen hätte können), jeweils zum Bilanzultimo der operativen Refco-Gesellschaft (28. Februar) kurzfristig durch Refco-Forderungen an scheinbar unbeteiligte Dritte, deren Bonität außer Zweifel stand, ersetzt haben (profil 43/05). Teils lief dieses Spiel auch zu den Stichtagen der Refco-Quartalsbilanzen. Auf diesem Umstand basieren zentrale Punkte der Anklageschrift des New Yorker Staatsanwalts Michael Garcia gegen Bennett. Bereits ab den frühen neunziger Jahren, so Garcia, habe dieser „ununterbrochen versucht, Verluste von Refco zu verstecken“, schreibt Garcia. „Bennett steuerte eine Serie von Transaktionen, die dazu bestimmt waren, diese Verluste am Jahres- und Vierteljahresende zu verschleiern. Dieses betrügerische Schema gipfelte im August 2005 im Börsegang von Refco Inc., bei dem die Öffentlichkeit RefcoAktien im Wert von annähernd 583 Millionen Dollar erwarb.“ In diesem Zusammenhang gab es offenbar dreimal, jeweils zu den Bilanzstichtagen der Refco, auch auffällige Bawag-Transaktionen: Am 28. Februar 2003 könnte, wie US-Anwälte vermuten, die Bawag Overseas Inc. ihrem Geschäftspartner Bennett für dessen Bilanztricksereien 175,2 Millionen Dollar auf ein paar Tage zur Verfügung gestellt haben. Ein Jahr später wiederholte sich dieser Vorgang offenbar mit 210,2 Austromillionen. Und man hört, dass auch im Februar 2005 ein zweistelliger Bawag-Millionenbetrag im RefcoBilanztrickzirkus eingesetzt worden sei. Forderungen. Hätte Bennett die wertlosen Refco-Forderungen an seine eigene Holding nicht an jedem Bilanzstichtag durch vorgeblich werthaltige Forderungen an außenstehende und zahlungsfähige Dritte ersetzt, wäre Refcos Finanzmisere schon weit früher offenkundig geworden. Aus der Tatsache, dass die Bawag dabei mehrfach mit hohen Summen involviert war, könnten die US-Anwälte eine Komplizenschaft der Bawag mit Bennett ableiten. Argumentation: Die Wiener, die jahrelang enge Geschäftsbeziehungen mit Refco unterhalten hatten und dort sogar über ein halbes Jahrzehnt kapitalmäßig beteiligt waren, hätten wohl wissen müssen, was hier läuft. „Wir sind noch mitten in den Recherchen zum Fall Refco. Sollte sich – was ich derzeit nicht weiß – herausstellen, dass die Bawag daran beteiligt war, illegale Geldtransaktionen als legale zu tarnen, wäre das definitiv ein Grund, im Namen von Refco-Aktionären gegen die Bank vorzugehen“, sagt Thomas Ciarlone, Anwalt der Kanzlei Shalov Stone & Bonner, die eine Sammelklage in der Causa Refco vorbereitet. „Es würde mich sehr überraschen, wenn die Bawag dann nicht unter den Angeklagten wäre.“ Und dann drohen der Bawag im schlimmsten Fall Milliardenklagen aus dem Titel Schadenersatz. Die Bawag begegnet diesen Gefahren mit einer offensiven Strategie des Gegenangriffs. Sie geht auf das Thema der Bilanzstichtagskredite gar nicht erst ein und präsentiert sich als lupenreines Opfer eines Komplotts, das von Bennett und hochrangigen Refco-Managern geschmiedet wurde. Immerhin waren, wie die Bank in ihrer Klage ausführt, neben Bennett zumindest zwei weitere Refco-Leute daran beteiligt, ihr im Oktober dieses Jahres den 350Millionen-Euro-Kredit in arglistiger Weise herauszulocken. Zudem erfolgte die öffentliche Beichte des Brokerhauses, nur wenige Stunden nachdem das Geld überwiesen worden war. Solcherart hinters Licht geführt, will die Bawag nun „zumindest“ ihre 350 Millionen Euro per Gerichtsbeschluss rückerstattet erhalten. Die Chancen, mit dieser Argumentation durchzukommen, werden von Juristen als „gar nicht so schlecht“ eingeschätzt. Gelingt es der Bawag aber, ein Gerichtsurteil in diesem Sinne zu erwirken, kann sie in der Folge versuchen, jene US-Anwälte zu einem Vergleich zu bewegen, die sie wegen Komplizenschaft bei der Bilanzverschleierungs vor Gericht zerren wollen. Ein hochriskantes Spiel. Denn abgesehen davon, dass Gerichtsprozesse mit hoher Ungewissheit behaftet sind, scheint es auch keineswegs ausgemachte Sache zu sein, dass ein solcher Vergleich jemals gelingen kann: Wer würde der Bawag denn garantieren, dass sich all die vielen verschiedenen Refco-Geschädigten in eine tragfähige Kompromissformel einbinden lassen? Während sich die Juristen mit Fragen dieser Art herumschlagen, hat sich für die BawagEigentümer jetzt eine neue Aufgabe aufgetan: Sie müssen blitzartig einen Nachfolger für Zwettler finden. Der erste Name, der in diesem Zusammenhang genannt worden war, lautete Gertrude Tumpel-Gugerell, Vorstandsdirektorin in der Europäischen Zentralbank. TumpelGugerell hat aber glaubwürdig abgewunken. Als Nachfolgekandidat kam zuletzt auch Wolfang Haller, ehemaliger Personalvorstand der Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), ins Spiel. Zudem Friedrich Kadrnoska, Vorstand der Privatstiftung AVZ und ehemaliger Vizegeneral der BA-CA. Sowie Kontrollbank-Chef Rudolf Scholten. Darüber hinaus verfügt das SP-Lager kaum über plausible Kandidaten. Dieses Manko bringt nun die ÖVP ins Spiel. Reformen. Seit die Regierung Schüssel I bei ihren Reformen über die Sozialpartner einfach drüberfuhr – Motto: „Speed kills“ –, hatte sich die Volkspartei quasi in ein gewerkschaftsfreundliches und ein gewerkschaftsfeindliches Lager gespalten. Jedenfalls wurde dies von außen so wahrgenommen. In dem Maß, in dem die Regierungs-Schwarzen den ÖGB „net amol ignorieren“ wollten (ein Gewerkschafter), bemühte sich Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl um eine Wiederbelebung der Sozialpartnerschaft. Dass gleichzeitig ein Vertrauter und persönlicher Freund des Bundeskanzlers, Stephan Koren, in der „roten“ Bawag mittlerweile zum Stellvertretenden Generaldirektor aufgestiegen war, schien so etwas wie ein Einzelphänomen zu sein. Weithin unbemerkt hatte freilich in den letzten Jahren darüber hinaus eine Annäherung zwischen dem Schüssel-Lager und der Bawag-Führung stattgefunden: Der vom Kanzler hoch geschätzte Industrielle Josef Taus, ein väterlicher Freund Korens, hatte gemeinsam mit Ex-Bawag-Chef Helmut Elsner und dem Geschäftsmann Martin Schlaff eine Reihe großer Geschäfte abgeschlossen. Mit der Gewerkschaftsbank pflegte die Regierungs-ÖVP also durchaus subtile Verbindungen. Nun scheint der Moment gekommen, da Schüssel den Gewerkschaftern zeigen kann, dass ihnen die sozialpartnerschaftliche Umarmung durch Leitl in solcher Krise wenig nutzt. Und dass andererseits Schüssel imstande und, unter bestimmten Voraussetzungen, auch willens sein könnte, ihnen aus ihrer Finanzmisere zu helfen. Immerhin steht die – an sich unabhängige und weisungsfreie – Finanzmarktaufsicht zumindest personell und somit de facto im Einflussbereich des Finanzministeriums und der Nationalbank. Der Finanzminister tut sich schwer, dem Kanzler wesentliche Wünsche abzuschlagen. Ein ehemaliger Kanzlersekretär, Kurt Pribil, steht an der Spitze der FMA, und OeNB-Chef Klaus Liebscher muss offene Ohren haben, wenn es gilt, Unbill vom österreichischen Finanzplatz abzuwehren. Freilich wird Schüssel bei seinen etwaigen Hilfsaktionen für die Bawag nicht darauf vergessen, Gegenleistungen des ÖGB beziehungsweise der Sozialdemokraten einzufordern – ausgesprochen oder unausgesprochen. Es kann schließlich nicht schaden, wenn sich die finanzmaroden Gewerkschafter ihm verpflichtet fühlen. Vor diesem Hintergrund scheinen in fernerer Zukunft weder eine Bawag im Teileigentum bürgerlicher heimischer Banken noch ein Bawag-Chef namens Koren unvorstellbar. Noch ist allerdings von Bewegung in diese Richtung nicht das Geringste zu bemerken. Konnte unmittelbar nach Auffliegen der Affäre der Eindruck entstehen, die gewerkschaftlichen Bawag-Eigner seien für personelle Konsequenzen in den Bankgremien offen, so kehrte sich diese Haltung zuletzt völlig um. Ein hochrangiger Gewerkschafter: „Die Bawag ist einfach betrogen worden. Schauen Sie sich doch an, welchen internationalen Finanzgrößen in dieser Causa dasselbe passiert ist.“ Die Forderung nach rollenden Köpfen sei „ausschließlich politisch motiviert“ und daher „absurd“. Johann Zwettler hat das offenbar anders gesehen. Von Liselotte Palme und Martin Staudinger * Artikel schicken * Artikel drucken Profil # » Aboservice # » Covergalerie # » Inhaltsverzeichnis # » Cartoongalerie # » Webdownload # » MAGAZIN AWARD Meinungen ·Leitartikel: Stefan Janny Eigentum braucht Kontrolle ·Elfriede Hammerl Wunschkinder ·Georg Hoffmann-Ostenhof Der Fall Irving ·Peter Michael Lingens War der Irak-Krieg doch berechtigt? ·Rainer Nikowitz Und – bamm! profil 47/05 ·Ende der Debatte: Andersrum? Natürlich! Homosexualität ist biologisch determiniert ·Bank für Arglosigkeit und Wegschauen Warum Zwettlers Rücktritt die Krise nicht entschärft ·Die oberen Sechzigtausend: Umverteilung Wie müsste gerechte Steuerpolitik aussehen? ·Wohnungseinbruch: Auf Biegen & Brechen Die Polizei bläst zur Jagd auf Einbrecherbanden ·Neues Deutschland: Hofübergabe in Berlin Diese Woche beginnt eine neue politische Ära ·Interview: „Der Wille zur Auslöschung“ André Glucksmann über sein neues Buch „Hass“ ·Der Foltergeist: US-Regierung in Bedrängnis Die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt TOPNEWS auf networld.at21.11.2005 09:11 Uhr ·ÖGB gibt heute neuen BAWAG-Chef bekannt Nach Refco-Affäre trat Johann Zwettler zurück ·Knalleffekt: Ariel Sharon gründet neue Partei Verlässt nach Scheitern der Regierung Likud-Block ·Liga-Krimi nach GAK-Triumph über Salzburg Top 5-Vereine nur durch vier Pünktchen getrennt ·Moshammer-Mord: Heute Urteil erwartet! Täter hat gestanden: War es Mord oder Totschlag? ·"Werde mit 50 noch auf der Bühne stehen" Christina Stürmer im großen TV-MEDIA-Talk! zurück zur Startseite 1995-2005 © News Networld Internetservice AG | Impressum | AGB | Jobs @ News | Tarife Online | Tarife – Print Im aktuellen PROFIL profil 47/05 » zur PROFIL Startseite Umverteilung: Die oberen Sechzigtausend Im obersten Einkommensbereich wächst das Vermögen, im untersten die Armut. Dennoch denkt in Österreich niemand an eine „Reichensteuer“ nach deutschem Vorbild, wohl aber an eine gerechtere Gestaltung des Steuersystems. Nehmen wir einmal an, Albert und Barbara Wussow-Fortell lebten in Deutschland. Und nehmen wir an, das Mimen-Ehepaar hätte zwischen den Dreharbeiten zu „Schlosshotel Orth“ und „Traumschiff“ Notstandshilfe beantragt. Sie hätten zunächst einmal den familieneigenen Chrysler Voyager verkaufen und die großzügige Villen-Etagenwohnung gegen eine bescheidene Bleibe eintauschen müssen. Dann erst wäre die Sozialunterstützung auf ihr Konto überwiesen worden. In Österreich brauchte das Glamour-Couple diese Vorleistungen nicht zu erbringen. Sie haben zwischen Drehpausen Notstandshilfe bezogen, und das ist – zu diesem Urteil kam die Staatsanwaltschaft in der Vorwoche – auch in Ordnung. „Sozialleistungen sind nun mal für alle zugänglich“, sagt Grünen-Sozialsprecher Karl Öllinger. Nur: Wie lange sind sie noch finanzierbar? Seit Jahren bitten praktisch alle europäischen Regierungen ihre Bürger unbarmherzig zur Kasse: Mit einschneidenden Maßnahmen ins Steuer- und Sozialrecht sollen jene Budgetlöcher gestopft werden, die Globalisierung und Kapitalflucht, Maastricht-Vorgaben und Steuerausfälle durch Arbeitslosigkeit gerissen haben. Doch in immer mehr Staaten stoßen diese Maßnahmen an die Grenzen der politischen Akzeptanz. Um all dem wenigstens den Anschein sozialer Symmetrie zu geben, führt die große Koalition in Deutschland nun eine „Reichensteuer“ ein. Künftig werden Alleinverdiener und Personengesellschaften jenen Einkommensanteil, der über 250.000 Euro Jahresbrutto liegt, mit einem dreiprozentigen Aufschlag versteuern müssen (für Familien liegt die Grenze bei 500.000 Euro Jahresbrutto). „In einem vernünftigen Gesamtpaket, wo jeder Bevölkerungsgruppe ihr Anteil am Sparpaket auferlegt wird, hat dies durchaus Berechtigung“, gibt sich Karl-Heinz Grasser generös. Doch in seinem rotweißroten Wirkungsbereich will der Finanzminister nichts davon wissen: „Das Thema stellt sich bei uns nicht.“ „Mit einer Reichensteuer sind keine großen sozialen Sprünge zu machen“, sagt auch Sozialministerin Ursula Haubner. „Das ist ein völlig falscher Ansatz.“ Dieser Befund ist – gemessen an den zu erwartenden Einnahmen – richtig. Aber er ist doch etwas defensiv für eine Ministerin, in deren Haus im Vorjahr ein Bericht erstellt wurde, der sich erstmals nicht nur mit der Armut im Land, sondern auch mit dessen Reichtum beschäftigte: * Ein Prozent der Österreicher über 19 Jahre ist wirklich reich. Das Gesamtvermögen dieser rund 60.000 Personen summierte sich 2002 auf rund 318 Milliarden Euro. Die „unteren“ 90 Prozent der Bevölkerung verfügten nur über 299 Milliarden Euro. * Das durchschnittliche Pro-Kopf-Vermögen der „Reichen“ war 2002 mit 5,4 Millionen Euro fast hundertmal höher als jenes der unteren 90 Prozent (56.000 Euro). * Auch die „Wohlhabenden“ – knapp neun Prozent der Bevölkerung – verfügten mit 611.000 Euro Pro-Kopf-Vermögen über das Zehnfache der unteren Gruppe. „Erstaunlich eigentlich“, sagt ÖVP-Gesundheitssprecher Erwin Rasinger, „dass wir uns in Anbetracht dieser Zahlen den Kopf darüber zerbrechen, woher wir zusätzliche 100 Millionen Euro für die Spitalsfinanzierung bekommen.“ Doch die Vermögens-Eliten verabschieden sich immer mehr von der Finanzierung des Solidarstaates. Industrielle, Medienzaren, Rechtsanwälte und sogar Sportler bringen ihr Vermögen in Stiftungen ein, um es an Erbschafts- und Einkommensteuer vorbeizuschleusen (siehe Grafik). Börsenotierte Unternehmer und Banken reizen das Steuerrecht bis an die Grenzen aus, um die Körperschaftsteuer auf ein Minimum zu drücken. Vermögenszuwachs. Wie rasch das Vermögen in Österreich gewachsen ist, zeigt die Entwicklung des Lohnanteils am Volkseinkommen: Lag er Ende der siebziger Jahre noch bei 72 Prozent, so rangiert er heute bei 58 Prozent. Trotzdem steigen die Einnahmen aus der Lohnsteuer seit Jahrzehnten kontinuierlich an. Zugleich sanken die Erlöse aus Körperschaftsteuer und so genannten Vermögensteuern – also Erbschafts-, Schenkungs- und Grundsteuer (siehe Grafik). Die Finanzierung des Staatshaushalts lastet immer stärker auf dem Gros der Unselbstständigen. Den Status quo fasst das Wirtschaftsforschungsinstitut in einer aktuellen Studie so zusammen: „Die Ungleichheit der Einkommensverteilung zwischen den Lohneinkommen und Einkommen aus Besitz und Unternehmung weitete sich in den letzten drei Jahrzehnten deutlich aus.“ Zwar trifft das progressive Steuersystem die Besserverdienenden stärker als die unteren Einkommensschichten, und mit einem Spitzensteuersatz von formal 50 Prozent, real – wegen der begünstigten 13. und 14. Monatsgehälter – aber 43 Prozent, liegt Österreich knapp über dem EU-Schnitt von 41,4 Prozent. Doch Sozialversicherungsbeiträge, Mehrwertsteuer und andere Verbrauchssteuern heben diesen Effekt weitestgehend auf. Das Wifo hat in verschiedenen Studien errechnet, * dass die Mineralölsteuer Monatseinkommen bis zu 1500 Euro brutto mit 4,6 Prozent belastet, Monatsverdienste bis zu 3000 Euro mit 4,7 Prozent und darüber liegende Gehälter mit nur noch 3,6 Prozent. * Ähnlich verhält es sich mit der Mehrwertsteuer: Die untersten Verdienstgruppen liefern 17,8 Prozent ihres verfügbaren Einkommens an die Umsatzsteuer ab, die mittlere Gruppe 15,7 Prozent, die oberste nur noch 13,2 Prozent. * Die Krankenversicherung kommt dem obersten Drittel mit 2,9 Prozent am billigsten, der mittleren Gruppe mit 3,5 Prozent am teuersten. Das unterste Drittel muss durchschnittlich 3,2 Prozent seines Bruttoeinkommens aufwenden. „Die Belastung durch Steuern und Abgaben entspricht beinahe einem Flat-Rate-System“, sagt Wifo-Steuerexperte Markus Marterbauer, also linear über alle Einkommen. Und sie führt zu beinahe skurrilen Verzerrungen: Bis zu einem Monatsgehalt von 3500 Euro brutto – in diese Gruppe fallen immerhin 90 Prozent der 5,9 Millionen unselbstständig Erwerbstätigen – kommen Beschäftigte ihrem Dienstgeber am teuersten (siehe Tabelle). „Für einen Betrieb ist es relativ weit günstiger, einen Spitzenmanager einzustellen als eine Putzfrau“, ätzt SPÖBudgetsprecher Christoph Matznetter. Wirtschaftsbund-Generalsekretär Karlheinz Kopf sieht dies naturgemäß anders: „Wir haben zwar ein solidarisches Versicherungssystem, trotzdem können wir die oberen Einkommensbezieher nicht über Gebühr zur Kassa bitten.“ Werden die Sozialausgaben für sich allein betrachtet, versteht man, was Kopf meint: Jeder zweite Euro aus dem Sozial- und Gesundheitsbudget fließt ins untere Einkommensdrittel. Ohne diese Umverteilung wären die Verhältnisse am untersten Ende der Einkommensskala noch trister, als es der Sozialbericht offenbart. Immerhin * leben sechs Prozent der Österreicher, also 467.000 Personen, in akuter Armut; * sind weitere sieben Prozent, also 577.000 Personen, armutsgefährdet; * kann sich fast jeder zehnte Österreicher grundlegende Dinge wie neue Kleidung oder Möbel nicht leisten. Doch es ist just diese Gruppe, die von indirekten Steuern und Gebühren – etwa Rezeptgebühr, Autobahnvignette oder Energiesteuer – überproportional belastet ist. Ferdinand Lassalle, Gründer der deutschen Sozialdemokratie, hatte schon 1867 indirekte Steuern als „Verbrechen“ bezeichnet. Luxussteuer. Wirkliche Umverteilungspolitik schaffte nur die Wiener SP in der Ersten Republik. Während die meisten Wiener nach dem Ersten Weltkrieg nicht einmal wussten, wo sie sich waschen sollten, genoss die Oberschicht bald wieder einen extravaganten Lebensstil. Bei ihnen setzte der damalige SP-Finanzstadtrat Hugo Breitner an und besteuerte gnadenlos jeden Luxus: Hunde, Nobelrestaurants, Schaumweine, Hausangestellte, ja sogar Bordelle waren abgabenpflichtig. Der Erlös floss in den Bau von Sozialwohnungen, öffentliche Bäder und karitative Einrichtungen. Die SPÖ-Alleinregierung ab 1970 kam an dieses Ausmaß an Umverteilung bei Weitem nicht heran. Zwar griff das Kabinett von Bruno Kreisky Minderbegüterten mit direkten Beihilfen für Schulfahrten, Geburten oder Hochzeiten unter die Arme. Doch im selben Ausmaß floss Bares auch an Begüterte. Der allgemeine Wohlstand wuchs, noch schneller wuchs das Vermögen: Die Einkünfte aus Dividenden, Vermietungen und Zinsen stiegen in der Ära Kreisky dreimal so stark wie die Löhne der Arbeiter und Angestellten. In den folgenden Jahrzehnten wurde der finanzielle und politische Spielraum geringer. Die Regierungsbeteiligung der ÖVP ab 1986 schloss Umverteilungspläne von vornherein aus: Sozialminister Alfred Dallinger blitzte mit seiner Idee einer Wertschöpfungsabgabe ab – die Berechnungsbasis für die Dienstgeberbeiträge sollte um den Gewinn verbreitert werden. Stattdessen gewann die unternehmerfreundliche Standortpolitik an Gewicht. Anfang der Neunziger schaffte Finanzminister Ferdinand Lacina die Vermögensteuer ab und initiierte ein Privatstiftungsgesetz, um Kapital ins Land zu bringen. Die im Gegenzug geplante Verschärfung der Erbschaftssteuer, die Entlastung der Löhne und eine stärkere Belastung des Kapitals, „die eigentlich vereinbart worden waren“ (Lacina), wurden nie umgesetzt. „Die meisten Versuche, das Geld von den Reichen zu sozial Schwächeren zu transferieren, scheitern an der politisch und finanziell mächtigen Oberschicht“, meint der Politologe Emmerich Talós. Reiche bevorzugt. 1996 rechnete das Wifo in einer Umverteilungsstudie vor, dass im Vergleich zu den Achtzigern das obere Einkommensdrittel immer mehr von den öffentlichen Ausgaben profitierte: Steuerreformen und Transferleistungen brächten eher horizontale Verschiebungen – etwa von kinderlosen zu kinderreichen Familien – oder unterm Strich gar Vorteile für die obere Einkommensgruppe. Vom freien Hochschulzugang, unter SchwarzBlau abgeschafft, zogen stets Kinder besser gestellter Familien Nutzen. Kinder aus Arbeiterfamilien finden weit seltener den Weg an die Universitäten. „Die schwarz-blaue Koalition hat bruchlos fortgesetzt, was die Regierungen davor begonnen hatten“, kritisiert Caritas-Präsident Franz Küberl (siehe Interview). In den vergangenen fünf Jahren holte sich der Finanzminister laut Arbeiterkammer von den Unselbstständigen trotz Steuerreform netto 1,5 Milliarden Euro. An Wirtschaft und Unternehmer hingegen flossen 1,2 Milliarden Euro. Dennoch: Von einer „Reichensteuer“ à la Deutschland will selbst die Opposition in Österreich nichts wissen. Der Budgetsprecher der Grünen, Werner Kogler, kann sich allerdings vorstellen, bei Jahresbruttobezügen über 200.000 Euro die steuerliche Begünstigung für den 13. und 14. Monatsgehalt auslaufen zu lassen: „Eine solidarische Gesellschaft darf sich nicht nur auf die freiwilligen Spendenleistungen der Superverdienenden verlassen.“ Es wäre allerdings, wie Kogler zugibt, mehr eine symbolische Geste. Nur zehn Prozent aller Lohnund Einkommensteuerpflichtigen unterliegen dem Spitzensteuersatz. SP-Sprecher Matznetter will „von neuen Steuern nichts wissen: Ich wäre schon zufrieden, wenn die Unternehmer ehrliche 25 Prozent Körperschaftsteuer zahlen würden.“ Das Streichen von Ausnahmen wie Gruppenbesteuerung oder eine faire Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage würde „zwei bis drei Milliarden mehr pro Jahr bringen. Unterkante!“ Mit dem zusätzlichen Erlös sollen die Lohnnebenkosten, vor allem beim Mittelstand, hinuntergeschraubt werden. Erst in einem zweiten Schritt sei eine Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage von derzeit 3450 Euro Bruttogehalt (Gehaltsbestandteile darüber unterliegen nicht mehr der Sozialversicherungspflicht) auf 5000 Euro denkbar. Verfassungsrechtliche Einwände gibt es nicht: Diese Erhöhung „scheint sich in einem für Österreich akzeptierten Rahmen bewegen“, sagt der Jurist Bernd-Christian Funk. Ex-Finanzminister Lacina bringt noch eine Denkvariante ins Spiel: „Es könnte die Höchstbeitragsgrundlage abgeschafft und im Gegenzug die Beitragshöhe für alle gesenkt werden.“ Flankenschutz für die Opposition kommt vom langjährigen Budgetfachmann des Wifo, Gerhard Lehner. Eine Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage hielte er für „nicht unvernünftig“. Auch die Idee, das 13. und 14. Gehalt bei höheren Einkommen stärker zu besteuern, sei überlegenswert. „Das hat es bereits in den sechziger Jahren gegeben.“ Abgeschafft wurde dies in den Siebzigern von Hannes Androsch. Einem sozialdemokratischen Finanzminister. Von Alexander Dunst, Martina Lettner und Ulla Schmid * Artikel schicken * Artikel drucken Profil # » Aboservice # » Covergalerie # » Inhaltsverzeichnis # » Cartoongalerie # » Webdownload # » MAGAZIN AWARD Meinungen ·Leitartikel: Stefan Janny Eigentum braucht Kontrolle ·Elfriede Hammerl Wunschkinder ·Georg Hoffmann-Ostenhof Der Fall Irving ·Peter Michael Lingens War der Irak-Krieg doch berechtigt? ·Rainer Nikowitz Und – bamm! profil 47/05 ·Ende der Debatte: Andersrum? Natürlich! Homosexualität ist biologisch determiniert ·Bank für Arglosigkeit und Wegschauen Warum Zwettlers Rücktritt die Krise nicht entschärft ·Die oberen Sechzigtausend: Umverteilung Wie müsste gerechte Steuerpolitik aussehen? ·Wohnungseinbruch: Auf Biegen & Brechen Die Polizei bläst zur Jagd auf Einbrecherbanden ·Neues Deutschland: Hofübergabe in Berlin Diese Woche beginnt eine neue politische Ära ·Interview: „Der Wille zur Auslöschung“ André Glucksmann über sein neues Buch „Hass“ ·Der Foltergeist: US-Regierung in Bedrängnis Die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt TOPNEWS auf networld.at21.11.2005 09:12 Uhr ·ÖGB gibt heute neuen BAWAG-Chef bekannt Nach Refco-Affäre trat Johann Zwettler zurück ·Knalleffekt: Ariel Sharon gründet neue Partei Verlässt nach Scheitern der Regierung Likud-Block ·Liga-Krimi nach GAK-Triumph über Salzburg Top 5-Vereine nur durch vier Pünktchen getrennt ·Moshammer-Mord: Heute Urteil erwartet! Täter hat gestanden: War es Mord oder Totschlag? ·"Werde mit 50 noch auf der Bühne stehen" Christina Stürmer im großen TV-MEDIA-Talk! zurück zur Startseite 1995-2005 © News Networld Internetservice AG | Impressum | AGB | Jobs @ News | Tarife Online | Tarife – Print Im aktuellen PROFIL profil 47/05 » zur PROFIL Startseite Wohnungseinbruch: Auf Biegen und Brechen Weil 96 von hundert Fällen nicht aufgeklärt werden können, konzentriert sich die Wiener Polizei auf potenzielle Tätergruppen. An der Spitze: georgische Einbrecherbanden. Donnerstag vergangener Woche, halb neun Uhr morgens: An einer Wohnungstür eines Zinshauses in Wien-Leopoldstadt klopft es. Erst leise, dann heftiger. Die Tür öffnet sich einen Spalt. Zwei verschlafene Augen eines jungen unrasierten Mannes blinzeln verdutzt heraus – direkt in die Mündung einer Dienstwaffe der Wiener Polizei. Sieben bewaffnete Beamte stürmen die heruntergekommene 60-Quadratmeter-Kaschemme und stehen plötzlich zehn Georgiern gegenüber. Sie finden, was Kriminalisten im Fachjargon eine Bunkerwohnung nennen: die kombinierte Wohn- und Geschäftsadresse einer gewerbsmäßigen Einbrecherbande. Unter Matratzen lagern Uhren, Schmuck, Bargeld und Digitalkameras. In den Matratzen selbst entdecken die Ermittler einschlägiges Spezialwerkzeug, um fremde Wohnungstüren im Akkord zu öffnen. Die zehn Georgier werden festgenommen. Für die Beamten beginnt die Uhr zu laufen. Gelingt es ihnen nicht, innerhalb von 48 Stunden die sichergestellte Beute einem der hunderten Wohnungseinbrüche der vergangenen Wochen zuzuordnen oder eine Straftat nachzuweisen, müssen sie die Verdächtigten wieder auf freien Fuß setzen. An diesem Donnerstag hat die Exekutive wie so oft in jüngster Zeit Großkampftag. Seit dem Morgen patrouillieren Streifen- und Zivilbeamte verstärkt durch die Straßen der von Einbrechern bevorzugten Gegenden Wiens. Abends riegelt die Exekutive die Ausfahrtsstraßen ab. Kleine Lieferwagen mit Ostkennzeichen werden zur Seite gewunken und penibel durchsucht. Spürhunde schnüffeln in Fahrzeugen und Gepäck. 200 Beamte im Sondereinsatz fahnden nach Diebsgut, das auf dem Weg nach Osteuropa sein könnte. Ein Kleinbus erweist sich als Fundgrube. Drei junge Serben müssen ihr in die Jahre gekommenes Fahrzeug entladen. Sechs alte Fernseher, fünf Waschmaschinen, vier Kühlschränke, drei Gasherde, zwei Dutzend Reifen und ein altes Sofa in nicht mehr definierbaren Pastelltönen stapeln sich neben dem Auto. Unter dem Fahrersitz finden sich ein neuer Laptop und die täuschend echte Attrappe einer silber-schwarzen Pistole, Marke Beretta. Den Computer wollen die drei Serben für 100 Euro auf einem Wiener Flohmarkt gekauft haben. Laut Polizeicomputer stammt das Gerät jedoch aus einem Wohnungseinbruch in der Wiener Gablenzgasse vom 8. November. Der Wiener Polizeigeneral Roland Horngacher stolziert mit erhobenen Zeigefingern zwischen seinen Beamten: „Man muss nur emsig sein, nur emsig sein.“ Resultat eines langen Tages: 200 Beamte haben geschätzte 2000 Arbeitsstunden investiert und dabei 33 Personen festgenommen. Zehn wegen unklarem Aufenthaltsstatus, 23 Personen, denen strafrechtliche Delikte vorgeworfen werden, jedoch keinen der georgischen Einbrecher, denen der Großeinsatz auch gegolten hätte. Zwei Drittel aller in Österreich durchgeführten Einbrüche werden in Wien begangen. In der Wiener Bevölkerung ist das massive Ansteigen der Einbruchsdelikte während der vergangenen Jahre eine der wichtigsten Ursachen für das abnehmende Sicherheitsgefühl. Geringe Aufklärungsquote. Einbruchsdiebstahl wird zwar mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren bedroht. Dazu braucht die Justiz freilich Täter und Beweise. Doch mit einer extrem mageren Aufklärungsquote von vier Prozent bei Wohnungseinbrüchen ist das abschreckende Strafmaß wirkungslos. Bei Spitzen von bis zu 70 Einbrüchen pro Tag werden derzeit in Wien durchschnittlich 34 Wohnungen ausgeräumt. Und nur jeden zweiten Tag wird ein Einbruch aufgeklärt. Was polizeistrategisch daraus folgt, ist eine massive Jagd auf potenzielle Tätergruppen, um sie zu vertreiben. Im Fall der rumänischen Diebsbanden, die in den vergangenen Jahren auffallend aktiv waren, hat das funktioniert. Polizeichef Horngacher: „Jetzt geht es hauptsächlich um Georgier. Wir bekämpfen sie mit allen Mitteln.“ Täglich werden in der Kommandozentrale der Polizei am Wiener Schottenring „Führungsberichte“ mit allen angefallenen Delikten erstellt, die Tatorte in Dichtheitsanalysen auf Karten sichtbar gemacht und überfallsartig mit Polizisten beschickt. „Die Georgier“ sind also da. „Primitiv und brutal“ sei ihre Arbeitsweise, sagt Kriminalist Ernst Geiger. „Arm und verzweifelt“ sei aber deren Situation zu Hause, räumt Roland Frühwirth von der Kriminaldirektion 1 ein, „viele dieser Menschen gehen auch dann noch auf Beutezug, wenn andere Täter vor der massiven Polizeipräsenz bereits kapitulieren“. In Wien, der ersten reichen EU-Metropole auf dem Weg in den Westen, leben laut Polizei mehr als 1000 georgische Staatsbürger, die in ihrem Heimatland als Einbrecher geschult wurden, in der Bundeshauptstadt dann mit Unterkunft, Handy und „Arbeitswerkzeug“ versorgt werden und bereit sind, Einbrüche zu begehen. Laut Polizei bringen die meisten von ihnen einen Asylantrag ein, um legalen Aufenthaltsstatus zu erlangen. Horngacher ist überzeugt: „Von denen will niemand Asyl, die wollen den Einbruchsdiebstahl.“ Nach zwei bis drei Monaten werden die Akteure ausgetauscht. Die polizeiliche Statistik der Festgenommenen zeigt: In der Zeit vom 1. Juni bis 14. September dieses Jahres haben Georgier doppelt so viele Einbrüche begangen wie Österreicher. Dazu Gerhard Haimeder vom Landeskriminalamt Wien: „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr auf bestimmte ethnische Gruppen konzentrieren und dabei die österreichischen Täter übersehen.“ Auf Platz drei finden sich Täter mit unbekannter Herkunft, gefolgt von Rumänen, Ungarn und Serben. In München etwa scheinen Georgier als Einbruchsbanden noch nicht angekommen zu sein. Von dort gibt es keine derartigen Wahrnehmungen. Nach Ansicht der Polizei befindet sich bereits die nächste Gruppe im Anmarsch auf Wien: „die Moldawier“. Großbanden. In einem profil vorliegenden internen Bericht der Exekutive zur „Sonderauswertung der Einbruchskriminalität“ werden die ermittelten Hintergründe des groß angelegten Einbrecher-Gewerbes geschildert. Dem zufolge handelt es sich um vier bis sechs große Banden, die ausschließlich aus Georgiern bestehen, voneinander unabhängig operieren und sich als Hauptgebiete den 2. und 20. Wiener Gemeindebezirk ausgewählt haben, aber in ganz Wien und Umgebung tätig sind. Dabei handle es sich um organisierte Kriminalität, jedoch gebe es keine Strukturen, die als mafios bezeichnet werden könnten. Als Unterkünfte dienen laut Polizei meist Wohnungen von in Österreich eingebürgerten Georgiern. Die Unterkünfte werden häufig gewechselt. Das Diebsgut (siehe Kasten) wird zum Teil auf dem Schwarzmarkt am Wiener Mexikoplatz veräußert. Was nicht absetzbar ist, wird per Post nach Georgien versandt. Manche Diebe reisen als Touristen ein und bringen ihre Beute auf dem Landweg nach Georgien oder verschiffen sie in Italien. Schließfächer auf dem Wiener Süd- und Westbahnhof dienen oft als Zwischenlager. Viele der Täter sind drogensüchtig und tauchen daher auf Umschlagplätzen wie dem Karlsplatz, dem Westbahnhof oder im Stadtpark auf. Zumeist sind sie in zwei- bis dreiköpfigen Gruppen unterwegs, oft führen sie auch Späher mit, die „Gegenobservationen“ (Horngacher) durchführen und ihrerseits die Polizei beobachten. Die meisten Einbrecher setzen an den Schließzylindern der Wohnungstüren an. Seit Kurzem benützen sie Socken statt Handschuhen, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Denn Handschuhe sind im Falle einer Polizeikontrolle ein Verdachtsmoment. Manche verkleben die Türspione der Nachbarwohnungen mit Papierstücken, die sie mit Speichel befeuchten und so zu wertvollen DNA-Spurenträgern machen. Statistisch am häufigsten wird zwischen 8 und 9 Uhr morgens eingebrochen, wenn die Bewohner zur Arbeit gegangen sind, oder abends, bevor sie heimkehren. Derzeit ist Hochsaison für „Dämmerungseinbrüche“, da die Dämmerung früher kommt als die Hausbewohner, laden unbeleuchtete Wohnungen zum Einbruch ein. Der Wiener Peter S., 33, wurde innerhalb von eineinhalb Jahren in zwei verschiedenen Wohnungen zum Einbruchsopfer. Nach dem ersten Mal dauerte es, bis das schwarze Pulver der Spurensicherung wieder entfernt war, beim nächsten Mal machte sich die Polizei mit Spurensicherung keine besondere Mühe mehr: Sowohl an seiner Adresse in Wien-Margareten als auch an der nächsten in Wien-Neubau hatten die Einbrecher alle Wohnungen des Stockwerks heimgesucht, beide Male handelte es sich um Altbauten mit ungesicherten Türen und Schlössern. Der materielle Schaden von Peter S. war gering: „Beim ersten Einbruch wurde ausschließlich nach Schmuck und Geld gesucht, nichts davon hatte ich in der Wohnung.“ Beim zweiten Mal fehlten Kleidung, Parfüms und Rasierklingen. Seine Wohnungsnachbarin war so geschockt, dass sie auszog. Bei Eva T. wurde im Oktober des Vorjahres aus der Wohnung in Wien-Erdberg der gesamte Schmuck gestohlen, die Maximalentschädigung von 8000 Euro in der Haushaltsversicherung konnte den Verlust nicht decken. Resigniert sagt sie: „Es waren so viele alte Stücke dabei, und die Polizei hat mir keine Hoffnung gemacht, dass ich davon je wieder etwas sehen könnte.“ Resignation auch bei einer alten Dame, aus deren Mietshaus in Wien-Hernals alles verschwindet, was sich im Keller oder auf Gängen befindet: „Man macht eine Anzeige, aber sie hat keine Wirkung.“ Offene Haustore. Die alte Dame ist von der Tatsache beunruhigt, dass ab Mitte des kommenden Jahres auch private Zustelldienste Zugang zu Postkästen und damit Haustorschlüssel bekommen. Die Tatsache, dass Wohnanlagen dann de facto offene Haustore haben, wird bereits jetzt in vielen Hausversammlungen heftig diskutiert. Doch der immaterielle Schaden durch Wohnungseinbruch ist oft höher als der materielle Verlust. Das Deutsche Forum für Kriminalprävention hat festgestellt, dass sich nach einem Einbruch nur noch jeder Dritte gern in seiner Wohnung aufhält, 87 Prozent haben Angst, erneut zum Opfer zu werden. Befragungen verurteilter Täter in Deutschland haben Einblicke in ihre kriminelle Welt gebracht. Viele nannten das geringe Entdeckungsrisiko als Hauptgrund, Einbrüche zu begehen. Einer meinte, man werde nur ertappt, wenn man „extremes Pech und die Polizei extremes Glück hat“. Ein anderer gab laut Studie zu Protokoll: „Jeder, der einmal auf frischer Tat ertappt worden ist, hat davor mindestens schon fünfzig Brüche gemacht, bei denen er nicht erwischt worden ist. Und das ist sogar noch tief geschätzt.“ Das geringe Risiko, sagte er, mache das Einbrechen „sehr attraktiv“. Von Josef Barth, Emil Bobi und Marianne Enigl * Artikel schicken * Artikel drucken Profil # » Aboservice # » Covergalerie # » Inhaltsverzeichnis # » Cartoongalerie # » Webdownload # » MAGAZIN AWARD Meinungen ·Leitartikel: Stefan Janny Eigentum braucht Kontrolle ·Elfriede Hammerl Wunschkinder ·Georg Hoffmann-Ostenhof Der Fall Irving ·Peter Michael Lingens War der Irak-Krieg doch berechtigt? ·Rainer Nikowitz Und – bamm! profil 47/05 ·Ende der Debatte: Andersrum? Natürlich! Homosexualität ist biologisch determiniert ·Bank für Arglosigkeit und Wegschauen Warum Zwettlers Rücktritt die Krise nicht entschärft ·Die oberen Sechzigtausend: Umverteilung Wie müsste gerechte Steuerpolitik aussehen? ·Wohnungseinbruch: Auf Biegen & Brechen Die Polizei bläst zur Jagd auf Einbrecherbanden ·Neues Deutschland: Hofübergabe in Berlin Diese Woche beginnt eine neue politische Ära ·Interview: „Der Wille zur Auslöschung“ André Glucksmann über sein neues Buch „Hass“ ·Der Foltergeist: US-Regierung in Bedrängnis Die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt TOPNEWS auf networld.at21.11.2005 09:12 Uhr ·ÖGB gibt heute neuen BAWAG-Chef bekannt Nach Refco-Affäre trat Johann Zwettler zurück ·Knalleffekt: Ariel Sharon gründet neue Partei Verlässt nach Scheitern der Regierung Likud-Block ·Liga-Krimi nach GAK-Triumph über Salzburg Top 5-Vereine nur durch vier Pünktchen getrennt ·Moshammer-Mord: Heute Urteil erwartet! Täter hat gestanden: War es Mord oder Totschlag? ·"Werde mit 50 noch auf der Bühne stehen" Christina Stürmer im großen TV-MEDIA-Talk! zurück zur Startseite 1995-2005 © News Networld Internetservice AG | Impressum | AGB | Jobs @ News | Tarife Online | Tarife – Print Im aktuellen PROFIL profil 47/05 » zur PROFIL Startseite Neues Deutschland * Hofübergabe in Berlin Diese Woche beginnt eine neue politische Ära – CDU-Chefin Angela Merkel wird am Dienstag zur ersten deutschen Bundeskanzlerin gewählt. Erstaunlich groß war die Vorschuss-Harmonie der neuen Bündnispartner in der vergangenen Woche: Nur drei von 116 CDU-Vertretern eines kleinen Parteikonvents missbilligten den ausgehandelten Pakt mit den Sozialdemokraten, die bayrische CSU sagte gar einstimmig Ja. Der bis vor Kurzem so autokratisch herrschende Parteichef und Landesfürst Edmund Stoiber leistete bei dieser Gelegenheit demütige Abbitte für seine erratische Rundreise München– Berlin–München, die daheim viel Furor auslöste: „Ich leide wie ein Hund.“ Bei den Sozialdemokraten gab es als Draufgabe zum einhelligen Ja zur Großkoalition – nur 15 von 500 Delegierten waren explizit dagegen – auch noch den neuen großen WohlfühlSteuermann. Der SPD-Parteitag in Karlsruhe wählte Newcomer Matthias Platzeck, den Ministerpräsidenten von Brandenburg und bekennenden „Ossi“, mit sensationellen 99,4 Prozent. Ein klassisches DDR-Ergebnis. Doch wohin steuert Europas größte Volkswirtschaft nun? Wie sieht die Politik der Ära Merkel aus? 1. Die große Koalition ist pragmatisch Mit Jubel verabschiedete die SPD jenen Gerhard Schröder, der sie so gut aufzuputschen verstand. Der populäre Emotionsdarsteller hatte die Partei zum Sieg geführt. Der Preis war wachsende Leere. Inhaltlich ist die SPD heute voller Sehnsucht, doch ohne Konturen. Ihre Machtbasis ist deutlich geschmälert. Angela Merkel übernahm die marode, von Skandalen geschüttelte Kohl-Partei in einer Phase der Desorientierung. Auch bei ihr wurden inhaltliche Konturen erst allmählich erkennbar. Wobei Merkels Ratgeber teilweise identisch mit jenen waren, die auch Kanzler Schröder den Weg zu mehr Wachstum und Wohlstand einflüsterten. Zwischenzeitlich suchte Angela Merkel sich ein wenig von der Härte einer Margaret Thatcher zuzulegen, entwarf weit reichende Reformen, versprach ein Tal der Tränen, des Heulens und Zähneklapperns auf dem Weg zum Gipfel ihrer „neuen sozialen Marktwirtschaft“. „Wir müssen mehr für Deutschland tun“, rief sie, „und jeder muss bei sich selber anfangen.“ Echte Begeisterung aber entfesselte Merkel damit nie. Wohl gewann ihre CDU Terrain. Doch als sie in diesem Spätsommer persönlich vors Volk trat, um sich zur neuen Kanzlerin küren zu lassen, war der Jubel äußerst verhalten. Merkel fuhr unter optimalen Bedingungen ein miserables Ergebnis ein. Und ist nun zur großen Koalition gezwungen. Schnell wurde klar, dass am großen Tisch keine grundverschiedenen Weltbilder aufeinander prallen. Die Gestaltungsfantasie der Volksparteien ist geschrumpft, ihre Analyse der Lage ähnelt sich in vielen Punkten so sehr wie die daraus abgeleiteten Rezepturen. Die Schnittmengen sind entsprechend groß. Auch persönlich kam man sich schnell näher. Fast verblüfft registrierte Merkel, man begebe sich nun auf eine „gemeinsame Wanderung mit einem Partner, mit dem wir über 40 Jahre lang in die tiefsten Kämpfe verstrickt waren“. (Was nicht ganz richtig ist: 1969, vor 36 Jahren, endete die bislang einzige SPD-CDU-Koalition.) Man spaziert auf Sicht. Beide Partner hoffen, auf der Strecke ein paar Schilder zu entdecken, die ihnen die Richtung weisen. „Die künftige Koalition verkörpert eher das Durchwursteln, an den großen Fragen haben sich SPD und Union in ihren Verhandlungen vorbeigemogelt“, meint Heribert Prantl von der „Süddeutschen Zeitung“. Doch wird man sich zu wehren wissen, wenn Verbandslautsprecher und die sich tagtäglich drehenden Talkshow-Runden in geübter Manier anheben, den Reiseplan der Wandersleute schon vor der ersten Weggabelung zu zerpflücken. Das wurde sofort klar, als etliche Wirtschaftsbosse letzte Woche losschimpften. Angela Merkel reagierte ebenso unwirsch wie ihr SPD-Vizekanzler Franz Müntefering. Und Edmund Stoiber platzte der Kragen: „Diese Damen und Herren“, fauchte er, „entlassen tausende von Arbeitskräften, kippen sie der Politik vor die Tür und kritisieren uns dann noch.“ 2. „Ossis“ prägen den neuen Stil deutscher Politik Wer den echten Berliner je erlebt hat, weiß, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist: Der deutsche Hauptstädter kommt geradeheraus daher, zuweilen übellaunig. Umgangsformen und Sprache sind frei von allem Barock. Er macht überhaupt ungern allzu viele Worte. Dem Brandenburger – das Land umringt Berlin – wird eine ähnliche Mentalität nachgesagt: schnörkellos, direkt, eher trocken. Im märkischen Sand gedeihe ein recht „nüchternes Völkchen“, sagt der neue SPD-Chef Matthias Platzeck, der sich selbst gern als „bodenständigen Märker“ präsentiert. Angela Merkel, aufgewachsen in Templin, Brandenburg, wird kaum widersprechen. Beide großen deutschen Volksparteien werden nun von Brandenburgern gelenkt, beide 51, beide Naturwissenschafter, beide unbeleckt von der Nachkriegsgeschichte der Westrepublik. Merkel kam 1990 zur CDU, Platzeck 1995 zur SPD. „Angie“ zog sehr zügig an der alten Männergarde der Konservativen vorbei. Ihr neuer SPD-Widerpart sprang jetzt als Überraschungsheld aus der Parteikulisse. Er beendet den ewigen, bitterbösen Kampf der „Enkel“ des letzten großen SPD-Führers Willy Brandt, dieser Schröders, Lafontaines, Scharpings, Engholms. So vage Platzecks Programm noch ist: Der Typ ist völlig neu. Die Genossen sind erleichtert. Platzeck wie Merkel wurden nicht im Kampf groß, auch nicht im Widerstand gegen das DDR-Regime. Ihr Leid hielt sich in Grenzen. Die Pfarrerstochter Merkel und der Arztsohn Platzeck stammen aus besserem Hause. Beide sind Außenseiter und müssen Wert drauf legen, sich zum Innersten ihrer Parteien vorzuarbeiten, dieses herauszuschälen, zu hegen und zu pflegen. Platzeck, der sich „klipp und klar“ dazu bekennt, ein „sozialisierter Ostdeutscher“ zu sein, strebt nach Transparenz und familiärem Umgang in der SPD, nach „Miteinander“ und „Vertrauen auf Dauer“. Taktvoll-beherzt räumte er die Granden der alten Ära vom Podium: Hans Eichel, Wolfgang Clement, Gerhard Schröder selbst. Und schuf so Raum für ein gutes, neues, von keiner Schuld beschwertes Platzeck-Feeling. Sinnstiftung soll folgen. Auch Merkel ist sehr bemüht, sich an den politisch-emotionalen Kern ihrer konservativen Partei heranzuarbeiten, dem Bleibenden in all der Veränderung. Immer wieder intoniert sie ein Credo aus Christentum, Familie und Marktwirtschaft. In der alten Patriarchenpartei zog sie ein Zwischengeschoß effizienter Macher ein. Intern gilt Merkel eher als hart und misstrauisch. Die neuen Partner aber schienen positiv überrascht. Der designierte SPDFinanzminister Peer Steinbrück lobt ihre „Offenheit in der Kommunikation“, gab zu Protokoll, er habe die neue Chefin „sehr unverkrampft, sachlich, keineswegs humorlos“ erlebt. Merkel, deren Wahlkampf ein so enttäuschendes Wahlergebnis zeitigte, ist überdies überraschend stabil. Ursachenforschung in Sachen Niederlage hat sie ihrer Partei erfolgreich verboten. Chefaufpasser Stoiber hat sich selbst demontiert. Und auch die ehrgeizigen Männer in der CDU sind still. Roland Koch durfte fleißig mitkoalieren, als Oberfinanzwart sitzt er nun fest mit im Boot. Ihr derzeit größter Rivale Christian Wulff huldigt Merkel als „Fels in der Brandung“. 3. Merkel hütet Joschkas Vermächtnis Die Außenpolitik war die eigentliche Erfolgsgeschichte des Duos Gerhard Schröder/Joschka Fischer. Was anfangs niemand für möglich gehalten hätte. Rot-Grün begann mit einer echten Feuertaufe, einem NATO-Krieg auf dem Balkan. Joschka Fischer musste bei seinen im Pazifismus verwurzelten Grünen den Krieg als Mittel der Politik hoffähig machen. Nach dem 11. September setzte Gerhard Schröder anfangs auf Solidarität mit den USA, Afghanistan wurde der zweite deutsche Kriegsschauplatz. Doch als sich George W. Bush und Co anschickten, Altfeind Saddam Hussein zum Chefterroristen mit Atomwaffen zu deklarieren, verweigerten Schröder und Fischer die Gefolgschaft. In Deutschland wurde diese Illoyalität gegenüber Washington anfangs scharf kritisiert. Angela Merkel reiste eigens nach Washington, um ihre Treue zu dokumentieren. Nicht ihr gelungenster Auftritt. Schröder bescherte sein Nein zum Irak-Krieg einen zweiten Sieg. Der Innenpolitiker gewann zunehmend Gefallen an der Außenpolitik, die er bis dahin vor allem als eine pragmatische Weltwirtschaftspolitik des Exportweltmeisters Deutschland sah. Die starken Interessen in Russland spiegelten sich in einer freundschaftlichen Nähe zu Kreml-Chef Putin, den Schröder niemals kritisierte. Auch in Peking gab sich der deutsche Kanzler stets fröhlich, machte sich gar für eine Aufhebung des EU-Waffenembargos gegen China stark. Dieses Thema ist nun fürs Erste vom Tisch. Merkel wird sich bemühen, das eisige Verhältnis zu Washington zu verbessern. Bereits Anfang letzter Woche schickte die US-Regierung einen Abgesandten nach Berlin, um mit Unionsleuten wie Wolfgang Schäuble und Friedbert Pflüger neue Möglichkeiten „gemeinsamen Handelns“ zu sondieren. Der kommende SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier kann da kaum im Wege stehen. Nur bremsen. Ein paar Merkel-Freunde in Europa, die Berlin bislang eher mit Verachtung strafte, werden wieder hoffähig: Italiens Premier Silvio Berlusconi etwa, auch Wolfgang Schüssel. Weniger klar ist die Zukunft der zentralen Europa-Achse Paris–Berlin. Das Duo Gerhard Schröder/Jacques Chirac funktionierte lange recht gut. Merkel hingegen ist politisch eher beim ehrgeizigen Innenminister Nicolas Sarkozy. Ihr Lieblingsthema aber, die Verhinderung eines EU-Beitritts der Türkei, steht derzeit nicht auf der Tagesordnung. Die Verhandlungen laufen. Auch gegenüber Putin wird die Kanzlerin mehr Distanz an den Tag legen, was auch die USA und den kritischen Nachbarn Polen freuen dürfte. Männerbündelnde Wärme ist ohnehin ausgeschlossen. Dafür kann die neue Kanzlerin mit dem Präsidenten Russisch reden. Das hat sie in der Schule gelernt. Und mit den Brudersoldaten der Roten Armee einst fleißig geübt. 4. Das soziale Klima wird rauer Schon die Schröder-SPD suchte zu exekutieren, was der Mainstream der Wirtschaftswissenschaft als Weg aus den Zwängen der Demografie und der Globalisierung ansieht: einen Schrumpf- und Sparkurs für den staatlichen Sektor, Abstriche an den Sozialsystemen und die Verbilligung des Faktors Arbeit durch eine Senkung der Sozialkosten sowie einen Abbau der Arbeitnehmerrechte. Dieser Weg wird unter Merkel fortgesetzt. Die Kanzlerin weiß: Dauerhafte Massenarbeitslosigkeit hält das System nicht aus. Doch in beiden Parteien schlagen kräftiger werdende Flügel, die einen Irrweg vermuten und auf die notorische Erfolglosigkeit dieser Rezeptur verweisen. Immer krasser wird die Kluft zwischen der extrem erfolgreichen Exportnation Deutschland und einem seit Jahren stagnierenden Binnenmarkt. Täglich verliert das Land 1000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Was die Binnennachfrage weiter dämpft und den Druck auf die Sozialversicherungssysteme und die Staatskasse weiter erhöht. „Deutschland ist Exportweltmeister und der größte Global Player neben den USA. Aber wir haben eine miserable Binnennachfrage“, moniert etwa Heiner Geißler, lange Jahre die programmatische Seele der Konservativen, „weil die Leute keine Zuversicht mehr haben und keine Hoffnung. Sie sind voller Depression, aber auch voller Wut wegen der offensichtlichen Unfähigkeit der politischen Eliten, den unvermeidlichen Prozess der Globalisierung human zu gestalten.“ Schon haben die Gewerkschaften ein Ende der Geduld angekündigt. Sie glauben das SparMantra nicht mehr und kündigen schon an, die für 2007 geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer mit der Forderung nach entsprechend höheren Löhnen zu kontern. Die große Koalition plant weitere Einschnitte bei der Unterstützung der fünf Millionen Arbeitslosen und will den Kündigungsschutz für die ersten zwei Jahre in einem neuen Job quasi abschaffen. Dadurch wächst die Unsicherheit. Das soziale Klima wird rauer. 5. Die deutsche Politik bleibt turbulent Das gab es noch nie im Nachkriegsdeutschland: Die Mehrheit der Regierung ist üppig. Und doch sitzen ihr im Parlament gleich drei Oppositionsparteien gegenüber, die begierig sind, Alternativen zu formulieren und Fehler aufzuspießen. Vor allem die FDP und die Linkspartei verkörpern die Pole der deutschen Debatte: neoliberal pur gegen klassisch links. Die größte Frage, wie der deutsche Sozialstaat im Zeitalter der Globalisierung und des demografischen Wandels funktionieren kann, bleibt unbeantwortet. Schon ist jedes siebente Kind im Land von Sozialhilfe abhängig. Offen reden die Vorturner der Großkoalition von einem schwierigen „Spagat“ zwischen Sparmaßnahmen und Belebungsversuchen. Noch bevor die Regierung angelobt wurde, verbündeten sich die konträren Oppositionsführer von FDP, Grünen und Linkspartei vergangene Woche in der Überlegung, gemeinsam gegen den Haushalt 2006 zu klagen, in dem einer Neuverschuldung von 41 Milliarden Euro Investitionen von nur 23 Milliarden gegenüberstehen – ein nach der Verfassung verbotenes Missverhältnis, das nur bei einer „Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“ hingenommen werden kann. Die Intimfeinde verfolgen völlig konträre Interessen: Die FDP wünscht eine noch viel härtere Sparpolitik vor allem im Sozialbereich, die Linkspartei hingegen Investitionsprogramme. Doch ein Ziel eint sie: die schwarz-rote Mehrheit zu quälen. Das Problem der Kritiker: Die Mehrheit von CDU-CSU-SPD ist derart üppig, dass die vereinte Opposition nicht auf ein Drittel aller Bundestagsabgeordneten kommt. Dieses Drittel aber ist notwendig, um eine so genannte „Normenkontrollklage“ beim Bundesverfassungsgericht anstrengen zu können. Auch der zweite Weg ist verbaut: Keine Oppositionspartei bestimmt die Geschicke eines Bundeslandes – die werden von fünf SPDund elf CDU-Ministerpräsidenten regiert. Der Ton wird schärfer werden. Groß ist der Drang nach politischer Sinnsuche schon innerhalb der Volksparteien. Die stark auseinander driftende Gesellschaft ist nicht nur für die Sozialdemokraten Dauerthema. Drei profilierungsdurstige Oppositionsparteien garantieren, dass der Zweifel am Kurs der Großen wach bleibt. Und auch in Fachkreisen werden neue Fragen laut. Die immergleichen Ratschläge der Chefökonomen etwa werden längst aus den eigenen Reihen hinterfragt. Schon warnt Peter Bofinger, Enfant terrible unter Deutschlands „Wirtschaftsweisen“, vor „negativen Rückkoppelungseffekten“ und zieht die Bilanz der Ära Schröder in Zweifel: Dessen Agenda- und Sparpolitik habe die Konjunktur „fiskalpolitisch gebremst“. Der Gedanke muss selbst die neuen Koalitionäre beschlichen haben. Eilig wurde die schon beschlossene Erhöhung der Mehrwertsteuer (von 16 auf 19 Prozent) auf den 1.1.2007 vertagt. Zu groß war die Angst, der Markt daheim könnte vor lauter Zukunftsangst der Konsumenten endgültig kollabieren. Und schließlich wird ja schon im Frühjahr 2006 wieder gewählt, quer durch die Republik: in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Von Tom Schimmeck * Artikel schicken * Artikel drucken Profil # » Aboservice # » Covergalerie # » Inhaltsverzeichnis # » Cartoongalerie # » Webdownload # » MAGAZIN AWARD Meinungen ·Leitartikel: Stefan Janny Eigentum braucht Kontrolle ·Elfriede Hammerl Wunschkinder ·Georg Hoffmann-Ostenhof Der Fall Irving ·Peter Michael Lingens War der Irak-Krieg doch berechtigt? ·Rainer Nikowitz Und – bamm! profil 47/05 ·Ende der Debatte: Andersrum? Natürlich! Homosexualität ist biologisch determiniert ·Bank für Arglosigkeit und Wegschauen Warum Zwettlers Rücktritt die Krise nicht entschärft ·Die oberen Sechzigtausend: Umverteilung Wie müsste gerechte Steuerpolitik aussehen? ·Wohnungseinbruch: Auf Biegen & Brechen Die Polizei bläst zur Jagd auf Einbrecherbanden ·Neues Deutschland: Hofübergabe in Berlin Diese Woche beginnt eine neue politische Ära ·Interview: „Der Wille zur Auslöschung“ André Glucksmann über sein neues Buch „Hass“ ·Der Foltergeist: US-Regierung in Bedrängnis Die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt TOPNEWS auf networld.at21.11.2005 09:12 Uhr ·ÖGB gibt heute neuen BAWAG-Chef bekannt Nach Refco-Affäre trat Johann Zwettler zurück ·Knalleffekt: Ariel Sharon gründet neue Partei Verlässt nach Scheitern der Regierung Likud-Block ·Liga-Krimi nach GAK-Triumph über Salzburg Top 5-Vereine nur durch vier Pünktchen getrennt ·Moshammer-Mord: Heute Urteil erwartet! Täter hat gestanden: War es Mord oder Totschlag? ·"Werde mit 50 noch auf der Bühne stehen" Christina Stürmer im großen TV-MEDIA-Talk! zurück zur Startseite 1995-2005 © News Networld Internetservice AG | Impressum | AGB | Jobs @ News | Tarife Online | Tarife – Print Im aktuellen PROFIL profil 47/05 » zur PROFIL Startseite USA: Der Foltergeist * Die jüngsten Folterskandale bringen die Regierung in Bedrängnis Folter in Geheimgefängnissen, Einsatz von Chemiewaffen im Irak: Die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Senator McCain versucht zu retten, was zu retten ist. Meldungen über den Missbrauch von Gefangenen in US-Gewahrsam sind häufig geworden – so häufig, dass es nur noch die skurrileren über die Wahrnehmungsschwelle der Weltmedien schaffen. So wie die Geschichte der beiden irakischen Geschäftsleute Thahe Mohammed Sabar und Sherzad Khalid vergangene Woche: Sie gaben an, 2003 in einem der Paläste von Ex-Diktator Saddam Hussein von US-Soldaten in einen Löwenkäfig gestoßen worden zu sein. Erst als die Löwen ihnen gefährlich nahe kamen, habe man sie hektisch wieder herausgezogen. „Das hört sich ziemlich weit hergeholt an“, kommentierte USVerteidigungsminister Donald Rumsfeld die Klage der Iraker. Zweifellos – nur durchaus vorstellbar. Die Beweislast in Foltersachen liegt längst bei den amerikanischen Soldaten und Agenten, ihr Ruf ist gründlich ruiniert. Die Geschichte mit den Löwen war nur ein Detail in einer Woche, in der es für das öffentliche Ansehen der USA wieder einmal knüppeldick kam. Am selben Tag musste die US-Armee ihre Dementis gegen die Berichte eines italienischen Fernsehsenders aufgeben und eingestehen, während ihrer Offensive gegen die Stadt Falluja im November 2004 Phosphorgranaten eingesetzt zu haben – nur gegen Aufständische und nicht gegen Zivilisten. Bei den verkohlten Leichen fällt die Überprüfung allerdings schwer. Und auch die Entdeckung von 170 unterernährten und teils schwer misshandelten Irakern in einem Gebäude des irakischen Innenministeriums in Bagdad wirft einen dunklen Schatten auf die Amerikaner. Zwar waren es US-Soldaten, die die Gefangenen befreiten. Doch die Versuche der US-Regierung, jegliche Verantwortung von sich zu weisen, klingen seltsam hohl. „Präsident Bush hat klargestellt, dass die USA keine Gefangenen foltern“, sagte Außenamtssprecher Adam Ereli. „Wir erwarten, dass unsere Alliierten denselben Standards gehorchen.“ Tatsache ist: Die US-Armee und der Geheimdienst CIA foltern sehr wohl, mit rechtlicher Rückendeckung durch das Weiße Haus. Das geht aus unzähligen Zeitungsberichten, Zeugenaussagen, offiziellen Untersuchungen und bekannt gewordenen Dokumenten der letzten Monate und Jahre zweifelsfrei hervor (siehe Kasten). Wenn die US-Regierung heute einen moralischen Führungsanspruch stellt und eine Vorbildwirkung für sich reklamiert, erntet sie nur noch Zynismus. Die „hearts and minds“ sind verloren. Im Irak, zu dessen Demokratisierung die Amerikaner ausgezogen sind, wird heute immer noch gefoltert. Acht bis zehn weitere Kerker, von irakischen Spezialeinheiten betrieben, soll es allein in Bagdad geben. Die US-Truppen sind für die Sicherheit offiziell nicht mehr verantwortlich. Doch die Ausbildung der irakischen Armee und Polizei liegt in ihren Händen. Damit ist genau das eingetreten, wovor Anti-Folter-Experten immer gewarnt haben: Weicht man nur einen Millimeter vom absoluten Folterverbot ab, nimmt das Unheil fast zwanghaft seinen Lauf und zerstört Disziplin und Moral bis ins letzte Glied. „Wir müssen auch unsere dunkle Seite einsetzen“, sagte US-Vizepräsident Dick Cheney direkt nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und meinte damit eigentlich nur den Umgang mit der Führungsriege der al-Qa’ida. Doch damit war der Foltergeist aus der Flasche entwichen. Widerstand. Die Anschuldigungen gegen US-Regierung, Armee und Geheimdienst sind nicht neu. Doch nun setzt sich mit jedem Tag mehr die Überzeugung durch, dass die USA tatsächlich von fortschreitender Verschurkung befallen sind. Selbst bei ehemaligen Verteidigern der Regierung Bush regt sich Widerstand. Zum Beispiel in Europa. Anfang November schreckte die „Washington Post“ Europa mit der Meldung auf, die CIA unterhalte in „mehreren osteuropäischen Demokratien“ Geheimgefängnisse für die knapp 30 Topterroristen der al-Qa’ida. Seither haben Behörden und Medien auf dem ganzen Kontinent Hinweise zusammengetragen. Hauptsächlich handelt es sich dabei um die Flugdaten von CIA-Flugzeugen, die in den letzten Jahren im Zickzack durch Europa geflogen sind, mit dem spanischen Mallorca und Island als Drehscheiben. Nun sind es gerade ehemalige Mitglieder von Bushs „Koalition der Willigen“, die besonders scharf gegen die USA vorgehen. Spanien und Dänemark ermitteln wegen illegalen Gefangenentransports gegen die CIA, Italien hat sogar schon gegen 22 Agenten Haftbefehle wegen Entführung erlassen. Der italienische EU-Justizkommissar Franco Frattini will die Vorwürfe in jedem Fall weiterverfolgen, notfalls strafrechtlich. Auch in den USA selbst wächst die Opposition gegen die Häftlings- und Folterpolitik des Weißen Hauses. Die Justiz dehnt in winzigen, aber stetigen Schritten ihre Befugnisse über das Gefangenenlager in Guantanamo aus. Republikanische Senatoren und Abgeordnete gehen ein Jahr vor den Kongresswahlen auf Distanz zu Bush, dessen Umfragewerte im Sinken sind. Vor allem der republikanische Senator John McCain aus Arizona, der Ambitionen auf das Präsidentenamt hat, bläst zur Attacke und versucht, Amerika zurück auf den Pfad der Tugend zu bringen. McCain ist überzeugter Anhänger eines absoluten Folterverbots. Während seiner mehrjährigen Kriegsgefangenschaft in Vietnam zerschmetterten ihm Soldaten des Vietcong die Arme. Noch heute kann er sie nicht über den Kopf heben, seine Frau muss ihn kämmen. Aufgerüttelt durch den Brief des jungen amerikanischen Offiziers Ian Fishback aus dem Irak, hat McCain in den vergangenen Wochen eine große Folterdebatte losgetreten. Fishback hatte 16 Monate lang versucht, von seinen Vorgesetzten zu erfahren, welche konkreten Regeln für den Umgang mit irakischen Gefangenen gelten – erfolglos. Zu groß ist die Verwirrung, die das Weiße Haus mit dem Abschied von den Genfer Konventionen im „Krieg gegen den Terror“ in den eigenen Reihen ausgelöst hat. Neues Gesetz. „Das bringt uns um“, sagt McCain. „Amerikas Ansehen ist am Tiefstpunkt.“ So wie alle Anti-Folter-Experten hält er durch Folter erzwungene Geständnisse für wertlos und Folter selbst für kontraproduktiv. „Wir laufen Gefahr, so zu werden wie unsere Feinde“, warnt der Senator. Im Oktober brachte er einen Gesetzesentwurf im Senat ein, der in Zukunft wieder jede „grausame, unmenschliche oder erniedrigende“ Behandlung von Gefangenen verbieten soll. Er gewann mit 90 zu neun Stimmen – und das, obwohl Vizepräsident Dick Cheney mit intensivem Lobbying bei republikanischen Senatoren zumindest eine Ausnahme für die CIA erwirken wollte. Auch die noch fehlende Abstimmung im Repräsentantenhaus dürfte McCain gewinnen. Mit allen Mitteln versucht daher das Weiße Haus, sie zu blockieren. Für den Notfall hat Bush bereits mit einem Veto gedroht: Das Folterwerkzeug will er sich nicht aus der Hand nehmen lassen, auch wenn 51 Prozent der Amerikaner sagen, Folter sei nie oder selten gerechtfertigt. Dabei werden selbst aus der CIA Stimmen für eine Rückkehr auf klar definierten rechtlichen Boden laut. In Geheimgefängnissen sitzen mindestens ein Dutzend Häftlinge, die die CIA wieder loswerden will – nur gibt es dafür keine rechtlichen Verfahren, keine Gesetze. „Wo ist der Aus-Knopf?“, fragt ein CIA-Mitglied frustriert. Von Sebastian Heinzel * Artikel schicken * Artikel drucken Profil # » Aboservice # » Covergalerie # » Inhaltsverzeichnis # » Cartoongalerie # » Webdownload # » MAGAZIN AWARD Meinungen ·Leitartikel: Stefan Janny Eigentum braucht Kontrolle ·Elfriede Hammerl Wunschkinder ·Georg Hoffmann-Ostenhof Der Fall Irving ·Peter Michael Lingens War der Irak-Krieg doch berechtigt? ·Rainer Nikowitz Und – bamm! profil 47/05 ·Ende der Debatte: Andersrum? Natürlich! Homosexualität ist biologisch determiniert ·Bank für Arglosigkeit und Wegschauen Warum Zwettlers Rücktritt die Krise nicht entschärft ·Die oberen Sechzigtausend: Umverteilung Wie müsste gerechte Steuerpolitik aussehen? ·Wohnungseinbruch: Auf Biegen & Brechen Die Polizei bläst zur Jagd auf Einbrecherbanden ·Neues Deutschland: Hofübergabe in Berlin Diese Woche beginnt eine neue politische Ära ·Interview: „Der Wille zur Auslöschung“ André Glucksmann über sein neues Buch „Hass“ ·Der Foltergeist: US-Regierung in Bedrängnis Die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt TOPNEWS auf networld.at21.11.2005 09:12 Uhr ·ÖGB gibt heute neuen BAWAG-Chef bekannt Nach Refco-Affäre trat Johann Zwettler zurück ·Knalleffekt: Ariel Sharon gründet neue Partei Verlässt nach Scheitern der Regierung Likud-Block ·Liga-Krimi nach GAK-Triumph über Salzburg Top 5-Vereine nur durch vier Pünktchen getrennt ·Moshammer-Mord: Heute Urteil erwartet! Täter hat gestanden: War es Mord oder Totschlag? ·"Werde mit 50 noch auf der Bühne stehen" Christina Stürmer im großen TV-MEDIA-Talk! zurück zur Startseite 1995-2005 © News Networld Internetservice AG | Impressum | AGB | Jobs @ News | Tarife Online | Tarife – Print Im aktuellen PROFIL profil 47/05 » zur PROFIL Startseite Interview: „Der Wille zur Auslöschung“ Der französische Philosoph André Glucksmann über sein neues Buch „Hass“, über Selbstmordattentäter, den Flächenbrand in den französischen Vorstädten und die Verschmelzung von Hiroshima und Auschwitz. profil: Ihre jüngste Publikation dreht sich um die Rückkehr des Hasses: In Frankreich hat dieses Motiv buchstäblich brennende Aktualität gewonnen. Wer und was steckt Ihrer Meinung nach hinter den Ausschreitungen in den Vorstädten? Glucksmann: Diese Brandstifter sind weder „alle Jugendlichen“ noch „die Jugend“ in den Banlieues. Es handelt sich um eine Minderheit, in deren Aktionen es durchaus etwas Neues gibt. Angezündete Autos kennt man aus der Vergangenheit. Aber jetzt stecken diese jungen Menschen Busse in Brand, die voll besetzt sind. In diesen Bussen saßen auch Kinder und alte Leute. Es gab beispielsweise eine behinderte Frau, die Brandwunden zweiten Grades davontrug und vom Buschauffeur gerade noch gerettet werden konnte. Man muss sehr genau hinsehen: Es handelt sich bei diesen Vorfällen keineswegs um eine islamistische Revolution. Denn sowohl diese Frau als auch der Busfahrer sind Muslime. Die Attentäter berücksichtigen also bei ihren Aktionen weder Hautfarbe noch kulturelle Zugehörigkeit. Es handelt sich bei den gegenwärtigen Ausschreitungen in Frankreich nicht um das Scheitern der Integrationsbemühungen. In Wahrheit war und ist die Integration erfolgreich. Die jugendlichen Täter sind nicht irgendwelche Araber. Ihre Eltern stammen aus arabischen Ländern, doch sie selbst sind französische Staatsbürger. Und in Wahrheit realisieren sie auf brutale Weise, was viele Franzosen denken – nämlich, dass die eigene Stärke, die Macht, ja die Wahrheit darin liege, etwas zerstören zu können und nicht etwas aufzubauen. Das ist eine ganz starke Ausdrucksform des Hasses, sogar der Grund allen Hasses – der Selbsthass. Wenn diese Jugendlichen nun Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder und selbst Fabriken, also den eigenen Arbeitsplatz anzünden, dann kann man von einem bereits selbstmörderischen Selbsthass sprechen. Was diese Minderheit von Jugendlichen momentan in den Banlieues macht, ist im Prinzip dasselbe, was Präsident Chirac macht, wenn er versucht, die Europäische Union zu zerstören. profil: Sie halten Chirac für einen politischen Extremisten? Glucksmann: Wenn Chirac den Polen und den Tschechen verbietet, ihre Stimmen zu erheben, weil das, wie er sagt, Länder seien, die man vom Kommunismus befreit habe, zerstört er einen Grundwert der Union, nämlich das Recht, als gleichwertiger Partner zu sprechen. Wenn Chirac die EU zerschlagen möchte, weil er auf den Landwirtschaftsförderungen besteht, obwohl jeder weiß, dass diese Ausgaben 45 Prozent des Haushalts der Union auffressen, dann verhält sich Chirac nicht anders als Jugendliche, die ihren eigenen Lebensraum niederbrennen. Diese Form des Nihilismus, ausschließlich anderen zu schaden, bestimmt sowohl die französische Außenpolitik als auch das Verhalten der Jugendlichen in den Banlieues. Das offizielle Frankreich täte gut daran, sich im Spiegel jener Ereignisse wiederzuerkennen, die momentan in den Banlieues die Szene beherrschen. Diese Jugendlichen sind bestens integriert – in ein Frankreich, das sich nihilistisch gibt. Frankreich ist zurzeit die Metropole des Nihilismus in Westeuropa! profil: „Hass“, Ihr neues Buch, trägt einen ominösen Untertitel: „Die Rückkehr einer elementaren Gewalt“. Was genau kehrt da zurück? Glucksmann: Die Rückkehr betrifft die Sichtbarkeit des Hasses, das Phänomen war ja nicht verschwunden. Die Idee, das 20. Jahrhundert sei eine Epoche ohne Hass gewesen, ist ziemlich absurd. Sicher haben die Ideologien dieser Zeit versucht, den Hass zu verdecken, ihn unsichtbar zu machen, oder er hat ihnen als Alibi gedient, doch er hat immer weiterexistiert. Ich definiere den Hass anders etwa als den deutschen Begriff der „Feindlichkeit“: Der Hass meint nicht einfach die Überlegenheit, die Verachtung, ja nicht einmal Unterdrückung und Versklavung. Nein, der Hass will die reale Beseitigung des anderen. Das meint etwa die Vernichtungslager. Der Hass steht im Blickfeld des Todes, während die „Feindlichkeit“ sich schlimmstenfalls in der Knechtschaft des anderen ausdrückt. profil: Wo orten Sie nun diese tödliche Form des Hasses? Glucksmann: In den Ideologien des NS-Staates, im Kommunismus, im radikalen Islamismus, bei Milosevic und seinem Serbentum, das eine Mischung aus nationalsozialistischer und kommunistischer Hasserfüllung war. Aber ich meine damit auch die orthodoxe Kirche und bestimmte Gangs. Hinter all diesen Ideologien steckt der Kern des Hasses, der die Auslöschung will. profil: Sie schreiben, es gebe klare Verbindungen zwischen Antisemitismus, Frauenhass und dem sehr gegenwärtigen Antiamerikanismus. Ist das nicht ein wenig pauschal? Glucksmann: Nein, es gibt da unverkennbare Verbindungen, der Hass kann von einem Aspekt zum anderen wechseln. Antisemitismus kann sich etwa in Antiamerikanismus verwandeln. Aber alle drei Aspekte haben noch etwas Wesentliches gemeinsam. Jean-Paul Sartre hat es hinsichtlich des Antisemitismus genau analysiert: Er erkannte, dass Antisemiten meist gar keine Juden kennen. Hitler kannte sie nicht, selbst Eichmann hatte nur wenig Ahnung vom Jüdischen. Der Hass auf die Juden bedarf keiner Kenntnis ihrer Existenz. Der Hass ist eben zuallererst ein Selbsthass. Wenn man Antisemit ist, so ist man das nicht, weil die Juden alle Frauen und alles Geld an sich gerissen hätten, sondern weil man selbst nicht alles Geld und alle wunderschönen Frauen besitzt! Man akzeptiert den eigenen Mangel, die eigene Endlichkeit des Wollens nicht. Man möchte Gott gleich sein und meint, die Juden würden einen daran hindern. profil: Wie wirkt der Hass konkret? Glucksmann: In Europa gibt es eine Mehrheit, die in gewisser Weise antiamerikanisch eingestellt ist. Man hat natürlich das Recht, Kritik an den USA zu üben. Es gibt sogar gute Gründe dafür. Es zeigt sich aber, dass die Menschen bei uns viel mehr gegen Bush sind als gegen Putin, obwohl der russische Präsident den schrecklichsten Krieg unserer Zeit führt: den Feldzug gegen die Tschetschenen, der einer Auslöschung jener Bevölkerung gleichkommt. Gegen diesen brutalen Krieg wird aber überhaupt nicht demonstriert, andererseits gibt es überall Großdemonstrationen gegen Bush und seine Irak-Politik. Das ist ein immenses Ungleichgewicht, das zeigt, dass man eigentlich nicht für den Frieden auf die Straße geht, sondern aus Gründen des Hasses auf Amerika. Wenn man für den Frieden demonstrieren wollte, müsste man es zumindest gegen beide Kriege tun. Der Antiamerikanismus ist vor allem in Westeuropa verbreitet. In Frankreich ist das ganz evident: Man hasst die USA, weil sie als Weltmacht Frankreich nicht erlauben, die Welt zu regieren, wie Frankreich das zu napoleonischen Zeiten zu tun glaubte. Es ist also Frankreich, das seine machtpolitische Endlichkeit nicht begreift. Sicher, die USA sind die einzig verbliebene Weltmacht, aber es ist Frankreich, das diese Macht erst in einen gottgleichen Zustand erhebt. profil: Mit Russlands Politik scheint Europas Politik tatsächlich kaum Probleme zu haben. Auch zwischen Gerhard Schröder und Wladimir Putin hat sich eine Art Männerfreundschaft entwickelt. Glucksmann: Wie kann ein Sozialdemokrat sagen, Putin denke und handle demokratisch – wo doch jeder weiß, wie der russische Präsident die öffentliche Meinung unterdrückt und die Medien kontrolliert? Putin versucht offensichtlich, die tschetschenische Bevölkerung auszulöschen, aber er unterdrückt auch die russische. Wie kann man akzeptieren, dass die Macht in Russland mehr und mehr von einer kleinen Gruppe von Putin-Getreuen ausgeübt wird? Wobei man festhalten muss, dass Russland immer noch eine Weltmacht darstellt, was Militär, Waffenarsenal oder Erdölvorkommen betrifft. Als Putin bei Schröders Geburtstag wie ein Zar aufgetreten ist, mit einer musizierenden Kosakentruppe, habe ich mich gefragt: In welcher Welt leben wir eigentlich? Was bedeutet denn diese Freundschaft? Ist Schröder blind? Oder ist er ein Kolonialist? Ich glaube, Letzteres ist der Fall. Es gibt da nämlich ein historisches Faktum. Der effizienteste Teil der zaristischen Administration im 19. Jahrhundert bestand aus den Deutschen und baltischen Baronen. Erleben wir also eine neue Form von illusionistischer Kolonialisation? Wenn deutsche Politiker nämlich glauben sollten, sie seien intelligenter als die Russen, so ist das eine gewaltige Fehleinschätzung, die der Situation zu Beginn des 20. Jahrhunderts ähnelt. profil: Denken Sie, das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland wird sich durch die neue Kanzlerin Angela Merkel ändern? Glucksmann: Ich habe da ein ganz klein wenig Hoffnung, weil Frau Merkel aus der DDR stammt, ebenso wie der neue Parteivorsitzende der SPD, Matthias Platzeck. Beide wissen, wie ein totalitäres Regime funktioniert. Sie sollten das niemals vergessen. profil: Sie haben die „menschliche Bombe“, den Selbstmordattentäter, als das größte philosophische Problem unserer Epoche bezeichnet. Glucksmann: Jeder Mensch erkennt heute an, dass der Atombombenabwurf auf Hiroshima keine einfache Kriegshandlung bedeutete, sondern einen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Also ist das auch ein Problem der Philosophie. Ebenso widerspricht heute kaum jemand mehr der Feststellung, dass Auschwitz kein einfaches Gefangenenlager gewesen sei, sondern ein Markstein in der Geschichte menschlicher Barbarei. Das ist also auch eine philosophische Problemstellung. Sartre, der keineswegs einer religiösen Sekte angehörte, sprach vom „absoluten Bösen“. Er habe es kennen gelernt, durch die Realität der Konzentrationslager. Sartre benutzte mit dem „absoluten Bösen“ einen Begriff, den man aus der christlichen Religion kennt. Und er sagte weiter, dass nach Hiroshima die Menschheit folgende Wahl habe: Jeden Morgen sollten wir uns fragen, ob wir am Ende der Welt einfach teilnehmen wollen oder ob wir es abwehren können. Nach 1945 haben wir zwei Entdeckungen gemacht: dass es Menschen gibt, die dazu fähig sind, die Humanität zu vernichten – das ist Auschwitz –, und solche, die in der Lage sind, die Menschheit auszurotten – das ist Hiroshima. profil: Heute stellt sich diese philosophische Problemstellung aber schon wieder anders. Glucksmann: Ja, heute treffen beide Elemente aufeinander, Auschwitz und Hiroshima werden ineinander geblendet. Vor dem 11. September 2001 gab es neun Atommächte, kleinere und größere, die das schrittweise Ende der Menschheit auslösen konnten. Seit dem 11. September ist diese tödliche Kapazität in den Händen von, ja, sagen wir: jedermann. Wenn zwanzig Personen, die ein Kapital zur Verfügung haben, das dem Kaufpreis eines größeren Apartments in New York entspricht, nach einer Vorbereitungszeit von zwei Jahren fähig sind, zwei Türme in Manhattan einstürzen zu lassen, dann sind sie auch fähig, ein Atomkraftwerk anzugreifen und dabei einen Schaden anzurichten, der jenem von Hiroshima gleichen könnte. Und wenn so etwas 20 Leute hinkriegen, dann kann man sicher sein, dass es noch viele, viele andere gibt, die das ebenfalls bewerkstelligen können. Es gibt also viele mögliche Hiroshimas! Die Macht der atomaren Verwüstung ist nicht mehr begrenzt auf ein paar Atommächte. Nun zeigt der Angriff auf die Türme in Manhattan aber auch Folgendes: Man tötet beliebig viele Menschen, das ist der Wille des absoluten Tötens, wie wir ihn von Auschwitz her kennen. Die Fähigkeit und der Wille zur Auslöschung sind das neue Problemfeld der Philosophie, weil sie bei gewissen Menschen eine gedankliche Einheit bilden. Diese Menschen sind keine Staaten, sie führen keine Kriege, sie verhandeln nicht, und es ist äußerst schwierig, sie zu kontrollieren. Es sind „lebende Bomben“, die nicht ausschließlich dem Lager der radikalen Islamisten angehören. Der Wille zur Auslöschung geht über diese Gruppe weit hinaus. Das ist absolut neu und bedarf einer philosophischen Bearbeitung, weil es gerade die Philosophie ist, die das mögliche Ende der Menschheit vor Augen hat. profil: Wie kann nun der Hass, den Sie beschreiben, im neutralen Österreich seine Wirkung zeigen? Glucksmann: Mir ist die Neutralität Österreichs nicht völlig klar. Wie kann man einer mächtigen Gemeinschaft wie der Europäischen Union angehören, die sich alles andere als neutral verhält, und doch selbst Neutralität reklamieren? Verhält sich Österreich – etwa als Mitglied der Vereinten Nationen – „neutral“, wenn es um die Bekämpfung eines Genozids geht, der gerade auf dieser Welt verübt wird? Nein, wird man sagen. Aber erst unlängst gab es ja den Fall einer weltweiten „Neutralität“. Leider hat fast die ganze Weltgemeinschaft zum Genozid in Ruanda geschwiegen. Diese Art von Neutralität ist ein Verbrechen, ein Verbrechen der Gleichgültigkeit, ein Verbrechen der Willfährigkeit, ein Verbrechen der Komplizenschaft! Das Wort „Verbrechen der Gleichgültigkeit“ stammt von einem österreichischen Schriftsteller: Hermann Broch. Als er aus dem amerikanischen Exil 1945 nach Europa zurückkehrte, fragte man ihn, ob er jetzt alle Deutschen und alle Österreicher für Nazis halte. Broch verneinte heftig: Die Nazis und Faschisten seien eine Minderheit gewesen. Die Sünde Europas sei es vielmehr gewesen, die Nazis walten zu lassen, ohne rechtzeitig einzugreifen. Das ist Brochs „Verbrechen der Gleichgültigkeit“. Mir fällt hier das schöne Wort auf Deutsch ein: „wegschauen“. profil: Und aus der Gleichgültigkeit hat sich so etwas wie eine Globalisierung des Hasses ergeben? Glucksmann: Die erste Form der Globalisierung begann mit dem Jahr 1914. Es ist die Globalisierung der Kriege, die den totalen Krieg, totalitäre Revolutionen und schließlich den Terrorismus nach sich gezogen haben. Der heutige Hass der international agierenden Terroristen zielt auf die Vernichtung von Menschen, egal, welcher sozialen oder kulturellen Zugehörigkeit. Die Globalisierung betrifft nicht in erster Linie die Wirtschaft oder die Politik, sondern die Handhabung von Waffen, von der Kalaschnikow bis zu nuklearen Bomben. Das ist der weltweite Hass, der sich als absoluter Wille zur Auslöschung manifestiert. Gegen diesen Hass müssen wir uns ab sofort zur Wehr setzen. Interview: Andreas Puff-Trojan André Glucksmann, 68, wurde als Sohn österreichisch-jüdischer Emigranten in Boulogne-surMer geboren. Er gehört mit Bernard-Henri Lévy und Alain Finkielkraut zu Frankreichs „Neuen Philosophen“, die in teils sehr persönlicher Auseinandersetzung mit dem Marxismus philosophisch konkrete Kritik an totalitären Systemen und undemokratischen Strukturen üben. Zu Glucksmanns bekanntesten Büchern zählen „Die Meisterdenker“, „Köchin und Menschenfresser“, „Politik des Schweigens“, „Philosophie der Abschreckung“ und „Die Macht der Dummheit“. In seiner jüngsten Publikation „Hass“ geht Glucksmann von drei elementaren Äußerungen des Hasses aus: Antisemitismus, Frauenhass und Antiamerikanismus. Diese drei Formen scheinen sich gegenwärtig in einer Gruppierung zu bündeln: den radikalen Islamisten. Die eigentliche Wurzel des Hasses sieht Glucksmann jedoch nicht im religiösen Fundamentalismus, sondern in einem Selbsthass, der sich in extremem Zerstörungswillen entlädt: „Ich hasse, also bin ich“, lautet die pervertierte Formel von Descartes’ Selbsterkenntnis. Glucksmann beruft sich auf die griechische Tragödie und Michel de Montaigne, um zu zeigen, dass der Hass auch in Westeuropa auferstanden ist. André Glucksmann: Hass. Die Rückkehr einer elementaren Gewalt. Aus dem Französischen von Bernd Wilczek und Ulla Varchmin. Nagel & Kimche, 286 S., EUR 19,90 * Artikel schicken * Artikel drucken Profil # » Aboservice # » Covergalerie # » Inhaltsverzeichnis # » Cartoongalerie # » Webdownload # » MAGAZIN AWARD Meinungen ·Leitartikel: Stefan Janny Eigentum braucht Kontrolle ·Elfriede Hammerl Wunschkinder ·Georg Hoffmann-Ostenhof Der Fall Irving ·Peter Michael Lingens War der Irak-Krieg doch berechtigt? ·Rainer Nikowitz Und – bamm! profil 47/05 ·Ende der Debatte: Andersrum? Natürlich! Homosexualität ist biologisch determiniert ·Bank für Arglosigkeit und Wegschauen Warum Zwettlers Rücktritt die Krise nicht entschärft ·Die oberen Sechzigtausend: Umverteilung Wie müsste gerechte Steuerpolitik aussehen? ·Wohnungseinbruch: Auf Biegen & Brechen Die Polizei bläst zur Jagd auf Einbrecherbanden ·Neues Deutschland: Hofübergabe in Berlin Diese Woche beginnt eine neue politische Ära ·Interview: „Der Wille zur Auslöschung“ André Glucksmann über sein neues Buch „Hass“ ·Der Foltergeist: US-Regierung in Bedrängnis Die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt TOPNEWS auf networld.at21.11.2005 09:16 Uhr ·ÖGB gibt heute neuen BAWAG-Chef bekannt Nach Refco-Affäre trat Johann Zwettler zurück ·Knalleffekt: Ariel Sharon gründet neue Partei Verlässt nach Scheitern der Regierung Likud-Block ·Liga-Krimi nach GAK-Triumph über Salzburg Top 5-Vereine nur durch vier Pünktchen getrennt ·Moshammer-Mord: Heute Urteil erwartet! Täter hat gestanden: War es Mord oder Totschlag? ·"Werde mit 50 noch auf der Bühne stehen" Christina Stürmer im großen TV-MEDIA-Talk! zurück zur Startseite 1995-2005 © News Networld Internetservice AG | Impressum | AGB | Jobs @ News | Tarife Online | Tarife - Print Click Here