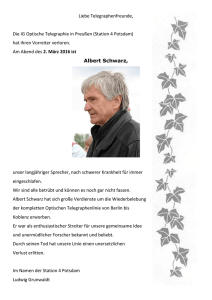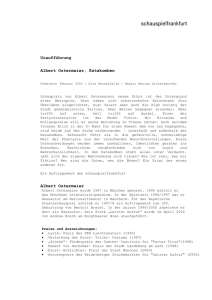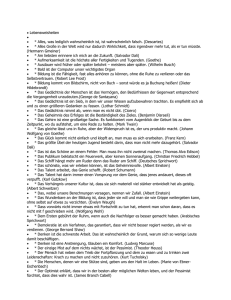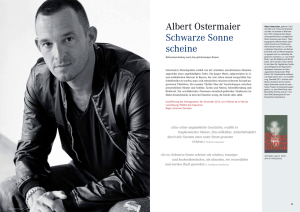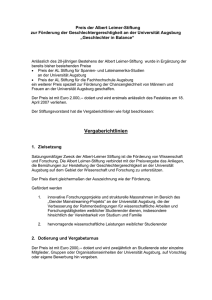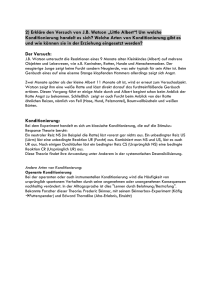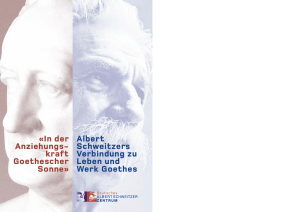Kapitel 21 - Forsthaus Droste
Werbung

Kapitel 21 Morgendämmerung Ein Nebelsee lag über Langenholzhausen; nur die Kirchturmspitze ragte daraus empor. Vom Forsthaus konnte Förster Zernikow über den See die Sonne aufgehen sehen. Sein Arbeitszimmer lag mit Blick auf das Dorf im Erdgeschoss, am Waldrand, oberhalb des Buchengrundes. Am gegenüberliegenden Habichtsberg stand nur noch das Haus von Albert Diestelfink außerhalb dieses Schleiers, der sich wie ein Betttuch über den Ort gelegt hatte. Es schien, als gäbe es nur diese beiden Häuser. Das Gesicht von Hermann Zernikow spiegelte das warme, rote Licht wieder. Er saß an seinem großen, reich mit Arabesken und Eichenlaub verzierten Schreibtisch. Der Deutsch Drahthaar lag rechts daneben auf einer Wildschweinschwarte, die von einem gewaltigen Keiler stammte, den er vor Jahren im Revier erlegt hatte. Der Förster stopfte sich seine Pfeife mit dem rumgetränkten Mapple Leaf Tabak, nahm sie in den Mundwinkel und entzündete sie mit einem Streichholz. Hermann paffte einige Male; die Flamme wurde tief in den Pfeifenkopf gesogen und schoss noch ein letztes Mal in die Höhe, als er das Streichholz wegnahm und ausschüttelte. Er legte das verkohlte Stück Pappelholz in den Hirschhornaschenbecher, lehnte sich zurück und sah über die Nebeldecke hinüber zu Diestelfinks kleinem Haus, das von zahlreichen Sträuchern und Obstbäumen grün umkränzt war. Die aufgehende Sonne machte aus allem eine Zauberlandschaft. Je höher sie stieg, desto mehr Dunstsäulen stiegen auf. Hermann Zernikow genoss diesen Morgen, obwohl ihn das Jagdfieber in den Knochen steckte. Doch die kühle Feuchte dieses Herbstmorgens würde ihren Zoll fordern. Sonntags Morgens blieb Hermann seit längerer Zeit im Hause und las, gemütlich am Schreibtisch, in seinem ledernen Lehnstuhl sitzend, die Wild und Hund oder ein Buch von Hermann Löns, dem größten Jagd- und Naturschilderer unseres Jahrhunderts, wie er es immer sagte, wenn das Gespräch auf Jagdliteratur kam. Was er dann nicht mochte, war diese belustigende Reaktion, vor allem von jüngeren Kollegen oder Jägern, bei der sie „Hermann Löns, die Heide brennt“ von sich gaben. Hermann Zernikow reagierte dann häufig etwas barsch und klärte diese Jagdidioten über die Genialität Löns auf, erklärte, wie dieser Naturbeschreibungen genauer wiedergeben konnte, als Brehms Tierleben und diese noch erzählerisch ansprechend mit der Geschichte oder der Mythologie verbinden konnte. Bei diesen Gedanken an Löns lehnte sich Förster Zernikow zurück und strich mit den Fingern über das vor ihm liegende Buch „Kraut und Lot“, das er in signierter Erstauflage besaß, ein Schatz für alle Bücherfreunde, ein Buch für waidgerechte Jäger, nichts für Jagdidioten, wie Löns dieses Schießertum in der Jägerei betitelte; ein Wort, das sich in den Wortschatz bei Förster Zernikow eingeprägt hatte. Er nahm es in die Hand und blätterte, bis er zur Geschichte vom Grenzbock kam und fing an darin zu lesen und zu schmunzeln, wobei er ab und zu eine Wolke aus seiner Pfeife ausstieß. Manchmal sah er auf und beobachtete diese Wolke im Sonnenlicht, sah durch sie hindurch, hindurch durch das Fenster, in die Ferne, eine innere Ferne, in der seine Gedanken abschweiften. Dann paffte er wieder und sah hinüber zu Albert Diestelfinks Haus, aus dessen Schornstein eine schlanke, weiße Rauchsäule aufstieg. Albert Diestelfink muss seinen Kamin angezündet haben, dachte Hermann. Zuerst stieg dieser Rauch dunkel und in Wölkchen auf, jetzt schlank und weiß. Hermann nahm das Fernglas von der Fensterbank und sah zu Diestelfinks Haus hinüber. „Ja, ja“, sagte er, „wieder im Laboratorium. – Hm, was der Diestelfink wohl gerade wieder erforscht? Der hätte das Zeug zum Forscher á la Löns!“, sagte Herman Zernikow, legte das Fernglas weg und las, gemütlich zurückgelehnt weiter. Er legte die Füße auf die Schreibtischkante und versank wieder in seiner Welt, einer Welt, die fern von den Stadtmenschen lag, die den meisten Menschen ewig fremd sein würde, gäbe es Leute wie Albert Diestelfink nicht, die als Dorfschullehrer all ihre Begeisterung in die Vermittlung der Vorgänge in der Natur legten. Mit dieser Begeisterung begann Albert Diestelfink nun auch, in seinem Laboratorium, wie es im Volksmund genannt wurde, herum zu wirbeln. Es war eine Art Schuppen, ein lang gezogener Flachdachbau, in dem er in einzelnen Räumen die verschiedensten Apparaturen, Terrarien, Aquarien, Kisten und Kästchen in Regalen stehen hatte. An der Fensterfront entlang waren die Arbeitsflächen zu finden, an denen er an aktuellen Projekten arbeitete. Dort lagen die Bestimmungsbücher bei den diversen Pflanzen- oder Blattteilen, dort lagen die Lupe, die Pinzette und das Skalpell. Dort wertete er seine Naturfunde aus. Albert saß gerade mit dem Mikroskop über einer Probe des Klebrigen Hörnlings, eines schrill orange leuchtenden Korallenpilzes. Seine Sandlaufkäfersammlung war weit bekannt, auch seine heimische Schmetterlingssammlung, die in diversen Anschauungskästchen hinter einer Glasscheibe in einem bestimmten Schubladensystem in den Schränken auf neugierige Blicke wartete, um ihre Farbenkraft noch ein mal zum Leuchten zu bringen, bevor sie mit der Zeit für immer verblassen sollten. Albert Diestelfink war immer neugierig, die beste Voraussetzung zum Forschertum. Er sollte jedoch Lehrer werden, da er nicht die nötigen Verbindungen zu den Professoren hatte und von Haus aus eine alte Familientradition fortsetzen sollte. So verband er nun beides, das Forschen und das Unterrichten. Die Morgensonne schien in sein Labor und tauchte es in warme Farben; sein Kanonenofen strahlte eine gemütliche Wärme ab. Albert Diestelfink sah hinaus in seinen Garten, lauschte auf die Lieder der Singvögel, beobachtete eine Schar Wacholderdrosseln über den Habichtsberg kommend in die abgeernteten Felder einfallen, hörte den Warnruf eines Fasanenhahns und sah eine Ricke mit zwei Kitzen im Waldrand verschwinden. Der Eichelhäher warnte – Albert schaute nun aufmerksamer in seinen Garten. Eine Drossel warnte - etwas stimmte nicht. Dann hörte er einen exotischen Ruf eines Vogels, der hier nicht heimisch war. Alberts Mundwinkel zogen sich hoch, so wie seine Augenbrauen. Er stand auf und öffnete vorsichtig das Fenster. Da hörte er den exotischen Ruf erneut, legte beide Hände an den Mund und imitierte diesen Ruf. Die Antwort war ein doppelter Ruf, den Albert wiederum entgegnete. Dann imitierte er den Ruf der Ringeltaube, der wiederum eine Antwort erhielt. Nun schien die Natur vollends vor Albert Diestelfinks Haus zu erwachen. Ein Reh schreckte, ein Dachs keckerte, ein Bussard miaute, eine Stockente lockte, ein Moorfrosch gluckerte und dann kam wieder dieser exotische Ruf eines Paradiesvogels. Und Albert Diestelfink konnte all diese Tierarten nachahmen. Er lachte nach dem letzten Ruf laut auf und Makishawka kam aus dem Apfelbau gesprungen, biss in einen gerade gepflückten Apfel und ging lächelnd auf das Fenster von Albert zu. Ihre langen, schwarzen Haare glänzten in der Morgensonne, als seien sie aus schwarzem Chrom; ihr von Eusebia Eulenbrink gestrickter Pullover leuchtete in mehreren Farben, die an den Ellenbogen verschmutzt waren, etwas braunes Laub und einige Moosreste hatten sich in den Maschen verfangen und ihre abgetragene Jeans hatte schon zwei kleine Löcher, durch die die braune Haut der jungen Indianerin zu sehen war. „Zeig mir noch mal den Ruf der Bekasine“, bat sie Albert Diestelfink. Der rollte die Zunge vor die Zähne und zog die Unterlippe hinter die Schneidezähne; dann stieß er ein pfeifendes Meckern aus, so dass Makishawka lachen musste. Dann versuchte sie, diesen Ruf ebenfalls zu imitieren, was ihr nicht so recht gelang. Ein Pfeifen war zu hören, etwas Speichel sprühte hervor und dann brach sie den Ruf ab. „Na“, lachte Albert, „klingt eher wie der Warnruf der Murmeltiere.“ Beide mussten laut loslachen. Dann lud Albert sie ein, ins Laboratorium zu kommen. Makishawka lief zur Tür und sprang hindurch. Sie war voller Energie und genoss die freie Zeit. Albert setzte einen Kaffee auf und sie setzten sich in die Ecke beim Kanonenofen, in der ein Ratantisch und zwei Ratansessel standen. Sie tauschten sich lebhaft ihre neuesten Naturerkundungen und Funde aus. Seit Makishawka die Jacobi-Realschule in Hohenhausen besuchte, war sie nicht mehr ganz so häufig bei Albert Diestelfink anzutreffen. Der Kaffee war durch und Albert goss ihn in zwei Becher und schob Makishawka einen hinüber. Sie saß, die Füße unter ihrem Gesäß angewinkelt im Sessel und schaute durch den Raum. Mit beiden Händen hielt sie die Kaffeetasse und pustete den warmen Dunst daraus in den Raum. Unter ihren schwarzen Augenbrauen sahen sich ihre dunklen Augen im Zimmer um. „In welcher Klasse bist du jetzt?“ fragte Albert. „Ich mache nächsten Sommer meinen erweiterten Realschulabschluss.“ „Ach, was die Zeit vergeht – ja, ja.“ Beide schlürften den Kaffee weiter. „Was hast du danach vor, Makishawka?“ „Ich werde studieren.“ „Ja, das ist richtig so“, freute sich Albert, „dann studierst du Biologie?!“ Makishawka schüttelte den Kopf, „nein, Journalismus. Ich will Reporterin werden und über die Natur schreiben und über den Regenwald. Über die Natur hab ich doch schon mehr gelernt, als meine Biologielehrerin, die ist richtig doof, kann kein einziges Tier nachmachen, weiß nichts über die Laufkäfer oder die Nachtschmetterlinge, und ihre Zellbiologie lässt auch zu wünschen übrig.“ „Oh, oh, da hab ich ja eine Fachfrau rangezogen, die schon alles weiß“, schmunzelte Albert. „Über den Regenwald willst du also schreiben?“ „Ja, Albert, wusstest du, dass die immer noch den Regewald zerstören, jeden Tag die Fläche von 42 % der Bundesrepublik?!“ Albert nickte betrübt und wusste, dass Makishawka Recht hatte. Es ist der Weg, den sie gehen musste. Und Alberte unterstützte sie, auch wenn er es lieber gesehen hätte, Makishawka ginge in die Naturwissenschaften. „Ja, das ist gut, dass du darüber schreiben willst.“ „Ich möchte meine Heimat noch einmal wieder sehen und will diese Zerstörung und diesen Mord an unseren Waldvölkern stoppen!“ Makishawka ballte ihre Faust bei den letzten Worten; ihr Blick wurde düster. „Du weißt doch, dass Hass nie zum Ziel führt, immer nur ins Verderben!“ beruhigte Albert sie. Albert hätte lieber über den Klebrigen Hörnling gesprochen oder mit Makishawka die Herbarien durchgesehen und über die Natur gefachsimpelt; bemerkte jedoch, dass sie sich nun mit anderen, größeren Dingen auseinander setzte, mit denen er sich nicht so gerne auseinandersetzen mochte, da es seine Ohnmacht deutlich machte. Albert war von praktischer Natur; er musste die Dinge erkunden, sein Wissen anwenden, erweitern und neue Entdeckungen einordnen, sie systematisieren und wieder anwenden. Er war ein Forscher, kein Politiker; er wusste, er würde die Welt nur im Kleinen verbessern, wenn er den Kindern die Begeisterung für die Natur nahe brachte. Makishawka hatte immer das Ziel vor Augen, eines Tages zurück zu kehren und ihre Heimat von den waldfressenden Maschinen zu befreien. „Woraus ist eigentlich die Tischplatte hier?“ fragte Makishawka und schaute Albert an. „Hm?“ Albert nahm die Brille aus seinem zerzausten Haar und setzte sie sich auf die Nase. „Hm, grobporiges Holz. – Ich schätze, du vermutest richtig. Da werde ich in Zukunft drauf achten müssen.“ „Ja, Albert, das musst du wirklich! Die Menschen dürfen kein Tropenholz mehr kaufen, nur weil es so billig ist!“ „Du hast Recht. Warum nur muss Gewalt und Zerstörung so billig sein?“ Makishawka schaute zum Fenster hinaus und entgegnete nach ihrer ihr eigenen Logik: „Wenn es eine Zerstörungssteuer und eine Kriegssteuer gäbe, wäre das sicher anders.“ Albert musste kurz auflachen. „Ja, genau, und eine Steuer auf Dummheit, da würde die Regierung sich dumm und dämlich bezahlen!“ Beide lachten laut los. „Dann noch eine Steuer auf Gier“, überlegte Albert laut, „da würden die ganzen Großunternehmer endlich mal zur Kasse gebeten werden. „Eine Steuer auf Hass, dann würden sie erst gar keinen Krieg bezahlen können“, warf Makishawka ein. Albert lachte: „Ja, ja, du musst Politikerin werden, dann wirst du unsere erste Kanzlerin!“ Makishawka wurde es nicht; das, so sagt es uns die Geschichte, wurde später eine andere Frau, die keine dieser Besteuerungsmöglichkeiten in Erwägung zog. Leider geschah das Gegenteil. Die Großkonzerne zahlten keine Steuern, das Volk um so mehr, die Armut wuchs und wurde nach langen Diskussionen im Parlament als Präkariat betitelt, um diese Bevölkerungsschicht nicht als Arm oder Unterschicht zu benennen, was einem Eingeständnis des eigenen politischen Versagens gleich käme. Die Zerstörung der Regenwälder hatte noch gewaltigere Ausmaße angenommen und die Erde steht heute vor dem Ökozid. Albert Diestelfink freute sich mit zunehmendem Alter über die Besuche Makishawkas, die immer seltener wurden und verfolgte ihren Weg mit Interesse. Als er in Pension ging, fing er an, über diese Geschichten zu schreiben. Er fand sein literarisches Talent und schrieb einen Abenteuerroman über die Erlebnisse Makishawkas, wie sie Journalismus und Politwissenschaften studierte und an den Studentenunruhen in Göttingen teilnahm, wie sie als erste Indianerin promovierte. Das war Albert Diestelfinks größter Tag. Er war schon Tage davor nervös und reiste mit den Grotewohls und Meiers nach Göttingen. Makishawka war die Kleinste, jedoch die Auffälligste unter den Doktoranten. Ihre schwarzen Haare fielen glatt auf den schwarzen Talar, der Doktorhut saß etwas tief, da er ein wenig zu groß war, leicht nach hinten. Makishawka hatte anstelle des Quastes einige Adlerfedern daran gehängt und trug eine für die Yanomami typische Festbemalung im Gesicht. Es wurde nicht nur akzeptiert, sondern begeistert von den Kommilitonen gefeiert. Nach der Überreichung der Ernennungsurkunde stieß Makishawka ihren Paradiesvogelruf aus. Als sie die Antwort nicht bekam, rief sie wiederholt und schaut zu Albert Diestelfink hinüber und hielt ihre Urkunde hoch. Da sah sie, dass Albert mit den Tränen kämpfte und versuchte, den Ruf zu erwidern; es gelang ihm nicht so recht. Makishawka rief vom Podium herunter: „Albert, das war eher der Ruf eines Murmeltiers!“ Albert lachte, hustete und strahlte sie mit roten Wangen an, über die seine Tränen rannen und nickte ihr zu. Anschließend zogen die Kommilitonen Makishawka mit dem Bollerwagen durch die Fußgängerzone zum Gänselieschen, einer alten Bronzestatue mit Brunnen, die alle neuen Doktoranden, einer alten Studententradition nach, küssen mussten. Jakob Grotewohl machte fleißig seine Photos, Albert unterhielt sich mit Ludwig Meier über Makishawka und wie sie nach Langenholzhausen kam und Eusebia Meier versuchte eine interessierte Studentin zu bekehren, die sich zum Glauben hin zu öffnen schien. Am Gänseliesel angekommen, war schon eine kleine Schar von Studenten anwesend. Es wurde sich gegenseitig zugeprostet, Sekt, Wein oder Bier getrunken. Jakob Grotewohl ließ dann auch schon bald den Fotoapparat über seinen Bauch baumeln und zeigte den Studenten, was man seiner Zeit ein Studentenbier nannte, setzt die Flasche an und lehrte sie, ohne dabei zu schlucken. Ein Student nahm diese Herausforderung an und versuchte, es Jakob gleich zu tun, jedoch mit Bier bekleckert und erfolglos. Die Göttinger kannten dieses Schauspiel am Gänselieschen und lächelten den Studenten zu. An einer Hauswand saß ein alter, weißhaariger Mann auf dem Boden mit einem Schälchen vor sich, in dem einige Münzen lagen. Seine Augen waren trübe und leer, sein Blick nach Nirgendwo geneigt. Eusebia Eulenbrink fielen diese Menschen immer sofort auf, konnte sich jedoch nicht um den alten Mann kümmern, da die Studentin sie mit Fragen zum Glauben löcherte. Eusebia gab ihr die Antworten, die diese junge Frau nicht wirklich befriedigten und immer wieder neue Fragen aufwarfen. An diesem Tag waren einige junge Freichristen aus dem benachbarten Bischhausen in der Fußgängerzone mit dem Verteilen kleiner, religiöser Schriften, so genannten Traktaten, beschäftigt. Eine fröhliche, lächelnde junge Frau sprang zwischen den Studenten herum und drückte jedem, mit den Worten „Jesus liebt dich“ ein Traktat in die Hand. Einige schauten verwundert in das lächelnde Gesicht, andere warfen es gleich wieder weg. Bis auf Eusebia Eulenbrink, die ihre am Glauben interessierte Studentin mit dieser jungen Frau in ein Gespräch verwickelte. Adressen und Telefonnummern wurden ausgetauscht und die Studentin war zum Hauskreis in Bischhausen eingeladen. Eusebia Eulenbrink dankte leise in einem Jubelgebet Jesus und freute sich, dass ihre Geschwister in den Städten aktiv sind. Sie schaute zu dem alten, obdachlosen Mann hinüber und sah, wie sich eine etwas bunt gekleidete Frau zu ihm kniete und mit ihm betete; sie sah, wie dem Alten die Tränen aus den Augen liefen. Eusebia musste immer wieder dorthin schauen. Diese Göttinger Christen schienen es wirklich ernsthaft zu betreiben, zu den Armen und Verlorenen zu gehen. Als die Gruppe der Studenten mit Makishawka im Bollerwagen, die Fußgängerzone wieder verließen, schaute Eusebia noch ein letztes Mal zu dem alten Mann herüber, bei dem nun schon zwei dieser Göttinger Christen knieten. Die bunte Frau nahm den Alten in den Arm und der leger in Jeans und Jeansjacke gekleidete Mann mit etwas zu langem Haar, schien für den Alten zu beten, so laut, dass sich die Passanten in der Fußgängerzone verwundert umdrehten. Eusebia nahm diesen Eindruck von Mut und evangelistischem Engagement mit in ihre kleine Brüdergemeinde nach Hohenhausen. Als die Meiers, Jakob Grotewohl und Albert Diestelfink wieder in Langenholzhausen ankamen, lud sie Jakob zur Feier des Tages mit in den Dorfkrug ein. Ludwig Meier trank eine Apfelschorle, Eusebia Meier, geborene Eulenbrink ein Wasser und Jakob und Albert den Rest des Angebots an alkoholischen Getränken, sehr zum Ärgernis von Eusebia, die an diesem Abend jedoch machtlos war, wie so oft. Am frühen Morgen saßen Albert Diestelfink und Jakob Grotewohl schweigend auf dem Sockel der alten Kanone an der Kalle. Das gelbe Laub der Trauerweide fiel in den Bach und schwamm leise gurgelnd davon. Albert und Jakob tranken ihr Bier und rauchten eine Kuhiba. Bilder der Vergangenheit zogen durch ihre Gedanken, so wie es bei alten Leuten vorkommt, die abends am Ofen sitzen und mit dem Blick in weite Ferne gewandert sind. „Albert“, sagte Jakob, „wir sind alt geworden.“ „Hm – ziemlich, kann man wohl sagen.“ „Es hat sich so viel geändert“, meinte Jakob. „Das ist wahr.“ Albert nahm die Zigarre zwischen zwei Finger und drehte sie hin und her. „Die Zigarren sind besser geworden.“ „Hat mir Johann aus Kuba mitgebracht, sind die besten.“ erwiderte Jakob und drehte sie ebenfalls wie Albert in den Fingern. Beide Männer pafften dann wieder daran und schauten der laubweinenden Weide zu; ihre Blicke schwammen mit der Kalle in die Ferne. Es war still – das Dorf schlief noch. „Buschs Lebensmittelgeschäft gibt es nicht mehr.“ erinnerte sich der Pastor. „Tja, Jakob, dafür haben wir jetzt den Aldimarkt.“ „Ja, das Sägewerk hat auch dicht gemacht.“ überlegte Jakob Grotewohl weiter. „Dafür haben wir jetzt Folia, die stellen alles aus Plastik her.“ Beiden Männern wurde klar, dass sich die Zeit schneller geändert hatte, als sie sich änderten. Die einzige, ihnen zu schnell verlaufende Änderung war die Zahl der Jahre, die beide nun schon auf dieser Welt verweilten. Die Jahre verflogen, doch sie blieben so, wie sie schon immer waren, so meinten sie. Nur bei dem morgendlichen Blick in den Spiegel bemerkten sie, dass ihr Haar grau geworden war, dass das Gesicht durch die zunehmenden Falten markanter geworden ist und ihre Sehkraft sich verändert hatte. Ihr Freundeskreis wurde auch immer kleiner. Einige zogen weg, andere erlagen ihren Krankheiten oder ihrem Alter. In Gedanken gingen sie diesen Personenkreis durch. „Der alte Kreinjobst ist auch schon unter der Erde.“ Pastor Grotewohl war von dem Lauf dieser Dinge von Berufs wegen stärker betroffen und musste an die vielen Beerdigungen denken. „Meierbökens haben sich scheiden lassen und sind auch weggezogen.“ fiel Albert ein. „Dr. Kober habe ich letztes Jahr beerdigen dürfen.“ „Hm, Förster Zernikow fand man mit seiner brennenden Pfeife tot an seinem Schreibtisch.“ erinnerte sich Albert. „Oh, ja, was hat sein alter Drahthaar bei der Beerdigung geheult, als die Jagdhörner spielten.“ „Ja, ja, der arme Hund, ich hab ihn noch in der Nacht vom Friedhof her heulen gehört.“ „Drei Tage hat er geheult, dann fand ihn der Totengräber tot auf dem Grab vom Hermann liegend.“ Albert Diestelfink ergriff dieses Bild, seine Augen wurden feucht. „Ich hatte ihm gesagt, er solle den Hund ebenfalls im Grab von Hermann Zernikow beisetzen; er hätte es so gewollt.“ Jakob zog noch einmal an seiner klein gerauchten Zigarre und trank einen Schluck Bier. „Haste jut gemacht, Jakob.“ Albert zog Jakob mit einem Arm an der Schulter zu sich ran, bzw. zog sich zu ihm hin, da Jakob von kräftigerer Statur war und drückte ihm einen Schmatzer auf die Wange. Der Alkohol ließ ihn emotionaler werden und baute die Schranken zwischen den beiden Männern sichtlich ab. „Haste jut gemacht, Jakob, bist ein guter Pastor!“ Beide Männer rauchten ihren Zigarrenstumpen herunter und warfen ihn in die Kalle. Die Morgendämmerung kam und mit ihr der Schein einer Fahrradlampe. Das Fahrrad kam auf der Brücke zum stehen und Siegfried Nolte stieg ab, um sich die beiden Gestalten unter der Kanone an zu sehen. „Na, wenn das nicht der Herr Pastor und der Herr Lehrer sind, n Morjen wünsch ich.“ Albert und Jakob prosteten ihm mit den leeren Bierflaschen zu und erwiderten den Gruß. Siegfried lachte und rief, während er sein Fahrrad bestieg, „macht mir keine Dummheiten, Jungs!“ und fuhr weiter zu seinen Teichen. „Tja, einige Leute bleiben immer gleich.“ lachte Albert. „Der alte Noltens Siegfried, ja, ja.“ pflichtete ihm Jakob bei. „Der überlebt uns noch alle“, musste Albert resümieren. Einiges blieb doch so, wie es immer war, und dazu schien Siegfried Nolte zu gehören. Das beruhigte die beiden alten Männer unter der Kanone vor der Wassermühle an der Kalle, die sich wie eh und je am Dorfkrug vorbei schlängelte und Langenholzhausen durch den Erlenbruch unterhalb der Försterei meandrierend verließ. Das morgendliche Vogelkonzert begann und Eusebia Meier kam über die Brücke spaziert. Der Rock fiel in weiten Falten bis zu den Knöcheln, die in schwarze Lederschuhe geschnürt waren, die schlichte Jacke war bis zum Hals zugeknöpft, die Haare hochgebunden unter einem farblich angepassten Kopftuch verhüllt, ihr Blick war vor sich auf den Bürgersteig gerichtet, um eventuellen Unebenheiten aus dem Weg gehen zu können. Jakob sah sie und stieß Albert in die Seite. „Psst, musst jetzt ruhig sein, da kommt die Eulenbrink!“ Alfred schaute zur Brücke hinauf und musste grinsen. „Oh, oh. Tja, einige Dinge ändern sich nie.“ „Ne“, meinte der Pastor, „Eusebia Eulenbrink wird immer etwas pünktlicher kommen, wenn mir die Nacht zu kurz geworden ist.“ Albert lachte wieder leise auf und sagte, „so, es wird Zeit, mein Freund, jetzt muß ich dich mit deinem Schicksal allein lassen.“ „Du bist mir ein Freund, Albert.“ lächelte Jakob mit glasigen Augen. Beide Männer verabschiedeten sich an der Kanone unter der Trauerweide und gingen nach Hause. Albert Diestelfink begann sein Buch zu schreiben, ein Buch über die Geschichten aus Langenholzhausen, Abenteuer des Nolten Siegfried und natürlich über die von Makishawka. Im Alter hatte er noch Erfolg und konnte einige Bücher gut verkaufen. Von dem Erlös eröffnete er in Langenholzhausen eine kleine Buchhandlung in Kombination mit einem Antiquariat und nannte es in Gedenken an Makishawka „Büchereservat“. Er schrieb ein Gedicht über seine Liebe zu den Büchern und in Anlehnung an einen Satz, den Makishawka einmal sagte, als sie von den amerikanischen Indianereservaten hörte, sagte sie: „Ich will in kein Reservat, ich lebe lieber in meinem Büchereservat.“ Dieses Gedicht1, das Albert Diestelfink dazu schrieb, hängt nun in seiner Buchhandlung in einer Ecke, in der die Bücher zur Natur zu finden sind. Kommt man heute nach Langenholzhausen, dann findet man diese kleine Buchhandlung in der Nähe der Brücke, die über die Kalle führt. Sollte der alte Albert Diestelfink noch leben, er wird sicher gerne von den Geschichten aus Langenholzhausen erzählen. Ein Besuch würde sich mit Sicherheit lohnen. Im Dorfkrug wird sicher immer ein Zimmer frei sein. Sieht man dann früh morgens aus dem Fenster, dann kann es sein, dass man einen alten, kräftigen, weißhaarigen Mann auf dem Fahrrad über die Brücke fahren sieht. Das ist Noltens Siegfried, das Urgestein von Langenholzhausen, der auf dem Weg zu seinen Fischteichen ist und dort sein morgendliches Bad zu nehmen pflegt. 1 Im Gedichtband „Syrinx“ von Oliver Droste nachzulesen im nove-Verlag