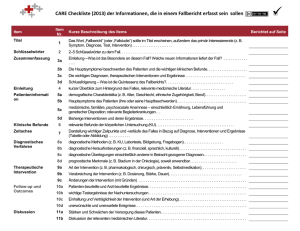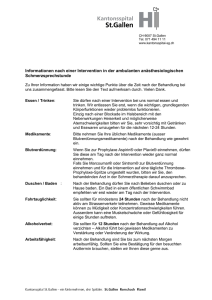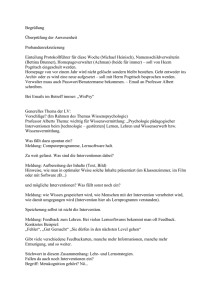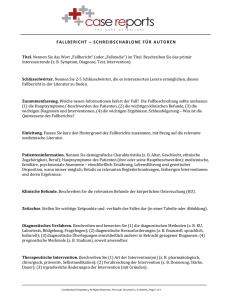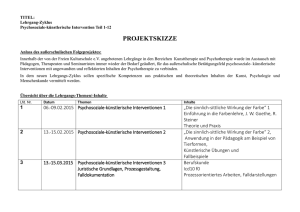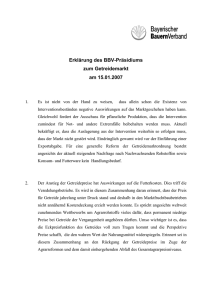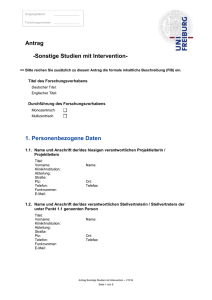"Humanitäre Intervention" und die UN
Werbung

"Humanitäre Intervention" und die UN-Charta Die geplante "Weiterentwicklung" des Völkerrechtes Von Helge von Horn Seit Anfang der neunziger Jahre wird als eine Lösung für kriegerische Auseinandersetzungen oder bei massiven Menschenrechtsverletzungen verstärkt die so genannte "humanitäre Intervention", also eine militärische Intervention in den betreffenden Staat, in Betracht gezogen. In den letzten Jahren geschah dies beispielsweise in Somalia, Bosnien, dem Kosovo, Osttimor, dem Kongo, die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Ziel sollte es meist sein, die Zivilbevölkerung der Krisenregion zu schützen und den Konflikt zu befrieden. Dies schien auch notwendig, denn seit Mitte der neunziger Jahre nahm vor allem der Anteil innerstaatlicher Konflikte, meistens Bürgerkriege, stark zu. Ein Beispiel für die Grausamkeit dieser Konflikte ist sicherlich der Bürgerkrieg in Ruanda, der in einen Völkermord mündete, dem im Jahr 1994, innerhalb weniger Wochen zwischen 500.000 bis 1 Million Menschen zum Opfer fielen. Unabhängig von der Frage nach der Wirksamkeit solcher militärischen Einsätze ergab sich dabei ein Problem: Es ist offensichtlich, dass ein militärisches Eingreifen in einen selbständigen Staat mit dem in der UN-Charta verankerten Grundsatz der staatlichen Souveränität nicht zu vereinbaren ist. Diese Einsätze stehen also vor dem Dilemma, selbst Unrecht zu sein. Eine Lösung soll nun eine Umdeutung des Völkerrechtes bringen, die vor allem von den Regierungen von Kanada und Großbritannien, aber auch mit Unterstützung der deutschen Regierung vorangetrieben wird. Vor allem in Berufung auf den Völkermord in Ruanda 1994 und der Rolle der internationalen Staatengemeinschaft als einem vermeintlichen "bystander to genocide" wurde im Jahr 2000 eine Kommission auf Anregung von Kofi Annan ins Leben gerufen, ihr Name war "International Commission on Intervention and State Souvereignty" - kurz ICISS. Im Herbst 2001 legte sie ihren Abschlussbericht mit dem Titel "The Responsibility to Protect"vor. Eine breitere Diskussion der darin enthaltenen Thesen fand erst in den letzten beiden Jahren statt. Staatliche Souveränität als Verantwortung - The Responsibility to Protect Das Hauptproblem vor dem die Kommission stand, ist die in der UN-Charta in Artikel 2 Absatz 4 festgeschriebene staatliche Souveränität, die jede Einmischung in einen Staat von außen untersagt. Eine militärische Intervention wird durch das Gewaltverbot explizit geächtet und einem Staat für einen solchen Fall sogar ein Widerstandsrecht gegen diese Intervention zubilligt (Artikel 51). Den Ausweg fand die Kommission darin, dass sie den Begriff der staatlichen Souveränität einfach mit neuen Inhalt gefüllt hat. Nach ihrer Auffassung ist staatliche Souveränität von nun an nicht als absolut anzusehen, sondern an eine bestimmte Voraussetzung geknüpft: den Schutz der eigenen Bevölkerung, beispielsweise vor Kriegen oder Verfolgung, aber auch vor Hungerkatastrophen oder durch Naturereignisse verursachtes Leid. Für den Fall also, dass die Bevölkerung eines Landes einem , wie es in dem Bericht heißt "großem Leid" ausgesetzt ist und der Staat diesen Zustand nicht beenden will oder kann, ist die internationale Staatengemeinschaft gefragt. An sie geht die Verantwortung für die Bürger über, der Staat kann sich dann nicht mehr auf seine Souveränität berufen. Der Bericht gliedert dabei die Verantwortung der Staatengemeinschaft in drei Teilverantwortungen: In eine "Verantwortung zu Verhindern" ("Responsibility to Prevent"): Konflikte können nach Ansicht der Kommission vor allem dadurch effektiv verhindert werden, indem demokratische Strukturen und Ökonomische Entwicklung befördert werden. Die Etablierung eines demokratischen Regimes und ein ökonomisches Entwicklungsprogramm, wie von Weltbank und IWF vielfach durchgeführt, sollen Konflikte gar nicht erst entstehen lassen. Die Staatengemeinschaft hat sich dafür einzusetzen. Greifen diese präventiven Maßnahmen aber nicht, soll nach der Vorstellung der Kommission aus der "Verantwortung zu Verhindern" die "Verantwortung zu Reagieren" ("Responsibility to React") erwachsen: Die möglichen Eingriffsmöglichkeiten reichen dabei von Sanktionen bis hin zu militärischen Intervention. Dabei ist die Bedingung für eine militärische Intervention, dass es sich um eine akute Bedrohung des Lebens einer großen Anzahl von Menschen handelt oder in großem Umfang ethnische Säuberungen oder gar Völkermord passiert. Wobei es unerheblich ist, ob die Gewalt von staatlicher oder nicht staatlicher Seite ausgeht, ob sie innerhalb von Staaten oder über Grenzen hinweg stattfindet. Letzter Teilbereich ist die "Verantwortung zum Wideraufbau" ("Responsibility to Rebuild"). Sie beinhaltet vor allem das zur Verfügung stellen von Hilfe beim Wideraufbau von durch die Intervention oder den vorhergehenden Konflikt zerstörter Infrastruktur und bei der Versöhnung ehemalig verfeindeter Gruppen. Zur Legitimation von militärischen Interventionen gibt es nach Ansicht der Kommission auf der internationalen Ebene kein geeigneteres Organ, als den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Es sollte also versucht werden, vor jeder Intervention die Zustimmung des Sicherheitsrates zu erhalten und dieser sollte sich in "konstruktiver Weise" mit der Situation auseinander setzen. Nach dem Willen der Kommission heißt dies aber auch, dass, wenn sich der Sicherheitsrat nicht auf Maßnahmen einigen kann, andere Staatenzusammenschlüsse oder sogar einzelne Staaten zu militärischen Mitteln greifen können. Konsequenzen des Konzeptes In dem Falle einer internationalen Anerkennung dieses Konzeptes der "Responsibility to Protect" wird das derzeit geltende Völkerrecht grundlegend verändert. Dann kann und muss, in Fällen wo von schweren Menschenrechtsverletzungen oder humanitären Katastrophen berichtet wird, der Sicherheitsrat Maßnahmen bis hin zur militärischen Intervention beschließen. Tut er dies nicht, aus welchen Gründen soll dabei unerheblich sein, so geht dieses Recht auf andere Staatenzusammenschlüsse oder gar auf einzelne Staaten über. Dieses eröffnet in letzter Konsequenz die Möglichkeit, dass wenn einzelne Staaten oder Staatszusammenschlüsse militärische Maßnahmen gegen einen anderen Staat durchführen, dieser sich in Zukunft weder auf seine Souveränität noch auf das Selbstverteidigungsrecht berufen kann, wenn nur die Interventions-Begründung sorgfältig genug vorbereitet worden ist. Es bietet gleichzeitig eine Legitimation für Eingriffe in Staaten, die sich den Vorstellungen der Industrieländer von "Entwicklung" durch Strukturanpassung, Privatisierung und Freihandel widersetzen. Denn dieser Widerstand wird dafür verantwortlich gemacht, dass es in den Staaten nicht zu einem anstieg des Wohlstandes kommt, der in den Prognosen von IWF und Weltbank so oft in Aussicht gestellt wurde. Damit ist der Staat nicht willens, seiner Bevölkerung diese Entwicklung zuzugestehen, Zwangsmaßnahmen bis hin zu militärischen Interventionen ließen sich mit dem Konzept der "Responsibility to Protect" nun ohne viel Mühe begründen. Schon jetzt haben die Argumente aus dem Report Eingang in die Debatten der Vereinten Nationen gefunden. Besonders in der Zeit um den 10. Jahrestag des Massakers in Ruanda wurde von Seiten des UN-Generalsekretärs Kofi Annan massiv für das Konzept geworben. Die kanadische Regierung strebt, wenn sich Kräfteverhältnisse günstig entwickeln, eine Verabschiedung einer Resolution auf einer UN Generalversammlung an. Darin soll vor allem die neue Konzeption der "Souveränität als Verantwortung" anerkannt werden. Diese "kalte" Änderung des Völkerrechtes per Neudefinition eines Begriffes ist nicht nur einfacher Durchsetzbar, weil die Konsequenzen vielfach unabsehbar sind, sondern auch wesentlich schneller zu realisieren, als eine Änderung der UN-Charta in ihrem Wortlaut. Mittlerweile wird die angestrebte Neuregelung sogar von einigen friedenspolitischen Gruppen propagiert. Etwa als Mittel zur Eindämmung der Präventivkriegsstrategie der USA, da Interventionen ja in dem Bericht an klare Vorbedingungen gebunden sind. Dabei sollte gerade aus der Begründung des Krieges gegen den Irak der umgekehrte Schluss gezogen werden. Eine Legitimation von Kriegen, die in erster Linie den ökonomischen und geostrategischen Interessen der Kriegführenden Staaten dienen, und eine solche Erleichterung stellt der Bericht der ICISS dar, sollte so schwer wie möglich gemacht werden. So ist dieser Report, so hoffnungsvoll ihn manche auch betrachten mögen, ein Schritt in die falsche Richtung. Viele Kritiker befürchten somit, dass es bei der Durchsetzung dieses neuen "weiterentwickelten" Völkerrechts nicht in erster Linie um Humanität und die Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen geht. Ziel sei vielmehr ein Mittel zu etablieren um Staaten, die von Verschuldung, Verarmung, von bestehenden Kriegen betroffen sind oder durch Bürgerkrieg zu Zerfallen drohen, auch dann unter Kontrolle halten zu können, wenn kein existierendes, einheitliches Staatswesen mehr vorhanden ist, das zur Einhaltung internationaler Verpflichtungen gedrängt werden könnte. Auf diese Weise können ökonomische und geostrategische Interessen in diesen Staaten weiter verfolgt werden. Die Momentan noch recht strikten Regelungen für eine militärische Intervention, wie sie in dem Bericht genannt werden und die von Befürwortern des Berichtes gern als Indiz für seine Ausgewogenheit angeführt werden, bieten gegen einen verstärkten Interventionismus keinerlei Schutz. Ist das Prinzip erst einmal geändert und sind Interventionen grundsätzlich legitimiert, dann ist es um so einfacher, die Eingriffsschwelle stückweise zu senken. Diese Tendenz spiegelt sich in der momentan Diskussion wieder, so initiierte die Friedrich-Ebert-Stiftung eine öffentlichen Diskussion zu Frage der "Spielregeln eines neuen Interventionismus". In den dort Vorgestellten Diskussionsbeiträgen namenhafter Politikwissenschaftler sind die dargestellten Gründe, bei denen eine Intervention zulässig sein soll, gegenüber dem ICISS Bericht erheblich ausgeweitet. Falls das Konzept, das die ICISS in ihrem Bericht präsentiert hat, sich international durchsetzt, werden sich die militärischen Interventionen, die unter den Stichwort "humanitär" geführt werden immens ausweiten. Schließlich braucht sich dann kein Staat mehr einen Bruch des Völkerrechts vorhalten lassen, wenn er seine ökonomischen und geostrategischen Interessen militärisch durchsetzen will. Diese nun "humanitären" Interventionen brauchen nur noch eine gelungene Begründung.