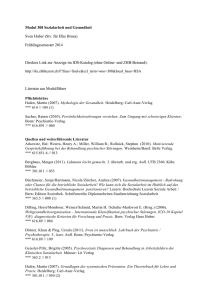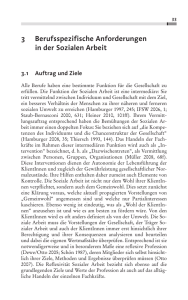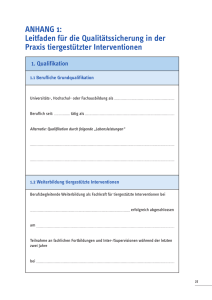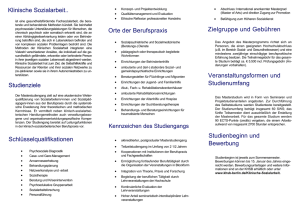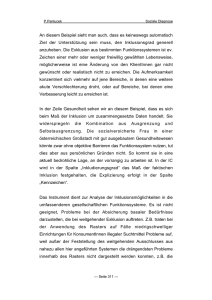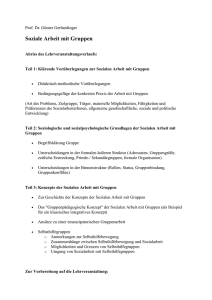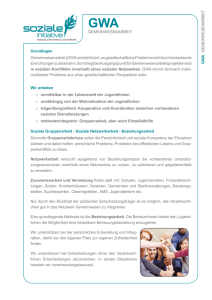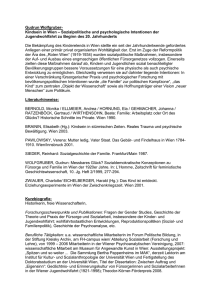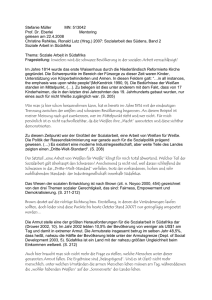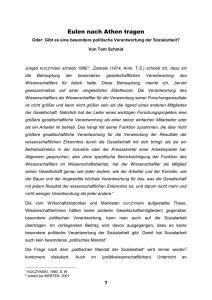20-Text-Kleve - Supervision
Werbung
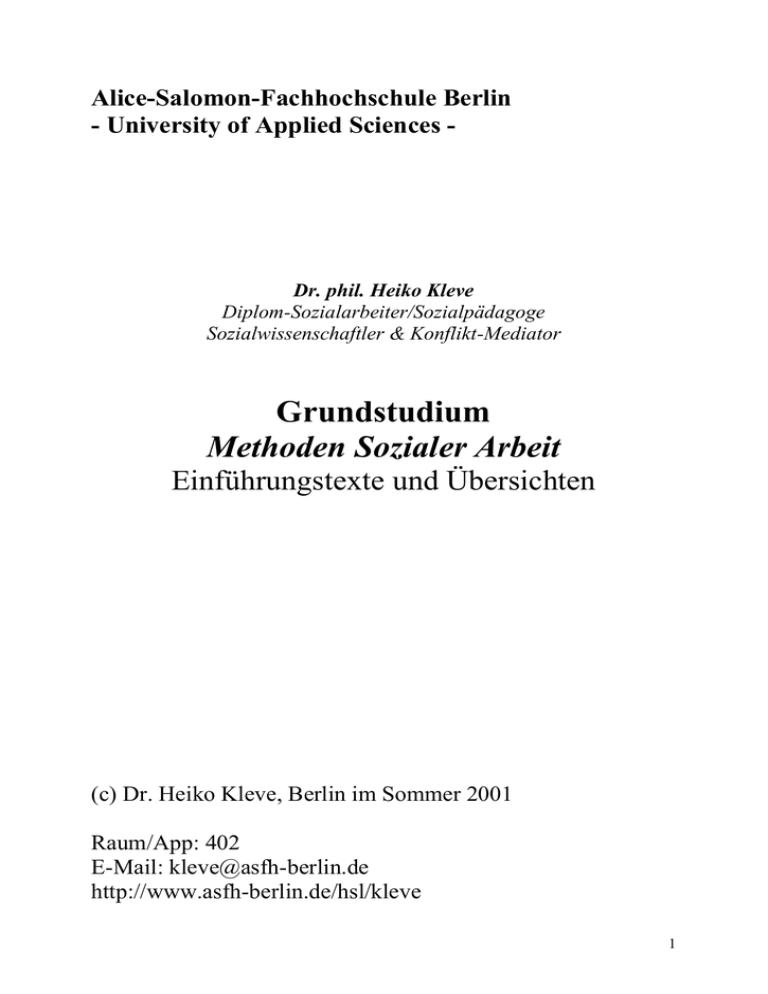
Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin - University of Applied Sciences - Dr. phil. Heiko Kleve Diplom-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge Sozialwissenschaftler & Konflikt-Mediator Grundstudium Methoden Sozialer Arbeit Einführungstexte und Übersichten (c) Dr. Heiko Kleve, Berlin im Sommer 2001 Raum/App: 402 E-Mail: [email protected] http://www.asfh-berlin.de/hsl/kleve 1 Inhaltsverzeichnis: Curriculum für das Fach Methoden Sozialer Arbeit .............................................. 3 Wichtige Grundlagenliteratur ................................................................................. 5 1. Einführung .......................................................................................................... 6 1.1 Theorie, Praxis und Methoden Sozialer Arbeit............................................. 6 1.2 Geschichtliche Entstehung der sozialarbeiterischen Methodik von der Moderne zur Postmoderne ................................................................................ 10 2. Klassische Methoden/Arbeitsformen Sozialer Arbeit ...................................... 13 2.1 Entwicklung der klassischen Methoden Sozialer Arbeit ............................ 13 2.2 Therapeutische Grundlagen der Sozialen Einzelfallhilfe............................ 16 2.2.1 Psychoanalyse/Tiefenpsychologie ........................................................ 16 2.2.2 Humanistische Psychotherapien ........................................................... 19 2.2.3 Systemische Familien-/Kommunikationstherapie ................................ 22 2.3 Soziale Gruppenarbeit ................................................................................. 26 2.4 Gemeinwesenarbeit ..................................................................................... 30 3. Aktuelle Methodendiskussion .......................................................................... 33 3.1 Systemische Konzepte in der Sozialen Arbeit – Eine (erste) Zusammenfassung............................................................................................. 33 3.2 Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit und Postmodernisierung der Gesellschaft ....................................................................................................... 35 3.3 Case Management ....................................................................................... 40 4. Schritte helfender Kommunikation .................................................................. 48 4.1 Ressourcen .................................................................................................. 50 4.2 Hypothesenbildung ..................................................................................... 51 5. Hilfsmittel bei der Fallbearbeitung .................................................................. 54 5.1 Familiärer Lebenszyklus ............................................................................. 54 5.2 Hierarchie der menschlichen Bedürfnisse nach Abraham Maslow ............ 55 5.3 Biologische, biopsychische und biopsychosoziale menschliche Bedürfnisse nach Werner Obrecht ........................................................................................ 56 6. Dimensionen der Sozialarbeiterischen Beratung ............................................. 57 2 Curriculum für das Fach Methoden Sozialer Arbeit von Prof. Britta Haye, Rose-Marie Freyer und Werner Glanzer 1. Curriculare Ziele Den Studierenden soll die Legitimation und die Kompetenz professionellen und methodischen Handelns vermittelt werden. Für das Verständnis des Handlungsrahmens und die zu leistende Beratung und Unterstützung ist eine integrierende Sicht nötig, die zu einer multiperspektivischen Bewertung kommen sollte. Die praktisch zu leistende Beratung und Unterstützung von Menschen aller Alterstufen in sozialen Konfliktlagen bedarf methodischer, reflexiver Kompetenzen zur Erziehung, Begleitung, Bertaung oder Therapie. Spezielle Handlungsstrategien sind erforderlich zur Förderung der unterschiedlichen Klientengruppen mit ihren jeweiligen eigenen Problemlagen. Die Studierenden sollen die Bezogenheit der Sozialarbeit auf die jeweilige Lebenswelt und Lebenslage der Klienten sowie auf die gegebenen und veränderbaren ökonomischen, politischen und kulturellen Bedingungen erkennen. So gilt es zu erfassen, dass sozialberufliches Handeln zur persönlichen Alltags- und Problembewältigung des einzelnen und zur Selbsthilfe beizutragen hat; und dort, wo eigene Fähigkeiten des Bürgers nicht von ihm erkannt sind bzw. ausreichen, ihn zu unterstützen, vorhandene eigene Ressourcen, auch die seines sozialen Umfeldes zu entdecken sowie die freier und öffentlicher Einrichtungen in Anspruch zu nehmen. Die sozial ökologische angelegte Ausbildung im Fach Methoden Sozialer Arbeit umfasst eine Einführung in das Verständnis methodischen Handelns, deren jeweilige theoretische Begründung sowie eine multufaktorielle Sicht individueller, institutioneller und gesellschaftlicher Zusammenhänge (Mikro-, Meso- und Makroebenen). Methodisches Handlungswissen und Können soll in diesem Fach vermittelt werden, besonders in den Bereichen Arbeit mit einzelnen, Arbeit mit Familien, Arbeit mit Gruppen, Gemeinwesenarbeit, Supervision und Sozialmanagement. 2. Thematische Schwerpunkte Grundstudium (zweites und drittes Semester) Die Veranstaltung soll die Studierenden in methodisches Arbeiten in der Sozialarbeit und den dazugehörigen Kontext (Klienten- und Helfersystem sowie Bedingungen, in denen die Hilfe statt findet) einführen und einen Überlick vermitteln: Geschichtliche Entwicklung der Methoden Sozialer Arbeit Kompetenz beruflichen Handelns (instrumentelle, reflexive und soziale Kompetenz) 3 Bedeutung sozio-ökonomischer und psycho-soialer Beratung als spezifischer sozialarbeiterischer Zugang Darstellung verschiedener Psychotherapiekonzepte, aus denen sich die methodische Sozialarbeit überwiegend speist Methodische Handlungsformen in der beruflichen Sozialarbeit: Arbeit mit einzelnen und Familien: Begleitung, Beratung, Unterstützungsmanagement (Kooperation, Ressourcen- und Netzwerkorientierung) Arbeit mit Gruppen: theoretische Aspekte, Gruppe als soziales System, Modelle der Gruppenarbeit, Gruppenprozess Gemeinwesenarbeit: Entstehung, ideologische Ansätze, Ziele, Entwicklungen in der Postmoderne Supervision: Definition und Entwicklung, Formen und Konzepte, Funktion Sozialmanagement: Lösungs- und problemorientierte Ansätze, Planung, Koordinierung, Leitung 4 Wichtige Grundlagenliteratur Galuske, M. (1998): Methoden der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Weinheim/München: Juventa Geiser, K. (2000): Problem- und Ressourcenanalyse in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung in die Systemische Denkfigur und ihre Anwendung. Freiburg/Br.: Lambertus Geißler, K. A.; Hege, M. (1988): Konzepte sozialpädagogischen Handelns. Ein Leitfaden für die Praxis. Weinheim/Basel: Beltz (1992) Heiner, M.; Meinhold, M.; Spiegel, H.; Staub-Bernasconi, S. (1994) Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. Freiburg/Br.: Lambertus Kersting, H. J. (1991): Intervention: Die Störung unbrauchbarer Wirklichkeiten. in: ders., Bardmann Th. M. u.a.: Irritation als Plan: Konstruktivistische Einredungen. Aachen: Kersting-IBS: S. 108-133 Kleve, H. (1996): Konstruktivismus und Soziale Arbeit: Die konstruktivistische Wirklichkeitsauffassung und ihre Bedeutung für die Sozialarbeit/ Sozialpädagogik und Supervision. Aachen: Kersting-IBS Kleve, H. (1999a): Postmoderne Sozialarbeit. Ein systemtheoretisch-konstruktivistischer Beitrag zur Sozialarbeitswissenschaft. Aachen: Kersting-IBS Kleve, H. (1999b): Soziale Arbeit und Ambivalenz. Fragmente einer Theorie postmoderner Professionalität, in: neue praxis, 4/1999: S. 368-382 Kleve, H. (2000): Die Sozialarbeit ohne Eigenschaften. Fragmente einer postmodernen Professions- und Wissenschaftstheorie Sozialer Arbeit. Freiburg/Br.: Lambertus Kriz, J. (1994): Grundkonzepte der Psychotherapie. Eine Einführung. Weinheim: Psychologie Verlags Union Lüssi, P. (1992): Systemische Sozialarbeit. Praktisches Lehrbuch der Sozialberatung. Bern: Haupt Merten, R. (1997): Autonomie der Sozialen Arbeit. Zur Funktionsbestimmung als Disziplin und Profession. Weinheim/München: Juventa Müller, B. (1993): Sozialpädagogisches Können. Ein Lehrbuch zur multiperspektivischen Fallarbeit. Freiburg/Br.: Lambertus Müller, C. W. (1988): Wie Helfen zum Beruf wurde. Band 1: Eine Methodengeschichte der Sozialarbeit 18831945. Weinheim/Basel: Beltz (2. Auflg.) Müller, C. W. (1997): Wie Helfen zum Beruf wurde. Band 2: Eine Methodengeschichte der Sozialarbeit 19451995. Weinheim Basel: Beltz (3. Auflg.) Nebel, G.; Woltmann-Zingsheim, B. (Hrsg.) (1997): Werkbuch für das Arbeiten mit Gruppen. Aachen: KerstingIBS Pfeifer-Schaupp, H.-U. (1995): Jenseits der Familientherapie. Systemische Konzepte in der Sozialen Arbeit. Freiburg/Br.: Lambertus Schilling, Johannes (1997): Entwicklungslinien der Sozialpädagogik/Sozialarbeit. Neuwied/Kriftel/Berlin: Luchterhand Schlippe, A. v.; Schweitzer, J. (1996): Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (1998) Schmidbauer, W. (1992): Hilflose Helfer. Über die seelische Problematik der helfenden Berufe. Reinbeck: Rowohlt Stark, W. (1996): Empowerment. Neue Handlungskompetenzen in der psychosozialen Praxis. Freiburg/Br.: Lambertus Stimmer, F. (2000): Grundlagen des Methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit. Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer Thiersch, H. (1993): Strukturierte Offenheit. Zur Methodenfrage einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit, in: Rauschenbach, T.; Ortmann, F.; Karsten, M.-E. (Hrsg.): Der sozialpädagogische Blick. Lebensweltorientierte Methoden in der Sozialen Arbeit. Weinheim/München: Juventa: S. 11-28 Wendt, W. R. (1997): Case Management im Sozial- und Gesundheitswesen. Eine Einführung. Freiburg/Br.: Lambertus 5 1. Einführung 1.1 Theorie, Praxis und Methoden Sozialer Arbeit Sozialarbeit und Sozialpädagogik sind die beiden zentralen Wissens- und Handlungsbereiche der Sozialen Arbeit. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass Sozialarbeit („Armenfürsorge“) Ersatz für schwindende familiäre Sicherungsleistungen bietet, während Sozialpädagogik („Jugendfürsorge“) die schwindenden familiären Erziehungsleistungen kompensiert (vgl. Mühlum 1996). Inzwischen können wir allerdings von einer Identität von Sozialarbeit und Sozialpädagogik sprechen (vgl. Merten 1998), d.h. eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Bereichen ist kaum noch möglich, so dass das Berufsfeld immer häufiger als Soziale Arbeit bezeichnet wird. Soziale Arbeit lässt sich in Praxis (Profession Soziale Arbeit) und Wissenschaft (Disziplin Soziale Arbeit, Sozialarbeitswissenschaft) unterscheiden. Die Methoden der Sozialen Arbeit können als ein Bindeglied zwischen Praxis und Wissenschaft verstanden werden. Sozialarbeit – Sozialpädagogik – Soziale Arbeit Sozialarbeitspraxis Sozialarbeitswissenschaft Profession Soziale Arbeit Disziplin Soziale Arbeit Sozialarbeiterische Organisationen, freiberufliche Sozialarbeit (Fach-)Hochschulen bzw. Fachbereiche für Soziale Arbeit Wirksamkeit und Angemessenheit des Handelns Wahrheit und Brauchbarkeit des Wissens Methoden Sozialer Arbeit ... als Bindeglied von theoretischem, disziplinärem (Erklärungs-)Wissen und praktischem, professionellem Handlungswissen (Wertewissen, Verfahrenswissen, Evaluationswissen) Übersicht 1 Praxis: Die Praxis der Sozialen Arbeit wird auch Profession genannt, sie ist das berufliche Handlungsfeld, in dem die SozialarbeiterInnen tätig sind. Das sozialarbeiterische Handlungsfeld lässt sich weiter in Interaktion (Mikroebene), Organisation (Mesoebene) und Gesellschaft (Makroebene) unterscheiden. Mit anderen Worten, SozialarbeiterInnen arbeiten etwa in der Beratung mit KlientInnen auf einer kommunikativen Interaktionsebene, weiterhin sind sie in sozialarbeiterische Organisationen (z.B. Sozial-, Jugend-, Gesundheitsamt oder freie Träger) als Angestellte eingebunden oder erhalten als freiberuflich Tätige ihre Aufträge von diesen Organisationen. Schließlich stellt die Soziale Arbeit ein gesellschaftliches Funktionssystem dar, das neben anderen Systemen der Gesellschaft (Wirtschaft, Politik, 6 Erziehung, Religion, Recht, Kunst, Wissenschaft etc.) potentiell für alle Gesellschaftsmitglieder („Bürger“) Leistungen („soziale Hilfe“) erbringt. Inzwischen kann gesagt werden, dass Sozialarbeit gewissermaßen von der Geburt bis zum Tode in allen Lebensabschnitten und -bereichen (präventiv, interventiv und postventiv) tätig ist. Dabei bezieht sie sich auf biologische, psychische und soziale Prozesse von Menschen (siehe Übersicht 1 zur Multifunktionalität der Sozialen Arbeit). Multifunktionalität der Sozialen Arbeit (als Profession) Soziale Arbeit als gesellschaftliches Berufsund Funktionssystem Soziale Arbeit als organisatorisches und interaktionelles Handlungssystem Universeller Generalismus: Heterogenität des sozialarbeiterischen Handlungsfeldes Spezialisierter Generalismus: Heterogenität des sozialarbeiterischen Fallbezugs (Zeitdimension) (Sozialdimension) Prävention Einzelfallarbeit (case-work, case-management) Intervention Gruppenarbeit Postvention Gemeinwesenarbeit (Sozial- und Sachdimension) (Sachdimension) Sozialhilfe Biologisches Kinder- und Jugendhilfe Familienhilfe Körperfunktionen und -entwicklungen, Gefühle, Ökologisches etc. Behindertenhilfe Psychisches Obdachlosenhilfe Suchthilfe Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle, Einstellungen, kognitive Entwicklungen etc. Krankenhilfe Soziales Schuldnerhilfe Familiäres, Erzieherisches, Bildendes, Ökonomisches, Politisches, Rechtliches, Religiöses (Spirituelles), Künstlerisches, Wissenschaftliches etc. Rechtshilfe Altenhilfe etc. Übersicht 2 Wissenschaft: Die Wissenschaft der Sozialen Arbeit (Sozialarbeitswissenschaft) wird auch Disziplin genannt, sie ist das Handlungs- bzw. Forschungsfeld, in dem die (Sozialarbeits-) WissenschaftlerInnen tätig sind, d.h. StudentInnen ausbilden (lehren) und forschen. Die 7 Wissenschaft hat insbesondere die Aufgabe, Wissen bereitzustellen, mit dem die Praxis beobachtet, beschrieben, erklärt und bewertet, kurz: reflektiert werden kann. Methoden: Die Methoden Sozialer Arbeit stellen, wie gesagt, ein Bindeglied zwischen Praxis und Wissenschaft dar, sie sind bestenfalls wissenschaftlich begründet und praktisch wirksam. Sie sollen in einem bestimmten Arbeitsfeld, innerhalb von Hilfeprozessen (z.B. innerhalb der Beratung) Menschen gezielt dabei helfen, ihre sozialen Probleme zu lösen. Methoden sind in dieser Hinsicht sozusagen ein „Kern“ professioneller Sozialarbeit/Sozialpädagogik. „Methode heißt, strategisch einen Weg zu beschreiten, der nach Zweck und Ziel und nach Lage der Dinge angemessen erscheint“ (Wolf-Rainer Wendt; z. n. Galuske 1998, S. 29). „Methoden der Sozialen Arbeit thematisieren jene Aspekte im Rahmen sozialpädagogischer/sozialarbeiterischer Konzepte, die auf eine planvolle, nachvollziehbare und damit kontrollierbare Gestaltung von Hilfeprozessen abzielen und die dahingehend zu reflektieren und zu überprüfen sind, inwieweit sie dem Gegenstand, den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, den Interventionszielen, den Erfordernissen des Arbeitsfeldes, der Institution sowie der beteiligten Personen gerecht werden“ (Galuske 1998, S. 25). Daraus ergeben sich sechs Perspektiven, die bei der Reflexion von Methoden Sozialer Arbeit grundsätzlich zu beachten sind (vgl. ebd., S. 25f.): 1. Sachorientierung: Welche Probleme sollen mit der Methode bearbeitet werden? Wird die Methode der Problemlage gerecht? 2. Zielorientierung: Welche Ziele sollen mit der Methode erreicht werden? Lassen sich die Ziele mittels der Methode einlösen? 3. Personen- und Interaktionsorientierung: Wird die Methode den betreffenden Personen (KlientInnen/SozialarbeiterInnen) und ihrer Interaktion gerecht? 4. Arbeitsfeld- und Institutionsorientierung: Ist die Methode sinnvoll innerhalb der institutionellen/organisatorischen Rahmenbedingungen anwendbar? 5. Planungsorientierung: Erlaubt die Methode die gezielte Planbarkeit von Hilfeprozessen? 6. Überprüfbarkeit (Evaluation; Controlling): Lassen sich am Ende darüber Aussagen treffen, ob und wie die Methode gewirkt hat? 8 Literatur: Mühlum, Albert (1996): Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Ein Vergleich. Frankfurt/M.: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Merten, Roland (1998): Sozialarbeit – Sozialpädagogik – Soziale Begriffsbestimmungen in einem unübersichtlichen Feld. Freiburg/Br.: Lambertus Galuske, Michael (1998): Weinheim/München: Juventa Methoden der Sozialen Arbeit. Eine Arbeit. Einführung. 9 1.2 Geschichtliche Entstehung der sozialarbeiterischen Methodik von der Moderne zur Postmoderne Die berufliche, professionelle Soziale Arbeit, so wie wir sie heute kennen, ist ein Ergebnis der gesellschaftlichen Evolution; sie ist beispielsweise hervorgegangen aus der bürgerlichen Frauenbewegung, der (sozialistischen) Arbeiterwohlfahrtsbewegung, der sozialreformerischen Bemühungen staatlicher Institutionen oder der sogenannten Armenpolicey. Gesellschaftshistorisch lässt sich die Soziale Arbeit neben vormodernen Hilfeformen als die moderne Form des sozialen Helfens bewerten (vgl. Luhmann 1973). Herausbildung verschiedener Hilfeformen im Wandel gesellschaftlicher Bedingungen Vormoderne Moderne (siehe dazu ausführlicher die Übersicht auf der folgenden Seite) Archaische Gesellschaft („Urgesellschaft“) Hochkultivierte Gesellschaft („Feudalistische Gesellschaft“) Moderne Gesellschaft („Kapitalistische Gesellschaft“, „Industriegesellschaft“ etc.) primär differenziert in soziale Segmente (z.B. in Familien, Stämme etc.) primär differenziert in soziale Schichten und Klassen (Bauern, Handwerker, Adel etc.) primär differenziert in Funktionssysteme (z.B. Wirtschaft, Politik, Recht, Wissenschaft, Erziehung, Soziale Arbeit etc.) reziproke (wechselseitige) persönliche Hilfen auf der Grundlage von Hilfs- und Dankeserwartungen moralisch bzw. religiös inspirierte Hilfen zwischen verschiedenen Schichten/ Klassen gesetzlich definierte/ abgesicherte und organisatorisch durchgeführte (rationalisierte, bürokratisierte und ökonomisierte) Hilfen (Sozialstaatsprinzip/moderne, professionelle Sozialarbeit) Übersicht 3 Soziales Helfen kann verstanden werden als Beitrag zur Befriedigung der Bedürfnisse von anderen Menschen, die diese nicht mehr selbst befriedigen können. Sozialarbeiterische Hilfen beziehen sich auf materielle und symbolische (sozio-kulturelle) Bedürfnisse, die für die physische und psychische Reproduktion von Menschen erforderlich sind bzw. gesellschaftlich so bewertet werden. Somit wird soziales Helfen auch verstanden als ein Bedarfsausgleich im Hinblick auf ungleich verteilte und verfügbare soziale Ressourcen und Kapazitäten – z.B. Unterkunft, Nahrung, Gebrauchsgegenstände, Geld, Arbeit, Freizeit, Erziehung, Bildung, Betreuung, persönliche Beziehungen, soziale Netzwerke etc. 10 Hilfeformen in der der modernen Gesellschaft situationsgebunden personengebunden personenübergreifend situationsübergreifend A: personengebunden- und situationsgebunden C: personengebunden und situationsübergreifend Hilfe in Familien, unter Freunden, in Nachbarschaften, in Selbsthilfegruppen professionelle soziale Hilfe (in Interaktionsprozessen) B: personenübergreifend und situationsgebunden D: personenübegreifend und situationsübergreifend spontane Hilfe unter Fremden Hilfen durch den Sozialstaat (Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe etc.), Versicherungsleistungen Übersicht 4 Die Professionalisierung (Verberuflichung) der sozialen Hilfe zur Sozialen Arbeit geht einher mit der Etablierung der modernen Gesellschaft. So ist die Soziale Arbeit Teil eines Projektes, das als ein permanentes Ringen um Ordnung, Eindeutigkeit, Rationalisierung, Kontrolle, Klassifizierung, Bestimmung und Identifizierung beschrieben werden kann: nämlich des Moderne-Projektes (vgl. Bauman 1991). Die Durchsetzung der Moderne, der modernen Gesellschaft, die ihren Ursprung hat in der aufkommenden Aufklärung des 17. Jahrhunderts, kann um die Zeit des Eintritts in das 20. Jahrhundert datiert werden. Der Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert war ebenfalls der Zeitpunkt, an dem sich die soziale Hilfe von einer primär moralisch bzw. religiös inspirierten ‚Mildtätigkeit‘ (vgl. Luhmann 1973) deutlich zu wandeln begann in die professionelle – zunächst ausschließlich frauenberufliche – Sozialarbeit. Nun wurde auch versucht, soziale Hilfe, Armen- und Jugendfürsorge, mithin das, was wir heute Sozialarbeit, Sozialpädagogik bzw. Soziale Arbeit nennen, den Kriterien der gesellschaftlichen Modernisierung, sprich: der Rationalisierung, Verrechtlichung und Bürokratisierung, kurz: der formalen Organisation unterzuordnen. In diesem Zusammenhang der Modernisierung steht auch die Entwicklung der Methoden und Arbeitsformen Sozialer Arbeit (Soziale Arbeit mit Einzelnen und Familien, Soziale Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit); sie sind der Ausdruck dafür, dass das geplant, rationalisiert, bürokratisiert und ökonomisiert im öffentlichen Bereich der Gesellschaft anzubieten und durchzuführen ist, was in der Vormoderne wenig rationalisiert eher im privaten Bereich oder ausgehend von privaten Motivationen und Interessen geleistet wurde: eben soziale Hilfe. 11 Inzwischen ist Soziale Arbeit zu einem normalen Teil der modernen (Dienstleistungs-) Gesellschaft geworden. Das 20. Jahrhundert, in dem sich Soziale Arbeit entwickelt und auf alle Gesellschaftsbereiche ausgedehnt und etabliert hat, kann daher auch als das „sozialpädagogische Jahrhundert“ (vgl. Thiersch 1992 oder auch Rauschenbach 1999) bezeichnet werden. Wie sich die Soziale Arbeit in der Postmoderne weiter entwickeln wird, ob es etwa zu einer Re-Familialisierung der sozialen Hilfe kommen wird, bleibt abzuwarten. Literatur: Bauman, Zygmund (1991): Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Frankfurt/M: Suhrkamp Luhmann, Niklas (1973): Formen des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Bedingungen, in: ders.: Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag (1975): S. 134-149 Rauschenbach, Thomas (1999): Das sozialpädagogische Jahrhundert. Analysen zur Entwicklung Sozialer Arbeit in der Moderne. Weinheim/München: Juventa Thiersch, Hans (1992): Das sozialpädagogische Jahrhundert, in: Rauschenbach, Thomas; Gängler, Hans (Hrsg.): Soziale Arbeit und Erziehung in der Risikogesellschaft. Neuwied/Kriftel/Berlin: Luchterhand: S. 9-23 12 2. Klassische Methoden/Arbeitsformen Sozialer Arbeit 2.1 Entwicklung der klassischen Methoden Sozialer Arbeit Die klassischen Methoden Sozialer Arbeit sind genaugenommen keine spezifischen Methoden, sondern Arbeitsformen. Innerhalb dieser Arbeitsformen wird dann methodisch etwa mit einzelnen KlientInnen/Familien (Soziale Einzelfallhilfe), mit Gruppen (Soziale Gruppenarbeit) oder Gemeinwesen (Gemeinwesenarbeit) sozialarbeiterisch gehandelt (kommuniziert). Die Entwicklung der sozialarbeiterischen Arbeitsformen/Methoden kann in vier Phasen unterteilt werden (vgl. Schilling 1997, S. 272ff.; Galuske 1998, S. 63ff.): 1. Phase: Anfänge (Anfang des 20. Jahrhunderts) In Deutschland hat vor allem Alice Salomon die Anfänge der professionellen sozialarbeiterischen Methoden maßgeblich beeinflusst. Mit der Veröffentlichung ihres Buches Soziale Diagnose in den 1920er Jahren versuchte sie die aus den USA kommende (von Mary Richmond entwickelte) Methode des „casework“ auch in Deutschland bekannt zu machen. Der Begriff „Diagnose“ deutet es schon an, dass die Sozialarbeit in ihrer ersten Phase bestrebt war, sich konzeptionell/methodisch an (eher naturwissenschaftliche) Professionen wie Medizin oder Psychologie anzulehnen. Das Ziel der sozialen Diagnose von FürsorgerInnen ist es, „Material zu sammeln (eigene Beobachtungen und Aussagen anderer), das beschaffene Material zu prüfen und zu vergleichen, es zu bewerten, Schlüsse daraus zu ziehen – schließlich ein Gesamtbild herzustellen, das erlaubt, einen Plan für die Abhilfe (Behandlung) zu fassen [...] Zum Material der Ermittlung gehören [...] alle Tatsachen aus dem Leben des Bedürftigen und seiner Familie, die dazu helfen können, die besondere soziale Not und das soziale Bedürfnis des Betroffenen zu erklären und die Mittel zur Lösung der Schwierigkeit aufzuzeigen“ (Alice Salomon, z. n. Müller 1988, S. 145). 2. Phase: Übernahme amerikanischer Methoden (Arbeitsformen) (1950er Jahre) In dieser Zeit nach dem 2. Weltkrieg wurden in der Bundesrepublik Deutschland die in den USA entwickelten o.g. klassischen Methoden/Arbeitsformen der Sozialen Arbeit in die Praxis und Lehre eingeführt. Soziale Einzelfallhilfe: Sie bezieht sich auf einzelne Individuen und Familien, betrachtet deren Bedürfnisse und Probleme – auch in Wechselwirkung mit der relevanten Umwelt und versucht, die KlientInnen und Familien zur Problemlösung anzuregen. Dabei wird von folgenden Prinzipien ausgegangen: Annehmen und Akzeptieren; Individualisieren; individuelle Selbstbestimmung; dort anfangen, wo die KlientInnen stehen; mit den Stärken des Individuums arbeiten. Methodisch wird in drei Schritten vorgegangen („Methodischer Dreischritt“): 1. Fallstudie/Anamnese; 2. Soziale Diagnose; 3. Behandlung. Im Mittelpunkt 13 dieser Arbeitsform stehen die helfende Beziehung und das Gespräch. Einen wesentlichen Einfluss auf die Einzelfallhilfe übte die Psychoanalyse aus. Soziale Gruppenarbeit: Sie bezieht sich auf (sozial)pädagogische Gruppen (von Kindern und Jugendlichen) oder auf themenbezogene Gruppen in allen Bereichen Sozialer Arbeit. In der Gruppenarbeit werden einzelne Gruppenphasen (Anfangs-, Machtkampfs-, Harmonie-, Differenzierungs- und Lösungsphase) unterschieden. Die Grundprinzipien der Gruppenarbeit sind: anfangen, wo die Gruppe steht und sich mit ihr in Bewegung setzen; mit den Stärken des einzelnen arbeiten; Zusammenarbeit ist besser als Einzelwettbewerb; Raum für Entscheidungen geben; erzieherisch notwendige Grenzen setzen; sich als Gruppenleiter überflüssig machen. Die Gruppenarbeit hat drei Ziele: 1. durch die Gruppenerfahrung den einzelnen Mitgliedern Sicherheit, Anerkennung, Unterstützung und Hilfe zu geben; 2. Werte und Normen zu vermitteln; 3. (neue) Möglichkeiten der Konfliktlösung zu bieten. Soziale Gemeinwesenarbeit: Sie bezieht sich auf eine größere Anzahl von Menschen, die etwa durch räumliche Nähe miteinander verbunden sind; die durch gemeinsame Problemlagen aufgrund äußerer Bedingungen benachteiligt sind; die durch gemeinsames Planen und Handeln ihre Benachteiligungen aufzuheben versuchen; oder die in Kommunikationsprozessen ihre Fähigkeiten zur Verbesserung ihrer Situation einsetzen wollen. Während der Gemeinwesenarbeit versuchen professionelle HelferInnen die Selbsthilfepotentiale der Menschen anzuregen, damit diese nicht nur sich selbst, sondern vor allem die sozialen Strukturen, in denen sie leben, verändern, umgestalten können. Gemeinwesenarbeit bezieht sich also nicht unmittelbar auf einzelne KlientInnen; sie ist vielmehr die Arbeitsform/Methode der Sozialen Arbeit die sich auf spezifische (mehr oder weniger begrenzte) gesellschaftliche (strukturelle) Veränderungen bezieht. Diesbezüglich wirken SozialarbeiterInnen als BeraterInnen oder VermittlerInnen z.B. innerhalb von BürgerInnenbewegungen oder Stadtteilinitiativen. 3. Phase: Methodenkritik (etwa 1968 – 1975) In Zusammenhang mit der 68er Studentenbewegung beginnt auch in der Sozialen Arbeit eine allgemeine Kritik unhinterfragter Methoden und Arbeitsformen. Kritisiert wird beispielsweise der unkritische Optimismus der 1950er Jahre bei der Übernahme der klassischen Arbeitsformen/Methoden aus den USA. Außerdem wird die Wissenschaftlichkeit der klassischen Methoden angezweifelt und dafür plädiert, angesichts des sog. „methodischen Dreigestirns“ der Sozialen Arbeit eher von Arbeitsformen zu sprechen. Zunehmend werden auch moderne psychotherapeutische Methoden (z.B. Gesprächspsychotherapie; Familientherapie) für das methodische Handeln in der Sozialen Arbeit aufbereitet. 4. Phase Ausdifferenzierung (1980er und 1990er Jahre) Angesichts der professionellen Etablierung Sozialer Arbeit differenzieren sich vielfältige neue Methoden aus, die vor allem die methodischen Diskurse der heutigen Sozialarbeit prägen: 14 z.B. lebensweltorientierte Sozialarbeit, systemische Beratung, Case Management, Empowerment, Mediation, Sozialmanagement, Selbstevaluation, Supervision. Literatur Galuske, Michael (1998): Methoden Weinheim/München: Juventa der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Müller, C. W. (1988): Wie Helfen zum Beruf wurde. Band 1: Eine Methodengeschichte der Sozialarbeit 1883-1945. Weinheim/Basel: Beltz (2. Auflg.) Müller, C. W. (1997): Wie Helfen zum Beruf wurde. Band 2: Eine Methodengeschichte der Sozialarbeit 1945-1995. Weinheim Basel: Beltz (3. Auflg.) Schilling, Johannes (1997): Soziale Arbeit. Entwicklungslinien Sozialpädagogik. Neuwied/Kriftel/Berlin: Luchterhand der Sozialarbeit/ 15 2.2 Therapeutische Grundlagen der Sozialen Einzelfallhilfe 2.2.1 Psychoanalyse/Tiefenpsychologie Psychoanalyse [ist] die Bezeichnung für ein von Sigmund Freud entwickeltes psychologisches Konzept, das auf drei Ebenen wirksam wird: 1. als Untersuchungsmethode von seelischen Vorgängen, 2. als Behandlungsmethode neurotischer Störungen (Neurosen) und 3. als Gesamtheit psychologischer und psychopathologischer Theoriebildung (vgl. Barth 1993). Die psychoanalytische Behandlung zielt darauf ab, unbewusste (Interaktions-)Erfahrungen bewusst zu machen. Denn es wird davon ausgegangen, dass seelische Konflikte und Probleme (Neurosen) auf der Verdrängung von traumatischen Interaktionserfahrungen (aus der Kindheit) beruhen. Durch das Liegen auf der Couch und die freie Assoziation während einer (klassischen) psychoanalytischen Psychotherapie soll das Erinnern und das Verbalisieren (Aussprechen) dieser Erfahrungen erleichtert werden. Im Verlaufe einer Psychoanalyse werden aktuelle Konflikte mit Bezugspersonen und mit dem Psychoanalytiker auf die Grundkonflikte, auf die traumatischen Interaktionserfahrungen der Kindheit zurückgeführt. Es wird angestrebt, diese Erfahrungen und die damit einhergehenden Gedanken und Gefühle nicht nur zu erinnern, sondern auch in der professionellen Übertragungsbeziehung zum Therapeuten emotional zu wiederholen und schließlich mit Hilfe des Therapeuten durchzuarbeiten. Übertragung bedeutet, dass die Interaktionserfahrungen der Kindheit (z.B. bezüglich der Eltern) auf die aktuellen Beziehungen (z.B. auf die Beziehung zum Therapeuten) übertragen werden. Diese Übertragung ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Psychoanalyse, in der kindliche Ängste, enttäuschte Erwartungen an die Eltern, Traurigkeit, Wut, Verzweifelung etc. zunächst erinnert, dann noch einmal emotional wiederholt, noch einmal erlebt und schließlich in Richtung einer neu zu konstruierenden („gesunden“) erwachsenen Perspektive auf die Realität therapeutisch durchgearbeitet werden können. Das psychoanalytische Persönlichkeitsmodell differenziert die menschliche Psyche in drei Bereiche: in „Es“, „Ich“ und „Über-Ich“. Das unbewusste „Es“ beinhaltet vor allem den Sexual- und den Aggressionstrieb und nimmt die aus dem „Ich“ verdrängten Wünsche, Affekte und Erinnerungen auf. Das „ICH“ versucht, die Triebimpulse des „Es“ sowie internalisierte soziale Anforderungen/Erwartungen aus dem „Über-Ich“ mit der sozialen Realität abzustimmen, zu koordinieren bzw. zu vermitteln. Das „Über-Ich“ bildet sich ab dem 3. Lebensjahr durch die Verinnerlichung (Internalisierung) elterlicher Vebote, Gebote, Normen und Erwartungen. 16 Die Soziale Einzelfallhilfe ist seit den 1920er Jahren stark geprägt von der Psychoanalyse (vgl. zu den folgenden Ausführungen auch Kleve 1999a, S. 120ff). Schon zu Beginn der professionellen Sozialarbeit erhofften sich SozialarbeiterInnen von der Rezeption der Psychoanalyse, „den Weg aus der alten, mit repressiven Mitteln arbeitenden Fürsorge zu finden, hin zu einer Menschenführung ohne Gewalt oder materielle Erpressung, die mit wissenschaftlichen Mitteln das eigene Interesse und die Mitarbeit der Klienten zu wecken vermöchte, ohne die materielle Hilfe wirkungslos bliebe“ (Müller, B. 1995, S. 35). Die Psychoanalyse lenkt den Blick der SozialarbeiterInnen auf die Gestaltung und Reflexion der helfenden Beziehung, auf die Möglichkeiten der kognitiven und emotionalen Ver- und Aufarbeitung, Gestaltung und Überwindung von subjektiv erfahrenen psycho-sozialen Problemlagen. Das Verdienst der Psychoanalyse für die Sozialarbeit liegt darin, die Perspektive der sozialen Hilfepraxis zu öffnen für die individuell-subjektiven und psychologischen Dimensionen des Helfens, die sowohl die KlientInnen als auch die HelferInnen gleichermaßen tangieren. Das professionelle Reflektieren der gegenseitigen Verstrickungen, der Übertragungen, Gegenübertragungen und Widerständen in Hilfeprozessen, das die Psychoanalyse ausgesprochen differenziert erlaubt, kann entscheidend dazu beitragen, helfende Beziehungen in ihrer konstruktiven oder destruktiven Dynamik einschätzen zu lernen und kontextuell angemessen zu handeln. Die Psychoanalyse kann SozialarbeiterInnen dafür sensibilisieren, dass die Kenntnis ihrer eigenen kognitiven und emotionalen Welten ein grundlegendes Arbeitsintrument bei der Gestaltung helfender Beziehungen ist. Die Persönlichkeit des Helfers ist mithin zentraler Bestandteil des Hilfeprozesses, der in seiner emotionalen bzw. affektiven Dynamik letztlich nur durch die Wahrnehmung seelischer Vorgänge des Helfers beobachtet werden bzw. beschrieben, erklärt und bewertet werden kann (vgl. Stierlin 1971). Kritik: Trotz der offensichtlichen Verbindungen, der „natürlichen Brücke“ (Hollis) zwischen Psychoanalyse und Sozialarbeit ist nicht zu verkennen, dass die – verkürzte und unreflektierte – Anwendung psychoanalytischer Erkenntnisse und Methoden in sozialarbeiterischen Handlungsfeldern Probleme bereitet. Beispielsweise medizinalisiert oder therapeutisiert die psychoanalytische Betrachtung nicht selten psycho-soziale Probleme. Vor allem die Medizinalisierung psycho-sozialen Leidens ist mit dem frühen psychoanalytischen und dem frühen sozialarbeiterischen Denken des Social Casework eng verhaftet. Genauso wie Freud, der die Psychoanalyse an dem zu seiner Zeit paradigmatisch auch die Human- und Sozialwissenschaften prägenden naturwissenschaftlichen Verständnis ausrichtete (vgl. Capra 1982, S. 194), orientierte sich beispielsweise auch Mary Richmond bezüglich der Konzeption einer personenbezogenen Sozialarbeit am medizinischen Modell. Die Begriffe ‘Diagnose’ und ‘Behandlung’ wurden somit zu wesentlichen Elementen der Casework-Literatur. 17 Literatur: Barth, Hannelore (1993): Psychoanalyse, in: Fachlexikon der sozialen Arbeit. Hrsg. vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge. Frankfurt/M.: Eigenverlag: S. 746 Capra, Fritjof (1982): Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild. München: dtv (1992) Kleve, Heiko (1999): Postmoderne Sozialarbeit. Ein systemtheoretisch-konstruktivistischer Beitrag zur Sozialarbeitswissenschaft. Aachen: Kersting Müller, Burkhard (1995): Außensicht – Innensicht. Beiträge zu einer analytisch orientierten Sozialpädagogik. Freiburg/Br.: Lambertus Stierlin, Helm (1971): Das Tun des Einen ist das Tun des Anderen. Eine Dynamik menschlicher Beziehungen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 18 2.2.2 Humanistische Psychotherapien Die humanistische Psychologie wurde 1962 in den USA als kritische psychologische und psychotherapeutische Kraft zwischen Psychoanalyse und der akademischen Verhaltenspsychologie begründet (vgl. Fraßa 1993). Als ihr geistiger Vater gilt der Motivationspsychologe Abraham Maslow (1908-1970). Die humanistische Psychologie hebt das Bedürfnis des Menschen nach Wachstum und Selbstverwirklichung hervor und betont deshalb vor allem die durch die Therapie zu aktivierenden „positiven Kräfte“ selbst verantwortlicher Individuen. „Nicht die Erforschung unbewußter seelischer Vorgänge wie bei der Psychoanalyse, sondern die Schärfung des Bewußtseins für innere Erfahrungen steht im Vordergrund. Psychotherapie wird als Lernerfahrung betrachtet, die nicht von außen gesteuert ist, sondern die dem Individuum innewohnenden, auf Selbstheilung zielenden Kräfte unterstützt“ (Fraßa 1993, S. 480). Im einzelnen werden insbesondere die Gesprächspsychotherapie nach Carl R. Rogers, die Gestalttherapie nach Fritz Perls oder die Logotherapie nach Viktor E. Frankl der humanistischen Psychologie bzw. Psychotherapie zugeordnet. Die Soziale Einzelfallhilfe wurde insbesondere von der nicht-direktiven, klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie bzw. Beratungsmethode eines Carl Rogers maßgeblich beeinflusst. Die wesentlichen Annahmen der Gesprächspsychotherapie sind (vgl. Schneider/Esser 1993): 1. Klienten-/Personenzentriertheit: Im Mittelpunkt des beraterischen Interaktionsgeschehens während der Sozialen Einzelfallhilfe steht die hilfesuchende Person mit ihren jeweiligen Gefühlen, Wünschen, Zielen und Wertvorstellungen, kurz: mit ihrer subjektiven Sicht auf die Innen- und die Außenwelt. Die HelferInnen geben weder Ratschläge noch Empfehlungen, weder bewerten sie die Sicht- und Verhaltensweisen der KlientInnen noch intervenieren sie diesbezüglich direktiv durch konkrete Vorschläge. Das Ziel während der Beratung besteht darin, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, die die Angst der KlientInnen mindert und sie schließlich in die Lage versetzt, selbst aktiv an der kreativen Lösung der eigenen Probleme zu arbeiten. Somit steht auch hier „Hilfe zur Selbsthilfe“ im Mittelpunkt. 2. Beeinflussung und Veränderung des Gesprächsverhaltens, der Selbstexploration (Selbstbefragung, -einschätzung, -offenbarung) und des problematisierten Verhaltens und Erlebens der KlientInnen durch das verbale und soziale Verhalten der SozialarbeiterInnen: Als für den Hilfeprozess maßgebliche Verhaltensweisen bzw. zentrale Basisvariablen der HelferInnen gelten: a) „Echtheit“ (Kongruenz; Authentizität) der HelferInnen; 19 b) die volle Akzeptanz bzw. Wertschätzung und bedingungslose, positive Bemühung um die KlientInnen; c) das tiefe, sensitive und einfühlende Verständnis der Gefühle der KlientInnen und deren Bedeutung (Empathie). Die Verfahren der nicht-direktiven Beratung sind insbesondere: 1. Ermöglichung der Selbstexploration: Hierbei geht es darum, die KlientInnen zu befähigen, über sich selbst zu sprechen, darüber, was sie bedrückt, was sie denken und was sie fühlen. Der Berater „bestimmt seine Rolle mit der Mitteilung, daß er selbst keine Lösung für die Schwierigkeiten des Klienten bereitstellen kann, daß er aber bereit ist, ihm bei der Lösung seiner Schwierigkeiten beizustehen. Da der Klient in kein Gespräch über Sachverhalte eintreten kann, wird er auf seine eigenen Erfahrungen zurückverwiesen“ (Geißler/Hege 1988, S. 80). 2. Die Verbalisierung der emotionalen Erlebnisinhalte der KlientInnen: Mit diesem Verfahren sind die BeraterInnen aufgefordert, den KlientInnen aktiv zuzuhören, sie vor allem emotional zu verstehen, d.h. die HelferInnen teilen den KlientInnen mit, was sie an Emotionen wahrgenommen haben. Es wird davon ausgegangen, je mehr es den BeraterInnen gelingt, adäquat die Erlebnisweise der KlientInnen verbal zu erfassen, um so stärker sind die KlientInnen in der Lage, sich zu öffnen und über ihre Probleme zu sprechen. Beispiel einer Interaktion, in der die Beraterin die emotionalen Erlebnisinhalte des Klienten verbalisiert: „Klient: Ich weiß manchmal gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Beraterin: Sie fühlen sich richtig verunsichert. Klient: Meine Mutter läßt mich nie in Ruhe. Beraterin: Sie fühlen sich fast kontrolliert. Klient: Ich langweile mich sehr. Beraterin: Es spricht Sie überhaupt nichts an.“ (Vgl. ebd., S. 85f.). Kritik: „In allen Gesprächen oder Gesprächsabschnitten, in welchen es darum geht, die emotionale Lage des Klienten ihm selbst und dem Sozialpädagogen zu verdeutlichen, ist die Anwendung dieses Verfahrens eine adäquate Intervention. Konflikte [...], die im Berufsfeld des Sozialpädagogen auftreten, sind jedoch mit Selbstexploration des Klienten allein nicht zu lösen. [...] Schon Rogers hat deutlich gemacht, daß Klienten, deren Schwierigkeiten im Umfeld liegen, nicht geeignet sind für klientenzentrierte Gesprächsführung. Dies bedeutet für 20 den Sozialpädagogen, daß er zunächst den Einfluß des Umfeldes sehen muß, dann erst entscheiden kann, ob er mit seinen Interventionen sich dem Umfeld, dem Problem und seinem Sachverhalt oder zunächst den psychischen Anteilen des Problems zuwenden muß“ (Geißler/Hege 1988, S. 86ff.). Literatur: Fraßa, Heinz-Jörg (1993): Humanistische Psychologie, in: Fachlexikon für soziale Arbeit. Hrsg. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge. Frankfurt/M.: Eigenverlag: S. 480 Geißler, Karlheinz A.; Hege, Marianne (1988): Konzepte sozialpädagogischen Handelns. Ein Leitfaden für die Praxis. Weinheim/Basel: Beltz (1992) Schneider, Manfred; Esser, Ulrich (1993): Gesprächspsychotherapie, in: Fachlexikon für soziale Arbeit. Hrsg. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge. Frankfurt/M.: Eigenverlag: S. 413 21 2.2.3 Systemische Familien-/Kommunikationstherapie Die Familientherapie, die in den 1950er Jahren vor allem in den USA entstanden ist, hat insbesondere zwei Wurzeln: zum einen die Sozialarbeit und zum anderen die Schizophrenieforschung; „beides sind Bereiche, die die Erfahrung vermitteln, daß das menschliche Individuum nicht ‚kleinste therapiefähige Einheit’ ist“ (Simon 1983, S. 349f.). Genau dies ist auch der Grundgedanke der Familientherapie: menschliches Verhalten ist abhängig vom System (Familie, Gemeinschaft, Gesellschaft etc.), in dem es gezeigt wird, so dass man menschliches Verhalten nur verstehen und Menschen nur zur Veränderung anregen kann, wenn man das jeweils verhaltensrelevante System betrachtet bzw. behandelt (z.B. die gesamte Familie). Die verschiedenen Schulen der Familientherapie (die von der Psychoanalyse kommende Familientherapie [z.B. H. Stierlin]; die strukturelle Familientherapie [z.B. S. Minuchin]; die Kurztherapie bzw. systemische Familientherapie [z.B. Mailänder Schule: M. SelviniPalazzoli; Mental Research Institute Palo Alto: Paul Watzlawick] sowie die entwicklungsbzw. erlebnisorientierte Familientherapie [z.B. V. Satir]) entstanden aus der Erfahrung, dass psychologische Therapien mit einzelnen Personen häufig erfolglos blieben – besonders bei schwerwiegenden psychiatrischen Symptomen und Multiproblem’fällen‘. Es zeigte sich, dass es nicht ausreicht, sich therapeutisch oder beraterisch auf die Psyche der jeweils zu therapierenden Personen zu beziehen, weil ihr (symptomatisches) Verhalten abhängiger erschien von den familiären Beziehungen, in denen die Personen lebten, als man gemeinhin (etwa im psychoanalytischen Denken) annahm. Die systemische Familientherapie begreift daher Verhalten von Menschen als eine Funktion bzw. als eine abhängige Variable von (zwischenmenschlichen) Systemen. Individuelles Verhalten ist nur sinnvoll verstehbar, wenn es in seinem jeweils relevanten systemischen Kontext betrachtet wird. Jedes soziale Verhalten von Menschen ist ein auf andere Menschen bezogenes Verhalten. Somit ist es wichtig, die Bedeutung und die Kommunikationsregeln der relevanten zwischenmenschlichen Beziehungen (der Systeme) zu kennen, wenn man Verhalten verstehen bzw. verändern will. Insbesondere die Möglichkeiten und Grenzen der Veränderung von Verhalten erscheinen in diesem Zusammenhang abhängig von den Möglichkeiten und Grenzen der Veränderung der Kommunikationsregeln von Beziehungen. Schon die ersten von dem Anthropologen Gregory Bateson (s. 1981) durchgeführten kommunikationstheoretischen Studien in den 1950er Jahren offenbarten, dass der Sinn menschlichen Verhaltens, der im interaktiven Kontext immer kommunizierend wirkt („Man kann nicht nicht kommunizieren“; s.u.), nur verstanden werden kann, wenn Verhalten in 22 seinem (kommunikativen) sozialen Kontext gesehen wird. Am Beispiel des Verhaltens von als schizophren diagnostizierten Familienmitgliedern wurde deutlich, dass Schizophrenie nicht nur das Symptom eines Patienten ist. Vielmehr entdeckten Bateson und seine MitarbeiterInnen, dass schizophrenes Verhalten Resultat einer (paradoxen) Kommunikation in einem bestimmten sozialen Kontext ist (s. dazu auch Watzlawick u.a. 1969, S. 171 ff.). Schizophrene Verhaltensmuster erscheinen demnach als die einzig mögliche Reaktion auf einen absurden zwischenmenschlichen Kontext. Der Ausgangspunkt der familientherapie-orientierten Konzepte der Sozialen Arbeit ist das Verständnis der menschlichen Interaktion als ein System (vgl. Watzlawick u.a. 1969, S. 115 ff.), das sich von einer Umwelt abgrenzt und aus „Mit-anderen-Personenkommunizierende[n]-Personen“ (ebd., S. 116). besteht. Neuere familientherapeutische bzw. systemisch Konzepte betonen allerdings, dass ausschließlich Kommunikationen bzw. Verhaltsweisen (vgl. Simon 1993, S. 104) als Elemente in die Bildung eines sozialen Systems (z.B. einer Familie) eingehen. Um in der Sozialen Arbeit die helfende Beziehung angemessen zu gestalten, erfordert die SozialarbeiterIn-KlientIn-Interaktion system- und kommunikationstheoretische Kenntnisse der SozialarbeiterInnen, denn „das Wesen jeder Beziehung ist trotz seiner Unmittelbarkeit und Alltäglichkeit schwer erfaßbar“, so Paul Watzlawick. Diesbezüglich lassen sich nach Paul Watzlawick u.a. (1969) folgende kommunikationstheoretische Axiome nennen: 1. Man kann nicht nicht kommunizieren; 2. Jede Mitteilung hat einen Beziehungs- und Inhaltsaspekt; 3. Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Ereignisfolgen bestimmt; 4. Jede Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten; 5. Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht. Auch für die ein soziales System konstituierenden Kommunikationsprozesse gilt wie für alle Beziehungen innerhalb einer jeden systemischen Ganzheit, dass sie „immer schon mehr und andersgeartet [...sind...], als die bloße Summe der Elemente, die [etwa...] Kommunikanten in [eine...] Beziehung hereinbringen“ (ebd.). Watzlawick beschreibt die Kommunikationsprozesse entsprechend der Systemtheorie, wenn er formuliert, dass „nicht nur [...] eine Ursache eine Wirkung [erzeugt], sondern jede Wirkung wirkt ihrerseits ursächlich auf ihre eigene Ursache zurück. Daraus entstehen Komplexitäten, die sich jeder Reduktion auf ihre Einzelbestandteile entziehen“ (ebd). 23 Da Verhalten, wie das Systemdenken lehrt, nicht verstehbar scheint, wenn der soziale Kontext, in dem es auftritt, vernachlässigt wird, ist der Erfolg sozialarbeiterischer Interventionen davon abhängig, inwieweit die SozialarbeiterInnen in der Lage sind, die konkreten psychischen, gesellschaftlichen und familiären Bedingungen ihrer KlientInnen in ihren wechselseitigen Abhängigkeiten einzuschätzen. Hierfür bietet die Familientherapie vielfältige Problembeschreibungsmöglichkeiten: z.B. das Genogramm (siehe Arbeitsblatt: Das Genogramm als Methode der systemischen (Familien-) Beratung. Literatur: Bateson, Gregory (1981): Ökologie des Geistes. Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven. Frankfurt/M.: Suhrkamp Schlippe, A. v. (1987): Familientherapie im Überblick. Basiskonzepte, Formen, Anwendungsmöglichkeiten. Paderborn: Junfermann Simon, Fritz B. (1983): Die Epistemologie des Nullsummen- und Nichtnullsummenspiels, in: Familiendynamik, 4/1983: S. 341-363 Simon, Fritz B. (1993): Unterschiede, die Unterschiede machen. Klinische Epistemologie. Grundlagen einer systemischen Psychiatrie und Psychosomatik. Frankfurt/M.: Suhrkamp Watzlawick, P. u.a. (1969): Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. Bern: Huber Exkurs: Das Genogramm als Methode der systemischen (Familien-) Beratung Genogramme dienen der übersichtlichen Darstellung von komplexen Informationen über Familiensysteme. Ein Genogramm kann bis zu drei Generationen umfassen und wird in der Regel gemeinsam – diskursiv, dialogisch – mit den Familienmitgliedern oder den einzelnen KlientInnen/KundInnen erarbeitet. Ein Genogramm ist eine (Re-)Konstruktion der familiären Vergangenheit aus der jeweiligen sozialen, sachlichen und zeitlichen Perspektive; insofern offenbart ein Genogramm nicht, wie die familiäre Geschichte wirklich war, sondern wie sie ‚hier und jetzt‘ (Zeitdimension) aus der Perspektive der entsprechenden Person(en) (Sozialdimension) bezüglich einer bestimmten in der Beratung zu bearbeitenden Problemstellung bzw. bezüglich eines bestimmten Themas (Sachdimension) beschrieben wird/werden kann. Das Genogramm wird in der Regel ausgehend von einem jeweils infrage stehenden Klienten erarbeitet. In einem Haushalt gemeinsam lebende Personen können umkreist werden. 24 In das Bild lassen sich dann wichtige Fakten einschreiben: * Name, Alter, Geburts- und eventuell Todesdaten; * Datum der Heirat, eventuell auch des Kennenlernes, Daten der Trennung und Scheidung; * Wohnorte, Herkunftsorte der Familie, Ortswechsel; * Krankheiten, schwere Symptome, Todesursachen; * Berufe. Interessant sind weitere Informationen: * Eigenschaften, die Personen zugeschrieben werden – auch besondere Fähigkeiten, Auffälligkeiten und Stärken; * Begriffe zur Kennzeichnung der jeweiligen Familienatmosphäre; * Hinweise auf bestimmte immer wiederkehrende Themen in der Familie; * Tabus und ‚weiße Stellen‘ im Genogramm: Z.B. von wem ist nichts bekannt? * Ressourcen, besondere Leistungen der Familie. „Das Wichtigste bleiben jedoch die Geschichten, die zu den Genogrammdaten erzählt werden. Sie bilden den Hintergrund für ein neues Verständnis der Gegenwart“ (A. v. Schlippe/J. Schweitzer, Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung, Göttingen 1996, S. 131). Die Erarbeitung eines Genogramms dient dem Ziel, die aktuelle (Familien-)Situation bzw. aktuelle Themen neu, d.h. anders als bisher zu beschreiben – bestenfalls so, dass Ressourcen ‚entdeckt‘ werden können, die bei der Lösung aktueller Schwierigkeiten/Probleme hilfreich sind. Im Genogramm sind also nicht lediglich problematisch bewertete Aspekte, Eigenschaften von Personen, Familienthemen etc. aufzuführen, sondern insbesondere auch Stärken, Ressourcen von Personen und vor allem die (verschütteten, bisher ausgeblendeten) ‚Schätze‘ der Familie, die es gilt, schätzen zu lernen. 25 2.3 Soziale Gruppenarbeit Geschichte: Die soziale Gruppenarbeit ist insbesondere aus vier verschiedenen Richtungen hervor gegangen: aus der Jugendbewegung (a), der Reformpädagogik (b), der Gruppendynamik (c) und der Bewegung der Nachbarschaftsheime/Settlements (d). (a) Die Jugendbewegung ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts als eine eigenständige Form sozialen Engagements entstanden. Sie zeichnete sich vor allem durch die gemeinsame Aktivität gleichaltriger Jungen aus, die von wenige Jahre älteren Gruppenführen angeleitet wurden und Wanderfahrten etc. unternahmen. (b) Die Reformpädagogik gilt als jene Bewegung, die die Gruppe als Medium sozialer Erziehung (wieder) entdeckt hat. Ihr liegt die Idee zugrund, dass der Gruppe eine zentrale Bedeutung bei der Erziehung und Sozialisation junger Menschen zur Selbstverantwortung und sozialer Orientierung zukommt. (c) Die Gruppendynamik ist eng mit dem Namen Kurt Lewin verbunden und entstand in den 1930er Jahren als eine Forschungsrichtung der Sozialpsychologie, die sich wissenschaftlich mit der Struktur, der Genese, der Entwicklung und nicht zuletzt mit Besonderheiten von Kleingruppen beschäftigte. Die Forschungsergebnisse dieser Richtung führten schließlich zur professionellen Nutzung der Gruppe für die Erziehung und die Therapie, z.B. in Form der Therapiegruppen, Trainingsgruppen, Encounter Gruppen oder der Themenzentrierten Interaktion. Exkurs: Gruppenregeln nach Ruth Cohn – Themenzentrierte Interaktion (TZI) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vertritt dich selbst in deinen Aussagen; sprich per ‚Ich’ und nicht per ‚Wir’ oder per ‚Man’. Wenn du eine Frage stellst, sage, warum du fragst und was deine Frage für dich bedeutet. Sage dich selbst aus und vermeide das Interview. Sei authentisch und selektiv in deinen Kommunikationen. Mache dir bewusst, was du denkst und fühlst, und wähle, was du sagst und tust. Halte dich mit Interpretationen von anderen so lange wie möglich zurück. Sprich statt dessen deine persönlichen Reaktionen aus. Sei zurückhaltend mit Verallgemeinerungen. Wenn du etwas über das Benehmen oder die Charakteristik eines anderen Teilnehmers aussagst, sage auch, was es dir bedeutet, dass er so ist, wie er ist (d.h. wie du ihn siehst. 26 7. 8. 9. Seitengespräche haben Vorrang. Sie stören und sind meist wichtig. Sie würden nicht geschehen, wenn sie nicht wichtig wären. („Vielleicht wollt ihr erzählen, was ihr miteinander sprecht?“) Nur einer redet zur gleichen Zeit. Wenn mehr als einer gleichzeitig sprechen will, verständigt euch mit Stichworten, über was ihr zu sprechen beabsichtigt. (d) Die Nachbarschaftsheime bzw. Settlements können als Vorformen der sozialen Gruppenarbeit angesehen werden und sind z.B. als englische Settlements entstanden, in denen Studenten gemeinsam mit „Nachbarn“ neue Formen sozialer Unterstützung erprobten oder konstituierten sich als amerikanische Nachbarschaftshäuser, die initiiert wurden von der Pionierin der Sozialarbeit Jane Addams. In Deutschland etablierte sich die soziale Gruppenarbeit insbesondere mit der Übernahme des sozialarbeiterischen Methoden-Dreigestirns – soziale Einzel(fall)hilfe, soziale Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit – aus den USA nach 1945 und wird heute allen Bereichen der Sozialen Arbeit angewandt, z.B. in der Kinder- und Jugendhilfe, siehe dazu § 29 KJHG (Soziale Gruppenarbeit), wo es heißt: „Die Teilnahme an einer sozialen Gruppearbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.“ Zwei Definitionen sozialer Gruppenarbeit: „Gruppenarbeit wird hier gesehen und beschrieben als einer der drei Methoden der Sozialarbeit. Durch sie will ein dafür besonders ausgebildete Gruppenleiter die Menschen in der Gruppe dazu bereit und fähig werden lassen, als ganze Menschen sich zu entwickeln, zu wachsen und reifen. Dabei spielen die Beziehungen eine ausschlaggebende Rolle, die die Mitglieder zueinander, zum Leiter und zu anderen Gruppen haben. Von wesentlicher Bedeutung ist jedoch außerdem die Begegnung und Auseinandersetzung mit einem sachlichen Programm“ (Lattke 1962). „Soziale Gruppenarbeit ist eine Methode der Sozialarbeit, die den Einzelnen durch sinnvolle Gruppenerlebnisse hilft, ihre soziale Funktionsfähigkeit zu steigern und ihren persönlichen Problemen, ihren Gruppenproblemen oder den Problemen des öffentlichen Lebens besser gewachsen zu sein“ (Konopka 1971). 27 Drei Bestimmungsmerkmale der sozialen Gruppenarbeit als Methode der Sozialarbeit: 1. 2. 3. Die Gruppe ist nicht Selbstzweck, sondern dient als Medium psycho-sozialer Veränderung. Daher stehen im Mittelpunkt Ziele wie Wachstum, Reifung, Bildung, Heilung und/oder Integration des Einzelnen. Von sozialer Gruppenarbeit wird erst dann gesprochen, wenn ein sozialpädagogisch geschulter Experte die Gruppe anleitet. Die Zielsetzung bezieht sich auf gesellschaftseingliedernde (integrierende und inkludierende) Bestrebungen. Durch die Gruppen soll der Einzelne seine sozialen Anpassungsmöglichleiten bzw. seine soziale Funktionsfähigkeit erhöhen. Der Gruppenleiter muss insbesondere das Phasenmodell (nach Garland 1975) der Gruppenarbeit kennen, will er eine Gruppe kompetent anleiten und gestalten. Demnach gliedert sich die Entwicklung einer sozialen Gruppe folgendermaßen: Phasen Bezeichnung der Phasen Aufgaben in den Phase 1. Orientierungsphase, Voran- Es muss das Problem der Gruppenzusammensetzung gelöst, und es sollten erste Ziele schluss für die Gruppe formuliert werden. 2. Machtkampf, Übergangsphase Kontraktklärung (in Lerngruppen: Lernzielabsprache). Drei Hauptprobleme sind zu lösen: 1. Rebellion und Autonomie; 2. die normative Krise (der Wahrscheinlichkeit des Austritts aus der Gruppe ist in dieser Phase am höchsten); 3. Schutz und Stützung. 3. Vertrautheitsphase, Beziehungsphase Wichtig sind Fragen der emotionalen Beziehungsabklärung, des Treffens von Entscheidungen und Bewältigung von Konflikten. 4. Entwicklungsphase, Differenzierung Wichtig sind Fragen des Lösens von Gruppenaufgaben und des Miteinanderarbeitens. 5. Trennung, Ablösung Wichtig sind: 1. Klärung, ob die Trennung gruppenentwicklungsbedingt oder durch die Umstände erzwungen ist; 2. Frage nach der Zukunft. 28 Literatur: Galuske, M. (1998): Methoden Sozialer Arbeit. Eine Einführung. Weinheim/München: Juventa: S. 77ff. Nebel, G.; Woltmann-Zingsheim, B. (Hrsg.) (1997): Werkbuch für das Arbeiten mit Gruppen. Insb. S. 31ff.: Krapohl, L.: Klassische Modelle Sozialer Gruppenarbeit und S. 362ff.: Das „Devolpmental Model“ der Sozialen Gruppenarbeit. Aachen: Kersting 29 2.4 Gemeinwesenarbeit Geschichte: Die Gemeinwesenarbeit stammt wie die anderen klassischen Methoden/Arbeitsformen der Sozialen Arbeit (Soziale Einzelfallhilfe, Soziale Gruppenarbeit) aus dem amerikanischen social work. Sie ist dort zum einen als community organization und zum anderen als community development in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert entwickelt worden. Community organization, als die auch in Deutschland der 1950er Jahre aufgenommene Form der Gemeinwesenarbeit, zielte auf die Verbesserung der Infrastruktur in urbanen Großstadtzentren ab: „Ihr Anliegen war es, in den durch Einwanderer unterschiedlichster Herkunft geprägten großstädtischen Elendsvierteln, durch gezielte Intervention und Unterstützung Entwicklungen in Gang zu setzen, die die Eingliederung dieser Bevölkerungsgruppen in die amerikanische Gesellschaft beförderten und die ‚Rekonstruktion heruntergewirtschafteter Massenwohnviertel’ (C.W. Müller 1992, S. 105) vorantrieben“ (Galuske 1998, S. 88). Definitionen (nach Galuske 1998, S. 90f.): „Community organization for social welfare gilt als eine der ‚grundlegenden Methoden’ der Sozialen Arbeit. In der einfachsten Form wird sie praktiziert, wenn eine Gruppe von Bürgern einer Stadt sich zusammentut, um in planmäßiger Weise ein gemeinsames Bedürfnis zu befriedigen. Als berufsmäßig ausgeübte Tätigkeit mit erprobten Methoden und anerkannten, lehrbaren Fertigkeiten aber ist community organization der Prozeß, durch den Hilfsquellen und Bedürfnisse der sozialen Wohlfahrt innerhalb eines geographisch oder inhaltlich begrenzten Arbeitsfeldes immer wirksamer aufeinander abgestimmt werden“ (Lattke 1955). „Der Begriff Gemeinwesenarbeit [...] bezeichnet einen Prozeß, in dessen Verlauf ein Gemeinwesen seine Bedürfnisse und Ziele feststellt, sie ordnet oder in eine Rangfolge bringt, Vertrauen und den Willen entwickelt, etwas dafür zu tun, innere und äußere Quellen mobilisiert, um die Bedürfnisse zu befriedigen, daß es also in dieser Richtung aktiv wird und dadurch die Haltung von Kooperation und Zusammenarbeit und ihr tätiges Praktizieren fördert“ (Ross 1968). „Gemeinwesenarbeit ist eine Methode, die einen Komplex von Initiativen auslöst, durch die die Bevölkerung einer räumlichen Einheit gemeinsame Probleme erkennt, alte Ohnmachtserfahrungen überwindet und eigene Kräfte entwickelt, um sich zu solidarisieren und Betroffenheit konstruktiv anzugehen. Menschen lernen dabei, persönliche Defizite aufzuarbeiten und individuelle Stabilität zu entwickeln und arbeiten gleichzeitig an der Beseitigung akuter Notstände (kurzfristig) und an der Beseitigung von Ursachen von Benachteiligung und Unterdrückung“ (Karas/Hinte 1978). Gemeinwesenarbeit ist „die zusammenfassende Bezeichnung verschiedener, vor allem nationaler und im Laufe der Entwicklung der letzten Jahrzehnte unterschiedlicher 30 Arbeitsformen, die auf die Verbesserung der sozio-kulturellen Umgebung als problematisch definierter, territorial oder funktional abgegrenzter Bevölkerungsgruppen (Gemeinwesen) gerichtet ist. Diese Verbesserung soll in methodischer Weise unter fachkundiger Begleitung durch theoretisch und praktisch ausgebildete Sozialarbeiter und unter aktiver Teilnahme der (entsprechenden) Bevölkerung(sgruppe) durchgeführt werden. Es geht hierbei um eine Anpassung der Problemgruppe an die Umgebung, um eine Veränderung der (Einstellungen, Verhaltensweisen der) Umgebung und um die gemeinsame Erarbeitung von, gemäß den entsprechenden kulturellen Normen, notwendigen Fertigkeiten oder Institutionen“ (Ludes 1977). Zielstellungen: Soziale Arbeit bezieht sich entweder auf Verhaltensänderung oder auf Verhältnisänderung bzw. hat beide Bereiche gleichzeitig im Blick. Während die Soziale Einzelfallhilfe und die Soziale Gruppenarbeit tendenziell eher Verhaltensänderungen von Individuen anstreben, intendiert Gemeinwesenarbeit eher eine Verhältnisänderung, eine Beeinflussung der sozialen Milieus, der Umwelt bzw. des Umfeldes von Individuen. In der Gemeinwesenarbeit werden also sozial-strukturelle Veränderungen angestrebt, um die Lebensbedingungen von Menschen zu verbessern. Dazu ist keine asymmetrische SozialarbeiterIn-KlientIn-Beziehung, mithin keine individuelle Falldefinition notwendig. Gemeinwesenarbeit ist vor allem durch folgende Aspekte gekennzeichnet: sie bezieht sich auf soziale Netzwerke, und zwar – territorial – auf einen Stadtteil, eine Nachbarschaft, eine Gemeinde, einen Wohnblock, einen Straßenzug etc., – kategorial – auf bestimmte ethnisch, geschlechtsspezifisch, altersbedingt abgrenzbare Bevölkerungsgruppen und/oder – funktional – auf inhaltlich bestimmbare Problemlagen, z.B. Wohnen, Bildung etc.; sie geht zumeist von sozialen Konflikten oder gemeinsam geteilten Problemen aus; sie richtet sich gegen die – normalerweise in der Sozialen Arbeit typische – Individualisierung sozialer Probleme, sie hat vielmehr eine sozial-strukturelle, sozialsystemische Perspektive; sie ist trägerübergreifend und intendiert Kooperationszusammenhänge zwischen verschiedenen sozialen Dienstleistern innerhalb eines Gemeinwesens; sie ist zum Teil methodenintegrativ, d.h. sie kann auch Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit umfassen; sie wird durch die gezielte Anregung, Unterstützung, Beratung, Koordination usw. von Menschen durch SozialarbeiterInnen geleistet. Formen der Gemeinwesenarbeit: Wohlfahrtsstaatliche Gemeinwesenarbeit; Integrative Gemeinwesenarbeit; Aggressive Gemeinwesenarbeit; Katalytisch/aktivierende Gemeinwesenarbeit. 31 Zur Methode der Gemeinwesenarbeit: Phasen (nach Ross): 1. Feststellen und Bewusstmachen von Bedürfnissen und Zielen; 2. Ordnen und Prioritätensetzen bei den Bedürfnissen und Zielen; 3. Entwickeln der Bereitschaft, ans Werk zu gehen; 4. Ausfindigmachen von (internen und externen) Hilfsquellen; 5. Übergang zur Aktion. Rollen der Gemeinwesenarbeiter (nach Ross): LeiterIn; BefähigerIn; Sachverständige/r; SozialtherapeutIn. Techniken und Verfahren: Verfahren der Kontaktaufnahme und Kontaktpflege; Verfahren der Feldforschung; Verfahren der Meinungsbildung innerhalb von Gruppen; Verfahren politischer Einflussnahme. Resümee: Die zentrale Idee der Gemeinwesenarbeit, soziale Probleme nicht zu individualisieren, sondern sie in ihren gesellschaftlichen Kontexten zu verstehen, zu beeinflussen und – angeleitet von SozialarbeiterInnen – gemeinsam mit den Betroffenen an den sozial-strukturellen Bedingungen dieser Probleme zu arbeiten, ist vor allem durch die kritische Studentenbewegung der 1960er Jahre in die gesamte deutsche sozialarbeiterische Methodendiskussion aufgenommen worden. Inzwischen finden wir in vielen sozialarbeiterischen Methoden (z.B. in der systemischen Beratung, im Case Management, im Empowerment etc.) derartige Denkweisen und Ansätze wieder. Literatur: Galuske, M. (1998): Methoden Sozialer Arbeit. Eine Einführung. Weinheim/München: Juventa: S.89ff. 32 3. Aktuelle Methodendiskussion 3.1 Systemische Konzepte Zusammenfassung in der Sozialen Arbeit – Eine (erste) "Der Sozialarbeiter kann optimale Sozialarbeit nur leisten, wenn er systemisch denkt und handelt". Peter Lüssi (Systemische Sozialarbeit, Bern 1992, S. 75) Systemische Konzepte (Theorieansätze, Methoden, Verfahren, Techniken etc.) in der Sozialen Arbeit gehen zum einen zurück auf sozialwissenschaftliche Systemtheorien und zum anderen auf die verschiedenen Schulen der systemischen (Familien-)Therapie. Die sozialwissenschaftlichen Systemtheorien beschäftigen sich mit sozialen Systemen und deren Wechselwirkung mit psychischen und biologischen Systemen. Ein System wird als eine miteinander in Wechselwirkung, in Interaktion stehende Menge von Elementen (z.B. kommunikative Verhaltensweisen/Handlungen in sozialen Systemen) verstanden, die sich von einer (nicht zum System gehörenden) Umwelt abgrenzen (lassen). Systemdenken ist also System/Umwelt-Denken; es interessiert sich für die Entstehung (Ausdifferenzierung) und Entwicklung von Systemen, die mit ihrer Umwelt bzw. mit anderen Systemen aus ihrer Umwelt in Interaktion stehen. Zum Beispiel lässt sich die Familie als ein soziales System verstehen, das sich durch die klar definierten Mitglieder bzw. Rollen (Vater, Mutter, Kinder) von einer Umwelt abgrenzen lässt, in der sich vielfältige andere Systeme beobachten lassen (z.B. Hilfesysteme der Sozialen Arbeit, ökonomische Systeme, erzieherische Systeme, politische Systeme etc.), mit denen die Familie in vielfältiger Weise in Beziehung steht. Die neuere sozialwissenschaftliche Systemtheorie, für die vor allem der Name des Bielefelder Soziologen Niklas Luhmann (1929-1998) steht, interessiert sich vor allem für die Unvorhersehbarkeit, Unsicherheit (Kontingenz) und für die nur begrenzten Beeinflussungsmöglichkeiten von sozialen Systementwicklungen. Die verschiedenen Schulen der systemischen (Familien-)Therapien entstanden (seit Ende der 1950er Jahre) aus der Erfahrung, dass psychologische Therapien mit einzelnen Personen häufig erfolglos blieben – besonders bei schwerwiegenden psychiatrischen Symptomen und Multiproblem’fällen‘. Es zeigte sich, dass es nicht ausreicht, sich therapeutisch auf die Psyche der jeweils zu therapierenden Personen zu beziehen, weil ihr (symptomatisches) Verhalten abhängiger erschien von den familiären Beziehungen, in denen die Personen lebten, als man 33 gemeinhin (etwa im psychoanalytischen Denken) annahm. Die systemische Therapie begreift daher Verhalten von Menschen als eine Funktion bzw. als eine abhängige Variable von (zwischenmenschlichen) Systemen. Individuelles Verhalten ist daher nur sinnvoll verstehbar, wenn es in seinem jeweils relevanten systemischen Kontext betrachtet wird. Jedes soziale Verhalten von Menschen ist ein auf andere Menschen bezogenes Verhalten. Somit ist es wichtig, die Bedeutung und die Kommunikationsregeln der relevanten zwischenmenschlichen Beziehungen (der Systeme) zu kennen, wenn man Verhalten verstehen bzw. verändern will. Insbesondere die Möglichkeiten und Grenzen der Veränderung von Verhalten erscheinen in diesem Zusammenhang abhängig von den Möglichkeiten und Grenzen der Veränderung der Kommunikationsregeln von Beziehungen. Aber diese Veränderungen können von außen, von der Therapie oder der Sozialarbeit, nur sehr eingeschränkt bewirkt werden. Systeme können sich nur nach ihren eigenen (strukturellen) Möglichkeiten verändern. Die Veränderungen sind also letztlich immer selbstbestimmt. Therapie und Sozialarbeit können diesbezüglich lediglich zur Selbstveränderung (Selbshilfe) anregen (helfen). Systemische Konzepte in der Sozialen Arbeit nehmen die dargestellten systemtheoretischen und systemtherapeutischen Vorstellungen auf und beziehen sie auf ihre Praxis. Dabei ist aber zu beachten, dass das systemische Denken für die Sozialarbeit nicht neu ist. Die Soziale Arbeit zeichnet sich nämlich seit jeher – im Gegensatz zur Psychotherapie – dadurch aus, dass sie nicht lediglich die einzelnen problembelasteten Menschen, die KlientInnen bzw. KundInnen bei ihren Hilfsangeboten beachtet, sondern immer auch deren soziale (familiäre, ökonomische, kulturelle etc.) Umwelt. Sozialarbeit versteht soziale Probleme als Probleme zwischen Menschen und innerhalb von sozialen Systemen. Menschen und deren soziale Probleme werden immer bezogen auf ihre jeweilige Umwelt sozialarbeiterisch beobachtet. So hat Sozialarbeit seit jeher versucht, nicht nur den einzelnen problembelasteten Menschen, den KlientInnen/KundInnen Hilfe anzubieten, sondern sie hat bestenfalls immer auch auch deren Familien, deren Lebenswelten, deren Gemeinwesen mit einbezogen in ihre Hilfeplanungen. Die Systemtheorie und die systemische Therapie können die Brauchbarkeit und Angemessenheit des systemischen sozialarbeiterischen Handelns (auch wissenschaftlich) bestätigen und der Sozialarbeit Denkweisen und Methoden zur Verfügung stellen, um reflektiert systemisch zu handeln. Solche Denkweisen und Methoden sind etwa das gezielte Kontextualisieren, zirkuläres Fragen, Reframing etc. Des weiteren trägt die systemische Denkweise dazu bei, eine sozialarbeiterische Haltung einzunehmen, die KlientInnen als ExpertInnen für deren Problemlösungen sieht, die klientäre Ressourcen zur Selbsthilfe zu aktivieren hilft und die auf gemeinsame Aushandlungsprozesse, auf professionelle Kooperation und nicht auf professionelles Besserwissen im helfenden Prozess setzt. 34 3.2 Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit und Postmodernisierung der Gesellschaft Ausgangsthese: Aktuelle Theorie- und Methodenansätze Sozialer Arbeit, die mit dem Sammelbegriff ‚lebensweltorientiert‘ bezeichnet werden können, sind Ausdruck für gesellschaftliche Wandlungsprozesse der Postmodernisierung. Diese These soll in zwei Schritten belegt werden: Im ersten Schritt sollen vier zentrale sozialpädagogische Theoriepositionen, die von einer Lebensweltorientierung ausgehen, benannt und knapp umschrieben werden. Im zweiten Schritt werden fünf gesellschaftliche Postmodernisierungs-Prozesse benannt und beschrieben sowie gezeigt, wie diese mit den zuvor dargestellten sozialpädagogischen Theoriepositionen verflochten sind. I. Lebensweltorientierung Mit ‚Lebensweltorientierung‘ ist ein allgemeines Strukturmerkmal sozialpädagogischer Theorien und nicht lediglich die sozialpädagogische Theorie von Hans Thiersch gemeint, die gemeinhin mit dem Titel ‚lebensweltorientiert‘ versehen wird. Allerdings hat Thiersch mit seinem Konzept der Lebensweltorientierung bereits Ende der siebziger Jahre einen Trend in der sozialpädagogischen Theoriebildung vorweggenommen, der besonders in den 1990er Jahren in Theorien Sozialer Arbeit strukturbildend wurde. Lebensweltorientierung bedeutet demnach in der Sozialpädagogik: das Einlassen auf die eigensinnigen Erfahrungen der AdressatInnen Sozialer Arbeit; Lebensweltorientierung wirkt damit normalisierenden, disziplinierenden, stigmatisierenden und pathologisierenden Tendenzen der gesellschaftlichen Funktion Sozialer Arbeit entgegen.1 Der Trend zur Lebensweltorientierung geht mit einer Enttraditionalisierung der theoretischen Grundprämissen Sozialer Arbeit einher. Zentral dabei ist, dass man sich von der traditionellen Leitunterscheidung Sozialer Arbeit, nämlich von der Unterscheidung Norm und Abweichung, verabschiedet und sich allmählich einer neuen Leitunterscheidung zuwendet: nämlich der Unterscheidung von Hilfe und Nicht-Hilfe.2 Mit anderen Worten, das doppelte Mandat der Sozialarbeit, das durch die Doppelorientierung von Hilfe und Kontrolle zum Ausdruck kommt, verlagert sich zusehends in Richtung Hilfe; die Hilfeorientierung gewinnt gegenüber der Kontrollorientierung an Gewicht. Auch in den rechtlichen Grundlagen der Sozialen Arbeit wird dies bereits sichtbar. So ist das achte Buch der Sozialgesetzgebung, das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weniger kontroll- denn hilfeorientiert. Es versteht sich klar als ein lebensweltbezogenes Dienstleistungsangebot für Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Und auch die im folgenden noch näher zu bestimmenden Aspekte der 1Vgl. Hans Thiersch, Strukturierte Offenheit. Zur Methodenfrage einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit, in. T. Rauschenbach, H. Gängler (Hrsg.): Der sozialpädagogische Blick. Lebenweltorientierte Methoden in der Sozialen Arbeit. Weinheim/München. Juventa, 1993, S. 13. 2Dirk Baecker, Soziale Hilfe als Funktionssystem der Gesellschaft, in: Zeitschrift für Soziologie, 2/1994, S. 93-110. 35 lebensweltorientierten Sozialpädagogik haben Eingang gefunden in das 1991 in Kraft getretene KJHG. In dem Maße, wie sich die Soziale Arbeit angesichts einer Lebensweltorientierung allmählich von ihrer normenkontrollierenden Funktion verabschiedet, werden in theoretischen Abhandlungen neue Themen zentral: nämlich u.a. die Themen: Kommunikation, Anerkennung von Differenz und Dissens, Grenzen des sozialpädagogischen Handelns und Reflexion. Kommunikation: Dass Kommunikation im Sinne von Diskurs, Aushandlung, Vermittlung, Dialog eine zentrale Kategorie sozialpädagogischer Theoriebildung geworden ist, wird exemplarisch sichtbar am Beispiel der Theorie des stellvertretenden Deutens. So begründen etwa Vertreter dieser Theorie, beispielsweise Bernd Dewe, eine ‚diskursive‘ Professionalität Sozialer Arbeit, in der es darum geht, gemeinsam und partnerschaftlich mit den AdressatInnen, Deutungen für deren problematische Lebenssituationen zu entwickeln.3 Diesbezüglich kommt es in der sozialpädagogischen Profession darauf an, jenseits von kontrollierenden Zwangsinterventionen die Autonomie der AdressatInnen nicht durch Bevormundung zu verletzen4. Vielmehr wird sozialarbeiterische Hilfe als Dialog, als Aushandlungsprozess verstanden. Anerkennung von Differenz und Dissens: Die Anerkennung von Differenz und Dissens ist insbesondere eine Leitidee in systemischen Konzepten. Hier wird von der Konstrukthaftigkeit subjektiver und sozialer Wirklichkeiten ausgegangen und deren jeweilige Verschiedenartigkeit herausgestellt. Dabei wird die Lebensweltorientierung deutlich durch die Anerkennung der Vielfältigkeit, der Pluralität der Wirklichkeitskonstruktionen, der Einstellungen und Werte der AdressatInnen Sozialer Arbeit. So muss im Hilfeprozess zuallerst kommunikativ ausgehandelt werden, worin überhaupt das Problem besteht bzw. wer was als Problem wie und wann sieht. Grenzen des sozialpädagogischen Handelns: Während etwa Bernd Dewe oder auch Roland Merten5 die Unterschiedlichkeit von Theorie und Praxis betonen und damit die Grenzen des theorieorientierten Handelns hervorheben, betont die systemische Position die von außen nicht direkt beeinflussbare Struktur von biologischen, psychischen und sozialen Systemen. Diesbezüglich erscheint Soziale Arbeit als ein soziales Handeln, das niemals direkt und unmittelbar Menschen oder soziale Systeme verändern kann. Soziale Arbeit kann allerdings Bedingungen, Möglichkeiten und Kontexte schaffen, um sich selbstorganisierende Problemlösungsprozesse, wenn man so will: ‚Selbstheilungskräfte’ auf Seiten ihrer AdressatInnen anzuregen. Reflexion: Reflexion avanciert in der gesamten erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Theoriedebatte der letzten Jahre zu einem zentralen Aspekt - und dies in zweierlei Hinsicht: 3Vgl. Bernd Dewe u.a., Professionelles soziales Handeln. Soziale Arbeit im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis. Weinheheim/München: Juventa, 1995, S. 50. 4Vgl. Ebd., S. 55. 5Siehe Bernd Dewe, a.a.O.; Roland Merten, Autonomie der Sozialen Arbeit. Zur Funktionsbestimmung als Disziplin und Profession. Weinheim/München: Juventa. 36 Einerseits wird die Sozialpädagogik, ja die gesamte Erziehungswissenschaft im zunehmenden Maße selbst reflexiv; sie fängt an, sich verstärkt mit sich selbst zu beschäftigen, theoretische Entwicklungen zu reflektieren und zu systematisieren. In diesem Zusammenhang spricht der Erziehungswissenschaftler Dieter Lenzen bereits von ‚reflexiver Erziehungswissenschaft‘.6 Andererseits betonen aktuelle sozialpädagogische Theorien besonders eindringlich die Notwendigkeit professioneller Selbstreflexionsmethoden wie Supervision und Selbstevaluation. Insbesondere durch das Einlassen auf die Ganzheitlichkeit der Lebenswelten sind Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen zu permanenten Selbstreflexionen angehalten. Somit ist Sozialarbeit sogar, wie Fritz Schütze formuliert, „eines der ‚Saatbeete‘ für das Wachsen der neuen Selbstreflexionsinstitution[en]“ geworden.7 II. Lebensweltorientierung als Folge gesellschaftlicher Postmodernisierung Unter Postmodernisierung kann – in Anlehnung an den Soziologen Hans-Günter Vester – die „Entfaltung, Entwicklung und Durchsetzung der Merkmale verstanden werden, die man als postmodern ansieht“,8 die mithin über die Moderne hinausführen, diese erschüttern, auflösen, infrage stellen, unterhöhlen etc. Im Folgenden werden diesbezüglich fünf Merkmale aufgeführt, die auf die theoretischen und methodischen Positionen einer lebensweltorientierten Sozialpädagogik bezogen werden können: 1. Die Postmodernisierung der Gesellschaft wird deutlich durch die soziale Auflösung der Unterscheidung von Norm und Abweichung. Daher muss sich auch die Sozialpädagogik von ihrer klassischen Leitdifferenz, Norm und Abweichung, verabschieden. Denn in der heutigen Gesellschaft vervielfältigt sich Normalität, und zwar so lange, bis sie sich als Orientierungsmaßstab von selbst auflöst.9 Dieses Auflösen von Normalitätsstandards lässt sich auf zwei soziale Prozesse zurückführen: zum einen auf die funktionale Differenzierung der Gesellschaft, die vor allem von Niklas Luhmann umfangreich analysiert wurde, und zum anderen auf die Individualisierung, was wohl bisher am intensivsten von Ulrich Beck beschrieben wurde. Durch diese Prozesse, also durch Differenzierung und Individualisierung, kommt es zu einer Vervielfältigung von Weltsichten, die nicht mehr unter den Hut einer einheitlichen Norm gebracht werden können. Interessant ist, dass sowohl funktionale Differenzierung als auch Individualisierung zutiefst moderne Erscheinungen sind. Die Moderne ist ja das Zeitalter, in dem Arbeitsteilung, also funktionale Differenzierung und Individualisierung ihre Blüte erreichen. Mittlerweile scheinen aber gerade diese Merkmale der modernen Gesellschaft eine Stufe erreicht zu haben, die die Moderne erschüttern, die ungeplante und schleichende Nebenfolgen produzieren. Dies führt schließlich dazu, dass eine andere gesellschaftliche Gestalt in Reichweite erscheint: die Postmoderne oder wie Beck sagt, die Risikogesellschaft bzw. ‚reflexive‘ oder ‚zweite‘ Moderne. 6Dieter Lenzen, Reflexive Erziehungswissenschaft am Ausgang des postmodernen Jahrzehnts, o.O., o.J. S. 166. 8Hans-Günter Vester, Soziologie der Postmoderne. München: Quintessenz, 1993, S. 24. 9Thomas Rauschenbach, Inszenierte Solidarität. Soziale Arbeit in der Risikogesellschaft, in: U. Beck; E. Beck-Gernsheim (Hrsg.): Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1994, S. 91. 7Ebd., 37 2. In der Postmoderne werden fast alle sozialen Prozesse ihrer Selbstverständlichkeit beraubt, fast nichts versteht sich mehr von selbst, fast alles wird kommunikativ hinterfragbar, muss begründet und ausgehandelt werden. Damit ist das zweite Merkmal angesprochen, das verdeutlicht, warum Kommunikation zu einem Leitmotiv der sozialpädagogischen Theoriediskurse wird. Mit der Steigerung der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft „verliert die Gesellschaft ihr Gesicht“, wie der Soziologe Bernhard Giesen formuliert; sie hat demnach „nichts Unverrückbares und Unbestreitbares mehr“10; sie wird polyzentrisch, fragmentarisch.11 Weder die Politik noch die Wirtschaft, weder die Religion noch die Pädagogik, weder die Wissenschaft noch die Familie und auch nicht das Rechtssystem können als Zentrum der heutigen Gesellschaft ausgemacht werden, von dem aus verbindliche Normen begründet und gesellschaftlich implementiert werden können. Vielmehr muss situativ und jeweils speziell verhandelt, ausgehandelt, vermittelt, diskutiert, debattiert, dialogisiert, kurz: kommuniziert werden, was hier und jetzt an Normen und Verbindlichkeiten gelten soll. 3. Dieses Kommunizieren setzt, wenn es keine Bevormundung sein will, die Akzeptanz von Differenz und Dissens voraus. Die Notwendigkeit dieser Akzeptanz verweist auf die ‚radikale Pluralität‘ in der postmodernen Gesellschaft. Spätestens in der Postmoderne wird Pluralität, also soziale Vielheit, Unübersichtlichkeit in welcher Hinsicht auch immer als Grundverfassung der Gesellschaft real. Daher wird die Suche nach pluralen Denk- und Handlungsmustern vordringlich, nach Denk- und Handlungsmustern eben, die von Pluralität ausgehen und diese anerkennen.12 Die Entwicklung dieser Pluralität lässt sich soziologisch beziehen auf die bereits angesprochenen Prozesse der funktionalen Differenzierung und Individualisierung. Die Anerkennung von Differenz und Dissens, von radikaler Pluralität ist schließlich, wie der Philosoph Wolfgang Welsch betont, untrennbar von wirklicher Demokratie,13 von Demokratie also, in der das kommunikative Aushandeln, das Diskursive zentrales gesellschaftliches Medium wird. 4. Dass Kommunikation jedoch nicht technologisch steuerbar ist und Menschen und soziale Systeme nicht direkt beeinflussen kann, verweist auf das Gewahrwerden der Grenzen des menschlichen Handelns in der Postmoderne. Die Moderne war und ist noch von dem Glauben, von dem Mythos getragen, dass der Mensch die Welt nach seinen Wünschen und Vorstellungen planvoll und zielgerichtet verändern und umgestalten kann. Die Postmoderne offenbart nun angesichts der Erfahrungen des Scheiterns vieler dieser Veränderungs- und Umgestaltungsversuche die Grenzen des menschlichen Denkens und Handelns. Die postmoderne Welt erscheint als ganzheitlicher Zusammenhang, der der menschlichen Veränderungsgewalt mit schleichenden und ungeplanten Nebenfolgen trotzt. Erst wenn man erkennt, was man machen kann und was nicht, welches ‚Schlechte‘ man sich einhandeln 10Bernhard Giesen, Die Entdinglichung des Sozialen. Eine evolutionstheoretische Perspektive auf die Postmoderne. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1991, S. 243. 11Vgl. Helmut Willke, Ironie des Staates. Grundlinien einer Staatstheorie polyzentrischer Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1992. 12Wolfgang Welsch, Unsere postmoderne Moderne. Berlin: Akademie, 1993, S. 5. 13Vgl. ebd. 38 kann, auch wenn man das ‚Gute‘ will, kann man einigermaßen realistisch die Möglichkeiten des Machbaren und dessen vielfältige Grenzen abschätzen. 5. Und dieses Abschätzen der Möglichkeiten des Machbaren verweist schließlich auf die Reflexion. In der Soziologie wurde erst kürzlich von Rodrigo Jokisch diagnostiziert, dass die funktionale Differenzierung der Gesellschaft sich zunehmend in eine reflexive Differenzierung wandelt.14 Unbestritten erscheinen inzwischen Effektivität und Effizienz der funktionalen Differenzierung, aber zum Problem wird immer mehr die Blindheit funktionaler Systeme gegenüber den Folgen, die sie in ihrer sozialen, biologischen und psychischen Umwelt auslösen. Damit wird Reflexion zum zentralen Kriterium der Differenzierung, ja zum ökologischen Überlebenskriterium von Systemen überhaupt. Das Reflektieren, das Beobachten des eigenen Beobachtens und Handelns wird in allen gesellschaftlichen Bereichen zentral. Politisch, rechtlich oder durch die Massemedien werden alle gesellschaftlichen Akteure angehalten, Risiken und Gefahren ihres Tuns für Mensch und Umwelt vorzubeugen und abzuschätzen. Und hier ist die Soziale Arbeit natürlich auch keine Ausnahme, sondern vielmehr eine Vorreiterin. Wie bereits erwähnt, Soziale Arbeit kann sich zu eigen halten, dass sie eine der ersten gesellschaftlichen Praxen ist, in der regelmäßig reflektiert und selbstbeobachtet wurde. 14Rodrigo Jokisch, Logik der Distinktion. Zur Protologik einer Theorie der Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag. 39 3.3 Case Management Was ist Case Management? Case Management ist eine an der klassischen sozialarbeiterischen Methode der Gemeinwesenarbeit orientierte Weiterentwicklung der traditionellen Sozialen Einzel(fall)hilfe („social casework“) und wurde in den letzten fünfundzwanzig Jahren insbesondere in der angloamerikanischen ambulanten/aufsuchenden Sozialarbeit entwickelt. So wurden etwa in den USA in den 1970er Jahren stärker als in Westeuropa stationäre Einrichtungen im Bereich der Psychiatrie, der Jugend- und Altenhilfe reformiert bzw. ganz geschlossen. Dadurch waren mehr hilfebedürftige – zum Teil langjährig hospitalisierte – Menschen als zuvor auf ambulante, gemeinwesennahe Hilfeangebote angewiesen. Diese Menschen waren aber nur sehr begrenzt in der Lage, das sehr differenzierte und spezialisierte Angebot an professionellen Hilfen und die eignen lebensweltlichen (privaten, familiären etc.) Ressourcen und Netzwerke (vgl. Bullinger/Nowak 1998) für eine biologisch, psychisch und sozial „gesunde“ bzw. selbstbestimmte Gestaltung ihres Lebens zu nutzen. In diesem historischen Kontext entwickelte sich das Case Management als eine Methode der Sozialarbeit, die Menschen, welche (wieder) in einem eigenen Haushalt leben, dabei hilft, formelle (professionelle) und informelle (privat-lebensweltliche) Hilfen zu initiieren und zu koordinieren. Im Case Management geht es darum, die Menschen dabei zu unterstützen, die eigenen Ressourcen und lebensweltlichen Netzwerke so gut wie möglich zu nutzen und Defizite, die nicht selbstständig oder durch andere privat-lebensweltliche Möglichkeiten kompensiert werden können, durch differenziert und planvoll eingesetzte professionelle Hilfen zu kompensieren. Die eingesetzten Mittel (u.a. Personal, Geld, Zeit) sollen so effektiv und effizient wie möglich genutzt werden. „Ziel von Case Management ist es, Fähigkeiten des Klienten zur Wahrnehmung sozialer Dienstleistungen zu fördern, professionelle, soziale und persönliche Ressourcen zu verknüpfen und höchstmögliche Effizienz im Hilfeprozess zu erreichen“ (Neuffer 1993, S. 200). Zur Realisierung eines solchen Ziels betreut ein Case Manager in generalistischer, d.h. in typisch sozialarbeiterischer Orientierung mehrere Fälle, für deren Koordinierung er federführend zuständig ist. Ein Case Manager führt „seine“ Klienten (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien), mit denen er im professionell-partnerschaftlichen Sinne kooperiert, durch den gesamten Hilfeprozess und erschließt die dafür notwendigen lebensweltlichen und professionellen Ressourcen und Netzwerke. Wie dies im Einzelnen geschieht, soll im Folgenden skizzenhaft gezeigt werden. Wie ‚funktioniert’ Case Management? Case Management versucht informelle (nicht-professionelle, lebensweltliche) und formelle (professionelle) Hilfen so effektiv und effizient wie möglich zu verkoppeln. Es setzt, wie man speziell in Deutschland sagen könnte, beim Subsidiaritätsprinzip an. Denn differenzierte 40 professionelle Hilfen sollen nur dort eingesetzt werden, wo privat-lebensweltliche Unterstützungen nicht (mehr) möglich sind. Nur dort, wo die KlientInnen sich nicht mehr bzw. noch nicht selbst oder durch Unterstützung ihrer privaten lebensweltlichen Netzwerke bzw. anderer Laien helfen können, sollen professionelle Hilfen dieses Hilfedefizit (vorübergehend) kompensieren. Damit ist das Case Management radikal ressourcenorientiert. Denn eine fortlaufende und zentrale Aufgabe eines Case Managers während der Fallarbeit ist es, permanent so gründlich wie möglich in professionell partnerschaftlicher Kooperation mit den KlientInnen und gegebenenfalls mit anderen professionellen Fachkräften (SozialarbeiterInnen, PädagogInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen etc.) die jeweiligen klientären Ressourcen und die lebensweltlichen Netzwerke zu erschließen, zu aktivieren sowie langfristig und stabil nutzbar zu machen. Die professionellen Hilfen, die zur Kompensation nicht vorhandener Ressourcen bzw. zur Behebung von Defiziten eingesetzt werden, sind vom Case Manager in Fallgesprächen mit den auszuführenden Trägern bzw. Fachkräften an die persönliche Situation der jeweiligen KlientInnen auszurichten. Es sind die Hilfen einzusetzen, die nötig sind und nicht jene, welche möglich wären. Mit dieser sehr an Selbsthilfe und Subsidiarität orientierten Arbeit minimiert Case Management ein ethisches Dilemma, dass nämlich Sozialarbeit entgegen ihrer Intentionen – gerade bei einer zeitlich sehr intensiven ‚Beziehungsarbeit’ – nicht (nur) Unabhängigkeit und Selbstständigkeit fördert, sondern potentiell und strukturell (auch) Abhängigkeit von Professionellen und Unselbstständigkeit erzeugt (vgl. Kleve 1999, S. 199ff./270ff.). Im Einzelnen gliedert sich Case Management in folgende zirkulär aufeinander verweisende Phasen (vgl. detailliert dazu Raiff/Shore 1993; Wendt 1997; Löcherbach 1998): a) Einschätzung/Kontextualisierung („assessment“) In der ersten Phase werden die jeweiligen Fälle z.B. von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe an die freien Träger (des Case Managements) verwiesen und eingeschätzt. Dabei gilt es abzuklären, ob es sich bei den jeweiligen Fällen um Fälle für das Case Management handelt oder nicht („screening“). Der Fall wird dann kontextualisiert, und zwar einerseits hinsichtlich der professionellen und andererseits hinsichtlich der lebensweltlichen Seite. Professionelle Seite: Es wird überprüft, wer strukturell (welches Amt, Jugendamt [ASD] oder möglicherweise auch Gesundheitsamt [KJPD oder SPD]?) und persönlich (welche/r Sozialarbeiter/in) von den öffentlichen Trägern für die Betreuung und die Finanzierung zuständig ist. Außerdem geht es darum zu prüfen, welche Professionellen (SozialarbeiterInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen etc.) bereits mit den KlientInnen arbeiten. Es ist mit den zuständigen Ämtern bzw. anderen Professionellen über die Problemsichten, Problemerklärungen und bereits versuchten Lösungen, über den aktuellen Hilfebedarf und über die bereits sichtbaren bzw. vermuteten lebensweltlichen Ressourcen (eigene Fähigkeiten/Potentiale) und Netzwerke (Verwandte, Freunde, Bekannte, die Unterstützungen 41 bieten könnten etc.) zu kommunizieren. So ist gegebenenfalls bereits zu prüfen und zu vereinbaren, bei welchen Problemaspekten Professionelle und bei welchen auch Laien (z.B. auch Zivildienstleistende und Studierende psycho-sozialer Disziplinen bzw. Professionen etc.) eingesetzt werden könnten. Lebensweltliche Seite: Es wird mit den KlientInnen Kontakt aufgenommen, bzw. ein erstes Kontakt- und Kennenlerngespräch wird von den zuständigen Professionellen der öffentlichen Träger (Ämter) vermittelt und unter Beteiligung des möglichen Case Managers durchgeführt. Es ist abzuklären, wie die KlientInnen die Probleme und die Hilfebedarfe selbst sehen, welche Erklärungen diesbezüglich herangezogen werden und welche Lösungsversuche bereits unternommen wurden. Weiterhin sind die Erwartungen der KlientInnen an den Case Manager bzw. hinsichtlich der Ambulanten Hilfe abzufragen. Schließlich ist eine erste gründliche Ressourcen- und Netzwerkanalyse im Hinblick auf der geschilderten Probleme und deren Lösung durchzuführen. Welche Fähigkeiten haben die KlientInnen? Was klappt auch hinsichtlich der Probleme (noch bzw. schon) gut? Welche BezugspartnerInnen haben die KlientInnen? Wie könnten diese Menschen in die Unterstützung eingebunden werden? etc. Möglicherweise sollten für das Assessment spezielle Leitfadenfragebögen entwickelt werden, die auf die Aufgaben und Zielstellungen der Ambulanten Hilfen zugeschnitten sind und dabei helfen, die ersten Interviews der Fachkräfte mit den KlientInnen (etwa bezüglich der Problemsichten, der Ressourcen- und Netzwerkanalyse sowie der Hilfebedarfsklärung) zu strukturieren. Wichtige Fragen könnten diesbezüglich sein (vgl. Galuske 1998, S. 186): Welche der Probleme oder Belastungssituationen bereiten den KlientInnen am meisten Schwierigkeiten? In welchen Bereichen zeigen die KlientInnen eigene Stärken und Fähigkeiten, wo können sie also aufgrund eigener Ressourcen die Belastungen bewältigen („coping“)? Welche Lösungsmöglichkeiten bzw. Hilfen sind unter den gegebenen Umständen am besten geeignet und entsprechen darüber hinaus den Wertvorstellungen, der Gefühls- und Lebenswelt der KlientInnen? Welche lebensweltlichen Netzwerke haben die KlientInnen zur Verfügung? Können aus diesem Netzwerk Personen unterstützen? Was könnten diese Personen bezüglich der Probleme und Bedarfe wann wie und mit wem tun? b) Hilfeplanung (“service planning”) In dieser Phase geht es um die Erarbeitung von Zielen, von erreichbaren Nah- und Fernzielen bzw. – kooperativ mit den KlientInnen – um die Erarbeitung eines Selbsthilfeplans. Dabei liegt der Fokus wiederum auf die lebensweltlichen Ressourcen und Netzwerke der KlientInnen. Welche Ziele können sie selbst, z.B. unter Hinzuziehung von Freunden/Verwandten oder anderer Laien erreichen? Welche Ziele können nur durch professionelle Unterstützung(en) erreicht werden? Wie können die klientären Ressourcen (Fähigkeiten, Stärken) sowie lebensweltlichen und professionellen Netzwerke, mithin die informellen und die formellen Hilfeangebote miteinander verknüpft werden? 42 Wichtig ist, dass Ziele positiv formuliert werden, d.h. es sollte beispielsweise nicht dabei stehen geblieben werden, etwas nicht mehr (tun) zu wollen, etwas zu unterlassen (z.B. nicht mehr zu trinken, nicht mehr so viel Geld auszugeben, keine Schulden mehr zu machen etc.), sondern erarbeitet werden, was anstatt dessen, anstatt der problematischen Verhaltensweisen denn – positiv – erreicht werden soll. Die Ziele sollten sich weiterhin in konkret beobachtbare Verhaltensweisen „übersetzen“ lassen. Es ist zu überprüfen, wer was wann wie von wem im Prozess der Hilfe will/erwartet. Welche Ziele hat der Auftraggeber (die öffentliche Jugendhilfe), der die Hilfe finanziert, und welche Ziele haben die KlientInnen? Wenn diesbezüglich große Differenzen sichtbar werden, ist eine Abstimmung und Klärung, z.B. durch Hilfekonferenzen vorzunehmen. Des weiteren ist zu erarbeiten, wer was wann wie womit mit wem tun muss, um die Ziele zu erreichen. Schließlich sind die Erfolgskriterien zu vereinbaren. Wer kann wann wie bei wem sehen, dass die vereinbarten Ziele erreicht wurden? In welchen Zeiten sollen diese Ziele (Nah- und Fernziele) erreicht bzw. soll die Erreichung kontrolliert werden? Schließlich ist es nötig, dass alle Ziele von den Ressourcen der KlientInnen ausgehen und diese weiter stärken. Der erarbeitete Selbsthilfeplan dient in der Evaluationsphase zur Auswertung und Erfolgsbewertung des Case Managements bzw. der geleisteten informellen und formellen Hilfen . c) Intervention – Durchführung der Hilfe Hier geht es darum, den Selbsthilfeplan umzusetzen. Dabei ist wiederum die Selbstständigkeit der KlientInnen anzuerkennen und zu stärken, es sind die klientären bzw. lebensweltlichen Möglichkeiten und Potentiale zu mobilisieren und zu unterstützen. Wenn möglich, sind Verwandte/Freunde bzw. Laien für eine Hilfeleistung, die von diesen ausgeführt werden kann, zu gewinnen, zusammen mit den KlientInnen einzusetzen und zu beraten. Wenn alle diese lebensweltlichen und auf die klientären Ressourcen ausgerichteten Möglichkeiten ausgeschöpft sind, müssen den KlientInnen, Träger bzw. Fachkräfte (TherapeutInnen, Erziehungs-, Familien-, Schuldner- oder andere Kontakt- und Beratungsstellen etc.) vermittelt werden, die für die Bewältigung bestimmter Probleme bzw. Problemaspekte notwendig sind. Diese Vermittlung übernimmt der Case Manager. Der Einsatz der vermittelten Träger oder Fachkräfte ist fallspezifisch zuzuschneiden, mit den KlientInnen vorzubereiten und vom Case Manager zu begleiten. Diese Begleitung umfasst die Beratung und Unterstützung der KlientInnen, um diese zur Inanspruchnahme der jeweiligen Träger und Fachkräfte zu befähigen. Der Case Manager hält den notwendigen Kontakt mit den KlientInnen, berät und unterstützt sie, und zwar – einerseits – hinsichtlich der Inanspruchnahme professioneller (formeller) Hilfen und – andererseits – hinsichtlich der Nutzung eigener und fremder lebensweltlicher (informeller) Ressourcen und Netzwerke. Der Case Manager hat dabei Beratungs- und Unterstützungsaufgaben, aber führt selbst keine pädagogischen (etwa auf die Kinder und Jugendlichen bezogenen) oder gar therapeutischen 43 Aufgaben aus; er übernimmt im Wesentlichen drei Aufgabenbereiche (vgl. Galuske 1998, S. 186): In bezug auf die KlientInnen geht es – erstens – um Information z.B. über die Zugänglichkeit bestimmter Angebote (Träger oder Fachkräfte), – zweitens – um Senkung von Zugangsschranken bezüglich bestimmter sozialer Dienstleistungen (z.B. durch gezielte Übungen) und – drittens – um Kontrolle des Klientenverhaltens im Sinne der Einhaltung des Selbsthilfeplans. In bezug auf die professionellen Hilfen geht es um die Überwachung der erbrachten Leistungen und um deren Koordination. d) Überwachung/Kontrolle der Hilfen („monitoring“) Hier besteht die zentrale Aufgabe des Case Managers darin, zusammen mit den KlientInnen ein Evaluationskonzept auszuarbeiten, um die Erfolge und Zielerreichungen bzw. „Korrekturen“, „Nachbesserungen“ der professionellen und lebensweltlichen (informellen) Hilfen feststellen zu können. Welche Erfolge lassen sich bereits beobachten? Wo sind neue Probleme aufgetaucht? Die von den KlientInnen in Anspruch genommenen professionellen Dienstleistungen sind hinsichtlich der Aspekte „Angemessenheit“, „Intensität“, Umfang“, „Qualität“ und „Wirksamkeit“ permanent zu überprüfen (vgl. Raiff/Shore 1993, S. 47). Dies geschieht durch regelmäßige Kontakte mit den KlientInnen sowie den eingesetzten professionellen und informellen HelferInnen, um „Feinabstimmungen“ zu ermöglichen, Absprachen, Vereinbarungen etc. zu treffen. Weiterhin sind Verfahren zu entwickeln, um unberücksichtigte Bedarfe und Lücken im Versorgungs- und Unterstützungssystem der KlientInnen „aufzuspüren“ und um die Erreichung der Ziele bzw. der Problemlösungen des Selbsthilfeplans zu überprüfen (z.B. anhand der Kriterien: Steigerung der Lebensqualität, Selbst- und Fremdbild etwa bezüglich der Kindererziehung, Umgang mit dem Einkommen etc.). e) Klientenfürsprache – Anwaltschaftliche Vertretung Grundsätzlich sind die KlientInnen durch das Case Management zu befähigen, selbstständig Hilfen und professionelle Dienste zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Diesbezüglich kann es allerdings notwendig sein, für die KlientInnen mit bestimmten Stellen Kontakt aufzunehmen oder die KlientInnen durch Beratungen zu befähigen, die jeweiligen Angebote anzunehmen und eigene diesbezügliche Bedürfnisse artikulieren zu lernen. Gerade vor Beendigung des Case Managements ist die Phase besonders herauszustellen, damit zukünftig ein informelles und formelles Netzwerk für die KlientInnen bereitsteht, das bei Unterstützungsnotwendigkeiten ohne großen Aufwand in Anspruch genommen werden kann. f) Beendigung und Evaluation/Auswertung der Ergebnisse/Dokumentation Schließlich steht am Ende eines Case Management-Prozesses, dass mit den KlientInnen erarbeitet wird, was angesichts des Selbsthilfeplans wie mit wem erreicht wurde, welche (formellen und/oder informellen) Hilfen beendet, welche – auch nach Ende des Case 44 Managements – weitergeführt werden sollten/müssten. Die Erfolge, die die KlientInnen erreicht haben, sind hervorzuheben, die klientäre Selbstständigkeit ist erneut herauszuarbeiten. Der Selbsthilfeplan ist auszuwerten, Erfahrungen und Ergebnisse sind zu dokumentieren, d.h. über das durchgeführte Case Management ist beiden Kunden – sowohl den KlientInnen als auch den geldgebenden Auftraggebern – Rechenschaft abzulegen. Schließlich ist die Möglichkeit eines emotionalen Abschieds der KlientInnen vom Case Manager professionell zu organisieren. Warum erlaubt Case Management ein effektives und effizientes Arbeiten? Obwohl Soziale Arbeit ein äußerst komplexes, ambivalentes und nur sehr begrenzt planbares bzw. rationalisierbares Geschehen im zwischenmenschlichen Bereich ist („Beziehungsarbeit“) (vgl. Kleve 1999; Kleve 2000), erlaubt das Case Management ein rationalisiertes Vorgehen, das die KlientInnen als ExpertInnen für ihre Probleme und deren Ressourcen sowie als Nutzer lebensweltlicher Netzwerke zu stärken vermag („Empowerment“). Es kann weiterhin die sehr effektiven kurzzeitorientierten Beobachtungs-, Beschreibungs-, Erklärungs- und Interventionsverfahren der systemisch-konstruktivistischen Beratung (siehe etwa PfeiferSchaupp 1995; Schweitzer/Schumacher 1995; Kleve 1996; von Schlippe/Schweitzer 1998) integrieren. Entgegen der klassischen Sozialen Einzelhilfe („social casework“) steigen die SozialarbeiterInnen als Case Manager nicht so sehr in eine professionell-intensive Beziehung mit den KlientInnen ein, sie beschränken zeitlich ihre KlientInnenkontakte und koordinieren, moderieren und managen vielmehr die formellen und informellen Netzwerke. „Das Aufgabenspektrum des Helfers verlagert sich von der psycho-sozialen Beziehungsarbeit zur organisierenden, planenden, koordinierenden und kontrollierenden Abstimmung von Angebot und Nachfrage nach Unterstützung, wobei es primäres Ziel ist, ‚potentiell auf die konkreten Problemlagen passende Hilfen ausfindig zu machen’ (Wendt [...])“ (Galuske 1998, S. 184). Durch diese eher distanzierte Arbeit mit den KlientInnen verringert sich, wie bereits ausgeführt, die Möglichkeit, dass die KlientInnen von den HelferInnen bzw. von der professionellen Hilfe „abhängig“ werden. Vor allem angesichts von sogenannten „Multi-Problem-KlientInnen“ bzw. „-familien“ (z.B. in den Ambulanten Hilfen), die bereits zahlreiche, nicht selten widersprüchlich und sich gegenseitig ‚aushebelnd’ arbeitende Hilfeeinrichtungen um sich ‚gescharrt’ haben, erscheint ein Case Management zur Effektivierung, Koordination und Abstimmung der Hilfen als sehr günstig. Gerade bezüglich solcher „Multi-Problem-Fälle“ kommt es nicht selten „zu kontraproduktiven und die sozialen Dienstleistungen unnötig verteuernden Überschneidungen verschiedenster Unterstützungsangebote“ (Galuske 1998, S. 183). Die Notwendigkeit von Case Management ergibt sich u.a. aus der für Laien zum Teil sehr unübersichtlich wirkenden Differenzierung und Spezialisierung sozialer Dienstleistungen. Diese Differenzierung und 45 Spezialisierung macht eine Kooperation und Koordination der Angebote für die jeweiligen Fälle notwendig. Im Case Management steht die Ressourcen- und Netzwerkanalyse im Mittelpunkt, so dass permanent überlegt wird, wie die klientären Stärken und Fähigkeiten so effektiv wie möglich für die Problemlösung eingesetzt und wie die lebensweltlichen Netzwerke der KlientInnen nach Unterstützungsmöglichkeiten ‚abgesucht’ und von den/für die KlientInnen aktiviert werden können. Die stärkere Aktivierung der klientären Ressourcen und der lebensweltlichen Netzwerke kann langfristig (professionelle) Zeit und Kosten sparen. An Case ManagerInnen werden hohe organisatorisch-professionelle Anforderungen gestellt. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist es, die sozialen Dienstleistungsangebote in ihrem Gemeinwesen sehr gut kennenzulernen, Kontakte zu Professionellen und Laien herzustellen und langfristig tragende Netzwerke zu initiieren und zu pflegen. Literatur: Bullinger, Hermann; Nowak, Jürgen (1998): Soziale Netzwerkarbeit. Eine Einführung. Freiberg/Br.: Lambertus Fritzsche, Brigitte u.a. (1994): Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt ... . Beiträge zur aufsuchenden psychosozialen Arbeit mit Einzelnen & Familien. Tübingen: dgvt-Verlag Galuske, Michael (1998): Methoden Weinheim/München: Juventa der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Kleve, Heiko (1996): Konstruktivismus und Soziale Arbeit: Die konstruktivistische Wirklichkeitsauffassung und ihre Bedeutung für die Sozialarbeit/ Sozialpädagogik und Supervision. Aachen: Kersting-IBS Kleve, Heiko (1999): Postmoderne Sozialarbeit. Ein systemtheoretisch-konstruktivistischer Beitrag zur Sozialarbeitswissenschaft. Aachen: Kersting Kleve, Heiko (2000): Systemtheorie und Ökonomisierung Sozialer Arbeit. Zur Ambivalenz eines sozialarbeiterischen Trends. Berlin, unv. Ms. Löcherbach, Peter (1998): Altes und Neues zum Case-Management – Soziale Unterstützung zwischen persönlicher Hilfe und Dienstleistungsservice, in: Mrochen, Siegfried u.a. (Hrsg.): Standortbestimmung sozialpädagogischer und sozialarbeiterischer Methoden. Weinheim: Deutscher Studienverlag: S. 104-122 Neuffer, Manfred (1993): Case Management, in: Fachlexikon der sozialen Arbeit. Herausgegeben vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt/M.: Eigenverlag: S. 200 Pfeifer-Schaupp, H.-U. (1995): Jenseits der Familientherapie. Systemische Konzepte in der Sozialen Arbeit. Freiburg/Br.: Lambertus Raiff, Norma R.; Shore, Barbara K. (1993): Fortschritte im Case Management. Freiburg/Br.: Lambertus (1997) 46 Schlippe, Arist von; Schweitzer, Jochen (1998): Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht (5. Auflg.) Schweitzer, Jochen; Schumacher, Bernd (1995): Die unendliche und endliche Psychiatrie. Zur (De- ) Konstruktion von Chronizität. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Wendt, Wolf Rainer (1997): Case Management im Sozial- und Gesundheitswesen. Freiburg/Br.: Lambertus Case Management „Hilfe zur Selbsthilfe“ durch verstärkte Aktivierung von informellen, privaten Hilfemöglichkeiten in den Lebenswelten der KlientInnen (im Sinne von Subsidiarität und Empowerment) – einerseits durch Aktivierung von klienteneigenen Ressourcen, andererseits durch Aktivierung von lebensweltlichen, informellen Netzwerken. 2. Kostensenkung durch 1. strikte Rationalisierung und Planung von Hilfeprozessen nach einem Phasenmodell (1. Assessment: Einschätzung und Bedarfsklärung; 2. Zielvereinbarung und Hilfeplanung; 3. Kontrollierte Durchführung; 4. Evaluation; 5. Rechenschaftslegung) 1. Ziele: Verfahren/ Mittel: ökonomische Leitgrößen: intendierte Ergebnisse: Effizienz Effektivität Ergiebigkeit, d.h. Verhältnis von Aufwand (Zeit und Personal, kurz: Kosten) zum Ertrag (Kostengünstigkeit) Verringerung des profes-sionellen Personals durch Aktivierung klienteneigener, informeller Ressourcen und lebensweltlicher Netzwerke Verringerung der profes-sionellen Hilfezeit Verringerung der Kosten Zielwirksamkeit, d.h. Verhältnis von Handlungen und intendierten Erfolgen / Ergebnissen Strikte Selbsthilfeorientierung und damit Verringerung der aus der Autopoiesis Sozialer Arbeit resultierenden Effekte des zentralen Hilfeparadoxons („fürsorgliche Belagerung“; Abhängigkeit vom Hilfe-system). Übersicht 5 47 4. Schritte helfender Kommunikation Schritte helfender Kommunikation 1. Schritt Kontextualisierung Wer berichtet über den „Fall“? Woher kommt der „Fall“? Wer ‚gehört‘ zum „Fall“? (Genogramm der Klientfamilie; Übersicht der beteiligten HelferInnen) Von wem soll er bearbeitet werden? Wer ist zuständig? Welche Interessen und Erwartungen gehen von wem/von welchen Personen (KlientInnen, HelferInnen, Dritten)/von welchen Institutionen mit dem „Fall“ einher? 2. Schritt Problemanalyse und Ressourcenanalyse Was ist das/sind die Problem/e? (genaue/konkrete Beschreibung der Probleme – wenn möglich auch aus den Sichten der jeweiligen Problembeteiligten) 3. Schritt Was sind die Ressourcen der KlientInnen? Modelle/Erklärungen (Hypothesen) über die Problem’ursachen‘ Welche Ursachen könnte das Problem/könnten die Probleme haben? Wie ist das Problem/sind die Probleme sozialarbeiterisch und mithilfe der Bezugswissenschaften Sozialer Arbeit (also soziologisch, psychologisch, ökonomisch, politisch, rechtlich, medizinisch, anthropologisch, ethisch etc.) – hypothetisch – erklärbar? 4. Schritt 5. Schritt Ziele für die Problemlösung Woraufhin soll das Problem/sollen die Probleme gelöst werden? Was sind die Ziele für die Problemlösung/en? Wer hat welche Ziele? Methodische Handlungsplanung zur Problemlösung Wer muss was wann wie womit mit wem tun, um die Ziele/die Problemlösung(en) zu realisieren? 6. Schritt Evaluation und Erfolgskontrolle Welche Ziele/Problemlösungen wurden realisiert und welche nicht? Was könnten die Ursachen/Erklärungen für die Erfolge und Misserfolge sein? Übersicht 6 48 Zirkulärer Ablauf der Schritte helfender Kommunikation 1. Schritt (Falleinschätzung, Kontextualisierung) 2. Schritt (Problem- und Ressourcenanalyse) zirkulärer Zeitpfeil 6. Schritt (Evaluation, Dokumentation, Berichterstattung) 3. Schritt (Hypothesenbildung bezüglich der Problembedingungen) 5. Schritt (Handlungsplanung- und realisierung - Intervention) 4.Schritt (Zieldefinition) Übersicht 7 49 4.1 Ressourcen „In der systemischen Therapie wird als Ressource jedes Potential verstanden, das die Verhaltensoptionen eines Systems erhöht und damit seine Lebens- und Problemlösefähigkeit verbessert. Eine Ressource kann materiell-wirtschaftlicher, sozialer, emotionaler oder intellektueller Natur sein. Die Ressourcenorientierung spielt in bezug auf das Menschenbild und die therapeutische Haltung eine zentrale Rolle. Im Gegensatz zu einer Defizitorientierung betont die Ressourcenorientierung die Verhaltensmöglichkeiten, die einem Klientensystem zur Verfügung stehen“ (Simon/Clement/Stierlin: Die Sprache der Familientherapie. Ein Vokabular. Stuttgart 1999, S. 275). Ressourcen sind alle Fähigkeiten, die durch innere Prozesse eines Einzelnen bzw. Systems entwickelt wurden, um a) Überleben zu sichern; b) kreative Lösungen für Probleme zu finden. Ressourcen sind alles, worauf sich ein Mensch psychisch und sozial oder ein soziales System in seinen Kommunikationen stützen kann, um mit Anforderungen erfolgreich umzugehen. Das sind: Fähigkeiten, Stärken, Erfahrungen, die angeboren sind oder erworben wurden; konkrete oder besondere Erlebnisse (z.B. Erfolge); aktuell funktionierende Quellen von Befriedigung, die die subjektive Befindlichkeit positiv beeinflussen (z.B. Kraft-, Lust- und Sicherheitsquellen); psychische Verarbeitungstechniken wie das Hoffen, das Vergessen, das Erinnern, das Kompensieren oder das Ausgleichen; förderliche systemische Kommunikationsmuster (z.B. Bestätigungen etc.). Ressourcen sind die Basis für Kontakte, Sicherheit, Wachstum und Weiterentwicklung. (Vgl. dazu Arbeitsblatt Ressourcen von Prof. Britta Haye, ASFH Berlin). 50 4.2 Hypothesenbildung Wissenschaftliche Definitionen Hypothese, allgemein: „Hypothese, empirisch gehaltvolle Aussage, die einer Klasse von Einheiten bestimmte Eigenschaften zuschreibt oder gewisse Ereigniszusammenhänge oder -folgen behauptet, d. h. das Vorliegen einer Regelmäßigkeit im untersuchten Bereich konstatiert. Sie gilt stets nur vorläufig und muss so beschaffen sein, daß ihre Überprüfbarkeit durch Beobachtung und Experiment gewährleistet ist. Hypothesen sind die wichtigsten Bestandteile wissenschaftlicher Erklärungen“ (Werner Fuchs u.a., Lexikon zur Soziologie, Opladen 1988, S. 320f.) Prüfung von Hypothesen: „[...] Die Grenzen, innerhalb deren H. als ‘richtig’ unterstellt werden können, beruhen auf Konventionen. Sie sind also wissenschaftliche Vereinbarungen. Die Prüfung der H. zielt [...] nicht auf den Beweis, daß der angenommene Bedeutungszusammenhang richtig ist, sondern darauf, daß er nicht widerlegt werden kann (Falsifikationsprinzip nach Popper). Eine H. hat nur solange Gültigkeit, solange sie nicht widerlegt werden kann. [...]“ (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Fachlexikon der sozialen Arbeit, Frankfurt/Main 1993, S. 481). Heuristische Hypothese: „Hypothese, heuristische, unüberprüfte Vermutung über bestimmte Zusammenhänge, die nur die Funktion hat, zu weiteren Überlegungen anzuregen“ (Werner Fuchs u.a., Lexikon zur Soziologie, Opladen 1988, S. 321). Hypothesen in der Sozialen Arbeit: „[...] Sozialarbeiter arbeiten sowohl in ihrer diagnostisch-begutachtenden als auch in der beratenden und intervenierenden Arbeit ständig mit – meist alltagstheoretisch formulierten – Hypothesen. Im diagnostisch-begutachtenden Bereich formulieren sie Erklärungshypothesen – etwa über die Entstehungsbedingungen devianter Karrieren im JGH-Bereich. In der intervenierenden und beratenden Arbeit formulieren sie explizit oder implizit H. über die wahrscheinlichen Interventionseffekte [...]“ (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Fachlexikon der sozialen Arbeit, Frankfurt/Main 1993, S. 481). 51 Systemisch-konstruktivistische Ausgangsannahmen Wir können niemals die „wahren“ Gründe bzw. Ursachen für ein psycho-soziales Problem ermitteln. Denn psychische und soziale Systeme „funktionieren“ nach komplexen und eigenen, von außen nicht direkt beobachtbaren Regeln. Und jede/r Beobachter/in beobachtet nach ganz spezifischen und eigenen Regeln und Mustern, m.a.W. jede/r Beobachter/in beobachtet anders. Daher lassen sich aus unterschiedlichen sachlichen, sozialen und zeitlichen Dimensionen möglicherweise unendlich viele Gründe bzw. Ursachen für Probleme aufführen. (Anmerkung: Die genannten Dimensionen lassen sich mit folgenden Fragen eingrenzen – Sachdimension: „Anhand welcher theoretischer Vorannahmen und auf der Grundlage welcher Informationen erkläre ich das Problem?“, Sozialdimension: „Wer erklärt das Problem und aus welcher Perspektive?“, Zeitdimension: „Wann erkläre ich das Problem?“.) Erklärungen (also warum etwas so beobachtet werden kann, wie es beobachtet wird) sind kontingent, sie können in Abhängigkeit der sachlichen, sozialen und zeitlichen Dimensionen „so, aber auch anders“ sein. Auch Beschreibungen („Was wird wie beobachtet?) und Bewertungen („Welche Bedeutung hat das, was beobachtet wird?“) sind kontingent. Hypothesenbildung Hypothesen sind zunächst (noch) unüberprüfte Erklärungen über die möglichen Bedingungen, Gründe bzw. Ursachen der jeweils relevanten Probleme. Sie dienen dazu, weitere Überlegungen (vor allem bezüglich der Problemlösung/Handlungsplanung) anzuregen. Hypothesen sollten plausibel und schlüssig sein, d.h. durch sie sollten die bekannten Informationen in sinnvoller Weise zu Erklärungen verknüpft werden. Hypothesen sind im Konjunktiv, d.h. in der Möglichkeitsform zu formulieren. Die Hypothesenbildung arbeitet daher – wie in Anlehnung an den Schriftsteller Robert Musil gesagt werden könnte – mit dem Möglichkeitssinn: „Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muß geschehen; sondern erfindet: Hier könnte, sollte oder müßte geschehen; und wenn man ihm von irgend etwas erklärt, daß es so sei, wie es ist, dann denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein“ (Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Reinbeck bei Hamburg 1978, S. 16). Weiterhin sollte beim Hypothesenbilden folgendes beachtet werden: Hypothesen sollten beziehungsdynamisch sein, d.h. Erklärungen für (als problematisch bewertete) Verhaltensweisen sollten sich auf die Interaktionen beziehen, in deren Kontext die (als problematisch bewerteten) Verhaltensweisen als (Re-)Aktionen bezüglich anderer Verhaltensweisen angesehen werden können; Hypothesen sollten erklären, wie, d.h. aufgrund welcher Annahmen/Modelle, welcher (inadäquater) Problemlösungsversuche, welcher Interaktionen, welcher (relevanter) 52 Ereignisse und welcher sozio-ökonomischer Faktoren Probleme bzw. (als problematisch bewertete) Verhaltensweisen entstehen und aufrecht erhalten werden; Hypothesen sollten erklären, durch welche (internen oder externen) Ereignisse die Veränderungen zustande kamen, die die Probleme bzw. die (als problematisch bewerteten) Verhaltensweisen hervorriefen. WICHTIG: „Es geht nicht darum, die eine ‚richtige’, sondern eine sinnvolle Hypothese zu finden oder, vielleicht besser: zu erfinden. Diese Hypothese sollte dann jederzeit auf Grund neuer Informationen verworfen, modifiziert oder durch eine zutreffendere ersetzt werden können“ (Helm Stierlin, Individuation und Familie, Frankfurt/Main 1989, S. 151). 53 5. Hilfsmittel bei der Fallbearbeitung 5.1 Familiärer Lebenszyklus (nach Prof. Britta Haye, ASFH Berlin) Phase Paarbildung Geburt eines Kindes Zu bewältigende Aufgaben Aufeinander einstellen Klären gegenseitiger Erwartungen Einüben von Verhaltensmustern Ausgleich von Wertvorstellungen Differenzierung zu den Herkunfts-familien (Regeln finden, welche Herkunftsfamilie setzt sich durch?) Erweiterung des 2-er Systems Paarbeziehung muss neu geregelt werden Mutter-Kind-Symbiose muss gelöst werden Einsetzen gruppendynamischer Prozesse Dreiecksbildung (kann stabilisierende und konfliktmildernde Funktion für die Paarbeziehung haben) Einsetzen sozialer Kontrolle durch öffentliche Institutionen Kind lernt andere Beziehungen und Wertvorstellungen kennen (Loyalitätskonflikte) „Leistung“ wird thematisiert Autonomiebestreben des Kindes verstärkt sich und ruft u.U. Verlustängste bei den Eltern hervor Entwicklung geschlechtlicher Identität Infragestellung elterlicher Autorität Hinwendung zu peer-groups Ablösung vom Elternhaus Eltern müssen Kind mehr Autonomie und Verantwortung zugestehen Übergang zum 2-er System Eltern müssen sich wieder als Paar definieren Bewältigung des Verlustes des Kindes Kind baut sich eine Paarbeziehung auf (Symptome können auftreten, weil Autonomiebestrebungen evtl. boykottiert werden; Kind phantasiert: es würde etwas Schlimmes passieren, wenn ich raus gehe) Ende der Berufstätigkeit Suche nach neuem Lebenssinn Geburt von Enkeln Abschied Kind kommt in die Kita/Schule Heranwachsen des Kindes Auszug des Kindes Altersphase Tod Übersicht 8 54 5.2 Hierarchie der menschlichen Bedürfnisse nach Abraham Maslow 7. Sinnvoller Beitrag für die Menschen (Transzendenz) 6. Persönliche Weiterentwicklung (Selbstverwirklichung) Geistige Bedürfnisse Realisieren des eigenen Potentials Wachstum und Lernfortschritt Zunahme der Verantwortung 5. Eigenwert Autonomie vorhandene Kapazitäten zur Geltung kommen lassen Selbstachtung Psychische 4. Prestige, Status Anerkennung durch andere Bedürfnisse 3. Geborgenheit sozialer Kontakt Dazugehörigkeit Akzeptiertsein Geborgenheit in der Gemeinschaft 2. Sicherheit Schutz der Gesundheit Altersvorsorge Vorratshaltung Physische 1. Physische Existenz Nahrung Kleidung Unterkunft Bedürfnisse Übersicht 9 Beachte: Die Entwicklung schreitet nach diesem Modell nicht einfach von Stufe zur Stufe fort, vielmehr schließt jede neue (höhere) Stufe die früheren (unteren) Stufen mit ein. 55 5.3 Biologische, biopsychische und biopsychosoziale menschliche Bedürfnisse nach Werner Obrecht (Vgl. dazu Obrecht: Sozialarbeitswissenschaft als integrative Handlungswissenschaft. Ein metawissenschaftlicher Bezugsrahmen für die Wissenschaft Sozialer Arbeit, in: Merten u.a. (Hrsg.): Sozialarbeitswissenschaft – Kontroversen und Perspektiven. Neuwied/Kriftel/Berlin 1996: S. 144) I. Biologische Bedürfnisse im engeren Sinne 1. nach physischer Integrität, d.h. nach Vermeidung von Verschmutzung, das Wohlbefinden reduzierenden (schmerzhaften) physikalischen Beeinträchtigungen (Hitze, Kälte, Nässe), Verletzungen, sowie der Exposition gegenüber (absichtsvoller) Gewalt; 2. nach den für die Autopoiesis des Lebens erforderlichen Austauschstoffen: a) verdaubarer Biomasse (Stoffwechsel); b) Wasser (Flüssigkeitshaushalt); c) Sauerstoff (Gasaustausch); 3. nach sexueller Aktivität und nach Fortpflanzung; 4. nach Regenerierung; II. Biopsychische Bedürfnisse 5. nach wahrnehmungsgerechter sensorischer Stimulation durch a) Gravitation; b) Schall; c) Licht; d) taktile Reize (sensorische Bedürfnisse); 6. nach schönen Formen in spezifischen Bereichen des Erlebens (Landschaften, Gesichter, unversehrte Körper; ästhetische Bedürfnisse nach ästhetischem Erleben); 7. nach Abwechslung/Stimulation (Bedürfnis nach Abwechslung); 8. nach assimilierbarer orientierungs- & handlungsrelevanter Information: a) nach Information via sensorischer Stimulation (Bedürfnis nach Orientierung); b) nach einem der gewünschten Information angemessenen Code (Bedürfnis nach [epistemischem] ‚Sinn’, d.h. nach dem Verstehen dessen, was in einem und um einen herum vorgeht und mit einem geschieht, insofern man davon Kenntnis hat.). Im Bereich des bewussten Denkens entspricht diesem Bedürfnis das Bedürfnis nach subjektiver Sicherheit/Gewissheit bzw. nach ‚Überzeugung’ in den subjektiv relevanten Fragen; 9. nach subjektiv relevanten (affektiv besetzten) Zielen und Hoffnung auf Erfüllung (Bedürfnis nach subjektivem ‚Sinn’); 10. nach effektiven Fertigkeiten (Skills), Regeln und (sozialen) Normen zur Bewältigung von (wiederkehrenden) Situationen in Abhängigkeit der subjektiv relevanten Ziele (Kontroll- oder Kompetenzbedürfnis); III. Biopsychosoziale Bedürfnisse 11. nach emotionaler Zuwendung (Liebe, Freundschaft, aktiv & passiv) (Liebesbedürfnis); 12. nach spontaner Hilfe (Hilfsbedürfnis); 13. nach sozial(kulturell)er Zugehörigkeit durch Teilnahme im Sinne einer Funktion (Rolle) innerhalb eines sozialen Systems (Inklusion; Integration) (Mitgliedschaft in Familie, Gruppe, Gesellschaft) (Sippe, Stamm, ‚Ethnie’, Region, Nationalstaat) (Mitglied zu sein heißt, Rechte zu haben, weil man Pflichten erfüllt) (Mitgliedschaftsbedürfnis); 14. nach Unverwechselbarkeit (Bedürfnis nach biopsychosozialer Identität); 15. nach Autonomie (Autonomiebedürfnis); 16. nach sozialer Anerkennung (Anerkennungsbedürfnis) 17. nach (Austausch-)Gerechtigkeit (Gerechtigkeitsbedürfnis) Übersicht 10 56 6. Dimensionen der Sozialarbeiterischen Beratung Dimensionen der Sozialarbeiterischen Beratung Auftrag/Funktion der Sozialarbeiterin bzw. des Sozialarbeiters während der BeratungsInteraktion: „Hilf uns, unsere Möglichkeiten/Optionen zu nutzen bzw. zu erweitern“ bzw. „Handle stets so, dass du die Anzahl der Möglichkeiten erweiterst.“ (Heinz von Förster) „Steigere die Alternativität.“ (Peter Fuchs) sozio-ökonomische Dimension psycho-soziale Dimension sach- bzw. informationsorientiert beziehungs- und/oder emotionsorientiert Erweiterung des Wissens Nutzung und/oder Erweiterung der sozialen, emotionalen und kognitiven Kompetenzen professionelle Kompetenzen/Grundlagen: professionelle Kompetenzen/Grundlagen: u.a. u.a. Rechtskompetenz Gesprächsführungskompetenz Verwaltungs-/Management-/ OrganisationsKompetenz Adressatenkompetenz Kontextkompetenz sozialpolitische Kompetenz Konfliktfähigkeit Gemeinwesenkompetenz Selbsterfahrung/Selbstreflexion Übersicht 11 57