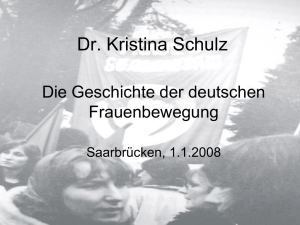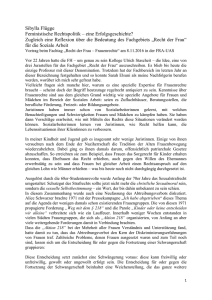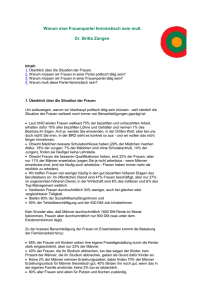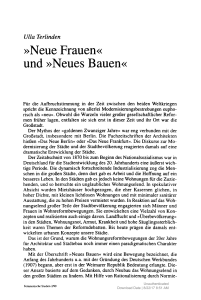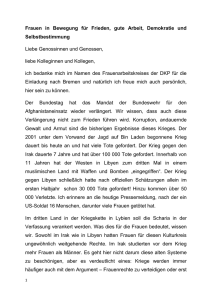Document
Werbung
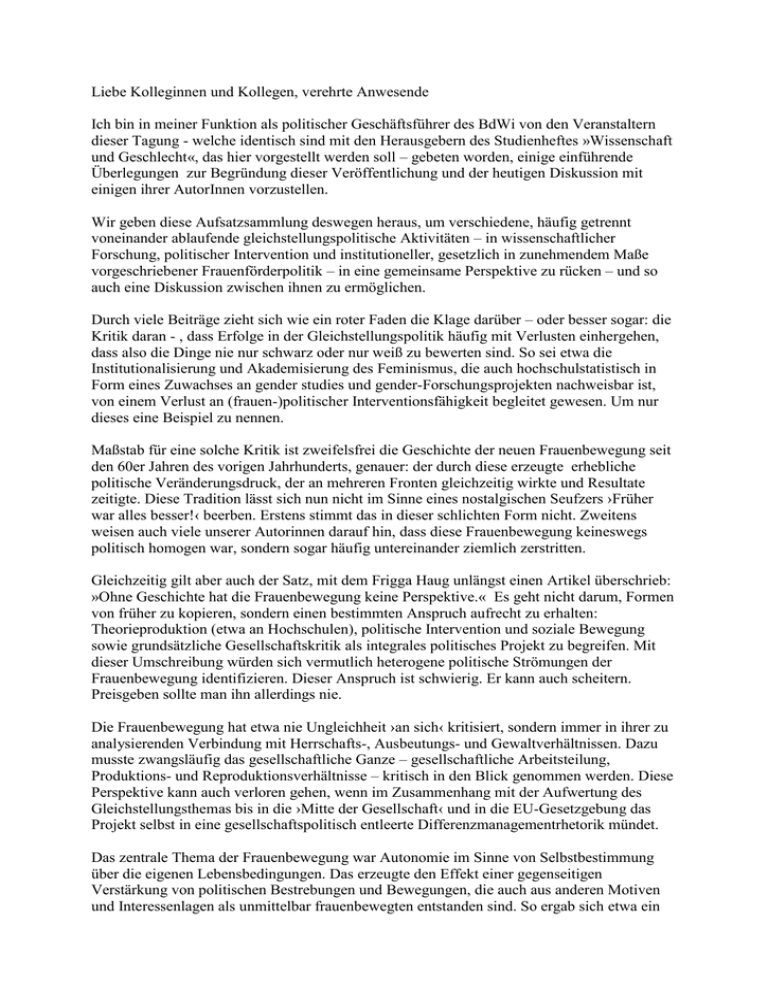
Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Anwesende Ich bin in meiner Funktion als politischer Geschäftsführer des BdWi von den Veranstaltern dieser Tagung - welche identisch sind mit den Herausgebern des Studienheftes »Wissenschaft und Geschlecht«, das hier vorgestellt werden soll – gebeten worden, einige einführende Überlegungen zur Begründung dieser Veröffentlichung und der heutigen Diskussion mit einigen ihrer AutorInnen vorzustellen. Wir geben diese Aufsatzsammlung deswegen heraus, um verschiedene, häufig getrennt voneinander ablaufende gleichstellungspolitische Aktivitäten – in wissenschaftlicher Forschung, politischer Intervention und institutioneller, gesetzlich in zunehmendem Maße vorgeschriebener Frauenförderpolitik – in eine gemeinsame Perspektive zu rücken – und so auch eine Diskussion zwischen ihnen zu ermöglichen. Durch viele Beiträge zieht sich wie ein roter Faden die Klage darüber – oder besser sogar: die Kritik daran - , dass Erfolge in der Gleichstellungspolitik häufig mit Verlusten einhergehen, dass also die Dinge nie nur schwarz oder nur weiß zu bewerten sind. So sei etwa die Institutionalisierung und Akademisierung des Feminismus, die auch hochschulstatistisch in Form eines Zuwachses an gender studies und gender-Forschungsprojekten nachweisbar ist, von einem Verlust an (frauen-)politischer Interventionsfähigkeit begleitet gewesen. Um nur dieses eine Beispiel zu nennen. Maßstab für eine solche Kritik ist zweifelsfrei die Geschichte der neuen Frauenbewegung seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, genauer: der durch diese erzeugte erhebliche politische Veränderungsdruck, der an mehreren Fronten gleichzeitig wirkte und Resultate zeitigte. Diese Tradition lässt sich nun nicht im Sinne eines nostalgischen Seufzers ›Früher war alles besser!‹ beerben. Erstens stimmt das in dieser schlichten Form nicht. Zweitens weisen auch viele unserer Autorinnen darauf hin, dass diese Frauenbewegung keineswegs politisch homogen war, sondern sogar häufig untereinander ziemlich zerstritten. Gleichzeitig gilt aber auch der Satz, mit dem Frigga Haug unlängst einen Artikel überschrieb: »Ohne Geschichte hat die Frauenbewegung keine Perspektive.« Es geht nicht darum, Formen von früher zu kopieren, sondern einen bestimmten Anspruch aufrecht zu erhalten: Theorieproduktion (etwa an Hochschulen), politische Intervention und soziale Bewegung sowie grundsätzliche Gesellschaftskritik als integrales politisches Projekt zu begreifen. Mit dieser Umschreibung würden sich vermutlich heterogene politische Strömungen der Frauenbewegung identifizieren. Dieser Anspruch ist schwierig. Er kann auch scheitern. Preisgeben sollte man ihn allerdings nie. Die Frauenbewegung hat etwa nie Ungleichheit ›an sich‹ kritisiert, sondern immer in ihrer zu analysierenden Verbindung mit Herrschafts-, Ausbeutungs- und Gewaltverhältnissen. Dazu musste zwangsläufig das gesellschaftliche Ganze – gesellschaftliche Arbeitsteilung, Produktions- und Reproduktionsverhältnisse – kritisch in den Blick genommen werden. Diese Perspektive kann auch verloren gehen, wenn im Zusammenhang mit der Aufwertung des Gleichstellungsthemas bis in die ›Mitte der Gesellschaft‹ und in die EU-Gesetzgebung das Projekt selbst in eine gesellschaftspolitisch entleerte Differenzmanagementrhetorik mündet. Das zentrale Thema der Frauenbewegung war Autonomie im Sinne von Selbstbestimmung über die eigenen Lebensbedingungen. Das erzeugte den Effekt einer gegenseitigen Verstärkung von politischen Bestrebungen und Bewegungen, die auch aus anderen Motiven und Interessenlagen als unmittelbar frauenbewegten entstanden sind. So ergab sich etwa ein Zusammenwirken mit politischen Interventionen zur Demokratisierung der Hochschulen – Demokratie als zwingende Form von Selbstbestimmung – seit den 60er Jahren. Wenn heutzutage Gleichstellung in Form von Gender Mainstreaming, Gender Budgeting oder Diversity Management auftritt, und zwar als ein Handlungsansatz, der ausdrücklich auf der Ebene der Hochschuladministration im Sinne eines Top-down-Managements angesiedelt ist, kann dieser radikaldemokratische Impuls auch verloren gehen. Ich sage ausdrücklich »kann«, nicht »muss«. Wir werfen schließlich auch die Frage auf – und wollen diese mit der Präsentation unserer Veröffentlichung stärker und fundierter diskutieren - ,wie diese ›offizielle‹ Anerkennung des Gleichstellungsthemas möglicherweise radikalisiert und politisiert werden kann. Diese Anerkennung und auch zunehmende gesetzlich-politische Regelung eines Gleichstellungsauftrags ist ambivalent zu bewerten. Sie ist einerseits eine Wirkung des unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen Drucks organisierter Frauen, auch des durch die Frauenbewegung insgesamt und langfristig veränderten gesellschaftlichen und kulturellen Klimas. Der Kapitalismus hat es seit je verstanden, Impulse und Forderungen sozialer Bewegungen in seine eigene ›Modernisierung‹ zu integrieren – und damit zugleich oppositionelle Milieus zumindest in Teilen sich zu kooptieren. Damit ist die offizielle Aufwertung von Gleichstellung aber eben nicht nur Reaktion auf politischen Druck, sondern gleichzeitig ein eigenständiges Herrschaftsprojekt. Dieses ist zutiefst interessenpolitisch – ergo: materialistisch – fundiert und allein deswegen nicht nur eine bloße Show oder ideologisches Manöver. Der ganzen Unternehmung liegt ein humankapitaltheoretischer Ansatz zugrunde, keine Ressourcen ungefördert oder ungenutzt liegen zu lassen, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken könnten. Wir bewegen uns hier natürlich im Hochqualifikationsbereich. Für mich ist dieser Ansatz auch der tiefere polit-ökonomische Kern der ›Exzellenzinitiative‹ als ein hochschulbezogenes Elitenförderprogramm - mit einer stärkeren gleichstellungspolitischen Komponente als sie frühere solcher Sonderprogramme hatten. Diese Hochqualifikationspolitik sollte uns aber nicht blind machen gegenüber einer Tatsache, die sich am entgegengesetzten Ende der sozialen Skala abspielt. Die Integration einer weitaus höheren Zahl von Frauen ins Erwerbsleben erfolgt über Teilzeitarbeit, Minijobs, prekäre Beschäftigungsverhältnisse generell. Gleichzeitig werden gesellschaftliche Aufgaben, die der Abbau des Sozialstaates unbearbeitet hinterlässt, in den privaten Bereich zurückverlagert bzw. entsorgt – und stärken dort möglicherweise eine traditionelle geschlechtshierarchische Arbeitsteilung. Das umreißt auch die Spannweite unserer notwendigen Debatte. Wir sollten den Anspruch haben, Elitenprogramme, Niedriglohnsektor und Hartz IV nicht als zufällig nebeneinander existierende Phänomene, sondern als integrale Erscheinungsformen ein und desselben neoliberalen Gesellschaftsprojektes zu begreifen und zu analysieren zu versuchen. Das ist auch der Anspruch, der sowohl an kritische Wissenschaft wie auch an die gesellschaftliche Verantwortung der Hochschulen gestellt werden muss. In diesem Sinne freue ich mich auf die Diskussion.