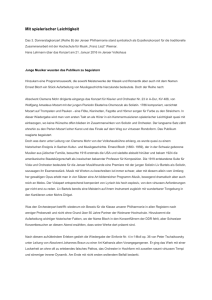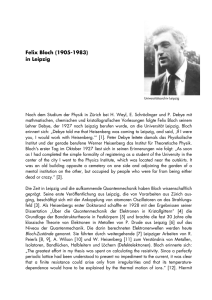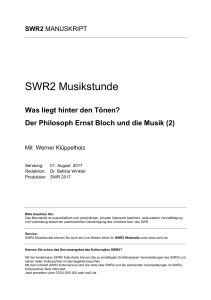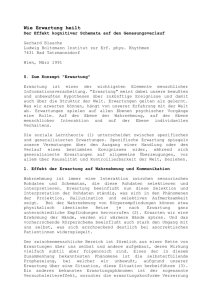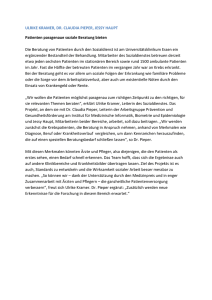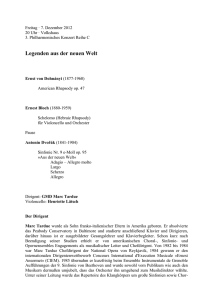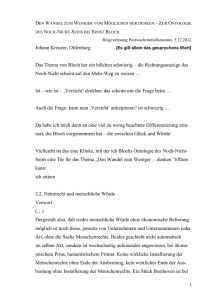Friedrich W
Werbung
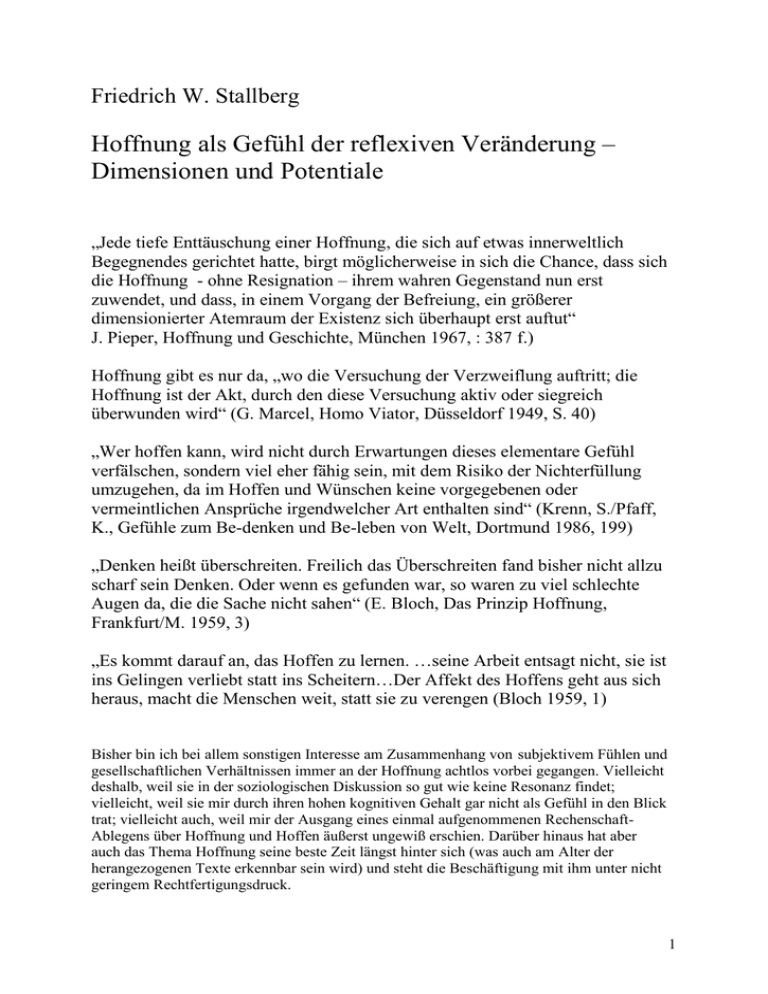
Friedrich W. Stallberg Hoffnung als Gefühl der reflexiven Veränderung – Dimensionen und Potentiale „Jede tiefe Enttäuschung einer Hoffnung, die sich auf etwas innerweltlich Begegnendes gerichtet hatte, birgt möglicherweise in sich die Chance, dass sich die Hoffnung - ohne Resignation – ihrem wahren Gegenstand nun erst zuwendet, und dass, in einem Vorgang der Befreiung, ein größerer dimensionierter Atemraum der Existenz sich überhaupt erst auftut“ J. Pieper, Hoffnung und Geschichte, München 1967, : 387 f.) Hoffnung gibt es nur da, „wo die Versuchung der Verzweiflung auftritt; die Hoffnung ist der Akt, durch den diese Versuchung aktiv oder siegreich überwunden wird“ (G. Marcel, Homo Viator, Düsseldorf 1949, S. 40) „Wer hoffen kann, wird nicht durch Erwartungen dieses elementare Gefühl verfälschen, sondern viel eher fähig sein, mit dem Risiko der Nichterfüllung umzugehen, da im Hoffen und Wünschen keine vorgegebenen oder vermeintlichen Ansprüche irgendwelcher Art enthalten sind“ (Krenn, S./Pfaff, K., Gefühle zum Be-denken und Be-leben von Welt, Dortmund 1986, 199) „Denken heißt überschreiten. Freilich das Überschreiten fand bisher nicht allzu scharf sein Denken. Oder wenn es gefunden war, so waren zu viel schlechte Augen da, die die Sache nicht sahen“ (E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt/M. 1959, 3) „Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. …seine Arbeit entsagt nicht, sie ist ins Gelingen verliebt statt ins Scheitern…Der Affekt des Hoffens geht aus sich heraus, macht die Menschen weit, statt sie zu verengen (Bloch 1959, 1) Bisher bin ich bei allem sonstigen Interesse am Zusammenhang von subjektivem Fühlen und gesellschaftlichen Verhältnissen immer an der Hoffnung achtlos vorbei gegangen. Vielleicht deshalb, weil sie in der soziologischen Diskussion so gut wie keine Resonanz findet; vielleicht, weil sie mir durch ihren hohen kognitiven Gehalt gar nicht als Gefühl in den Blick trat; vielleicht auch, weil mir der Ausgang eines einmal aufgenommenen RechenschaftAblegens über Hoffnung und Hoffen äußerst ungewiß erschien. Darüber hinaus hat aber auch das Thema Hoffnung seine beste Zeit längst hinter sich (was auch am Alter der herangezogenen Texte erkennbar sein wird) und steht die Beschäftigung mit ihm unter nicht geringem Rechtfertigungsdruck. 1 Nun ergibt sich aber die Gelegenheit, etwas Neues zu probieren. Greifen wir also eine übrigens auch von Stefanie Krenn und Konrad Pfaff vor über zwei Jahrzehnten angeregte Sicht weise auf und sprechen wir hier also über die Hoffnung als Emotion. An ihr lässt sich zeigen, was an Veränderung durch Reflexion möglich wäre, hätten wir nur den Mut und die äußeren Bedingungen und Berechtigungen, die etablierten Grenzen des Erwartens, Wünschens und Sehnens zu überschreiten. Ich bemühe mich im folgenden zunächst um eine Bestimmung. Hilfreich sind dabei emotionsund medizinpsychologische Begriffszugänge, weit mehr noch läst sich aber von philosophischen Grundlegungen profitieren. Die unterschiedlichen Ansätze zum Verständnis der Hoffnung im Kontext von Wünschen, Erwartung, Sehnsucht, Glaube, Angst, Liebe und Verzweiflung werden dann im Sinne einer „anspruchsvollen“, gesellschaftsbezogenen Perspektive akzentuiert. Es liegt mir in der Anknüpfung an die Positionen vor allem von Ernst Bloch ,Erich Fromm und Josef Pieper – wie man weiß, ganz unterschiedlicher, aber eben doch dem Grundsätzlichen verpflichteter Theoretiker der Hoffnung – an einem kritischen Begriff der Hoffnung, welcher vom alltäglichen und negativen Hoffen Distanz hält, reflexive Veränderung und verändernde Reflexion in den Vordergrund rückt. Diese mitunter als fundamental oder wahr etikettierte Hoffnung scheint in ihren diversen Äußerungsformen gegenwärtig einem dramatischen Wandel zu unterliegen. Mein Eindruck ist, dass sich die Hoffnung zunehmend aus dem gesellschaftlichen Raum zurückgezogen hatinsbesondere auch dem unablässig fließenden Angstdiskurs Platz gemacht hat, ihr Veränderungspotential einbüßt, jedenfalls nicht mehr dringlich, sehnsüchtig, in Frage stellend ausgedrückt wird. (gerade stoße ich auf eine unterstützende Aussage in dem neuen Erfolgsbuch von Sloterdijk, Du musst dein Leben ändern. „Es fehlt nicht mehr viel, und die letzten Hoffnungsheger aufklärerischen Stils ziehen sich aufs Land zurück, als wären sie die Amish der Postmoderne“,11) Warum das so ist, warum Erwartungen auf die Realisierung des ganz anderen weder verbreitet noch legitim sind, bleibt wenigstens ansatzweise zu überlegen. Warum also hat unser Hoffen das Unangepaßte, Grenzüberschreitende, Riskante und Radikale zugunsten des gesellschaftlich anerkannten, ja geforderten Bewahrens einer positiven Bewertung zukünftigen Lebens und Sterbens verloren? I. Grundlegung 1. Hoffnung als Forschungskategorie Emotionswissenschaftlich wird Hoffnung in Form einer genauen Analyse ihrer Grundzüge nur selten bearbeitet. Das hat sicher mit der eben nur schwachen emotionalen Ausprägung und dem Fehlen einer unverwechselbaren Identität mit dem Überwiegen von Bewertungsprozessen einerseits, Handlungsmotivation andererseits zu tun. Wenn nun Hoffnung zu bestimmen versucht wird, dient dies meist – mit entsprechenden Folgen – dem Interesse an ihrer Operationalisierung, speziell für die Erstellung von Messinstrumenten, von denen es schon zahlreiche gibt. In Deutschland hat wohl als erster D. Ulich (1984) einen Eingrenzungsvorschlag entwickelt. Er formuliert „Wenn jemand hofft, dann drückt er damit aus, 1.) dass er etwas für sich Bedeutsames dringend wünscht , 2.) dass er sich nicht sicher ist, ob er es erreichen wird, und 2 3.) dass es nicht allein oder überhaupt nicht in seiner Hand liegt, dies herbeizuführen „ (1984, 37). Ulich grenzt Hoffnung deutlich von der Erwartung ab: sie enthält mehr Wunsch- als Gewißheitselemente, in der Erwartung ist das Gegenteil der Fall. Hoffnung weist eine emotionale Komponente – das Empfinden von Mut, Zuversicht, Vertrauen -, eine kognitive Komponente im Sinne einer positiven Zukunftsbezogenheit sowie eine motivationale Dimension im Sinne des Sich-Behaupten- und Nicht-Aufgeben-Wollens auf .Jahre später in einem mit Mayring verfassten Lehrbuch (1992, 145) wird Hoffnung zusätzlich in eine enge Verbindung mit Situationen der Beeinträchtigung und Gefährdung zentraler Ziele und Lebensbezüge gebracht. 2002 haben sich die deutschen Psychologen Hammelstein und Roth in Auseinandersetzung mit diversen einschlägigen Ansätzen um die Erarbeitung eines bewertungstheoretischen Hoffnungskonzepts bemüht. Sie kritisieren an den vorliegenden Positionen vor allem, dass diese Hoffnung weniger als kurzzeitigen emotionalen Zustand denn als Persönlichkeitsmerkmal beschrieben haben. Sie selbst fassen nun Hoffnung als Erwartungsemotion. Definiert wird diese „als die Erwartung, dass ein prinzipiell mögliches, subjektiv positiv bewertetes Ereignis, dass durch personale und/oder situative Faktoren beeinflusst wird, in der Zukunft eintritt“ (2002, 196). Die Stärke bzw. das Auftreten individueller Hoffnungsgefühle wird als abhängig von der subjektiven Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit gesehen. Gemeint ist damit, dass eine Person zunächst einschätzt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Ereignis eintritt (subjektive Eintrittswahrscheinlichkeit) und in einem zweiten Schritt dann die Wahrscheinlichkeit prüft, mit welcher sie zu den in ähnlichen Situationen Befindlichen gehört, für welche sich das Gewünschte einstellen wird. Ist die subjektive Eintrittswahrscheinlichkeit eher gering, muss relativ viel kognitive Arbeit geleistet werden, um ein hohes Hoffnungsniveau zu erreichen. Diese Hoffnungsarbeit besteht vor allem darin, positive Aspekte der Situation zu betonen, negative hingegen zu vernachlässigen. Schauen wir noch auf die von Hammelstein und Roth angenommene Beziehung zwischen Hoffnung und Wunsch: Hoffnungsobjekte gelten als konkret und auch vom individuellen Engagement abhängig, Wunschobjekte als eher unbestimmt und dem Einfluß des Wünschenden weithin entzogen. Für die empirische Beschreibung von Hoffnung einschlägig sind auf jeden Fall noch die von Averill u.a. (1990) ermittelten Regeln der Hoffnung. Diese bestehen aus Vorsichtsregeln – das Erhoffte sollte sich in Nähe zur aktuellen eigenen Realität befinden -. moralischen Regeln – Hoffnungsobjekte sollten gesellschaftlichen Normen nicht widersprechen -, Prioritätsregeln – das Erhoffte sollte von erheblicher subjektiver Bedeutung sein – und Handlungsregeln – zur Realisierung des Erhofften sollten auch dazu geeignete Anstrengungen unternommen werden. In den Kontext forschungsorientierter Überlegungen zum Hoffnungskonzept alles letztes einordnen lässt sich ein von Brodda 2006 vorgelegtes Prozeßmodell der Hoffnung. In diesem wird, wie sonst an keiner Stelle, dem mit dem Hoffen verbundenen Kognitionsvorgang einige Aufmerksamkeit zuteil. Interesse verdienen zunächst einige andere Annahmen: Alles Hoffen geht auf Wünsche zurück; deren Dringlichkeit wie auch das jeweilige Vorhandensein spezieller Hoffnungsmotivationen bestimmt die individuelle Hoffnungsstärke. Hoffnung findet immer intrapersonal statt („Ein jeder kann für einen anderen Menschen hoffen, aber nicht an Stelle des anderen“, 2006, 31) und weist nur relativ wenig Interaktivität auf, was sie auch soziologisch zu einem nur sekundären Gefühl macht. Hoffung ist physisch kaum repräsentiert, lässt sich auch nicht mit einer speziellen gestischen oder mimischen Aktivität verbinden. Gerichtet ist sie auf Objekte meist zukünftiger Art im Sinne aller wünschbaren Ereignisse. Sie entwickelt sich nur langsam, besitzt dafür aber relativ viel Beständigkeit. Hoffnung verschwindet, wenn das jeweils Intendierte tatsächlich eintritt oder durch den 3 Wandel zur Enttäuschung, wenn sie durch den Gang der Ereignisse nicht mehr berechtigt erscheint. Das Kognitive im Prozeß der Hoffnungsbildung beschreibt Brodda nun über seine Funktionen. Diese bestehen darin, 1) ein inneres Ereignismodell für das hypothetische Hoffnungsobjekt und seinen zeitlichen Verlauf zu schaffen, 2) das Objekt als geeigneten Gegenstand des Hoffens zu verifizieren, d.h. Ähnlichkeiten zwischen ihm und erwünschten Geschehnissen zu bestimmen und 3) die Eintretenswahrscheinlichkeit des externen Ereignisses zu bestimmen. Diese Modellbildung vollzieht sich als Auswahl sog. präsumtiver Hoffnungsobjekte und arbeitet vor allem mit dem Abrufen von Gedächtnisinhalten „über frühere Erfahrungen mit ähnlichen Ereignissen, über Bedeutungsbelegungen von Ereigniseigenschaften sowie über Zweck-, Sinn- und Zieleinordnungen für das Ereignis“ (25). Es geht also um höchst komplexe individuelle Reflexionsprozesse. Um es in einer mir näherliegenden Art auszudrücken: Warum und wie entscheiden wir uns durch Informationssammlung, Abwägen, Prüfen, Vergleichen, In-Frage-Stellen dafür, gerade dieses, nicht aber jenes zu hoffen und woran merken wir, ob das Erhoffte tatsächlich in vollem Umfang geschehen ist. 2. Hoffnung gesehen von Verena Kast Nachdem bis hierhin Hoffnung als Forschungsmittel vorgestellt wurde, können wir uns nun, wie ich glaube, interessanteren, gehaltvolleren und existentielleren, wenngleich immer auch wissenschaftlich motivierten Problemzugängen zuwenden. Beginnen wir mit den Einsichten von Verena Kast. Dass diese schriftstellerisch so ungemein produktive Züricher Tiefenpsychologin irgendwann auch auf das Thema Hoffnung gestoßen ist, kann nicht weiter überraschen. Sie handelt Hoffnung knapp und anschaulich im Rahmen einer Darstellung von Wesen und Funktionen gehobener Gefühle ab (Kast 1991). Definiert wird diese als „die gehobene Emotion in bezug auf die Zukunft“ (157). Sie steht mit anderen guten Gefühlen in Wechselwirkung, ist einerseits Basis für das Auftreten von Freude, Ekstase und Inspiration, wird andererseits von diesen auch wieder unterstützt. Was kennzeichnet nun die Hoffnung für Kast im einzelnen? Sie ist 1) eine besonders nützliche Emotion, die dem Individuum Halt und Trost gibt, Vertrauen und Geborgenheit zu vermitteln vermag, Angst reduziert. Sie stellt sich 2) als unbestimmtes und leises Gefühl dar, erkennbar eher durch ihre Abwesenheit als die Präsenz. Für mich selbst sind Kasts, von Ernst Bloch angeregte Einsichten in das Wandlungspotential der Hoffnung das Wichtigste. Hoffnung besitzt ihr zufolge eine transzendierende Funktion, zielt auf das Unverhoffte und Unmögliche, bekämpft das Gewohnte, entsteht und bleibt auch wider besserem Wissen und aller Vernunft. Hoffnung will die Veränderung zumindest der eigenen Verhältnisse. „Man wendet sich sozusagen einem Licht zu, das noch nicht sichtbar ist, von dem man aber den Eindruck hat, es müsse existieren „(158). Hoffnung ist also von ihrem Kern her immer auf Wandlung hin angelegt. Festhaltenswert bleiben noch die Überlegungen der Autorin zum Verhältnis von Hoffnung, Erwartung und Sehnsucht, denen es freilich an Konsistenz mangelt. Erwartung scheint ihr das allgemeinere (und sonderbarerweise auch emotional bestimmt) zu sein, in der es immer auch Hoffen und Sehnsucht gibt. Erwartung und Hoffnung, von Wunsch ist nicht die Rede, unterscheiden sich nun insofern, als die erste inhaltsbezogen, die zweite unspezifisch und dann geduldiger ist. In der Hoffnung bewegen sich, so die Aussage, die Dinge auf den Menschen zu; ihre Besonderheit ist die große Offenheit. Für Kast ist sie der weitaus wertvollere mentale Zustand. Ein Grundanliegen von Therapie besteht demnach darin. Erwartung durch Hoffnung zu ersetzen. 4 3. Grundzüge der Hoffnung im Werk Josef Piepers Mit dem Hoffnungskonzept von Pieper, das seit den 1930er Jahren in wiederholten Anläufen entwickelt wurde, betreten wir nun das auch nur wenig bestellte Gebiet der Philosophie der Hoffnung. Pieper lehrt eine konventionell christliche Philosophie in der Tradition der Scholastik und wäre mir wohl keine Lektüre wert gewesen, gäbe es nicht bei ihm Interessantes über Hoffnung zu erfahren. Hoffnung wird von Pieper in alltägliche Hoffnungen (espoir), vermutlich also Gefühlszustände, und die fundamentale Hoffnung (esperance) unterschieden. Im Verständnis der letzteren bezieht der Autor offenbar wechselnde Haltungen: ist es etwas, was sich im Lebensvollzug erwerben lässt oder geht es eher um eine theologische Tugend, also ein empfangenes Geschenk. Die „natürliche“ Hoffnung wird nun mit einigen zentralen Merkmalen beschrieben (Schumacher 2000,69ff.) Sie setzt, um mehr als ein Wunsch zu sein, voraus, dass ihr Objekt mit einem Minimum an Gewissheit und Zuversicht in den Besitz des Hoffenden gelangt. Das Erhoffte muss 2) für das jeweilige Subjekt gut und begehrenswert sein. Es wird 3) nichts erhofft, was ohne Anstrengung oder durch einen bloßen Willensakt erlangt werden kann. Das Objekt muss, in den Worten Piepers, steil sein. Es muss auch 4) nicht unbedingt zur Wirklichkeit werden. Das Erhoffte zu erreichen, liegt des weiteren 5) nicht in der Macht des hoffenden Subjekts. Man hofft nichts, was man selbst machen kann. Mit jeder Hoffnung verbindet sich etwas Unverfügbares. Hoffnung besteht schließlich 6) in einer Erwartung, welche sich stets auf etwas für das Subjekt Gutes richtet. Piepers Interpret Bernard N. Schumacher (2000) hat, unzufrieden mit dieser knappen Merkmalsbestimmung, noch einiges ergänzt. Hoffnung wird nun zusätzlich als intentionaler, auf ein zuvor wahrgenommenes und bewertetes Objekt gerichteter Akt betrachtet. Dieser Akt „ist die Folge einer Antwort auf ein Objekt oder eine bestimmte Situation“ (2000, 70). Hoffnung wird darüber hinaus mit individuellen Wünschen verbunden. Sie entsteht aus deren Aktualisierung, ist aber insofern nicht mit diesen identisch, als sie einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Realisierung des Erhofften bedarf, Wünsche aber vielfach nicht erfüllt werden können oder auch zu einfach umzusetzen sind. Differenziert wird ferner das Verhältnis von Hoffnung und Erwartung. Während Hoffnung das gute und steile Objekt benötigt, sind Erwartungen an keine qualitativen Voraussetzungen gebunden und bestätigen sie sich vielfach mit einem hohen Sicherheitsgrad; während Hoffen durch Entspanntheit und Flexibilität gekennzeichnet ist, vollzieht sich Erwarten mit einer starken inneren Aktivität. Eine letzte Erweiterung besteht in der Annahme einer minimalen Geöffnetheit des hoffenden Subjekts. „Dieser muß fähig sein, das erhoffte Objekt, das es aus eigener Kraft errungen oder durch die Hilfe eines anderen erreicht hat, auch zu empfangen. Wer nicht mehr verfügbar ist, hat aufgehört zu hoffen“ (83). 4. Die gesellschaftliche Relevanz der Hoffnung bei Erich Fromm Mit den beiden letzten Autoren in Sachen Hoffnung wenden wir uns nun gesellschaftskritischen Positionen zu, die über das Potential des subjektiven und auch kollektiven Hoffens umfassende Veränderungen entwerfen und propagieren. Erich Fromm zeichnet in seiner 1968 erschienenen Studie „Die Revolution der Hoffnung“ das Bild einer enthumanisierten technikhörigen Gesellschaft und formuliert ein radikales, wenngleich heute nicht mehr sonderlich innovativ erscheinendes Veränderungsprogramm, welches Hoffen wieder möglich machen soll. Hoffnung ist für ihn als Erkenntnisgegenstand so bedeutsam, 5 weil sie ihm als entscheidender Teil jedes Vorhabens gilt, „unser Sozialsystem zu verändern und lebendiger, bewusster und vernünftiger zu machen“ (18). Sein Begriff von Hoffnung bewegt sich freilich auf einem hohen Anspruchsniveau. Erwartungen haben sich dann weit vom Hoffen entfernt, wenn sie sich durch Passivität und Warten auszeichnen, nur , so Fromm, die Hoffnungslosigkeit verbrämen oder die Zukunft verehren. Das ist dann nur entfremdete Hoffnung. Echte Hoffnung dagegen wird als paradox verstanden, indem sie weder passiv wartet noch Unerreichbares erzwingen will. „Hoffen heißt, in jedem Augenblick für das bereit zu sein, was noch nicht geboren ist – und trotzdem nicht zu verzweifeln, wenn es in unserer Lebensspanne zu gar keiner Geburt kommt“ (20). Hoffnung soll also nicht dem gelten, was schon existiert oder niemals existieren wird. Eine wichtige analytische Unterscheidung trifft Fromm, indem er bewusste von unbewußter Hoffnung abgrenzt. Die letztere, nur aus individuellen Charakterstrukturen zu erschließen, d.h. nicht in Worten und Verhalten aufgehend, ist ihm die eigentlich wichtige; ihrer Verborgenheit wegen lässt sich aber nur wenig über sie herausfinden. Thesenartig ausgeführt wird aber folgendes: Hoffen begleitet alles menschliche Leben, vollzieht sich noch in den einfachsten, ständig wiederkehrenden Aktivitäten und Bewußtseinsprozessen („Hoffen wir nicht zu einem neuen Tag zu erwachen, wenn wir abends einschlafen? Hofft der Kranke nicht gesund, der Gefangene nicht frei, der Hungrige nicht satt zu werden?“ 24). Hoffen ist ferner ein Seinszustand , „eine innere Bereitschaft, ein intensives, aber noch nicht verausgabtes Aktivsein“ (23), ist auf den Glauben im Sinne des Überzeugtseins von noch nicht Erwiesenem und des Erkennens realer Möglichkeiten angewiesen und hält diesen andererseits aufrecht. Beide – Glaube und Hoffnung – benötigen nun als Erfolgsbedingung etwas, was Fromm Seelenstärke nennt. Er meint damit die Fähigkeit, solche Kompromisse zurückzuweisen, die Hoffnung und Glauben zerstören würden, da „Nein zu sagen, wo die Welt Ja erwartet“ (26). Seelenstärke bezeichnet eine bestimmte Art von Furchtlosigkeit; sie setzt voraus, in sich selbst zu ruhen und das Leben zu lieben. Hoffnung wie auch Glaube drängen von Natur aus zur Überwindung des status quo, sind Kräfte des persönlichen und gesellschaftlichen Wandels – Fromm verwendet für sie das Bild der Auferstehung, jetzt interpretiert als Verwandlung hin auf größere Lebendigkeit. Subjektive Hoffnung ist für Fromm immer auch durch die soziale Verankerung, d.h. die Zukunftserwartungen der Gruppe und Klasse, welcher jemand angehört, bestimmt. Die so beschriebene Hoffnung, das ist nun seine Zeitdiagnose, hat sich in der westlichen Welt auf dem Hintergrund von Bürokratisierung und individueller Machtlosigkeit zunehmend aufgelöst und zu Hoffnungslosigkeit transformiert. Die zunichte gemachte Hoffung zeigt sich freilich nun unter der Oberfläche von Anpassung und resignativem Optimismus sowie indirekt als Gewalttätigkeit, Destruktivität, Isolation, Unberührbarkeit, Langeweile und Unfähigkeit zum Widerstand. 5. Hoffnung als revolutionäre Kraft: der Ansatz von Ernst Bloch Den wohl ideenreichsten und kraftvollsten Beitrag zum Verständnis von Hoffnung hat Ernst Bloch mit seinem in den 1940er Jahren während der Emigration in Nordamerika verfassten „Prinzip Hoffnung“ geliefert. Heute wird seine Position allerdings durchweg distanziert oder gar abwertend betrachtet. Dafür gibt es zwei mehr oder minder wirksame Gründe: der erste, Bloch argumentiert in der weithin abgewerteten Erkenntnistradition von Marx und schreibt eine dialektisch- materialistische Philosophie der Weltveränderung; der zweite, Bloch erarbeitet seinem Anspruch nach eine Enzyklopädie der Hoffnung, setzt aber nicht die nötigen Organisationsmittel ein, um zwischen den vielen aufgesuchten Schauplätzen Verbindung zu stiften und das ungemein vielfältige Material zusammenzuhalten. So entsteht leicht Verwirrung und Überforderung. 6 Blochs Einsichten in das Veränderungspotential des Hoffens bleiben aber bewundernswert und sollen hier auch in einigen Ansätzen gewürdigt werden. Die Bedeutung der Hoffnung kann Bloch zufolge gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie markiert einen Grundzug des menschlichen Bewusstseins, ist darüber hinaus die menschlichste aller inneren Bewegungen, entwickelt schließlich den Reichtum der menschlichen Natur. Allerdings mag sie in Gesellschaften des Niedergangs, Gesellschaften der Angst und Entfremdung nahezu verschwunden und in die Latenz abgedrängt sein. Vom Wesen her ist sie also ein Hintergrundgefühl; sie ist schon da, bevor sie weiß, worauf sie hofft (1959, 78). Gefühlstheoretisch eingeordnet wird die Hoffnung als positiver Erwartungsaffekt des Selbsterhaltungstriebs, als Richtungsakt kognitiver Art. Bloch trennt nicht, wie dies heute üblich geworden ist, zwischen Hoffen, Sehnen und Wünschen, nennt sie zusammen die einzig ehrlichen Empfindungen. Hoffnung ist aber ihrer Intensität wegen immer auch Sehnsuchtsaffekt, aktiv, kämpferisch, schmerzhaft. Hoffnung, welche ihren Namen verdient, zeigt sich als „wissend-konkrete“ Hoffnung. Deutlich abgegrenzt wird sie von als schwindelhaft bezeichneter Hoffnung als weit verbreiteter Beschwichtigungs- und Täuschungsinstanz. Angst als negative Erwartung vermag sich unter bestimmten Bedingungen vor das Hoffen zu stellen und die Entfaltung ihrer Inhalte und Funktionen zu blockieren. Letztlich verfügt aber Hoffnung, wie Bloch sie sieht, über das weitaus stärkere Wirkungspotential. Sie ist mit ihrem kämpferischen Tätigsein „über dem Fürchten gelegen, ist weder passiv wie dieses, noch gar in ein Nichts gesperrt“ (1) eine Emotion des Tages und nicht der Nacht. Diese „Arbeit gegen die Lebensangst und die Umtriebe der Furcht ist die gegen ihre Urheber, ihre großenteils sehr aufzeigbaren, und sie sucht in der Welt selber, was der Welt hilft“ (1). Gelingt sie richtig gut, wird, so sagt Bloch, die Angst ersäuft (126). Hoffen stellt sich also keineswegs mühelos ein, muss auf wendig entwickelt werden. Aber wir können uns für sie entscheiden; sie lässt sich als ein durch und durch weltliches Gefühl erlernen (und lehren).Am Anfang dieses Lernprozesses muss zweierlei stehen: Es sind zunächst Mangel und Entbehrung anzuerkennen, die unsere Existenz bestimmen, und eine Selbstdefinition als Entbehrender vorzunehmen (86), es ist danach eine Verneinung des vorhandenen Schlechten erforderlich. Zur Bildung von Hoffnung bedarf es nun des Wunsches, am besten gar der Sucht, es besser haben zu wollen; darüber hinaus aber auch einer Idee, einer Ahnung vom Besseren, von noch ungewordenen Möglichkeiten, vom NochNicht. Wo kommt nun dieses Wissen vom Noch-Nicht und Nicht-Haben her, welches dem Hoffen die Richtung weist? Es stammt zu einem erheblichen Teil aus Utopien des Alltags, wie vor allem den Tagträumen, welche die Hoffnung in einem besonderen Maße erhalten und bekräftigen. Es speist sich ferner aus vielen kulturellen Landschaften mit subjektiven und objektiven Hoffnungsinhalten, in denen Noch-Nicht-Bewusstes mit dem Noch-NichtGewordenen kommuniziert. Bloch beschreibt Hoffnung als im utopischen Denken fundierte Kategorie. II. Bilanzierung : Hoffnung begreifen 7 Meine Absicht ist es nun, aus den vorgestellten Sachzugängen einiges, das mir besonders überzeugend erscheint, herauszuarbeiten und in einem gleichermaßen analytisch und kritisch angelegten Konzept zu verbinden. 1. Grundlegendes Beginnen wir mit der Begriffarbeit im engeren Sinne. Einiges, womit sich Hoffnung beschreiben lässt, ist offenbar unstrittig. Hoffen gilt weithin als starker Wunsch nach etwas von hoher subjektiver Bedeutung, dessen Realisierung aber ungewiß ist und auch nicht oder nur eingeschränkt in unsere Hand liegt. Hoffnung muss positive Ereignisse mit eigener Qualität anstreben; es reicht nicht die Zuversicht, dass eine Befürchtung nicht zur Gewissheit wird. Sie zeichnet sich durch anspruchsvolle Bewertungsaktivität aus, ist der Umwelt gegenüber zurückhaltend oder gar verborgen, orientiert sich auf gutes Zukünftiges hin, entwickelt sich in inneren Prozessen, ist von großem existentiellen Nutzen, stattet den Inhaber mit stabiler Handlungsmotivation aus, beruht auf Glauben und Vertrauen. Kontrovers diskutiert werden nun mindestens drei sehr grundsätzliche Fragen: Handelt es sich bei Hoffnung um ein Gefühl im engeren Sinne oder stellt sie einen umfassenden Seinszustand, eine subjektive Bereitschaft, eine menschliche Haltung zum Leben dar? Wie ist ihre genaue Position im Spannungsfeld von Wunsch, Sehnsucht und Erwartung? Kann sie dann als gegeben gelten, wenn sie mitgeteilt wird oder kann über ihr Vorhandensein nur durch objektive Analyse entschieden werden, kann sie also falsch sein oder auch latent? Ich versuche mit einiger Vorsicht, mich festzulegen. Hoffnung bezeichnet einen Sonderfall in der Welt der Emotionen: Sie gleicht insofern anderen Gefühlszuständen, als auch sie zeitlich begrenzt ist, kommt und geht, weder herbeigezwungen noch festgehalten werden kann. ; andererseits benötigt sie aber im Sinne von Haltungen und Stimmungen Zeit zur Entfaltung, weist sie einige Kontinuität auf und lässt sie sich durch gedankliches Bemühen beeinflussen. Es gibt allen Anzeichen nach einen tief im subjektiven Selbst verankerten „hoffnungsvollen Kern“ ( Scioli/Biller 2009) mit bindungs-, willens- und überlebensorientierten Bestandteilen, der mit einiger, individuell unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit auf problematische Situationen mit speziellen Hoffnungsgefühlen antwortet. Zum nächsten Streitpunkt: Wir haben schon gesehen, dass Hoffnung für gewöhnlich als Erwarten von etwas Zukünftigem beschrieben, von anderen Erwartungsformen dann aber durch geringere, subjektive Gewissheit, größere Flexibilität, Geduld, innere Gelassenheit und anderes mehr abgegrenzt wird. Der Wunsch wird zumeist als Vorform oder Willensaspekt des Hoffens bestimmt und mit dem Erwarten verbunden, manchmal auch als Alternative zu ihm benannt. Das süchtige Sehnen kommt ins Spiel als etwas, was dem Hoffen einen besonderen Ausdruck verleiht. Eine ablehnendere Sicht der Erwartung deutete sich immerhin bei Verena Kast an. Sehr viel kritischer besprechen aber nun Stephanie Krenn und Konrad Pfaff in einer 1986 erschienen Studie über menschliches Fühlen den Sachzusammenhang. Für sie sind Wunsch und Erwartung nichts, was sich analytisch zusammenfügen ließe, sondern völlig gegensätzliche Phänomene. Ihr Unterschied kann so groß sein, so die den Aussagen vorangestellte Überschrift, „wie der von Leben und Tod“ (188). Wunsch und Erwartung sind absolute Gegenspieler, freilich auch verwandt und insofern Stiefbrüder. Es reicht den Autoren allerdings bei weitem nicht, die Unvereinbarkeiten herauszuarbeiten. Es folgt vielmehr eine Wesensbestimmung der beiden Phänomene, welche einerseits den Wunsch als Gefühl der Grenzüberschreitung und Befreiung, „Inkarnation des natürlichen und freien Menschen“ 8 (198), Ausdruck von Lebendigkeit, positive Beziehung zur Welt, als rundum guten Handlungsgrund also vorstellt. Die Erwartung andererseits wird als Hindernis individueller Selbstverwirklichung und Machtinstrument der gesellschaftlichen Institutionen einer radikalen Kritik unterzogen. Erwartungen gelten als von außen kommende, unterwerfende, repressive Ordnungen stützende Forderungen, als gewalttätig und verführerisch, als „Gleitschienen von Konformismus“ (198), als etwas, welches nur Enttäuschung hervorrufen kann. Aus dieser Einschätzung folgt natürlich ein Verständnis von Hoffnung, welches diese allein auf Wünschen gegründet sieht. Erwartungen können das subjektive Hoffen nur hindern, verformen und zunichte machen. Zu einer ganz so eindeutigen Beurteilung der Entstehungsgründe und Folgen des Erwartens kann ich mich selbst nicht entschließen. Ich denke, das normative Element des Erwartens muss gegenüber dem kognitiven nicht immer dominieren und Erwarten muss keineswegs von Haus aus mit Ungleichheit und Freiheitsverlust verbunden sein. Andererseits scheint mir aber auch erwartungsgesteuertes Hoffen, wiewohl es nicht gleich zum Scheitern verurteilt ist, gegenüber einem wünschend sich Entfaltenden das erheblich weniger wertvolle zu sein. Hoffen gelingt vor allem, wenn es aktiv ist. Es vollzieht sich in ganz unterschiedlichen Formen, aber die beste ist die, welche schmerzhaftes Verlangen und gefühlten Mangel zur Grundlage hat, also die des sehnsüchtigen Hoffens. Die dritte Streitfrage war die nach der wissenschaftlichen Identifizierung des subjektiven Hoffens. Müssen wir das als Hoffnung beschreiben, was als solche ausgegeben wird oder können wir diese an objektiven Standards der Authentizität, Entstehung und Stärke kritisch prüfen? Kann darüber hinaus Hoffnung auch da als Potential angenommen werden, wo sie nicht geäußert wird oder nicht ermittelbar ist? Gibt es also latente, unterdrückte, unbewusste, versteckte Hoffnungen? Es geht hier um weitreichende erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Entscheidungen. Mein Standpunkt sieht derzeit so aus: Wir sollten uns im Sinn einer subjektorientierten Perspektive zuerst an den vermeintlich Hoffnung Hegenden orientieren und ihre Empfindungen Ernst nehmen , gleichzeitig aber das für Hoffnung Gehaltene mit einem kritischen Hoffnungskonzept konfrontieren. Wir werden dann feststellen, dass vieles als Hoffen Deklarierte anderes ist. Andererseits kann, wie Bloch gezeigt hat, hinter- und untergründiges Hoffungsgefühl an vielen Orten aufgefunden werden. Wird sie aber nur als verborgen behauptet, bleibt sie eine Idee des Interpreten. 2. Hoffnung und Veränderung Hoffnung kann nur, das haben die einzelnen Ansätze mit unterschiedlicher Akzentuierung in den Blick gehoben, durch ihre Bezogenheit auf Wandel bestimmt werden. Sie gründet sich auf ein schmerzhaftes Nicht-Einverstanden-Sein mit den gerade gegebenen Lebensverhältnissen insgesamt oder einzelnen Situationen. Diese gelten als problematisch und zutiefst veränderungsbedürftig. Wird auch an deren Veränderbarkeit geglaubt, möglicherweise gegen herrschende Auffassungen und die Überzeugungen des Umfelds, baut sich Hoffnung auf. Sie findet ihre subjektive Berechtigung und Nahrung häufig nur jenseits der öffentlichen Diskurse, in berühmten und unbekannten Zukunftsentwürfen, Träumen, Ahnungen vom ganz anderen oder nur in der Kraft des unbeirrbaren Wünschens. Setzt nun der subjektive Hoffnungsprozeß ein, verändert sich mit der Wandel wünschenden Bewertung der Blick auf uns selbst und unsere Identität. Ändert sich dann eines Tages das Äußere nur partiell im gewünschten Sinn, hat dies wieder Rückwirkungen auf das Innere – Veränderung ist also überall. 3. Hoffnung ist Reflexion 9 Hoffen entwickelt, bestätigt, vertieft und verändert sich durch unaufhörliche Reflexion. Wünsche und Absichten werden identifiziert, benannt, bewertet und auf Möglichkeiten, die auch wieder Prüfung bedürfen, bezogen. Veränderungsbedürftige Zustände werden analysiert und mit Alternativmodellen verglichen; Veränderungswahrscheinlichkeiten werden durchdacht. Hoffnungen werden im Verlauf eingeschätzt, aufgelöst, aufgegeben, durch immer wieder neue ersetzt. Eine Vielzahl von Fragen ist vom hoffenden Subjekt reflexiv zu bearbeiten: Worauf darf und will ich hoffen? Warum hoffe ich gerade dieses? Was macht das erhoffte Objekt begehrenswert? Was und wie wird es zu meiner Lebensrealität beitragen? Was kann ich selbst zur Realisierung des Erhofften tun? Darf und soll ich mein Hoffen bekannt machen? Was ist die Bedeutung anderer in meinem Hoffen? Woran erkenne ich, dass sich mein Wunsch erfüllt hat, dass das Erhoffte eingetreten ist? Woran erkenne ich dagegen die Nichterfüllung? Kommt dann das, was geschieht, den Hoffnungsinhalten nahe genug? Müssen die eingetretenen Ereignisse mit dem in meinem Inneren Erdachten identisch bzw. wie groß darf die Diskrepanz zwischen Phantasie und Realität sein? Wie gehe ich mit einer Enttäuschung des Hoffens um? Ist es möglich oder sinnvoll, die anfänglichen Bewertungsstandards aufzugeben oder zu modifizieren bis hin zu einer Art Selbstbetrug? Wie lange macht es Sinn, an unerfüllten Hoffnungen festzuhalten? Ist mein Hoffen status-, zeit-, alters-, umfeldgemäß? Der so vielfältige Prozeß des reflexiven Hoffnungshegens und –aufgebens als Suchbewegung lässt sich stets auch, hier ist Bloch zu folgen, als Hoffnungslernen verstehen. Dieses Lernen ist emotional, moralisch und kognitiv, wissens- und erfahrungsorientiert, geschieht in allen Sozialisationsfeldern und es lohnt sich immer. Vermutlich ist es angebracht, zwischen einem fundamentalen Lernen im Sinn der Bildung von generalisierter Hoffensbereitschaft, d.h. Vertrauen, Selbstwert, Bindung und einem spezifischen Lernen der Begründung und inneren Organisation von Hoffnungsprozessen zu unterscheiden. Als Gegenstand einer individuellen Selbstinstruktion oder auch einer kollektiven Schule der Hoffnung bietet sich vor allem das zweitgenannte an. Hier käme es darauf an, Unerwünschtes wie Gewünschtes, Leidvolles und sonst wie Veränderungswertes analysieren und in Frage stellen und bessere Zukünfte konzipieren zu können. 4. Hoffnung und Verzweiflung Verzweiflung, das völlige Fehlen von Hoffnung, lässt sich natürlich als deren Gegenstück betrachten. Weil die Hoffnung verschwunden ist, fallen wir in Verzweiflung, und weil wir verzweifeln, fehlt es an den notwendigen Bedingungen für die Entstehung von Hoffnung. Man kann auch so weit gehen zu sagen, dass erst die Auflösung fundamentaler Hoffung Verzweiflung möglich macht. Es gibt aber auch die auf den ersten Blick paradoxe Auffassung, erst die individuelle Grenzsituation mit dem Zusammenbruch des Hoffens auf das Naheliegende und Selbstverständliche gäbe Anlaß zur Manifestation fundamentaler Hoffnung im Sinne eines Grundvertrauens in das Sein und einer begründeten Gewissheit. Eine eher seltene, aber schon ihrer Radikalität wegen bedenkenswerte Position besteht schließlich darin, der intellektuellen Verzweiflung ihren Krankheitsmakel zu nehmen und sie als Befreiung von Angst und Leere und auch unnützem Hoffen zu feiern. „Es gilt also, sich jeder Hoffnung zu entledigen, in völlige Verzweiflung zu versinken, um so in den Genuß der ganzen Weisheit zu gelangen“ (Schumacher 148) Derrick Jensen, ein prominenter Zivilisationskritiker (2008) hält sogar das Ende aller Hoffnung für die Voraussetzung verändernden Handelns. Hoffnung unterwirft, erzeugt Anpassung und das ewige Sicheinrichten in Positionen geduldigen, gläubigen Wartens. Erst das Verzweifeln an der Welt und ihren Institutionen lässt uns Angst und Vernunft in 10 wünschenswerter Weise verlieren und den Kampf gegen die Herrschenden, die dabei sind, die Erde zu vernichten, aufnehmen. Hoffnung ist ein tödliches Gift, dessen Wirkung sich mit äußerster Verzweiflung am ehesten schwächen lässt. Mir selbst erscheint es vorerst das Klügste, die Dialektik von Hoffnung und Verzweiflung offen zu halten und von diesen gegensätzlichen Zuständen anzunehmen, dass sie sich gegenseitig bedingen, zeitlich aufeinander folgen können und auch niemals ohne Spuren des anderen auftreten. III. Ausblick: Das aktuelle Schicksal der Hoffnung Vieles spricht dafür, dass es mit der Emotion Hoffnung, wie ja auch von Bloch und Fromm eindrucksvoll beschrieben, schon seit längerem bergab geht. Sie scheint sowohl quantitativ dadurch an Bedeutung zu verlieren, dass die Häufigkeiten mitgeteilter oder sonst wie erkennbarer Hoffungsbekundungen abnehmen als auch qualitativ einem Gehalts- und Wirksamkeitsverlust zu unterliegen. Dieser Eindruck des Verfalls lässt sich freilich nur als Trendmeldung weitergeben und mit plausibel erscheinenden Argumenten untermauern; harte empirische Befunde stehen jedoch nicht zur Verfügung. Des weiteren muss eingeräumt werden, dass die Diagnose stark durch das zugrunde liegende Hoffnungskonzept bedingt ist. Wäre der Maßstab weniger streng, könnten die vielfältigen Aktivitäten hoffnungstechnologischer und hoffnungsrhetorischer Art, wie sie sich in der Gegenwartsgesellschaft finden lassen, als vitale Hoffungsnachweise akzeptiert werden. Stattdessen lässt sich konstatieren, dass weniger und anders gehofft wird. Hoffnung wird trivialisiert, entemotionalisiert, d.h. zum bloßen Wahrscheinlichkeitsglauben, institutionell domestiziert, umgewandelt in Ressourcen und Kompetenzen. Sie zieht sich 1) ins Private zurück und konzentriert sich auf die schmerzhaften Erfahrungen und Abhängigkeiten des postmodernen Alt- und Krankwerdens; sie wird 2) weiterhin systematisch und dogmatisch gepflegt in alt- und neureligiösen Organisationen der Sinnstiftung; sie verfällt 3) in der zu Angstmanagement gewandelten staatlichen Politik zur legitimatorischen Beschwörungs- und Wiederherstellungsarbeit. Hoffung tritt auch mehr und mehr in negativer Form auf, indem auf das Nicht-Eintreten von Befürchtungen gehofft wird, wird des weiteren zum „Hoffentlich“ reduziert. Sie wird von der Veränderungs- zur Ertragungsinstanz: es erscheint nicht mehr legitim und vernünftig, auf die Lösung zentraler Probleme, ein Ende aller Ungerechtigkeit und Ungleichheit etwa, zu hoffen, stattdessen darf aber unermüdlich gehofft werden, Kontrolle über störende Entwicklungen zu gewinnen, von den Segnungen der Zivilisation auch weiter angemessen zu profitieren, nicht jetzt schon oder nicht für immer zu den Statusverlierern, Exkludierten, Prekarisierten, Überflüssigen der Weltgesellschaft zu gehören. . . . 11 Literatur Averill, J.R. u.a., Bloch, E., Rules of Hope, New York 1990 Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt/M. 1959. 2 Bde., 2. Auflage Brodda, K., Zur Deutung und Bedeutung von Hoffnung, in: Huppmann, G/Lipps, B. (Hrsg.), Prolegomena zu einer Medizinischen Psychologie der Hoffnung, Würzburg 2006, S. 23-42 Fromm, E., Die Revolution der Hoffnung. Für eine humanisierte Technik, Stuttgart 1971 Hammelstein, P./Roth, M., Hoffnung – Grundzüge und Perspektiven eines vernachlässigten Konzepts, in: Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie 23(2002), S. 191203 Jensen, D., Endgame. Zivilisation als Problem, München-Zürich 2008 Kast, V., Freude, Inspiration, Hoffnung, Olten-Freiburg im Breisgau 1991 Krenn, S./Pfaff, K., Gefühle zum Be-denken und Be-leben von Welt. Ein Reflexionsbuch zum kraftgewinnenden Umgehen mit den eigenen Gefühlen, Dortmund 1986 Marcel, G., Homo Viator, Düsseldorf 1949 Pieper, J., Hoffnung und Geschichte. Werke, Bd.VI, München 1967 Pieper, J., Über die Hoffnung. Werke, Bd.IV, München 1977 Schumacher, B., Rechenschaft über die Hoffnung: Josef Pieper und die zeitgenössische Philosophie, Mainz 2000 Scioli, A./Biller, H.B., Hope in the Age of Anxiety, Oxford-New York 2009 Sloterdijk, P., Du musst dein Leben ändern. Über Religion, Artistik und Anthropotechnik, Frankfurt/M. 2009 Ulich, D., Psychologie der Hoffnung, in: Zeitschrift für personenzentrierte Psychologie und Psychotherapie 3(1984), S. 375-384 Ulich, D./Mayring. P. Psychologie der Emotionen, Stuttgart 1992 12