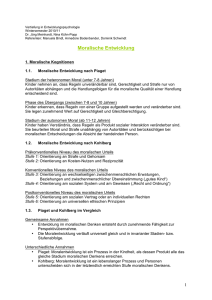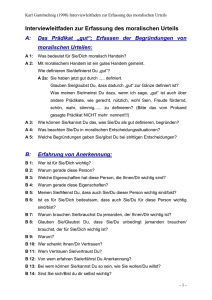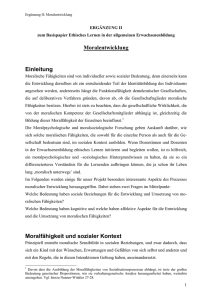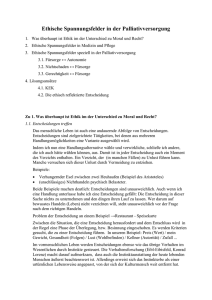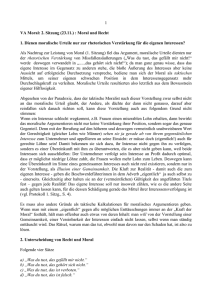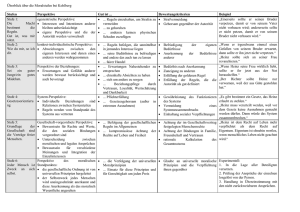Moralisch Handeln
Werbung
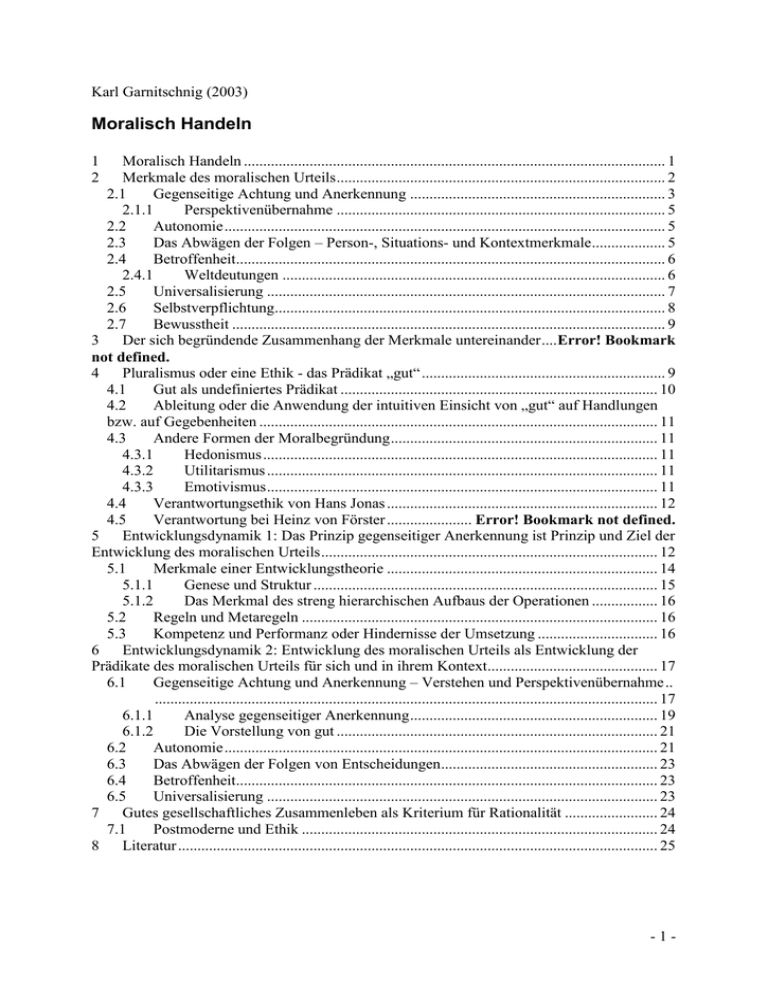
Karl Garnitschnig (2003) Moralisch Handeln 1 2 Moralisch Handeln ............................................................................................................. 1 Merkmale des moralischen Urteils ..................................................................................... 2 2.1 Gegenseitige Achtung und Anerkennung .................................................................. 3 2.1.1 Perspektivenübernahme ..................................................................................... 5 2.2 Autonomie .................................................................................................................. 5 2.3 Das Abwägen der Folgen – Person-, Situations- und Kontextmerkmale ................... 5 2.4 Betroffenheit............................................................................................................... 6 2.4.1 Weltdeutungen ................................................................................................... 6 2.5 Universalisierung ....................................................................................................... 7 2.6 Selbstverpflichtung..................................................................................................... 8 2.7 Bewusstheit ................................................................................................................ 9 3 Der sich begründende Zusammenhang der Merkmale untereinander ....Error! Bookmark not defined. 4 Pluralismus oder eine Ethik - das Prädikat „gut“ ............................................................... 9 4.1 Gut als undefiniertes Prädikat .................................................................................. 10 4.2 Ableitung oder die Anwendung der intuitiven Einsicht von „gut“ auf Handlungen bzw. auf Gegebenheiten ....................................................................................................... 11 4.3 Andere Formen der Moralbegründung ..................................................................... 11 4.3.1 Hedonismus ...................................................................................................... 11 4.3.2 Utilitarismus ..................................................................................................... 11 4.3.3 Emotivismus ..................................................................................................... 11 4.4 Verantwortungsethik von Hans Jonas ...................................................................... 12 4.5 Verantwortung bei Heinz von Förster ...................... Error! Bookmark not defined. 5 Entwicklungsdynamik 1: Das Prinzip gegenseitiger Anerkennung ist Prinzip und Ziel der Entwicklung des moralischen Urteils ....................................................................................... 12 5.1 Merkmale einer Entwicklungstheorie ...................................................................... 14 5.1.1 Genese und Struktur ......................................................................................... 15 5.1.2 Das Merkmal des streng hierarchischen Aufbaus der Operationen ................. 16 5.2 Regeln und Metaregeln ............................................................................................ 16 5.3 Kompetenz und Performanz oder Hindernisse der Umsetzung ............................... 16 6 Entwicklungsdynamik 2: Entwicklung des moralischen Urteils als Entwicklung der Prädikate des moralischen Urteils für sich und in ihrem Kontext............................................ 17 6.1 Gegenseitige Achtung und Anerkennung – Verstehen und Perspektivenübernahme .. .................................................................................................................................. 17 6.1.1 Analyse gegenseitiger Anerkennung ................................................................ 19 6.1.2 Die Vorstellung von gut ................................................................................... 21 6.2 Autonomie ................................................................................................................ 21 6.3 Das Abwägen der Folgen von Entscheidungen........................................................ 23 6.4 Betroffenheit............................................................................................................. 23 6.5 Universalisierung ..................................................................................................... 23 7 Gutes gesellschaftliches Zusammenleben als Kriterium für Rationalität ........................ 24 7.1 Postmoderne und Ethik ............................................................................................ 24 8 Literatur ............................................................................................................................ 25 -1- Bevor es sinnvoll ist, die Entwicklung des moralischen Urteils beobachtend oder fragend zu verfolgen, ist es nötig, sich über das Besondere des moralischen Urteils im Unterschied zu anderen Urteilen zu verständigen. Soweit gehen wir noch konform mit Piaget und Kohlberg. Letzterer hat explizit für eine Theorie moralischer Entwicklung gefordert, „that any conception of what moral judgment ought to be must rest on an adequate conception of what it is“ (1981, S. 178, zit. nach Aufenanger 1992, S. 127 f.). Aber schon durch seine Festlegung von Moral auf eine Theorie der Gerechtigkeit in Anschluss an John Rawls wählt er einen Ansatz, der gegenüber Moral eine eigene Dimension darstellt. Darin ist aber sehr wohl das Moment der Universalisierung als auch das der Reversibilität von Urteilen hervor zu heben. Erst in neueren Arbeiten bezieht er auch das Konzept der Verantwortung ein (Kohlberg/Levine,Hewer 1984). Wie mehrdeutig ein Begriff verwendet werden kann und was von einer nur oberflächlichen Rezeption der Philosophie der Moral zeugt, demonstrieren die zusammenfassenden Bemerkungen Piagets von „Das moralische Urteil beim Kinde“: „Die Autoritätsmoral, welche die Moral der Pflicht und des Gehorsams ist, führt auf dem Gebiet der Gerechtigkeit zur Verwechslung dessen, was gerecht ist, mit dem Inhalt des bestehenden Gesetzes, und zur Anerkennung der Sühne. Die Moral der gegenseitigen Achtung, welche die des Guten (im Gegensatz zur Pflicht)und der Autonomie ist, führt auf dem Gebiet der Gerechtigkeit zur Entwicklung der Gleichheit, welcher der konstitutive Begriff der austeilenden Gerechtigkeit und der Gegenseitigkeit ist.“ (1983, S. 383) Nur der Begriff der gegenseitigen Achtung charakterisiert Moral im eigentlichen Sinn. Klar zeigt sich im Text jedoch, dass Gerechtigkeit eine eigene Dimension im Verhältnis zur Moral darstellt. In erster Annäherung können wir sagen, dass moralische Aussagen solche über Handlungen sind, denen wir das Prädikat „gut“ geben. Was also in einem moralischen Sinn gut ist, bezieht sich auf unsere Handlungen. Handlungen sind immer mit Entscheidungen verbunden, denn das Handeln fordert von den Individuen Abwägen von alternativen Handlungsmöglichkeiten, die mit Wertungen verbunden sind. Wir handeln um eines Guten willen. Natürlich gibt es auch quasi standardisierte Entscheidungen, die einmal getroffen wurden und sei es implizit, also ohne die klare Vorstellung vom gefällten Entscheidungsprozeß, die in eine aktuale Entscheidung einfließen. Dies soll aber im Moment nicht das Problem sein. Weiters setzen wir voraus, dass moralische Urteile direkt oder indirekt Menschen betreffen. Insofern er jedoch Teil des Universums ist (vgl. Cohn 1980), hat sein Handeln Folgen auf allen Ebenen. Daher gibt es auch eine Umweltethik, die von der Ehrfurcht und Anerkennung gegenüber allem Lebendigen ausgeht. Die Pflanze ist nicht nur des Menschen willen pflegenswert, sondern auch um ihrer selbst willen. So gesehen ist Mittel zum Zweck nur, was wir für unser Leben brauchen, sofern Leben der Zweck schlechthin ist, aber nicht bloß im Sinne des Vegetierens, sondern im Sinne der höchstmöglichen Vervollkommnung seiner selbst. In diesem erweiterten Sinn kann alles unter einem bestimmten Aspekt moralisch relevant sein. Denn wie eine Person an eine Aufgabe herangeht, hat Bedeutung für seine eigene Vervollkommnung. 1 Merkmale des moralischen Urteils Ausgangspunkt allen Definierens ist eine unmittelbare Einsicht in das, was es zu definieren gilt. Denn wenn man zunächst noch keinen Begriff von etwas hat, und es ferner gilt, dass wir nur auf unser zu einem gegebenen Zeitpunkt während unserer Lebensgeschichte gebildetes Bewusstsein zurück greifen können, bleibt uns nur der Rückgriff auf das, wie wir einen Begriff zum gegebenen Zeitpunkt unmittelbar verstehen. In der Entfaltung der Definition, wenn wir versuchen, die notwendigen und hinreichenden Merkmale des Begriffs zu finden, klären wir diese unmittelbare Einsicht auf. Sie kann sich in diesem Prozess auch verändern, weil eben diese Tätigkeit des Definierens Teil unserer Lebensgeschichte wird, im besonderen 2 dann, wenn wir diesen Prozess mit anderen durchlaufen. Trotzdem bleibt dieser unmittelbare Bezug auf sich selbst, dieses auf sich selbst Merken wesentlich für den Prozess des Definierens, denn er soll unsere Realität treffen. Ausgehend von unserer Einsicht in das, was unmittelbar als moralisch angesehen werden kann, werden nach und nach jene Merkmale eingeführt, die Moral definieren. Am Ende ist zu fragen, ob denn nun mit diesen Merkmalen, Moral auch schon hinreichend definiert sei, also eindeutig von anderen Formen menschlicher Interaktion abgegrenzt werden könne. Ein moralisches Urteil wird im weiteren nur als solches bezeichnet, in dem alle notwendigen und auch hinreichenden Merkmale enthalten sind, um ein Urteil als moralisches Urteil eindeutig bestimmen zu können. Moraldiskussionen müssen sich auf jene Merkmale beziehen, über die Moral definiert ist. Daher ist es nötig, die Merkmale moralischen Handelns zu entwickeln. 1.1 Gegenseitige Achtung und Anerkennung Es dürfte wohl allgemein angenommen werden, dass nur dann von einem moralischen Urteil gesprochen werden kann, wenn die Folgen von moralischen Entscheidungen für alle anderen bedacht werden und wenn diese Folgen für die anderen auf ihr Wohl hin bedacht werden. Es mag zwar Situationen geben, in denen drastische Maßnahmen nötig sind, wie z. B. eine Operation, aber dies wäre geradezu ein Beispiel für die Begründung der gemachten Annahme, denn man wird eine Operation eben nur dann durchführen, wenn es keine andere Wahl gibt, das Wohl einer Person zu erreichen. Es ist im besonderen, wie schon Kant in seiner zweiten Formulierung des Kategorischen Imperativs hervorhebt, der andere – und wir dürfen hinzufügen – das andere niemals bloß als Mittel, sondern immer als Zweck zu sehen. Dies erfordert dem Menschen gegenüber die Einstellung von Anerkennung und Achtung. Alles als Zweck zu sehen, impliziert die Forderung, dass alles in seiner Einheit und gegenseitigen Abhängigkeit bzw. Vernetztheit gesehen werden muss, weil man sonst Gefahr läuft, auch den Menschen als Selbstzweck zu missachten. Der Mensch als Mensch wird wohl nur dann als Selbstzweck gesehen und in unsere Handlungsentscheidungen einbezogen, wenn er als solcher anerkannt und geachtet wird. Die Achtung und Anerkennung des jeweils anderen ist die Bedingung dafür, dass der andere voll zu sich selbst kommen und sich selbst zur Darstellung bringen kann, was die Grundlage allen Glücklichseins ist. Dies ist auch der Grund, warum Kant Moral in der Beförderung der Glückseligkeit des anderen und der eigenen Vollkommenheit sieht (Sittenlehre). Denn wie sollte das Motiv der Beförderung der Glückseligkeit des anderen erfüllt werden können, wenn sich nicht jeder in Selbstreflexion und in der Prüfung seines Gewissens übt, wieweit er dem nahe ist, was er als für sich gut erkannt hat und wie weit er das Glück des anderen tatsächlich will. Wenn dies aber geschieht, dass jeder die Glückseligkeit des anderen will und auch befördern kann, dann sind alle glückselig. Der moralische Mensch hat daher auch den Willen, die Perspektiven des Anderen zu übernehmen, ihn verstehen zu wollen. Wenn Moralität über gegenseitige Anerkennung definiert wird, dann kann das Ziel nur sein, Prinzipien für ein moralisches Handeln als Basis gemeinsamen Wollens, ein gutes Zusammenleben zu gestalten, aufzustellen und nicht eine Moral für alle zukonstruieren. Dies wird angesichts eines möglichen globalen Desasters – Hans Jonas (1984) baut darauf sein Prinzip Verantwortung als Prinzip der Ethik auf – immer dringlicher. Unterschiede kann es nur in situationsbedingten Fragen geben. Allerdings setzt dies voraus, dass tatsächlich gemeinsam unter Anerkennung der anderen an der Gestaltung des Zusammenlebens 3 gearbeitet wird. Werden wir uns der Kriterien für Anerkennung bewusst, wird klar, warum sich letztendlich die Vorstellungen von einem guten Leben bei einer Vielfalt der Situationen gleichen werden. Wird gegenseitige Anerkennung nicht real – Karl-Otto Apel spricht in diesem Zusammenhang von einer „realen Kommunikationsgemeinschaft“, dann bleibt fraglich, wie weit die Universalisierung moralischer Urteile gegeben ist. Die Vorstellungen über ein gutes Zusammenleben sind also in Kommunikation mit den Betroffenen zu teilen, auszutauschen, weil sich Individuen grundsätzlich über ihre Verallgemeinerungen , speziell wenn es andere betrifft, täuschen können. Daher gibt es eine Notwendigkeit, sich über die Vorstellungen des guten Zusammenlebens mit realen Anderen zu verständigen. Trotz dieses Verfahrens ist es möglich, dass die Verständigung über die Vorstellungen des guten Zusammenlebens mit anderen scheitert. Erst die Annahme einer „idealen Kommunikationsgemeinschaft“ (Apel 1983) löst dieses Problem, allerdings bloß abstrakt ideal. Das Problem der Universalisierbarkeit (siehe 1.5) bleibt also trotz des Verfahrens iterativer Verständigung bestehen. Es gibt aber auch kein besseres oder schlüssigeres Verfahren als das eben Beschriebene, wenn dabei die Voraussetzung eingelöst wird, dass die Personen die Universalisierung auf potentiell alle Menschen (gegenwärtig und zukünftig) ernst nehmen und im Verständigungsprozess wahrhaftig sind. Ihren Inhalt bekommt Moral durch die Konstruktion eines guten Zusammenlebens, ihre Gewissheit und damit ihre Form durch gegenseitige Anerkennung. Das moralische Subjekt weiß zwar, wessen es bedarf, aber das erfüllt sich erst im Blick auf den Anderen. Im Blick jedes Subjekts auf jedes andere Subjekt, weiß es, was es wollen kann. Dessen, was der Andere bedarf, kann zwar im Rückschluss auf sich selbst vermutet werden, aber man kann es nie voll und ganz wissen. Glaubt man es zu wissen, werden aus den Vermutungen unter Umständen Zumutungen an der Anderen. Ob Vermutungen zutreffen, kann der Andere mitteilen. Eine volle Übereinstimmung sollte nie angenommen werden, denn das kann nur allzu leicht zu einer Machtäußerung werden. Aus der Unterschiedlichkeit der Subjekte wird deutlich, dass sie mit den Anderen in Kommunikation treten müssen, will man ihr Sosein als Ergänzung und Bereicherung für sich selbst, jeder für jeden erfahren. Faktisch kann man aber nur mit einer relativ kleinen Anzahl von Anderen in Beziehung treten. Nennen wir konkreten Gruppen Vergesellschaftungen. Damit ist jene Gruppe von Subjekten gemeint, die untereinander und für jede Mitglied bewusst faktisch mit einander kommunizieren können. Gegenseitige Anerkennung schließt den Willen zur Autonomie für jeden ein. Wird in wirtschaftlichen Zusammenhängen, z. B. in der Werbung auf die Abhängigkeit des einzelnen gesetzt, widerspricht dies dem Prinzip von Anerkennung. Entsprechend muss Management darauf abgestellt sein, jeden einzelnen zu professionalisieren, jeden einzelnen dazu zu führen, die Strukturen des Betriebs in allen Bereichen, auch der Budgetierung zu durchschauen. V. a. muss auch im Sinne der Zielerreichung klar sein, welchen Beitrag jeder einzelne für das Ganze leistet. Unsere halbaufgeklärte Zeit fordert Gesamtaufklärung, damit Wahrheit, auch Kostenwahrheit auf allen Gebieten erreicht werden kann. Dieser Prozess trägt selbst wieder zur Professionalisierung bei. In solchen Organisationen wird es vermehrt Kooperationen unterschiedlichster Art und Kommunikation geben. Es muss alles getan werden, um die Selbst- und Fremdaufklärung von Individuen zu erweitern, ihre Handlungsmotivation und Handlungskompetenz zu erhöhen. 4 1.1.1 Perspektivenübernahme Marvin Berkowitz und John Gibbs (1983) konnten in einer Studien nachweisen, dass bei „transaktiven Diskussionen“, die darin bestehen, dass die Überlegungen der Anderen in die eigenen Überlegungen einbezogen werden, ein Stufentransformation in Richtung eines höheren moralischen Urteils erfolgt (vgl. Aufenanger 1992, S. 161).. 1.2 Autonomie Anerkennung und Achtung des anderen ist aber nicht möglich, wenn dies nicht jedes Individuum von sich aus umsetzt. Niemand kann für einen anderen Anerkennung und Achtung leisten, jeder muss es für sich selbst tun. Daher ist im Sinne eines moralischen Urteils jeder Mensch als Individuum aufgefordert, seine Entscheidungen selbst zu treffen. Eine übernommene Entscheidung wäre moralisch nicht ausreichend. Die Person folgt dann äußeren Normen. Ein moralisch handelnder Mensch will seine Entscheidung selbst treffen, will selbst die Verantwortung für seine Entscheidung übernehmen. Aber genau diese Übernahme von Verantwortung macht das Besondere des Menschseins aus. Deshalb darf auch ein Verbrecher, auch wenn sein Verhalten krankhaft ist, nicht aus der Verantwortung entlassen werden. Es kann mildernde Umstände geben, aber trotzdem bleibt die Verantwortung. Würde man ihn aus der Verantwortung entlassen, würde man ihm zugleich absprechen, autonom handeln zu können und damit zugleich ein wesentliches Prädikat seines Menschseins. Verantwortung schließt das Abwägen der Folgen des Handelns ein als auch Selbstverpflichtung. Darin erweist sich die Freiheit des Subjekts, die eigene Willkür bewusst nach selbst entworfenen Regeln einzuschränken. Man spricht allenthalben von begrenzter Freiheit. Aber Freiheit ist entweder absolut oder sie ist gar nicht. Die Aussage, man könne doch aus der Erfahrung nicht behaupten, der Mensch sei absolut frei, hat viel Plausibilität, aber nur auf den ersten, oberflächlichen Blick. Der Aussage kann tatsächlich nichts entgegen gehalten werden, wenn man nicht auf den Sinn solcher Rede reflektiert. Es fragt sich nämlich, ob ein Handelnder darauf angewiesen ist, dass ihm jemand sagt, nachdem er es empirisch festgestellt hat, wie sein Handeln begrenzt ist, welche Handlungsmotive er vernünftig nur wählen oder für welche Handlungsmotive er sich vernünftig nur entscheiden könne. Liegen der Verantwortung empirische Gründe voraus oder ist nicht Verantwortung vor jeder empirischen Beobachtung vorauszusetzen? Freiheit als reflektierte Selbstbestimmung verstanden steht in der Dialektik von Bestimmtheit und Bestimmung, die sich nach dem Maß ihrer selbst, nämlich wie gut es einer Person in Anerkennung der Freiheit anderer gelingt, mit diesen ihr Leben zu entwerfen und auch nach diesem Entwurf zu leben und zu handeln. Danach hat Freiheit/Autonomie mindestens zwei Aspekte. Man handelt nur dann autonom, wenn man (1) den Entscheidungsprozess nach eigenen Prinzipien und Regeln vollzieht und (2) mit diesen Prinzipien und Regeln selbst übereinstimmt und nicht bloß auf die Anweisung und Zumutung anderer folgt. Denn nur dann ist auch gewährleistet, dass die Prinzipien und Regeln ihnen gemäß vollzogen werden. Jedenfalls impliziert moralisches Handeln, wenn es autonom sein und real werden soll, dass Menschen moralisch handeln wollen, aber nicht wie bei Kant aus Achtung vor dem Gesetz, sondern aus Achtung und Anerkennung vor den Menschen, denn die Glückseligkeit des Menschen ist Ziel und Zweck moralischen Handelns. Der Sinn eines Gesetzes kann nicht in sich selbst beruhen, sondern in dem, wozu es dient. 5 1.3 Das Abwägen der Folgen – Person-, Situations- und Kontextmerkmale Jedes Individuum kann je nach seiner intellektuellen Kapazität unterschiedlich viele Folgen als Merkmale von Personen, Situationen und dem Kontext zwischen beiden einbeziehen. In diesem Zusammenhang ist für ein Konzept der Entwicklung des moralischen Urteils nötig, die intellektuelle Entwicklung zu verfolgen. Der moralische Mensch wird danach trachten, in seine Entscheidungen alles einzubeziehen, was ihm nur möglich ist. Im weiteren dürfte wohl klar sein, dass jemand, der sich von Situationen tatsächlich sensibel betreffen lässt, mehr entdecken wird, was noch in der Entscheidung berücksichtigt werden sollte. Somit gehört Sensibilisierung für Situationen zum moralischen Leben. Dazu gehört aber genauso eine affektiv-volitive Komponente, denn eine Person kann sich verweigern, bestimmte Person-, Situations- und Kontextmerkmale einzubeziehen. Dies führt zu einem weiteren Merkmal, dem der Betroffenheit. 1.4 Betroffenheit Jedes Individuum muss in sich spüren und damit bereit sein, überhaupt alle möglichen Folgen zu beachten. Eine Person kann nämlich durchaus stärker auf ihren Vorteil bedacht sein und daher die in die Entscheidung einzubeziehenden Situations-, Person- und Kontextmerkmale zum eigenen Vorteil auswählen. Es ist also auch eine Frage des Wollens und der emotionalen Betroffenheit und nicht bloß der intellektuellen Kapazität, welche und wie viele Merkmale eine Person in die Entscheidung einbezieht (vgl. 1.5). Aus diesem Grund ist es angemessen, das Merkmal einzuführen. Zur Betroffenheit von der Situation gehört auch sich betreffen zu lassen. Dazu gehört Bewusstheit seiner selbst und die Bewusstheit über und in Situationen. Menschen entscheiden sich faktisch nach unterschiedlichen Motiven. Die Motive selbst erhalten wir aus dem Aufgegebensein, Angesprochensein, die wir in Situationen erfahren. Aber ein und dieselbe Situation kann Menschen ganz anders ansprechen. 1.4.1 Weltdeutungen Oser/Althof (1992, S. 31) schreiben, dass „je nach Situation und Perspektive der Beurteilenden ... aus ein und demselben Wert unterschiedliche Handlungsentscheidungen abgeleitet werden“, so als würden der Inhalt der Entscheidung und die Begründung für die Entscheidung auseinander fallen. Um dieser Unklarheit zu entgehen, ist einerseits der Begriff „Situation“ und andererseits der Begriff „Perspektive“ zu klären. Nach Franz Fischer (19 ) ist „Situation“ ein Gewissensbegriff (Garnitschnig 1994). Die Situation gibt für sich das Motiv des Handelns, dies natürlich nur unter der Bedingung, dass ich mich von der Situation unter der Perspektive moralischen Handelns betreffen lasse. Da kommt offensichtlich noch ein anderes Moment zum Tragen, das nicht aus der Situation abgeleitet werden kann, sondern aus den Sinnbestimmungen einer Person, der Art und Weise ihres Zugangs zur Welt bzw. seines Verhältnisses zu ihr. Die Welt umfasst (1) die natürliche Umwelt, (2) die soziale Mitwelt, (3) den Bezug zu sich selbst in freier Selbstbestimmung und (4) zur übernatürlichen Welt (Fichte, WL von 1804, Buber 1992). Zu all diesen Bereichen kann horizontal und vertikal unterschiedlich Stellung bezogen werden, sie können unterschiedlich gedeutet werden (Garnitschnig 1991). So kann horizontal zu allen Bereichen unter dem Aspekt moralischen Handelns Bezug genommen werden oder unter dem Aspekt sozialer Gegebenheiten. Dann verliert Moral seine eigentliche Bedeutung und wird zu einer heteronomen oder konventionellen Moral. So kann ein und derselbe Name für einen Wert (z. B. Gerechtigkeit) je nach der Perspektive, aus der heraus er gesehen wird, eine andere Bedeutung annehmen. Wenn im weiteren der Begriff „Welt“ verwendet wird, meint er immer all diese Verhältnisse. Sofern der Mensch in Situationen zu Welt Stellung bezieht, wertet er. 6 Ob er will oder nicht, ob es ihm bewusst ist oder nicht, er bezieht Stellung. Auch wenn manche Handlungen unbewusst ablaufen, der Mensch sich also verhält, so als passierte ihm etwas, gehört es doch zum Menschsein, dass er für das verantwortlich ist, was er tut. Sprechen wir jemand die Verantwortung für sein Handeln ab, sprechen wir ihm auch sein Menschsein ab. Wie nun der Mensch Stellung bezieht, lässt sich über die Weisen seines Bestimmungsverhältnisses zur Welt bestimmen, das über Situationen variieren kann. Erst in Handlungen in der Weise freier Selbstbestimmung (3) ist der Mensch definitionsgemäß moralisch. 1.5 Universalisierung Damit ein Urteil als moralisch bezeichnet werden kann, will die handelnde Person die Konsequenzen der Entscheidung bezogen auf prinzipiell alle Menschen, aber auch letztlich das gesamte Universum beachten. Denn wie wir gegenüber der Natur handeln, hat auch Folgen für den Menschen. Dieses Merkmal moralischen Urteilens hängt auch mit dem Merkmal gegenseitiger Achtung und Anerkennung zusammen, denn diese setzen die Bereitschaft voraus, Folgen des eigenen Handelns für andere Personen zu bedenken. Auch wenn es letztlich unmöglich ist, alle Konsequenzen zu beachten, und damit Urteile niemals universalisierbar sind, darin ist Baumann recht zu geben (1995, S. 25 f.), hält der moralische Mensch doch den Anspruch aufrecht. Wenn er also handelnd erfährt, dass seine Handlungen negative Konsequenzen zeitigen, ist er bereit, die Folgen dafür zu tragen. Man würde wieder in die Rationalität der Moderne zurückfallen, wollte man eine strikte Universalisierung fordern. Kritische Intellektualisten neigen dazu, die Postulate der Vernunft absolut einzufordern, wenn sie schon aufgestellt werden, um den Gedanken selbst zu destruieren. Deutlich wird aber die Konsequenz erst von der Negation des Postulats oder des Motivs. Das Motiv der Universalisierung nicht prinzipiell anzuerkennen würde dazu führen, Gruppenethiken einzuführen. Was für die eine Gruppe gilt, mag für eine andere nicht gelten. Dies ist eine cosa nostra-Ideologie, die gegenseitige Anerkennung und den Menschen als Zweck für sich selbst zu sehen und zu achten ablehnt. Daraus folgt, dass moralisches Handeln prozesshaft zu denken ist. Es ist niemals abgeschlossen in dem Sinne, dass wir immer noch umfassender unsere komplexe Welt zu erfassen suchen und wir uns weiterhin sensibilisieren und uns von allen Situationen betreffen lassen. Übrigens ist das auch ein Aspekt der besseren Erfassung unserer Welt. Moraltheoretiker, die glauben, Moral auf allgemeingültige Regeln aufbauen zu können, die für alle gelten, sind offensichtlich zum Scheitern verurteilt. Aber deshalb kann niemand wollen, dass es überhaupt keine Handlungsmotive gibt, die zwischenmenschliches Leben steuern. Da ferner klar geworden ist, dass es nicht gelingen wird, alle Menschen für die Annahme gemeinsamer Voraussetzungen zu begeistern, von denen ausgehend man Vorstellungen für ein gutes Zusammenleben entwickeln kann, wird man nicht umhin können, Menschen zu suchen, mit denen man zu einem gemeinsamen Verständnis kommen kann. Macht man gegenseitige Anerkennung zu einer notwendigen Bedingung moralischen Handelns, dann könnte die Bedingung allgemein annehmbar sein. Fakten und auch Erklärungen und auch gesellschaftlichen Praktiken wie die Todesstrafe sprechen das Gegenteil. Universalisierung ist bezogen (1) auf Personen und (2) auf Situationsmerkmale. 7 ad 1. Diese Bedeutung von Universalisierung setzt Perspektivenübernahme, prosoziales Verhalten bzw. Handeln, Verstehen, Einfühlen voraus. Im Sinne des Definitionsmerkmals „Selbstverantwortlichkeit für moralische Urteile“ gibt es und kann es kein bloß technisches Verfahren geben, nach dem universalisierte Aussagen „errechnet“ werden könnten. Vielmehr bedarf die Anwendung jedes Kriteriums wieder einer Entscheidung, die auf mehreren Möglichkeiten fußt. Jede Entscheidung eröffnet wieder ein Feld von Entscheidungen, die wieder Entscheidungen fordern. Am Ende steht ein Komplex von Entscheidungen, der vom Individuum letztlich vom Sinn der Kriterien her entschieden werden muss. ad 2. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Personen bereit sind, alle Faktoren zu bedenken, die für eine moralische Entscheidung von Bedeutung sein könnten. Dass dies wegen der Komplexität von Welt grundsätzlich nicht möglich ist, haben wir schon oben erörtert. Der moralische Imperativ kann also nur lauten: Lasse nie willkürlich aus parteiischen Überlegungen Situationsmerkmale unberücksichtigt. Es kommt wieder das Zusammenspiel aller Merkmale, im besonderen das der Anerkennung zum Tragen. In einer Zeit, in der das Überleben der Menschheit in Frage steht, bekommt das Moment der Universalisierung eine verschärfte Bedeutung. Er ist überlebensnotwendig geworden. Hans Jonas baut sein Prinzip „Verantwortung“ darauf auf. „Globalisierung“ als Stichwort weist in die gleiche Richtung. Für die moralische Argumentation ist da aber Vorsicht geboten. Baut nämlich Moral auf solchen Argumenten auf, dann verrät sie sich selbst. Denn fühlt sich eine Person nicht von sich aus für den anderen verantwortlich ohne jeden weiteren Grund, wird sowohl die Kategorie der Selbstverpflichtung als auch der Autonomie wie der Achtung vor dem anderen nicht erfüllt. Denn der Andere sollte in seinen Bedürfnissen für sich, als reiner Selbstzweck wahrgenommen werden. Am radikalsten hat diesen Gedanken Emmanuel Lévinas (1987) ausgedrückt. 1.6 Selbstverpflichtung Wegen des Merkmals der Autonomie moralischen Handelns kann es keine Verpflichtung von außen geben. Moralische Regelsysteme werden in unserer heutigen pluralistischen Gesellschaft nicht nur nicht beachtet, sondern würden auch gegen die Verantwortung des einzelnen verstoßen. Sie könnten höchstens Anlass sein, sich mit ihnen auseinander zu setzen, nicht um sie als moralische Regel zur Grundlage seines Handelns zu machen, sondern als Grundlage für die eigene Prüfung. Außerdem ist jede Situation und jeder Mensch so einmalig, dass eine Regel niemals ohne eigene Überlegung anwendbar ist. Nach Kant gebührt allein dem Gesetz Achtung. Ihm seien wir unterworfen, „als uns von uns selbst auferlegt“ (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten S. 40, Anm.). Wenn aber Kant die „Achtung für eine Person“ in die Achtung für das Gesetz legt, das sie in sich verkörpert, dann ist das insofern problematisch, als er nicht beachtet, dass es auch Pflicht ist, will ich insgesamt Sittlichkeit befördern, dass ich die Glückseligkeit des anderen befördere. Achtung gebührt also dem Menschen, weil er in der Lage ist, das moralische Gesetz in sich zu verwirklichen, ob er es nun tut oder nicht. Im Sinne der Selbstverpflichtung will eine Person gute Entscheidungen treffen. Im Zentrum moralischen Urteilens steht also das Wollen und nicht das Sollen, welches einen Rechtbegriff darstellt. Hinter der Selbstverpflichtung steht auch der Anspruch an sich selbst, wachsen zu wollen, um immer leichter moralisch leben zu können. Moralisches Handeln kann also nicht erzwungen werden, sondern kann nur einer anderen Person unter Berücksichtigung der Merkmale moralischen Handelns immer und allerorts angemutet werden. Erfolgt dies in 8 Achtung und Anerkennung und aus dem Willen, den anderen zu verstehen, ist dies die realste Chance, dass der andere ein moralisches Leben von sich aus beginnt. Man könnte sich schon zufrieden geben, wenn jemand sich selbst verpflichtet, moralisch zu handeln und es auch tut. Der eigentliche moralische Mensch ist aber der, der moralisch handeln will, für den ein anderes Handeln erst gar nicht in Frage kommt. Nach Friedrich Schiller wäre das die „schöne Seele“. Sie will in sich Einheit und Harmonie. 1.7 Bewusstheit Die Spanne des Bewusstseins reicht von unbewusst bis überbewusst. Mit Bewusstheit ist aber das tatsächliche Gewahrsein seiner selbst in einer Entscheidungssituation gemeint. Wenn eine Person in ähnlichen Situationen immer wieder bewusst handelt und entschiedet, wird die Entscheidung ritualisiert, sie läuft mehr oder weniger automatisch ab. Dies nützt Individuen und auch Gruppen zur Entlastung. In diesem Sinne kann man Entscheidungen wohl auch unter moralischen Aspekten akzeptieren, aber es wäre moralisch nicht legitim, eine Handlung mit dem Hinweis zu rechtfertigen: Das hätte man schon immer so gemacht. Eine einmal bewusste Handlung kann immer wieder bewusst gemacht werden. Aus diesen Erörterungen kann nun als Definition des moralischen Urteils bzw. als Moral formuliert werden: Moralisch sind jene Handlungsentscheidungen, die autonom, unter Abwägung ihrer Folgen für potentiell alle Menschen unter dem Prinzip gegenseitiger Achtung und Anerkennung getroffen werden. Man wird zurecht die Frage stellen, warum in die Definition nur vier Merkmale einfließen. Genau bedacht ergeben sich die anderen Merkmale von selbst. Sie wurden bei der Ableitung der Merkmale nur eingeführt, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. 2 Pluralismus oder eine Ethik - das Prädikat „gut“ Kann es einen Grundsatz geben, der für alle gilt und der zugleich den Grund für eine universelle Ethik legen könnte. Akzeptiert man einen solchen Ansatz nicht, dann muss man sich den Vorwurf nicht nur der Relativität – ein solcher Standpunkt wird heute von vielen vertreten und gilt als salonfähig – sondern der Beliebigkeit gefallen lassen Versuche solcher Grundlegungen von Ethik, die von einem Grundsatz ausgeht, gibt es schon viele. Dass es viele gibt, hat einen guten Grund. Wir dürfen annehmen, dass die, die eine einheitliche Ethik wollten, von einem positiven Motiv geleitet waren. Aber können nicht alle Versuche der Definition von gut oder gutem Handeln einen wahren Kern haben, nämlich dann, wenn sie den Merkmalen entsprechen, wie sie oben formuliert wurden. Das größtmögliche Glück oder der größtmögliche Nutzen, die höchste Lust, wenn sie jeweils für alle gemeint sind, nicht nur für eine ausgewählte Gruppe sondern universell, mit Beachtung der Folgen des Handelns usw., dann fallen diese Prädikate alle zusammen und „gut“ ist dann nicht mehr über ein bestimmtes Prädikat definiert, sondern über alle diese Prädikate und das Verdikt des naturalistischen Fehlschlusses (Moore 1970) wird überwunden. Fasst man also jedes Prädikat von gut über die Kriterien, dann werden sie universell auch in diesem Sinn, dass Glück auch Nutzen und Lust bedeuten und Lust auch Nutzen und Glück herzustellen vermag. Die Verabsolutierung der Prädikate hat möglicherweise ihren Grund in der Vorstellung der jeweiligen Vertreter einer Partikularethik, dass über dieses Prädikat am leichtesten und am rationellsten die Erfüllung der Kriterien möglich ist. Daraufhin könnten die Hauptvertreter dieser Ethiken untersucht werden. 9 Die unterschiedlichen Moralsysteme lassen sich im Prinzip der Anerkennung integrieren. Denn wird durch Anerkennung die Perspektive des anderen übernommen, dann muss wohl auf alle Aspekte des Personseins des Anderen eingegangen werden, auf sein Wohlsein ebenso wie auf die Nützlichkeit einer Entscheidung für ihn. Wenn Personen in der Entwicklung ihrer kognitiven Kompetenz so weit sind, dass sie fähig wären, im definierten Sinn moralisch zu handeln, es aber doch nicht tun, muss das Verstehen dieses Handelns anders konzipiert sein, will man einer Person nicht bloß böse Absicht bescheinigen. Es kann sein, dass Menschen äußerst trickreich oder völlig offen z. B. einen niedrigen Utilitarismus vertreten oder einfach einen Rechtsstandpunkt. Da die Annahme eines Standpunkts auch gewollt werden muss, Personen es aber auch ablehnen können, einen Standpunkt annehmen zu wollen, obwohl sie es könnten, werden sie ihren Verstand dazu einsetzen, den eigenen Stanpunkt intellektuell zu verteidigen. Erleben etwa Personen keine ausreichende Anerkennung, wird es ihnen schwer fallen, andere anzuerkennen, wenn sie überhaupt dazu in der Lage sind. , sondern je nach ihrer Möglichkeit andere in ihre Überlegungen einbeziehen und im Sinne des Moralbegriffs defiziente Weisen des Aushandelns von Regeln wählen: Eudaimonismus, niederer oder höherer Utilitarimus (vlg. Anzenbacher 1992). Ein weiterer Grund für die Akzeptanz unterschiedlicher Vorstellungen liegt im Pluralismus unserer Gesellschaft. Schon aus dem Prinzip gegenseitiger Anerkennung müssen unterschiedliche Vorstellungen zugelassen werden. Sie können die Debatte sehr bereichern, wenn sich Personen nicht auf eine Vorstellung versteifen, oder andere, weil voraussetzungsreichere Vorstellungen abtun. Meist sind es weltanschauliche Fragen, die Personen es äußerst schwierig macht , sich auf Standpunkte anderer einzustellen. 2.1 Gut als undefiniertes Prädikat Gut zu definieren bedeutet einen naturalistischen Fehlschluss (Moore)1. Von gut darf kein bestimmtes Bild gemacht werden. Es muss grundsätzlich der Intuition offen bleiben. Daher gibt es eine dauernde Veränderung der intuitiven Einsicht von gut seiner Qualität und seinem Inhalt nach. Dies lässt sich sowohl historisch als auch individuell lebensgeschichtlich beobachten. Um nun nicht einer Fixierung auf ein bestimmtes Prädikat von gut zu verfallen, muss immer mit dem Urteil Aufmerksamkeit verbunden sein, den je und je bestimmten Inhalt nicht zu fixieren. Die unterschiedlichen Moralsysteme (Hedonismus, Utilitarismus ...) haben „gut“ in bestimmter Weise definiert, einen Inhalt von gut fixiert. Gut kann den Inhalt von Wohltun oder von Nützlichkeit haben, aber geht darin nicht auf. Gut ist all das, was unter gut vorgestellt werden kann, in sich integriert. Was im Sinne des Utilitarismus Nutzen für einen anderen ist, entspricht auch der Lust – nicht als biologische Kategorie – denn der moralisch Handelnde will den Nutzen für den anderen. Zunächst wollen wir die Frage stellen, welcher Art das Prädikat „gut“ ist. „Gut“ als ein traditionell transzendentales Prädikat meint eine Bedingung der Möglichkeit der Prädikation von Handlungen al sgut, also überhaupt von Handlungen in einem bewertenden Sinn sprechen zu können. Mehr ist damit nicht ausgesagt. „Gut“ als Prädikat ist also nur dadurch definiert, dass es möglich ist, von Handlungen zu sagen, dass sie gut sind. Nicht jeder Handlung kommt Missverständnis dessen, was „naturalistischer Fehlschluss“ bedeutet, bei Kohlberg (1971, S. 222). Vgl. Aufenanger 1992, S. 131 f. ausführen im Text 1 10 das Prädikat „gut“ zu. Aber wie können Handlungen, denen das Prädikat „gut“ zukommt von solchen unterschieden werden, denen es nicht zukommt. Alle Ethiken, die „gut“ definieren, sind trivial. Solche Ethiken definieren „gut“, um entscheidbar zu machen, welche Handlungen „moralisch“ sind. Man verkennt dabei allerdings, dass man damit moralische Handlungen auf ein bestimmtes Muster beschränkt. Diese Ethiken verfallen einer Reduktion, weil sie nach einem Algorithmus entscheiden können wollen, welche Handlungen „gut“ sind. Definiert man „gut“ nicht, betrachtet man „gut“ als ein undefiniertes Prädikat, dann kann „gut“ jede Bedeutung annehmen: wohlsein (Hedonismus), nützlich für die möglichst größte Zahl (Utilitarismus), gerecht im Sinne von, dass allen Gleiches zukommen soll, aber auch jedem nach seinen Bedürfnissen... Es wird dann spannand zu fragen, wie denn das Wohlsein, die Nützlichkeit für jeden und für alle, Gerechtigkeit ... in einer Handlung erfüllt sein kann. Auf diese Weise kommt Ethik von trivialen Sätzen weg und wird dynamisch und trotzdem nicht beliebig. Es wird klar, dass dann nicht mehr nach Eindeutigkeit ethischen Handelns und nach eindeutiger Entscheidbarkeit gefragt wird, sondern gefragt ist die Person in ihrer Einmaligkeit und ihre Achtung und Verantwortung für andere. Eine eindeutige Entscheidbarkeit auf der Basis von I. Kants zweiter Formulierung des kategorischen Imperativs „Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest“ (Kant 1786, S. 79) zu verlangen, hieße, Personalität und Subjektivität und damit Verantwortung aufzugeben und auf algorithmische Prozeduren zu verlegen. Mit Heinz von Foerster (1993) könnte man davon sprechen, dass der Mensch nicht nur maschinenanalog, sondern analog einer Trivialmaschine gedacht würde. 2.2 Ableitung oder die Anwendung der intuitiven Einsicht von „gut“ auf Handlungen bzw. auf Gegebenheiten Will man einem anderen mitteilen, was gut ist, bzw. was man unter gut versteht, dann ist das nur möglich, wenn die intuitive Einsicht auf konkrete Handlungsentscheidungen übertragen wird, wenn man also einem anderen mitteilt, warum man sich in einer bestimmten Situation so entschieden habe oder entscheiden würde und warum man diese Entscheidung für gut hält. Wie schon betont, „gut“ kann durch verschiedene Merkmale bestimmt werden, aber es darf keines dieser Merkmale absolut gesetzt werden, will man nicht in den Streit der Morallehren geraten. Man kann also eine „gute“ Entscheidung sehr wohl dadurch begründen, dass man sagt, sie würde Glück verschaffen, sie wäre nützlich usw.. 2.3 Andere Formen der Moralbegründung 2.3.1 Hedonismus 2.3.2 Utilitarismus 2.3.3 Emotivismus Dass Werturteile von Gefühlen begleitet sind, nimmt der Emotivismus als Ausgangspunkt seiner Werttheorie (Stephenson, Ayer). Aber diese Gefühle konstituieren nicht Werturteile (Lenk 1994, S. 171). 11 2.4 Verantwortungsethik von Hans Jonas Es lässt sich zurecht fragen, warum nicht auch „Verantwortung“, zumal sie in der Moral eine so große Rolle spielt, als Prädikat des moralischen Urteils eingeführt wurde. Dies wäre nur zu rechtfertigen, wenn angenommen werden kann, dass „Verantwortung“ in den anderen Prädikaten enthalten ist. Wer sich selbst zu moralischem Handeln verpflichtet und bereit ist alle Folgen seines Handelns zu tragen, handelt verantwortlich. Tatsächlich leitet auch Hans Jonas aus seinem Prinzip Verantwortung nicht etwas für moralische Entscheidungen ab, sondern will wegen der tatsächlichen Gefährdung unserer Lebensgrundlagen moralischen Entscheidungen eine besondere Valenz geben. Tatsächlich ist die Verantwortung jeder einzelnen Person immer gefragt. 3 Entwicklungsdynamik 1: Das Prinzip gegenseitiger Anerkennung ist Prinzip und Ziel der Entwicklung des moralischen Urteils Die Entwicklung eines Subjekts geschieht im Austausch mit der Umwelt, bei dem innere und äußere Faktoren zusammenspielen. Dem Kind müssen schon von allem Anfang an Fähigkeiten des Zugangs zur und der Verarbeitung von Reizen aus der Umwelt zugeschrieben werden, weil sich sonst Entwicklung als dynamischer oder dialektischer Austauschprozess zwischen einem Organismus und seiner Umwelt nicht fassen ließe. Interessant in unserem Kontext ist nun in besonderer Weise, welches denn die Fähigkeiten eines menschlichen Subjekts sind, über die es sich mit seiner Umwelt austauscht und wie es sich durch die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt. Innerhalb eines derartigen Ansatzes sind Formulierungen, nach denen das Subjekt durch die soziale Welt konstituiert werden soll, wobei das Subjekt diese wieder mitgestaltet falsch (vgl. Aufenanger 1992, S. 31 – 36, 183 f., der sich auf Hurrelmann 1983 bzw. später auf Oevermann 1976, 1979 bezieht). Vielmehr wird das Subjekt durch den wechselseitigen Austausch mit der Um- und Mitwelt konstituiert, wobei noch angenommen werden muss, dass dieser Austausch über die Kompetenzen des Subjekts bestimmt ist, welche sich durch den und im Austausch differenzieren. 2 Dieser Prozess kann durch die Kompetenz des Menschen zu Reflexivität im Idealfall bis zur Selbstkonstitution des Subjekts in dem Sinn führen, dass er sich eine bestimmte geistige Existenz gibt. Richtig ist, dass das Kind „von Anfang an an einer Interaktion [teilnimmt], welche das für seine Rekonstruktionsleistungen notwendige Material zur Verfügung stellt“ (Aufenanger 1992, S. 183). Aufenanger verfährt hier widersprüchlich, wenn er einmal schreibt: „Die Sinnstrukturen von Interaktionen werden durch die Anwendung von Kompetenzen der handelnden Subjekte hervorgerufen.“ Als gelte dies nicht auch für das Kind. Dann schreibt er weiter, dass die Interaktionsstrukturen erst durch die Eltern „einen spezifischen Sinn bekommen, den das sich und ohne Kompetenzen ausgestattete Kind zur Konstruktion seiner eigenen Kompetenzen rekonstruieren kann“ (a. a. O., S. 184). Wie soll das möglich sein, wenn dem Kind nicht schon Kompetenzen zugeschrieben werden, dies zu leisten. Richtig wäre zu sagen, dass das Kind nur an den menschlichen Interaktionsstrukturen, ausgehend von seinen sich in den Interaktionen ausdifferenzierenden psychischen Funktionen, sich Welt mit ihren Strukturgesetzlichkeiten aneignet. In diesem Kontext darf der Als-ob-Gedanke nicht zu weit getroeben werden. Der Pädagoge handelt dem Kind gegenüber so, als würde er Sprache schon verstehen, als wäre es schon 2 Wolfskinder sind in diesem Kontext kein Gegenbeispiel, denn sie hatten bestimmte Kompetenzen, die sich unter gegebenen Bedingungen nicht weiter ausformen konnten.. Sie und Kinder unter Bedingungen des Hospitalismus zeigen aber, wie wesentlich die Qualität der Beziehung für die Entwicklung des Subjekts ist. Je nach der Qualität der Beziehungen in der Kindheit hat diese auch im Erwachsenenalter eine große Bedeutung. 12 autonom, zu Kommunikation fähig. Tatsächlich muss das Kind dazu schon gewissermaßen fähig sein, sonst könnte es nicht lernen – und es lernt mit einer enormen Geschwindigkeit. Dieses Handeln ist nicht „kontrafaktisch“ (a. a. O., S. 185 f.), sondern es muss angenommen werden, dass im Kern diese Fähigkeiten bereits angelegt sind, sonst wäre es sinnlos, so zu handeln. Unter diesem Gesichtspunkt muss auch die Vorstellung stellvertretender Deutung revidiert werden. Für welches Alter soll diese Operation gelten, die Aufenanger in folgendem Zitat beschreibt? „Es (das Kind, KG) interpretiert die ihm durch stellvertretende Deutung unterstellte Handlung als seine Handlung und erfährt damit eine mögliche Lesart von rationaler Vermittlung von Handlungskontext und Handlungsabsicht.“ (S. 187, Unterstreichung im Original) Das Kind ist schon sehr früh zu intentionalem Handeln fähig, wohl aber nicht so schnell zu einer derartigen Interpretation wie im Zitat beschrieben. Die durch den Saugreflex ausgelöste Handlung des Trinkens wird schon nach ein paar Tagen zu einem aktiven Suchen. Außerdem reagiert das Kind schon sofort mit der Geburt auf Angebote der Mutter. Es hört auf die Stimme der Mutter und hört z. B. auf zu schreien. Anstatt mit dem komplexen Begriff der Deutung wäre günstiger mit dem Konzept der ErwartungsErwartungen operieren, die Kommunikation definieren und wie seit sie anschlussfähig sind. Entsprechen Erwartungs-Erwartungen bekommt das Kind Sicherheit, ist dies nicht der Fall, dann entsteht beim Kind Unsicherheit und es zieht sich zurück. Häufigere Schleifen von solchen Erwartungs-Erwartungen führen zu Generalisierungen und damit zu ersten Strukturbildungen. Man sollte unter pädagogischen Gesichtspunkten damit vorsichtig sein, man könne für das Kind irgendetwas ersetzen. Indem man mit ihm lebt und handelt, ergeben sich ständig spezifische Anlässe zu Wahrnehmungen und Generalisierungen, wie das Kind die Sprache mit ihrer Grammatik lernt, ohne über sie bewusst zu verfügen. Pädagogisch gewendet ist die Frage zu stellen, was Bezugspersonen zur Förderung dieser Entwicklung auf ein bestimmtes ideal gedachtes Ziel hin beitragen können. Darin erweist sich die Sonderstellung der Erziehungswissenschaft von der Soziologie und der Psychologie, die feststellen, welche Faktoren den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung unter subjekthaften und welche unter gesellschaftlichen Bedingungen beeinflussen. Die Erziehungswissenschaft bedient sich dieser Ergebnisse und stellt sie in den normativen Kontext der Förderung des Subjekts zu einer voll handlungsfähigen Person. Wenn ein Kind geboren wird, ist es zwar einerseits auf Pflege, Fürsorge, Zuwendung, Achtung und Anerkennung angewiesen, andererseits ist es ein eigentätiges, selbständiges Wesen, das eben auch nur überleben kann, weil es schon bestimmte Kompetenzen hat. Könnte es nicht atmen, saugen, würde es sterben. Darüber hinaus hat es aber ein klares Empfinden bezüglich dessen, was ihm wohl tut. Es reagiert sofort positiv auf Streicheln und reagiert negativ auf Situationen, die Unbehagen erzeugen. Es muss also schon von Anfang an die Interaktion mit dem Säugling als komplementär aufgefasst werden. Die Aktionen der Bezugspersonen müssen für das Kind anschlussfähig sein. Dann schließt es gerne an. Die Eigenaktivität des Organismus auf Entwicklung hin ist eine biologische Grundkonstante. Diese äußerst sich beim Menschen schnell in spezifischer Weise. Erfährt das Kind Achtung und Anerkennung, dann entwickelt es schon sehr bald soziales Handeln, beginnend mit dem sozialen Lächeln (Stern 19 ), in der Regel spätestens mit der 3. Woche. Schon in dieser ganz frühen Zeit kann es zu Defizitentwicklungen kommen, wenn das Kind zu wenig Achtung und Anerkennung erfährt. Es sollte von Anfang an klar sein, dass die Entwicklung der abgeleiteten Kompetenzen moralischen Urteilens von Anfang an je nach der Gestaltung der Interaktionen glücken oder scheitern können, entweder differenziert das Kind seine Möglichkeiten der Eigentätigkeit (Autonomie) aus, oder es gibt diese auf. Dasselbe gilt für alle anderen wesentlichen Merkmale des moralischen Urteils. Entweder das Kind kann 13 seine Bewertungsgrundlage in sich selbst behalten oder es wird von außen so überformt, dass es an sich zu zweifeln beginnt. Dass die Beziehung zum Säugling äußerst sensibel ist, zeugen die vielen neurotischen Karrieren von Personen, aber auch jene, die sich so angepasst haben, dass sie im Grunde sich selbst aufgegeben haben (vgl. Gruen 1986, 1990). Bei diesem Entwicklungskonzept des moralischen Urteils ist also die Dynamik des Glückens und Scheiterns integraler Bestandteil. Damit das Kind gegenseitige Anerkennung entwickeln kann, muss es gegenseitige Anerkennung erfahren, damit es autonom entscheiden kann, muss ihm Autonomie gewährt werden, damit es sich von Situationen betreffen lassen kann, muss es spüren können dürfen, was für es selbst gut ist. Um zu lernen möglichst viele Situations-, Person- und Kontextmerkmale in seine Entscheidungen aufzunehmen, muss es immer wieder in Entscheidungen einbezogen werden, in denen es sich selbst äußern kann. Speziell am Anfang der Entwicklung ist die emotionale Komponente von besonders großer Bedeutung. Aus Untersuchungen darf angenommen werden, dass zunächst die kognitive Entwicklung an das emotionale Reifen geknüpft ist. Zunächst gewinnt das Kind an der Bezugsperson, wenn sie zuverlässig ist, das Gefühl der Konstanz des „Objekts“ und damit das Bewusstsein von einer äußeren gestaltbaren Welt. Gerade das negative Beispiel, der frühkindliche Hospitalismus zeigt, welche Bedeutung positive emotionale Beziehungen für die Entwicklung haben. Die Qualität sozialer Beziehungen wird in verschiedenen Untersuchungen betont. So hat Warren (1994) nachgewiesen, dass blinde Kinder bedeutend früher nach der Mutter als nach Gegenständen greifen (vgl. Hackl 1997, S. 82) Die Moralentwicklung im eigentlichen Sprachgebrauch beginnt also schon mit der Geburt oder schon vorher. Es ist für die Beschreibung der Entwicklung zu zeigen, unter welchen umweltlichen Bedingungen jeweils die Entwicklung der einzelnen Merkmale steht. Es ist darauf zu achten, dass es nicht nur soziale Aspekte sind, über die wir „universale Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im Begriff einer Kompetenz gefaßt werden können“ (Aufenanger 1992, S. 11) erwerben, wenn auch dem sozialen Aspekt unwidersprochen das größere Gewicht zukommt. Die gegenständlichen Überlegungen gehen von einem Entwicklungsbegriff aus, der die psychischen Funktionen, über die der Austausch mit der Umwelt erfolgt und Welt angeeignet wird, in diesem Prozess als einander stützend und integrierend begreift. In jeder Handlung spielen immer alle Operationen – wenn auch jeweils unterschiedlich konstelliert und gewichtet – zusammen. Für die Förderung von Entwicklung bedeutet dies, dass jeweils auf die psychische Verfassung einer Person zu achten ist, um feststellen zu können, bei welcher Funktion zu einem gegeben Zeitpunkt am besten anzusetzen ist. Denn kognitive Entwicklung kann durch emotionale Probleme behindert werden, genauso aber auch durch einen Mangel an Aufmerksamkeit, also einer Entwicklungshemmung im Bereich der Funktion des Wollens. Wo für die Förderung der Entwicklung jeweils anzusetzen ist, werden erst mehrere Versuche zeigen können und es erweist sich als zielführend, jeweils mehrere Zugänge zu versuchen. 3.1 Merkmale einer Entwicklungstheorie Aufenenanger (1992) weist darauf hin, dass es in unserem Jahrhundert schon so viele differenzierte Entwicklungstheorien gibt, so dass sich die Definitionsversuche kaum noch überblicken lassen. Dazu gibt Ulich (1986) einen guten Überblick. In unserem Zusammenhang gilt es nur zu prüfen, wie weit die eigene Theorie nicht wichtige Differenzierungen vermissen lässt. Es wird auch notwendig sein, explizit auf die Theorie von 14 Piaget und Kohlberg Bezug zu nehmen, weil es gerade diese Theorien zu kritisieren gilt. Bei Piaget und Kohlberg finden sich mehrere Merkmale, durch die Entwicklungstheorien gekennzeichnet sind. Der zentrale Aspekt ist die Strukturgenese. In ihr wird Entwicklung „als eine Folge von Transformationen in qualitativ jeweils neue Strukturmuster, wobei die früheren Errungenschaften in die neuen Strukturen eingehen“ (Geulen 1981, S 545, zit. nach Aufenanger 1992, S. 90), verstanden. Diesen einzelnen Merkmalen nachzugehen, wird die eigene Theorie präzisieren lassen. 3.1.1 Genese und Struktur Entwicklung verläuft in einer Abfolge von immer ausbalancierteren Strukturen (die eine Ganzheit bilden) der Interaktion mit der Umwelt durch Transformation, die wieder Gesetzen folgt. Diese Transformationsregeln sichern die Möglichkeit der Selbstregulierung. Diese Regeln sind nach Piaget: Identität, Negation, Reziprozität. Der Strukturbegriff führt zum Theorem der hierarchischen Abfolge. Jede Stufe stellt eine strukturelle Ganzheit dar, die so zu einer umfassenderen Stufe transformiert wird, dass diese die weniger differenzierte Stufe in sich einschließt3. Problematisch ist, dass Piaget die Operationen an kognitive Strukturen bindet, wodurch es bei ihm voroperationale Stufen gibt, für die dann das formulierte Gesetz nicht gelten kann. Als strukturbildend dürfen also nicht nur Denkgesetze angenommen werden, sondern jede Form von Verallgemeinerung (Generalisierung), die auf nicht bewusster Ebene erfolgt, die schon mit der Geburt gegeben ist. Den Anfang der Strukturbildung sieht Piaget in der wechselseitigen Anpassung von Organismus und Umwelt. In diesem Sinn kann der Strukturbegriff universell verstanden werden. Wenn Piaget allerdings diesen Prozess wieder an das Denken koppelt, nimmt er eine unnötige Einschränkung vor. Aufenanger (1992) erklärt den Prozess der Entwicklung durch die Unterscheidung von retroaktiven und proaktiven Akten beim Aufbau von Welt (S. 175). In retroaktiven Akten werden Interaktionen mit der Umwelt rekonstruiert bzw. analysiert4, während in proaktiven Akten neue Regeln ausprobiert werden, die zu einer äquilibrierteren Stufe der Interkationen führen können. Beide Akte spielen bei der Interpretation von Welt und somit beim Aufbau der Welt des Kindes zusammen. Diesen Prozess konzeptualisiert Aufenanger (1992, S. 179) in gleicher Weise über die von Peirce (1973) eingebrachte Unterscheidung in Induktion, Deduktion und Abduktion, wobei letztere der neuen Einsicht, dem schöpferischen Einfall einer neuen Idee entspricht, also einem proaktiven Akt. In diesem Sinne bezeichnet Aufenanger (1992, S. 180) das Kind mit Recht als „rekonstruktiven Hermeneut“, was bedeutet, dass es alles intentional interpretiert. In der Terminologie von Franz Fischer (1985) heißt diese Unterscheidung Reflexion und Proflexion. Dass bei diesem Prozess emotionale Operationen immer auch begleitend auftreten, ist so offensichtlich, dass dies nicht weiter bewiesen zu werden braucht. Sowohl intra- als auch interindividuelle Faktoren sind maßgebend. Das Kind muss sich bei diesem Experimentieren sicher fühlen können und zu sich selbst Zuversicht gewonnen haben, damit es gerade in seinen ersten sechs Lebensjahren, in denen es im wesentlichen seine Welt aufbaut und die entscheidend für seine Entwicklung sind, eine sichere Basis aufbauen kann (vgl. dazu auch Piaget 1981). 3 4 Dieses Stufenkonzept wird von Flavell 1979 kritisiert. Nicht interpretiert, wie Aufenanger (ebd.) schreibt, weil Interpretation beide Akte einschließt. 15 3.1.2 Das Merkmal des streng hierarchischen Aufbaus der Operationen Dieses Merkmal gilt nur begrenzt, sofern nämlich Basisoperationen angenommen werden müssen, die erworben sein müssen, damit komplexere Operationen aufgebaut werden können. So ist die Operation der Konstanz von Flüssigkeiten, der Konstanz des Gewichts, des Volumens erst möglich, wenn es dem Kind möglich ist, mindestens zwei strukturell verbundene Merkmale – der Flüssigkeitspegel sinkt, wenn die Basis des Gefäßes eine größere Flache bekommt – als solche zu erfassen. Anders verhält es sich bei anschaulichen Merkmalen wie Kugeln verschiedener Größe und Farbe. Bei dieser Aufgabe handelt es sich um eine Zentrierung auf ein Merkmal. Beim früheren Beispiel aber müssen die beiden Merkmale in ihrer Abhängigkeit erkannt werden. Die Tätigkeit des Umgießens mehrmals durchgeführt reicht noch nicht aus, um dieses Koppelung zwischen zwei abhängigen Größen zu erfassen. Wie häufig muss die Tätigkeit durchgeführt werden, bis das Kind die Einsicht bekommt. Wenn aber das Kind bereits in der Lage ist, Zusammenhänge zwischen abhängigen Merkmalen zu erkennen, dann können beliebige Merkmale in unterschiedlichen inhaltlichen Bereichen miteinander verknüpft werden. Zum Beispiel kann dann die vorher beschriebene Aufgabe der Gleichheit der Flüssigkeitsmenge genauso gelöst werden, wie Aufgaben, die sich auf Strafen, Konventionen oder Gerechtigkeitsfragen beziehen. Dann lässt sich nämlich zeigen, dass Fragen der Bestrafung, der Konvention, der Gerechtigkeit usw. innerhalb anderer Dimensionen liegen, die alle mit Fragen der Moral gekoppelt werden können, aber nicht genuin moralisches Handeln definieren. So gesehen ist der durchgängige hierarchische Aufbau von Wissensstrukturen, aber auch von Strukturen innerhalb der anderen psychischen Funktionen ein aufzuhebender Mythos. Um diese Strukturen zu verstehen, wären genaue Analysen vorzunehmen, die zeigen, auf welchen Basisoperationen komplexere Operationen aufbauen und wie die Linerarität der Entwicklung in Verzweigungen übergeht. Unterschiedliche Operationen koppeln sich zu verschiedenen Mustern, die dann jeweils komplexere Operationen bilden. Dies gilt sowohl innerhalb einer Funktion, z. B. der Wahrnehmung, gilt aber auch zwischen den Funktionen. Basisoperationen der Wahrnehmung verbinden sich mit solchen des Denkens und des Fühlens wie des Wollens – prinzipiell mit allen Basisoperationen aller Funktionen. 3.2 Regeln und Metaregeln Hirnphysiologische Untersuchungen in Verbindung mit Computersimulationen über die unterschiedlich leistungsfähige Netzwerke experimentell geprüft werden können, legen nahe, dass das komplex vernetzte Hirn ohne bewusste Regelbildung selbständig Regeln bildet (Spitzer 1997). Metaregeln wären dann solche, die Regeln über die Regeln bilden. Dies scheint formale Akte des Denkens voraus zu setzen. Bis hin aber zu den konkreten Operationen im Sinne von Piaget lassen sich automatisch generierte Regeln vorstellen. Unabhängig davon, wie sich dies hirnphysiologisch verhält. Unterscheidung zwischen impliziten und expliziten Regeln (Polanyi 1985). 3.3 Kompetenz und Performanz oder Hindernisse der Umsetzung Es kann nun dazu kommen – und es kommt dazu leider allzu häufig - , dass die Entwicklung der Kompetenzen in der Regel durch Behinderungen der Funktionen des Fühlens und Wollens, die eben auch mit Motivation zu tun haben, nicht nur gehemmt wird, sondern eine Person auf frühere Operationen zurück fällt bzw. unbewusst zurück greift. Die Gründe dafür können sowohl interaktions-, kommunikations- oder bindungstheoretisch, als auch auf einer 16 komplexeren Ebene sozialisationstheoretisch bzw. sozialisationsökologisch (Bronfenbrenner 1976) untersucht werden. Siehe in diesem Zusammenhang auch die Unterscheidung von regulativen und konstitutiven Regeln nach Searle (1971) zit. bei Aufenanger (1992, S. 62) Fassen wir nochmals die Faktorengruppen zusammen, die für eine Theorie der Entwicklung des moralischen Urteils von Bedeutung sind: 4 Entwicklungsdynamik 2: Entwicklung des moralischen Urteils als Entwicklung der Prädikate des moralischen Urteils für sich und in ihrem Kontext Moral ist kein Endstadium einer Entwicklung wie bei Piaget oder Kohlberg. Wird moralische Entwicklung auf diese Weise gefasst, dann gibt es vorethische Stadien, bzw. Stadien, die genau das Gegenteil von Moral sind, die heteronome Phase bei Piaget oder die Stufen bei Kohlberg bis hin zur eigentlichen Stufe von Moral, der prinzipiengeleiteten Perspektive. Was sich entwickelt bzw. was bei der Entwicklung des moralischen Urteils verfolgt werden muss, sind das moralische Bewusstsein selbst, bzw. die ein moralisches Urteil definierenden Merkmale, in den sie repräsentierenden psychischen Operationen. Diese Entwicklung wird – wie die Entwicklung anderer menschlicher Fähigkeiten, z. B. Leistung – durch Umweltfaktoren gefördert oder gehemmt. Natürlich können dies sehr unterschiedliche Faktoren sein. Im besonderen wird von Moraldefinitionen her zu fragen sein, wie weit sich gegenseitige Anerkennung entwickelt hat und wodurch eine solche Entwicklung gefördert werden kann (1). Je nachdem, welchen Grad der Ausprägung gegenseitige Anerkennung erreicht hat, wird sie bezogen auf alle Sozialperspektiven, die eine Person einnehmen kann, stärker oder schwächer sein bzw. wird eine Person bestimmte Sozialperspektiven bevorzugen (2), auch wenn sie nach ihrer kognitiven Kompetenz auch schon weitere Sozialperspektiven übernehmen könnte (3). In Abhängigkeit davon wird eine Person mehr oder weniger Betroffenheit von Situationen zeigen, die stärker ichbezogen sind oder stärker im Ich-Du-Bezug stehen. Im Sinne der Moralentwicklung kann 1. an der Betroffenheit von Situationen und der Sensibilität für sie angesetzt werden, 2. an der kognitiven Fähigkeit, Situationsmerkmale in ihren Konsequenzen für andere Personen aber auch für die Umwelt, was indirekt wieder Personen betrifft, abzuwägen. Die kognitive Fähigkeit steht in Zusammenhang mit der Betroffenheit von Situationen, weil immer auch Bewertungsprozesse eine Rolle spielen. Natürlich muss grundsätzlich die Fähigkeit gegeben sein, komplex und vernetzt zu denken. Um tatsächlich die Entwicklung des moralischen Urteils in seiner Dynamik verfolgen zu können, müssen die philosophisch gewonnenen Merkmale in psychische Operationen übersetzt werden, wie sie sich im alltäglichen moralischen Handeln zeigen. Dabei wird in zwei Schritten vorgegangen. Zunächst werden die Operationen dargestellt, die das jeweilige Merkmal moralischen Handelns in seiner Vollfunktion beschreiben, um dann in einem zweiten Schritt zu zeigen, auf welchen basalen Operationen diese aufbauen, deren Entwicklung dann jeweils bis zu ihrem Ende hin verfolgt wird. 4.1 Gegenseitige Achtung und Anerkennung – Verstehen und Perspektivenübernahme Weder Verstehen noch Perspektivenübernahme ist ohne Reversibilität möglich. Daher ist sie eine Basisoperation, die darin besteht, dass eine Person in der Lage ist zu erkennen, dass ein 17 Vorgang, eine Operation umkehrbar ist. In der einfachsten logischen Form heißt dies, dass wenn a gleich b ist, dann ist b gleich a. Auf Handlungen bezogen heißt es, dass wenn ich eine Handlung umkehre, dass dann wieder der Ausgangspunkt erreicht ist, innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen, dass ich gegenüber einen Anderen in gleicher Weise handle, wie ich möchte, dass er mir gegenüber handelt und umgekehrt. Kohlberg (1979, siehe Aufenanger 1992, S. 134, S. 168) hat die Entwicklung von Reversibilität beschrieben, allerdings auf eine Weise, wie in dieser Beschreibung wieder deutlich wird, dass bei ihm Entwicklung nicht mit der Beobachtung von Kindern zu tun hat, sondern mit einer Konstruktion. Denn wenn er die Stufe 1 „als eine rein mechanische Reziprozität, auf der die Lösung moralischer Konflikte unter dem Aspekt der konkreten Gleichheit von Handlungen gesehen wird“ (Aufenanger 1992, S. 134) und dies auch gleich mit dem alttestamentlichen „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ vergleicht, dann beschreibt er Erwachsenenverhalten. Außerdem konstruiert er Reversibilität in gleicher Weise nach wie die Perspektivenübernahme in seinen Stufen der moralischen Entwicklung. Kohlberg beschreibt aufeinander aufbauende Konzepte und nicht Entwicklung. Er hat seine Daten ja auch tatsächlich von älteren Kindern und Erwachsenen gewonnen. Im Bereich der Perspektivenübernahme folgt die kognitive der sozial-emotionalen Entwicklung. Sie verläuft von der idealtypisch gedachten Symbiose mit einer Bezugsperson, über die Primärgruppenperspektive und Sekundärgruppen- oder Systemperspektive bis zur Möglichkeit der Einbeziehung potentiell aller Menschen (vgl. Selman 1984). In klinischen Untersuchungen hat v. a. der Kinderpsychiater Hellbrügge in München an deprivierten Kindern gezeigt, wie sehr bei Repression ihre Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung von anderen eingeschränkt ist. Ihre Möglichkeit soziale Beziehungen aufzunehmen war anfangs fast unmöglich. Zu gleichen Ergebnissen kamen auf klinischer Ebene Robert Kegan (1986) und Arno Gruen (1986, 1990). Nach letzterem führt Macht im Gegensatz zu Liebe zur Abspaltung der Gefühle nach innen oder nach außen. Die Folge davon sind entweder Neurosenbildungen oder völlige Anpassung, die er als „Wahnsinn der Normalität“ (1990) bezeichnet. Menschliches Leben – wie überhaupt Leben – will erhalten werden. Den anderen vom eigenen Standpunkt überzeugen zu wollen, bedeutet nicht gegenseitige Anerkennung. Diese bedeutet vielmehr, die Überzeugungen der anderen verstehen zu wollen. Die Entwicklung von Anerkennung hat die Eigenart, dass sie sich nur entwickelt, wenn man in seiner Kindheit Anerkennung erfahren hat. Wenn sich Menschen anerkannt fühlen, können sie sich freier, selbstbewusster, bei sich bleibend und damit originär äußern. Anerkennung in schulischen Situationen würde bedeuten, dass alle ihr Zusammenleben frei und demokratisch gestalten, die Regeln für ihr Zusammenleben in gegenseitiger Anerkennung aushandeln. Dadurch entsteht eine gute Gesellschaft. Empirisch konnte dies Monika Keller (1976) nachweisen. Die sozio-affektive Dimension elterlichen Erzieherverhaltens – ausgedrückt in Wärme und Unterstützung – hat für die Fähigkeit zur Rollenübernahme große Bedeutung (vgl. Aufenanger 1992, S. 123).5 Das Leiden des Anderen (Metz 19..) als Ausgangspunkt für moralisches Handeln zu wählen, ist eine Minimalforderung. Die Kantsche Forderung, die Glückseligkeit des anderen befördern zu wollen, steht am anderen Pol. Sensibilität für die Bedürfnisse der anderen zu entwickeln wird auf jeden Fall Bedingung sein. Je sensibler eine Person aber für seine Bedürfnisse ist, Weitere empirische Belege siehe in Datei „Kompetenz“, in der das Moralurteil förderliche Bedingungen beschreiben werden. 5 18 desto besser wird er sie auch bei anderen spüren. In diesem Kontext kann auf die Skalierung von Tausch/Tausch (1977) zurück gegriffen werden. Kommt eine Person nicht zu gegenseitiger Anerkennung, wird sie einen Standpunkt einnehmen, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die Person sich als Mittelpunkt aller Überlegungen sieht und Subjekte wie Objekte betrachtet, d. h. sie für ihre eigenen Zwecke instrumentalisiert. Dies ist vermutlich zur Zeit immer noch die häufigste Erscheinungsform in der Wirtschaft, im Verhältnis von Leitern und Mitarbeitern. In der öffentlichen Verwaltung erfolgt die Instrumentalisierung der Mitarbeiter mediatisiert über Gesetze. Dadurch mag ein gemilderter Eindruck dieses Standpunkts entstehen Es gibt zwei moralische Theorien, deren Axiome von einem solchen Standpunkt ausgehen, der Hedonismus und der niedere Utilitarismus, deren Grundsatz das eigene größtmögliche Wohl bzw. der eigene größtmögliche Nutzen auf Kosten der Anderen ist. Diese Form des Hedonismus bzw. Utilitarismus wird zwar heute theoretisch nicht mehr vertreten, wenn auch bei einzelnen Liberalen dieser Standpunkt immer noch durchkommt, aber als Lebenspraxis dürfte sie nicht selten vorkommen. Untersuchungen dazu wären interessant. 4.1.1 Analyse gegenseitiger Anerkennung Person A anerkennt Person B und umgekehrt. Dies ist die einfachste analytische Formel. In Wirklichkeit sind es immer mehrere Personen, potentiell alle Menschen, die der Anerkennung bedürfen. Anerkennung ist so als zweistelliges Prädikat definiert, wobei jedoch an der Stelle der Verbalphrase potentiell alle Menschen stehen könnten. Der Sachverhalt wird aber nochmals komplexer, wenn man bedenkt, dass die Anerkennung des Anderen/der Anderen immer auch bedeutet, ihn in allen seinen Lebensbezügen, die er braucht, anzuerkennen, andernfalls bliebe die Anerkennung abstrakt. Dadurch wird das Prädikat dreistellig: Jemand erkennt einen anderen mit all seinen Lebensbezügen an. Zur genauen Bestimmung von Anerkennung einer Person müssen wir also zumindest alle jene Merkmale noch anführen, die zu ihrer Integrität in dem Sinne gehören, dass wir nicht sagen könnten, wir würden einen Anderen anerkennen, wenn wir nicht auch das zu seinem Leben Gehörige anerkennen. Dazu zählt zumindest all das, was Personen brauchen, um sich physisch und psychisch wohl zu fühlen, aber auch, was sie dazu brauchen, um ihr Leben bestmöglich zur eigenen Vervollkommnung hin zu gestalten. Jeder braucht eine Position in einer Referenzgruppe, um sich sicher zu fühlen. Daraus ergibt sich an jeder Stelle der Ableitung eine Fülle von Fragen, die alle im Blick auf die Anderen bzw. mit den Anderen diskutiert werden müssen, weil sonst die Anwendung der Regel formal bleibt. Noch dazu laufen alle diese Diskussionen unter der Bedingung der Begrenztheit von Gütern ab. Aber genau unter der Beachtung dieser Bedingungen wird das Prinzip gegenseitiger Anerkennung konkret und erweist sich als notwendiges Merkmal der Bestimmung moralischen Handelns. Gegenseitige Anerkennung kann also nur real werden, wenn das Leben der Anderen in all seinen Bezügen geachtet wird, aber auch, dass sie sich frei äußern können und jeder sich innerhalb des frei anerkannten Rahmens bewegen kann. Dies wäre nicht ein für alle Male zu beschließen, denn dann kämen wir in die Sphäre des Rechts bzw. der Politik, sondern je und je neu zu bedenken und auszuhandeln. Ausüben von Gewalt in welcher Form immer, auch in der Form der Einschüchterung, der Manipulation, ist ausgeschlossen. Der „herrschaftsfreie Dialog“ in gegenseitiger Anerkennung ist Bedingung für die Ableitung von moralischen Urteilen, von Wertaussagen und moralischem Handeln als Form. Der Inhalt kommt erst aus den Vereinbarungen über ein gutes Zusammenleben unter dem gegebenen faktischen Rahmenbedingungen gruppen-, gemeinschafts- und (welt)gesellschaftsbezogener Art. Die 19 historischen so und so gewordenen Gegebenheiten sind das Material, das in gegenseitiger Anerkennung darauf hin zu befragen ist, wie es geordnet werden müsste. Bei all diesen Überlegungen wird deutlich, dass die gesamte Realität niemals gedanklich eingeholt werden kann, wohl aber haben Handeln und Sprache „einen zwischenmenschlichen Mehrwert und Überschuß, der über alles in ihr Gesagte hinausgeht“ (Miething 1991, S. 206). Miething fährt weiter fort: „Reden ‚über’ ist dem Unendlichen des Lebendigen im anderen Menschen oder des Transzendenten nicht angemessen.“ (a. a. O., S. 209) Ebenso könne man den Charakter der Ich-Du-Beziehung nicht erfassen, ohne den moralischen Charakter in dieser Beziehung. Die Gegenseitigkeit allein reiche nicht aus, die Ich-Du-Beziehung heraus zu arbeiten (a. a. O., S. 211). Drückt man Gegenseitigkeit über die Formel „Wie du mir, so ich dir“ aus, dann bleibt Gegenseitigkeit formal, kann unmoralisch werden, denn das heißt ja auch, wenn mir jemand ein Unrecht zufügt, zahle ich es ihm in gleicher Münze heim. Dieser Grundsatz begründet höchstens einen schlechten Rechtsbegriff, denn auch das Recht will dazu beitragen, dass Individuen sich nicht immer weiter verletzen, sondern will nur dem Recht schaffen, dem Unrecht geschah oder geschieht, Recht konstituiert sich erst auf dem Grund gegenseitiger Anerkennung im Sinne der Anerkennung der formalen Gleichheit aller Individuen. Wie ich meine Integrität anerkannt wissen möchte, erkenne ich die Integrität des Anderen an. So gesehen konstituiert sich auch Recht nicht über ein Sollen, sondern über die Übereinkunft, den Anderen so weit gelten zu lassen und ihm so viel Freiraum zu geben als er braucht, sofern er nicht meinen Freiraum einschränkt. Das Recht regelt also Freiräume von Individuen, was dann nötig wird, wenn sich (1) das soziale Gebilde so kompliziert hat, dass die Individuen nicht mehr untereinander ihre Handlungsräume selbst abstecken können oder (2) einzelne über andere Macht ausüben wollen. In kleinen, für den einzelnen überschaubaren Vergesellschaftungen braucht es daher kein formales kodifiziertes Recht, es genügt die Sitte oder bei Übergriffen einzelner, Sanktionen bis hin zum Ausschluss aus der Gemeinschaft, wenn gegenseitige Anerkennung nicht in einem angemessenen Rahmen zu erwarten ist. Dies setzt einen Konsens über das gegenseitig Anerkennenswerte hinaus oder noch besser faktische gegenseitige Anerkennung voraus. Ist diese nicht gegeben, dann beginnt man darüber nachzudenken, was konsensfähig ist oder sein könnte oder – in total pluralistischen Gesellschaften - sein müsste. Gegenseitige Anerkennung bekommt eine ganz andere Qualität, wenn sie die Anderen auch sofern im Blick hat, als die Anderen vielleicht nur im Moment, vielleicht auch auf Dauer zu ihrer Entwicklung ein Mehr an Fürsorge, ein Mehr an Handlungsspielraum brauchen als ihnen unter dem Aspekt formaler Tauschbedingungen zustehen würde. Das Verhältnis Ich-Du wird dann asymmetrisch – aber nicht im Sinne von Macht – sondern der Gewährung. Ein Ich gewahrt ein Du als Du und sieht, dass Du etwas braucht und gewährt es. Es kommt mit der formalen Anerkennung das Achten in den Blick. Nicht die bloße Beachtung, sondern auch die Achtung und Fürsorge wird angesprochen. Die Beachtung ist nur Bedingung, geht voraus. Aber das Beachten bekommt erst aus der Achtung und dann auch Wertschätzung die Qualität, die Du sich äußern lässt, dass die Beachtung das Gute erfährt. Damit sind die Bedingungen für die Entwicklung zur Anerkennung des Anderen: Anerkennung, Achtung des anderen Verstehen des anderen ihm Vertrauen schenken den Willen des anderen respektieren Einbeziehen in Entscheidungen, auch wenn sie zunächst gefühlsmäßig getroffen werden Auffordern, Entscheidungen zu treffen, Motive zu erfassen, Folgen zu bedenken Hilfe beim Abwägen der Folgen 20 eigene Entscheidungen begründen, ein Nein oder Sanktionen sind begründungspflichtig die Argumente des anderen ernst nehmen, ihn um Argumente fragen je und je volles Menschsein zur Darstellung bringen helfen Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Es zeigt sich jetzt schon deutlich, was gemeint ist. Einen Säugling hat man im Sinne dieser Entwicklung schon unterstützt, wenn man ihn anlächelt, ihn massiert, sein differenziertes Schreien beachtet. Informationen über den anderen, seine Einstellungen und Denkweisen Wahrnehmen seiner selbst und des anderen Klärung des eigenen Vorverständnisses Nachvollziehen der Logik des anderen, seiner inneren Welt, die er im Laufe seiner Lebensgeschichte gewonnen hat und wozu er in ihr geworden ist einfühlendes Verstehen des anderen iterativer Deutungsprozess – Verstehen 4.1.2 Die Vorstellung von gut Bis Kinder etwa 10 Jahre als sind, erklären sie das was gut ist, mit Beispielen, d. h. mit konkreten Eigenschaften von Personen oder Dingen oder mit konkreten Situationen. Damit zeigen sie, dass sie zwar intuitiv wissen, was gut ist, aber sie können es nicht explizit sagen. Erst Kinder, die formal operieren können, fassen gut als gut, können einen Allgemeinbegriff von gut geben. Handlungen werden als solche gesehen und daher an sich gut oder schlecht beurteilt. Die Begründung erfolgt zirkulär. Man macht etwas nicht, weil man so etwas nicht macht, „man ist doch nicht so gemein“. „Gemein“ ist eine Substitution für „schlecht“. Auch werden positive oder negative Handlungen mit Gefühlsausdrücken belegt und durch sie begründet. Man ist traurig, man fühl sich gut oder nicht gut. Handlungen, bei denen man sich nicht gut fühlt, sind schlecht, bei denen man sich gut fühlt, sind auch gut. Kinder begründen Handlungen als gut, weil mit ihnen Angenehmes oder Unangenehmes verbunden ist. 9jährige Kinder begründen aus der Sozialperspektive der Gruppe. Es gelingt ihnen noch nicht über die Gruppe, in der sie sind, hinaus zu denken. Die Gruppe als Gruppe kommt noch nicht in den Blick. 4.2 Autonomie Aus Heteronomie kann nicht Autonomie entstehen, wie das bei Piaget und Kohlberg der Fall zu sein scheint. Es müssen daher die autonomen Äußerungen des Kindes von der Geburt an aufgedeckt werden, um den Prozess moralischer Entwicklung zu erfassen und fördern zu können. Die sg. +1-Regel nach Blatt/Kohlberg (1975, vgl. auch Oser/Althof 1992), dass bei der Förderung der Entwicklung des moralischen Urteils Argumente, Begründungen auf der nächst höheren Stufe vorgelegt werden müssten, würde den Prozess der Entwicklung in unserem Sinn hemmen, weil nicht moralische Argumente benützt werden. Diese gibt es definitionsgemäß erst auf der Stufe 5. Also nur Personen, die auf dieser Stufe stehen, könnte die Regel nützen. In unserer Bedeutung des moralischen Urteils ist vielmehr danach zu fragen, welche autonomen Äußerungen, Bestrebungen des Kindes zu einem klaren Bewusstsein der genuinen Dimensionen des moralischen Urteils führen. Im Prinzip sind es die Einbeziehung des Kindes in moralische Entscheidungen und die Hilfe bei der Erweiterung seiner Handlungsräume über die erste Technik. 21 Lebensgeschichtlich dürfen wir davon ausgehen, weil es eine anthropologische Konstante ist, dass das Kind zunächst die Bewertungsgrundlage für sein Tun in sich selbst hat. Wir setzen ein Selbst ohne Selbsttäuschung voraus. Verzerrungen der Wahrnehmung entstehen erst im Laufe missglückter, durch Macht bestimmter Interaktionen (vgl. dazu Rogers’ (1973) humanistisches Bild der Persönlichkeitsentwicklung und Gruens (1986) Psychodynamik der Abspaltung der Gefühle). Der autonome moralische Mensch will sich nicht täuschen und täuschen lassen. Er wird in allen Entscheidungen darauf achten in gegenseitiger Anerkennung das Eine, Wahre, Gute und Schöne in sich zu verwirklichen, nicht aus Pflicht sondern aus eigenem Wollen. Die Entwicklung zur Autonomie gerade beim kleinen Kind ist an Sicherheit, die bei Anerkennung gegeben ist, gebunden. In unsicheren Situationen wagt sich eine Person nicht aus sich heraus, fragt, forscht, untersucht nicht (siehe die Aussagen unter dem vorigen Kap.). Offenheit, die wiederum Sicherheit usw. voraussetzt ist auch für den Ausdruck jeder Art von Bedeutung. Fritz Oser (1981) hat in einer groß angelegten Untersuchung (1200 Schüler im Alter von 15 Jahren in 42 Klassen) Interaktionen in Gruppen bei der Lösung moralischer Probleme auf dem Hintergrund des Stufenkonzepts von Kohlberg beschrieben: Er unterscheidet vier Stufen, die sich auch empirisch bestätigten. 1. Funktionale Stufe: Die Mitglieder der Gruppe sind allein am Ergebnis ohne systematische Legitimation orientiert. 2. Analytische Interaktionsstufe: Die Lösung eines Problems wird auf der Faktenebene gesucht. 3. Normative Interaktionsstufe: In die Problemlösung werden moralische Regeln und Prinzipien einbezogen. Normen werden diskutiert und hierarchisiert. 4. Philosophische oder authentische Interaktionsstufe: Die Gruppe konzipiert eine Theorie gerechten Handelns, die Universalität beansprucht (vgl. Aufenanger 1992, S. 159 f.). Es zeigt sich, dass in einer Gruppe von gleichaltrigen Schülern alle Weisen des Argumentierens von einer funktionalen bis zu einer prinzipiengeleiteten, nach Universalität strebenden Form verwendet werden. Interessant wäre nun festzustellen, von welchen Faktoren sowohl die Kompetenz als auch die Performanz der Argumentation abhängig ist. Oser konnte in seiner Untersuchung nur einige Aspekte zur Klärung bringen, die er an die Interventionen bindet, die in den Gruppen gemacht wurden. Es waren drei Interventionen in unterschiedlichen Gruppen: 1. Es werden Informationen zur Differenzierung der Fakten gegeben, die mit dem Problem verbunden sind. Es handelt sich also um eine Stimulierung zu höherer kognitiver Komplexität. 2. Es werden unterschiedliche Gerechtigkeitsregeln vorgelegt, die mit Kohlbergs Stufenschema korrespondieren. 3. Es wird eine Strategie zur Lösung des moralischen Problems vorgelegt Die Studie zeigt, dass in erster Linie die Vorgabe von Gerechtigkeitsregeln zu einer höheren Interaktionsstufe führen. Bedenken und Prüfung von Erwartungen von außen – Modifikation der Erwartungen nach selbst gewählten Motiven. Aus sozialen Interaktionen entwickelt sich das Selbst (Noam 1993, S. 174) Bedenken/Reflexion der Trieb-/Bedürfnisansprüche von innen Integration von Körper/Seele/Geist sich selbst definieren – in sich einfühlen Selbstverpflichtung 22 selbst die eigenen Entscheidungen verantworten aufmerksames Gewahrsein des Prozesses Selbstbewußtsein, Selbstgewahrsein 4.3 Das Abwägen der Folgen von Entscheidungen Dabei handelt es sich zunächst um eine kognitive Funktion. Es ist die Frage, wie viele Merkmale Kinder von ihrer kognitiven Entwicklung her zur gleichen Zeit in Erwägung ziehen können. Wie viele Elemente also können gleichzeitig beachtet, in der Aufmerksamkeit behalten werden? Daran zeigt es sich, dass Kognition auch etwas mit dem Wollen zu tun hat. Kann ein Kind in der von Piaget gestellten Situation, ob ein Freund weiterhin Freund bleiben kann, auch wenn er einen Diebstahl begeht und der Diebstahl negativ bewertet wird, beide widerstreitenden Merkmale im Auge behalten? Zunächst sieht das Kind nur den Freund oder nur den Diebstahl und je nach dem worauf es im Moment die Aufmerksamkeit gerichtet hat, kann der Freund bleiben oder nicht. Erst wenn das Kind gelernt hat, beide Momente in der Aufmerksamkeit zu halten und damit in der Lage ist, sie gegeneinander abzuwägen, kann ein Freund trotz Diebstahl Freund bleiben. Das Begreifen von Einstellungsobjekten oder von Werten ist in seiner Entwicklung von einer undifferenzierten nur ein Merkmal einschließenden Vorstellung bis hin zu einer differenzierten, hochäquilibrierten, potentiell alle Situations- und Personmerkmale umfassenden Vorstellung zu beschreiben. 4.4 Betroffenheit Gertraud Nunner-Winkler (1991) konnte in eigenen Untersuchungen feststellen, dass die unmittelbare Betroffenheit von einer Sache ausschlaggebend für die moralische Orientierung (im Sinne von Giligan) ist (S. 132) Aufmerksamkeit sich in sich einfühlen – offen sein für die Situation, sich von der Situation so ansprechen lassen (zweckmäßiges Wahrnehmen), dass man sich quasi durch sie zur „guten Tat“ drängen lässt. der oben genannte iterative Deutungsprozess ist auch um des Anderen willen gewollt – „Nichts ist gut als allein ein guter Wille.“ (Kant) sich der Situation aus tiefer existentieller Erfahrung aus einem inneren Gefühl stellen 4.5 Universalisierung Universalisierung ist sowohl an das Subjekt als auch an den Diskurs gebunden. Damit sind unterschiedliche Operationen zu aktivieren. Es ist unerlässlich, einerseits die Frage zu stellen, ob eine bestimmte Handlungsmaxime, d. h. ein als gut erkanntes Handlungsmotiv zunächst aus einer subjektiven Einsicht, dann aus der Sicht von Partnern, schließlich aus der fiktiven Sicht potentiell aller Menschen, die dieser oder ähnlichen Handlungsmaximen gefolgt sind, gut ist und damit universalisierbar. Aus subjektiver Sicht folgt, dass der Einzelne für sich selbst prüfen muss, welche Folgen seine Entscheidung für andere hat. Aus der Sicht der Diskurspartner heißt dies, der Einzelne muss bereit sein, die Abwägungen und Einschätzungen anderer über die Folgen einer Entscheidung in seine Überlegungen einzubeziehen. Das Individuum soll bei der eigenen Prüfung seiner Entscheidung die Sicht anderer nicht vernachlässigen oder gar negieren. Außerdem könnte ein Individuum zu einem gegebenen Zeitpunkt für sich eine bestimmte Handlungsmaxime bevorzugen und eine andere 23 bessere übersehen. Unter diesem Gesichtspunkt beseht sogar die Pflicht, auf mögliche andere Handlungsmaximen oder Entscheidungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Da sich Menschen grundsätzlich immer täuschen können, ist jede Möglichkeit des Findens universalisierbarer Handlungsmaximen zu ergreifen. Universalisierung fordert noch eine weitere Kompetenz, nämlich die Handlungsfolgen für alle Menschen auf der ganzen Erde und für die Zukunft zu bedenken. Sich Entscheiden erfordert das aufmerksame, kognitive Abwägen der Folgen einer Entscheidung. das Herstellen einer Beziehung zwischen der Entscheidung und der inneren Gewissheit der Übereinstimmung zwischen der Entscheidung und der Idee eines guten Zusammenlebens. Da Universalisierung wegen der Komplexität der Welt theoretisch niemals möglich ist, ist diese intuitive Überprüfung nötig: Wurde die Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen gefällt. Da moralische Entscheidungen immer Personen betrifft, besteht die Verpflichtung, wenn es möglich ist, sich zu vergewissern, ob der andere sich in der Entscheidung voll berücksichtigt weiß. Damit muss die Entscheidung für den anderen/die anderen nachvollziehbar sein. 5 Gutes gesellschaftliches Zusammenleben als Kriterium für Rationalität Angenommen, es ließen sich Kriterien, Bedingungen für Handlungsentscheidungen, die ein gutes Zusammenleben ausmachen, formulieren, dann müssten doch alle, mit denen man kommunizieren kann, gefragt werden, ob sie damit einverstanden sind. Denn dies erfordert das Kriterium gegenseitiger Anerkennung. 5.1 Postmoderne und Ethik Es ist beliebt geworden, Moral und Ethik als überständig abzutun. Es sei das gut, was Individuen für sich einfach tun wollen, ohne nach einer Legitimation danach zu fragen. Eine Legitimation gäbe es ohnehin nicht. Die großen Systeme der Ethik wie die Kants, Fichtes oder gar Nicolai Hartmanns materiale Wertethik als Ausdruck der Moderne gehörten der Vergangenheit an. Zur einzigen moralischen Regel einer Ausprägung der Postmoderne ist eine indifferente Toleranz geworden, und es gilt als einzige moralische Quasiregel, Individuen das tun zu lassen, was sie tun wollen, eine Regel, die eigentlich keine Regel ist, weil sie nichts regelt, sondern nur ein Nichtstellungnehmen auferlegt. Dies allerdings hinterlässt ein Unbehagen, denn bei einer solch indifferenten Haltung lässt sich nichts kommunizieren, zu einer gemeinsamen Sache machen. Sich vereinzelnde und vereinzelte Individuen fühlen sich nicht glücklich, geraten in neurotische, wenn nicht psychotische Depression. Diese nimmt in einem epidemischen Ausmaß zu. Eine Zeit des Après-Devoir, in der man nichts mehr soll oder gar muss, wie sie Gilles Lipovetsky (zit. nach Zygmunt Bauman (1995) herbeisehnt, kann einerseits als Befreiung von letzten Überresten von Geboten und Pflichten gefeiert werden, andererseits ist eine derartige Sicht der Dinge zynisch, denn leisten könnten sich das nur einige wenige oder diese Wenigen würden sich wundern, wenn sie nicht mehr auf ihre liebgewordenen Infrastrukturen zurückgreifen könnten. Gegenüber Auswüchsen schulbürokratischer Regelementierungen (mehr Verordnungen als Tage im Jahr) könnte man wohl diese Haltung einnehmen. Dann allerdings wird Moral nicht an sich abgewehrt, sondern nur die Übergriffe gegen Wünsche, sich selbst autonom zu regeln. 24 Aus diesen Überlegungen ergeben sich zwei Ansätze über Moral zu sprechen: 1. Kommunikation, Zusammenleben will Verbindlichkeiten, die nicht von außen vorgegeben werden, sondern von den Individuen selbst eingegangen werden wollen. 2. Nicht das Sollen ist die grundlegende ethische Kategorie, sondern das Wollen. Das Sollen konstituiert Recht und nicht Moral. Moral wird durch den Willen sich selbst verpflichtender Individuen in symmetrischen, kommunikativen Prozessen konstituiert. Pädagogen stehen in besonderer Weise immer wieder vor Entscheidungen, wie sie in einer bestimmten Situation handeln wollen. Entscheiden hat Bewerten zur Bedingung. Das bedeutet, sie müssen sich ihrer Bewertungen bewusst sein, wollen sie ihre Entscheidungen transparent und vermittelbar kommunizieren. Aus der postmodernen Vorstellung, wie sie von Zygmunt Bauman (1995, S. 57 f.) vertritt, „Moral aus dem steifen Panzer künstlich konstruierter ethischer Codes herauszulassen“ folgt, was der modernen Auffassung entspräche, Moral zu repersonalisieren. Moralische Verantwortung muss wieder dort angesiedelt werden, wo Entscheidungen getroffen werden und dieser Ort ist das Individuum oder sind vergesellschaftete Individuen. Dieser Anspruch kann unter moralischen Gesichtspunkten nur befürwortet werden, er ist allerdings problematisch, wenn damit der Anspruch auf Universalisierung abgelehnt wird. Universalisierung meint nicht unbedingt wie es Bauman vertritt, dass jeder Mensch dazu gezwungen sei, eine moralische Regel für unbedingt verpflichtend zu halten, sondern meint, dass, wer eine moralische Entscheidung trifft, ihre Konsequenzen für potentiell alle Menschen berücksichtigen müsste. Dies ist aber wohl der Anspruch jedes moralisch denkenden Menschen. 6 Literatur Anzenbacher, Arno: Einführung in die Ethik. – Düsseldorf: Patmos, 1992 Aufenanger, Stefan: Entwicklungspädagogik. Die soziogenetische Perspektive. – Weinheim: Deutscher Studien Verlag, 1992 Baumann, Zygmunt: Postmoderne Ethik. - Hamburg: Hamburger Edition, 1995 Blatt, Moshe/Kohlberg, Lawrence: The effect of classroom moral discussion upon children’s level of moral judgment.- Journal of Moral Education, 1975, 4. H-, S. 129 - 161 Bronfenbrenner, Urie: Ökologische Sozialisationsforschung. – Stuttgart: 1976 Buber, Martin: Das dialogische Prinzip.- Gerlingen: Lambert Schneider, 1992, 6. Aufl. Cohn, Ruth C.: Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion. Von der Behandlung einzelner zu einer Pädagogik für alle. - Stuttgart: Klett-Cotta, 1980, 4. Aufl. Fetz, Reto: Struktur und Genese. Jean Piagets Transformation der Philosophie. – Bern : 1988 Flavell, John: Kognitive Entwicklung. – Stuttgart: 1979 Fischer, Franz: Proflexion - Logik der Menschlichkeit.- Wien, München: Löcker, 1985 Foerster, Heinz von: KybernEthik.- Berlin: Merve, 1993 Garnitschnig, Karl: Werte als Wirklichkeitsrepräsentationen. Werten und Werden.- In: Längle, Alfried: Das Kind als Person. Entwicklung und Erziehung aus existenzanalytischer Sicht.- Wien: Gesellschaft f. Logotherapie und Existenzanalyse, 1990, S. 65 – 84 Gruen, Arno: Der Verrat am Selbst. Die Angst vor Autonomie bei Mann und Frau.- München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1986 Gruen, Arno: Der Wahnsinn der Normalität. Realismus als Krankheit: eine grundlegende Theorie zur menschlichen Destruktivität.- München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1990, 3. Aufl. Hackl, Maria: Dipl. Arb. Wien 1997 25 Hurrelmann, Klaus: Das Modell des produktiv realitätsverarbeitenden Subjekts in der Sozialisationsforschung. – In: Zeitschr. f. Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 3. Jg. (1983), S. 91 – 103 Hurrelmann, Klaus/Mürmann, Martin/Wissinger, Jochen: Persönlichkeitsentwicklung als produktive Realitätsverarbeitung. Zeitschr. f. Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 6. Jg. (1986), S. 91 – 109 Huschke, Rolf Bernhard: Von der Anthropologiekritik zur Handlungsanthropologie. Wissenschaftstheoretische und normenkritische Überlegungen. – In: Päd. Rundschau, 32. Jg. (1978), S. 367 - 378 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. - Stuttgart: Reclam, 1965 Kegan, Robert: Die Entwicklungsstufen des Selbst. Fortschritte und Krisen im menschlichen Leben.- München: Kindt, 1986 Keller, Monika: Kognitive Entwicklung und soziale Kompetenz. – Stuttgart: 1976 Kohlberg, Lawrence: From is to ought: how to commit the naturalistic fallacy and get away with it in the study of moral development. – In: ders.: Essays in moral development. Vol. Two: The philosophie of moral development. – New York: 1981, S. 101 – 144 Kohlberg, Lawrence/Levine, Charles/Hewer, Alexandra: The current formulation of the theory. – In: Kohlberg, Lawrence: Essays in moral development. Volume II. The psychology of moral development. – San Francisco: 1984, S. 212 – 319 Moore, Geroge E.: Principia Ethica. - Stuttgart: Reclam, 1970 Oevermann, Ulrich: Kontroversen über sinnverstehende Soziologie. Einige wiederkehrende Probleme und Mißverständnisse in der Rezeption der ‚objektiven Hermeneutik’. – In: Aufenanger, Stefan/Lenssen Margit (Hrsg.): Handlung und Sinnstruktur. Bedeutung und Anwendung der objektiven Hermeneutik. – München: 1986, S. 19 – 83 Oser, Fritz: Moralisches Urteil in Gruppen, soziales Handeln, Verteilungsgerechtigkeit: Stufen der interaktiven Entwicklung und ihre erzieherische Stimulation.- Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1981 Oser, Fritz/Althof, Wolfgang: Moralische Selbstbestimmung. Modelle der Entwicklung und Erziehung im Wertebereich. Ein Lehrbuch.- Stuttgart: Klett-Cotta, 1992 Piaget, Jean: Das moralische Urteil beim Kinde. – Piaget, Jean: Intelligence and affevtivity: their relationship during child development. – Palo Alto: 1981 Polanyi, Michael: Implizites Wissen. –Frankfurt/M.: 1985 Rogers, Charles R.: Die klient-bezogene Gesprächstherapie.- München: Kindler, 1973 Searle, John R.: Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay. – Frankfurt/M.: 1971 Selman, Robert L.: Die Entwicklung des sozialen Verstehens. Entwicklungspsychologische und klinische Untersuchungen. – Frankfurt/M.: 1984 Spitzer, Manfred: Geist im Netz. – Ulich, Dieter: Kriterien psychologischer Entwicklungsbegriffe. – In: Zschr. f. Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 6. Jg. (1986), S. 29 - 64 Warren, David: Blindness and Children. An Individuual Differences Approach. – Cambridge, USA: University Press, 1994 26 Nachtrag: Überlegungen zu Piagets Theorie des moralischen Urteils Piaget unterscheidet in seiner Theorie der Entwicklung des moralischen Urteils beim Kinde zwischen der Anwendung der Regeln und dem Bewusstsein von Regeln. Im ersteren Fall erkenntPiaget 4, im zweiten Fall 3 Stadien. Abbildung 1: Anwendung der Regeln Stadium 1. Rein motorisches und individuelles Stadium 2. Egozentrisches Stadium 3. Stadium der beginnenden Zusammenarbeit 4. Stadium der Kodifizierung der Regeln Auftreten im Alter 1 2-5 7-8 11 - 12 Abbildung 2: Bewusstsein der Regeln Stadium 1. keine zwingende Regel 2. Regel heilig und unantastbar 3. Regel als ein auf gegenseitigem Übereinkommen beruhendes Gesetz Alter bis zum Anfangstadium des Egozentrismus Egozentrismus und erste Hälfte des Stadiums der Zusammenarbeit ab der zweiten Hälfte des Stadiums der Zusammenarbeit Piagets Deutungen der Entwicklung des moralischen Urteils können anders schlüssiger und weniger aus einer autoritären Erwachsenensicht, von der sich selbst Piaget offensichtlich nicht ganz befreien konnte, gefasst werden, wenn man z. B. die kindlichen Äußerungen im „egozentrische Stadium“ von den Operationen des Kindes her interpretiert, komplexere Zusammenhänge noch nicht zu durchschauen. Daher braucht es auch für sich die Sicherheit der Regeln, es muss auch die Regeln einmal gelernt haben, beherrschen und in seiner Funktion durchschauen, damit es sie überhaupt in Frage stellen kann. Jean Piaget kommt bezüglich „der Beurteilung von Handlungen nach ihrem materiellen Ergebnis oder der alleinigen Berücksichtigung der Absichten“ (1979, S. 148) aus seinen Untersuchungen selbst zu dem Schluss, dass wegen des Tadels und der Sanktionen der Erwachsenen der „objektive Begriff der Verantwortlichkeit ... ganz zweifellos als Ergebnis des vom Erwachsenen ausgeübten moralischen Zwanges“ erscheine und dem Beispiel der Erwachsenen selbst entspringe (ebd.). Außerdem wäre darauf zu achten, ob das Kind nicht zu anderen Aussagen fähig ist bzw. kommt, wenn es über es selbst stärker betreffende Geschichten oder besser Sachverhalte befragt wird. Piaget legt selbst nahe, eine Form der Beziehung des Erwachsenen zum Kind zu finden, in der das Kind „gewöhnt“ wird, „vom Gesichtspunkt der Nächsten zu handeln und ihnen eher Freude zu machen sucht als zu gehorchen“, weil es erst dann dazu gelange, „auf Grund der Absichten zu urteilen“. und Piaget kommt zu dem Schluss: „Die Berücksichtigung der Absichten setzt daher die Zusammenarbeit und die gegenseitige Achtung voraus.“ (a. a. O., S. 155) Aber auch dieser Prozess ist anders zu sehen, denn das Kind ist so angewiesen auf Zuwendung, Anerkennung, Achtung, dass es von sich aus selbstverständlich auf jede Zuwendung eines Erwachsenen mit Lächeln, mit Freude reagiert. Unter diesem Gesichtspunkt müsste man die Thesen Piagets in der Weise umformulieren, dass man sagt, dass das Kind erst dann verunsichert ist, wenn die Erwachsenen mit zu wenig Achtung dem Kind begegnen und es daher nicht eine „objektive Verantwortlichkeit“ entwickelt, denn dafür hat das kleine Kind noch keinen Begriff, sondern es wird beginnen, seine eigene gefühlsmäßige Bewertungsgrundlage aufzugeben und sich an die Regeln der Erwachsenen halten, um Zuwendung zu bekommen. 27 Piagel bleibt aber diesbezüglich selbst in Schwebe, ob nicht „der Zwang des Erwachsenen, welcher ihm (dem moralischen Realismus, KG) zugrunde liegt, im Kinde die Erscheinung der objektiven Verantwortlichkeit erzeugt“ (1979, S. 133) und argumentiert diesbezüglich immer wieder vom moralischen Realismus her, der erzeugt und nicht ursprünglich ist: „Findet das Kind dagegen in seinen Geschwistern oder Spielkameraden eine Gesellschaft, welche sein Bedürfnis nach Zusammenarbeit und gegenseitiger Sympathie entwickelt“ – als wäre dieses nicht schon ursprünglich gegeben – „so wird es einen neuen Typus von Moral in sich wachrufen, einer Moral der Gegenseitigkeit und nicht des Gehorsams. Die Moral der Absicht und der subjektiven Verantwortlichkeit.“ (a. a. O., S. 154) Mit Piaget kann man aber voll übereinstimmen, wenn es um die Frage geht, wie Moral entwickelt werden kann, wenn die ursprüngliche Wechselseitigkeit als fundamentales Prädikat moralischen Handelns gebrochen wurde. Die Argumentation Piagets spitzt sich bei der Untersuchung der Lüge zu, weil er davon ausgeht, dass das Lügen beim Kinde aus dem „Problem des Zusammentreffens des egozentrischen Verhaltens mit dem vom Erwachsenen ausgeübten Zwang“ zu verstehen sei. Piaget kennt hier wieder drei verschiedene Definitionen der Lüge, die sich entwicklungsdynamisch überhöhen. 1. Er fand zunächst bei den kleinen Kindern (bis 6 Jahre) eine „rein realistische“ Definition: „eine Lüge ist «ein häßliches Wort»“ (a. a.O., S. 156) Lüge hat damit die Bedeutung wie jedes hässliche Wort, wie Schimpfwörter. Als Erklärung für diese Gleichsetzung, bzw. Form der Assimilation bietet Piaget die Tatsache an, dass beide sprachlich sind. Lügen und Schimpfwörter gehören beide der linguistischen Sphäre an (a. a. O., S. 158). Piaget meint in diesem Zusammenhang, dass es für das Kind zunächst keine Lüge gebe, für es sei das Lügen wie ein Fabulieren und es würde ihm nur zur Lüge, wenn sich die Umwelt darüber entrüste. Das Bewusstsein der Lüge bleibe dem Kind also zunächst äußerlich (a. a. O., S. 159). 2. Zwischen 6 und 10 Jahren definieren Kinder die Lüge als etwas, „was nicht wahr ist“ (ebd.). Dabei wird zunächst der Irrtum selbst für eine Lüge gehalten. Diese Assimilation hört mit etwa 8 Jahren auf. Piaget meint gerade zu der Zeit, zu der absichtliches und unabsichtliches Handeln unterschieden werden. Vorher bestehe ein Animismus, Artifizialismus und Finalismus. Nun diese Deutungen von kindlichen Weisen des Weltverstehens ließen sich auch anders vornehmen, indem auf die psychischen Kompetenzen von Kindern dieses Alters geachtet wird. Solche Deutungen sind außerdem gefährlich, weil man mit ihnen das kindliche Verstehen zu stark rubriziert und nicht von seinen Kompetenzen her interpretiert. 3. Die Lüge erhalte nun die „korrekte Definition“: „eine Lüge ist eine absichtliche falsche Behauptung“ (a. a. O., S. 163). Sie taucht bei den 10 bis 11jährigen auf. Auch bei diesen Interpretationen ist es wieder sinnvoll, von der Psychodynamik der kleinen Kinder auszugehen. Sie brauchen die Wertschätzung, Achtung und Sicherheit der Erwachsenen und werden eher das für „schlimmer“ ansehen, das bei den Erwachsenen negativere Konsequenzen hat. Kann das Kind aber sich bei den Erwachsenen auch ohne „Lügen“ sicher fühlen, dann wird es auch nicht „lügen“, vielmehr bei dem bleiben, was es erlebt hat. Dabei können Übertreibungen aus Angst oder anderen Gründen schon vorkommen. In der künstlichen Situation des Interviews wird von den Kindern eine Lüge umso schwerer beurteilt „je unwahrscheinlicher sie ist und je mehr ihr Inhalt von der Wirklichkeit abweicht“ (a. a. O., S. 173). Interessant ist, dass selbst Piaget bemerkt, dass bei den Kindern zwischen 6 und 12 Jahren fest zu stellen ist, dass sie einmal sich nur auf den materiellen Schaden, das andere Mal sich nur auf die Absicht beziehen. Dies dürfte wohl damit zusammenhängen, was die Kinder mehr zu befürchten haben. Wird noch ergänzt!!!!! 28