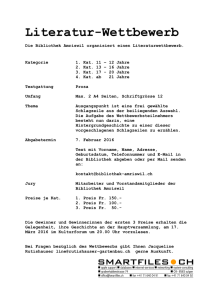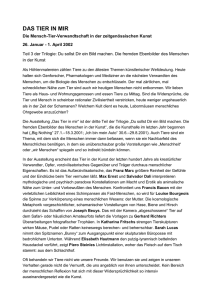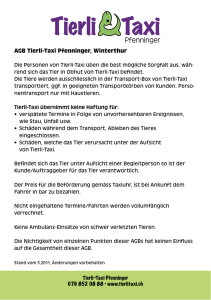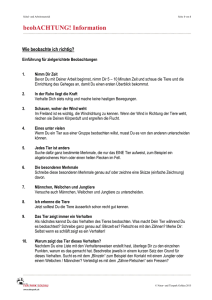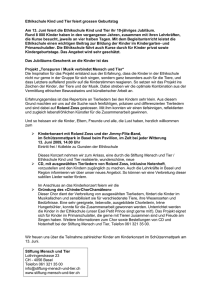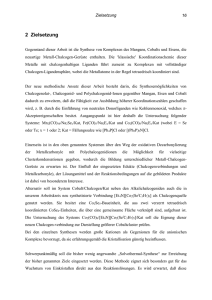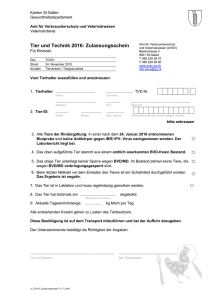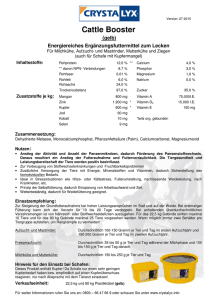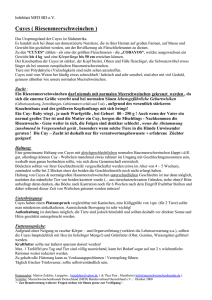Das Tier in mir
Werbung
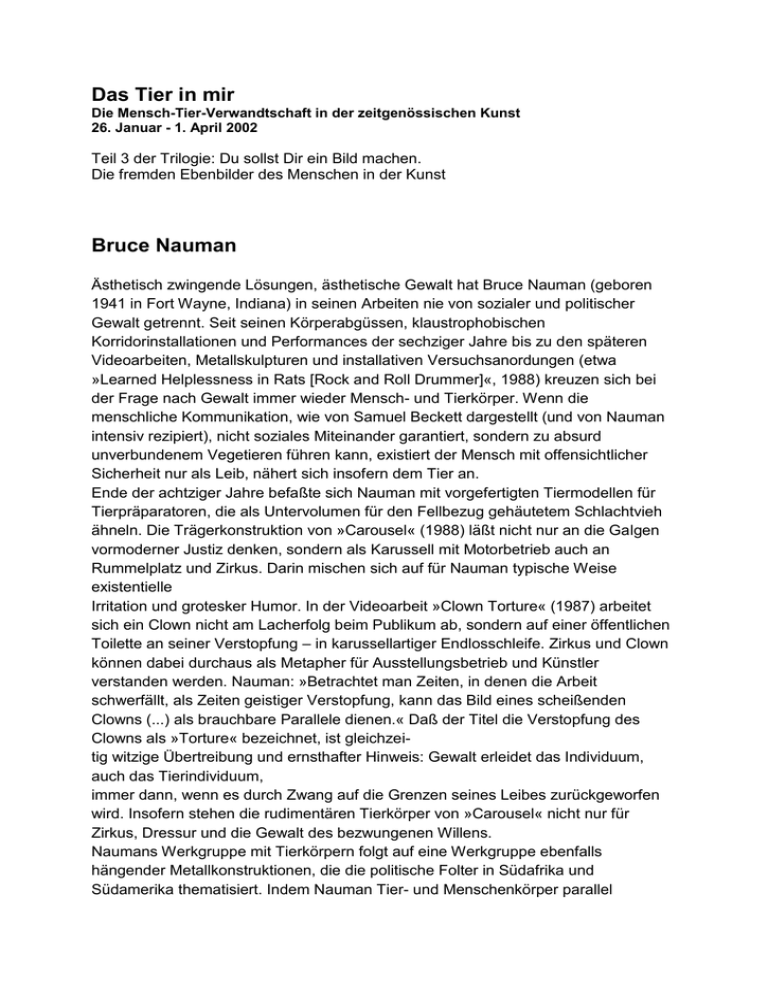
Das Tier in mir Die Mensch-Tier-Verwandtschaft in der zeitgenössischen Kunst 26. Januar - 1. April 2002 Teil 3 der Trilogie: Du sollst Dir ein Bild machen. Die fremden Ebenbilder des Menschen in der Kunst Bruce Nauman Ästhetisch zwingende Lösungen, ästhetische Gewalt hat Bruce Nauman (geboren 1941 in Fort Wayne, Indiana) in seinen Arbeiten nie von sozialer und politischer Gewalt getrennt. Seit seinen Körperabgüssen, klaustrophobischen Korridorinstallationen und Performances der sechziger Jahre bis zu den späteren Videoarbeiten, Metallskulpturen und installativen Versuchsanordungen (etwa »Learned Helplessness in Rats [Rock and Roll Drummer]«, 1988) kreuzen sich bei der Frage nach Gewalt immer wieder Mensch- und Tierkörper. Wenn die menschliche Kommunikation, wie von Samuel Beckett dargestellt (und von Nauman intensiv rezipiert), nicht soziales Miteinander garantiert, sondern zu absurd unverbundenem Vegetieren führen kann, existiert der Mensch mit offensichtlicher Sicherheit nur als Leib, nähert sich insofern dem Tier an. Ende der achtziger Jahre befaßte sich Nauman mit vorgefertigten Tiermodellen für Tierpräparatoren, die als Untervolumen für den Fellbezug gehäutetem Schlachtvieh ähneln. Die Trägerkonstruktion von »Carousel« (1988) läßt nicht nur an die Galgen vormoderner Justiz denken, sondern als Karussell mit Motorbetrieb auch an Rummelplatz und Zirkus. Darin mischen sich auf für Nauman typische Weise existentielle Irritation und grotesker Humor. In der Videoarbeit »Clown Torture« (1987) arbeitet sich ein Clown nicht am Lacherfolg beim Publikum ab, sondern auf einer öffentlichen Toilette an seiner Verstopfung – in karussellartiger Endlosschleife. Zirkus und Clown können dabei durchaus als Metapher für Ausstellungsbetrieb und Künstler verstanden werden. Nauman: »Betrachtet man Zeiten, in denen die Arbeit schwerfällt, als Zeiten geistiger Verstopfung, kann das Bild eines scheißenden Clowns (...) als brauchbare Parallele dienen.« Daß der Titel die Verstopfung des Clowns als »Torture« bezeichnet, ist gleichzeitig witzige Übertreibung und ernsthafter Hinweis: Gewalt erleidet das Individuum, auch das Tierindividuum, immer dann, wenn es durch Zwang auf die Grenzen seines Leibes zurückgeworfen wird. Insofern stehen die rudimentären Tierkörper von »Carousel« nicht nur für Zirkus, Dressur und die Gewalt des bezwungenen Willens. Naumans Werkgruppe mit Tierkörpern folgt auf eine Werkgruppe ebenfalls hängender Metallkonstruktionen, die die politische Folter in Südafrika und Südamerika thematisiert. Indem Nauman Tier- und Menschenkörper parallel thematisiert, zielt seine Kunst auf die existentielle Ebene von Schmerz, Gewalt und Vergänglichkeit. »Es heißt, in der Kunst geht es um Leben und Tod; das mag melodramatisch sein, aber es stimmt auch« (Nauman 1978). MW Joseph Beuys »Tiere sind an und für sich auch Engelwesen. Das spricht von einem Reich oberhalb des Menschen, von einer geistigen Dimension, die im Menschen selbst enthalten ist.« In der Vorstellung von Joseph Beuys ist das Tier Verbindungsglied und Zugang zu anderen geistigen Ebenen. »Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt« (1965) und »Coyote, I like America and America likes Me« (1974) sind zwei der berühmtesten Aktionen des Künstlers, in denen deutlich wird, welche wesentliche Rolle das Tier für sein künstlerisches Schaffen spielt. Bereits früh beschäftigt sich Beuys (geboren 1921 in Krefeld, gestorben 1986 in Düsseldorf) intensiv mit naturwissenschaftlichen Studien. Sein Interesse für Zoologie vertieft sich in der Freundschaft mit dem Naturforscher und Tierfilmer Heinz Sielmann, in der späteren Auseinandersetzung mit dem Akademielehrer und Tierbildhauer Ewald Mataré und der Bekanntschaft mit Konrad Lorenz. Beuys geht es um Wesensqualitäten des Tieres in einem tieferen Sinne. Er versteht es als ein erweiterndes Organ des Menschen, als Transmitter und Katalysator zwischen organischer und intellektueller Existenz. Seine Tierdarstellungen und Mischwesen aus Tier und Mensch mögen an Höhlenmalereien wie in Lascaux, Altamira oder Chauvet erinnern, sie transformieren die archaischen Bilder ins 20. Jahrhundert und konfrontieren sie mit sozialen, ökonomischen und ökologischen Problematiken. Biene und Hase haben einen Sonderstatus im Werk: Der Hase, mit direkter Verbindung zur Erde, in die er sich immer wieder eingräbt, steht für Geburt und Reinkarnation; am Beispiel der Bienen entwickelt Beuys seine »plastische Theorie« und deren erweiterten Kunstbegriff. Die planetarische Bedeutung der Biene als Sonnentier, der Bienenstaat als Energiemodell und der Wärmecharakter der Substanzen Wachs und Honig bieten den entscheidenden Anstoß dazu. Frühe Zeichnungen der fünfziger Jahre verschmelzen das Motiv der Bienenkönigin und der Frau zum Bild der Tierfrauen. In der Documenta-Installation »Honigpumpe am Arbeitsplatz« von 1977 zirkuliert der energietragende Blütennektar im Raum und bringt darin Beuys’ alternativen Begriff von Wissenschaft und die weitreichende politisch-gesellschaftliche Bedeutung von Kunst als kreatives Potential zur Anschauung. DE Volker Harlan: Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Beuys. Stuttgart 1986 Theodora Vischer: Joseph Beuys – Die Einheit des Werkes. Köln 1991 Franz Marc »Ich sehe kein glücklicheres Mittel zur Animalisierung der Kunst als das Tierbild.« Für Franz Marc (geboren 1880 in München, gestorben 1916 vor Verdun) ist die Darstellung insbesondere des Pferdes unerschöpfliches Thema und mythisches Leitmotiv der Entwicklung seiner Vorstellungen von der utopischen Kraft der Malerei. Beeindruckt vom Impressionismus sowie von van Gogh und in freundschaftlichem Kontakt mit Kandinsky, Macke und Münter sucht Marc im Symbolgehalt der Farbe höhere, spirituelle Seinsebenen zu erkennen. Auf seiner pantheistischkosmologischen Suche wird ihm das Auge des Tieres zum Gewährsort ganz anderen Sehens. »Gibt es für Künstler eine geheimnisvollere Idee als die, wie sich wohl die Natur in dem Auge eines Tieres spiegelt? Wie sieht ein Pferd die Welt oder ein Adler, ein Reh oder ein Hund? Wie armselig, seelenlos ist unsere Konvention, Tiere in eine Landschaft zu setzen, die unsren Augen zugehört, statt uns in die Seele des Tieres zu versenken.« Ein empfindungsreicher Glaube an die sensitiven, den Menschen beinahe übertreffenden spirituellen Fähigkeiten der Tiere sind der Weg, »ihr absolutes Wesen, das hinter dem Schein lebt«, zu erkennen. »Die Kunst ist metaphysisch, wird es sein; sie kann es erst heute sein. Die Kunst wird sich von Menschenzwecken und Menschenwollen befreien«, glaubt Marc. Strukturierte Naturnähe in empfindsam gesehener, kraftvoller Plastizität zeigt sich in der skulpturalen Gruppe »Zwei Pferde« (1908). Zugleich ist die Suche nach der Autarkie der animalischen Natur getragen von den Gesetzlichkeiten der Farbe und der Form. Insofern erscheinen in »Blaue Fohlen« die Pferde ornamental in die Fläche gebannt. Im Bildaufbau den Grundfarben vertrauend, wird die natürliche Energie der Tiere in ein konstruktives Miteinander gesetzt. Die Fohlen erscheinen in typisierter Vitalität und signalisieren in der blauen Färbung zugleich Ferne, Spiritualität. Das Bild entsteht 1913, im Jahr des »Turms der Blauen Pferde«, der seit dem Zweiten Weltkrieg angeblich verschollenen Ikone des Expressionismus. 1913 deutet sich nochmals das »Ziel« an, zu dem sich Marc 1911 als einer der »Wilden Maler Deutschlands« bekannt hat: »Durch ihre Arbeit ihrer Zeit ›Symbole‹ zu schaffen, die auf die Altäre der kommenden geistigen Religion gehören und hinter denen der technische Erzeuger verschwindet.« DT Christian von Holst (Hg.): Franz Marc – Pferde. Kat. Staatsgalerie Stuttgart 2000 Sandra Munzel In den Plastiken von Sandra Munzel (geboren 1968 in Peine) begegnet man kleinen Kreaturen zwischen Mensch und Tier, nahen fremden Wesen. Unterschiedliche Körper gehen ineinander über, scheinbar Gegensätzliches wird kombiniert – Tiergesichter wachsen aus einem Menschenleib (»Bärmutter«, 1997), eine Vielzahl weiblicher Brüste sitzt auf einem männlichen Vogelrumpf (»Die Ganterin«, 1997), ein Bärenkörper trägt ein Kindergesicht (»Tier mit Zunge«, 1996). In ihren zierlichen Werken exerziert die Künstlerin unheimliche Körperexperimente. Stofftiere bildeten zunächst den Kern der plastischen Arbeiten, sie wurden mit Wachs überzogen und verfremdet. Wie bei Jeff Koons oder Mike Kelley sind diese Stofftiere, als emotionale Speicher und puppenhafte Gegenüber für Kinder, das besetzte Ausgangsmaterial für ein psychologisch-bildhauerisches Spiel. Auch die später entstehenden Tonfigürchen überzieht Munzel mit jener Wachsschicht, die den Körpern eine durchscheinende Weichheit verleiht. Eingefärbt und bemalt wirken ihre Oberflächen wie gerötete, verletzliche und verletzte Haut. En miniature werden so gewaltige Themen verhandelt wie Geburt, Fruchtbarkeit, Sexualität und Tod. Mit ihrer konzentrierten Körperlichkeit, ihrer Vielbrüstigkeit etwa oder den zur Schau getragenen Geschlechtsteilen, haben die kleinformatigen Plastiken die Ausdruckskraft archaischer Idolfigürchen. In seiner Publikation »Das biotechnische Zeitalter« (1998) spricht Jeremy Rifkin vom künstlichen Menschen als der »zweiten Schöpfung« und beschwört neue Möglichkeiten einer technoiden Wesenskombinatorik: »Vielleicht werden wir Zeugen der Erschaffung zahlloser neuer Tierchimären, unter anderem auch von MenschTier-Hybriden (...) Die künstliche Erschaffung von klonierten, chimären und transgenen Tieren könnte (...) den Beginn einer bioindustriell gestalteten Welt einläuten.« Ganz entgegen der Faszination Rifkins haben Munzels Chimären mit verborgenen Stimmungen und Kräften zu tun, mit emotionalen Zuständen, nicht mit biotechnischer Optimierung des Körpers. Chimären haben die Kunst als Erfahrungs- und Experimentierraum fremder Selbstbilder immer belebt und darin dem Menschen Äußerliches wie Innerliches zugänglich gemacht. Munzels Skulpturen sind Anschlüsse an Urbilder, unbewußte Identitäten und Empfindungen, eine unheimliche und kraftvolle Miniaturwelt, in der Körper aufbrechen, sich verformen und darin auf die fremden Dimensionen unseres eigenen Leibes und unseres Bewußtseins deuten. DE (e.) Twin Gabriel Häufig in ihren Skulpturen, Klanginstallationen, dezentralen Projekten und vielgestaltigen Recherchearbeiten haben (e.) Twin Gabriel, d.h. Else Gabriel (geb. 1962 in Halberstadt) und Ulf Wrede (geb. 1968 in Potsdam), Tierverhalten in architektonischen Zusammenhängen thematisiert, um letztlich Menschenverhalten ebenso illusionslos wie humorvoll in den Blick zu rücken. Im Berliner Haus am Waldsee setzten sie gemeinsam mit Georg Herold 1996/97 Tausende von Schnekken aus. Die Ausstellungsbesucher schritten behutsam durch die Räume, um kein Kriechtier zu zertreten – und nahmen erstmals den Kunstort selbst als architektonische Gegebenheit wahr, was Ziel der Schneckeninvasion gewesen war. Für das Institut Technische Informatik der Universität Mannheim, an dem in der Chipentwicklung und Optoelektronik spektakuläre Forschungsergebnisse erreicht worden sind, entwarfen (e.) Twin Gabriel im Rahmen eines Kunst-am-BauWettbewerbs einen Beitrag in Gestalt einer Sitzlandschaft. Aus farbigem Beton wird das Modell eines Längsschnitts durch das Hirn eines Affen nachgebaut. Besonders hervorgehoben werden die Bereiche, die teilweise zum limbischen System gehören und in denen das Belohnungszentrum vermutet wird. In der Mitte steht ein Frischobstautomat, an dem Bananen (alternativ Glückskekse) gekauft werden können. Wenn hochentwickelte Superchips und optoelektronische Identitätskontrollen irgendwann einmal an Automaten zum Einsatz kommen, funktionieren diese für den Benutzer emotional nicht immer noch so schlicht wie die Staude, von der der Urwaldprimat die Banane klaubt? Freut sich der auf Kreditkarte konditionierte Bankkunde über die gelungene Geldentnahme nicht wie der Affe über die Banane? Es gibt Theorien, die ordnen die Affektlogik ein zwischen qualitativer Gefühlswelt und quantifizierender, sachorientierter Wahrnehmung. Schon Pawlows Versuche mit Hunden ließen manchen Menschenerzieher und Soziotechnokraten erkennen: Belohnung stimuliert Leistung. Das Belohnungszentrum ist Quelle des Forschritts dank Lust an der Entspannung durch Erkenntnis. Nie allerdings streift die stets auf das Verhalten und das Bewußtsein des Menschen zielende Hirnforschung an Tieren die unfreiwillige Komik ab, mit der – bildlich gesprochen – Menschen ihr Gehirn anstrengen, um in ihr eigenes Gehirn zu gucken. Sie ähneln darin Hunden, die kreisend versuchen, ihren Schwanz zu schnappen. DT (e.) Twin Gabriel: floating-floccinaucinihilipilification. Kat. South London Gallery, London 1997 Kirsten Geisler Kirsten Geisler (geboren 1949 in Berlin) befaßt sich seit den frühen neunziger Jahren in ihren Videos, Installationen und computeranimierten Bildern mit Verfügungsfantasien des Menschen über Maschinen und Tiere. Einem größeren Publikum wurde sie Mitte der neunziger Jahre durch ihre Darstellung eines überlebensgroßen, Schönheitsstandards perfekt umsetzenden Frauengesichts bekannt, das sie in verschiedenen, auch interaktiv »reaktionsfähigen« Varianten ausführte. Der Werkgruppe der »Beauty« folgte Ende der neunziger Jahre die »Fliege«, ebenfalls auf unterschiedlich untersuchende Weise umgesetzt. Die in Holland tätige Künstlerin operiert auf der ästhetischen Grenze von real und fiktiv: Sie spielt maximale technische Perfektion gegen das schleichende Glaubwürdigkeitsdefizit solcher Perfektion aus. Je glamouröser uns die überlebensgroße »Beauty«, interaktiv gereizt, zuzwinkert, je naturgetreuer die virtuelle Fliege ihre vielgliedrigen Beine bewegt, desto irrealer, desto jenseitiger erscheinen sie. Beide, das schöne Frauengesicht und die Fliege, Mensch und Natur, sind digitale Kreaturen der Künstlerin, womit sie, durchaus ironisch gebrochen, den Schöpfergottmythos als Künstlerselbstverständnis reaktiviert. So glatt und technoid sich die Videoarbeiten und interaktiven Bildschirme Geislers präsentieren, so tief sind sie in die alte theologische Hierarchiedebatte um Tier, Mensch und Gott und, in der rationalisierten Erbschaft dieser Debatte, um die Maschine und den Menschen als ihren Schöpfergott verstrickt. In Geislers Arbeiten scheint die digitale Rechenmaschine dem menschlichen Willen Verfügungsmacht über so etwas Flüchtiges wie physiognomische Schönheit oder – wörtlich flüchtig – stets davonfliegende Insekten zu geben. Am Rande, fast abgründig beiläufig, wird dadurch die Dressur des Publikums durch sogenannte interaktive Medien thematisiert. Je nachdem, wo die Besucher den Bildschirm berühren, »reagiert« die virtuelle Fliege mit einer Bewegung. Die kausale Schlaufe zwischen Bildschirmberührung und dadurch ausgelöster, vorprogrammierter Bildschirmreaktion ist eng und vorhersagbar, allerdings suggeriert sie den Übertritt aus dem Realen ins Fiktive, einen kategorialen Realitätensprung. Insgeheim ist diese Überschreitung eine elektronische Nachinszenierung metaphysischen Einwirkens auf konkret-banales Alltagsleben, Gottes Fingerzeig in den Wirrnissen von Natur und Kultur, vom interaktiv gebannten Besucher immer wieder nachgespielt mit Daumen oder Zeigefinger auf dem Touch Screen. Fliegen sind da eigensinniger. MW Louise Bourgeois »Die Gewalt im Werk resultiert aus der Frustration. Jede Art von Frustration macht ein Tier gewalttätig. Wir sind alle in gewisser Weise frustriert, und Frustration und Gewalt sind wie ein Pendel, das hin und her schwingt, hin und her.« (Louise Bourgeois, 1990) Im Jahr 1994 beginnt Louise Bourgeois (geboren 1911 in Paris) mit einer Serie von großformatigen Spinnen-Plastiken aus Stahl, die mit ihrer beunruhigenden Größe in den Raum greifen und in ihren beängstigenden Ausmaßen bedrohlichen Kindheitserfahrungen gleichkommen. Eines der ersten Exemplare, »Spider« von 1994, ist eine Aneinanderfügung abstrakter Formen, die zum surrealistischen Insekt werden. Vom kleinen, massiv runden Leib ragen die Beine dünn und spitz herab. Unter dem dunklen Torso zeigt sich ein Glas mit blauer Flüssigkeit, die sich ebenso als das kühle Blut des Insekts, als das Substrat seiner ausgesaugten Opfer, oder als giftig schillerndes, symbolisches Destillat von Ängsten lesen läßt. Als persönliche Metapher für die Mutter von Bourgeois knüpft das Motiv der Spinne zugleich an archaische Bilder an. Robert Pincus-Witten betont die Bedeutung des französischen Wortes »tordre« (weben oder drehen) für die Skulptur von Bourgeois, und Marina Warner stellt die Verbindung zur mythologischen Figur der Arachne her. Die mythologische Weberin, die kunstvolle Teppiche anfertigte, wird, weil sie Geschichten der Olympier ausplaudert, von Minerva zur Strafe in eine Spinne verwandelt – Arachne ist ebenso eine Bildproduzentin wie die Künstlerin Bourgeois, deren Eltern in Paris eine Werkstatt für Teppichrestauration betrieben. Dort hatte die junge Louise bald die Aufgabe, in Zeichnungen die fehlenden Stellen für die Weber zu ergänzen. Im Restaurieren der Teppiche, in der sorgsamen und kunstvollen Ergänzung ihrer Fehlstellen, erkennt sie auch eine Metapher für die Auseinandersetzung mit persönlicher und kollektiver Geschichte. DE Louise Bourgeois – Skulpturen und Installationen. Kat. Kestner-Gesellschaft Hannover 1994 Louise Bourgeois. Kat. Tate Modern, London 2000 Katharina Fritsch Als Katharina Fritsch (geboren 1956 in Essen) Ende der achtziger Jahre zur Vorbereitung einer Ausstellung von der Dia Art Foundation nach New York eingeladen wurde, war ihr erster Eindruck: »New York ist ja gar nicht so eine moderne Stadt, sondern eher eine aus den 20er Jahren (...) Metropolis, Dämon der Großtadt (...) Also dieser Eindruck war für mich in den ersten Tagen die erste Erfahrung, und die führt bei mir meistens zu einer Vision, die absolut momentan intuitiv kommt (...) Dann sind wir durch ein Türchen hinten aus dem Ausstellungsraum herausgegangen, in einen ganz kleinen, engen Gang zwischen zwei Hochhäusern. Und das war ein richtiges Rattenloch. Und dann war die Vorstellung sofort da. Und das verband sich mit der Idee, einen ›Rattenkönig‹ zu bauen (...) Eine Ratte ist für mich überhaupt kein Ekeltier. Aber als ich (...) über mein Projekt für das Dia Center nachgedacht habe, wurde mir klar, daß die Symbolik der Ratte – Überlebenswille, Aggressivität, eine gewisse Ruchlosigkeit – gut zu New York paßt.« Waren die historischen Wappentiere und Stadtallegorien aus dem kollektiven Bilderfundus des mittelalterlichen Rittertums und später der Bistümer und Herzogtümer hervorgegangen, so setzte Katharina Fritsch New York 1993 ein heraldisches Zeichen aus individueller Intuition: den »Rattenkönig«, bestehend aus sechzehn 2,80 m hohen Tierskulpturen, in einem Kreis von 13 m Durchmesser aufgestellt und im Kreisinneren an den Schwänzen zu einem stilisierten Knoten verbunden. Immerhin geht diese Verknotung auf kollektive Erzählungen zurück. Nach alten europäischen Volkssagen bildet sich ein sogenannter Rattenkönig, wenn sich junge Ratten im Nest an ihren Schwänzen unentwirrbar miteinander verheddern. Katharina Fritsch, zu deren Werk Großskulpturen eines Elefanten (1987), einer Maus (1991/92) oder von Pudeln (1995/96) gehören, erhielt 1993 in New York zwar gemischte Reaktionen zu ihrer persönlich intuitiven Allegorie der Stadt, dafür aber die Zustimmung einzelner: »Die direktesten Reaktionen sind von einer New Yorker Schulklasse gekommen, die mit ihrer Lehrerin im Dia Center war (...) Was mich wirklich fasziniert hat, war, daß einige aus der Gruppe dann meinten, die Häßlichkeit und das Abstoßende an Ratten wären doch nur Projektionen, Ratten könnte man doch auch süß finden. Ein Mädchen sagte, der ›Rattenkönig‹ müßte auf das Empire State Building, damit man ihn von Queens aus sehen könnte, als Zeichen von New York.« Katharina Fritsch. Kat. Museum of Modern Art San Fransciso / Museum für Gegenwartskunst Basel 1997 Diana Thater In Diana Thaters Film »Electric Mind« (1996) gelingt es einem Neurologen, das Gehirn seiner toten Tochter als elektrische Kopie einem Schimpansen einzupflanzen. Der besondere Fall des schließlich als Person akzeptierten Schimpansen läßt uns allgemeine Sichtweisen hinterfragen: die holzschnitthafte Dualität von Mensch/Tier, Geist/ Körper, Vernunft/Instinkt, mit der wir uns von unseren animalischen Ursprüngen abgrenzen. Immer wieder konfrontiert uns die 1962 in San Francisco geborene, in Los Angeles lebende Künstlerin in ihren Installationen mit Tieren, die scheinbar menschliche Eigenschaften besitzen bzw. annehmen. In Thaters Menagerie sind die Tiere allesamt dressiert. Sie zeigt ein Zebra, das sich auf einen Zirkushocker quält, einen weißen Hengst, der nach der Peitsche tanzt. Ist es in »Electric Mind« ein Affe, den ein Filmteam sorgsam dirigiert, so wird in »A Confusion of Prints« ein Wolf zum Hollywood-Darsteller abgerichtet. In kurzen, gegeneinander geschnittenen Sequenzen sehen wir den tierischen Protagonisten in einem eingezäunten Übungsgelände. Wir beobachten, wie der ›wilde‹, weiße Wolf gezähmt und von Trainern – hat er sie als ranghöhere Rudelmitglieder anerkannt? – angeleitet wird. Die mediale Produktion, deren Zeugen wir werden, offenbart die Konstruiertheit unserer mentalen Bilder. Was wir alltäglich auf Tiere projizieren, wird hier professionell umgesetzt. Das Tier verwandelt sich in ein Bild unserer Vorstellungen von ihm. In der Installation jedoch wendet sich unversehens das Blatt, und die Tiere scheinen uns anzusehen. »Mich interessiert die Überlagerung und der Austausch von Identitäten (...) Wenn ich diese Tiere mittels Video in den Kunstraum einführe, erhebt sich die Frage des Austauschs zwischen betrachtenden Subjekten und betrachteten Objekten.« (Thater 1998) Es gibt keinen festen Standpunkt, von dem aus der Betrachter sich passiv vom Bildgeschehen distanzieren könnte. Von Monitoren und/oder Projektionen umgeben, bewegt er sich in der Arbeit, wechselt Perspektiven und nähert sich so dem Eigenen im Anderen an. Die Auseinandersetzung mit der Ähnlichkeit und Andersartigkeit der Tiere ermöglicht eine Relativierung des eigenen Ich: »Ich wäre lieber ein Delphin als ein Mensch.« (Thater 1999) FE Diana Thater: Electric Mind. Gent 1996; Diana Thater – Selected works 1992–96. Kat. Kunsthalle Basel 1996; Parkett, Nr. 60, 2000, 76–117 Eadweard Muybridge 1873 erhielt Eadweard Muybridge (Kingston-upon-Thames, 1830–1904) seinen wohl wichtigsten Auftrag von Leland Stanford. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien wollte beweisen, daß Pferde in einer Phase des Galopps mit allen vier Beinen in der Luft schweben. Bei Experimenten mit kürzester Belichtungszeit gelang Muybridge, der als Landschaftsfotograf Karriere gemacht hatte, ein Foto, das tatsächlich ein Pferd in voller Bewegung zeigt. Später erhielt er eine ganze Serie von Negativen, indem er das Pferd über verspannte Fäden mehrere Kameraverschlüsse auslösen ließ. Muybridge (»The Horse in Motion«, 1878) zerlegte den Bewegungsablauf in eine Folge von Einzelmomenten, was als Wahrnehmungssensation wirkte. Die Aufnahmen waren unglaublich, da sie den gewohnten Kunst-Posen, in denen Bewegung zum Bild synthetisiert wurde, widersprachen und auch die eigene Anschauung verunsicherten. (Um die Einzelbilder wieder zur Illusion eines Pferdegalopps zu verschmelzen, projizierte er sie schließlich auf eine Leinwand – »die Bilder hatten Laufen gelernt«, Beaumont Newhall, 1937). Eine vergleichbare Irritation erfuhr auch das Menschenbild durch die Fotografie: Stereoskopische Ansichten bevölkerter New Yorker Straßen zeigten um 1860 Passanten in erstaunlichen Schrittstellungen. Als Muybridge 1879 erstmals den Menschen zu seinem Studienobjekt machte, war der Kontext wiederum der Sport. Stanford hatte mit seinem Fotoprojekt geplant, eine Theorie der Tierdressur und ein (später im Pferdesport sehr erfolgreiches) Trainingssystem zu entwickeln, das auf einer allgemeinen Theorie der Bewegung basieren sollte. Nun untersuchte Muybridge mit mehreren durch Uhrwerke gesteuerten Kameras zunächst Athleten. Bald fotografierte er Menschen bei allen möglichen Tätigkeiten sowie Tiere des Zoos. Als eine Art visueller Atlas der Bewegungsformen erschienen die Ergebnisse 1887: »Animal Locomotion«. Wie der Titel Menschliches und Tierisches eigentümlich vermischt, so gleicht der auf den körperlichen Bewegungsapparat und dessen Aktionen fokussierte Kamerablick die weitgehend nackt auftretenden Menschen den Tieren an. Die neue, Raum und Zeit exakt korrelierende Sicht zeigt, was jenseits der Grenzen menschlicher Wahrnehmung liegt, und wird künstlerische Darstellungsweisen im 20. Jahrhundert – die Futuristen ebenso wie Francis Bacon – nachhaltig beeinflussen. FE Eadweard Muybridge. Kat. Stuttgart/ Zürich/ Bochum/ Basel/ Graz, Stuttgart, 1976 Katharina Büche Katharina Büche (geboren 1963 in Karlsruhe, lebt in Davos/Graubünden) konfrontiert gegerbte Felle mit künstlichen und organischen Objekten in rätselhaften Zusammenstellungen. Trotz des – unter politisch korrekten Vorzeichen – brisanten Tier-Materials, von dessen sinnlicher Ausstrahlung und haptischer Qualität auch die Arbeit »dicker Brocken« (1999) lebt, hat die Künstlerin das Placet der Tierschutzvereine gewonnen. Ihre Arbeit fordert eine Überprüfung unserer Beziehungen zu Tieren. Den Nerz kennen wir zu Pelz verarbeitet oder präpariert im (Naturkunde-) Museum. In beiden Fällen ist er aus seinem natürlichen Umfeld buchstäblich herausgelöst: getötet und gehäutet. Anstatt den Naturkontext zu rekonstruieren, verfremdet Büche ihn. Das Raubtier, das sich eigentlich von Fischen und kleinen Säugetieren ernähren sollte, scheint einen Kürbis im Ganzen fressen zu wollen. Der gewaltige Kürbis steht senkrecht auf der Erde, von der sich der Nerz stemmt, um die Frucht zu verschlingen. Durch die Erde sind beide verbunden, und man ist an das alte Bild der sich in den Schwanz beißenden, den Kreislauf der Natur symbolisierenden Schlange erinnert. Im gespannten Bogen eines Dreiviertelkreises, den sie mit ihren gelängten Körpern beschreiben, scheinen Nerz und Kürbis jedoch eher wie Jäger und Beute miteinander zu ringen. Die formal vermittelte Dynamik der Szene läßt vermuten, daß im nächsten Moment einer der beiden Gegner in die Luft gehoben oder zu Boden geworfen wird. Der Kampf aber ist ein ungleicher, in dem sich das Opfer nicht gegen den Zugriff des Räubers wehren kann – eine Konstellation, die uns nur allzu bekannt ist, da sie unser beherrschendes Verhältnis gegenüber der Natur beschreibt. Daß der vorgeführte Aggressor, der Nerz, in Europa vor allem aufgrund intensiver Bejagung weitestgehend ausgestorben ist, leitet zusätzlich auf diese metaphorische Ebene über. Der Nager, der sich wider seine Natur einen Kürbis einverleibt, gleicht darin dem Menschen, der ihn ausgerottet hat, ohne sein natürlicher Feind zu sein. Er bezeichnet eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. Der Brocken, den er sich vorgenommen hat, ist nicht für den Nerz bestimmt und offensichtlich zu »dick«. FE Katharina Büche – Alles für die Katz. Kat. Mannheim/Davos 1999; Katharina Büche – Ach Leute. Kat. Gesellschaft der Freunde junger Kunst Baden-Baden 2001 Paul McCarthy Bevor Michael Jackson als früh gealterte Diva, von kosmetischer Chirurgie und chemischer Hautbleichung gezeichnet, Pressespekulationen über seinen Niedergang auslöste, hatte er in den achtziger Jahren als weißer Schwarzer, als animalische Tanzmaschine, als weiblicher Mann, als Liebhaber von Kindern und Tieren alle möglichen Fantasieerwartungen des amerikanischen Publikums gereizt. Sensationell konnte die differenzlose Imagebildung nur wirken, weil sie auf eine scharf differenzierende öffentliche Moral stieß. Amerikanische Kinokritiker preisen im Fernsehen familientaugliche Filme als »clean fun«, eine verklemmte Kategorisierung von Spaß, die nicht ohne ihr ekstatisch gefürchtetes Pendant schrankenloser Obszönität auskommt. Das offiziöse Meinungsklima rigider, dabei unsicherer Leibpolitik stattete die Zuneigung des Popstars zu seinem Hausaffen rasch mit skandalös erotischen Untertönen aus. McCarthys Doppelskulptur »Michael Jackson White«, »Michael Jackson Black« (1997–1999) treibt die Verklemmung bewußt auf die Spitze. McCarthy (geboren 1945) buchstabiert die Gleichsetzung von vermenschlichtem Affen und maskottchenhaftem Sängeridol unter dem vereinheitlichenden Vorzeichen einer Comicfigurenidentität aus. »Weiß« und »schwarz« als Skulpturenfarben codieren einen Rassismus, der den Typus des dunkelhäutigen, erotischanimalischen Entertainers anziehend und zugleich, weil so affengleich, abstoßend erscheinen läßt. Daß Michael Jackson vor dem inneren Widerspruch dieses Rassismus in die chemisch-chirurgische Körpermanipulation flüchtete, machte – böse Pointe – den realen Körper dieses Superstars der Öffentlichkeit so verfügbar wie es sonst in der westlichen Gesellschaft nur Tierkörper im Medizinexperiment oder der Nahrungsmittelindustrie sind. Anders als Jeff Koons, der Jackson und den Affen Bubbles bereits 1988 porträtierte und der sich den Perversionen veröffentlichter Moral durch Angleichung nähert, stellt sich der Kalifornier McCarthy dem hysterisierten Spektakel lüsterner Empörung konfrontativ entgegen. McCarthys Performances der sechziger und siebziger Jahre knüpften entfernt an das Ethos der West-Coast-Hippies an, das sich gegen Heuchelei und Körperfeindlichkeit richtete: Gehe gezielt auf deine Alpträume zu, und du wirst sehen, auf welch banal repressive Weise Massenmedien und öffentliche Moral dein Körperselbst (und deine – wie auch immer erotische – Freude an Tieren) unterwandern. Diese Haltung gibt McCarthys thematisch stets sex- und gewaltträchtigen Arbeiten ihre verblüffende Leichtigkeit: Befreiung durch klares Denken. MW William Wegman William Wegmans Zusammenarbeit mit Weimaranern begann 1970 mit ersten Videos. Seit 1978 fotografiert Wegman (geboren in Holyoke, Massachusetts, lebt in New York) die Hunde in sorgsam arrangierten, theatralischen Szenen. In bedingungsloser Loyalität halten sie in allen möglichen und unmöglichen Posen still – wie von Marionettenfäden geführt. Wegman kennt seine Hunde (»every dog is an individual«), er weiß, wie weit er gehen kann (»don't tell anyone how easy this is«), und man wundert sich über die verkehrte Welt seiner Bilder: Er bemalt die Hunde, verdeckt sie unter Fellen, maskiert und verwandelt sie chamäleonartig – mal zum Frosch mit Kulleraugen und Schwimmflossen, mal zum Elefanten mit Stoßzähnen und gestricktem Rüssel. Die Camouflage, das Spiel mit Identitäten, führt immer wieder über das Tierreich hinaus. Wegman wirft die Vierbeiner in Robe und stellt sie entsprechend gekleideten Menschen als Partner zur Seite. Die Ähnlichkeit – zentrale Idee seiner Arbeiten – ist durch die Verkleidung pointiert, das Verschiedene fügt sich zu befremdenden Einheiten (»I like things that fluctuate«). Auf kaschiertem Hocker sitzend, scheint die Hündin in den aufrechten Gang erhoben: »That made the power of that image, the anthropomorphic image, more ascertive and less silly.« Grundsätzlich bemüht, jede Lächerlichkeit zu vermeiden, nähert Wegman Haltung und Ausdruck im Rollenspiel so weit an, daß die in »Becoming« (1990) gezeigte Metamorphose nur konsequent erscheint. In einem Dreischritt sehen wir eine Frau im Abendkleid neben einem Hund, die dann fotografisch übereinander geblendet und schließlich vollends zu einem Zwitter verschmolzen werden. Am Ende des pseudonarrativen Prozesses posiert die synthetische Hundefrau als elegantes Mischwesen. Die Glaubwürdigkeit der Fotografie als Medium der Wirklichkeitserfahrung wird damit vollends fraglich. Die Realität verschwimmt, erweist sich als undurchdringliche Oberfläche, der wir unsere Erwartungen durch Dressurakte und Projektionen auferlegen. FE Martin Kunz (Hg.): William Wegman – Malerei, Zeichnung, Fotografie, Video. Kat. Luzern/ London/ Amsterdam/ Frankfurt a.M./ Paris/ New York/ Boston/ Florida, Köln 1990 Paul Klee In seinem ersten größeren Radierzyklus »Inventionen«, der zwischen 1903 und 1905 entsteht, entfaltet Paul Klee (1879–1940) eine künstlerische Programmatik im Klima von Jugendstil, Naturalismus und Symbolismus. Mit Blick auf Francisco Goya, Alfred Kubin und James Ensor schließt diese Werkphase zynisch-skeptische Distanz ein: »Große Ratlosigkeit. Deshalb bin ich ganz Satire (...) Vorläufig ist sie mein einziger Glaube. Vielleicht werde ich nie positiv.« (Klee) Es geht Klee darum, sich künstlerisch zu seiner Zeit ins Verhältnis zu setzen, wozu er sich mit den Bildwelten des Jugendstil und seinen zahllosen erotisierenden Frauendarstellungen auseinandersetzt. Im Oktober 1904 nimmt Paul Klee die Arbeit an der Radierung »Weib und Tier« (Inv. 1, II. Fassung) auf. Die wie aus der Erde aufwachsende athletische Frau, halbnackt mit herabgleitendem Gewand, wendet sich einem mageren, lüstern schnüffelnden Hund zu und scheint ihm eine Blüte herablassend willig zu reichen, eine psychologisch komplex angelegte Verführungsszene. »Das Tier ist das Tier im Menschen (im Manne). Es belästigt ein Weib vorläufig durch unanständiges Beriechen. Moral für Schwachbegabte: Das Weib, das edel sein soll, aber in effektvolle Beziehungen zum Tier gebracht ist, stellt etwas ebenso durchaus Wahres vor. Zweck: Läuterung zum Menschlichen«, schreibt Klee an Lily Stumpf. Die satirische Deutung scheint auf mehrschichtige, nicht eindimensional erotische Wirkung bedacht. Zu sehen ist »eine Dame, welche sich nicht ganz unempfänglich zeigt. Die Damenpsyche wird leicht entschleiert.« Die in den «Inventionen« gesuchte künstlerische Orientierung erreicht im März/April 1905 einen emotionalen Tiefpunkt: »O Satire, Du Leid der Intellektuellen.« (Paul Klee) »Eben druckten wir ›Das drohende Haupt‹. (...) Der Abschluß ist düster genug. Irgendein vernichtender Gedanke, ein scharf negierender kleiner Dämon über einem hoffnungslos resignierten Antlitz.« (Paul Klee) Der frontal gesehene Kopf mit aufgerissenen Augen und zusammengepreßtem Mund zeigt sich als betont antiklassische Kopfgeburt, Variation über Zeus, aus dessen Haupt nicht Athena als Göttin lichter Weisheit hervorbricht. Vielmehr wird ein mürrisch und zornig dreinblickender Orientale dargestellt, dem ein Kobold mit Dornengeweih und dürren Armen, einer Ratte oder einem unheimlichen Wesen aus der Unterwelt nicht unähnlich, zu entwachsen scheint. DT Armin Zweite (Hg.): Paul Klee – Das Frühwerk 1883–1922. Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus München 1979 Jochen Lempert Jochen Lempert (geboren 1958, lebt in Hamburg) ist ausgebildeter Biologe. Seine Fotokunst-Arbeiten wie die »Physiognomischen Versuche I« bewegen sich zwischen Wissenschaft und Kunst. Der Titel deutet einen offenen Prozeß an, eine erste Versuchsreihe mit Gesichtern uns mehr oder weniger bekannter Tiere. Der Fotograf greift hier die Methoden des Forschers auf – das vergleichende Betrachten, die Inszenierung naturhistorischer Kabinette. Aus dem reichen Fundus der Biodiversität nimmt er einige Exemplare, um sie aus der Nähe zu besehen. Zugleich aber entzieht er diese dem ordnenden Zugriff des Naturforschers. Die unkonventionelle Gruppierung folgt nicht tierphysiologischen Kriterien. Vielmehr zielt die Recherche auf die menschliche Wahrnehmung des Tieres, die Physiognomie, so wie wir sie ›lesen‹. Fische, Vögel, Affen und immer wieder Hunde, Schafe und Schlangen, heimische und exotische, Haus-, Nutz- und wilde Tiere blicken uns aus den Fotos heraus an. Unweigerlich fühlen wir uns als ihr Gegenüber angesprochen. Die ›malerische‹ Bearbeitung des Fotomaterials, Unschärfe-Effekte und gewölbtes Papier vermitteln subjektive Nähe und Porträthaftes. Wir fühlen uns dabei ertappt, Tiere nicht nur als Gattungswesen, sondern als Individuen anzusehen: Wie beim Blick in ein Menschengesicht reagieren wir mit Sympathie oder Antipathie, wenn nicht sogar mit konkreten Charakterurteilen. Nach einer Art »natürlicher Physiognomik« (Hegel) schließen wir mit unserem Alltagsverstand von der äußeren Erscheinung auf ein »Inneres«. Wie spekulativ diese Lektüre des Gesichts als Spiegel der Seele ist, offenbart Lemperts Zusammenstellung. Die Fülle unterschiedlicher Gesichter läßt uns zögern. Vorrationale Zugänge – vermittelt etwa durch das Kindchenschema, das hier ein Rüssel, dort ein zu großer Mund stört – werden irritiert. Der zweite Blick offenbart das Ausmaß an menschlicher Projektion, das unsere alltäglichen Tierbilder prägt. Diese anthropozentrische Deutung des Tiers weist auf eine lange Tradition der Physiognomik als moralisierender Charakterkunde. Seit ihrer Frühzeit war die Fotografie hierfür bevorzugtes – in Kriminologie und Rassentheorie mißbrauchtes – Instrument. Giambattista Della Porta, einer der ersten Physiognomen, erfand Ende des 16. Jahrhunderts die Camera Obscura. FE Jochen Lempert – 365 Tafeln zur Naturgeschichte. Kat. Bonn/Freiburg 1997; Claudia Schmölders: Das Vorurteil im Leibe – Eine Einführung in die Physiognomik. Berlin 1995 Marcus Weber Die Affen von Marcus Weber (geboren 1965 in Stuttgart) beobachten uns nicht von Bäumen aus, sondern von Balkonen. Mit der inszenatorischen Verschiebung aus dem Dschungel in die städtische Zivilisation geht eine Reihe von Widersprüchen einher. Mag das Fell der Tierfiguren haptisch anziehend wirken, so distanziert uns ihr starrer Blick. Was erfaßt dieser beobachtende Blick? Kann er überhaupt etwas erkennen? Wenn nicht, ist dann der Fellüberzug nur Maske? Aber was wird maskiert? Sind diese Gestalten eher dem Spielzeug ähnlich, oder dem Tierpräparat (was immerhin die Tötung des Tieres voraussetzt)? Wie barocke Emblemata scheinen Webers skulpturale Denkbilder Sinn zu verkapseln, allerdings nicht den sprichwortartig auflösbaren der historischen Sinnbilder mit Motto, Bild und ausdeutendem Kommentar. Marcus Weber bringt es fertig, seine hängenden Tierskulpturen in die lange Tradition der Tierfabeln, Emblemata und physiognomischen Charakterkunden von Mensch und Tier zu stellen, ohne ins Narrative, Anekdotische oder Urteilende zu geraten. Übrig bleibt, daß uns Affen und Kunstwerk anstarren – und unserer Realität einen von subjektiver Absicht und Deutungsverfügung unabhängigen Ort entgegensetzen, wie ihn Adorno beschrieb: »Der Ausdruck der Kunstwerke ist das nicht Subjektive am Subjekt, dessen eigener Ausdruck weniger als sein Abdruck; nichts [ist] so ausdrucksvoll wie die Augen von Tieren – Menschenaffen –, die objektiv darüber zu trauern scheinen, daß sie keine Menschen sind.« Adorno, der sich die permanente zivilisatorische Unterwerfung von äußerer und innerer Natur durch den Vernunftmenschen keineswegs idyllisch vorstellte, erkannte im Unverfügbaren des Ausdrucks, mit dem Kunstwerke oder Tiererscheinungen uns unwillkürlich anspringen, eine überraschende Nähe des spätmodernen Menschen zum Tier: »Im clownischen Element erinnert Kunst tröstlich sich der Vorgeschichte in der tierischen Vorwelt. Menschenaffen im Zoo vollführen gemeinsam, was den Clownsakten gleicht. (...) Nicht so durchaus ist der Gattung Mensch die Verdrängung ihrer Tierähnlichkeit gelungen, daß sie diese nicht jäh wiedererkennen könnte und dabei von Glück überflutet wird; die Sprache der kleinen Kinder und der Tiere scheint eine. In der Tierähnlichkeit der Clowns zündet die Menschenähnlichkeit der Affen; die Konstellation Tier/Narr/Clown ist eine von den Grundschichten der Kunst.« MW Elisabeth Hautmann In »Herr und Hund«, einem kleinen Prosastück von 1919, beschreibt Thomas Mann in anrührend persönlicher Sprache das private Leben mit seinem Hund Bauschan. Es sind feinsinnige Beobachtungen der Wahrnehmung und des Verhaltens des Tieres, aber auch des Einflusses auf das Herrchen selbst. Gerade das Gegenteil unternimmt der australische Soundpoet Chris Mann in seinem Radioprojekt »Hundegeschichten«, realisiert 1989 für die »Ars electronica«. In lokalen Radiostationen wurden Zuhörer aufgefordert, ihre Hundegeschichten zu erzählen. Chris Mann war am Immergleichen solcher Geschichten interessiert: »Die Hundegeschichten sind eine Untersuchung von Versionen eines Themas. Es geht um die Ähnlichkeiten, um Muster. Hundegeschichten sind ähnlich wie Couplets oder einfache Gedichtformen oder Schulstundenpläne.« Irgendwo dazwischen verortet sich die Situation, die Elisabeth Hautmann (geboren 1960 in Neustadt) mit ihrer Installation »Ohne Titel« von 1995 entstehen läßt: Vor einem Tisch mit zwei Stühlen sitzt ein Rauhaardackel mit erhobenen Vorderpfoten und bettelt. Ein Projektionsraum, der sowohl bekannte Muster in Erinnerung ruft, als auch für subjektive Erzählungen und Stimmungen offen bleibt. Der Dackel, der vor dem Tisch bettelt, bettelt ins Leere. Niemand sitzt auf dem Stuhl, nichts liegt auf dem Tisch – der künstliche Ort bleibt frei für jede mögliche zwischenmenschlich/tierische Beziehung. Sowohl in der professionellen wie in der Alltagspsychologie steht der Hund für Triebe und Triebzügelung, für Gefühle und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Zuneigung und Gehorsam. Ein ausgestopfter Dackel dient Hautmann dazu, über Menschen zu sprechen. Elisabeth Hautmann läßt häufig Innenraumsituationen entstehen, die eigentlich psychologische Räume sind und persönliche Verfassungen, Familien- und Generationsgeschichten spiegeln. In »Passion and the Interest« von 1996 etwa ist ein Detail das »Jagdzimmer«: Ein schwerer Schreibtisch, mit Chefsessel, hinterlegt von einer eindrucksvollen Galerie von Geweihen; ein Gewehr lehnt an einem halbhohen Schrank, Reh- und Wildschweinfelle rings auf dem Boden; ein zweiter Stuhl steht vor dem Schreibtisch und läßt die Situation eines Verhörs assoziieren. Mit wenigen prägnanten Objekten rekonstruiert die Künstlerin »private« Orte, deren Psychologie, Soziologie und Symbolik. Tierisches verweist auf Menschliches, die Beziehungen zueinander sind in beider Überresten eingefroren. DE Christiane Möbus Christiane Möbus (geboren 1947 in Celle, lebt in Hannover und Berlin) arbeitet mit präparierten Tieren. Mit Flügeln aus Flugentenfedern greift sie 1972 den alten Menschheitstraum vom Fliegen auf. Mit Krähen läßt sie 1982/83 an die animalische Bedrohung in Hitchcocks »Die Vögel« denken. Mit einem Schiff »Auf dem Rücken der Tiere« (1994) verkehrt sie die im Bild der Arche Noah gefaßte Schicksalsgemeinschaft von Mensch und Tier zu einer Konfrontation auf Kosten der Natur, von der wir abhängig sind. Das Tier erweist sich als die andere Seite des Menschen, der »janusartig Aug in Auge mit sich selbst konfrontiert wird«. Möbus setzt unerwartete Beziehungen. Spannungsreiche Gegensätze von Formen und Ideen regen eine Fülle von Assoziationen an. So trifft in der Arbeit mit den beiden Eisbären das Körperliche, Organische auf kühle Geometrie, der extreme Realismus ausgestopfter Tiere auf abstrakte, perfekt geformte Holzkegel. Die Tiere liegen auf dem Rücken und balancieren mit allen vieren weiße Hütchen. In diesem Balanceakt scheinen die Widersprüche formal zunächst merkwürdig aufgehoben. Unweigerlich aber stellt sich das Bild von der Spitze des Eisbergs ein und mahnt vor nicht beachteten Gefahren. Wie bei der auf Tierrücken lastenden Arche erweist sich die Konstellation als labil. Das Gleichgewicht ist nicht dauerhaft eingefroren. Vielmehr läßt uns die spielerische Leichtigkeit, mit der es hergestellt wird, seine Kurzlebigkeit erahnen – die Stille vor der Katastrophe. Die Eisbären vermitteln den Eindruck, sich gleich weiterzubewegen, und »tödlich«, so der poetische Titel, kann der Ausgang ihres Spiels sein. Das erhabene Thema der Selbsterhaltung vor übermächtigen Ereignissen führt die Betrachtung auf eine existentielle Ebene: Was ist unsere Rolle in dem komplexen, schwer einsehbaren Wechselspiel von Natur und Kultur: Opfer oder Täter? Wir geben dem reflexhaften Bedürfnis, das Fell der Raubtiere zu streicheln, nicht nach, um den scheinbar glücklichen Moment nicht zu gefährden. FE Christiane Möbus – Auf dem Rücken der Tiere. Kat. Kunstverein Braunschweig 1994 Christiane Möbus – laute und leise Stücke. Kat. Kunstverein Hannover 1997 Valie Export/Peter Weibel Mit einem Seitenhieb gegen Wiener Künstlerkollegen, die um 1965/1970 mit orgiastischen Inszenierungen für Aufregung sorgten, erläutert Peter Weibel 1984: »Der bloße Einsatz des Tieres als Fleisch scheint den symbolischen Reichtum des Tieres zu verengen. Ich habe es daher vorgezogen, nur partielle Eigenschaften von Tieren zu verwenden, oder selbst als Tier zu sprechen, wie in meiner Fotosequenz ›Porträt des Künstlers als junger Hund‹ (1967) oder in der Aktion, gemeinsam mit Valie Export, ›Aus der Mappe der Hundigkeit‹ (1968), wo ich als Hund auf allen Vieren über die Straße marschierte.« An der Leine läßt Weibel (geboren 1945 in Odessa) sich von Valie Export (geboren 1940 in Linz) ins belebteste ›Gassi‹ Wiens, die Kärntner Straße, führen, wo die beiden öffentliches Aufsehen, Irritation und Wut erregen. In scheinbar absurder Verkehrung tradierter Beziehungsmuster von Mensch und Tier (sowie von Mann und Frau) führen sie ein Rollenspiel auf, das in Abwendung vom archaischen Pathos des Wiener Aktionismus auf eine Medienreflexion überleitet. Im Visier sind die konventionellen Informations- und Unterhaltungsstrategien der Massenmedien, die – so die Kritik der Künstler – durch ihre »Identifikationsstrukturen« Bild und Wirklichkeit gleichsetzten und das Bewußtsein betäubten (Weibel 1971). Wenn Weibel mit ›Frauchen‹ durch die Stadt kriecht, führen die beiden hingegen eine Art erweiterten Film (»expanded cinema«) vor, der unmittelbar in die Wirklichkeit hineinreicht und die Zuschauer mit realen Personen konfrontiert. Die anscheinend perverse Handlung dieses »aktionsfilms« liefert die schonungslose Analyse einer Gesellschaft, die längst selbst pervertiert ist, diese Perversion aber nicht wahrnehmen will oder – aufgrund der verschleiernden Praktiken der Medien – nicht wahrnehmen kann. Die Rolle des Hundes offenbart den wahren Status des Menschen, der von seinesgleichen erniedrigt wird. Unter dem Slogan »Aus der Mappe der Menschlichkeit« beklagte eine humanitäre Vereinigung solche Mißstände – Export und Weibel wenden den Titel dialektisch: »hündisch zu gehen bedeutet, sich dem gang der zeit zu beugen, den gang der zeit zu zeigen! bedeutet, die utopie des aufrechten ganges in unserer tierischen gemeinschaft als uneingelöstes versprechen zu proklamieren.« (1970) FE Symbol Tier. Kat. Galerie Krinzinger/ Forum für Aktuelle Kunst Innsbruck 1984; Exhibition. Kat. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien 1994 Francis Bacon Francis Bacon (geboren 1909 in Dublin, gestorben 1992 in Madrid) gehört zu den bedeutenden und legendären Persönlichkeiten der Malerei des 20. Jahrhunderts. Die Darstellung des Menschen als in unbändiger Vitalität wie in seelischer und metaphysischer Verlorenheit befangenes Wesen bestimmt sein Werk. Seine Bilder vereinen hohe Intensität mit künstlerischer Distanz. »Ich versuche lediglich Bilder zu machen, die so akkurat wie möglich meinem Nervensystem entnommen sind.« Betrachtet man Körperhaltung und Anatomie, so scheint das Bild einen Affen im Käfig zu zeigen. Der eine Arm hängt herab. Die linke Hand umklammert die Stange, während der rechte Arm die Balance des unsicheren Sitzens auszugleichen sucht und doch ins Leere greift. Der Kopf ist zurückgeworfen, das Maul mit gebleckten Zähnen wie zum wahnsinnigen Schrei geöffnet. Der Körper erscheint nahezu durchsichtig. Die Gitterstäbe entmaterialisieren sich zur diagonal strukturierten Fläche, ein diffuser Außenraum hebt sich von der düster kalten Atmosphäre des Käfigs ab. Suggeriert der Titel die Darstellung eines Schimpansen, so blickt unverwandt ein dem Menschen nahestehendes Wesen den beunruhigten Betrachter an. Zudem zeigt sich der aufgerissene Mund zwischen aggressivem Schmerz, verzweifeltem Aufschrei und tiefem Atemholen als ergreifendes Bild körperlicher Geworfenheit, dem der gerichtete Blick Bewußtsein vom Selbst unterlegt. Hier hat keine großmächtige Seelenempfindung mehr Platz, sondern gerade im Tier findet sich diesseits allen vernünftigen menschlichen Bewußtseins das Menschliche als in Leiblichkeit begründet. So schafft Bacon ein Zwischenreich der vitalen Existenz, skizziert den Raum zwischen Mensch und Tier in labiler Ambivalenz. Dabei geht es nie um Illustration, sondern um den Prozeß der Malerei, für Bacon »Austoben des Kopfes und der Hand« (Michel Leiris 1983). Er steht hier Georges Batailles Kritik an der fortwährenden »idealistischen Selbsttäuschung« nahe, die der Mensch an sich verübte. Das Menschliche im Tierischen oder Fast-Tierischen offenbart sich, wo Bacon sich als Maler und Künstler von seiner menschlichsten, existentiell betroffenen Seite zeigt. Sinn entsteht in der Abwesenheit von Sinn: »Ich halte das Leben für bedeutungslos, aber so lange wir leben, geben wir ihm Bedeutung.« DT Peter Beye, Dieter Honisch (Hg.): Francis Bacon. Kat. Staatsgalerie Stuttgart, London 1985 Salvador Dalí »Meine Liebe geht durch die Seele, meine Erotik durch das Auge.« Altmeisterlich gezeichnet und gestochen reiht sich Kopf an Genital in lustvollem Reigen um die nackt mit gesenktem Haupt erscheinende Frau. Die Säfte der Lust strömen, es trieft allenthalben, doch mit eigentümlicher Distanz. Das Buch »Les métamorphoses érotiques« (1969) von Salvador Dalí (geboren 1904 in Figueras, gestorben 1989 ebenda) ist weniger ein Lehrbuch sexueller Animation als ein Orbis pictus der erotischen Metamorphose einer in belehrenden Bildern systematisierten Welt. Die Bilder sind zwei Übermalungen einer altertümlichen Lehrbuchillustration, die Dalí seiner paranoisch-kritischen Methode unterzogen hat. Hier die Fantasie sodomitisch sündiger Lust, dort die Transformation eines sinnlich brutal sich aufdrängenden Gesichts. In mehr als sechzig Seiten entfaltet sich eine erotisierte Welt aus Lichtdrucken, reproduzierten Zeichnungen, Gemälden und eksaltierten Überarbeitungen. Der metamorphotische Blick amalgamiert alles: von Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs über Früchte bis zu Löwe und Schaf und den zahllosen nahen und fernen Verwandten des homo sapiens. All dies kann die Sinne als libidinöse Sensation affizieren. Den Einsichten, die Sigmund Freud in das Unbewußte des Menschen eröffnet hat, gibt Dalí bildliche Anschaulichkeit. Sexuelle Lust zeigt Dalí als Tierähnlichkeit des Menschen, nur um letztlich tierischen und menschlichen Trieb scharf zu trennen. Das Buch ist nur für die Gier des Auges gemacht, als Ort sinnlicher Imagination, denn, so schreibt Salvador Dalí, »(...) die erhabene Perversion und die schärfste Lust, die, die meine Lippen verzerrt und von den Zähnen zieht, ist die jähe Vereitelung des Begehrens, der unerwartete Stillstand, die Niederlage. (...) Ich meine heute, daß meine Erotik nicht ohne Verbindung zu dem alten Einfluß der Katarer ist, zur Mystik der Troubadoure und der höfischen Liebe, zu den Genüssen des Nichtvollzugs, den Vergeistigungen des Akts durch Entzug, dem Wiederaufsteigen der Kräfte des Orgasmus zum Gehirn, der Umkehrung des Stroms und der dadurch hervorgerufenen Erleuchtung des Gehirns. (...) Große intellektuelle Orgasmen, die von einem greifbaren Fast-Nichts ausgehen. Die Begierde als verwandelter Wert: der Koitus, verinnerlicht, der auf die Spitze des Pinsels zurückstrahlt.« DT Karin von Maur (Hg).: Salvador Dalí 1904–1989. Kat. Staatsgalerie Stuttgart 1989 Rudolf Schwarzkogler Bereits in der ersten Aktion von Rudolf Schwarzkogler (1940 in Wien geboren, 1966 in Wien gestorben), die den Titel »Hochzeit« trägt und 1965 in der Wohnung von Heinz Cibulka stattfindet, gehören Tiere zum »Material« des Stückes. Die Aktion ist fotografisch dokumentiert, ihre Partitur listet Werkzeuge und Objekte auf. Auf einem weiß gedeckten Tisch befinden sich u.a. »ein schwarzer Spiegel mit Heringen, Messer und Scheren, (...) Gläser mit blauer Farbe, (...) Eier, ein Huhn, ein Hirn, (...) Mullbinden«. Die Handlungen, die Schwarzkogler mit diesen Objekten und am Leib der Akteure vollzieht, müssen auf das Publikum der sechziger Jahre befremdlich und schockierend wirken: »S. umwickelt einen Fisch mit einer Mullbinde und legt ihn auf den schwarzen Spiegel. Mit einem Glas wird blaue Farbe auf den Tisch gegossen. Ein Fisch wird mit dem Messer aufgestochen, mit der Schere aufgeschnitten. Gelbe Kristalle werden hineingeschüttet. Das Huhn, das in ein weißes Tuch gehüllt ist, wird mit blauer Farbe übergossen (...) Zwei aufgeschnittene Fische werden mit rosa Blüten gefüllt, mit blauer bzw. roter Folie umwickelt und an die Wand genagelt.« Die körperbezogene Dramatik steigert sich in späteren Aktionen und berührt tiefe gesellschaftliche Tabus: »Der Körper Cibulkas und besonders sein Penis werden vor einer weißen Wand oder auf einem weiß gedeckten Tisch mit Mullbinden umwickelt; aufgeklaffte Fische werden über den Penis gestülpt, und umherliegende Rasierklingen und Blutspuren evozieren die Vorstellung von Verletzung und Kastration« (Dieter Schwarz). In seinen Stücken kombiniert Schwarzkogler Elemente aus den spektakulären Aktionen von Nitsch, Mühl und Brus, die sich 1965 gemeinsam mit Schilling, Frohner und Schwarzkogler zur »Wiener Aktionsgruppe« erklären. Automatismus, Ekstase, dichtes sinnliches Erleben in symbolischen Handlungen sind die künstlerischen Mittel, um im bedrohend engen, geschichtsverdrängenden Klima der österreichischen Nachkriegsgesellschaft in der extremen Selbsterfahrung eine Befreiung von psychologischen, sozialen und moralischen Zwängen zu erreichen. Im Zentrum steht der Körper, als Basis unseres Wahrnehmens, Denkens und Handelns. Er ist das eigentliche Material der Aktion, für den das Tier, an dessen totem Leib das Verdrängte stellvertretend ausgelebt wird, eintritt. DE Von der Aktionsmalerei zum Aktionismus. Wien 1960–1965. Klagenfurth 1988 Piero Steinle Wer 1969 in der Galleria l’Attico in Rom die Ausstellung von Jannis Kounellis besuchte, fand in der weiß getünchten ehemaligen Garage zwölf lebende Pferde. Ihre dampfenden Leiber belebten für die Dauer der Kunstschau den Raum. Kounellis verstand diese Aktion als eine Dramatisierung der Malerei und damit der Kunst überhaupt. »Dodici Cavalli Vivi / Zwölf lebende Pferde« – so der Untertitel – ließ im White Cube des Galerieraumes eine dichte sinnliche Erfahrung entstehen. Gute zwanzig Jahre später zeigt Piero Steinle (geboren 1959 in München) seine Installation »Tierkörper«. Auch er liefert eine schockierend andere Erfahrung im Kunstraum: In den raumfüllenden Diaprojektionen seiner hochperfekten Schwarzweißfotografien sieht man ebenso Tiere in der vollen Präsenz ihrer Körperlichkeit – sie alle aber sind tot. Seine Installation versuche, sagt Steinle, »eine Reise in die fremde animalische, uns ernährende und umgebende Körperwelt, sie sucht den Kontakt mit einem nahen fernen Universum: mit uns selbst«. Ausgehend von der Architektur als Ausdrucksträger, geht Steinle aus dieser Perspektive auf Räume fotografisch zu, untersucht deren praktischen Gebrauch wie ihre inhaltliche Besetzung. Der »exotische« Raum, in den er den Betrachter mit der Serie »Tierkörper« führt, sind die modernen Verarbeitungsanlagen von überflüssigen Tierkörpern in einer industriellen Gesellschaft. In den Stilleben des Barock ist das tote Tier ein Memento mori und damit immer auch Spiegel unserer eigenen existentiellen Bedingungen als sterbliche Kreaturen. Wie schonungslos ein solches Memento mori am Anfang des 21. Jahrhunderts aussehen kann, zeigt Steinle mit der schockierenden Intensität seines dunklen Projektionsraumes und mit bewußtem Aufwand ästhetisierender Mittel. Das 60minütige Bildprogramm der Fotoinstallation wird durch ein akustisches Programm aus Originaltönen und elektronischen Tönen verdichtet. Steinles Schwarzweißfotografien zeigen Rinder, Hühner, Schweine, Schafe. Er inszeniert die Körper isoliert vor schwarzem Grund, drapiert das tote Fleisch der Tierleiber zu eindringlichen Skulpturen und zeigt die leblosen Körper im Kontext des sachlich maschinalen Ambientes des industriellen Verwertungsbetriebes. Im Unort der Tierkörperverwertung prallen die Idealisierung und Sentimentalisierung des Tieres und die Bürokratisierung und Mechanisierung des Todes und dessen gleichzeitige Tabuisierung in unserer Gesellschaft aufeinander. DE Albert Oehlen Im Klima der Jungen Wilden Malerei der achtziger Jahre desavouiert Albert Oehlen (geb.1954 in Krefeld) Malerei durch Malerei in postsurrealistischen Imaginationen. Abgenutzter symbolischer Konsens, etwa die Taube als Emblem des Friedens, wird aufgekündigt. Die fette Friedenstaube, mit strahlend glotzenden Augen grob skizziert, segelt behäbig lustlos über eine linear strukturierte Welt. Ihr fehlt die charmant naive Leichtigkeit der Versöhnung und Frieden suggerierenden Vogelikone, wie sie als elegante Graphikertaube mit Ölzweig in den vorausgegangenen Jahrzehnten populär geworden war. Der Flügel verwandelt sich in eine Hand, die eine Pistole umgreift. Emotional gut transportierbaren Slogans der Friedensbewegung – »Frieden schaffen ohne Waffen!« – antwortet sie realistischer und zugleich abstruser: »Frieden schaffen mit immer mehr Waffen.« Die wie von einer Düse vorwärtsgetriebene Friedenstaube entsteht in einem Jahr, in dem die Raumfähre Challenger explodiert, der Supergau von Tschernobyl die Welt erschüttert, der »Hamburger Kessel« der Polizei 800 Atomkraftgegner einschließt, Tripolis durch die USA bombardiert wird und sich die Attentate auf den schwedischen Reformpolitiker Olov Palme, den Atomphysiker Kurt Beckurts und dessen Fahrer sowie den Diplomaten Gerold von Braunmühl ereignen. Der Reigen von Gewalt, Tod und Vernichtung ist stets begleitet von der trügerischen Hoffnung auf eine bessere, fortschrittlichere, alle Menschen beglückende Gegenwart und Zukunft. Vielleicht zynische, jedenfalls bleibende Aktualität offenbart Oehlens unfriedliche Taube heute angesichts des Kriegs gegen den Terrorismus, der Zerreißproben von Parteien und Regierungen am Rande der Krise. Bei Oehlen behauptet sich der »Hunger nach Bildern« (Max G. Faust) als bissiges Experiment. »Er rekapituliert nicht das Gewesene, sondern erfindet das Kommende«. (Carsten Ahrens) Zugleich geht es um den Ge- und Verbrauch von Kunst. »Der Anspruch an ein Kunstwerk ist so hoch, daß man gerade deswegen nicht will, daß es sich manifestiert. (...) Dann müßte man ja glücklich sein, (...) und das wäre dann der Endpunkt. (...) Man will das natürlich auch in gewissem Grade abnutzen durch Draufgucken.« (Albert Oehlen) Diesem Abnutzungsprozeß von Kunst setzt Oehlen Destruktion als konstruktiven Vorschlag entgegen. DT Carl Haenlein, Carsten Ahrens (Hg.): Albert Oehlen – Terminale Erfrischung. Kat. Kestner Gesellschaft Hannover 2001 Sarah Lucas Zwei berühmte Kreationen amerikanischer Spaßkultur sind die Comicfigur Bugs Bunny und das Playboy-Häschen. Der schlacksige Comic-Hase Bugs Bunny mit seinem New Yorker Vorstadtakzent und seiner smarten Unverschämtheit bedient im Zeichentrick brutalisierte Vergnügungsfantasien. Hugh Hefners Playboy Bunny dagegen ist die weibliche Variante des vermenschlichten Tieres bzw. des animalisierten Menschen. Liefert es die gewünschten Maße an Busen und Po, wird es für den männlichen Lustgebrauch verziert mit weißen Häschenohren und einem niedlichen Stümmelschwänzchen. Sarah Lucas‘ (geboren 1962 in London) Arbeit »Häschen gerät in eine schwierige Lage« läßt unmittelbar weder Hase noch Blondine erkennen. Der Titel, die Accessoires und ihre Anordnung aber konstruieren ein animalisches Bedeutungsspiel voll boshaften Humors, in dem sowohl die Projektionen des männlich brutalen Alltagshelden wie die des unterdrückten weiblichen Opfers aufscheinen. Zu Lucas’ Installation gehören neben einem blauen Bürostuhl, Füllwatte und Draht vier Paar Nylonstrümpfe. Die Anzahl der Nylons – seit ihrer Erfindung reizsteigernder Fetisch – und ihre Inszenierung lassen kaum Zweifel am sexistischen Abgrund hinter dem Spielerischen von Titel und Machart dieser Arbeit. Mit Watte gefüllt, ist eine der beigen Nylonstrumpfhosen so über die Rückenlehne gestülpt, daß sie mit gespreizten Beinen auf der Sitzfläche des Bürostuhles zu liegen kommt. Über die langen dünnen Schenkel dieses Wesens ohne Oberleib sind zwei weiße Strapse gestreift, die verdunkelte Naht im Schritt wird zum künstlichen Schamdreieck. Schlapp wie zwei Hasenohren hängt darüber eine weitere Strumpfhose rechts und links die Rückenlehne hinab, eine dritte, mit Watte gefüllt, knickt nach vorne ab. In der Alltagsikonographie ist der Bürostuhl ebenso Chefsessel (und damit Zeichen der Macht) wie Opferaltar des Bürohäschens. Auf ihm wird nicht nur der Fetisch Strumpfhose, sondern auch dessen Trägerin zum Objekt der Begierde und – mit aggressiv verniedlichendem Tiernamen versehen – zum entindividualisierten Sex-animal. Letztlich aber ist es der Betrachter selbst, der in dieser hintersinnigen Inszenierung von Sarah Lucas in eine schwierige Lage geraten kann: Sei es, daß er seine eigenen »Häschen«-Anteile wiedererkennt oder aber seine Lust an der fetischisierten Wahrnehmung ausgestellt sieht. DE Stephan Balkenhol Der 1957 in Fritzlar geborene Bildhauer Stephan Balkenhol arbeitet seit den achtziger Jahren an eigentümlich nahen und zugleich fernen menschlichen Gestalten. Auch tummeln sich Löwen, Stiere, Nashörner, Giraffen, Hühner, Pinguine und Seehunde in seiner (Kunst-)Welt, die Ende der siebziger Jahre nach den Desillusionen und Reflexionen von Minimal Art und Concept Art kaum noch möglich schien. Aus einem Stamm mit suchend formgebenden Beilhieben geschlagen, erscheint auf mittelhohem Sockel ein zweiköpfiges Wesen mit festem Stand. Aus dem Körper eines Löwen wachsen zwei Hälse, die in hundeartigen Häuptern enden. Der eine fletscht die Zähne, der andere scheint gespannt und still zu lauern. Flügel an den Seiten vollenden das Mischwesen aus dem Jahr 1992, das seine Ahnen unter den mittelalterlichen Grotesken gotischer Kirchen findet. Fest in der gestalterischen Struktur, doch eher Skizze als klassisch durchgeformt, zeigen sich die Arbeiten werkgerecht gegenüber dem Material und dem Herstellungsprozeß – entfernter Nachhall der minimalistischen Analyse seines Lehrers Ulrich Rückriem. Balkenhol: »Ich will alles auf einmal: Sinnlichkeit, Ausdruck, aber nicht zuviel, Lebendigkeit, aber keine oberflächliche Geschwätzigkeit, Momentanität, aber keine Anekdote, Witz, aber keinen Kalauer, Selbstironie, aber keinen Zynismus. Und in erster Linie eine schöne, stille, bewegte, viel- und nichts-sagende Figur.« Zwischen materialer Konkretion und erzählend realistischer Illusion wird die im Konzeptualismus der sechziger und siebziger Jahre scheinbar verloren gegangene Magie des Bildwerks erprobt, die nach der Kraft des statuarischen Bildwerks fragt, ohne illustrierende Antworten zu versuchen. Funktioniert im spätmodernen Zeitalter von High-Tech-Rakete, Klimakatastrophe und Atomkraft-GAU ein Drache noch als Skulptur? Dabei geht es Balkenhol nicht um die Darstellung des Schrecken erregenden Grauens, sondern um die metaphorisch zeichenhafte Umdeutung einer mittelalterlichen Bildfindung. Das Mischwesen, das über die Evolution hinausgeht, könnte unversehens als aktueller Beitrag zur Genmanipulation erscheinen, als monströse Vervielfältigung, als Produkt der Fantasie, als Ausdruck von gegenwärtiger und kommender Angst. »Die Figur soll über sich hinauswachsen, über sich und über andere Dinge erzählen, ohne sich zu verrenken und Grimassen zu schneiden. Vielleicht ist das ja das religiöse Element.« (Balkenhol) DT Stephan Balkenhol: Über Menschen und Skulpturen. Kat. Witte de With Rotterdam, Ostfildern 1993 Wols Mit Fotografien, Zeichnungen, Gemälden und Radierungen eröffnet Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze, geboren 1913 in Berlin, gestorben 1951 in Paris) eine sarkastische Sicht auf die menschliche Existenz als Spielball nicht beherrschbarer Mächte. Natürliche Formen zeigt Wols nicht als Urordnung, eher als Urschleim der Schöpfung. In der Zeit um den Zweiten Weltkrieg, in der täglich durchlittenen Zerrüttung jeglicher Entwürfe und Selbstbestimmung, wird ihm Kunst zum Medium der Suche. Man kann »L´Arche de Noe« (1940) kaum als Bild hoffnungsfrohen Überlebens der Menschheit in göttlicher Bereitschaft zur Versöhnung auffassen, angesichts der menschlich verursachten Sintflut des gerade ausgebrochenen Weltkriegs. Ein Schiff mit skurriler Takelage beherbergt Tiere, die der Wiederbelebung der Erde dienen sollen. Gazelle, Antilope, Elefant, Kamel, Giraffe und Fuchs sind zu erkennen, aber auch Urtierchen, Amöben. Das Menschenpaar karikiert Wols als zwei Nachtschwärmer, armlos und handlungsunfähig, dem Unbill der Natur – und der Geschichte – ausgeliefert, er mit kess zurückgeschobenem roten Hut, zur Unkenntlichkeit zerschlagener Physiognomie und zipfeliger Hemdbrust, die kleinere Gestalt – eine Frau? – mit tiefschwarz geränderten Augen, lasziv geschürzten Lippen und organisch verquollenem Körper. Gleich schemenhaften Segeln an gebrochenem Mast wachsen beide aus einem Gefährt auf, dessen papierdünne Wände an die Umzäunung eines Lagers erinnern. Wols erlebt zwischen September 1939 und Oktober 1940 eine Odyssee durch fünf Internierungslager. Mit Wols sind u.a. Hans Bellmer, Max Ernst, Lion Feuchtwanger, Heinrich Davringhausen, Anton Räderscheidt und der Kunsthistoriker Max Raphael interniert. Wols’ späterer Frau Gréty gelingt es, Papier, Tusche, Aquarellfarben in die Lager zu schmuggeln. So stabilisiert sich inneres Überleben trotz beginnender Alkoholexzesse unter menschenunwürdigen Lebensbedingungen. Wols arbeitet besessen an seinen Zeichnungen, vom Surrealismus und den Notaten Yves Tanguys angeregt, doch mit eigenem, bizarr abgründigem Humor. Befreit durch die Hochzeit mit Gréty, zieht er sich nach Dieulefit zurück. Hier entsteht »La Reine des Grenouilles« (1942). Halb durchlichtete Zellakkumulation, halb anthropomorphes Sumpfgespenst, scheint die »Königin der Frösche« den Betrachter zu fixieren mit fernem Ernst, unendlichem Wissen und unendlicher Macht. DT Claus Mewes: Wols. Aquarelle, Zeichnungen, Notizblätter. Kat. Kunsthaus Hamburg 2000 Max Ernst »1906 Der Vogelobre Hornebom. Ein Freund namens Hornebom, ein kluger buntgescheckter treuer Vogel stirbt in der Nacht; ein Kind, das sechste in der Reihe, kommt in selbiger Nacht zum Leben. Wirrwarr im Hirn des sonst sehr gesunden Jünglings. Eine Art Ausdeutungswahn, als ob die eben geborene Unschuld, Schwester Loni, sich in ihrer Lebensgier des lieben Vogels Lebenssäfte angeeignet hätte.« So beschreibt Max Ernst (geboren 1891 in Brühl, gestorben 1976 in Paris) in seiner Autobiographie frühe Erinnerungen an die Vermengung zwischen Mensch und Vogel. Mischwesen bevölkern geradezu obsessiv das Werk bis in die späten Jahre. Für seinen Roman »Une semaine de bonté« (1934) benutzt Ernst Illustrationen aus Zeitschriften des 19. Jahrhunderts. Die halluzinatorische Kraft vorgefundenen Bildmaterials führt Max Ernst seit Dezember 1919 zu einer Erkundung des »Inventars«. Durch systematischen »Widerspruch« analysiert er Standards reproduzierter visueller Wahrnehmung im Bezug auf die menschliche Psyche. Nach surrealistischer Methode sucht er »Annäherung von zwei (oder mehr) scheinbar wesensfremden Elementen auf einem ihnen wesensfremden Plan, die die stärksten poetischen Zündungen provoziert«. Hier erscheint der Mann löwenköpfig, dort wandelt er sich zum Reptil, dann wieder wird er zu einem Mischwesen, halb Mensch halb Vogel. Er steht für die tierische, über die menschliche Vernunft hinausgehende unheimliche Macht in Politik und Sexualität. Gleichzeitig entfaltet sich der Werkzyklus »Loplop présente«. Hauptthema der teils als Collage, Gemälde oder auch als Grafik ausgeführten Arbeiten ist ein Vogelwesen, das im Bild Bilder darbietet. Es ist eine eigene Form des Selbstporträts, »der Künstler in der dritten Person« (Werner Spies), sein Alter Ego. Loplop zeigt »Muschelblumen«, die »schöne Jahreszeit«, auch »Leichtigkeit«, »Vipern« oder »Eiche«. Er ist manchmal schlecht gelaunt, wandelt sich, einem apokalyptischen Wesen gleich, zum »Hausengel«. Er steht als Mutation von »fluguntüchtigem Archaeopterix und Elefant Celebes« (Spies) programmatisch für die surrealistische Malerei. Loplop ist »L’Intérieur de la vue«, das Innere Gesicht, das Innere des Sehens der aus dem Unterbewußten hervorbrechenden Bilder. Er ist die Repräsentationsfigur zum Bildprozeß, öffnet sich hier doch der unendliche Raum »jenseits der Malerei«. DT Werner Spies, Max Ernst: Collagen – Inventar und Widerspruch. Köln 1974 Pablo Picasso Ab 1933 dringt der Minotaurus, das stierköpfige Ungeheuer aus der kretischen Mythologie, in die Bildwelt Pablo Picassos (geboren 1881 in Malaga, gestorben 1973 in Mougins) ein. Ein menschlich-tierisches, zugleich göttliches Instinktbündel ist aus dem Labyrinth des Hephaistos ausgebrochen, unberechenbar widernatürlich, voller chaotisch destruktivem, hybrid sinnlichem Vermögen. Es wird Symbol der surrealistischen Bewegung und der von André Breton redigierten gleichnamigen Zeitschrift, für die Picasso zahlreiche Darstellungen schuf. An die innere und äußere Wildheit erinnert in der Radierung »Minotaurus, Trinker und Frauen« (1933) der gehörnte, faltig struppige Kopf, der bedächtig auf die Hand gestützt ist und eher zweifelnd an seinem männlichen Gegenüber vorbeischaut. Ihnen zur Seite ruhen selig ermattete Mädchen, die klassisch offenen Gesichtszüge spätarchaischen Koren entlehnt. Picassos Bilder vom Minotaurus erzählen von Rausch und Erotik, Gewalt, Leiden und Genuß an den triebhaft wollüstigen Empfindungen für das andere Geschlecht, ein orgiastischer Angriff auf Welt und Leben, hilflos ängstlich auch, besinnlich, voller Sucht und Zärtlichkeit, Kampf und Zuneigung, voller tödlicher Gewalt und brünstig liebender Vereinigungssucht. Das Spiel listiger Vernunft mit den Kräften der Natur inszeniert sich theatralisch in der Corrida, der Picasso 1959 eine Serie von Farblinolschnitten widmet. Das Töten des Stiers nach festgelegten Regeln als Demonstration einer seit den kretischen Stiertänzern im mediterranen Raum verwurzelten Tradition ist ein komplexes, menschlich-tierisches, männlich-weibliches Ritual um Liebe, Sexualität, Herrschen und Unterwerfen, um rationales Todeskalkül und instinktiv gelenkte Aggression. Picasso gestaltet dies als Zyklus in Formen voll zärtlicher Leichtigkeit und spröder Härte. Weniger das graphische Bemühen um lineare Eleganz scheint ihn zu bewegen, als das energetische Umgreifen zerfasernd ruppiger Flächenkonturen. Ihnen gewinnt er eine direkte, scheinbar unkünstlerische Form ab, die den Bewegungen der Protagonisten archaische Unmittelbarkeit voller existenzieller Emotion zu verleihen scheint. Die formale Abstraktion steht durchaus Felszeichnungen eiszeitlicher Höhlenmalereien nahe und verleiht, fern von Blut, schmerzhafter Verletzung und grausamer Mißachtung der lebenden Kreatur, der Corrida eine mythische Dimension. DT René Hirner, Wendelin Renn: Picassos Toros. Kat. Heidenheim 1996 Sigmar Polke Bei der experimentellen Entwicklung immer neuer Bildformen spielte die Fotografie für Sigmar Polke (geboren 1941 in Oels/Schlesien, lebt in Köln) eine entscheidende Rolle. Die 14 Aufnahmen der Arbeit »Bärenkampf« von 1974 belichtete er auf dünnem Umkopierpapier, das er zusammengefaltet ins Entwicklerbad tauchte. Symmetrische Gebilde erstarrter Entwicklungsflüssigkeit, Schleier von Fließspuren, Verwischungen und Knicken legten sich auf die Oberfläche der Fotografien. Polke hat seinen eigenen Worten nach »alle Fehler, die beim Entwickeln und Vergrößern geschehen können, eingesetzt, aber so, daß sie das Bild zugleich interpretieren« (1990). „Chimärenartig» schleichen sich die fotochemischen Zufallsformen in die gegenständliche Welt ein und »produzieren Konnotationen« (Martin Hentschel, 1997), angesichts des grausamen Spektakels etwa Gedanken an verschmiertes Blut. Wie die Punkte in seinen Rasterbildern oder die Muster der Stoffe, auf die Polke gemalt hat, wirken diese Effekte transformierend. Sie verunklären nicht nur das Motiv und verleihen dem Foto Aura, sie deuten und vermitteln die beunruhigende Dramatik des im Negativ festgehaltenen Geschehens. Polke fotografierte auf einer Reise, die ihn auch in die Opiumhöhlen Pakistans führte, ein allmonatlich stattfindendes Schauspiel. Zwei trainierte Kampfhunde, Afghanen, wurden vor zahlendem Publikum auf einen Bären losgelassen. Der brutale Kampf war Ritual, ein unmißverständliches Symbol für den damaligen Konflikt mit der UdSSR, der hier stellvertretend durch die Tiere ausgetragen wird: Zwei wendige, bissige Hunde treten gegen den gewaltigen, aber behäbigen und zudem festgebundenen Bären »Rußland« an. Mit aller Drastik schlägt uns die Archaik des seit alters in Arenen simulierten Krieges entgegen. Gleichzeitig werfen die Bilder ihren Schatten auf spätere, unweigerlich auch auf jüngste kriegerische Auseinandersetzungen voraus, die uns vor den Bildschirmen bannen und auf deren Verlauf nun die Börse wettet. Über naheliegende politische Assoziationen hinaus kann die Bildserie als allgemeine Metapher für menschliche Konflikte gelesen werden. Vor allzu naiver Parteilichkeit bewahrt uns Polkes nachträglich aufgelegter Schleier. Dieser unterscheidet das Seherlebnis des Bildbetrachters von der blanken Schaulust, durch welche sich die Zuschauer im Bild der Blutrunst der Kampftiere angleichen. FE Sigmar Polke: Die drei Lügen der Malerei. Kat. Bonn/Berlin 1997/98