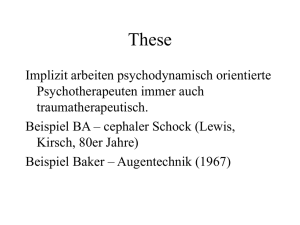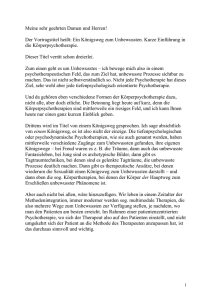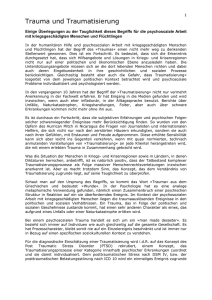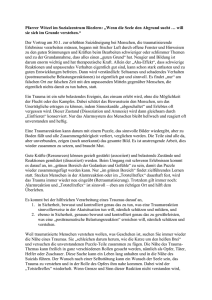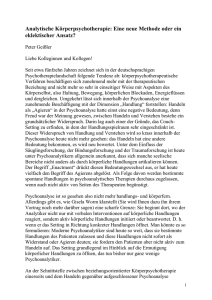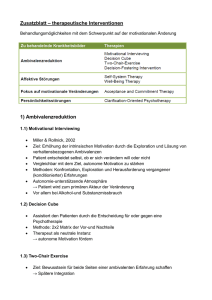Die traumatische Reaktion
Werbung
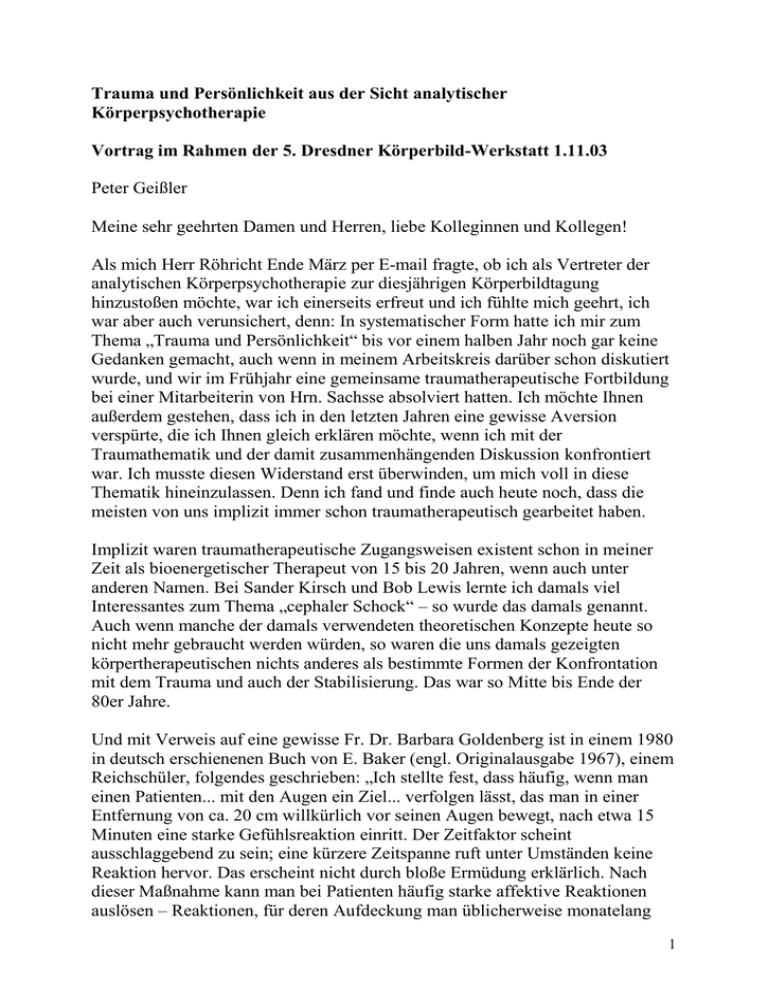
Trauma und Persönlichkeit aus der Sicht analytischer Körperpsychotherapie Vortrag im Rahmen der 5. Dresdner Körperbild-Werkstatt 1.11.03 Peter Geißler Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als mich Herr Röhricht Ende März per E-mail fragte, ob ich als Vertreter der analytischen Körperpsychotherapie zur diesjährigen Körperbildtagung hinzustoßen möchte, war ich einerseits erfreut und ich fühlte mich geehrt, ich war aber auch verunsichert, denn: In systematischer Form hatte ich mir zum Thema „Trauma und Persönlichkeit“ bis vor einem halben Jahr noch gar keine Gedanken gemacht, auch wenn in meinem Arbeitskreis darüber schon diskutiert wurde, und wir im Frühjahr eine gemeinsame traumatherapeutische Fortbildung bei einer Mitarbeiterin von Hrn. Sachsse absolviert hatten. Ich möchte Ihnen außerdem gestehen, dass ich in den letzten Jahren eine gewisse Aversion verspürte, die ich Ihnen gleich erklären möchte, wenn ich mit der Traumathematik und der damit zusammenhängenden Diskussion konfrontiert war. Ich musste diesen Widerstand erst überwinden, um mich voll in diese Thematik hineinzulassen. Denn ich fand und finde auch heute noch, dass die meisten von uns implizit immer schon traumatherapeutisch gearbeitet haben. Implizit waren traumatherapeutische Zugangsweisen existent schon in meiner Zeit als bioenergetischer Therapeut von 15 bis 20 Jahren, wenn auch unter anderen Namen. Bei Sander Kirsch und Bob Lewis lernte ich damals viel Interessantes zum Thema „cephaler Schock“ – so wurde das damals genannt. Auch wenn manche der damals verwendeten theoretischen Konzepte heute so nicht mehr gebraucht werden würden, so waren die uns damals gezeigten körpertherapeutischen nichts anderes als bestimmte Formen der Konfrontation mit dem Trauma und auch der Stabilisierung. Das war so Mitte bis Ende der 80er Jahre. Und mit Verweis auf eine gewisse Fr. Dr. Barbara Goldenberg ist in einem 1980 in deutsch erschienenen Buch von E. Baker (engl. Originalausgabe 1967), einem Reichschüler, folgendes geschrieben: „Ich stellte fest, dass häufig, wenn man einen Patienten... mit den Augen ein Ziel... verfolgen lässt, das man in einer Entfernung von ca. 20 cm willkürlich vor seinen Augen bewegt, nach etwa 15 Minuten eine starke Gefühlsreaktion einritt. Der Zeitfaktor scheint ausschlaggebend zu sein; eine kürzere Zeitspanne ruft unter Umständen keine Reaktion hervor. Das erscheint nicht durch bloße Ermüdung erklärlich. Nach dieser Maßnahme kann man bei Patienten häufig starke affektive Reaktionen auslösen – Reaktionen, für deren Aufdeckung man üblicherweise monatelang 1 mühevolle Arbeit aufwenden musste...“ Sie werden unschwer erkennen, dass hier die EMDR-Technik gemeint ist, die später von anderen Autoren als „neu“ benannt und berühmt gemacht wurde Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Frage des sog. Realtraumas bereits ausführlich diskutiert – es ging damals um Eisenbahn- und Arbeitsunfälle und daraus resultierender Störungen und auch Schadensersatzansprüche. (Das ist nachlesbar in Sachsse, Venzlaff und Dulz 1997.) Und es wurde – um die Person von Charcot an der Salpetriere – das Problem sexualisierter Gewalt gegen Kinder und junge Frauen beforscht und diskutiert. Zwei seiner Schüler haben sich ja einen besonderen Namen gemacht: Pierre Janet, auf den die Begriffe Dissoziation und Bewusstseinsspaltung zurückgehen, und Sigmund Freud. Die Geschichte der Psychoanalyse ist in ihrer Theoriebildung und Praxis ohne die Auseinandersetzung mit der Traumätiologie gar nicht denkbar. Vor allem die Anfänge der Psychoanalyse unter Breuer und Freud haben Gemeinsamkeiten mit heutigen traumatherapeutischen Vorgangsweisen. Es stimmt aber, dass spätestens seit Anna Freud und der Londoner Arbeitsgruppe das Trauma überwiegend als Beziehungstrauma aufgefasst wurde und dadurch eine bestimmte Schwerpunktbildung stattfand. Außerdem hat sich durch die klare Tendenz der Psychoanalyse zum Determinismus die Meinung eingeschlichen, es gäbe gar keinen Zufall, es gäbe auch keine Opfer, jeder Mensch inszeniere sich sein Schicksal – und zwar sein gesamtes – selbst; man könne also nicht einfach Pech haben. Auch heute kann es in schlechten Analysen noch vorkommen, dass nach einem Auffahrunfall an einer Ampel reflektiert wird, ob man nicht im Grunde genommen gewollt hat, dass einem hinten jemand reinfährt – nicht, dass es solche Psychodynamiken überhaupt nicht gäbe, aber traumatherapeutische Sichtweisen sind so gesehen ein gesundes Gegengewicht gegen einen übertriebenen psychoanalytischen Determinismus. Was ich aber heute bei Reddemann u. a. an sog. neuen Stabilisierungs- und Traumexpositionstechniken lese, ist so neu nun wahrlich nicht. Hier liegt ein wichtiger Grund meines Unbehagens - neue Namen werden erfunden, die eigentlich schon Bekanntes angeblich benennen, und damit wird Aufmerksamkeit erregt. Neue Namen schaffen ja noch nicht unbedingt neue Fakten. Wirklich neu sind Forschungsergebnisse außerhalb der Psychotherapie – vor allem aus der Gehirnforschung. Da ist echt Bahnbrechendes ans Tageslicht gekommen und wird noch weiter kommen. Und: Die Zentrierung auf traumatherapeutische Zugangsweisen hatte auch den positiven Begleiteffekt, dass ein Aufeinander-Zugehen verschiedener Psychotherapiemethoden feststellbar war und ist. Es ist ein spannender Dialog in Gang gekommen, u. a. auch ein kritischer Diskurs um manche Aspekte der Psychoanalyse, der 2 durchaus wichtig ist. Einen solchen Dialog habe ich auch bei der Vorbereitung zum heutigen Vortrag gesucht, ich habe vor allem per E-mail mit einigen Kolleginnen und Kollegen mehr oder weniger intensiv diskutiert, und das war sehr bereichernd. Bedanken möchte ich mich ausdrücklich bei meinem Freund und AKP-Kollegen Otto Hofer-Moser, bei Jörg Scharff, Gisela Worm, Günter Heisterkamp, Niko Roth, bei Thomas Reinert, Gabriele Poettgen-Havekost, bei Heinz Golkenrath, Ulrich Sachsse und – last but not least - bei meiner Frau, Christine Geißler. Sie alle haben mir wichtige Impulse gegeben. So war die Einladung zu Ihrer Tagung gewissermaßen der Anstoß, mir die Beschäftigung mit dem Thema als Programm zu verordnen. Und – ich kann feststellen, dass mir die Sache nach Überwindung meines Widerstandes im Laufe der Zeit mehr und mehr Spaß gemacht hat. Mein heutiges Referat möchte ich so verstanden wissen, dass ich Ihnen ein paar Gedanken zum Thema „Trauma aus der Sicht psychoanalytisch orientierter Körperpsychotherapie“ vermittle – als Zwischenergebnis meiner Recherchen und eigener Erfahrungen. Ob ich dabei einen Beitragung zu Ihrem längerfristigen Ziel, der Evaluation spezieller körperpsychotherapeutischer Interventionsstrategien leisten kann, lasse ich zunächst offen, vielleicht könnte dies ein nächster Schritt sein. Ein kurzer Überblick über mein Referat: Ich werde Ihnen berichten über Gedanken zur Neurobiologie und zur Säuglingsforschung Extremtrauma und Alltagstrauma Traumaprozess Traumatische Reaktion Traumaverarbeitung Behandlungstechnische Perspektiven aus der Sicht analytischer Körperpsychotherapie Übersicht über das Spektrum psychoanalytisch orientierter traumatherapeutischer Vorgehensweisen R. Plassmann U. Volz-Boers T. Reinert Eigene traumatherapeutische Erfahrungen Traumatherapie und existenzielle Perspektive Sollte ich aus Zeitgründen die eine oder andere Passage streichen müssen, haben Sie die Möglichkeit, das Referat in der kompletten Fassung unter www.a-k-p.at unter „Vorträge“ nachzulesen. 3 Einige Gedanken zur Neurobiologie und zur Säuglingsforschung Das Realtrauma ist dadurch definiert, dass das Individuum in der Situation selbst nicht mehr deutendes Subjekt sein kann, dass seine Fähigkeit, traumatisches Geschehen zu verstehen und ihm eine Bedeutung zu verleihen, aufgehoben ist. Konstituierend für das Realtrauma ist also die Erfahrung, reines Objekt geworden zu sein.Traumatische Erfahrungen beeinträchtigen somit Prozess der Symbolisierung, und sie beeinträchtigen ebenso ein integriertes Körpererleben. Unter extremer Belastung scheinen auch wir Menschen in gewisser Weise säugetierhaft zu reagieren – zumindest erscheinen gewisse Parallelen zu Angstreaktionen bei Säugetieren recht evident, und das macht die Tierforschung für unser Thema auch so interessant. Allerdings entsteht dadurch auch ein Spannungsfeld: zwischen einem biologischen Menschenbild und einem psychotherapeutischen. Ulrich Sachsse drück dies pointiert so aus: Ihn interessiert mehr das Säugetier Mensch und die Biologie menschlicher Reaktionen sowie damit verbundenes Lernen, und nicht so sehr der Mensch in seinen sozialen Bezügen. Dies schafft natürlich schon eine gewisse Schwerpunktverschiebung, schafft ein Spannungsfeld. Es ist wichtig, dieses Spannungsfeld zu sehen, um Befunde aus der Biologie nicht 1:1 in das psychotherapeutische Feld zu übertragen. Überdies steht eine biologistische Sichtweise von Traumatisierung der ursprünglichen psychoanalytischen Triebtheorie näher als den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, wie der psychoanalytischen Selbstpsychologie und der Objektbeziehungstheorie, wodurch sich vielleicht auch die eine oder andere Schwierigkeit bei der Übernahme traumatheoretischer Befunde in ein psychoanalytisches Vorgehen erklären lassen. Trauma heißt auch Konfrontation mit dem Unfassbaren und damit einhergehende affektive Reaktionen. „Ich kann es nicht fassen“ – das wäre ein typisches Traumaerleben. Die im Zuge von traumatischen Belastungen stattfindenden Affektüberflutungen führen dazu, dass besonders der sensorische, der sprachlose Anteil der Erfahrung im impliziten Gedächtnis gespeichert wird. Anstelle eines differenzierten Speicherungsvorganges im Sinne geordneter Wahrnehmungsbilder werden bloß Sinnfragmente abgespeichert und überdauern in dieser desintegrierten Form. Daran sind verschiedene Gehirnareale beteiligt, wie Hippocampus, Hypothalamus, Gyrus cinguli und andere. Zudem scheint die Zusammenarbeit der beiden Hemisphären beeinträchtigt und damit verbundene kognitive Prozesse – also die Verbindung zwischen analytisch-symbolischproblemorientierten und ganzheitlich-nonverbal-handelnden kognitiven Funktionen. In traumatischen Zuständen scheint eine erhöhte rechtsseitige Aktivität vorzuliegen, die linke Hälfte, die auch das Sprachzentrum enthält (die Broca-Region), ist gehemmt, damit auch die Fähigkeit zur sprachlichen 4 Symbolisierung. Hier liegt vielleicht der Wirkbereich der EMDR-Technik – in einer Vermittlung zwischen rechter und linker Gehirnhälfte. Die Gedächtnisforschung hat ergeben, dass wir von unterschiedlichen, vielleicht sogar vielen Gedächtnissystemen auszugehen haben; sehr bekannte Formen sind das episodische und das prozedurale Gedächtnis; aber da gibt es wahrscheinlich noch etliche andere. Bezogen auf den Speicherungsvorgang ist wichtig zu sagen, dass normalerweise eine Serie von Gedächtnisstufen durchlaufen werden muss, damit wir uns langfristig etwas merken. Die Information geht durch das sog. Sekundengedächtnis in den Arbeitsspeicher (mit maximal zwei Minuten Speicherkapazität). Wenn die Information emotional wichtig ist, gelangt sie in den „Mittelspeicher“ (im Hippocampus), und erst dort erfolgt durch eine Abgleichung mit vergangenen Erfahrungen der Übergang in den Dauerspeicher (Cortex). Die in Bezug auf das Affektgedächtnis wichtige Hippocampusregion ist das sog. „kühle“ alltägliche Gedächtnis; es stellt ebenso die Verbindung zu den Kategorien Raum, Zeit und Kausalität her. Wichtig finde ich hier zwei Punkte: 1. Was vom episodischen ins prozedurale Gedächtnis übergegangen ist, ist nur mehr schwer verlernbar. Im prozeduralen Gedächtnis haben wir es vor allem mit Handlungsautomatismen zu tun, mit „Gefühlsgewohnheiten“, mit Ritualen und Symptomhandlungen. Als Psychotherapeuten wissen wir genau, wie schwer solche automatisierten Handlungen und Gewohnheiten veränderbar sind. Ihre Veränderung innerhalb einer gewissen Spannbereite erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für körperliche und Handlungsprozesse, und oft damit verbunden viel an neuer Einübung – das ist aufwendig, das ist energiezehrend. Aber: körperliche Achtsamkeit und deren therapeutische Förderung ist gerade hier eine Hilfe! Und: Nach neueren Wirksamkeitsuntersuchungen vollziehen sich offenbar therapeutische Veränderungsprozesse mehr als bisher angenommen auf einer impliziten Ebene – d. h. weder dem Patienten noch dem Therapeuten bewusst! 2. Trauma heißt andere Abspeicherung! Nicht die komplexen Speicherwege werden durchlaufen, sondern die Information wird sofort in den Mandelkernen abgespeichert, und diese Kerne haben zu tun mit der Reaktion auf biologisch verankerte Gefahrensignale – z. B. Schlangen, oder böser Gesichter. D. h. der Speicherprozess geht vorbei an allen Verarbeitungsmechanismen und direkt in die basalsten Reaktionszentren des Gehirns, was biologisch bzw. aus Überlebensgründen durchaus sinnvoll ist, damit eben nicht zweimal das gleiche passiert. Aus 5 Tierexperimenten weiß man nämlich, dass bestimmte Tiere sterben, wenn sie einem Extremtrauma zum zweiten Mal ausgesetzt werden (z. B. Mäuse). Aber das ist nicht bei allen höheren Tieren so: Wenn z. B. Schimpansen einem Extremtrauma wiederholt ausgesetzt werden (z. B. wenn man sie in einem Stall aussetzt, der an einen Leopardenstall angrenzt und sie keine Rückzugsmöglichkeit haben), dann sterben sie nicht, aber sie erstarren in einer gewissen Weise, und es dauert etwa ein halbes bis ein Jahr, um sie aus der Traumatisierung wieder herauszubringen. Traumaauslöser sind dabei bestimmte Fragmente, Trigger, wie ein Geruch, ein Geräusch, ein Bild oder anderes – also nicht der Leopard als ganzes ist als Trigger notwendig - und sofort wird der Schreckreflex aktiviert. Das Problem dabei ist, das uns in der Therapie ja auch beschäftigt, dass die nun einsetzende Erfahrung nicht als Erinnerung, sondern ganz real und gegenwärtig erlebt wird. Dem „kühlen“ Gedächtnis der Hippocampusregion wird mittlerweile ein „heißes Gedächtnis gegenübergestellt, das mit den Mandelkernen in Verbindung gebracht wird. Diese üben eine Art affekgeleiteter Verstärkerfunktion aus. In extremen Erregungszuständen werden die hypothalamischen Steuerungszentren des autonomen Nervensystems aktiviert, die Hippocampusregion wird gehemmt, sodass sie ihre Integrationsfunktion nicht erfüllen kann. An die Stelle integrierter Wahrnehmungsbilder treten die schon genannten fragmentierten Sinneseindrücke – auch fragmentierte körperliche Sinneseindrücke, und diese bilden gleichsam „Löcher im Ich“ und im „Körper-Ich“ (ein Ausdruck von Plassmann), in denen Spontanregressionen und Intrusionen drohen, im therapeutischen Kontext eine maligne Regression – Regression hier verstanden als ein Zusammenbruch integrativer Ich-Funktionen. Die Integration solcher Erfahrungen – dies ist eine der traumatherapeutischen Thesen - bedarf daher besonderer therapeutischer Zugänge, denn im Moment der Intrusion, der Überflutung ist es einziges Anliegen der Patienten, aus diesem Zustand wieder herauszukommen – sonst nichts. Interessant sind auch die Forschungen von Jaak Panksepp. Er hat ja nicht nur herausgefunden, dass Ratten lachen können, wenn man sie kitzelt – nur dass wir ihr Lachen nicht hören, weil diese Töne in für uns unhörbaren Frequenzbereichen gelegen sind. Relevanter für unser Thema sind seine Arbeiten zu den Stress-Systemen – er unterscheidet ein Panik- von einem Furchtsystem. Ein Außenfeind aktiviert zunächst das Kampf-Furcht-System, bei dem kognitive Problemlösung ablaufen kann. Das ist die – wenn man so will – reifste Stressreaktion. Versagt das Furcht-Kampf-System und ist auf dieser Ebene keine Problembewältigung möglich, tritt das Panik-System in Kraft, wobei hier keine kognitive Problemlösung möglich ist! 6 Panik bedeutet: ich bin allein, und ich brauche die Herde. Es ist also das Bindungssystem, das in Kraft tritt. Und das heißt auch, dass alles, was mit Bindung assoziierbar ist, also auch körperliche Berührung, eine beruhigende Wirkung hat. Das eher parasympathikotone Paniksystem tritt also in Kraft, wenn das eher sympathikotone Furchtsystem versagt hat. Die Panikreaktion ist somit eine Reaktion auf einer einfacheren Stufe, die Bindungsverhalten aktiviert. Versagt auch das Paniksystem, dann kommt es zu einer noch primitiveren Reaktion, der sog. Freeze-Reaktion, einer Art von Totstellen, von Verschwinden, weil sich Totstellen anscheinend in der Evolution bewährt hat, um in Extremfällen die Überlebenschancen zu erhöhen. Bei höher entwickelten Säugetieren wird im Zuge der Freeze-Reaktion der übersteigerte Stoffwechsel heruntergefahren, um irreversible Gehirnschäden zu vermeiden. Die Art der Stressreaktionen hat somit eine Auswirkung darauf, ob das Bindungssystem aktiviert wird oder nicht. Die Bindung ist wiederum ein System, das ganz früh im menschlichen Leben in Kraft tritt, aber lebenslang wichtig bleibt – jedenfalls bei vielen Tieren und auch beim Menschen. Nun sind wir im Zuge der Säuglingsforschung so weit, dass wir sogar annehmen, dass „Intersubjektvitität den Stellenwer eines primären Motivationssystem“ zu haben scheint, und das passt ganz gut zur Auffassung der Humanethologen, die davon ausgehen, dass der Mensch ein Herdentier ist und aus biologischen Gründen auf ein Zusammenleben in Kleingruppen programmiert ist. Ich finde es interessant, dass auch die Traumaforschung unser Menschenbild in die Richtung prägt, dass wir andere Menschen lebenslang brauchen, dass wir immer auf die „Herde“ angewiesen sind, und dass wir eben im Grunde unserer Existenz keine Singles sind, auch wenn gegenwärtig eine gewisse Tendenz zur Versingelung in Mode zu sein scheint. Wir sind also nicht so konstruiert wie Raubtiere, bei denen das Bindungssystem ab einem gewissen Zeitpunkt ihrer Entwicklung außer Kraft tritt. Das Bindungssystem – oder Selbst-Objektbedürfnisse, wie die Selbstpsychologen sagen würde – ist ein lebenslang bedeutsames Motivationssystem und – das ist wichtig die Therapie - auch ein lebenslanges nicht-regressives Bedürfnis. Von Seiten der Säuglingsforschung her scheint mir ein weiterer wichtiger Aspekt darin zu bestehen, dass gesunde seelische Entwicklung und Strukturbildung auf der Basis einer amodalen, wahrnehmungsintegrativen Erfahrungsqualität erfolgt. Der Säugling nimmt allem Anschein nach Erfahrungsepisoden als Gesamteindrücke wahr und speichert sie auch als solche – denken Sie an die Rigs im Sinne Daniel Sterns -, auch wenn er sich daran nicht aktiv erinnern kann. Jedoch wird – das ist entscheidend – Interaktion als solche gespeichert und wirkt strukturbildend. Dissoziation ist zu verstehen als ein Zusammenbruch dieser amodalen Wahrnehmungs- und Erlebensganzheit als 7 Reaktion auf Extremeinwirkungen, die dissoziative Reaktion kann man als zentrale Abwehr früher traumatischer Erfahrungen verstehen. Desweiteren muss man mittlerweile davon ausgehen, dass frühe Traumatisierungen schon intrauterin vorstellbar sind, und dass spätere Traumatisierungen die traumatischen Ersterfahrungen antriggern können und in ihren Abbildungsnuancen stark von diesen geprägt werden. Somit ist von einer zeitfusionierten Verdichtung und Verflechtung früher Traumata mit nachfolgenden Extremerfahrungen auszugehen. Extremtrauma und Alltagstrauma Wenn man von Trauma spricht, muss man wissen, dass Trauma nicht gleich Trauma ist. Es gibt hier zumindest starke quantitative, wenn nicht qualitative Unterschiede. Unterschiedliche Intensitätsgrade von traumatischen Einwirkungen sollten daher mitbedacht werden: Nehmen wir das Beispiel einer extremen physischen Gewalteinwirkung. Ab einem gewissen „Abschaltpunkt“ setzt eine Schockreaktion ein und damit verbunden eine Entkoppelung des Erlebens von der Situation. Es fallen folgende mentale Funktionen aus: Zeitlichkeit, Perspektivität, Symbolisierung durch Sprache und Sinngebung. Es bildet sich für diesen Teil des traumatischen Geschehens ein dauerhaftes Erlebensdefizit, als Kern eines potenziellen Strukturdefizits. Die traumatische Erfahrung verbleibt ein hoch geladenes, von der übrigen Erfahrungswelt isoliertes Erlebnisbruchstück im Selbst. Die affektive Verknüpfung mit anderen Erfahrungen, wie z. B. einer integrierten Körpererfahrung, und die Symbolisierung sind unmöglich. Davon zu unterscheiden sind mit Sicherheit mehr oder weniger alltägliche Beziehungstraumata. Im Falle von kumulativer Interaktionspathologie erzeugen die traumatischen Episoden im Einzelfall nicht unbedingt Schockqualität, sondern erst ihre Häufung bewirkt eine dauerhafte Veränderung. Der Traumaprozess Wenn wir von Trauma sprechen, meinen wir im Grunde genommen ein prozesshaftes Geschehen. Drei Phasen des Traumaprozesses können nach einer Einteilung von Fischer und Riedesser unterschieden werden, die auch jeweils unterschiedliche therapeutische Zugänge erfordern: die Traumasituation selbst, die Traumareaktion und die Traumaverarbeitung (der Versuch, das Trauma kognitiv einzuordnen). In der Traumasituation erlebt der Mensch eine vitale Diskrepanz zwischen subjektiven und objektiven Situationskomponenten, ein Missverhältnis zwischen objektiven Situationsfaktoren und subjektiven Erwartungen der Realität, die ein zentrales traumatisches Situationsthema konstellieren, da eine subjektiv angemessene Reaktion nicht möglich ist. Im Falle von Naturkatastrophen beispielsweise wird das „pragmatische 8 Realitätsprinzip“ erschüttert, d. h. die Grundannahme bzw. Illusion (je nach Blickwinkel), die Kräfte der Natur wären prinzipiell beherrschbar. Im Falle von Beziehungstraumata kommt es zu einer Erschütterung des „kommunikativen Realitätsprinzips“ (einer Verletzung der Erwartung, die Handlungen der Mens chen wären vorhersehbar). Trotz markanter Parallelen zwischen Traumamechamismen zwischen Mensch und Tier wird beim Menschen im Innersten eine „kognitive Szene“, eine Grunderwartung, in wesentlich differenzierterer Form eingeschrieben als bei Tieren, bei denen natürlich auch kognitive Prozesse ablaufen – wenn auch einfachere. Die Grunderwartung verleiht dem Handeln - dem eigenen und dem fremden – erst seine eigene Bedeutung. Die Bedeutungsgebung, die Sinnhaftigkeit von Handlungen, das ist ein wichtiger, typisch menschlicher Aspekt im Handlungsgeschehen. Im Falle traumatischer Einwirkungen zerfällt diese Sinnhaftigkeit, Traumata sind nicht einordenbar, widersprechen der gewohnten Realtitätserfahrung. Unser unstillbares Bedürfnis nach Sinngebung führt aber dazu, dass bestimmte sekundäre Reaktionen in Gang kommen, mit dem Ziel, ein solches an sich unbegreifliches Geschehen irgendwie zu erfassen. Und hier sind neurotischen Mechanismen Tür und Tor geöffnet. Therapeutische Grundprinzipien bezogen auf die Traumasituation entsprechen im wesentlichen denen einer Krisenintervention. Es geht darum, dem Betroffenen rasch und weitgehend Sicherheit zu vermitteln, ihm als empathischer, einfühlsamer Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen sowie Verständnis zu haben für die Traumawirkungen und den Prozess der Traumaverarbeitung; ebenso – wenn nötig – unmittelbare Hilfen zu geben, wie Informationen betreffend Verlauf, natürlich angepasst an die Bedürfnisse des Betroffenen. Die traumatische Reaktion Die traumatische Reaktion kann man analog zur Immunreaktion als einen komplexen Abwehrvorgang verstehen, in dem der Mensch versucht, sozusagen einen eingedrungenen Fremdkörper entweder zu vernichten oder auszuscheiden – oder mit dem Fremdkörper weiterzuleben und ihn gleichsam abzukapseln. Hier zeigt sich, dass Abwehr offenbar nicht nur einen psychodynamischen, sondern auch einen biologischen Sinn hat: nämlich einer Informationsüberflutung des Systems und einem übersteigerten Anpassungsdruck entgegenzuhalten. Es werden hier – im Falle gelingender Traumaverarbeitung - fünf unterschiedliche Phasen unterschieden, und zwar: 1. peritraumatische Phase: Aufschrei, Angst, Wut 2. Verleugnungsphase im Sinne eines Sich-Wehrens gegen die Erinnerung an die traumatische Situation 9 3. Phase des Eindringens von Gedanken und Erinnerungsbildern (Intrusionen, Flashbacks) 4. Phase des Durcharbeitens, der Auseinandersetzung mit den traumatischen Ereignissen und den persönlichen Reaktionen 5. Abschluss des Traumas Die Traumareaktion zeichnet sich durch einen biphasischen Charakter aus, durch eine regelhafte Wiederkehr von Intrusion und Verleugnung. Frühe therapeutische Hilfe ist in der Regel wichtig, denn eine Fixierung in der Phase der Verleugnung führt zur Abstumpfung und Erstarrung der Persönlichkeit, die Intrusionen zu seelischer Qual. Grundsätzlich gilt, dass frühe Intervention Vorteile mit sich bringt und einer Chronifizierung entgegenwirkt. Das Durcharbeiten traumatischer Agenda wird möglich, wenn die Fähigkeit zur Selbstberuhigung so weit gestärkt ist, dass ein kontrolliertes Wiedererleben der traumatischen Situation möglich ist. Nun ist eine schrittweise Umarbeitung der kognitiv-emotionalen Schemata möglich, sodass die traumatische Erfahrung integriert werden kann. Hingegen entwickelt sich ein chronisches posttraumatisches Belastungssyndrom dann, wenn die Kontrollmechanismen der Persönlichkeitsorganisation zu schwach sind, um die Überflutungen durch traumatische Erinnerungen einzudämmen. Grundprinzipien der Therapie der Traumareaktion – der postexpositorischen Traumatherapie – sind die Vermeidung jeder weiteren Stressbelastung und die Förderung der Erholungsphase. Dynamisch orientierte Psychotherapeuten verfügen in aller Regel ohnehin über ich-stützende Zugangsweisen zum Patienten, die hier zur Anwendung kommen sollten. Zusätzlich erweisen oft Entspannungsverfahren und auch imaginative Techniken als hilfreich; aber auch körperbezogene Zugänge, wie ein dosiertes Anbieten körperlichen Halts, kann sich als günstig erweisen und entlastend wirken. Wenn diese Phase nicht gut durchlaufen wird, dann besteht eine Tendenz, das Trauma gleichsam einzukapseln. Dann besteht zwar keine floride Angst mehr, allerdings sind dazu umfangreiche Umbaumaßnahmen in der seelischen Struktur notwendig, die einen hohen Preis haben, d. h. mit einer weit reichenden Reorganisation von Beziehungsschemata und kognitiv-affektiven Wissensbeständen einher gehen – all dies mit dem Ziel der Schadensbegrenzung. Der zunehmende Zerfall von Gesamtwahrnehmung und Handlung soll die Kontextualisierung der gefürchteten Erinnerungsbilder verhindern. Ein spezifischer Konflikt zwischen der traumatischen Erfahrung und den kompensatorischen Strukturen führt zu voneinander dissoziierten Erlebniszuständen mit wechselnden Stimmungslagen. Diese Wechsel vollziehen sich nach für den Traumatisierten unsichtbaren Mechanismen, er ist sich dieser Autorenschaft nicht bewusst – das ist entscheidend. Es spielt sich ein innerer, 10 unbewusster Kampf an zwischen zwei Gegenspielern: auf der einen Seite das Traumaschema – das sind alle mit dem Trauma assoziierten inneren Tendenzen, die sich ausdrücken wollen, die nach Lösung suchen, die aber auch die gefürchtete Erinnerung an das Trauma im Kern enthalten; daher soll das Traumaschema unbewusst bleiben. Auf der anderen Seite stehen die traumakompensatorischen Tendenzen. Würden die traumakompensatorischen Mechanismen bewusst werden, dann würde der Traumatisierte auf den „Gegenspieler“, das sog. Traumaschema, aufmerksam werden, womit das Ziel der kompensatorischen Abwehr verfehlt wäre. Die schrittweise Bewusstwerdung des Traumaschemas und der traumakompensatorischen Bewältigungsmaßnahmen ist Gegenstand einer auf lange Zeit ausgelegten psychodynamischen Psychotherapie. Die Traumaverarbeitung Fischer und Riedesser beschreiben in ihrem Lehrbuch sehr differenziert und umfassend die komplexen Verarbeitungsprozesse in der dritten Phase des Traumaprozesses, auf die ich hier aus Zeitgründen nicht eingehen kann. Diese dritte Phase ist für mich das Feld der Psychoanalyse – die dabei ablaufenden Verarbeitungsmechanismen sind psychoanalytisch gut verstehbar. Ich möchte an dieser Stelle nicht ausführlich auf diesen Punkt eingehen und auf den Folgevortrag von Hrn. Scharff hinweisen. Nur als kurze Andeutung: Wenn ich z. B. als Folge des Trauma sage: „Ich war schuld an dieser Katastrophe!“, dann kann man den Sinn dieser Überzeugung so verstehen, dass man hier zumindest in der Fantasie gehandelt hat und daher das Gefühl gerettet hat irgendwie handlungsfähig zu sein, anstatt komplett ausgeliefert zu sein, was schwieriger zu ertragen ist. Es ist dies ja auch ein typischer infantiler Mechanismen – Größenfantasien zu entwickeln, um die eigene Hilflosigkeit bewältigen zu können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bedeutungsgebung ein an sich sinnvoller Versuch einer Reorganisation des Organismus darstellt, der gelingen oder aber misslingen kann. Behandlungstechnische Perspektiven: Grundlegendes zur analytischen Körperpsychotherapie Theoretischer Hintergrund der analytischen Körperpsychotherapie ist die Psychoanalyse, wobei diesbezüglich bestimmte Theorien von besonderer Wichtigkeit sind – ich nenne exemplarisch die Modifikation des Verstehens von Übertragung als „interaktionelle Übertragung“ wie vor allem bei Bettighofer, die Theorie der „Körperinszenierungen“, wie sich Küchenhoff beschreibt, sowie 11 Ansätze zu einem basalen Verstehen von Enactments, wie sie von Heisterkamp in seinem letzten Buch beschrieben wurden. Im wesentlichen ist analytische Körperpsychotherapie, so wie ich sie verstehe, eine Erweiterung der Psychoanalyse in Richtung der Konkretisierung der Handlungsdimension im Beziehungsgeschehen zwischen Patient und Therapeut. Agieren wird dabei nicht mehr als Widerstand angesehen, sondern als förderliche und teilweise sogar notwendige therapeutische Dimension, um an traumatisches Material überhaupt herankommen zu können. Aus einer psychoanalytisch fundierten körpertherapeutischen Sicht ist die Leitperspektive, um das therapeutischen Geschehen immer wieder zu verstehen, die Beziehungsperspektive. Diese Perspektive ermöglicht es daher, Beziehungsprozesse nunaciert zu erfassen und gemeinsam zu verstehen. Das ist der Vorteil, aber natürlich hat diese Zentrierung auch seinen Preis. D. h. im Vergleich zu neoreichianischen Körpertherapien spielt die Fokussierung körperlicher Selbstprozesse (Spüren, Einlassen in körperliche Erfahrungen, Erproben körperlicher Impulse, körperliche Abreaktion von Affekten, Anwendung körperlicher Stresstechniken mit dem Ziel autonomer Körperreaktionen) eine geringere Rolle zugunsten konkret-körperlicher Interaktionserfahrungen zwischen Patient und Therapeut, z. B. im Sinne umgrenzter Handlungsszenen, im Sinne von Modellszenen. Dazu ist ein „offenes Setting“ von vornherein notwendig und wird als solches sofort eingeführt. Speziell die Arbeit in einem solchen „offenen Setting“ anstatt im festgelegten Couch-Setting der Psychoanalyse bringt eine Menge an behandlungstechnischen Implikationen mit sich. Dadurch, dass im konkreten Gegenüber und in der Handlung die nonverbalen Signalgebungen nicht nur des Patienten für den Therapeuten – sondern umgekehrt: des Therapeuten für den Patienten – viel sichtbarer und auch Material der Bearbeitung werden, bekommt die reale Beziehung im Vergleich zur Übertragungsbeziehung eine große Bedeutung. Analytische Körperpsychotherapie ist durch ihr von vornherein offenes Setting etwas anderes als die bisher übliche psychoanalytische Therapie; aber sie ist auch keine Körperpsychotherapie wie z. B. die Bioenergetische Analyse. Im Unterschied zu klassisch-körperpsychotherapeutischen Handhabungen von Körperinterventionen, wo diese von vornherein Teil des Settings sind und ohne spezifische Beachtung des Standes der Beziehung angeboten werden können, erfolgt körperliche „Arbeit“ in der analytischen Körperpsychotherapie in engster Anlehnung an den aktuellen Stand von Übertragung und Gegenübertragung, was einige wesentlich andere Akzentsetzungen bringt. Z. B. entscheiden wir uns als analytische Körperpsychotherapeuten sehr oft, die unbewussten Bedeutungen von möglichen Beziehungsangeboten zuerst zu analysieren (z. B. auch körperlichen Beziehungsangeboten), anstatt eine „Übung“ vorzuschlagen. 12 Dieses Analysieren unbewusster Beziehungsbedeutungen kann Gegenstand der verbalen Arbeit sein, oder auch ein Prozess im Therapeuten selbst, den er für sich behält, im Sinne eines Containings, um ihn erst an späterer Stelle in modifizierter Form im Sinne einer Deutung oder Querverbindung an den Patienten zurückzugeben. Oftmals bringt die Analyse dieser Beziehungsfantasien genügend Material, dass eine tatsächliche durchgeführte konkrete Handlung gar nicht immer angezeigt. Gemeinsame Enactments sind manchmal wichtig, d. h. es werden im Rahmen einer solchen Therapie eher wenige, aber meist hochbedeutsame Schlüsselszenen in konkretes Handeln umgesetzt bzw. sie ereignen sich von selbst, der Prozess steuert quasi in diese Richtung gemeinsamer Enactments – und sie dürfen sich ausdrücken, wenn der Therapeut dafür offen ist und sie nicht aus methodischen Gründen blockiert. Durch die Zentrierung auf unbewusste, sich auch handelnd inszenierende Beziehungsprozesse steht analytische Körperpsychotherapie m. E. der Psychoanalyse näher als den mir bekannten klassischen Körperpsychotherapien, wie der Bioenergetischen Analyse. Und nochmals: Dieses Vorgehen hat – wie jedes Verfahren - Vorteile und auch einen Preis. Der Vorteil besteht in einem differenzierten Erfassen-Können unbewusster Beziehungsaspekte. Der Preis hat damit zu tun, dass körperliche Prozesse nicht in einer Art und Weise erfasst und durchgearbeitet werden können, wie das z. B. in der Bioenergetischen Analyse möglich ist. In jedem Fall bin ich davon überzeugt, dass ein längerfristiges entwicklungsbezogenes Arbeiten sinnvoll und gewinnbringend ist – auch wenn ich verstehen kann, dass nicht alle meine Patienten entwicklungsbezogen an sich arbeiten möchten. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen als Patient bin ich der Überzeugung, dass in einer langfristigen Perspektive ein differenziertes Verstehen der unbewussten Repräsentationen sehr hilfreich ist, also z. B. das stabilisierende Anknüpfen-Können an tröstliche Primärerfahrungen bzw. positive prätraumatische Erfahrungen, die sich durch Distanzierbarkeit, integrierte Wahrnehmung und ganzheitliches Erleben auszeichnen. Sie sind deshalb innerlich evozierbar und jederzeit geeignet, ängstigende Erfahrungen im Hier und Jetzt zu relativieren. Hingegen ist der sofortige Stabilisierungsgewinn durch ein übungsorientiertes Verfahren, wie in der klassischen Körperpsychotherapie, aber auch in der imaginationszentrierten Traumatherapie (z. B. im Sinne Reddemanns) oft beeindruckend und aus der Sicht des Patienten sicher zunächst gewinnbringend, da sich sein Leiden rasch vermindert. Allerdings können solche thematische Anregungen – wie das Anknüpfen an sichere Orte, Hilfsintrojekte und konfliktfreie Situationen – nicht nur Ressourcenzustände des Patienten anregen, sondern auch kompensatorische Rettungsfantasien verstärken, die letztlich aber 13 an traumakompensatorische Rettungsillusionen anschließen und somit im Dienste der Abwehr stehen. Im Einzelfall muss natürlich jeder Therapeut im Gespräch mit dem jeweiligen Patienten abwägen, was an Angebot hilfreicher erscheint – ein Setzen auf Langzeitprozesse oder auf kurzfristige Stabilisierungen. Diese Entscheidung ist sicher nicht immer eine leichte. Inwieweit aus dieser psychoanalytischen Sicht von Körpertherapie der Körper in seinem Handlungsaspekt in das Verfahren einbezogen wird - hier gibt es erhebliche Unterschiede, die zu einem nicht geringen Teil Stilunterschiede sind – abhängig von der Person des Therapeuten und seinen Möglichkeiten und Grenzen. Ich selbst bin z. B. mit Berührung sehr langsam und auch vorsichtig, es entspricht meinem Stil mehr, mich in kleinen Schritten an den Patienten heranzutasten, ich selbst brauche Zeit um auf der körperlichen Ebene Sicherheit und Vertrauen zu gewinnen. Da ich körperliche Interventionen eben nicht technisch einsetze, ist mir dieses langsame Vorgehen wichtig – es ist mein persönlicher Stil. Übersicht über das Spektrum psychoanalytisch orientierter traumatherapeutischer Vorgehensweisen Analytische Körperpsychotherapie ist wegen ihrer Fokussierung auf unbewusste Abwehrprozesse und unbewusste Beziehungsbedeutungen meiner Meinung nach ein Verfahren, das sich für die Phase 3 des Traumaprozesses als Mittel der Wahl anbietet – für die Traumaverarbeitung. Auf der einen Seite des Spektrums siedle ich Kollegen an, wie z. B. Reinhard Plassmann, die im klassischen Setting ohne konkrete körperliche Interaktion und Berührung verbleiben, sich aber Überlegungen machen, wie man Deutungen so modifizieren kann, dass sie dem Gegenstand, der Behandlung traumatisierter Patienten, gerechter werden. Plassmann hebt den Unterschied von Inhalts- und Prozessdeutungen hervor. Er sagt ganz klar, dass dann, wenn eine semiotische Regression vorliegt (ein Verlust an Zeitlichkeit, Perspektivität, Symbolisierungsfähigkeit durch Sprache und Sinngebung), die inhaltliche Deutungsarbeit zurückgestellt werden muss zugunsten Prozessdeutungen – die im wesentlichen das erfassen, WIE Dinge geschehen (und nicht, welche unbewusst dynamischen Bedeutungen mit ihnen verbunden sein könnten). Dabei werden die Ressourcenanteile der Patienten in die Prozessdeutung einbezogen, z. B.: „Mir ist aufgefallen, dass in unserer letzten Stunde eine Spannung herrschte. Dann haben Sie etwas sehr Gutes gemacht, was uns beiden geholfen hat, mit dieser Spannung besser fertigzuwerden – Sie sind aufgestanden und 14 haben sich ein wenig bewegt – das hat nach meiner Wahrnehmung die Spannung etwas gelöst.“ Diese Deutung als Beispiel – man wird hier als Körperpsychotherapeut unwillkürlich an die Beachtung und das Aufgreifen nonverbaler und nur atmosphärisch wirksamer Prozesse erinnert. Ein anderes Beispiel: Ursula Volz-Boers verbleibt ebenso im klassischen hochfrequenten Couch-Setting und berührt weder ihre Patienten noch ermutigt sie sie zu konkreter Interaktion. Ihr Zugang zum traumatischen Erleben ist die Körpererfahrung des Analytikers in der Gegenübertragung. Körperliche Empfindungen werden über Imaginationen und deren wortsprachliche Benennung in das Analysierbare einbezogen. Die Körperlichkeit wird sozusagen über die Bilderwelt und deren sprachliche Mitteilung in die Psyche des Patienten implantiert, durch Anregung des Psychoanalytikers wird aus subsymbolischer Kommunikation schrittweise symbolische Kommunikation, und mit einer derartigen Bildung neuartiger Körperrepräsentanzen entsteht neue psychische Struktur. Einen entscheidenden Schritt geht Jörg Scharff, der dann, wenn das klassische Couch-Setting an seine Grenzen gerät, zu einer anderen Methode überwechselt, die er „inszenierende Interaktion“ nennt. Was er darunter versteht, können Sie im nächsten Referat hören. Auch Hans Müller-Braunschweig ist als einer jener Psychoanalytiker anzusehen, die auf der Grundlage eigener körperpsychotherapeutischer Erfahrung gelegentlich Abweichungen des klassischen Couch-Settings zulässt oder sogar aktiv einführt. Zwei wichtige Dinge stellt er fest: 1. ein sehr häufiger Setting-Wechsel kommt bei ihm nicht so oft vor, weil ihm der Abwehrcharakter desselben als Möglichkeit im Hinterkopf ist. 2. Die grundsätzlich Offenheit für gelegentlich eingeführte szenische Arbeit sensibilisiert nicht nur für neue Möglichkeiten des Handlungs- und Aushandlungsraumes zwischen Patient und Therapeut, sondern fördert auch Erfahrungen der Lebendigkeit beider. Noch weiter gehen Psychoanalytiker wie Tilmann Moser, Günter Heisterkamp und Gisela Worm, die ein offenes Setting von Anbeginn an einführen. Das geht z. B. bei Gisela Worm teilweise so weit, dass sie das festgelegte Sitzen auf den Stühlen ganz aufgibt, sodass beide Seiten – Patient und Therapeut – jede Stunde neu gefordert sind, die therapeutische Distanz neu zu bestimmen, einschließlich der körperlichen Basishaltung, in der sie sich begegnen. Den Variationen sind hier kaum Grenzen gesetzt – man kann im Sitzen, aber auch in anderen Positionen arbeiten – die kontinuierliche Aushandlung von Nähe und Distanz zwischen Patient und Therapeut ist dabei ein entscheidender handlungsleitender Gesichtspunkt. 15 Gisela Worm achtet ausdrücklich darauf, ob sie es mit einem Patienten mit einer relativ intakten Ich-Struktur zu tun hat oder nicht. Man kann ihrer Meinung nach „klassisch“ analytisch-körpertherapeutisch nur bei einigermaßen intakter IchStruktur arbeiten, d. h. Körperarbeit „in der Übertragung“ machen, was wegen der manchmal enormen Affektverdichtung zwar sehr wirksam, aber auch sehr ich-belastend ist. Neurotisch strukturierte Patienten ziehen daraus in der Regel großen Gewinn. Haben wir es hingegen mit ich-strukturellen Störungen, dann ist diese Form beziehungszentrierter Körperinterventionen kontraindiziert, und man wendet selbstzentrierte körpertherapeutische Interventionen an, oder Imaginationstechniken, die das Ich des Patienten schonen. Es ist daher in der analytischen Körperpsychotherapie wichtig, zwischen selbstzentrierten und beziehungszentrierten Interventionen zu unterscheiden und deren Verwendung an die Struktur des Patienten anzupassen. Dies schließt gut an, was ich von Ulrich Sachsse gehört habe, nämlich dass das Klientel, mit dem er auf seiner Klinik traumatherapeutisch anstatt psychoanalytisch arbeitet, offensichtlich ein solches ist, das durch erhebliche strukturelle Ich-Störungen gekennzeichnet ist – also Patienten, die oft sogar an der Grenze zwischen Psychotherapie und psychiatrischer Intervention dahinwandern. Es ist schön zu sehen, wie sich unter psychoanalytischen Autoren eine Weiterentwicklung in Zusammenhang mit dem Verstehen von Enanctments im therapeutischen Geschehen abzeichnet. So wird in einem in der Psyche 2003 abgedruckten Beitrag von Manfred Schmidt aus Köln berichtet, wie er im Rahmen einer niederfrequenten psychoanalytischen Therapie eine gemeinsame Inszenierung auf der Handlungsebene nutzt, um die während der gemeinsamen Szene hochgekommenen Affekte zu klären. Daraus entstand in dem von Schmidt referierten Fallbeispiel ein erinnernder Zugang zu schweren Traumatisierungen, die nach und nach in ihrer affektiven Bedeutung realisiert werden konnten. Nach Meinung des Autors ist die Beachtung der emotionalen Klärung gemeinsam erlebter Handlungsszenen die zentrale veränderungswirksame Dimension, und erst dann schließen sich Erinnerung und in weiterer Folge die Erzählung als weitere symbolisierende Veränderungsschritte an. Schmidt, der sich u. a. auf Heisterkamp bezieht, weist dabei auf die Wichtigkeit der Beachtung impliziten Beziehungswissens hin, als einer Form eines „emotionalen Unbewussten“, das zunächst über die Handlung zugänglich wird und nicht über das gesprochene Wort. Thomas Reinert, Leiter die Langenberger Klinik für Psychotherapie, arbeitet seit vielen Jahren mit Patienten mit schweren Borderline-Störungen1. Er, aus 1 Reinert verdanke ich folgende Klarstellung. Das Borderline-Syndrom ist nicht identisch mit der posttraumatischen Störung. Selbstverständlich haben Borderline-Patienten eine Vielzahl schwerer Traumata erlitten, insbesondere auf sexuellem Gebiet, und häufig handelt es sich um Lebensgeschichten mit einem sog. „kumulativen Trauma“. Trotzdem sollte dies nicht mit der Genese der Borderline-Struktur gleichgesetzt werden. 16 einer Adlerianischen Tradition stammend, hat in seiner Arbeit eigene körperliche Zugangsweisen entwickelt und ermöglicht diesen schwerstgestörten Patienten z. B. einen Rückzug auf eine „embryonalhafte Regressionsebene“, auf der die Patienten ihren Rückzugsimpulsen folgen und z. B. Höhlen bauen, in die sie sich hineinlegen und dort verharren. Die Patienten dürfen also entwicklungsanalogen Erfahrungsmodi nachgeben bzw. werden dazu ausdrücklich ermutigt, und vom Setting her bedeutet dies, dass ein entsprechendes Angebot an Materialien zur Verfügung steht, wie Decken, Kissen, Matratzen, Schaumstoffwürfel, Säcke und anderes.2 Nach Reinert, der viel Erfahrung mit dieser Patientengruppe gesammelt hat3, liegt der Schlüssel der Behandlung hier tatsächlich in der Zur-Fügung-Stellung der körperlichen Handlungsebene. Konventionelle Therapien können seiner Meinung nach sehr wohl eine gute Integration des Patienten ins Lebensgefüge erreichen, jedoch bleiben diese Patienten oft „seelische Krüppel“, d. h. mit einem auf immer währenden pathologischen Fühlen und einer erheblichen Distanz zur menschlichen Umgebung. Die Möglichkeit der Regression auf die körperliche Ebene und ein systematisches Fördern der Wahrnehmung von sich selbst auch im körperlichen Bereich sowie der Nähe des Anderen führt zu neuen Erfahrungsdimensionen für den Patienten, die dadurch in der Tat eine nachholende Ich- und Selbstentwicklung durchlaufen, einen Neu-Beginn im Balint´schen Sinn erleben können. Das beschreibt Reinert auch in einigen seiner Artikel der letzten Jahre4. In Phasen solcher Tiefenregression5 steht der Therapeut dem Patienten nicht so sehr als konturiertes Objekt gegenüber, der Übertragungstyp ist also nicht der einer objektalen Übertragung, sondern eher der einer Selbstobjektübertragung bzw. ist der Therapeut, wie Reinert selbst meint, ein Verwandlungsobjekt im Sinne von Bollas – d. h. geschlechtlich undifferenziert, universell verwendbar und mit Funktionen ständig wechselnden Charakters befrachtbar. Auch ist der verbale Kontakt in dieser Therapiephase relativ unwichtig. Vor diesen tiefen Regressionen schrecken nach Meinung Reinerts viele Kollegen zurück, und es kommt bei solchen schwerstgestörten Patienten tatsächlich auch zu Dabei geht es vielmehr um eine spezifische Familiendynamik, bei der die wichtigsten Autonomie-Bewegungen des Kindes nicht toleriert wurden, sondern eine Botschaft vermittelt wurde, die auf ein „Nicht-mehr-Existierensollen“ im Falle autonomer Impulse hinausläuft. Diese implizit vermittelte Botschaft erklärt die starken Ängste dieser Patienten, die faktisch Todesängsten gleichkommen. Das Trauma ist also die Beziehung selbst. 2 Es gibt mittlerweile eine große Sammlung solcher Materialien, die gleichsam als Übergangsobjekte dienen. Eine ausführliche Übersicht dazu ist nachlesbar bei Vogt, R. (2003): Beseelbare Objekte zur analytischen prozessnahen Diagnostik und –therapie im körperpsychotherapeutischen Setting. Psychoanalyse und Körper 2/2/1, S. 41-57. 3 Ein Buch dazu ist in Vorbereitung (persönliche Mitteilung) 4 Z. B.: Reinert, T.: Und sie bewegen sich doch! Modofiziert-analytische Langzeittherapie bei Patienten/innen mit schweren Borderline-Störungen. In: Gerlach, A., Schlösser, A. M., Springer, A. (2003): Psychoanalyse mit und ohne Couch – Haltung und Methode. Psychosozial, Gießen, S. 208-220 5 Regression benutze ich hier im Sinne eines deskriptiven Begriffs und als Metapher, nicht aber theoretisches Konstrukt. Genaueres dazu bei Geißler, P. (2001): Mythos Regression. Psychosozial, Gießen. 17 psychotischen Phänomenen, die Angst machen können. Andererseits bewirkt das Durchleben dieser Phasen einschließlich psychotischer Dekompensationen enorme Wandlungsmöglichkeiten, die Reinert anhand von Fallbeispielen belegt. Reinert stellt u. a. auch kritisch fest, dass es bei den meisten Behandlungskonzepten der Borderline-Störung um Versuche geht, eine möglichst objektive Erfassung des Krankheitsgeschehens und darauf bezogene therapeutische Strategien zu gewährleisten. Er stellt dem gegenüber aus seiner Adlerianischen Perspektive eine „personale Haltung“6, was bedeutet, dass es darum geht, nicht nur die Krankheit, sondern auch und v. a. den Patienten zu verstehen. Daraus leitet sich seine Überzeugung ab, dass es möglich ist – ich zitiere – „auch schwerste Borderline-Syndrome, trotz aller zunächst einmal bizarr wirkenden Phänomene und scheinbar willkürlichen Verhaltensweisen zu verstehen und zu einer insgesamt völligen Aufklärung der jeweiligen individuellen Psycho-Dynamik hinzuführen“, denn „alles, was der Patient hervorbringt, folgt einer privaten inneren Logik und ist nicht etwa nur eigengesetzlich ablaufender Ausfluss einer primär gegebenen hirnorganischen Pathologie“. Im Rahmen langjähriger Erfahrung in der ambulanten Therapie mit solchen Patienten hat Reinert folgende Behandlungsbedingungen aufgestellt (hier verkürzt wiedergegeben): 1. Die Behandlung erfolgt in einem regressions-förderlichen Milieu, möglichst in einem Therapieraum, der nur mit Matratzen, Kissen, Decken und evtl. Stofftieren ausgestattet ist und vom Patienten verändert werden kann. 2. Sitzungen finden zwei- bis dreimal wöchentlich statt, wobei jedes Mal eine neue Gestaltung des Raums möglich ist. 3. Die Körperebene als primäre Erfahrungsebene menschlicher Existenz wird in den Behandlungsprozess einbezogen. 4. Kreative Produkte des Patienten, wie Bilder, sind willkommene Hilfsmittel. Kurz zum Therapieverlauf, so wie Reinert ihn beschreibt: Zunächst wird der Therapeut aufgrund seiner spezifischen Pathologie als „Feind“ angesehen. Wenn der Therapeut dieser Betrachtungsweise des Patienten (die einzige, die ihm möglich ist) standhält, durchläuft der Therapieprozess folgenden Phasen und zugleich Testungsebenen7 (ebenfalls verkürzt): 6 Nimmt man eine solche personale bzw. intersubjektive Perspektive ernst, wäre es eigentlich gerechtfertigter, anstelle von „Techniken“ und „Interventionssatrategien“ von therapeutischen „Antworten“ zu sprechen, wie dies z. B. in der Gestalttherapie üblich ist. 7 Diese Testungsebenen erinnern an das Konzept der „Control-mastery-theory“ von Weiss, J. und Sampson, H.(1986): The psychoanalytic process. Theory, clinical observations and research. New York (Guilford Press); Weiss, J. (1990): Strategien des Unbewußten. Spektrum der Wissenschaft, S. 122-129. 18 1. Die Ehrlichkeit des Therapeuten wird getestet – er versucht, den Therapeuten zu persönlichen Stellungnahmen zu bewegen und ihn bei Widersprüchen zu ertappen. 2. Die Stärke des Therapeuten wird getestet – vor allem hinsichtlich der enormen Aggressivität dieser Patienten. 3. Die Zuneigung des Therapeuten wird getestet – der Patient versucht, den Therapeuten mittels projektiver Mechanismen zu negativen Affektäußerungen zu bringen. Dabei wünscht er sich eigentlich, wie auch bei den anderen Testungsebenen, der Therapeut möge die Tests bestehen. Schafft es der Therapeut, diese Tests zu bestehen, wird er zunehmend zu einem „Verwandlungsobjekt“ im Sinne von Bollas, und der Patient lässt sich in die beschriebene Tiefenregression auf ein intrauterines Niveau ein, indem er sich aus Kissen und Decken Höhlen baut und sich in eine Embryonalhaltung zurückzieht. Oder er malt Bilder mit ebensolchen Bezügen. Wichtig sei es, dem Patienten diese Regression voll zu gestatten, wobei der Therapeut in dieser entscheidenden Therapiephase für den Patienten auch telefonisch erreichbar sein sollte. Da Trennungen sehr schwierig sind, ist diese Phase für den Therapeuten äußerst belastend. Wird sie aber überstanden, ist eine sehr positive Entwicklung möglich – dies bei einem Gesamtstundenausmaß von etwa 700 bis 800. Der entscheidende therapeutische Erfolg besteht gegenüber anderen Therapien nach Reinert eben darin, dass durch das veränderte Körpererleben und Distanz-NäheErleben die Nähe-Gestaltung zu anderen Menschen im Alltag auf eine gänzlich neue Weise möglich ist und diese Patienten zu echter Lebensfreude finden können. Diese hohe Stundenzahl hat sicher mit dem Umstand zu tun, dass das, was normalerweise das Paniksystem am besten beruhigt, nämlich das Bindungssystem, bei diesen Patienten als ständige latente Gefahrenquelle erlebt wird und die therapeutische Arbeit eben hier ansetzen muss. Patienten dieser Art sind eben alles andere als sicher gebunden, und die therapeutische Aufgabe besteht implizit im wesentlichen darin, neue und stabilere Bindungsrepräsentanzen aufzubauen. In Kürze einige Eigenerfahrungen Bei Patienten, mit denen ich von der Methode her analytischkörperpsychotherapeutisch in einem langfristigen Prozess arbeite (vielleicht die Hälfte meiner Patienten), erlebe ich, wie gut sich wenige gemeinsam konkretkörperlich durchlebte Szenen eignen, um wertvolles Analysematerial für die verbale Bearbeitung und auch Durcharbeitung zu gewinnen. Erst der konkrete Handlungsdialog bewirkt, dass der Patient bestimmte traumatische Erinnerungen in einer affektive Dichte reaktiviert, die in rein verbal geführten Prozessen oft so nicht erreichbar ist. Beispielsweise erinnerte ein etwas blässlich wirkender 19 Patient, als ich ihm in einer interaktiven Szene das Gesicht hielt, einen Satz seiner Mutter, die ihm gesagt hatte, er hätte ein Gesicht zum Erbrechen. Für diesen Patienten, bei mir in Zweittherapie nach einer langjährigen CouchAnalyse, eröffnete das Wiederhochkommen dieses Satzes (den er in der CouchAnalyse nicht erinnert hatte) ein altes Beziehungstrauma und damit verbunden eine für ihn neue Dimension früher präödipaler Wut, was einen Wendepunkt in der Therapie einleitete. Hier arbeite ich also traumatherapeutisch in einer Weise, dass alte, prozedural gespeicherte Beziehungstraumata durch den Handlungszugang reaktiviert werden. Die zeitlich gesehen viel umfangreichere verbale Arbeit dient dazu, die jeweils spezifische unbewusste Traumaverarbeitung aufzuklären und bewusst zu machen. Hin und wieder sehe ich Patienten, die Zeugen eines Banküberfalls waren oder vom Täter direkt bedroht wurden. Ich sehe diese Patienten in der Regel zum ersten Mal ein bis zwei Tage nach dem Banküberfall, d. h. oft noch in der Phase der Traumareaktion. ein Hier ist mein Zugang ein mehr stützend-beratender – ich wähle hier absichtlich ein anderes Vorgehen als analytische Körperpsychotherapie, weil es mir – bezogen auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Traumaphase – angemessener vorkommt. Ich gebe diesen Patienten einerseits viel Raum zum Erzählen, frage einzelne Details nach, vermittle Empathie und auch die Überzeugung, dass der traumatische Prozess langfristig gut überstehbar sein wird. Und ich berate die Patienten ganz konkret, was sie in den nächsten Tagen und Wochen tun können – angefangen von wiederholten Erzählen des Vorfalls im Beisein von Angehörigen, über Aufklärung, wie ein Traumaprozess normalerweise verläuft (also Zeit braucht), bis hin zur Empfehlung, wenn nötig kurzfristig schlaffördernde Medikamente einzunehmen. Im Schnitt sind zwei bis zehn Sitzungen, aufgeteilt auf zwei Wochen bis zwei Monate, ausreichend, um eine psychische Stabilisierung und eine Rückkehr auf den Arbeitsplatz zu ermöglichen – außer bei einigen wenigen Patienten, die erhebliche ichstrukturelle Störungen oder polytraumatische Vorerfahrungen haben. Das Extrembeispiel war ein etwa 50-jähriger Bankangestellter, der, als er zu mir in Therapie kam, zum 7. Mal Opfer eines Banküberfalls geworden war und der, parallel zur Therapie, eine Frühpensionierung anstrebte und meines Wissens auch erreichte. Zum Abschluss: Traumatherapie und existenzielle Perspektive Das paradoxe Dilemma als Folge der traumatischen Erfahrung ist: Einerseits ist alles so wie immer, und andererseits ist nichts wie vorher! Und diese Paradoxie hat einen erschütternden Effekt, die Weltsicht des Menschen nach einer traumatischen Erfahrung verändert sich nachhaltig. Menschen, die dem Tode 20 nahe waren, sind nachher manchmal nicht die gleichen, sie gewinnen nicht selten eine neue Tiefe ihrer Lebenserfahrung. Traumatisches Erleben bietet so gesehen einen Einstieg in eine Erfahrungsdimension, die in einer „normalen“ Psychotherapie gar nicht so selbstverständlich hochkommt: nämlich die existenzielle Dimension, also Fragen der eigenen Sterblichkeit, des Verlusts geliebter Menschen und der Sinngebung im Leben. Hier handelt es sich um eine spezielle Tiefungsebene, die nichts mit regressiven Prozessen zu tun hat,8 und die in einer psychodynamisch geführten Psychotherapie durchaus ihren Platz haben kann. Gerade das veränderte Erleben – „alles ist so wie es immer war, und nichts ist mehr, so wie es ist“ – definiert ja gerade eine existentielle Wahrnehmungsebene, nur mit dem Unterschied, dass sich der traumatisierte Patient dieser Paradoxie längere Zeit hilflos ausgeliefert fühlt. Während man in „normal“ geführten Therapien diesen Erlebensbereich – vor allem in der Therapie älterer Menschen – oft bewusst einführen muss, weil die Patienten ihn von sich aus nicht begehen, liegt er bei traumatisierten Patienten sozusagen offen zutage und kann zum geeigneten Zeitpunkt aufgegriffen werden. Somit ergibt sich aus der Traumatisierung der deren Verarbeitung auch eine besondere Chance, die Krise als Entwicklungsimpuls zu nutzen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 8 Eine ausführliche Darstellung dazu ist nachlesbar bei Yalom, I. D. (1989): Existentielle Psychotherapie. Ed. Humanistische Psychologie, Köln. Er spricht von einer „Bewusstheit der letzten Angelegenheiten“, d. h. einem Bewusstsein von Endlichkeit, Tod, Freiheit, Verantwortung, existenzieller Isolation und der vorgegebenen Sinnlosigkeit des Lebens. 21