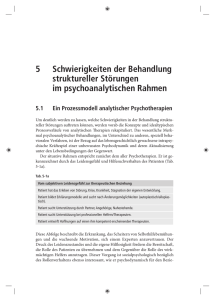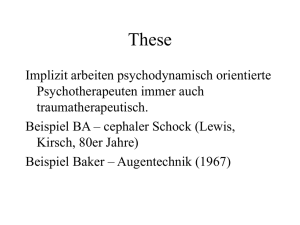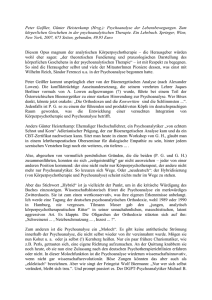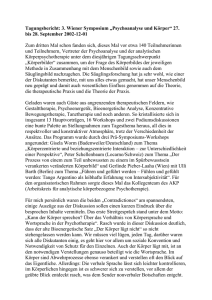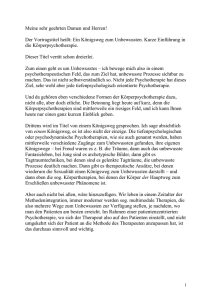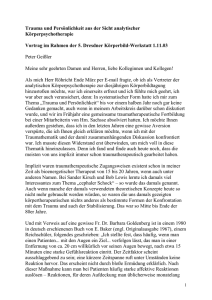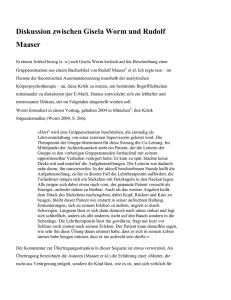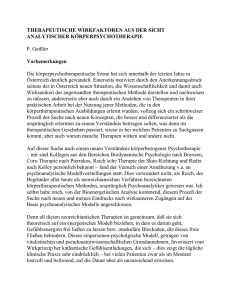Folie - bei DI Gerhard Lang
Werbung
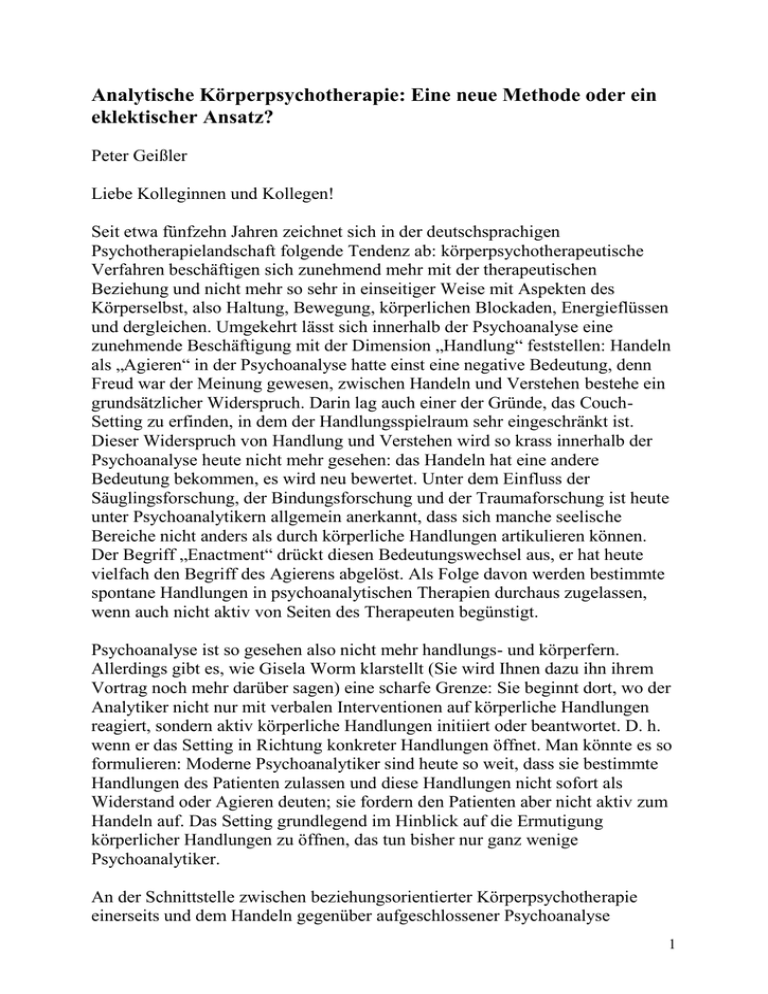
Analytische Körperpsychotherapie: Eine neue Methode oder ein eklektischer Ansatz? Peter Geißler Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit etwa fünfzehn Jahren zeichnet sich in der deutschsprachigen Psychotherapielandschaft folgende Tendenz ab: körperpsychotherapeutische Verfahren beschäftigen sich zunehmend mehr mit der therapeutischen Beziehung und nicht mehr so sehr in einseitiger Weise mit Aspekten des Körperselbst, also Haltung, Bewegung, körperlichen Blockaden, Energieflüssen und dergleichen. Umgekehrt lässt sich innerhalb der Psychoanalyse eine zunehmende Beschäftigung mit der Dimension „Handlung“ feststellen: Handeln als „Agieren“ in der Psychoanalyse hatte einst eine negative Bedeutung, denn Freud war der Meinung gewesen, zwischen Handeln und Verstehen bestehe ein grundsätzlicher Widerspruch. Darin lag auch einer der Gründe, das CouchSetting zu erfinden, in dem der Handlungsspielraum sehr eingeschränkt ist. Dieser Widerspruch von Handlung und Verstehen wird so krass innerhalb der Psychoanalyse heute nicht mehr gesehen: das Handeln hat eine andere Bedeutung bekommen, es wird neu bewertet. Unter dem Einfluss der Säuglingsforschung, der Bindungsforschung und der Traumaforschung ist heute unter Psychoanalytikern allgemein anerkannt, dass sich manche seelische Bereiche nicht anders als durch körperliche Handlungen artikulieren können. Der Begriff „Enactment“ drückt diesen Bedeutungswechsel aus, er hat heute vielfach den Begriff des Agierens abgelöst. Als Folge davon werden bestimmte spontane Handlungen in psychoanalytischen Therapien durchaus zugelassen, wenn auch nicht aktiv von Seiten des Therapeuten begünstigt. Psychoanalyse ist so gesehen also nicht mehr handlungs- und körperfern. Allerdings gibt es, wie Gisela Worm klarstellt (Sie wird Ihnen dazu ihn ihrem Vortrag noch mehr darüber sagen) eine scharfe Grenze: Sie beginnt dort, wo der Analytiker nicht nur mit verbalen Interventionen auf körperliche Handlungen reagiert, sondern aktiv körperliche Handlungen initiiert oder beantwortet. D. h. wenn er das Setting in Richtung konkreter Handlungen öffnet. Man könnte es so formulieren: Moderne Psychoanalytiker sind heute so weit, dass sie bestimmte Handlungen des Patienten zulassen und diese Handlungen nicht sofort als Widerstand oder Agieren deuten; sie fordern den Patienten aber nicht aktiv zum Handeln auf. Das Setting grundlegend im Hinblick auf die Ermutigung körperlicher Handlungen zu öffnen, das tun bisher nur ganz wenige Psychoanalytiker. An der Schnittstelle zwischen beziehungsorientierter Körperpsychotherapie einerseits und dem Handeln gegenüber aufgeschlossener Psychoanalyse 1 andererseits hat sich eine eigene therapeutische Strömung entwickelt, die derzeit unter der Bezeichnung „analytische Körperpsychotherapie“ läuft und auch bereits Eingang in das eine oder andere Lehrbuch oder Lexikon gefunden hat. Es gibt diese Strömung seit etwa 15 Jahren, und sie wurde seitens der Psychoanalyse dadurch begünstigt, dass man sich wieder mehr mit den Werken von Sandor Ferenczi beschäftigte, einem Freud-Schüler, der recht revolutionäre Gedanken eingebracht hatte. Wie gesagt: diese Strömung wurde von zwei Seiten her begünstigt. HansJoachim Maaz ist einer der Begründer dieser Strömung von der Seite der Körperpsychotherapie her. Er definiert sie folgendermaßen: "Analytische Körperpsychotherapie ist analytische Psychotherapie / Psychoanalyse, die den Körper theoretisch und praktisch integriert." Folie Drückt diese Definition wirklich das aus, was mit diesem Ansatz gemeint ist? Es handelt sich ja hier um eine sehr allgemeine Definition. Der Schrägstrich: Handelt es sich um eine Form von Psychoanalyse? Oder um „analytische Psychotherapie“? Sind die beiden in Wirklichkeit das gleiche, oder verschieden voneinander? Und was heißt dann „analytisch“? Psychoanalytisch – oder etwas anderes? Handelt es sich um eine „Körperpsychotherapie“, mit analytischen Elementen? Das Wort „Integration“ lässt vermuten, dass es sich um einen eigenständigen methodischen Ansatz handelt. Dies wollen wir aber in Frage stellen. Ist es ein methodischer Ansatz, oder ist es ein eklektisches Verfahren? Wie gelungen ist diese Integration? Oder sind vielleicht sogar zwei oder mehrere unterschiedliche Ansätze gemeint, bisher in einem gemeinsamen Oberbegriff vereint, und schafft dies eher Verwirrung als Klarheit? Ich stelle der Definition von Maaz einmal eine Definition von Gisela Worm zur Seite, wo sie folgendes sagt: Folie (oben nochmals Maaz) 2 Ihr Ansatz ist die Anwendung der Widerstands- und Übertragungsanalyse auf den interaktionellen Umgang. Das ist auch eine eher allgemeine Definition. Ich bitte zu beachten: 1. Es kommen die Begriffe Widerstand und Übertragung klar zum Ausdruck – also zwei genuin psychoanalytische Begriffe. 2. Es hier die Rede von „interaktionellem Umgang“ – d. h. vom beidseitigen Handeln; das schließt körperliches Handeln mit ein, jedoch ist in dieser Definition – im Gegensatz zu der von Maaz – der Fokus nicht so sehr auf den Körper gerichtet – sondern auf die Interaktion; und das ist wahrscheinlich kein Zufall. Mit diesen ersten Assoziationen habe ich das Thema umrissen, um das es mir heute geht. Lassen Sie mich gleich jetzt dazu sagen, dass diese Diskussion noch sehr in Fluss ist, dass sie auch spannungsgeladen ist – immerhin geht es dabei um methodische Identitäten – das sind heiße Fragen. Auch wenn es dabei oft mehr um Schwerpunktsetzungen als um Widersprüche geht, so sind die angesprochenen Themen doch wichtig und führen nicht selten zu Konflikten, die in Spaltungen oder Ausschlüssen münden können. Die Methodengeschichte der Psychotherapie ist voll von alledem. Denken Sie nur an den Ausschluss Wilhelm Reichs aus der psychoanalytischen Gemeinschaft und auch die Ächtung, die Ferenczi erfahren musste (er wurde damals von Freud für paranoid erklärt). Wir sind also in Diskussion, und das ist wichtig, diese Diskussion braucht Zeit. Meinen Beitrag heute möchte ich als Teil der Diskussion verstanden wissen, es geht nicht um definitive Schlussfolgerungen. Meine Anstöße sind insgesamt assoziativ, ich habe sie – eher willkürlich – in folgender Weise zu systematisieren versucht: FOLIE Die Gedankenkomplexe Gedankenkomplex 1: Allgemeine Gedanken zur Methodik Gedankenkomplex 2: Wer braucht methodische Überlegungen? Gedankenkomplex 3: Sind unsere Schwierigkeiten sind gegenstandsangemessen? Gedankenkomplex 4: Psychotherapie als erlernbare Methode Gedankenkomplex 5: Handeln vs. reflektierendes Verstehen Gedankenkomplex 6: Klinisches Vorgehen und diagnostische Überlegungen Gedankenkomplex 1: Allgemeine Gedanken zur Methodik Hier stehen sich zwei Positionen gegenüber: die Forderung nach einer „integrierten“ Methode auf der einen Seite; sie kommt mehr aus der Theorie; und die Notwendigkeit eklektisch vorzugehen, sie ergibt sich eher im praktisch3 klinischen Umgang mit Patienten. Beide Positionen bergen Chancen und Gefahren. Die Chance eine integrierte Methode anzustreben besteht darin, in ihrer Theorie und Theorie der Praxis so widerspruchsfrei wie nur möglich zu sein. Widerspruchsfreiheit oder zumindest ein klares Benennen von Widersprüchlichkeiten ist eine Anforderung an die Wissenschaftlichkeit einer Theorie bzw. Methode. In Österreich z. B. muss man dies Art von Wissenschaftsbeweis antreten, damit eine Methode vor dem Gesetzgeber anerkannt ist – hier in Deutschland wird es wohl nicht viel anders sein. Die Gefahr besteht darin, dass nicht nur Widersprüche reflektiert werden, sondern zur Wahrung der „Reinheit“ der Methode bestimmte neue Gedanken, die nicht dazupassen, einfach nicht berücksichtigt werden; dass also gewissermaßen ein Denkverbot entsteht und dadurch die Methode eng bleibt, damit sie ihre „Reinheit“ wahren kann. Und dass dadurch ein gewisses SichVerschließen gegenüber Anderem die Folge ist – eine Art hermetischer Methodik, die im Extremfall in sektenhafte Entwicklungen münden kann. Beispiele dafür gibt es im psychoanalytischen ebenso wie im körperpsychotherapeutischen Bereich, aber auch in humanistischen Verfahren – überall dort, wo wir es mit Fundamentalisten zu tun haben. In bestimmten psychoanalytischen Richtungen z. B. dort, wo die Erkenntnisse der modernen Säuglingsforschung weitgehend ignoriert werden, weil sie zum eigenen Säuglingsbild nicht dazupassen. Im körpertherapeutischen Bereich z. B. das „Back-to-Basics“-Programm von Alexander Lowen, der Begründer der Bioenergetischen Analyse, das er in den späten 80er Jahren ausgeschrieben hat. Lowen hat damals, um die Reinheit der BA gegenüber zu starken psychoanalytischen Einflüssen zu bewahren, alle Lehrtherapeuten zu Seminaren einberufen, um sie auf die von ihm begründete Methode einzuschwören. Sie müssen sich vorstellen: diese etwa 30 Lehrtherapeuten hatten allesamt lange klinische Erfahrung. In Lowens Programm war vorgesehen, dass jeder Lehrtherapeuten – neben der Seminararbeit im Gruppen – nochmals Einzelstunden mit ihm, Lowen, dem Begründer, nahm. Aus beziehungsdynamischer Sicht ist dies doch recht merkwürdig – aber ich wollte es absichtlich als Extrembeispiel bringen. Ich glaube nicht, dass es eine Ausnahme darstellt. Es scheint sich beim Versuch des Bewahrens einer Methode eher um eine allgemeine, methodenübergreifende Reaktionsweise zu handeln – besser gesagt: um eine menschlich Reaktionsweise in Gruppenzusammenhängen, wo es um die Bestimmung und Verteidigung von Gruppenidentitäten geht. Von politischen Gruppierungen wissen wir ja, dass der Ausschluss des Anderen eine wichtige identitätsbildende Maßnahme ist. Die Erfahrung zeigt, dass es im psychotherapeutischen Feld in Gruppenzusammenhängen nicht viel anders ist. 4 Das hat mich lange Jahre sehr irritiert, ich beginne es mehr und mehr als menschliche Conditio zu akzeptieren, und kenne ich diese Tendenz – zu polarisieren und zu spalten, auch in mir selbst. Meine psychoanalytische Selbsterfahrung hat mich gelehrt, dies zu sehen und auch annehmen zu können. Heiße Diskussionen kommen vor allem dort in Gang, wo methodisches Wissen an die eigenen Kinder weitergegeben werden soll, also im Bereich der Fortbildungen und Ausbildungen. Sie können sich unschwer dazudenken, dass hier natürlich auch andere Interessen auf dem Spiel stehen, die nicht nur mit der Vermittlung von Wissen und Wissenschaft zu tun haben, sondern mit Geld und Macht – es steht die Verteilung des Kuchens auf dem Spiel. Und dies nicht von ungefähr. Denn von Seiten derer, die sich für Therapie und Therapieausbildung interessieren, sind oftmals eklektische Verfahren mit klingenden Namen und diversen Heilsversprechungen interessanter; oder es sind solche Verfahren interessanter, die kürzere Ausbildungszeiten aufweisen und weniger kosten – ich denke hier an den gegenwärtigen Trauma-Boom mit allen seinen Verheißungen. Aus der Sicht von Patienten und von Psychotherapie-Ausbildungs-Kandidaten ist all das natürlich auch verstehbar! Psychotherapie kostet Geld, viel Geld, Ausbildungen sind teuer, und man hat immer weniger Zeit. Das ist die eine Seite. Der Anspruch, eine Methode fundiert zu erlernen, auch wenn es viele Jahre dauert, das ist die andere Seite. Die Abschottung von methodischen Richtungen gegenüber postmodernen Entwicklungen ist so gesehen auch eine verstehbare Reaktion – wenn vielleicht nicht die beste, wie ich meine. Nun zu den eklektischen Verfahren. Es gibt hier Abstufungen zwischen einem technischen Eklektizismus und einem systematisch-kritischen Eklektizismus, d. h. je nach Grad der Reflexion beim Einsatz verschiedener Methoden und Techniken. Eklektisch arbeiten wird oft aus der „Not der aktuellen therapeutischen Situation“ geboren: man macht in der Therapie das, was im Moment nützlich und zweckmäßig erscheint – um dem Patienten zu helfen, oft aber ohne zu bedenken, dass man sich dabei vielleicht in eine Verwicklung begibt, die man später nur mehr schwer lösen kann. Man tut das, was Patienten im Moment zu brauchen scheinen – das kann je nach Therapiephase sehr unterschiedlich sein. Eine bekannte Körperpsychotherapeutin hatte einmal gesagt: Eine gute Therapiestunde ist eine solche, an deren Ende der Patient glücklich ist. Einerseits ist das Motiv sich elastisch an die Notwendigkeit der therapeutischen Situation anzupassen verstehbar – Ferenczi sprach z. B. davon, die psychoanalytische Arbeit müsse elastisch genug seien, das starre Couch-Setting sei für manche Patienten eine Retraumatisierung. Andererseits ist bei einem eklektischen Vorgehen dem Agieren im Sinne eines abwehrhaften Handelns natürlich Tür und Tor geöffnet. 5 Ich denke in diesem Zusammenhang an Patienten mit einer starken Neigung zur Spaltung oder zur projektiven Identifizierung, Patienten also, die uns aufgrund unsicherer Ich-Grenzen in ihre Erlebniswelt stark hineinziehen und dabei auch in uns Therapeuten Spaltungsvorgänge auslösen – mit der möglichen Folge, dass wir selbst einen roten Faden im therapeutischen Prozess verlieren. Wir sind dann, von Spaltung angesteckt, versucht, einmal das und das nächste Mal etwas anderes zu tun, damit der Patient zufrieden ist. Und – das ist wichtig: damit auch ich, als Therapeut, genügend beruhigt bin, genügend sicher bin, denn Patienten mit einer Neigung zur projektiven Identifizierung können im Therapeuten starke Gefühle auslösen – z. B. Verwirrung, Hilflosigkeit oder auch Zorn. Es kann sich im ungünstigen Fall ein Zustand entwickeln, den Balint „maligne Regression“ genannt hat, und aus der man nur mehr schwer herauskommt. Maligne Regression bezeichnet ein Aufschaukeln einer Bedürftigkeit seitens des Patienten, die immer verzweifelter wird, und ein paralleles Bemühen des Therapeuten, auf die Forderungen des Patienten einzugehen – z. B. nach körperlichem Kontakt, das immer aussichtsloser wird. Ferenczis technische Experimente sind hier anzusiedeln, und aus psychoanalytischer Perspektive sind solche Entwicklungen eine Horrorvision und erklären die starke Reserviertheit vieler Psychoanalytiker gegenüber eklektischen Vorgehensweisen bzw. überhaupt gegenüber einem interaktiven Umgang in der Analyse. Körpertherapeutische Verfahren sind prädisponiert für solche Beziehungsfallen, da sie stark mit bedürfnisbefriedigenden Elementen arbeiten. Wird dieser Punkt, d. h. das Risiko einer malignen Regression, nicht ausreichend reflektiert, kann ein Scheitern der therapeutischen Arbeit vorprogrammiert sein. Besonders auch dann, wenn nicht zwischen basalen Bedürfnissen und Ersatzbedürfnissen unterschieden wird – hier verweise ich neuerlich auf Gisela Worm. Die Frage also: Haben wir es bei analytischer Körperpsychotherapie – die also den Körper und körperliches Handeln in die Analyse integriert - mit einem solchen Eklektizismus zu tun? Ist es hier so, dass wir beides machen wollen: auf der Beziehungsebene arbeiten und auf der Körperebene ebenso – je nachdem was der Patient gerade braucht? Und dass wir dabei vielleicht zu viel wollen und maligne Regressionen begünstigen? Kommt dabei nicht eigentlich die Widerstandsanalyse zu kurz? Nun – solche Fragen sind natürlich schwer generell zu beantworten. Aber ich meine, man muss diese Fragen dennoch stellen. Ein Beispiel: Wenn wir dem Patienten dort, wo er verbal in einer Sackgasse zu sein scheint, eine körperliche Übung vorschlagen und der Patient freudig mitmacht, weil er das Reden auch schon satt hat – könnte es dann nicht sein, dass sich der Patient dem Vorschlag des Therapeuten vielleicht unterwirft, wo es im Untergrund, auf unbewusster Ebene, eher darum geht, einer konflikthaften Konstellation in der Übertragung 6 in die Augen zu sehen, auch wenn der Patient im Moment dafür noch keine Worten finden kann? Sie sehen vielleicht, die Sache ist komplex und erfordert viel Fingerspitzengefühl beim Therapeuten, wenn er mit beiden Ebenen arbeitet – mit der verbalen und der konkret-interaktionellen Ebene. Manipulationen sind möglich, der Wechsel zwischen verbaler und körperlicher Ebene kann sicher auch im Dienste der Abwehr beider Interaktionspartner stehen, denn konflikthafte Spannungen sind auch für den Therapeuten belastend. Nicht umsonst hört man von analytischer Seite oft harsche Kritik an analytischer Körperpsychotherapie – ich erinnere an die Kritik Thea Bauriedls an den Lehrvideos von Tilmann Moser. Eine Antwort darauf, ob die spezifische technische Mischung beim Patienten angemessen war, erhalten wir nur, wenn wir dem Prozess langfristig folgen und beobachten, was sich bei ihm und zwischen uns beiden entwickeln kann und was nicht. Gedankenkomplex 2: Wer braucht methodische Überlegungen? Diese Frage erscheint Ihnen auf den ersten Blick vielleicht seltsam. Ich stelle sie dennoch. Zunächst: Aus der Sicht unserer Patienten sind methodische Überlegungen in der Regel uninteressant. Der Patient will, dass ihm geholfen wird – wie das passiert, ist ihm meist egal; mit Recht auch. Manches Mal stellen Patienten schon Fragen nach der Methode – meiner Erfahrung sind solche Fragen nicht selten Ausdruck einer aufkeimenden negativen Übertragung, wo zwischen den Zeilen ausgedrückt wird, dass der Patient keinen Fortschritt spürt, aber seine Kritik nicht offen äußern möchte. Manches Mal fragen uns natürlich Patienten, die zugleich Kandidaten sind, nach der Methode, aber das ist etwas anderes. In meiner Wiener Stadtpaxis fragen mich auch viele Patienten, was ich genau tue, am Beginn der Therapie; das finde ich legitim, auch wenn eine befriedigende Erklärung selten gelingt. Methodische Überlegungen sind vorwiegend für uns Therapeuten interessant. Neben dem Punkt der Wissenschaftlichkeit spielt ein zweiter, schon erwähnter Grund m. E. eine Rolle: Welcher psychotherapeutischen Methode man sich zugehörig fühlt, ist so etwas wie die Frage, zu welcher Familie innerhalb der Großfamilie aller Methoden man sich bekennt; also eine Frage der Identität, der Ideologie, des Menschenbildes, der Notwendigkeit sozialer Bindung, um in Diskussionen mit „Gleichgesinnten“ ein basales Gefühl zu haben, mit der eigenen Meinung nicht allein dazustehen. Wir praktizierende Psychotherapeuten befinden uns in der Arbeit immer wieder mal vor einem ähnlichen Problem: einerseits sind wir von methodischen Überlegungen geleitet, die uns Sicherheit geben und sagen, was wir in welcher Therapiesituation wie tun sollen; so haben methodische Überlegungen auch eine 7 normative Dimension. Andererseits ist es uns im therapeutischen Prozess immer wieder einmal so, dass die verwendete Methode an Grenzen zu stoßen scheint. Wo der Patient auf das, was wir ihm aus dem Set unserer methodischen Zugänge anbieten, nicht positiv zu reagieren scheint. Das verunsichert uns in der Regel, und wir fragen uns dann, ob es richtig ist, dass wir tun, was wir gerade tun. Und man fragt sich dann vielleicht auch, ob dieser spezielle Fall eine methodische Abweichung rechtfertigt. Zu bedenken ist, dass psychotherapeutische Prozesse oft sehr komplex sind und wir in der Situation ja oft nicht wissen, was jetzt richtig ist. Erst in der Nachreflexion wird uns deutlich, welches Gegenübertragungsmotiv uns geleitet hat – und ob wir dem Patienten sozusagen auf den Leim gegangen sind, ob er uns verwickelt hat, oder ob die Abweichung „sachlich“ vertretbar war. Dieses Dilemma kennt wohl jeder von uns – es ist ein gegenstandsbedingtes Dilemma wie ich meine. Wir stehen also im Spannungsfeld zwischen einem normativen Druck, der der Preis der Zugehörigkeit zu einer Methodenfamilie ist, und dem berechtigten Motiv, von Fall zu Fall davon abzuweichen. Eigenes Beispiel: Ich habe in den letzten Jahren einiges aus der Traumatherapie dazugelernt – z. B. Imaginationsübungen. Und ich spüre, als psychoanalytischer Psychotherapeut, regelmäßig diesen inneren Widerstand, wenn ich in einer Situation stehe, in der sich die Idee aufdrängt: wäre da eine solche Technik nicht hilfreich? Wenn ich sie anwende, weiche ich dann nicht von meinen inneren Regeln ab, agiere ich vielleicht etwas aus meiner Gegenübertragung aus? Wenn ich eine solche Übung anbiete, verbünde ich mich dann vielleicht mit den ausgesprochenen Illusionen des Patienten – das Trauma in kurzer Zeit heilen zu wollen? Mittlerweile meine ich: dieser innere Konflikt in mir ist wichtig, er ist genau das, was ich auszuhalten habe. Er schützt mich zwar nicht davor, mich im Einzelfall zu irren und Fehler zu begehen, aber er gibt mir das Gefühl, dass ich das Problem sozusagen zunächst in mir durcharbeite – wobei dabei manches Mal spontanes Reagieren verloren geht, was auch wichtig sein kann. Auch hier sei ein Widerspruch angedeutet, der generell nicht so leicht so leicht lösbar ist: während körperpsychotherapeutische Verfahren auf Intuition, Spontaneität und auch Affektabfuhr einen gewissen Wert legen, ist im psychoanalytischen Bereich gerade das Aushalten ambivalenter Spannungen ein Reifekriterium. Gedankenkomplex 3: Unsere Schwierigkeiten sind gegenstandsangemessen Ich wechsle nun auf das Feld der Systemtheorie. Da gibt es den Begriff Autopoiesis, der von Maturana und Valera aus dem Bereich der Neurobiologie in die Psychotherapie eingeführt wurde: Es geht dabei um das Prinzip der Selbsterzeugung und auch Selbststeuerung von Identitäten, von Organismen. 8 Ein Kennzeichen von Autopoiesis ist, dass nicht nur aus vorhandenen Handlungsalternativen bestimmte ausgewählt und andere unterdrückt werden, sondern dass in diesem Prozess auch ständig neue Alternativen erzeugt werden. D. h. Autopoiesis ist emergent, d. h. es geht um neue Kreationen, um neu Hervorgebrachtes. Und diese Emergenzen sind prinzipiell nicht antizipierbar! Mit einfacheren Worten: der Prozess der Entwicklung ist offen, wir haben es auf der organismischen Ebene mit einem Individuum zu tun, das aktiv und gestaltend ist, das seinen eigenen Prozess ständig beeinflusst und ihn durch Erkenntnis, durch Lernen verändert. Autopoiesis heißt somit Lernen durch Erfahrung, heißt Autonomie, heißt historischer Wandel und offene Zukunft. Was bedeutet das Autopoiesis-Prinzip in Bezug auf unseren Gegenstand, die psychotherapeutischen Methodik? In unserem Feld haben wir es mit subjektiven Erlebnisweisen zu tun, die einen hohen Emergenzgrad aufweisen. Im subjektiven Bereich und im intersubjektiven Bereich, als zwischen zwei Menschen, wird ja immer wieder Neues hervorgebracht. Davon bleiben natürlich auch methodische Überlegungen nicht verschont. Wendet man das Konzept der Autopoiesis also auf unseren Bereich an, dann heißt dies, dass die theoretische Reflexion autopoietischer Realität einen besonderen Theorietypus verlangt, der sich von dem der Naturwissenschaften unterscheidet: ein Symbolsystem, das nicht mit eindeutig festlegbaren Zeichen operiert (wie Zahlen in der Mathematik), sondern mit kognitiven Konzepten, in denen die Erfassung des jeweils Besonderen im Mittelpunkt steht. Ein solches Symbolsystem zielt also auf die spezielle Logik, auf das Individuelle, auf Subjektivität und Reflexivität des Prozesses. An die Stelle allgemein gültiger Gesetzmäßigkeiten treten sinnvolle Begriffe – als teils widersprüchliche, multipel determinierte und autonome Einheiten, die sich letztlich erst in der Beziehung zu dem erfassen, was thematisiert wird. In der Welt der Psychotherapiemethoden gibt es dieser Auffassung nach – es ist dies die Position des „konstruktiven Realismus - keine definitiven Wirklichkeiten, sondern einen permanenten Prozess der Entwicklung, Veränderung und Auffächerung. Die Folge davon ist eine permanent wachsende Zahl an Möglichkeiten, menschliches Erleben zu verstehen und zu erklären, wobei immer die Stellung des erkennenden Subjekts zentral ist. Und dies öffnet den Boden für eine Vielfalt von Verstehensmöglichkeiten und damit auch Methoden. Widersprüchlicheiten sind daher unserem Gegenstand Widersprüchlichkeiten immanent. Wir können diese Widersprüche nicht nivellieren; wir können sie uns immer wieder nur reflexiv bewusst machen und sie vorübergehend entschärfen – im Wissen, dass wir darin níe ganz erfolgreich sein können. 9 Das heißt natürlich im Bereich des Methodenfeldes, dass Abspaltungen in gewisser Weise vorprogrammiert sind. Denn die Heterogenität gehört ja zentral zu unserem Gegenstand. Als Folge davon werden in den verschiedenen Methoden verschiedene Mikrowelten beschrieben und thematisiert; keiner von ihnen kommt eine Priorität zu. Jede ist in ihrem eigenen Bezugsrahmen gefangen, der von den Fragen aufgespannt wird, die diese Theorie stellt und die sie ausspart. Eine Einheit der Erkenntnis ist eine Illusion. Jedes gegenwärtige Paradigma ist ein Paradigma auf Zeit – auch wenn sein exaktes Ende nicht vorhersehbar ist. In der psychoanalytischen Therapie ist derzeit das Handlungsparadigma wichtig geworden, und ich glaube, es wird auch noch eine Weile wichtig bleiben. Irgendwann wird es wieder an Bedeutung verlieren. Gedankenkomplex 4: Psychotherapie als erlernbare Methode Als erfahrener Therapeut hat man im Laufe der Zeit ein gewisses Raster verinnerlicht, mit dessen Hilfe man das therapeutische Geschehen verstehen kann. Es ist nicht anders als beim Autofahren: Im Laufe der Zeit sind die Handlungslogiken so weit verinnerlicht, dass man davon bewusst nicht mehr Gebrauch machen muss – man kann sich im Laufe der Zeit zunehmend freier auf das Geschehen einlassen. Diese Freiheit auf Seiten des Therapeuten macht es möglich, dass spontane Verdichtungen im intersubjektiven Feld von Zeit zu Zeit wie von selbst entstehen – sog. „Now-moments“, Momente unmittelbarer Begegnung, die für das Fortschreiten des Prozesses wichtig sind. Dem erfahrenen Therapeuten gelingt es dann wie von selbst, das zu tun, was Yalom, ein gegenwärtig bekannter Vertreter der Existenzanalyse, so beschreibt: „Meine Technik besteht darin, alle Technik fahren zu lassen!“ Für den Lernenden stellt sich die Situation anders dar. Er muss sich in der klinischen Praxis erst bewähren, muss – wie in den ersten Fahrstunden – die nötigen Handgriffe ganz bewusst tun, damit das Auto Richtung und Geschwindigkeit beibehält und die Fahrt nicht ins Stocken oder ins Schleudern gerät. Daher gilt aus der Perspektive der Erlernbarkeit einer Methode: bestimmte grundlegende Lernschritte sollten vermittelbar und erlernbar sein, und zwar innerhalb einer umgrenzten Zeitspanne. Psychotherapeutische Ausbildungsvereine sind daher auf Methoden angewiesen, die von ihrer Struktur her nicht zu komplex sind, sondern dem Lernenden die Möglichkeit geben, sich anhand klar umrissener Kategorien zu orientieren; und dass das erlernte Raster diese im großen und ganzen widerspruchsfrei ist. 10 D. h. eine gewisse Logik und Widerspruchsfreiheit im Vorgehen ist im Dienste der Erlernbarkeit einer Methode wichtig. Allerdings wäre in einer Ausbildung auch zu vermitteln, dass das vorgezeigte Denkmodell nur ein Raster von vielen ist, und dass seine Reichweite, psychische Prozesse zu erklären, naturgemäß begrenzt ist. Gedankenkomplex 5: Handelndes Agieren vs. Reflektierendes Verstehen Vergegenwärtigt man sich die methodischen Ausgangspunkte von Psychoanalyse und Körperpsychotherapie, dann wird deutlich, dass eine Integration von psychoanalytischen und körpertherapeutischen Vorgehensweisen in einem gemeinsamen Ansatz gar nicht so selbstverständlich ist. Im Gegenteil! Dann wird nämlich klar, wie unterschiedlich die beiden Vorgehen eigentlich sind: auf der einen Seite steht ein geduldiges Abwarten des Psychoanalytikers, auf der anderen Seite ein aktives Intervenieren. Auch wenn in Körperpsychotherapien mehr oder weniger viel gesprochen und verbal reflektiert wird, so erfordert die Besonderheit des methodischen Zugangs immer wieder aktive Interventionen seitens des Therapeuten, die über reines Verbalisieren hinausgehen. Dies hat mit den unterschiedlichen Logiken in beiden Ansätzen zu tun. Während sich der Psychoanalytiker auf die innere Welt des Patienten in Form dessen vorbewusster Fantasietätigkeit konzentriert und ihm dabei Raum und Zeit geben muss, damit er seinem Fantasieduktus folgen kann, ist der Körperpsychotherapeut an körperlicher Exploration, körperlichem Spüren und körperlichem Ausdrucksverhalten interessiert. Solange dabei nur die Wahrnehmungsebene angesprochen ist – das Empfinden von körperlichen Haltungen und Bewegungen, Haltungs- und Bewegungsveränderungen, Eigenheiten des Atmens usw. – tritt dieser Unterschied noch nicht so deutlich zutage. Geht es aber um körperliche Impulse oder um Handlungsbereitschaften des Patienten, dann ist in aller Regel die Aktionsbereitschaft des Therapeuten gefordert. Seine Aufgabe ist es dann, die motorischen Bereitschaften durch begleitende Interventionen zu stützen und zu ermutigen, verbal oder direkt körperlich, damit sich die Körperassoziationen entfalten können. Tut man dies als Therapeut nicht, dann brechen die körperlichen Handlungsversuche des Patienten oft nach wenigen Momenten wieder ab, außer bei körpertherapieerfahrenen Patienten, die bereits gelernt haben, diesen Formen der Assoziation zu vertrauen. Also – hier stehen sich zwei unterschiedliche Zugangsweisen gegenüber! In diesem Gedankenkompex verbergen sich viele weitere Fragen: nach der Rolle des Therapeuten (ob Begleiter oder Übertragungsfigur), nach dem Modus der Interventionen (selbst- oder beziehungszentriert), und andere – ich verweise auf das Referat von Gisela Worm. 11 Gedankenkomplex 6: Klinisches Vorgehen und diagnostische Überlegungen Im Tagungsprogramm einer Fachtagung der DGAPT im Juni dieses Jahres ist nachzulesen: „Die Integration des Körpers in die therapeutische Praxis ist vor allem bei der Behandlung der sogenannten "Frühstörungen" von großer Bedeutung. Interventionen am und mit dem Körper eröffnen über die Grenzen rein verbaler und symbol-bezogener analytischer Techniken einen therapeutischen Zugang zu präverbalen Defiziten und Konflikten. Der Körper ist eine zweite via regia zum Unbewussten.“ “Regression, Widerstand, Übertragung und Gegenübertragung haben eine körperliche Dimension und werden vor allem auch über den Körper reguliert.“ Auf einen Punkt weise ich hier hin – auf die Diagnostik und die Indikation: der körperbezogene Zugang vor allem bei der Behandlung von Frühstörungen Mit Frühstörungen ist, so meine Annahme, das gemeint, was wir in einer anderen Terminologie als strukturelle Ich-Störungen bezeichnen, zu denen z. B. Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsorganisation zu rechnen sind, frühtraumasierte Patienten und Patienten mit frühen und schweren Defiziten. Zur Verdeutlichung: Bei Patienten mit Frühstörungen, oder besser: strukturellen Ich-Störungen, ist es notwendig, wegen der Fragilität ihres Ich nicht zu intensive Affektverdichtungen herbeizuführen, die das Ich überschwemmen würden. Ichschonend ist es, an der Selbstwahrnehmung im körperlichen Bereich zu arbeiten, wobei der Therapeuten die Rolle eines Begleiters innehat. Ein weiterer Punkt zur Verdeutlichung: Arbeit in der Übertragung, Arbeit an der Übertragung. In der Übertragung zu arbeiten heißt, dass die Äußerungen des Patienten relativ systematisch in die Hier-und-Jetzt-Situation übersetzt werden und sich alles darum dreht, was jetzt zwischen den beiden Interaktionspartner geschieht – verbal und körperlich. Das ist relativ belastend. Schonender ist die Arbeit an der Übertragung, wo man nur fallweise, v. a. bei Übertragungsstörungen, auf das beziehungsmäßige Hier und Jetzt ganz gezielt eingeht. Nun in der Gegenüberstellung zur obigen Passage – eine Passage aus einem Beitrag von Gisela Worm, die sich auf analytische Körperpsychotherapie bei solchen Patienten bezieht: 12 Im Falle einer starken Strukturlabilität ist körperbezogene Arbeit in der Übertragung wegen der immensen Affektverdichtung nicht indiziert! Das Mittel der Wahl sind hier körperbezogene Zugänge, welche die therapeutische Rolle als begleitende Funktion definieren. Bitte beachten Sie: körperbezogene Arbeit IN DER ÜBERTRAGUNG. Das ist für diese Patienten zu viel. Andererseits ist es so, dass im psychoanalytischen Arbeiten die Arbeit IN DER ÜBERTRAGUNG zentrales Vehikel ist, aber das Hinzunehmen der Körperebene und die damit verbundene Verdichtung wäre zu viel. Wenn also die einen Kollegen gerade für die Frühstörungen Interventionen an und mit dem Körper für wichtig erachten und zum zentralen Vehikel ihres therapeutischen Vorgehens machen, und wenn auf der anderen Seite herausgestrichen wird, dass direkte körperliche Arbeit in der Übertragung nicht indiziert ist, liegt ein Schluss nahe (sofern wir übereinstimmen, dass wir einigermaßen gleich diagnostizieren): es handelt sich um zwei Wege des Vorgehens, und nicht um einen. Der eine Weg besteht darin, mehr auf der körperlichen Selbstebene zu arbeiten und nur partiell in der Übertragung; oder gar nicht in der Übertragung, sondern nur an der Übertragung. ist damit vielleicht doch etwas anderes gemeint als ein Vorgehen, bei dem die Arbeit in der Übertragung nach Möglichkeit Kern des therapeutischen Vorgehens sein soll! Besonders ich-belastend wird die Arbeit, wenn es um konflikthafte Anteile geht – Stichwort „negative Übertragung“. Die Belastung steigt nochmals ins Extreme, wenn man die negative Übertragung auf der körperlichen Ebene zusätzlich verdichtet. Patienten mit ich-strukturellen Störungen und einer Neigung zu Spaltung erleben das manches Mal so: Bricht der Hass ungefiltert durch, entstehen Fantasien den Therapeuten umzubringen. Auf der Fantasieebene, im Couch-Setting, ist das noch zu handeln, auf der Körperebene nur mit Ersatz-Objekten (Schaumstoffwürfel und dgl.), aber nicht im direkten Kontakt. Dieser wird durch Arbeiten in der Übertragung aber stark herausgefordert. Die Angst vor diesem intensiven Hass führt oft zu lähmungsartigen Zuständen. Körperbezogene Arbeit in der Übertragung ist daher bei strukturellen Ich-Störungen in der Regel nicht indiziert. Auch dazu wird Gisela Worm noch einiges sagen. Resümee: Ich glaube, dass hier wirklich zwei verschiedene Schwerpunktsetzungen vorliegen. Wir sollten uns überlegen, ob es sich dabei 13 nicht um zwei Vorgehensweisen handelt, die auch unterschiedliche Namen verdienen würden. In der einen Vorgangsweise geht es mehr um gute und heilsame Erfahrungen – um therapeutische Regression, die in der Tat auch auf der körperlichen Ebene reguliert werden kann. In der anderen Vorgangsweise geht es eher um das Herausarbeiten des Konflikthaften in der Übertragung, also um den Widerstand, die Abwehr. Ich denke, da gibt es Unterschiede auch im Bereich der Technik, der Praxeologie. Abschließende Betrachtungen: Die Grenzen des Integrierens und die Verdrängung des Schmerzes der eigenen Begrenztheit In meiner nun 25-jährigen Geschichte als Psychotherapeut habe ich viele interessante methodische Zugänge kennen gelernt. Gleichzeitig habe ich schmerzlich zur Kenntnis nehmen müssen, dass ich einerseits all diese Methoden, so interessant sie auch sind, nicht erlernen kann, und dass ich andererseits sogar diejenigen methodischen Elemente, die ich ganz gut erlernt habe, nicht gleichzeitig in einem einzelnen Vorgehen einbauen kann, weil dies den Prozess eher stören als fördern würde. Es geht – mit anderen Worten – um das Akzeptieren eines Schmerzes, der im weiteren Sinn mit den notwendigen Begrenztheiten des Lebens zu tun hat. Den Schmerz und die Trauer zu erfahren ist wichtig, um die Begrenztheiten des Lebens akzeptieren zu lernen. Vorsichtig bin ich gegenüber Ansätzen, die diesem aus meiner Sicht unvermeidlichen Schmerz nicht genügend Raum geben. Gerade die neuere Traumadiskussion hält uns meiner Meinung nach – mit ihrer Technikzentrierung - die Illusion vor Augen, dass alles, was man nur will und wenn man nur genügend viele Techniken hat, machbar wäre. Diese Einstellung fügt sich gut in die moderne Lebenserfahrung unserer globalisierten Welt ein, wo in der Tat alles machbar erscheint. Sie kann uns aber genau dadurch von wesentlichen existenziellen Erfahrungen weg führen – z. B. von der schmerzlichen Anerkennung der Begrenztheit des Lebens durch den Tod. Daher bergen eklektische Verfahren das Risiko, sich über vorhandene Begrenztheiten illusionär hinwegzusetzen, um eine „Supermethode“ oder eine „Supertheorie“ zu entwickeln, die alles kann, die für alles und jedes einen Weg hat. Mir gefällt eine Haltung besser, die davon ausgeht, dass gegenwärtige Trends innerhalb bestimmter Traditionen, wie z. B. in der Psychoanalyse das Paradigma der Handlung, gegenwärtig wichtig geworden sind und breit diskutiert werden – ohne den Anspruch einer Supertheorie, die alles will! Ausgehend von der Erfahrungstatsache, dass sich das Verdrängte eben wieder 14 meldet, haben wir es jetzt, in der modernen Psychoanalyse, mit einer Wiederkehr von Themen zu tun, die schon vor Jahrzehnten Ferenczi und Reich aufgebracht haben und die jetzt die psychoanalytische Welt wieder zu beschäftigen beginnen; dass auf diese Weise Wege gesucht werden, den therapeutischen Spielraum zu erweitern, aber auch neuerlich Grenzen abgesteckt werden. Auf diese Weise bleiben Methoden in Bewegung, in Entwicklung. Dass wir als Psychotherapeuten natürlich auch Grenzen haben und zu diesen klar stehen können, ist im übrigen nicht nur für uns selbst, sondern auch als explizite oder implizite Mitteilung an unsere Patienten wichtig. Ich erinnere diesbezüglich an Ferenczis berühmt gewordene Falldarstellung von E. Severn. Im Versuch, ihren Wünschen gerecht zu werden, hat Ferenczi sich damals sogar in das Wagnis der „mutuellen Analyse“ eingelassen, und er hat zugelassen, dass sie ihm in den Urlaub nachreist. Das war zu viel für ihn, zu viel auch für seine Ehe, wie Sie sich vorstellen können - und Ferenczi ist an diesem Anspruch gescheitert. Man kann über dieses Experiment so oder so denken – deutlich sollte sein, dass das Stehen zu eigenen Grenzen ein wichtiger Aspekt in der Therapie sein sollte. Diese Grenzen können das Setting betreffen, wichtiger aber erscheint mir noch eine bestimmte therapeutische Haltung, indem wir dem Patienten zeigen, dass wir auch nur Menschen sind, mit eigenen Wünschen und ebenso eigenen Grenzen. Eklektische Verfahren bergen das Risiko, dass genau dieser Aspekt der Grenzen zu wenig bearbeitet wird. Für den methodischen Zugang, der sich derzeit analytische Körperpsychotherapie nennt, bedeutet dies, in einem Diskussions- und Differenzierungsprozess mögliche Handlungsräume ebenso wie Begrenzungen derselben abzustecken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 15