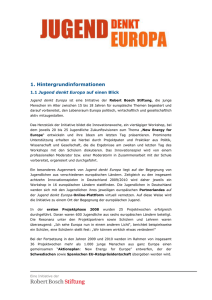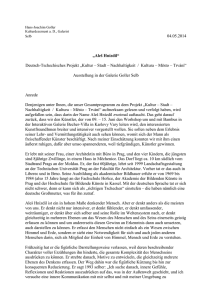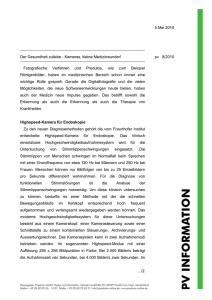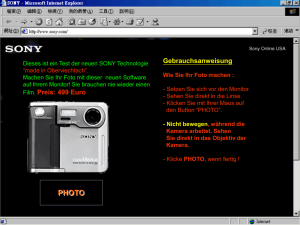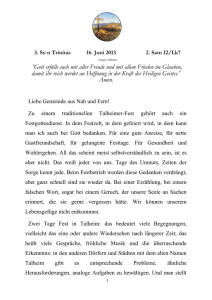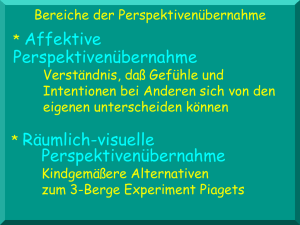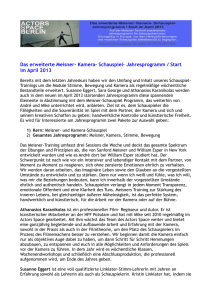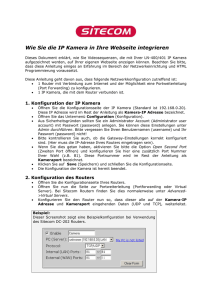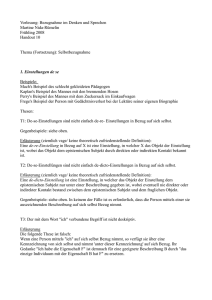die ganze Rezension - Andreas Unterweger
Werbung
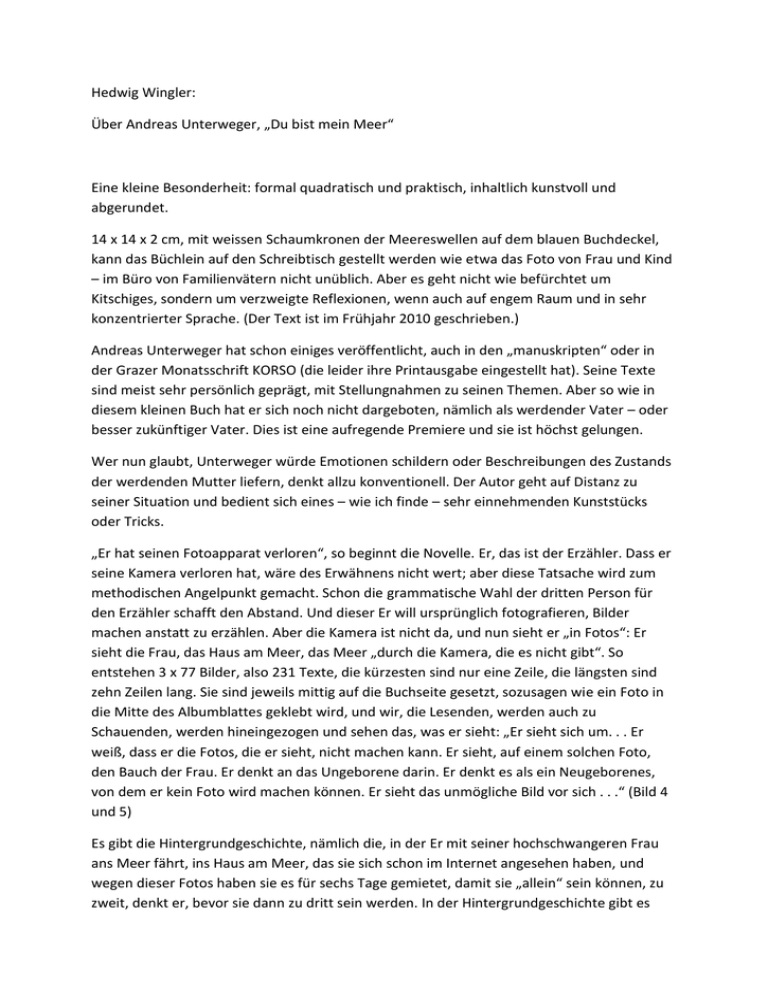
Hedwig Wingler: Über Andreas Unterweger, „Du bist mein Meer“ Eine kleine Besonderheit: formal quadratisch und praktisch, inhaltlich kunstvoll und abgerundet. 14 x 14 x 2 cm, mit weissen Schaumkronen der Meereswellen auf dem blauen Buchdeckel, kann das Büchlein auf den Schreibtisch gestellt werden wie etwa das Foto von Frau und Kind – im Büro von Familienvätern nicht unüblich. Aber es geht nicht wie befürchtet um Kitschiges, sondern um verzweigte Reflexionen, wenn auch auf engem Raum und in sehr konzentrierter Sprache. (Der Text ist im Frühjahr 2010 geschrieben.) Andreas Unterweger hat schon einiges veröffentlicht, auch in den „manuskripten“ oder in der Grazer Monatsschrift KORSO (die leider ihre Printausgabe eingestellt hat). Seine Texte sind meist sehr persönlich geprägt, mit Stellungnahmen zu seinen Themen. Aber so wie in diesem kleinen Buch hat er sich noch nicht dargeboten, nämlich als werdender Vater – oder besser zukünftiger Vater. Dies ist eine aufregende Premiere und sie ist höchst gelungen. Wer nun glaubt, Unterweger würde Emotionen schildern oder Beschreibungen des Zustands der werdenden Mutter liefern, denkt allzu konventionell. Der Autor geht auf Distanz zu seiner Situation und bedient sich eines – wie ich finde – sehr einnehmenden Kunststücks oder Tricks. „Er hat seinen Fotoapparat verloren“, so beginnt die Novelle. Er, das ist der Erzähler. Dass er seine Kamera verloren hat, wäre des Erwähnens nicht wert; aber diese Tatsache wird zum methodischen Angelpunkt gemacht. Schon die grammatische Wahl der dritten Person für den Erzähler schafft den Abstand. Und dieser Er will ursprünglich fotografieren, Bilder machen anstatt zu erzählen. Aber die Kamera ist nicht da, und nun sieht er „in Fotos“: Er sieht die Frau, das Haus am Meer, das Meer „durch die Kamera, die es nicht gibt“. So entstehen 3 x 77 Bilder, also 231 Texte, die kürzesten sind nur eine Zeile, die längsten sind zehn Zeilen lang. Sie sind jeweils mittig auf die Buchseite gesetzt, sozusagen wie ein Foto in die Mitte des Albumblattes geklebt wird, und wir, die Lesenden, werden auch zu Schauenden, werden hineingezogen und sehen das, was er sieht: „Er sieht sich um. . . Er weiß, dass er die Fotos, die er sieht, nicht machen kann. Er sieht, auf einem solchen Foto, den Bauch der Frau. Er denkt an das Ungeborene darin. Er denkt es als ein Neugeborenes, von dem er kein Foto wird machen können. Er sieht das unmögliche Bild vor sich . . .“ (Bild 4 und 5) Es gibt die Hintergrundgeschichte, nämlich die, in der Er mit seiner hochschwangeren Frau ans Meer fährt, ins Haus am Meer, das sie sich schon im Internet angesehen haben, und wegen dieser Fotos haben sie es für sechs Tage gemietet, damit sie „allein“ sein können, zu zweit, denkt er, bevor sie dann zu dritt sein werden. In der Hintergrundgeschichte gibt es auch ein Hinterland, hinter dem Meer: „Er sieht: Traktoren, Dung.“ (Bild 57) Denn er will nicht immer nur das Meer sehen. Es gibt die Ortschaft und Menschen. Es gibt eine Umwelt, in der ein fremder Mann mit Stativ und Kamera sich an den Strand begibt und sozusagen in den Augen des Er als Spiegelbild der eigenen Absichten erscheint – und der Fremde erscheint ihm als lächerlich. Es gibt das kleine Geschäft im Ort, wo in der Auslage eine Kamera zum Kauf verlockt und dann von ihm doch nicht erworben wird. Dies ist der Handlungsstrang mit den Fakten, der Hintergrund. Dazu gehört auch noch die Bemerkung, dass die verschwundene Kamera ein Geschenk des Vaters zur Hochzeit war; es ist das einzige Zugeständnis an „Analytischem“: Er stellt fest, dass der Verlust eine „Fehlleistung“ gewesen ist. Die Vordergrundgeschichte aber ist die Reflexion auf den Umstand, wie er sieht, was er sieht, weil er es nicht mit der Kamera aufnehmen kann. Um den Verlust des Bildermachens zu kompensieren, fällt ihm ein, dass er zeichnen könnte, und er fängt an zu zeichnen. „Er zeichnet, was er sieht, auf das Papier. Man zeichnet, denkt er, die Dinge einfach in ihrer wahren Größe: . . . (Und ganz genau so, wie er denkt, denkt er, zeichnet er auch.) . . . Er sieht auf dem Papier nicht das, was er gezeichnet hat.“ (Bild 16) Es schaut nicht so aus, wie es wirklich aussieht! Er stellt fest, dass man das Meer nicht zeichnen kann. Dies bringt ihn dazu, die Namen der Dinge neben das Gezeichnete zu schreiben: „Meer“ oder „(weiße) Mauer“. Das Zeichnen ist nämlich eine ungeheure Leistung der Abstraktion von dem, was uns anschaulich gegeben ist. Und daher beschliesst er, „schriftliche Fotos“ zu machen. Weil er nicht nur werdender Vater, sondern auch Schriftsteller ist. Er kehrt sozusagen das bekannte Diktum „Bilde Künstler, rede nicht“ einfach um und schreibt. Andreas Unterweger schildert lebhaft und anschaulich – immer in der leicht ironischen Distanz der dritten Person - , wie seine Ausflüge in das Zeichnen ihn darin bestärken, zu schreiben. Sein bildsamer Geist scheitert an der ästhetischen Herausforderung der bildnerischen Mimesis und brilliert in der Schilderung dieses Scheiterns. Und er sublimiert versuchsweise auf andere Art: „Er hat die Idee zu einem Gedicht. . . . Er verwirft die Idee. / Er hat die Idee zu einer Geschichte. Besser gesagt: ihm fallen Worte ein.“ (Bild 19, 20) Und jetzt schreibt er auf, wie die Geschichte beginnen wird: „>Er hat seinen Fotoapparat verloren<, steht in seinem Notizblock.“ Jetzt beginnt die Erzählung darüber, wie Er eine Idee hat, ein Buch zu schreiben, eher eine Novelle, und die Verschachtelung wird vollständig: „In der Novelle könnte es um ein Haus am Meer gehen, denkt er, ein Haus wie dieses hier . . . Ein Ehepaar könnte das Haus bewohnen. Der Mann heißt Robert, denkt er, und die Frau heißt Sara. (Die Namen muss man später selbstverständlich unbedingt noch ändern, denkt er.) Sara ist schwanger, denkt er, Robert Maler. (Oder auch Fotograf, Philosophieprofessor oder Clown – was immer. Robert darf alles machen, denkt er, nur nicht schreiben wie ich/.)“ (Bild 105-107) So werden Vordergrund und Hintergrund der Erzählung durch einen Kunstgriff zur verschränkten Rahmenhandlung einer Fiktion, die in witziger Weise der Haupterzählung ähnlich würde. . . Die Pointe besteht dann darin, dass er – naturgemäss, möchte Thomas Bernhard gesagt haben, denken wir - die Idee der fiktiven Geschichte des Paares verwirft. Denn „wie bei Parmenides“ – ja, die alten Griechen! – geht nichts jemals verloren und nichts ändert sich. . . (Bild 111-113). Das hindert den Er jedoch nicht, im weiteren Verlauf sich an Robert zu wenden: „Was würde Robert tun, denkt er“, als er zögert, ob er sich die Kamera in der Auslage kaufen soll. „(Aber R. gibt es nicht. R. schweigt.)“ Er kauft sie nicht. (Bild 207) Ist Robert seine spiegelbildliche oder virtuelle Persona? Ein kleiner Tipp (Bild 151): Unter den Büchern im gemieteten Haus findet sich „Alice im Wunderland“, Through the Looking-Glass and What Alice Found There. Demgemäss ist dies ein Verweis auf die literarische Verwandtschaft, wie Unterweger sie versteht. Die Katze der Nachbarn heisst Alice – welch sonderbarer Name für eine Katze, denkt er. - Blicke durchs Fenster oder spiegelnde Glastüren sind ein durchgehendes Motiv. Das im Haus gefundene Fernglas erlaubt den Blick durch die Scheiben der Hoftür auf das Meer hinaus. Perspektivismus ist ein Kennzeichen moderner Literatur. Mit dem wiederholten Hinweis auf den Verlust der Kamera betont der Autor, dass nicht „die Welt“, oder in seinem Fall (der Urlaub eines Paares, bestehend aus dem zukünftigen Vater und der schwangeren Frau) dargestellt wird. Sondern er zeigt die möglichen Blickwinkel auf das, was geschieht, etwa auch in den Abschnitten, wo die Frau, wie er beobachtet, mit ihrem Mobiltelefon ein Foto vom Meeresstrand und auch von ihm gemacht hat: „Man sieht dich auf dem Foto nicht“, sagt sie zu ihm. Indirekt schildert er ihren Zugriff, ihre Perspektive. Es gäbe nämlich auch andere Möglichkeiten des Blickes, so ist es wohl gemeint. Es hat sich schon in den Zitaten gezeigt, wie einfach und klar dieser Text geschrieben ist. Die Sprache ist verblüffend lakonisch. Viele kurze Hauptsätze, oder nur Aufzählungen: „(Der Hof, die Hummerreuse im Hof, das Meer: hinter der Hoftürscheibe.)“ (Bild 196) Und immer wieder kurze Hypotaxen: „Wieder überrascht ihn, wie groß ihr Bauch ist. (Und: Wie klein das Wesen darin sein muss, denkt er.)“ (Bild 65) Das entspricht der Ästhetik der Fotografie, denke ich mir, und bewundere die Konsequenz, mit der der Autor diese stilistische Reduktion durchhält, die umso mehr Eindruck macht, weil seine Erzählung durchaus von Situationen durchzogen ist, die beim Lesen Kommentare evozieren, assoziative oder emotionale. Aber Andreas Unterweger bleibt bei seiner Methode „Klick“, ich halte fest. Und hat durchaus einen Schriftstellerkollegen parat, Rolf Dieter Brinkmann, der seine Gedicht „snap-shots“ nannte – „Er fragt sich, ob Brinkmann wohl auch einmal seinen Fotoapparat verloren hat“ (Bild 184, 185) Es ist Unterwegers Text auch ein Spiel mit Verweisen, mit Anspielungen, etwa wenn er Vincent van Gogh zitiert (zur Perspektive, Bild 26) oder Stéphane Mallarmé, der gesagt hat, Verse mache man nicht mit Ideen, sondern mit Worten (Bild 19). Oder das Zitat des alten Parmenides, siehe oben. Damit bekennt sich der Autor (nicht Er, sondern es ist das Anrufen einer Meta-Ebene, die aufblitzt) als ein Poeta Doctus. Es verleiht der Komposition eine weitere vergnügliche Dimension, ein intellektuelles Gegengewicht zur Liebesgeschichte. Unterweger nennt seine Erzählung Novelle; ja sie erfüllt das Merkmal des „Ereignisberichtes“, aber dieser Bericht ist keineswegs chronologisch-linear, sondern die sechs Tage des Aufenthaltes am Meer wirbeln durcheinander, sind manchmal mehrfach geschildert, wie die Motivik es erfordert. Das macht die Lektüre lebendig, trotz der schon erwähnten bewusst einfachen Sätze. Und die Struktur, der Aufbau mit Hinter- und Vordergrund und Rahmen und „Abbild“ sowie Meta-Ebene unterstreicht die muntere, fast nervöse Atmosphäre, die den Erzähler einhüllt – denn es steht ein grosses Ereignis bevor. Es ist ein Buch über die Liebe, aber nicht nur: sondern auch über das Wunder, dass ein Kind im Bauch einer Mutter im Werden ist. Und eine Ahnung entsteht, wie völlig anders dem Mann, dem zukünftigen Vater, dieses Phänomen sozusagen zustösst. Darf gesagt werden, die Frau erfährt es existenziell, der Mann beobachtet und sublimiert es? In einer Folge von Bildern schildert Er einen Traum: Er fliegt aufs Meer hinaus, „stößt im Sturzflug auf das Meer hinab, bricht durch den Schatten (seinen eigenen Schatten), durch die Scheibe, den Spiegel. Er taucht.“ (Bild 166, 167) Dieser Traum als gedichtete Metapher für den Ersatz dessen, dass Er nicht gebären kann? Aber zeugen. Es ist ein wunderschönes Buch über die gemeinsame Erwartung, geschildert aus dem Blickwinkel des Autors, ohne Interpretation der eigenen Gefühle oder der emotionalen Situation der Partnerin. Aber die Beschreibung ihres Körpers, ihrer Körperlichkeit – etwa wie sie einmal Yoga zur Geburtsvorbereitung macht – ist in einer Einfachheit gehalten, wie sie nur aus grosser und respektvoller Nähe möglich ist, kurz aus Liebe. Gerade wenn Er über sie, die Frau (beide haben keinen Namen) schreibt, fällt die die fast kühle Sachlichkeit auf: als Merkmal der Kunst des Autors, nicht aus Mangel an Nähe, sondern eher um die grosse Nähe zu verschleiern. Denn: sie, die Frau, ist sein Meer. Es gibt ein - zu Unrecht vergessenes – Büchlein von Günther Anders (ja, dem mit der „Antiquiertheit des Menschen“), es heisst „Mariechen. Eine Gutenachtgeschichte für Liebende, Philosophen und Angehörige anderer Berufsgruppen“; Hauptfigur ist ein durch die Weltmeere gleitender weiblicher Wal namens Mariechen, weiters figurieren Er als Erzähler und seine mit ihm im Bett liegende Geliebte, die auch Mariechen heisst. Anders schrieb diese Geschichte in gebundener Sprache im Jahr 1946, sie erschien erstmals 1987 zu seinem 85. Geburtstag. Auch dort spielt das Meer als Projektionsfläche für die als unendlich empfundene Liebe eine Hauptrolle. Andreas Unterweger, „Du bist mein Meer“, Novelle (in 3 x 77 Bildern). 236 Seiten. Literaturverlag Droschl, Graz - Wien 2011. PS. „Maria auf dem Titelblatt hält die manuskripte sicher hinaus in die Zukunft. Die Dichtertochter (Andreas Unterwegers) versinnbildlicht das Weiterschreiben, das Vertrauen zur Poesie.“ So Alfred Kolleritsch in seiner Marginalie im März-Heft Nr. 191/2001 der „manuskripte“, wo leibhaftig (Foto von Sepp Unterweger) das Baby aus „Du bist mein Meer“ tatsächlich das Heft Nr. 187 (2010, mit dem bunten Titelbild von Günter Waldorf) zu begutachten scheint – visuell und taktil, noch nicht kritisch! So wissen wir Lesenden der Zeitschrift, dass die poetische neue Generation im Heranwachsen ist. In der Wirklichkeit gibt es doch nicht nur verlorene Fotoapparate! Also gibt es auch Fotos, die den Schreibtisch schmücken. Aber nur in der Wirklichkeit. So ein Glück.