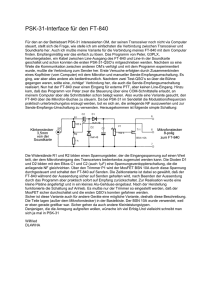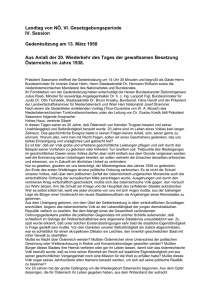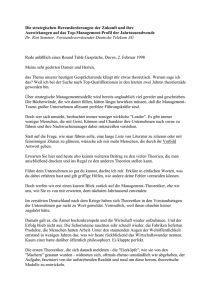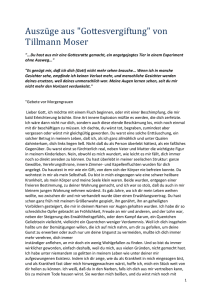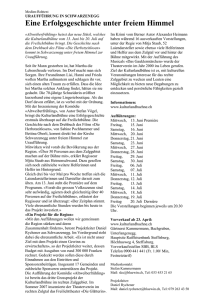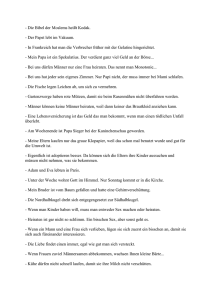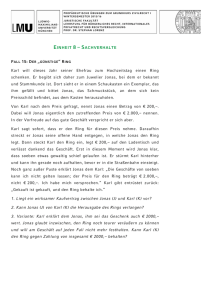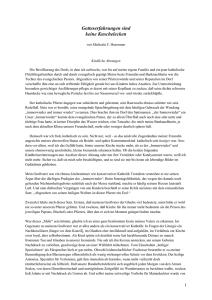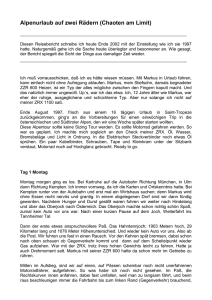Roland Müller - Roland Seeheim
Werbung
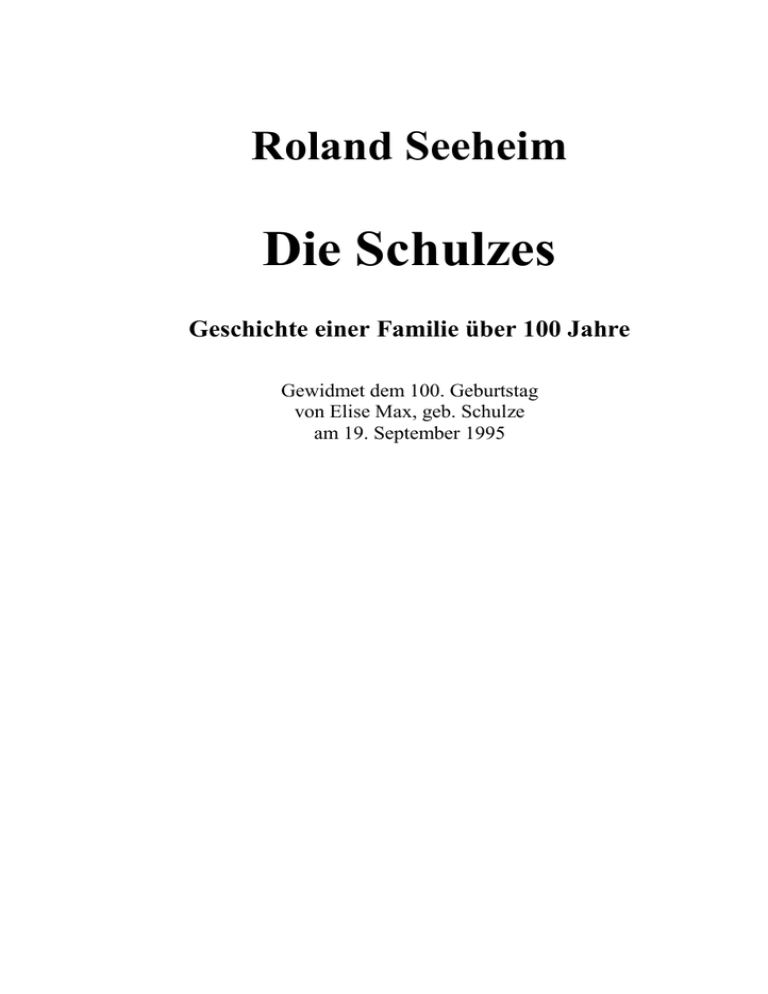
Roland Seeheim Die Schulzes Geschichte einer Familie über 100 Jahre Gewidmet dem 100. Geburtstag von Elise Max, geb. Schulze am 19. September 1995 2 1. Kapitel Margarete erzählt von ihren Großeltern Vor zwei Jahren ist meine Mutter gestorben - im Alter von 98 Jahren. Sie war eine beeindruckende Frau gewesen, eigensinnig und ein wenig despotisch, wie das bei wirklich starken Persönlichkeiten häufig vorkommt, aber auch liebenswert. Es gibt Menschen, die rasch in Vergessenheit geraten, wenn sie gegangen sind. Sie gehört nicht zu dieser Sorte Menschen. Denen, die sie kannten, wird sie lange in Erinnerung bleiben. Und niemand kannte sie so gut wie meine Schwester und ich. In den letzten Jahren hatte meine Mutter das Haus nicht mehr verlassen können. Gefangen in einer Welt von fünfzig Quadratmetern waren ihr nur noch wenige Dinge geblieben: ihre Energie, die sich nun erschöpfte in letzten großen, nicht mehr zu verwirklichenden Plänen, ihr unbändiger Wille, am Leben zu bleiben, und - ihre Erinnerung. Wenn ich sie besuchen kam, verlangte sie, daß ich mich zu ihr setze und ihr zuhöre, bis in die Nacht hinein. Sie war eine ausgezeichnete Erzählerin. Freilich ließen sich die vielen, vielen Stunden, die ich bei ihr saß, selbst mit einer so weitverzweigten Familie wie der unseren nicht ausfüllen. Die Geschichten wiederholten sich - fast wörtlich übrigens. Nun ist sie tot, das letzte der Schulze-Kinder, und auch die nächste, meine Generation schwindet dahin. Niemand kommt an gegen die Allmacht der Zeit. Seit sich vor ein paar Jahren mein Augenleiden verschlimmert hat, bin ich fast blind. Es fällt mir schwer, diese Zeilen zu schreiben. Wer aber soll es tun, wenn nicht ich? Ich fühle es - wenn ich jetzt nicht beginne mit dieser Arbeit, die ich schon so lange vor mir herschiebe, wenn ich mich jetzt nicht dazu aufraffe, dann wird niemand je etwas 3 erfahren von jenen Ereignissen. Sie werden verloren sein für immer. Die Lexika geben Auskunft, wer vom ersten der Weltkriege profitierte, wann und warum der Kaiser abdanken mußte, wer welche Wahl gewonnen hat, wie die Nazis an die Macht gekommen sind. Doch das alles sind tote Fakten, widerwillig auswendig gelernt durch Generationen von Schülern. Mein Buch ist kein Buch über die wenigen, welche die Politik bestimmten, sondern eines über die vielen, die ihr ausgeliefert waren und sich dennoch ihre Würde bewahrten, die keine Helden werden konnten und wollten, und die dennoch inmitten ihres Alltags so viel Heldenhaftes vollbrachten. Die Heimat der Schulzes war die heute knapp 35.000 Einwohner zählende Stadt Köthen. Sie liegt etwa in der Mitte zwischen Halle und Magdeburg und hat viel von ihrem einstigen Glanz verloren, obgleich sie auch heute noch eine Ingenieurschule beherbergt und ein Zentrum der metallverarbeitenden und chemischen Industrie ist. Die spätgotische Pfarrkirche St.Jacob mit ihren zwei durch eine Brücke miteinander verbundenen, schlanken Türmen, das stolze Renaissanceschloß, die barocke Agnuskirche mit ihrem wertvollen Flügelaltar und die klassizistische St.Marien-Kirche zeugen noch von den Jahrhunderten, in denen mächtige Adelsgeschlechter in ihren Mauern residierten, zuletzt - von 1603 bis 1847 - eine Linie der Fürsten von Anhalt. 1717 berief der kunstliebende Fürst Leopold keinen Geringeren als Johann Sebastian Bach zum Hofkapellmeister. 1856, als mein Großvater Wilhelm August Schulze geboren wurde, waren die Fürsten bereits verschwunden. In seiner Kindheit wurden die ersten Fabriken gebaut. Am Stadtrand 4 entstanden ausgedehnte Gärtnereien. Etliche Bewohner lebten aber auch noch von der Landwirtschaft. Eine besondere Schicht bildeten die Studenten, die - zumeist aus reichen Familien stammend - ihre Zeit weniger mit Lernen verbrachten als mit Zechgelagen oder mit den Sportarten der feinen Leute, dem Hockey vor allem. Inwieweit die großen politischen Umwälzungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts das Leben der Köthener beeinflußten und inwieweit sie Anteil nahmen daran, läßt sich heute nicht mehr genau sagen. Sicherlich war das von Familie zu Familie sehr unterschiedlich. Seine frühe Kindheit erlebte mein Großvater in den Jahren des Kampfes um die Ergebnisse der Revolution von 1848. Es war eine Zeit volle Widersprüche. 1864 wurde die "Erste Internationale" der jungen Arbeitervereinigungen gegründet. Ab 1866 einte Preußen mit Diplomatie und Waffengewalt die deutschen Länder zur Nation. 1870 brach der Krieg gegen Frankreich aus, an dessen Ende die Proklamation des "Zweiten Deutschen Kaiserreiches" stand. Was von alledem drang bis ins Bewußtsein meines Großvaters vor? Ein weites Feld für Spekulationen! Ich persönlich bin überzeugt davon, daß er das Geschehen in der Welt schon zeitig mit wachem Verstand verfolgte. Wie sonst ließe sich erklären, daß er später als erfolgreicher Bauunternehmer in erstaunlichem Maße Idealist blieb und typisch sozialdemokratischen Überzeugungen bis ans Lebensende die Treue hielt? Sicher ging die Zeit der Sozialistengesetze von 1878 nicht spurlos an ihm vorüber. Als junger Arbeiter wußte er aus eigenem Erleben, was es mit Schlagwörtern wie "Ausbeutung" und "Gerechter Lohn für alle" auf sich hatte. Doch ich will nicht zu viel vorwegnehmen sondern der Reihe nach berichten. Der kleine Wilhelm wuchs heran in der Gärtnerei, die seine Eltern besaßen. Das war ein Vorzug. Er hatte viel frische Luft und den freien Blick über die weite, 5 flache Felderlandschaft. Das muffige Hinderhofmilieu, in welchem die Arbeiterkinder in den jungen Industriestädten dahinkümmerten, blieb ihm erspart - eine wichtige Voraussetzung dafür, daß er sich zu einem aufrechten, selbstbewußten Menschen entwickeln konnte. Allerdings war die Familie nicht reich. Um den Betrieb am Leben zu erhalten, mußte jeder einzelne zupacken. Auch die Kinder blieben dabei nicht ausgespart. Als Erbe stand von Anfang an der älteste der Söhne fest. Wilhelm, der Nachgeborene, mußte sich anderswo nach einem Broterwerb umsehen und entschied sich für eine Maurerlehre. Er hatte sich inzwischen zu einem stattlichen Burschen entwickelt, war zwar nicht allzu groß aber breitschultrig und kräftig. Zu seinen dunklen, drahtigen Haaren hatte er helle, graublaue Augen - ein überraschender Kontrast, der später einer seiner Töchter großen Liebreiz verleihen sollte. Als Dreiundzwanzigjähriger lernte er die vier Jahre jüngere Auguste Luise Höhne kennen. Sie litt unter der Tyrannei eines gewalttätigen Vaters. Seit dem Tode ihrer Mutter hatte sie niemanden mehr, an den sie sich in ihrem Kummer anlehnen konnte. So war die schnell vereinbarte Heirat für sie geradezu eine Erlösung. Danach brach sie zu ihrem Vater alle Verbindungen ab. Wilhelm liebte seine junge Frau von ganzem Herzen, und es entsprach ganz seinem Charakter, für sie so etwas wie ein Beschützer zu sein. Da sie auffällig klein und zierlich war, kam das auch äußerlich zum Ausdruck. Eine wirklich romantische Verbindung, wie sie damals noch viel seltener vorkam als heute. Das hieß freilich nicht, daß Auguste sich verwöhnen ließ oder daß Wilhelm ihr dergleichen in Aussicht stellte. Die ersten Ehejahre waren eine Periode voller Mühe und Entbehrung. Zunächst fehlte es den beiden an so ziemlich allem, nicht zuletzt an einer eigenen Bleibe. Als sie sich für ein paar hundert Mark ein kleines Haus kaufen konnten, mußten sie die 6 Verpflichtung eingehen, die alte Frau, die darin wohnte, bis zu ihrem Tode zu pflegen. Bald kam das erste Kind zur Welt, ein Mädchen, das den Namen Minna erhielt. Franz, der erste Sohn, folgte im nächsten Jahr. Für vier Personen war der Teil des Hauses, den die Familie nutzen konnte, bereits zu klein. Da besann Wilhelm sich auf seine Kenntnisse aus dem Maurerberuf und baute an. Das konnte er selbstverständlich erst nach Feierabend tun, nach Sonnenuntergang zumeist, im Licht einer Stallaterne, die, an einen nahen Baum gehängt, die Baustelle mehr schlecht als recht erhellte. Auguste, die tagsüber und nicht selten auch noch in der Nacht die beiden Kleinkinder versorgte, übernahm die Handlangerdienste. Niemand, der die zerbrechlich zart erscheinende junge Frau sah, mochte glauben, welchen Belastungen sie standhielt. Ihre innere Energie und ihre Aufopferungsbereitschaft waren unglaublich. An einige ihrer Kinder gab sie diese Eigenschaften weiter. Es verging kaum ein Jahr, ohne daß bei den Schulzes ein neues Baby in der Wiege lag. Kinder hatten damals für die ärmeren Familien eine große Bedeutung. Sie mußten später zum Unterhalt beitragen, und sie waren die Altersversicherung für ihre Eltern. Vor allem die Geburt eines Sohnes galt als großer Segen, und auch in dieser Hinsicht konnten Wilhelm und Auguste sich über ihr Schicksal nicht beklagen. Nacheinander wurden Karl und Paul geboren. Nur einmal traf die Familie ein Unglück. Richard, der vierte der Söhne, starb, noch ehe er das erste Lebensjahr erreichte, an einer heimtückischen Krankheit. Ein wenig Unterstützung erhielt Auguste durch ihre Großmutter, die sich um Töchterchen Minna kümmerte und sich schließlich sogar bereit erklärte, sie bis zur Einschulung ganz zu sich in Pflege zu nehmen. Sie war mit ihren fünfundsechzig Jahren noch rüstig und freute sich darüber, auf diese Weise weiter nützlich sein zu können. 7 Minna muß sich wohl gefühlt haben bei ihrer Urgroßmutter. Immerhin war sie dort das einzige Kind und erhielt weitaus mehr Zuwendung als ihre drei Brüder. Nach Hause kam sie immer nur am Sonntag. Deshalb wunderte sich die Mutter, als die inzwischen Sechsjährige eines Morgens mitten in der Woche vor der Tür stand. Sie war ganz unruhig, spürte wohl, daß irgend etwas Schicksalhaftes sich ereignet hatte, freilich ohne es schon in seiner ganzen Bedeutung zu begreifen. "Die Großmutter will nicht aufstehen", berichtete sie. "Sie sagt auch nichts." Die Großmutter war tot - unbegreiflich für alle, denn nichts hatte zuvor darauf hingedeutet. Am meisten aber litt unter dem Unglück die kleine Minna, denn für sie änderte sich mit diesem Tag fast alles. Sie mußte zu ihren Eltern zurückkehren und erfuhr, was es damals bedeutete, das älteste Mädchen einer großen Familie zu sein. Mit jedem Jahr wurden ihr - zur Entlastung der Mutter - weitere der traditionellen Frauenpflichten übertragen. Von Auguste, die nichts anderes kannte, als buchstäblich bis zum Umfallen zu arbeiten, konnte sie in dieser Hinsicht kaum Mitleid erhoffen. Minna entwickelte sich zu einer umsichtigen kleinen Hausfrau. Vor allem die Betreuung der jüngeren Geschwister, von denen immer noch mehr zur Welt kamen, war ihre Aufgabe. Sie hatte Talent dafür, fand fast immer das richtige Maß zwischen Strenge und Zärtlichkeit. Sie war geduldig, murrte nie. Auf den ersten Blick also schien sie ganz nach der Mutter geraten zu sein. In ihrem Innern indes sah es ganz anders aus. Wenn sie einmal Gelegenheit hatte, für einen Moment zu verweilen, dann ließ sie den Blick schweifen über die schier endlosen Felder und Gärten, hinter denen irgendwo große Städte voller Abenteuer und Kurzweil lagen. Das Herz wurde ihr schwer vor Sehnsucht. Sie stellte sich vor, daß sie das alles vielleicht nie sehen würde, daß ihr vorbestimmt war, im Altenteil ihrer Kinder zu enden, von der Arbeit krumm und kurzsichtig, ohne 8 zuvor wenigstens ein einziges Mal wirklich frei gelebt zu haben. Wenige Monate nach ihrem vierzehnten Geburtstag hielt sie das Fernweh nicht mehr aus, und sie bedrängte ihre Mutter so lange, bis diese ihr erlaubte, in Magdeburg eine Anstellung als Hausmädchen anzunehmen. Allerdings tat auch Wilhelm sehr viel mehr, als von ihm verlangt wurde. Sobald er eine freie Minute fand, las er Bücher, um sich ohne Unterricht bautheoretische Kenntnisse anzueignen. Er beschäftigte sich mit Statik, mit Materialkunde, mit besonderen Techniken des Mauerns. So lernte er in mühevollem Selbststudium nach und nach die Kunst, Baupläne nach eigenen Ideen selbst zu entwerfen, einschließlich aller dazu notwendigen Berechnungen. Er hing einem Traum nach, den er zwar zunächst noch nicht verwirklichen konnte, den er aber fest im Auge behielt. Durch den Tod seines Vaters ergab sich dann überraschend die große Chance. Der ältere Bruder übernahm die Gärtnerei und Wilhelm ließ sich das ihm zustehende "kleine Erbteil" auszahlen. Mit diesem Startkapital wagte er den Schritt in die Selbständigkeit. Wilhelm war nun also ein Unternehmer geworden. Er stellte Arbeiter ein, gab ihnen Anweisungen, plante. Aber er vergaß dabei nie, daß er als kleiner Maurer begonnen hatte, im Gegenteil. Er war mehr den je ein überzeugter Sozialdemokrat. Gerade in jenen Jahren hatte die Bewegung die Fesseln der Sozialistengesetze abgeschüttelt und erlebte eine stürmische Entwicklung. Die 1890 gegründete SPD brachte Ideen in die Gesellschaft ein, die wenige Jahrzehnte zuvor noch ungeheuerlich erschienen wären. Wilhelm, der träumende Realist, wollte nicht allein den persönlichen Erfolg. Er wollte ein Beispiel schaffen, wollte beweisen, daß es Frieden geben kann zwischen Unternehmern und Arbeitern, wenn einer die Bedürfnisse des anderen achtet. Was ist geworden aus seinen Visionen? Reichtum ließ sich nicht anhäufen mit einer solchen Grundeinstellung. Immerhin aber konnte er sich wie kaum ein anderer Unternehmer auf 9 seine Arbeiter verlassen. Fast alle von ihnen hielten zu ihm, was auch geschah. Und ein Vermächtnis blieb erhalten bis heute - seine Häuser, solide, mehrgeschossige Bauten aus roten und gelben Klinkersteinen. Wenn ich mit meiner Mutter durch die Schützenstraße oder die Antoinettenstraße ging, dann versäumte sie niemals, sie mir zu zeigen. Voller Stolz sagte sie dann: "Sieh, das hat dein Großvater gebaut." Nach dem Tod der Eltern bestand für Wilhelm die Möglichkeit, mit der Familie in sein Geburtshaus zurückzuziehen, denn der Bruder hatte sich in unmittelbarer Nachbarschaft in einem Neubau eingerichtet. Das Angebot war verlockend. Auguste konnte für einen geringen Lohn in der Gärtnerei ihres Schwagers arbeiten und gleichzeitig den Haushalt versorgen. Es mußte keine Miete bezahlt werden. Auch Gemüse sollte umsonst sein. So ließ sich Wilhelm schließlich darauf ein. Zur Familie gehörten mittlerweile sieben Personen. Minna, die zu dieser Zeit noch im Hause lebte, war zehn Jahre alt, Franz, der älteste der Söhne, neun. Karl und Paul sollten im nächsten und übernächsten Jahr eingeschult werden. Die kleine, noch im alten Haus geborene Emma lernte gerade laufen, während das nächste Kind bereits unterwegs war - ein weiteres Mädchen, das den Namen Martha erhielt. Von den schon erwähnten, mit dem Umzug verbundenen kleinen Vorteilen abgesehen, änderte sich für die Familie in den nächsten Jahren wenig, obwohl Wilhelm immer größere und prächtigere Projekte übernahm und erfolgreich ausführte. Wurde für ein neues Haus nicht rasch ein Käufer gefunden, fraßen die Lohnkosten für die Arbeiter und die Zinsen der Bankkredite den knapp kalkulierten Gewinn beinahe 10 vollständig auf. Die Kinder des Unternehmers mußten für ihren Onkel Stachelbeeren pflücken, Petersilie zu Sträußen flechten, Mohrrüben binden und vieles andere mehr tun. Sonst hätte das Geld zum Leben nicht gereicht. Auch das Schicksal überschattete die ersten Erfolge einige Male. Karl erkrankte an Diphtherie. Das bedeutete beim damaligen Stand der Medizin einen Kampf am Rande des Todes, zumal wenn ein Kind betroffen war. Buchstäblich binnen weniger Stunden schwoll der Hals so sehr an, daß er die Luftröhre zudrückte. Der Junge drohte zu ersticken. Ein Arzt rettete ihn in letzter Minute vor einem schrecklichen Tod, indem er ihm eine Silberröhre einsetzte. Noch bösartiger traf es das vierte Töchterchen. Es hieß Agnes und litt von Geburt an unter Krämpfen. Die Anfälle ereigneten sich unregelmäßig Tag und Nacht, und bei jedem von ihnen hatte es den Anschein, als würde das Baby ihn nicht überstehen. Das Gesicht verfärbte sich, die Händchen ballten sich zu Fäusten. Das allerschlimmste für die Angehörigen jedoch war die völlige Hilflosigkeit diesem Leid gegenüber. Es gab kein einziges Medikament, das wirklich etwas taugte. Was die Ärzte rieten, diente allenfalls dazu, ein wenig trügerische Hoffnung zu wecken, das Gefühl, nicht tatenlos zuzusehen. Die Last der nahezu pausenlosen Krankenpflege lag vor allem auf den Schultern der inzwischen dreizehnjährigen Minna. Es war dies ihre letzte stille Heldentat für die Familie. Wenige Monate nachdem das Geschwisterchen trotz aller Opfer gestorben war, ging sie nach Magdeburg. Mit Tochter Liese, die später meine Mutter werden sollte, kam wieder ein gesundes Kind zur Welt. Doch nicht einmal dieses eigentlich so glückliche Ereignis blieb gänzlich frei von Kümmernissen. Kaum nämlich waren Auguste und das Neugeborene außer Gefahr, da geschah etwas ganz Eigenartiges. Emma, die Sechsjährige, die niemals Schwierigkeiten bereitet hatte und bald zur Schule gehen sollte, sie begann plötzlich unter Lähmungen in den Beinen zu leiden. 11 Sie konnte nicht mehr laufen, mußte selbst auf kurzen Wegen getragen werden. Nach den tragischen Erfahrungen mit Agnes versetzte das die gesamte Familie in helle Aufregung. Diesmal jedoch wußte der alte, treue Hausarzt Rat. Instinktiv erriet er die Ursache. Emma litt nicht am Körper sondern an der Seele. Immer wieder mußte sie aus irgendwelchen Gründen einem Geschwisterkind gegenüber zurückstehen, nun schon zum dritten Mal. Seit zwei Jahren ging das nun so. Sie war mit ihrer Geduld einfach am Ende und versuchte unbewußt, sich ihr Recht auf Zuwendung durch Nachahmung der toten Schwester zu erzwingen. Der Arzt riet, die Kleine nicht länger am Rand stehen zu lassen, sondern sie gewissermaßen auszusöhnen mit Liese, dem neuen Familienmitglied, und ihr mehr Beachtung zu schenken. Diesen Rat befolgten dann auch alle - neben den Eltern gleichermaßen die älteren Geschwister - und tatsächlich verschwand die Lähmung bald, ohne sich je im Leben zu wiederholen. Drei Jahre vergingen. Deutschland befand sich mitten in einer Ära, die von den Geschichtsschreibern heute die "Wilhelminische" genannt wird - nach jenem Kaiser, auf dessen Namensvetternschaft mein Großvater mit Sicherheit alles andere als stolz war. Das Land trieb langsam aber stetig einem Krieg entgegen, wie es ihn auf der Welt zuvor noch nicht gegeben hatte. Dieser Krieg sollte auch die sozialdemokratische Bewegung in eine neue, ernste Zerreißprobe stürzen. Doch all diese Gefahren lauerten im Verborgenen, kaum wahrnehmbar für die Menschen, die sich nach einem harten Arbeitstag nicht mehr mit politischen Spitzfindigkeiten beschäftigen mochten. Vermutlich erkannte auch Wilhelm, der sich zeitlebens den Luxus einer Zeitung leistete, die Zeichen der Zeit damals noch nicht. Es gab zu viel Alltag in der Familie. Auguste hatte gerade das vorletzte der Schulzekinder geboren - Max, einen Jungen also nach einer Serie von vier Mädchen. Karl, Paul und Emma besuchten inzwischen die Schule. Bei Martha stand die 12 Einschulung unmittelbar bevor. In die Schule gehen zu dürfen, empfanden fast alle Kinder als Privileg, obwohl sie keine Ahnung davon hatten, wie wenig selbstverständlich das noch wenige Jahrzehnte zuvor gewesen war. Diejenigen, die noch zu Hause bleiben mußten, fühlten sich ganz einfach zurückgesetzt gegenüber denen, die frühmorgens fortgingen und "draußen" alle möglichen Abenteuer erlebten, von denen sie am Nachmittag wichtigtuerisch berichteten. Als für Martha das herbeigesehnte Ereignis endlich nahte, konnte sie kaum schlafen. Es gab ja so viel Aufregendes in diesen Tagen! Ein neues Kleid lag bereit für sie. Sogar eine Zuckertüte sollte sie bekommen - gefüllt mit duftenden Semmeln und einem bunten Ball als Krönung. Am nächsten Morgen aber, als die ganze Familie im Sonntagsstaat zum Aufbruch bereitstand, da war sie verschwunden. Alle riefen nach ihr, suchten die ganze Umgebung ab - umsonst. Schließlich glaubte man, sie habe sich vor Angst, wie Kinder sie manchmal aus für Erwachsene unerklärlichen Gründen empfinden, irgendwo versteckt. Um sie wenigstens der Ordnung gemäß anzumelden, ging Auguste allein bei der Schule vorbei. Dort erlebte sie eine Überraschung. Ihr Töchterchen saß schon längst an ihrem Platz in dem noch leeren Klassenzimmer. Sie hatte den großen Augenblick nicht erwarten können. Martha blieb ihr gesamtes, kurzes Leben lang ein ganz besonderer Mensch - bei den schönen und großartigen Dingen ebenso wie bei den traurigen. Aber davon wird später noch die Rede sein. Franz war zu einem stattlichen und selbstbewußten jungen Mann herangewachsen. Nach dem erfolgreichen Abschluß einer Buchbinderlehre arbeitete er in Dessau. Dort lernte er die hübsche Hertha kennen, die sich in den attraktiven Burschen auf Anhieb verliebte. Wenn sie auf Besuch kam, brachte sie Spielzeug und Süßigkeiten für die Kleinen mit und bemühte sich auch eifrig um die Gunst der Eltern. Als sie dann aber zur Heirat zu drängen versuchte, mußte sie feststellen, daß ihre 13 Hoffnungen auf Sand gebaut waren. Franz, der noch große Pläne hatte, wollte seine Freiheit so schnell nicht einbüßen. Er nahm Hals über Kopf eine neue Stellung in Magdeburg an und stahl sich gleichsam aus Herthas Leben. Liese und Max, die beiden Jüngsten, wurden jeden Tag frühmorgens eingeschlossen, wenn Auguste die Wohnung verließ. Dann lagen vor ihnen mehrere furchtbar langweilige Stunden, bis am Nachmittag die Geschwister aus der Schule zurückkehrten und sie mitnahmen zur Arbeit in die Gärtnerei. Einmal nun ereignete sich in dieser Zeit wider erwarten doch etwas - etwas, das aufregender war, als es den beiden lieb sein konnte. Wie immer hatte ihre Mutter die Tür abgesperrt und dann den Schlüssel - den einzigen, den es gab - im Hausflur unter den stets vollen Wassereimer gelegt. Wie immer gruselten sich die Kinder ein wenig angesichts der ungewohnten Stille um sie herum. Wie immer vertrieben sie sich die Zeit mit ein paar Spielen. Da plötzlich klopfte jemand kräftig an die Tür. "Emma, bist du es?" fragte Liese. "Ja", kam als Antwort. Doch das konnte nicht sein, denn das war eine Männerstimme. "Ich kann nicht aufmachen." "Mach auf und sag mir, wo dein Vater seinen Geldschrank hat!" "Ich weiß nicht, wo der Geldschrank ist." "Mach auf, oder ich komme mit Gewalt rein!" Zum Glück wußte er nicht, daß nicht einmal einen Meter von ihm entfernt der Schlüssel bereit lag. Eine Beruhigung aber war das nicht. Liese nahm ihren Bruder an die Hand und verkroch sich mit ihm hinter einem Schrank. Gerade als der Fremde die Tür einschlagen wollte, wurde er gestört und flüchtete. Am Abend werteten die Eltern gemeinsam mit den Kindern den Vorfall aus. Dabei stellte sich heraus, daß Emma dem Einbrecher ahnungslos auf der Straße nahe dem Gartentor noch begegnet sein mußte. Sie konnte ihn ziemlich genau 14 beschreiben, und dem Vater kam daraufhin ein Verdacht. Er hatte geschäftlich hin und wieder mit einem Kaufmann zu tun, dessen Laden sich ganz in der Nähe befand, und der nebenher Aufträge vermittelte. Dort verkehrte seit einiger Zeit ein ziemlich zwielichtiger Kerl, auf den die Beschreibung genau paßte. Noch am selben Abend suchte Wilhelm zusammen mit seiner Tochter den Kaufmann auf. Emma erkannte den Fremden auf Anhieb wieder. Im Hinterzimmer des Kaufmannsladens gestand er schon bald. Die Polizei freilich erfuhr von dem Zwischenfall nie etwas. Wilhelm gab sich zufrieden mit dem Versprechen, der Überführte werde künftig ein ehrbares Leben führen. 15 2. Kapitel Margarete erzählt Eigentlich hätte ich meinen Bericht erst hier beginnen dürfen, denn in diese Jahre reichen die frühesten Erinnerungen meiner Mutter zurück. Was sich davor abspielte, wußte auch sie nur aus Erzählungen. Manchmal fällt es mir ein wenig schwer, sie mir als die kleine Liese von damals vorzustellen. In einigen Situationen freilich erkenne ich sie wieder. Da offenbarte sie bereits die später für sie so typischen Charakterzüge. Abenteuerlustig und ängstlich zugleich war sie, ungemein fleißig, aber nicht leicht zu lenken, vor allem voller Diesseitigkeit und Lebenslust. Ich staune, mit welcher Klarheit sich meine Mutter noch mit über neunzig Jahren an ihre Kindheit und Jugend erinnerte. Über viele Episoden wußte sie noch die geringsten Einzelheiten. Sie erzählte dabei keinesfalls nur über sich selbst. Die Schulzegeschwister lebten so eng beieinander, daß sie voneinander selbst die verborgensten Sehnsüchte und Ängste kannten. Ein Geheimnis ließ sich nur über kurze Zeit bewahren. So glaube ich ganz sicher, daß meine Mutter - von ein paar kleinen, verständlichen Färbungen abgesehen - ein guter Gewährsmann ist für die gesamte Schulzefamilie. Liese erzählt Kurz vor der Jahrhundertwende heiratete meine älteste Cousine. Mein Onkel wollte nun unser Haus gern für sie und ihre künftige Familie haben. Er kündigte uns zwar nicht einfach so den Mietvertrag, doch wäre es gewiß nicht sehr klug gewesen, hätten wir uns lange gesträubt. Als Vater für eines 16 seiner neu gebauten Häuser keinen Mieter fand, zog er kurz entschlossen mit uns dort ein. Ich war damals gerade fünf Jahre alt. Vielleicht lag es daran, daß mir das Haus zunächst riesengroß erschien. Es hatte allein im Hochparterre vier Zimmer. Eine kleinere Wohnung im Obergeschoß brauchten wir gar nicht und konnten sie vermieten. Das Anwesen umfaßte zudem noch einen ausgedehnten Hof mit Stallungen und einen Garten mit Gemüsebeeten sowie allerlei Bäumen und Sträuchern. Ich lief staunend umher und mochte lange nicht glauben, daß dies nun wirklich unser Zuhause werden sollte. Das Haus lag nicht direkt in Köthen, sondern in Geuz, einem Vorort, von dem aus man zu Fuß etwa vierzig Minuten bis zum Marktplatz brauchte. Er wurde seinerzeit von Bauernhöfen und Gärtnereien geprägt. Aber auch einige Pensionäre hatten sich hier - wohl der ruhigen Lage wegen - niedergelassen und mit ihren kleinen, schmucken Villen den Charakter ein wenig veredelt. In den Quergassen wohnten die Landarbeiter. Die zumeist zahlreichen Kinder halfen auf den Feldern der Großbauern beim Rübenverziehen, Steineauflesen und Kartoffelnernten. Auch eine Schmiede gab es. Eine besonders wichtige Einrichtung schließlich war die Freiwillige Feuerwehr. Das mit viel Holz gebaute Geuz hatte schon mehrere verheerende Großbrände erlebt. Zwei künstliche Teiche sollten die Gefahren mindern. Die Teiche erfüllten allerdings auch noch manch anderen Dienst. Die Pferde erfrischten sich in dem einen. Den anderen nutzten die Knechte, um sich zu waschen. An der Dorflinde am Anger traf sich wie seit hunderten von Jahren abends die Jugend. Freilich brachte der Umzug nicht nur Gutes für uns. Emma und Martha, die weiterhin nach Köthen in die Schule gingen, hatten nun einen ziemlich weiten Weg zu laufen. Auch Vater kam nicht mehr so einfach zu seinen zumeist im Stadtinnern gelegenen Baustellen. Um immer rechtzeitig an Ort und Stelle zu sein, kaufte er sich ein Fahrrad, was damals bereits Luxus 17 war. Zum Mittagessen kam er immer nach Hause, und damit er nicht unnütz Zeit verliert, mußte auf die Minute genau zwölf Uhr das warme Essen auf dem Tisch stehen. Ich kann mich übrigens nicht an einen einzigen Fall erinnern, wo Mutter das nicht schaffte. Aber wir konnten uns dennoch nicht beklagen. Unsere Eltern genossen an den Abenden die Ruhe des kleinen Ortes. Die Brüder beobachteten den Schmied in seiner Werkstatt direkt gegenüber. Wenn der Lehrjunge mit seinem Blasebalg das Feuer anfachte, stiebten Funken in die Luft, und das gab dem Haus etwas Gespenstisches, Abenteuerliches. Wir Mädchen fanden rasch neue Freundinnen. Vater versuchte, uns Kindern die Umstellung dadurch zu versüßen, daß er ab und an ein Tier zum Spielen mitbrachte - einmal einen Raben, der im ganzen Haus herumspazieren durfte und sogar ein paar Worte sprach, ein andermal eine Ziege, die einen kleinen Wagen zog. Andere Tiere wurden als Nutzvieh gehalten - Hühner vor allem, auch ein Schwein. Hier in Geuz kam ein Jahr später das jüngste der Schulzekinder zur Welt - Hedwig, unser Nesthäkchen. Wir alle hatten sie von Anfang an sehr lieb, vielleicht weil sie uns wie ein Glücksbringer im neuen Heim erschien. Wir nannten sie zärtlich "Hedchen", und es galt beinahe mehr als Vorzug denn als Arbeit, sie zu betreuen. Aber das Glück dauerte gerade sechs Wochen an. Dann brach unvermittelt ein Schicksalsschlag über die Familie herein, und das kam folgendermaßen. Sobald Vater einen Rohbau fertiggestellt hatte, übernahm Mutter gemeinsam mit den älteren Mädchen die Grobreinigung. Dabei riß sie sich eines bösen Tages einen Splitter in den Finger. Sie nahm das zunächst nicht besonders ernst, zog den Splitter heraus und arbeitete weiter. Am nächsten Tag jedoch begann sich eine Entzündung zu entwickeln. Die wurde mit Hausmitteln behandelt, bis sich unter der Haut ein roter Streifen abzeichnete, und die Schmerzen sich ins Unerträgliche 18 steigerten. Nun endlich bestellte Vater einen Arzt. Der diagnostizierte eine Blutvergiftung und wies Mutter in die Universitätsklinik von Halle ein. Im Krankenhaus begann ein Wettlauf mit dem Tode. Die Ärzte kämpften aufopferungsvoll um ihr Leben, nicht zuletzt weil sie wußten, daß es neun Kindern die Mutter zu erhalten galt. Am Ende wurde sie mit knapper Not gerettet, mußte aber mehrere Operationen über sich ergehen lassen und konnte erst nach fast einem Jahr entlassen werden. Vielleicht zeigte sich in diesen Monaten so wie nie zuvor und nie wieder danach, wie sehr meine Eltern einander liebten. Damit Mutter eine bessere Versorgung bekam und nicht in einem der großen Säle zu liegen brauchte, ließ Vater sie in die erste Klasse verlegen, und das obgleich die Versicherung nur einen lächerlich geringen Teil der Kosten übernahm. Jeden Sonntag fuhr er sie besuchen und nahm dabei jedesmal zwei von uns Kindern mit. Zu Hause vermißten wir die Mutter sehr. Gewiß, wir versuchten, uns irgendwie zu behelfen, denn niemand von uns ist verwöhnt worden. Doch wir schafften es einfach nicht. Vater hatte mehr als genug mit seinen Baustellen zu tun und konnte sich um den Haushalt nicht kümmern. Die älteren Geschwister waren außer Haus. Franz und Minna lebten in Magdeburg und konnten von dort so schnell nicht weg. Karl hatte drei Jahre lang das Maurerhandwerk gelernt und war, wie damals üblich, auf Wanderschaft gezogen. Der zwölfjährigen, jäh in die Rolle der Hausfrau gestoßenen Emma aber wuchs die Arbeit hoffnungslos über den Kopf. Unsere ganze Hoffnung ruhte auf Karl, von dem jedoch zunächst niemand aus der Familie so recht wußte, wo er sich gerade aufhielt. Zum Glück bat er in einem Brief um frische Wäsche, so daß er informiert und zurückgerufen werden konnte. Das war natürlich eine gewaltige Umstellung für ihn, statt mit Maurerkelle und Wasserwaage nun mit Waschzubern und Kochtöpfen, mit Hedchens Flasche und mit unseren 19 löchrigen Kleidern hantieren zu müssen. Doch schon bald bewies er ein ganz erstaunliches Talent für die Pflichten einer Mutter. Wenn ich an Karl zurückdenke, erinnert er mich immer ein wenig an Vater. Er war nicht allzu groß aber schon damals ziemlich kräftig und breitschultrig. Allerdings hatte ich niemals Angst vor ihm. Es gibt nicht allzu viele Männer, die so verständnisvoll und sanft sind, wie er es war. Sogar das kleine Hedchen fühlte sich bei ihm so geborgen wie sonst nur bei der Mutter. Gelang ihm einmal etwas nicht so ganz nach Wunsch, trug er es mit Geduld und Humor. Wenn zum Beispiel Emma und Martha über das Mittagessen maulten, weil es ihnen mißraten schien, dann fragte er mich: "Na, Lieschen, schmeckt es dir? Willst du noch mehr haben?" und ich antwortete strahlend: "Oh ja!" Das war kein großes Wagnis für ihn. Ich hatte immer Hunger und aß so ziemlich alles. Durch ihn ging der Alltag für uns fast in der gewohnten Weise weiter. Als ich in die Schule kam, kaufte er mir ein schmuckes neues Kleid und neue Schuhe, so daß ich meinen Klassenkameraden nicht nachstand. Minna arbeitete zu dieser Zeit noch immer als Hausmädchen in Magdeburg und war gewiß nicht unzufrieden darüber, daß ihr Bruder für sie einsprang, als die Mutter ersetzt werden mußte. Sie hatte sich inzwischen zu einer ansehnlichen jungen Frau gemausert. Wie die Mutter war sie recht klein. Den Schönheitsnachteil, dabei nicht so zierlich zu sein wie diese, glichen ihre blonden, schulzeuntypischen Haare wieder aus. Auf jeden Fall gewann sie durch ihr offenes, fröhliches Wesen. Nach der Arbeit und vor allem am Sonntag genoß sie die Möglichkeiten der großen Stadt. Irgendwo gab es immer einen Saal, wo eine Kapelle zum Tanzen aufspielte, und sie 20 bedauerte, daß sie nicht alle Veranstaltungen gleichzeitig besuchen konnte. Das war es, wonach sie sich in Köthen vor Sehnsucht verzehrt hatte. Eine innere Unruhe trieb sie umher. Sie glich einem Ausgehungerten, der plötzlich vor einem reich gedeckten Tisch steht und unbeherrscht alles in sich hineinschlingt, was er zu fassen bekommt. Mit der Familie blieb Minna durch gelegentliche Briefe und -mehr noch - durch regelmäßige Besuche verbunden. Die älteren Geschwister mochten sie gern. Emma und Martha waren als Babys von ihr betreut worden und erinnerten sich noch immer mit einer gewissen Dankbarkeit daran. Mir blieb sie ein wenig fremd. Ich kannte sie zu wenig, und was sie erzählte, das verstand ich damals noch nicht. Eines Tages lag ein merkwürdiger Brief im Kasten. Darin bestellte Minnas Arbeitgeber den Vater nach Magdeburg. Was hatte das zu bedeuten? Minna war ehrlich und zuverlässig, dabei stets kerngesund und selbständig. Es hatte nie Anlaß gegeben, sich um sie zu sorgen. Was also war geschehen? Vater brach sofort auf und erfuhr, daß es seiner Tochter seit einiger Zeit aus unerfindlichen Gründen nicht mehr gut ging. Sie hustete ständig und wurde immer blasser. Zwar behauptete sie selbst, mit ihr sei alles in Ordnung. Sie erledige ihre Arbeit wie eh und je und sei nur vorübergehend ein wenig leidend. Es bestehe auch überhaupt kein Grund, zum Arzt zu gehen. Vater jedoch glaubte ihr nicht, kündigte den Arbeitsvertrag für sie und nahm sie sofort mit nach Köthen. Leider verbesserte sich ihr Zustand zu Hause nicht. Im Gegenteil. Kaum eine Woche später war sie zu schwach, um ohne Hilfe das Bett zu verlassen. Bei jedem Atemzug quälte sie ein Brennen in der Brust. Der Hausarzt ließ sie sofort ins Krankenhaus einliefern. Doch selbst dort konnte man nur feststellen, daß alle Hilfe zu spät kam. Der linke Lungenflügel war bereits vollständig zerstört, der rechte stark angegriffen. Vier Wochen lang kämpften die Ärzte noch gegen die 21 Krankheit, dann starb Minna im Alter von gerade dreiundzwanzig Jahren. Im Nachhinein wurden viele Vermutungen angestellt darüber, wie es zu dieser Tragödie hatte kommen können. Der Hausarzt meinte, daß sie vielleicht einmal bei einer Tanzveranstaltung erhitzt ins Freie gelaufen war und sich dabei erkältet hatte. Wird eine schwere Erkältung verschleppt, kann sie sich leicht zur Lungenentzündung entwickeln. Möglicher Weise war sie aber auch, ohne es zu wissen, an einer der bösartigsten Volksseuchen jener Zeit, der Tuberkulose, erkrankt. Endlich kehrte Mutter zurück. Das Unglück jedoch hatte seine Spuren bei ihr hinterlassen. Ihre bei den Operationen mehrfach zerschnittene Hand konnte sie kaum noch benutzen. Sie brauchte Hilfe bei den täglichen Verrichtungen im Haus. Karl stand dafür nicht mehr zur Verfügung. Schon während Mutters Krankenhausaufenthalt hatte sich das Militär wiederholt bei ihm gemeldet. Jetzt gab es endgültig kein Argument mehr, ihn zurückstellen zu lassen, und so blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Dienstzeit bei der Truppe abzuleisten. Die zusätzliche Arbeit mußte unter die noch zu Hause lebenden Kinder aufgeteilt werden. Vor allem für Emma, Martha und mich brachte das eine gehörige Umstellung mit sich. Bevor wir zur Schule gingen, halfen wir der Mutter beim Anziehen und beim Aufstecken der Haare. Außerdem war ein großer Eimer Kartoffeln zu schälen. Am Nachmittag gab es andere Aufgaben. Wenn große Wäsche anstand, fielen sogar die freien Stunden am Sonntag weg. Von Paul war inzwischen Lehrling bei einem Fleischer. Wir wußten wenig von ihm, was vor allem daran lag, daß er bei 22 seinem Meister ständig wohnte und nur am Sonntag für ein paar Stunden zu seiner Familie auf Besuch gehen durfte. War er bei uns, dann redete er nicht viel. Ein bißchen sonderbar finde ich es jetzt im nachhinein aber dennoch, daß wir ihn so sehr aus den Augen verloren, denn die Metzgerei, in der er immerhin zwei Jahre lang arbeitete und wohnte, befand sich nicht im fernen Ausland sondern nur vierzig Wegminuten entfernt in Köthen. Warum war es nie jemandem eingefallen, ihn zu fragen, ob er Kummer hat, wenn er auch von sich aus nichts davon erzählte? Vor allem unsere Eltern machten sich später bittere Vorhaltungen für diese Oberflächlichkeit. Ich möchte sie jedoch ein wenig in Schutz nehmen. Sie hatten mit ihrer großen Familie Sorgen in Hülle und Fülle. Wie wir alle dachten sie immer vor allem an das Nächstliegende. Es waren letztlich die rauhen Zeiten, die einen stillen Jungen, der glaubte, mit seinen Schwierigkeiten ganz allein fertig werden zu müssen, in Vergessenheit geraten ließen. Eines Sonntags verhielt Paul sich anders als sonst. Bevor er um die Ecke bog, drehte er sich noch einmal um und winkte seiner Mutter lange zu. Die wunderte sich und sagte sofort zu mir: "Liese! Paul scheint das Weggehen heute besonders schwer zu fallen. Schnell, lauf ihm nach und begleite ihn noch ein Stück!" Das tat ich dann auch. Montagabend aber kam der Fleischermeister und fragte erbost, wo sein Lehrjunge bleibe. Paul war verschwunden. Ein paar Tage lang hofften wir noch, er werde ganz von selbst wieder zurückkommen, jedoch er blieb verschwunden. Erst neun Jahre später unter merkwürdigen Umständen sollten wir wieder etwas von ihm erfahren. Obwohl es dafür im Grunde zu spät war, versuchte Vater herauszufinden, was meinen Bruder zu dieser Flucht getrieben hatte. Er erkundigte sich bei den Nachbarn des Metzgers und 23 erfuhr, daß der Junge von frühmorgens um drei Uhr an bis zum späten Abend fast ohne Pausen hatte arbeiten müssen. Bei der kleinsten Nachlässigkeit war er mit Schlägen traktiert worden. Vater dachte kurz darüber nach, ob er gegen den Meister etwas unternehmen sollte. Er ließ es aber schließlich bleiben. Wem nutzte es noch? Vielleicht dachten unsere Eltern im Stillen an Paul bei einem Erlebnis, das sie einige Zeit später hatten. Auf unserem Hof stand eine Schüssel mit Futter für die Hühner. Damit keine Ratten herbeigelockt wurden, deckten wir diese Schüssel jeden Abend sorgfältig ab. Eines Morgens aber war das Futter dennoch verschwunden. Wir dachten uns: ‘Wahrscheinlich haben wir das Auffüllen vergessen’. Indes, am nächsten Tage geschah genau das selbe. Die Schüssel war noch immer abgedeckt doch ganz und gar leer. Wie konnte so etwas geschehen? Am vierten Tag legte Mutter sich nach Einbruch der Dunkelheit auf die Lauer. Sie rechnete mit einem besonders geschickten Tier. Plötzlich aber bemerkte sie auf dem Hof eine menschliche Gestalt. Erschrocken wollte sie schon davonlaufen und Hilfe holen, da sah sie, daß es sich bei dem vermeintlichen Einbrecher um ein Kind handelte. Sie trat nun hervor aus ihrem Versteck und gab sich zu erkennen. Da erschrak sie ein zweites mal. Vor ihr stand der zwölfjährige Nachbarsjunge und zwar in einem wirklich erbarmungswürdigen Zustand. Er wimmerte und war völlig verstört. Mutter nahm ihn mit hinauf in die Wohnung. Weil er sich seit Tagen nicht mehr gewaschen hatte, steckte sie ihn erst einmal in einen Zuber mit Wasser. Dabei fand sie etliche Spuren schwerer Mißhandlungen an ihm. Dann gab sie ihm etwas zum Essen. Während sie ihn durch behutsame Zuwendungen allmählich beruhigte, wurde er nach und nach aufgeschlossener. Er fühlte, daß da ein Mensch war, dem er vertrauen konnte. Schließlich begann er zögernd, auf Mutters Fragen zu antworten. Dabei stellte sich dann das ganze 24 Ausmaß dessen heraus, was er in den vergangenen Jahren erlitten hatte. Es muß die Hölle auf Erden gewesen sein. Die Nachbarin gehörte zu den eigenartigsten Menschen des Ortes. Sie lebte völlig zurückgezogen und niemand wollte etwas mit ihr zu schaffen haben. Das ging so weit, daß sich auch niemand darum kümmerte, wenn sie die alte, behinderte Frau, die in der Dachkammer ihres Hauses wohnte, anschrie und sogar ganz offen bedrohte. Erst recht sahen die Leute weg, wenn sie ihr Kind schlug. Aus Feigheit wollten sie sich lieber nicht einmischen und taten so, als wüßten sie von nichts. Auch unsere Eltern redeten lange miteinander darüber, was sie tun konnten, um dem Jungen wirklich zu helfen. Einfach behalten konnten sie ihn ja nicht. Am nächsten Morgen aber packte meinen Vater plötzlich die Wut. Er brachte das Kind persönlich ins Nachbarhaus und verprügelte die Frau kurzerhand. "Wenn Sie ihn noch einmal mißhandeln, möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken", drohte er am Schluß. "Und glauben Sie nicht, daß ich nicht merke, was bei Ihnen vorgeht!" Dieser Auftritt des kräftigen Bauunternehmers beeindruckte sie denn doch gehörig, und sie beherrschte sich von da an. Wenn Franz zu Besuch kam, war das immer ein besonderes Ereignis. Ihm haftete ein Stück der großen, weiten Welt an, und wenn er erzählte, hörten wir alle staunend zu. Zweifellos hätte ich damals vor dem König in leibhaftiger Person kaum mehr Ehrfurcht empfinden können als vor meinem eigenen großen Bruder. Er war immerhin ein richtiger Herr geworden. Größer noch als Vater, stattlich, mit einer kleinen Tendenz zur Beleibtheit sehe ich ihn noch ganz deutlich vor mir. Er trug stets einen tadellos sauberen schwarzen Anzug und weiße Manschetten. Sogar den heimatlichen Dialekt hatte er weitestgehend abgelegt. Aber nicht nur für uns Kinder sondern auch für Mutter war er der Stolz der Familie. Sobald er die Schwelle des Hauses überschritt, drehte das ganze Leben sich nur noch um ihn. Beim Essen bekam er die besten Bissen, und 25 es wäre gewissermaßen ein Sakrileg gewesen, sie ihm nicht zu gönnen. Chancen bei Frauen hatte Franz nun natürlich mehr denn je. Es war nur eine Frage der Zeit gewesen, bis er unseren Eltern eine neue feste Freundin vorstellen konnte. Sie hieß Charlotte und lebte seit dem Tod ihrer Eltern bei einem verheirateten Bruder. Wie Hertha, ihre Vorgängerin, versuchte auch sie, der Familie zu gefallen, allerdings auf andere Art. Gleich nach der Begrüßung nahm sie sich eine Schürze vom Haken und half unserer Mutter dabei, das Essen zuzubereiten. Mit uns Kindern spielte sie im Garten. Wir mochten sie deshalb sehr und wünschten sie uns als Tante. Franz jedoch blieb auch ihr nicht treu. Als sie ein Baby von ihm erwartete, machte er sich nach Dänemark aus dem Staube. Von dort aus reiste er weiter nach Norwegen. Bei der Geburt starb Charlotte. Vater hätte seinen ersten Enkel gern nach Geuz geholt. Davon jedoch wollte Charlottes Bruder aus verständlichen Gründen nichts wissen. Das Baby blieb in Magdeburg, und was aus ihm geworden ist, das weiß ich nicht. Franz erfuhr von alledem erst viel später. Mutter schrieb es ihm nicht, um ihn nicht unnütz zu beunruhigen, wie sie sagte. Zu Ostern 1904 war für Emma die Schulzeit zu Ende, und sie ging wie die meisten Mädchen zu dieser Zeit in Stellung. Ihre Arbeit bestand darin, eine alte, blinde Dame zu betreuen. Da schwer körperbehinderte Menschen bekanntlich mißtrauisch und launisch sind, hatte sie damit kein leichtes Los gezogen. Mindestens ein Dutzend mal am Tage mußte sie zum Lehnstuhl gehen und befühlen lassen, was sie gerade in der Hand hielt. Sie selbst wurde bei dieser Gelegenheit meistens gleich mit abgetastet - zur Prüfung ob sie ihr Haar ordentlich aufgesteckt hatte, ob sie richtig angezogen war, und natürlich ob sie etwas Gestohlenes bei sich trug. Um ganz sicher zu gehen, ließ die Frau ihr Personal sich sogar gegenseitig 26 kontrollieren. Emma zum Beispiel mußte regelmäßig Bericht erstatten, was die Haushälterin gerade tat. Erstaunlicher Weise gelang es Emma tatsächlich, die eigenwillige Dame zufrieden zu stellen. Sie war nach der Mutter geraten, körperlich wie auch charakterlich. Die mittelblonden Haare hatte sie ebenso geerbt wie die Zähigkeit. Weil sie aber ein wenig größer war, wirkte sie nicht nur schlank sondern beinahe hager. Diese Tendenz verstärkte sich im Laufe der Jahre sogar noch. Die alte Frau erkannte bald, daß sie ein arbeitsameres und pflichtbewußteres Dienstmädchen schwerlich bekommen konnte. Deshalb sparte sie nicht mit Lob, wenn die Eltern sich erkundigen kamen. Im Unterschied zu Emma ähnelte Martha ihrem Vater. Von ihm hatte sie die dichten, schwarzen Haare, die ihr schwer wie Brokat auf die Schultern fielen, wenn keine Frisur sie hielt, von ihm auch die graublauen Augen, die dazu kontrastierten wie Sterne an einem klaren Sommernachthimmel. Jetzt, da sie dreizehn Jahre alt war, begann ihre Schönheit aufzublühen. Die Leute im Ort nannten sie "Schulzes Schwarze", was sie in ihrer derben Sprechweise durchaus freundlich meinten, und was zweifellos eher eine Hervorhebung denn eine bloße Unterscheidung bedeutete. Schon begannen die jungen Männer sich für sie zu interessieren, wenngleich sie es vorerst bei harmlosen Neckereien bewenden ließen. Martha hatte aber von Vater nicht nur Äußerlichkeiten geerbt. Wer sie genauer kannte und sich nicht täuschen ließ durch die charmant-kokette Fröhlichkeit, mit der sie sich in der Öffentlichkeit zumeist darzustellen pflegte, der entdeckte sie als ein hochintelligentes, ungewöhnlich wißbegieriges Mädchen. Manchmal verfiel sie aus äußerster Ausgelassenheit heraus urplötzlich in tiefernste Stimmung. Dann starrte sie vor sich hin und schien etwas zu sehen, was allen anderen verborgen blieb. Tatsächlich verblüffte sie wiederholt mit erstaunlichen Bemerkungen. 27 Naturgemäß war Martha Vaters Lieblingstochter. Sie verband eine tiefe Vertrautheit, die beide nicht hätten begründen können. Bei bestimmten Beschäftigungen duldete er nur sie in seiner Nähe, beim Zeitunglesen zum Beispiel. Zuweilen redete er mit ihr sogar über Politik. Dann hing sie voller Begeisterung an seinen Lippen und merkte sich jedes Wort. Dabei galten politische Themen seinerzeit als für ein Mädchen recht unschicklich. Nicht eine einzige ihrer Freundinnen befaßte sich damit. Vater jedoch dachte gar nicht daran, seine Tochter zurückzuhalten. Ich glaube, er ahnte, daß die neue Zeit, die er vorhersah, auch den Frauen eine neue Stellung bringen mußte, und er war stolz, in seiner großen Kinderschaar auch ein so blitzgescheites, selbstbewußtes Prachtmädel zu haben. Freilich - so wie der Vater unsere Mutter nicht verwöhnte, so sehr er sie auch liebte und verehrte, so schonte er auch Martha nicht. Noch während der Schulzeit betraute er sie mit einer besonderen, nicht ganz leichten und nicht einmal besonders ehreverheißenden Aufgabe. Er hatte eines seiner Häuser an eine alleinstehende Frau verkauft. Als er nun erfuhr, daß diese Frau für einen vierzigjährigen, geistig behinderten Sohn und eine schwerkranke Tochter sorgen mußte, plagte ihn das schlechte Gewissen. Um sich nicht länger als Schuft fühlen zu müssen, schickte er Martha jeden Tag nach der Schule zu ihr als Haushaltsgehilfin. Dafür nahm er keinen Pfennig Lohn an, obwohl die dankbare Frau ihn regelrecht damit bedrängte. Die Uneigennützigkeit unseres Vaters hatte freilich nicht nur Folgen für meine Schwester sondern auch für mich. Jemand mußte schließlich unsere Mutter im Haushalt unterstützen. Zwar vermochte sie ihre verkrüppelte Hand in erstaunlichem Maße wieder zu benutzen, doch schaffte sie die Arbeit dennoch nicht allein. Ich war damals aber gerade erst neun Jahre alt und gehörte nicht einmal zu den Größten. Beim Wäschewaschen mußte eine Fußbank an die Wanne herangeschoben werden, damit ich mich über das Waschbrett beugen konnte. 28 Unter diesen Umständen wäre es sicher verständlich, hätte ich Vater gegrollt. Was nutzt es, wenn er sich fremder Leute Sorgen annimmt und dafür seine eigene Familie leiden läßt! Das hätte ich denken können. Eigenartiger Weise jedoch kam ich auf diese Idee niemals. Nein, ich empfand meine neuen Pflichten wirklich nicht als Last. Ich fühlte vielmehr, daß ich gewissermaßen einen neuen Rang erreicht hatte, und war mächtig stolz darauf. Welch wichtige Rolle ich plötzlich spielte, das merkte ich vor allem daran, daß Mutter mich lobte. Mutter lobte sehr selten jemanden. Sie hatte ihr Leben lang so hohe Ansprüche an sich selbst gestellt, daß es für jeden schwer war, sie zu beeindrucken. So ruhig und ernst, so frei von Leidenschaften schritt sie durchs Leben, daß sie groß und erhaben wirkte - und unerreichbar. Ich glaube, wir Kinder verehrten sie mehr, als daß wir sie liebten. Aber ich kleiner Fratz, ich kleines Mädchen, das nicht einmal an das Waschbrett heranreichte, ich wurde von ihr gelobt und zwar nicht nur einmal sondern immer wieder. Ein wenig neidisch war ich nur auf Max, meinen zwei Jahre jüngeren Bruder, der viel mehr Freizeit hatte als ich, nach Herzenslust spielen durfte und obendrein vor den Nachbarn als Wunderkind herausgestellt wurde. Er ähnelte in seiner Neugier und seiner schnellen Auffassungsgabe seiner Schwester Martha. Allerdings war er viel verschlossener, empfindlicher und schwieriger als sie. Wenn ihn nichts störte und aus dem seelischen Gleichgewicht warf, vollbrachte er die erstaunlichsten Leistungen. Schreiben lernte er schon, bevor er in die Schule kam. Rechnen übte er, indem er kleine Steine zu Häufchen ordnete. Seine Freunde suchte er sich zumeist unter älteren Kindern. Es war also kein Wunder, daß sich Vater viel von ihm versprach. Allerdings hatte sein Leben ja gerade erst so richtig begonnen. Es warteten auf ihn noch viele Erlebnisse, die seinen Weg beeinflussen sollten. Noch litt er nicht unter den Erwartungen, die auf ihm lasteten. 29 Hedchen war zu dieser Zeit erst vier Jahre alt und durfte noch ganz und gar unbeschwert ihr Kindsein genießen. Wenn die großen Geschwister einmal nach Hause kamen und Zeit übrig hatten, versäumten sie niemals, mit ihr zu spielen. Sonntags nach dem Kaffeetrinken unternahm Vater mit ihr Ausflüge. Dabei zeigte und erklärte er ihr die Tiere und Pflanzen, die sie zu sehen bekamen. Zwischendurch rastete er mit ihr in einer kleinen Gaststätte und spendierte ihr dort eine Limonade. Leider vergaß er im Eifer, daß er ein kleines, zierliches Mädchen an der Hand führte und nicht einen seiner Arbeiter. Er scheuchte Hedchen dermaßen, daß ihr die so gutgemeinten Ausflüge schließlich gründlich verleidet waren. Wenn die Rüben zu verziehen waren und während der Erntezeit brauchte man auf den großen Gutshöfen der Umgebung Hilfskräfte. Ein Inspektor kam dann ins Dorf und verkündete, wieviele Leute er für welche Arbeit suchte. Da sich die meisten Familien den Nebenverdienst nicht entgehen lassen wollten, hatte er die freie Wahl und konnte die Löhne niedrig halten. Am billigsten waren natürlich Kinder. Die nahm er besonders gern. Ich mochte ihn nie gut leiden. Er behandelte uns herablassend wie ein Sklavenhändler. Anderseits wußte ich, daß ich mir - der Eltern wegen - das nicht anmerken lassen durfte. Mit wenigen Ausnahmen hatte jedes Jahr wenigstens eines von uns Schulzekindern zu den Ausgewählten gehört - zuerst Emma, dann Martha, schließlich ich. Die Arbeit war schwer und machte auch keinen Spaß. Immer stand ein Aufseher in der Nähe und wachte darüber, daß jeder die Norm schaffte. Wem das nicht gelang, sei es aus Trägheit, sei es aus Ungeschicklichkeit, auf den ließ er seine lange Lederpeitsche herabsausen. Das hatte nichts, aber auch gar 30 nichts gemein mit der Arbeit für Mutter in der Küche und im Waschhaus. Nur wenn Martha, die große Schwester, mich begleitete, dann fand ich es halbwegs erträglich auf den Gutshoffeldern. Auch zahlreiche polnische Arbeiter wurden für diese Wochen angeheuert. Sie wohnten in großen Gemeinschaftsunterkünften, den sogenannten Schnitterkasernen. Am Sonntag besuchten wir deutschen Kinder und Jugendlichen sie dort. Das war aufregend und lustig zugleich. Manches von dem, was wir hörten und sahen, empfanden wir als ein wenig fremd. Aber wir lernten es besser verstehen. Ich denke, daß alle Menschen sich besser miteinander vertragen, sobald sie mehr voneinander wissen. Spätestens, wenn zum Tanz aufgespielt wurde, war alles Trennende vergessen. Wir amüsierten uns prächtig, die etwas älteren auf ihre, wir Kinder am Rande auf unsere Weise. Für die Musik sorgten die polnischen Arbeiter übrigens immer selbst. Einiger der Frauen hatten ihre Babys mitgebracht. Weil sie die Kleinen weder allein lassen noch mit zur Arbeit nehmen konnten, gaben sie sie Leuten aus Geuz zur Pflege. Zu denen, die sich dazu bereiterklärt hatten, gehörte auch Mutter. Sie nahm für diese Gefälligkeit nicht einmal Geld an sondern allenfalls ein wenig Lebensmittel als Dankeschön. Dabei war das durchaus mit Umständen verbunden. Die noch nicht entwöhnten Säuglinge mußten zum Stillen hinaus aufs Feld gebracht werden. Den Bauern aus dem eigenen Ort halfen wir nicht nur des Lohnes wegen. Während der Ernte zeigte sich deutlich wie selten, daß die Geuzer im Grunde eine einzige Großfamilie bildeten. Auch bei diesen Einsätzen mußte hart gearbeitet werden, doch das taten wir gern. Die Stimmung war immer ausgezeichnet. Lustige Bemerkungen flogen hin und her. Wir merkten kaum, wie die Zeit verging. Am Nachmittag brachten die Mägde der Bauern Körbe mit Butterbroten und Krüge voll 31 Milch zur Vesper aufs Feld. Am Abend beim Heimweg auf dem Leiterwagen sangen wir gemeinsam. Zum Erntedankfest schließlich - am Ende aller Mühe - gab es für alle, die geholfen hatten, selbstgebackenen Kuchen von großen Blechen. Die Erwachsenen bekamen im Dorfgasthof Freibier spendiert. Nicht zuletzt durch die gemeinsame Arbeit wurde Martha meine Lieblingsschwester, und wir verbrachten fortan auch viel Freizeit miteinander. Wenn es am Sonntag nichts Besonderes zu erledigen gab, durften wir uns in Geuz und manchmal auch in Köthen vergnügen. Nach den Vorstellungen unserer Mutter sollten wir sittsam spazieren gehen. Sie steckte uns zu diesem Zweck in schmucke Kleider und stattete uns mit bunten Sonnenschirmen aus. Wir dachten freilich an sehr viel aufregendere Erlebnisse - an solche, bei denen die guten Kleider, die auf keinen Fall schmutzig werden durften, eher hinderlich waren. Sobald wir um die nächste Hausecke bogen, genossen wir die Freiheit. Voller Übermut nahmen wir dann unsere Sonnenschirme und fochten damit. Da wurde Martha unvermittelt wieder zum Kind. Unsere Eltern wären wohl erschüttert gewesen, hätten sie uns so ertappt. Alle Dörfer haben Traditionen. Das sind zumeist bestimmte Feste, die in überlieferter, mitunter recht eigentümlicher Art und Weise gefeiert werden, und an die niemand zu rühren wagt. Auch in Geuz gab es solche Bräuche. Einer davon war der jährliche Schulausflug. Wir Kinder freuten uns darauf immer schon Wochen vorher. Die Bauern stellten Fuhrwerke dafür zur Verfügung. In den Wagen wurden Bretter als Sitzbänke festmontiert. Grüne Zweige dienten als Schmuck. Gleich nach Sonnenaufgang brachen wir in Begleitung einiger Erwachsener auf. Den Tag verbrachten wir mit allerlei Spielen an irgend einem schönen Fleck in der Umgebung. Die Lehrer, die den Ausflug in ihrer Freizeit organisierten, gaben sich viel Mühe, um uns mit wenig Aufwand möglichst viel Kurzweil zu bieten. Erst am späten Nachmittag kehrten wir 32 zurück und hielten singend Einzug auf der Dorfstraße, wo unsere Eltern uns schon erwarteten. Große Aufregung herrschte, wenn Soldaten zur Einquartierung kamen. Die Dorfbewohner mochten die Soldaten. Das lag wohl vor allem daran, daß viele Familien selbst Söhne beim Militär hatten - so wie wir Schulzes unseren Karl. Eltern sahen in den fremden Jungen ihre eigenen Kinder. Die Mütter bewunderten sie in ihren schmucken Uniformen und umsorgten sie. Die Väter wiederum meinten, daß ein richtiger Mann nur werden könne, wer gedient hat. Immer standen viel mehr Übernachtungsplätze zur Verfügung, als notwendig waren. In jenen Friedenszeiten dachte kaum jemand daran, welche Gefahren mit dem Soldatsein verbunden waren. Uns Kindern, Jungen wie Mädchen, hatten es vor allem die Waffen angetan. Wenn sie auseinandergenommen und geputzt wurden, blieben wir in der Nähe stehen und verfolgten jeden Handgriff. Die etwas älteren Mädchen gingen zum Soldatenball. Für die hübsche Martha war das ein Riesenspaß. Obwohl sie noch keinerlei Interesse an einem festen Freund hatte, spürte sie natürlich sehr wohl, daß sie schon die Blicke der jungen Männer auf sich zog. Zum Schein ließ sie sich manchmal bis zu einer gewissen Grenze auf die Flirts ein. Dabei verliebte einer der Soldaten sich geradezu unsterblich in sie. Nicht einmal die Eröffnung, daß sie gerade erst vierzehn war, vermochte ihn abzuschrecken. Er werde geduldig auf sie warten, solange es sein müsse, schwor er ihr hoch und heilig. Am nächsten Tag im Kreise ihrer Freundinnen erzählte Martha dann von ihren kleinen Triumphen, und alle amüsierten sich köstlich. Wenn die Truppe weiterzog, folgten wir Kinder und Jugendlichen ihnen kilometerweit. Die Mutigsten kamen dabei bis Bernburg, wo sie bei der ersten Rast manchmal noch etwas vom Proviant abbekamen. Die meiste Zeit über war Mutter recht streng zu uns. Es gab aber Momente, da lernten wir ganz andere Seiten von ihr kennen. Sie wirkte dann wie ausgewechselt. Ich erinnere mich 33 dabei vor allem an die "Dämmerstunde". Das war damals für uns nicht einfach nur eine bestimmte Tageszeit sondern vielmehr eine besondere Familientradition, fast schon ein Ritual. Wir setzten uns dazu um die Mutter herum. Dann sangen wir mit ihr gemeinsam alte Volkslieder oder hörten uns von ihr Geschichten an. Manchmal gab sie uns auch Rätsel auf. Solche Szenen sind auf einigen romantischen Bildern zu sehen. Ich habe sie in der Wirklichkeit erlebt. Übrigens waren bei der Dämmerstunde auch die Größeren dabei, ohne sich deshalb zu schämen. Ein wenig an ein Ritual erinnerte auch das Verlesen der Briefe von Franz mittags am Küchentisch. Franz saß irgendwo im Norden und schrieb uns, was er dort sah und erlebte. Ehrfurchtsvoll hörten wir jüngeren Geschwister Berichte von Dingen, die wir uns kaum vorzustellen vermochten, die aber für ihn allem Anschein nach ganz selbstverständlich waren. Lediglich Vater hielt sich bei den Ausrufen der Bewunderung zurück. Er wirkte zuweilen sogar beinahe mißgestimmt und blieb wohl nur Mutter zuliebe auf seinem Platz. Wenn Martha mich am Sonntag nicht mitnehmen wollte, weil sie etwas vorhatte, wozu sie eine kleine Schwester nicht gebrauchen konnte, vertrieb ich mir die Zeit mit Spielkameraden aus Geuz. Wir bildeten eine richtige Clique und heckten gemeinsam so manchen Streich aus. Ich muß gestehen, manchen Unfug höchstselbst angezettelt und auf diesem Wege meinen Freundinnen die zugehörige Tracht Prügel eingebrockt zu haben. Selbstverständlich kassierte auch ich etliche wohlverdiente Maulschellen, aber das störte mich immer nur kurzzeitig. Ich war eine ziemlich wilde Range, und die Erwachsenen hatten es zweifellos nicht gerade leicht mit mir. Einmal gerieten wir mit einem älteren Jungen in Streit, und weil er viel stärker war als wir, löste er das Problem schließlich mit ein paar kräftigen Nasenstübern. Es tat eigentlich nicht allzusehr weh, aber dennoch bebte ich vor Wut. Erwachsene 34 hatten das Recht, mich zu schlagen. Das war nun einmal so. Ein anderes Kind aber durfte das nicht! Ich sann auf Rache und hatte schon bald eine Idee, eine glänzende Idee, wie ich fand. Ich gewann eine meine Freundinnen für den Plan. Mit ihr zusammen schlich ich mich eines Nachts zum Haus dieses Grobians. Mitgebracht hatte ich dazu einen Topf schwarze Farbe und einen großen Pinsel. Es war nicht allzu schwierig gewesen, das eine wie das andere unbemerkt von Vater zu entwenden. Nun schrieben wir an die schneeweiße Wand mit großen Buchstaben einen saftigen Spruch. Natürlich blieb unser Streich nicht ohne Folgen. Der Bauer, dem das Haus gehörte, beschwerte sich wutentbrannt beim Lehrer. Dieser wiederum brauchte nicht allzu lange, um uns als die Übeltäterinnen zu ermitteln. Die Strafe, die er sich dann ausdachte, war ziemlich originell - wir mußten den zum Glück mit Wasserfarbe geschriebenen Spruch eigenhändig wieder abwaschen und zwar am frühen Morgen, als die Landarbeiterfrauen sich zusammenfanden, um aufs Feld hinauszufahren. Die Schande, in dieser Weise vor dem ganzen Dorf bloßgestellt zu sein, traf uns letztlich mehr, als die sonst übliche Züchtigung es getan hätte. Freilich galten damals in mancherlei Hinsicht ganz andere Maßstäbe als heute. Sicherlich hätte ich weitaus weniger Ärger gehabt, wäre ich ein paar Jahrzehnte später auf die Welt gekommen. An einem heißen Sommertag überredete ich meine Freundinnen zu einem kleinen Erfrischungsbad im Dorfteich. Wir zogen uns aus bis aufs Hemd und stiegen frohgemut ins Wasser. Nun hielten sich aber zur selben Zeit auch ein paar Jungen dort auf. Als ein Lehrer zufällig vorbeikam, gelangte der Vorfall ans Licht der Öffentlichkeit, und durchs Dorf ging ein Schrei der Empörung über das von uns gegebene Beispiel um sich greifender Sittenlosigkeit. Wenn Martha mich nicht mitnahm, ging sie zumeist mit ein paar Freundinnen ihres Alters ins Köthener Zentrum. Dort trafen sie die Stadtschüler, die ihnen mit ihren flotten, bunten 35 Mützen und ihrem weltmännischen Gehabe sehr viel begehrenswerter erschienen als die Jungen aus Geuz, dem Dorf. Martha hatte nun schon den einen oder anderen nicht mehr ganz so unschuldigen Traum. Da sie jedoch nicht nur hübsch war sondern auch klug, wußte sie ziemlich genau, wie weit sie gehen durfte. Auf eine beständige Freundschaft mit einem Jungen ließ sie sich auch weiterhin nicht ein. Das hätte nur Verdruß eingebracht. Obwohl wir beide nun also mehr und mehr eigene Wege gingen, blieb unsere innige Schwesternfreundschaft ungetrübt. Martha war sogar mehr den je mein großes Vorbild. Ich bewunderte sie ihrer Abenteuer wegen, auch wenn ich nicht so recht verstand, worum es eigentlich ging bei diesen Sachen, für die ich angeblich noch zu klein war. Plagte ich mich mit irgend einer heiklen Frage herum, holte ich mir Auskunft nur bei ihr. Die Antworten, die ich dann erhielt, galten mir als unumstößliche Wahrheiten. Nur als sie mich über die Herkunft der Babys aufzuklären versuchte, glaubte ich ihr nicht. Das war mir denn doch zu ungeheuerlich. Max hatte sich unterdessen zu einem Musterschüler entwickelt. Sein Lehrer empfahl den Eltern, ihn - ungeachtet der damit verbundenen Kosten - auf eine höhere Schule zu schicken, damit seine Begabung sich entfalten könne. Allerdings setzte er seinen regen Verstand auch außerhalb der Schule ein und zwar sehr zu seinem Vorteil. Manchmal nutzte er zum Beispiel die Gelegenheit einer kleinen Besorgung dazu aus, sich ein paar Stunden zusätzlicher Freizeit zu verschaffen. Bei der Rückkehr war er um eine glaubwürdige Ausrede niemals verlegen. Er erzählte dann nämlich eine Geschichte. Dabei stotterte er nicht etwa wie andere Kinder, denen das schlechte Gewissen zusetzt. Nein - er sah vor sich, was er erzählte, mit allen Einzelheiten. Eigentlich erzählte er gar nicht, er berichtete. Und er berichtete mit solcher Leidenschaft und solcher Dramatik, daß Mutter ihm jedes Wort glaubte. 36 Auch seine Spielkameraden beeindruckte er auf diese Weise. Den nicht existierenden reichen Onkel aus Amerika kannte bald jeder von ihnen. Alle wußten von dessen heimlichen Besuchen in Geuz, und von den Geschenken, die er mitbrachte. Wenn wir Geschwister den Geschichten widersprachen und unseren Bruder einen Spinner nannten, hatten wir keine Chance. "Ihr wollt bloß nichts von den Geschenken abgeben!" bekamen wir zu hören. Im Mai fand in Köthen traditionell ein Viehmarkt statt. In diesem Jahr wollte Vater die Gelegenheit nutzen, um ein kleines Schwein zu kaufen. Das sollte bis zum Herbst fett gefüttert und dann geschlachtet werden. Ich bekam unterdessen ein paar Groschen in die Hand gedrückt, um mich mit Max und Hedwig auf dem gleich nebenan aufgebauten Rummel zu amüsieren. Wir verlebten also einen wirklich lustigen Tag und kehrten - viel später als unsere Eltern - erst im Dunkeln nach Hause zurück. Als wir uns durch den Vorgarten tasteten, dachte ich noch immer an nichts Böses. Auf dem Hof aber hörte ich plötzlich ein verdächtiges Geräusch. Ich geriet sofort in helle Aufregung, denn trotz meiner Wildheit war ich in gruseligen Situationen ein rechter Hasenfuß. Mutter allerdings lachte nur über meine Angst, zumal Max nachdrücklich versicherte, er habe nichts bemerkt. In Geuz kamen Einbrüche selten vor, so selten, daß die Leute ihre Haustüren nicht abschlossen. Niemand hörte auf mich. Wenig später aber flogen plötzlich Steine gegen das Fenster, und im Hof huschten Schatten hin und her. Es wollten uns also doch irgend welche finstere Gesellen behelligen! Vermutlich hatten sie es auf unser Schwein abgesehen. Freilich mochte ich 37 mich nicht so recht darüber freuen, daß ich recht behielt. Ich stand senkrecht im Bett und war vor Angst ganz durcheinander. Was ich mir in diesem Moment dachte und ob ich überhaupt noch klar denken konnte, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, daß ich mir - wodurch auch immer getrieben - meinen Wollrock überwarf und mit den Worten: "Ich hole Hilfe!" einfach loslief. Ehe Mutter mich zurückhalten konnte, war ich schon wie ein Geist vorbei an den ungebetenen Gästen über den stockdunklen Hof hinaus auf die Straße gehuscht. Dort begab ich mich auf die Suche nach dem Nachtwächter. Dessen Dienst begann allerdings erst um Mitternacht, weshalb er sich nur mit Mühe überreden ließ, mir zu folgen. Was nun geschah, war eine wilde Jagt - fast so wie in einem billigen Film. Der Nachtwächter, Vater und ein Nachbar versuchten gemeinsam, der Eindringlinge habhaft zu werden. Diese aber entschlüpften ihnen im Schutz der Dunkelheit immer wieder und warfen mit Steinen. Es dauerte fast zwei Stunden, bis die Drei sie wenigstens vertrieben hatten. Die Gefahr war so erst einmal glücklich gebannt. Und jetzt, jetzt, da es eigentlich gar keinen Grund mehr dafür gab, jetzt packte mich wieder die Angst und zwar gleich so übermächtig, daß kein Zureden mich dazu bewegen konnte, mich wieder ins Bett zu legen. Ich blieb bis zum frühen Morgen an der Seite des Nachtwächters, von dem ich mich einigermaßen beschützt fühlte. Noch ein zweites Mal hatten wir Schulzes Glück im Unglück. Vater suchte einen Käufer für eine gerade fertiggestellte Villa. Eine Maklerin stellte ihm eine interessierte Frau vor. Das war eine vornehm wirkende Dame in schwarzer Witwentracht. Der Tod ihres Mannes habe sie, wie sie versicherte, schwer angegriffen. Sie war ständig einer Ohnmacht nahe. Als sich die Verhandlungen hinzogen und am selben Tag nicht mehr zum Abschluß kamen, bot Vater ihr voller Mitgefühl an, bei uns zu übernachten. Das wiederum 38 ließ die Maklerin nicht zu. Nein, ihre Pflicht sei es, der armen Frau ein Quartier und ein wenig Trost zu gewähren. Am Tag darauf war die trauernde Witwe verschwunden - offenbar wieder in bester Verfassung - mitsamt dem Geld und dem Schmuck der Maklerin. Sie hatte nur zuzugreifen brauchen, denn einem Ehrengast wie ihr stand natürlich das beste Zimmer zu, das, worin alles Wertvolle aufbewahrt wurde. Emma betreute die alte, blinde Frau mehr als zwei Jahre lang bis zu ihrem Tode. Danach vermittelte eine Bekannte der verstorbenen Dame sie auf ein Rittergut. Darin drückte sich eine besondere Wertschätzung aus. Die Stelle versprach recht guten Lohn, und es wurde dafür ausdrücklich eine ganz besonders zuverlässige Person gesucht. Zu Emmas Leidwesen erwies sich die neue Aufgabe als kaum weniger schwierig als die vorhergehende. Ein sechsjähriger Junge war zu betreuen, der einzige Sohn der Herrschaftsfamilie, ein maßlos verwöhntes, eigensinniges Früchtchen. Selbst nachts hatte das geplagte Dienstmädchen keine Ruhe mit ihm. Er stand manchmal urplötzlich auf und verschwand. So war Emma erleichtert, als er in ein Pensionat gesteckt wurde. Die Gutsherrin vermittelte das Mädchen weiter zu ihren Eltern nach Dessau. Emmas Stellung dort entsprach in etwa der einer Zofe. Das war im Grunde keine große Belastung. Allerdings herrschte Unfriede im Haus. Der Mann hatte einst als General kommandiert und tyrannisierte nun seine Familie. Nicht selten kam es dabei so weit, daß er seine Frau schlug. Emma litt darunter, obwohl sie selbst zumeist nicht unmittelbar betroffen war, und suchte nach Wegen, zu einer anderen Herrschaften zu kommen. Nach knapp zwei Jahren fand sie schließlich eine Anstellung in Berlin. Martha ging nach Beendigung der Schule nicht in Stellung wie ihre beiden älteren Schwestern sondern wurde Arbeiterin in der Köthener Schokoladefabrik. Sie fand sich dort schnell zurecht und war wegen ihrer aufgeschlossen-freundlichen 39 Wesensart einerseits und ihrer Geschicklichkeit andererseits sehr gut angesehen. Dennoch war sie überrascht, als sie zwei Jahre später nach dem Tode des Fabrikbesitzers von dessen Witwe ein ganz besonderes Angebot erhielt. Die Frau bestellte sie ins Büro und eröffnete ihr dort, daß sie das Werk verkaufen werde, um sich nach Düsseldorf zurückzuziehen. Sie wolle aber nicht gern allein dorthin gehen, sondern sich von jemandem begleiten lassen, den sie kennt und dem sie vertraut. Über die Bezahlung könne man reden. Es lasse sich gewiß ein Übereinkommen finden. Martha beriet sich mit Vater, und als der ihr zuriet, nahm sie das Angebot an. Sie brach in bester Stimmung auf und versprach sich viel von der großen Stadt. Natürlich fielen ihr sofort die atemberaubenden Geschichten ein, die Minna und Franz von Magdeburg erzählt hatten. Wirklichkeit und Traum jedoch sind immer zweierlei. Martha merkte in der Fremde mit einem Mal, wievieles sie an ihre Heimat, an ihr Köthen band. Sie vermißte ihre Freundinnen, sie vermißte den vertrauten Dialekt der Anhaltiner, sie vermißte die hundertmal besuchten, erinnerungsbehafteten Orte - Kleinigkeiten, über die sie noch nie zuvor nachgedacht hatte, und die sie erst wichtig nahm, seit sie auf sie verzichten mußte. Sie merkte, daß sie von anderem Schlage war als Franz, ihr Bruder. Es tröstete sie schließlich nicht einmal mehr, daß die ehemalige Fabrikbesitzerin sie nach wie vor mochte und alles tat, um sie zu halten. Nach einem Jahr war das Heimweh so stark, daß sie nach Köthen zurückkehrte. In jenem Jahr, als Martha in Düsseldorf lebte, stellte Vater einen jungen Zimmermann ein. Er hieß Willi und hatte keine Eltern mehr. Als dann auch noch seine Großmutter starb, gab es praktisch niemanden mehr, bei dem er Halt finden konnte. Das war wohl der Grund, weshalb er sich an seinen Arbeitgeber viel enger anschloß, als seine Kollegen das taten. Umgekehrt begann Vater ihn wie einen eigenen Sohn zu 40 mögen. Bald ging er in unserem Hause ein und aus und saß beim Mittagessen mit am Tisch. Willi war ein angenehmes Familienmitglied. Mit seinem Fleiß, seiner Ehrlichkeit und seiner Gewissenhaftigkeit hatte er sich schon auf den Baustellen manches Lob verdient. Nach Feierabend aber erwies er sich zudem als lustig und unkompliziert. Er nahm das Leben nicht so schwer und fand auch in schwierigen Situationen immer noch irgend eine heitere Bemerkung. Das tat dem Klima bei den Schulzes gut. Als Martha aus Düsseldorf zurückkam, entdeckte sie an ihm sogar noch einen dritten Vorzug - er sah auch gut aus. Er war groß, hatte blondes, weiches Haar und dazu blaue, immer strahlende Augen. Schon bei ihrer ersten Begegnung mit ihm wußte sie, daß er ihre erste große Liebe sein würde. Gerade aber weil er ihr soviel bedeutete, wollte sie mit ihm nichts überstürzen. Sie ließ sich von ihm ins Kino einladen, freute sich über die kleinen Geschenke, mit denen er sie regelmäßig überraschte, bremste ihn aber sofort, wenn er mehr von ihr wollte als das. Dadurch konnte zwischen ihnen eine zarte, geradezu unschuldige Liebesbeziehung aufkeimen und allmählich zu einem starken Gefühl heranreifen. Im Jahre 1910 war auch für mich die Schulzeit zu Ende. Ich bedauerte es nicht, und ich freute mich auch nicht darüber. Ich empfand es als etwas ganz Natürliches. Auch, daß ich danach in Stellung ging, war nichts Besonderes für mich. Ich kannte das ja durch meine Schwester Emma. Meine neue Aufgabe bestand darin, das drei Monate alte Kind eines an der Köthener Hochschule studierenden russischen Ehepaars zu betreuen. Damit hatte ich kein allzu schweres Los gezogen. Die beiden waren ruhige, freundliche Leute, und wenn mich überhaupt etwas an ihnen störte, dann höchstens ihre ständige Besorgtheit. Einmal hatten sie etwas in Berlin zu erledigen. Als ich erfuhr, daß sie mich dorthin mitnehmen wollten, war ich überglücklich. Berlin - wieviel hatte ich schon davon gehört! 41 Das alles sollte ich nun mit eigenen Augen sehen! Schon malte ich mir die staunenden Mienen meiner Freundinnen bei meinem Bericht nach der Rückkehr aus. Aber da war eben die Sorge meiner Dienstherren. Selbst wenn sie sich im Hotel aufhielten und mich eigentlich gut hätten entbehren können, ließen sie mich nicht fort. Die große Stadt berge für ein unerfahrenes junges Mädchen wie mich zu viele Gefahren, behaupteten sie. Alles Maulen half nichts - ich lernte zunächst von Berlin nur genau das kennen, was vom Fenster aus zu sehen war. Aber dann, als ich schon gar nicht mehr darauf rechnete, bekam ich doch noch meine Chance auf ein Abenteuer. Meine Dienstherren hatten Butter zu kaufen vergessen und schickten mich, ein Stück aus dem Geschäft gleich an der Ecke zu holen. Sie waren zweifellos überzeugt, daß mir auf einem so kurzen Wegstück nichts Verhängnisvolles widerfahren könne. Freilich vergaßen sie dabei, wie sehr ich auf diesen Moment der Freiheit gewartet hatte. Schon im Hausflur wußte ich nicht mehr, was ich eigentlich tun sollte. Ganz krank vor Neugier lief ich von einem Schaufenster zum nächsten. Die schillernde, flimmernde Welt, in die ich so unversehens hineingepurzelt war, hatte mich einem Strudel gleich rettungslos in ihren Bann gezogen. Ich lief und lief - bis ich nicht mehr wußte, wo ich mich befand. Mag mich niemand fragen, wie ich wieder zum Hotel gelangt bin! Es muß so gegen neun Uhr abends gewesen sein, als ich dort eintrudelte, ohne Butter und ziemlich kleinlaut. Das Russische Ehepaar hatte natürlich mit dem Allerschlimmsten gerechnet. Daß ich nun bis zur Abreise keinen Schritt mehr ohne Aufsicht gehen durfte, brauche ich sicherlich nicht zu betonen. Ein Jahr später kehrten die beiden in ihre Heimat zurück. Eigentlich wollten sie mich dorthin mitnehmen, doch das ließ Mutter nicht zu. Sie befürchtete, mich dann völlig aus den Augen zu verlieren, und hatte damit sicher nicht ganz unrecht. 42 Ich selbst jedoch wäre gern ein wenig mehr in der Welt herumgekommen. Es wurde mir allmählich langweilig in dem kleinen Geuz. Eines Tages verfiel ich deshalb auf einen tollkühnen Plan. Ich hatte noch eine Rechnung offen, denn ich war in Berlin gewesen und kannte es trotzdem noch so gut wie gar nicht. Das sollte nicht so bleiben. Ich kaufte mir heimlich von meinem ersparten Geld eine Fahrkarte und verstaute meine Arbeitssachen sowie ein paar Schuhe in einem Pappkarton. Nur die kleine Hedwig weihte ich ein während meiner Vorbereitungen, und die mußte mir hoch und heilig versprechen, zu schweigen wie ein Grab. Der große Tag rückte heran, und ich fuhr los. Zunächst landete ich bei einer Arbeitsvermittlung in der Nähe des Bahnhofs Friedrichstraße. Die Adresse kannte ich durch eine Freundin. Da Mädchen aus der Provinz als fleißig und anspruchslos galten, fand ich sofort eine Stelle. Kaum hatte ich den Raum betreten, stürzten schon mehrere Frauen auf mich zu. Eine von ihnen nahm mich gleich mit. So löste sich auch die Frage nach dem ersten Nachtquartier praktisch von selbst. Die Frau betrieb eine Pension und hatte noch ein zweites junges Mädchen in Stellung. Das war angenehm für mich, denn dadurch hatte ich gleich eine Gefährtin, die sich auskannte und mich in das Berliner Leben einführen konnte. Sonntags gingen wir tanzen. In einem Saal ganz in der Nähe spielte dann eine Blaskapelle, und wir amüsierten uns jedesmal prächtig. Meinen Eltern und Geschwistern schrieb ich, daß ich zwar wisse, wie sich jeder um mich gesorgt habe, daß ich aber glücklich sei und ausgezeichnet zurecht komme. Doch dann beendete ein schlimmer Zwischenfall abrupt diese schöne Zeit. Im Erdgeschoß des Hauses wohnte ein alleinstehender Bankbeamter, der einen Dackel hielt. Diesen Hund liebte die Mutter der Pensionsinhaberin leidenschaftlich. Sie war an den Rollstuhl gefesselt und wollte sich kein eigenes Tier zumuten. Eine meiner Aufgaben bestand nun darin, den 43 Dackel jeden Abend für eine Stunde zu der Frau zu bringen und ihn anschließend wieder dem Besitzer zurückzugeben. Dadurch kannte ich den Mann recht gut. Eines Tages hallte ein Knall durch das Haus. Erschrocken liefen wir alle nach unten. Dort fanden wir den Beamten tot am Boden liegen. Er hatte sich selbst erschossen. Den Anblick werde ich nie vergessen. Ich war so schockiert, daß ich unter keinen Umständen weiter in der Pension arbeiten wollte. Weil mein Vertrag mich noch band und meine Dienstherrin mich nicht ohne Weiteres gehen ließ, stahl ich mich heimlich davon. Wieder bewarb ich mich bei der Arbeitsvermittlung an der Friedrichstraße und wieder fand ich rasch eine Anstellung, diesmal in einem Milchgeschäft. Dort mußte ich jeden Morgen gegen vier Uhr die Milch austragen. Das bedeutete nicht nur, zeitig aufzustehen, sondern auch, reichlich Treppen hochzusteigen, denn die Häuser im Viertel waren zumeist mehrstöckig. Die einzige Erleichterung, die ich mir dabei verschaffen konnte, beruhte auf einem Abkommen mit dem Bäckersjungen, der gewissermaßen mein Schicksal teilte. In der einen Hälfte der Häuser nahm ich seine Brötchen mit, in der anderen Hälfte er meine Milch. Allerdings hatte die neue Arbeitsstelle für mich auch Vorteile. Wenn ich gegen sechs Uhr von meiner Tour zurückkam, stand das Frühstück auf dem Tisch - dampfender Kaffee, Wurst in mehreren Sorten, auch Käse. Von all diesen guten Dingen durfte sich jeder nehmen, soviel er wollte. Wenn ich reichlich zu Essen bekam, war ich schon recht zufrieden mit meinem Schicksal. In dieser Hinsicht glich ich noch ganz jenem Lieschen, das Karls Essen gegen die Geschwister verteidigt hatte. Tagsüber half ich im Laden oder ging mit den beiden Kindern des Inhaberehepaars spazieren. Vom späten Nachmittag an konnte ich über meine Zeit frei verfügen. Inzwischen hatte ich eine neue Freundin kennengelernt, ein junges Mädchen aus Köthen, das bei einem Schneidermeister 44 lernte. Mit ihr zusammen verbrachte ich manchen Abend und manches Wochenende. Allein mochte ich nicht tanzen gehen. Ein wenig gruselte es mich nämlich noch immer im Großstadtdickicht, obwohl andrerseits die unterschwellige Gefahr gerade jenen Reiz auf mich ausübte, der mich dort festhielt. So ganz ungefährlich war das Berlin jener Jahre übrigens tatsächlich nicht, zumal für ein junges Mädchen wie mich. Gerade erregte der Fall des Massenmörders Haarmann die Gemüter. Der Fleischersmeister hatte jahrelang Menschen zu Wurst verarbeitet. Nun suchte die Polizei fieberhaft nach ihm, und den Gerüchten nach tauchte er mal in diesem, mal in jenem Viertel auf. Wenn ich frühmorgens in der Dunkelheit mit meiner Milch durch die noch leeren Straßen lief, argwöhnte ich hinter jeder Häuserecke eine finstere Gestalt. Ein unangenehmes Erlebnis widerfuhr mir übrigens auch ganz persönlich. Ich wollte in einem Schreibwarenladen eine Ansichtskarte kaufen. Während ich mir nun am Ständer eine passende aussuchte, kam der Inhaber und schloß plötzlich die Eingangstür zu. Ich begriff sofort, daß ich in der Falle saß, und spähte verzweifelt nach Rettungsmöglichkeiten aus. Vor dem Schaufenster hielt sich leider gerade niemand auf, dem ich hätte Zeichen geben können. Der Mann kam von hinten immer dichter an mich heran, und sein keuchender Atem ließ keinen Zweifel daran, woran er dachte. Ich schrie, war mir aber nicht sicher, ob mich jemand hörte. Schon hatte er mich in eine Ecke getrieben und setzte zum Sprung an, um mich zu packen - da kam buchstäblich in letzter Minute von hinten eine Frau herein. Der gestörte Ladenbesitzer beeilte sich nun, die Eingangstür wieder aufzuschließen, und ich fand die Gelegenheit zur Flucht. In Köthen war ich seit meinem heimlichen Aufbruch nicht mehr gewesen, und obwohl ich das ungebundene Leben in der Hauptstadt nach wie vor in vollen Zügen genoß, bekam ich allmählich Heimweh. Auch plagte mich zunehmend das 45 schlechte Gewissen. Als ich für drei Tage Urlaub bekam, fuhr ich sofort los zu den Eltern nach Geuz. Zu meiner Überraschung wurde ich dort sogar ohne Vorwürfe empfangen. Freilich war Mutter nicht so recht froh über das, was ich in Berlin trieb. Vor allem wegen der Milchtouren zu früher Stunde sorgte sie sich. Am Abend des dritten Tages schließlich hatte sie mich überredet, die Stelle aufzugeben - trotz des guten Lohnes, den Trinkgelder noch beträchtlich aufbesserten. Mein Entschluß ließ sich aber nicht ohne weiteres in die Tat umsetzen. Meine Arbeitgeberin war zufrieden mit mir und wollte mich nicht gehen lassen. Auf jeden Fall bestand sie auf der vertraglich vereinbarten, vierwöchigen Kündigungsfrist. Ein anderes Mädchen hätte das wahrscheinlich als unvermeidlich akzeptiert. Ich jedoch war nicht der Typ, mich so einfach in die Gegebenheiten zu schicken. Ich flüchtete abermals mitten in der Nacht, wobei ich meine Sachen in einem Korb verstaute und aus dem Fenster warf. Der Bäckersjunge begleitete mich bis zum Bahnhof. Diesmal aber hatte die Flucht noch ein Nachspiel. Die erboste Milchhändlerin ging zur Polizei und erwirkte ein Bußgeld von drei Mark wegen "böswilligen Verlassens des Arbeitsplatzes". Das war immerhin der Lohn für vierzehn Tage. Ähnlich turbulent, wie mein Berlinabenteuer begonnen hatte, endete es also auch. In Köthen suchte ich mir eine Stelle in einem großen Kaffee. Während der Besitzer im Keller in der Backstube feine Torten buk und seine Frau im Lokal die Leute bediente, blieb mir die Besorgung des Haushalts überlassen. Da war zunächst einmal Essen zu kochen. Dann mußten zwei Kinder in die Schule geschickt werden. Auch der Abwasch für das Lokal gehörte zu meinem Bereich. Das schmutzige Geschirr wurde mit einem Aufzug in die Wohnung hinauftransportiert und gelangte sauber auf dem selben Wege wieder zurück. Hin und wieder fielen zudem Botengänge verschiedener Art an. 46 Einmal mußte ich eine prächtig verzierte Torte zu einem Kunden nach Hause bringen. Ich gab mir unsäglich viel Mühe, das Kunstwerk heil ans Ziel zu bringen. Um jedoch den Klingelknopf drücken zu können, mußte ich den Teller für einen Moment auf einer Hand balancieren - und da geschah das Unglück. Die Torte geriet ins Rutschen. Meine Versuche, sie noch zu retten, verschlimmerten alles nur noch. Das Kunstwerk verwandelte sich blitzschnell in einen fettigen, scherbendurchsetzten Haufen. Sekunden später öffnete sich die Tür, und ich wünschte inständig, augenblicklich im Boden zu versinken. Abgesehen von diesem Mißgeschick hatte mein neuer Arbeitgeber aber kaum Grund zum Klagen. Mochte ich manchmal auch ein wenig eigensinnig sein, mein Arbeitseifer war immer vorbildlich. Was man mir auftrug, erledigte ich sofort, oft gründlicher als gefordert. Umgekehrt bot das Kaffee einen Vorteil, den wohl kaum jemand so wie ich zu schätzen wußte. Sobald das Buffet frisch aufgefüllt wurde, blieben zahlreiche Stücken Torte übrig, und jeder der Angestellten konnte davon essen, soviel er mochte. Hedwig war neunjährig, als ich bei dem Russischen Studentenehepaar Kindermädchen wurde. Das heißt, sie übernahm die Aufgabe, Mutter bei der Hausarbeit zu helfen, fast genau im selben Alter wie ich. Allerdings hatte sie es dabei zweifellos noch schwerer als ich seinerzeit, denn sie war von Natur aus klein und zierlich. Darum tat sie uns allen ein wenig leid, vor allem am Anfang. Da sie aber nun einmal das letzte noch bei den Eltern lebende Mädchen war, half ihr das wenig. Immerhin hatte sie von Mutter nicht nur die Konstitution geerbt sondern auch die innere Energie und die bedingungslose Opferbereitschaft. Tapfer fügte sie sich in ihr Schicksal, und es kam ganz selten vor, daß sie sich bei uns Geschwistern beklagte. Ob sie trotzdem unglücklich war, oder ob sie einen ähnlichen Stolz empfand wie ich, das kann ich nicht mit 47 Bestimmtheit sagen. Wirklich schätzen lernte ich ihre Leistung erst Jahre später aus einem gewissen Abstand. Was Max anging, befolgten unsere Eltern den Rat der Lehrer und schickten ihn auf ein Gymnasium. Vor allem Vater setzte große Hoffnungen in ihn. Er konnte sich noch gut daran erinnern, wie schwer es ihm gefallen war, sich vom Gärtnerssohn zum Bauunternehmer hochzuarbeiten. Er wußte auch, daß jedes Studium halbherzig bleiben muß, wenn es nur nach Feierabend betrieben werden kann. Bei Max nun sollte das alles ganz anders sein. Er sollte unter besten Bedingungen lernen und am Ende all das erreichen, was dem Vater verwehrt blieb. Allerdings war die Umschulung mit vielen Kosten verbunden. Max benötigte besondere Unterrichtsmittel. Auch bessere Kleidung bekam er. Schließlich sollte er sich von seinen Mitschülern nicht durch ein besonders ärmliches Aussehen unterscheiden. Es wurde also sehr viel mehr Aufwand mit ihm getrieben als mit uns anderen Geschwistern. Würde ich behaupten, daß wir alle ihm das von Herzen gönnten, wäre das gewiß eine Lüge. Allerdings hielt sich der Neid in Grenzen, denn wir glaubten ebenso wie Vater an seine Begabung. Wenn er unsere Familie dort am Gymnasium gut vertrat, so brachte das immerhin auch uns ein wenig Ehre ein. Max hatte tatsächlich keine Mühe, dem Unterricht zu folgen. Dennoch fiel es ihm schwer, sich in der neuen Umgebung zu behaupten. Seine Mitschüler stammten durchweg aus reichen Familien. Sie gingen in ihrer Freizeit reiten, spielten Tennis oder bekamen Musikunterricht. Max versuchte, sich wieder mit Hilfe seiner Phantasie zu retten. Unglücklicher Weise hatte er es jetzt aber nicht mehr mit leichtgläubigen Dorfkindern zu tun sondern mit überheblichen Gymnasiasten, die seinen Geschichten mißtrauten und rasch die Wahrheit herausfanden. Als notorischer Lügner überführt, sank sein Ansehen in der Klasse noch tiefer. 48 Allmählich verlor er jedes Interesse an der Schule. Er ging zwar nach wie vor frühmorgens pünktlich aus dem Haus, nahm aber kaum noch am Unterricht teil, sondern trieb sich irgendwo in Köthen herum. Es dauerte nun nicht mehr lange, da bestellte der Direktor den Vater zu sich. Der war von seinem Sohn so enttäuscht, daß er ihn sofort vom Gymnasium nahm und in eine Schlosserlehre gab. So nahm Maxens Aufstieg, der einmal so steil begonnen hatte, ein jähes Ende. Er erreichte niemals im Leben annähernd das, was man ihm seinen Talenten nach zutrauen mußte. Was wäre wohl aus ihm geworden, hätte er unter anderen Bedingungen gelebt, in einer anderen Familie, in einer anderen Zeit, unter einem verständnisvolleren, idealistischen Lehrer? Ein erfolgreicher Schriftsteller vielleicht, ein Journalist bei einem der großen Magazine? Es ist müßig, darüber zu spekulieren. In Wahrheit blieb er immer der Geschichtenerfinder, der an Stammtischen seine atemberaubenden Storys zum Besten gab, dem leichtgläubige Gemüter mit offenem Mund zuhörten und der von allen anderen als weltfremder Träumer belächelt wurde. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte die Widersprüchlichkeit der Wilhelminischen Ära ihren Höhepunkt. Nie zuvor hatten die größten Hoffnungen und die schlimmsten Gefahren so dicht beieinandergelegen. 1912 wurde die SPD zur stärksten Fraktion im Reichstag. Das gab ihr zwar noch keinen entscheidenden Einfluß auf die Politik, weil die Macht noch fast ausschließlich beim Kaiser und dessen nächsten Vertrauten konzentriert war, zeigte aber, wie tiefgreifend sich die Stimmung in der Bevölkerung gewandelt hatte. Erinnerungen an die Revolution von 1848 wurden wach. 49 Anderseits schmiedeten die europäischen Herrscher emsig an Bündnissystemen. Konflikte zwischen kleinen Staaten eskalierten, weil Großmächte sich einmischten, so zum Beispiel auf dem Balkan. Es war ein doppeltes Wetterleuchten zu sehen am Horizont, und niemand vermochte zu sagen, welches Gewitter sich zuerst entladen würde. Eines Sonntags - es muß am frühen Vormittag gewesen sein - stürmte meine Schwester Martha freudestrahlend ins Zimmer und rief: "Komm schnell! Wir gehen nach Köthen! August Bebel wird sprechen!" Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich damals mit dem Namen August Bebel recht wenig anzufangen wußte. Nun ja, das war so ein Politiker, einer von diesen Linken. Ich interessierte mich für dergleichen nicht. Wenn aber Martha vor Begeisterung ganz außer sich geriet, dann mußte es mit diesem Bebel etwas Besonderes auf sich haben. Ich zog mich also an und folgte ihr. Auf dem Bahnhofsvorplatz hatte sich bereits eine gewaltige Menschenmenge eingefunden. Viele Arbeiter der Köthener Fabriken waren demonstrativ in ihrer Berufskleidung erschienen. Das gab ihnen eine Gefühl der Verbundenheit. Zugleich ließen sie sich dadurch zuordnen. Vorn, direkt gegenüber der Bahnhofshalle bildeten die Männer aus der Maschinenfabrik "Wagner" mit ihren blau-weiß gestreiften Hemden einen kompakten Block. Rechts von ihnen mischten sich die baumlangen Hünen aus der Zuckerfabrik mit den Druckereiarbeitern. Martha indes wandte sich mit mir nach links, wo sie ihre Kolleginnen aus der Farbenfabrik "Musche" entdeckt hatte. Sie war dort seit ihrer Rückkehr aus Düsseldorf in der Verpackungsabteilung angestellt. Eigentlich galt ich als ein ziemlich freches Mädchen. Im Vergleich mit Emma und Hedwig war ich das wohl auch. Den Fabrikarbeiterinnen gegenüber aber kam ich mir ausgesprochen brav vor. Die hatten ein ganz anderes Selbstbewußtsein als wir, 50 die wir bei Herrschaftsleuten als Hausmädchen dienten. Daß manch einer über sie die Nase rümpfte und ihnen alle möglichen Schlechtigkeiten unterstellte, schien sie wenig zu stören. Unmittelbar vor uns nahmen uns die Männer aus der Leimfabrik ein wenig die Sicht. Mir war, als haftete ihnen auch jetzt am Sonntag noch der atemberaubende Gestank ihrer Bottiche an. Etwas abseits warteten jene Arbeiter, die den Malz für die Bierherstellung produzierten. Das große, rote Gebäude, das sie jeden Morgen verschluckte, erinnerte mich jedesmal, wenn ich an ihm vorbeigehen mußte, an ein Gefängnis. Martha lenkte meine Aufmerksamkeit auf eine Gruppe von Frauen schräg hinter uns. Das war die Belegschaft der Schokoladefabrik, unter denen sie noch etliche Freundinnen hatte. Deren Nachbarn wiederum waren die Zigarrendreherinnen. Die Zigarrenherstellung wurde gut bezahlt, erforderte jedoch viel Geschicklichkeit. Wer diese Kunst beherrschte, genoß eine Menge Ansehen. Aber diese großen Gruppen bildeten zusammen nur etwa die Hälfte der Kundgebungsteilnehmer. Die Lücken zwischen ihnen füllten die Mauerer und Zimmerleute der zahlreichen Baustellen, die Handwerker aus den kleinen Familienbetrieben der Stadt, die Verkäuferinnen, die Gärtner und die Tagelöhner. Hinzu kamen noch etliche Schaulustige. Während ich mich so umsah, breitete sich plötzlich eine Begeisterungswelle von der Bahnhofshalle beginnend aus. Ich reckte mich in die Höhe, vermochte jedoch noch nichts zu erkennen. Den Frauen in meiner Nähe ging es zweifellos kaum anders. Dennoch schlossen sie sich den Rufen an. Etwas später kam Bewegung in die Reihen der Maschinenbauer. Zwei kräftige Schlosser hoben einen Mann auf die Schultern und trugen ihn unter immer neuen, sich fortpflanzenden Beifallsstürmen durch die Menge. Für einen Moment sah ich ihn aus verhältnismäßig geringer Entfernung. Dabei bemerkte ich verwundert, daß er auf den ersten Blick kaum etwas 51 Besonderes an sich hatte. Er war schon ziemlich alt und wirkte ein wenig abgehärmt. Bei der Versammlung dann jedoch änderte ich meine Meinung über ihn. Seine kräftige Stimme, die Energie und Entschlossenheit die er ausstrahlte, als er auf der Bühne stand, die Klarheit, mit der er selbst komplizierte politische Zusammenhänge erläuterte, das alles überzeugte schließlich auch mich. Das großartige Gefühl jenes Nachmittags blieb nicht allzu lange erhalten. Im nun folgenden Jahrzehnt sollten sich die Ereignisse überschlagen, für die Welt und auch für unsere Familie. Spurlos ging sie jedoch nicht vorüber, die Zeit des Aufbruchs und der Illusionen. In gewisser Hinsicht reichen ihre Auswirkungen bis in unsere Tage hinein. Auch das gilt für die große Politik ebenso wie für die Schulzes und ihre Nachkommen. Emma lebte noch immer in Berlin. Dort lernte sie bei einer Tanzveranstaltung den Eisenbahner Gustav Schatz kennen. Gustav war ein attraktiver junger Mann, groß und kräftig, dunkelhaarig. Seine braunen Augen verliehen ihm eine vertrauenerweckende Ausstrahlung, ohne daß er etwas dafür tun mußte. Sein Temperament wiederum gab ihm einen Hauch südländischer Wesensart, wie viele Deutsche Frauen es mögen. Allerdings hätte die ordnungsliebende Emma sich wohl trotz allem nicht in ihn verliebt, wäre er nicht auch in der Lage gewesen, bei gegebenem Anlaß als ein Herr mit vorbildlichen Manieren aufzutreten. Das bewies er unter anderem, als sie ihn zum ersten mal mit nach Köthen brachte und unseren Eltern vorstellte. Da überreichte er Mutter einen gewaltigen Blumenstrauß und brachte sie durch seine zuvorkommende Art im Handumdrehen auf seine Seite. Damit war die Entscheidung gefallen. Emma pflegte nicht lange zu zaudern, wenn sie sich zu etwas entschlossen hatte. Bereits beim nächsten Besuch wurde ein Hochzeitstermin vereinbart. 52 Die beiden Verlobten bereiteten sich getrennt auf den großen Tag vor. Emma brachte ihre Wäsche und ihre Kleider in Ordnung, um nicht als schlechte Hausfrau dazustehen. Gustav deutete an, daß er sich etwas ganz Besonderes ausgedacht habe und daß alle staunen werden, verriet aber bis zuletzt nicht, worum es sich handelte. Um so größer war dann die Überraschung. Am Vorabend der Hochzeit präsentierte er seiner Braut eine vollständig eingerichtete Zweizimmerwohnung. Es fehlte an nichts - im Küchenschrank standen Töpfe und Pfannen, an den Wänden hingen Bilder, und die Betten im Schlafzimmer waren mit seidenen Decken überzogen. Gustav hatte sein ererbtes, kleines Vermögen dafür geopfert. Emma war überglücklich. Zur Hochzeit nach Berlin fuhren neben unseren Eltern auch Martha, Willi und ich. Max und Hedwig mußten zu Hause bleiben, um die Tiere zu versorgen. Wie schon bei der Wohnung sparte Gustav auch bei der Feier nicht. Sie war eines jener Ereignisse, über die wir redeten, wenn uns der Alltag aufs Gemüt drückte, und wir uns mit irgend einer angenehmen Erinnerung aufzumuntern versuchten. Martha mochte sich nicht so rasch festlegen wie ihre Schwester. Die Heirat mit Willi, über die nicht nur in der Familie sondern auch im Ort längst jeder sprach, schob sie immer wieder vor sich her. Sie zweifelte keineswegs daran, daß sie mit ihm den Mann fürs Leben gefunden hatte. In all ihren Zukunftsplänen kam er in ganz natürlicher Weise vor. Sie verspürte aber keine Lust, Ehefrau zu werden. Sie wäre sich gleich um zehn Jahre älter vorgekommen. Allmählich begann Mutter sie aber zu einer Entscheidung zu drängen. Da verschaffte ihr Willis Einberufung zum Militärdienst unverhofft Aufschub. Der Gestellungsbefehl wurde übrigens noch immer keinesfalls als Unglück angesehen. Noch immer wollte niemand an den nahenden Krieg glauben. Willi meldete sich freiwillig zur Marine. Wenn er in seiner schmucken Matrosenuniform zu Besuch kam, dann war Martha 53 mächtig stolz auf ihn, und ihre Freundinnen bestärkten sie darin mit ihrem unterschwelligen Neid. Bei der Frage "Glauben Sie an übernatürliche Dinge?" scheiden sich die Geister. Die einen behaupten, alles, was in der Welt geschieht, habe eine natürliche Ursache, und es gebe keinen Gott, keine Engel und keine Dämonen. Auch jede über die Aufnahmefähigkeit der bekannten Sinnesorgane hinausgehende Wahnehmung sei nichts als Betrug oder Einbildung. Die anderen verfechten ebenso vehement das glatte Gegenteil. Interessanter Weise hat die Wissenschaft den Streit nicht beigelegt sondern vielmehr mit neuen Argumenten auf beiden Seiten bereichert. Ich persönlich neige eher zu den Skeptikern, möchte mich aber an der Auseinandersetzung lieber nicht beteiligen, schon gar nicht in einem Bericht wie diesem. Immerhin wäre ja auch möglich, daß beide Parteien gleich weit von der Wahrheit entfernt sind. Wie können wir uns unserer Erkenntnisse denn so sicher sein, da doch fast täglich irgend etwas entdeckt wird, das zumindest auf einem begrenzten Gebiet alles bisher als wahr Geltende in Frage stellt? Auch in meinen Erinnerungen gibt es Ereignisse, die ich mir nicht erklären kann. Sie hängen fast alle mit Martha zusammen. Da sie meine Lieblingsschwester war, kannte ich sie so gut wie kaum einen Menschen sonst. Hin und wieder geschah es, daß sie plötzlich aufmerkte, als habe eine uns anderen verborgene Stimme sie gerufen. Sie wirkte einen Moment lang völlig verändert. Dann schreckte sie hoch wie aus einem Traum und murmelte ein paar Sätze, wobei sie selbst zu zweifeln schien an dem, was sich ihr da aufgedrängt hatte. Dann war sie wieder wie immer - fröhlich, aufmerksam und realistisch. Häufiger noch erschienen ihr derlei Gesichte in der Nacht. Zu diesen Geheimnissen um Martha gehört auch die folgende Episode. Eines Morgens sagte sie beim Erwachen: 54 "Ich habe heute Nacht geträumt, daß der Paul wieder bei uns ist." Das war eigentlich ein schöner Traum, doch niemand von uns vermochte, sich darüber zu freuen. Der Name unseres Bruders riß eine Wunde auf. "Ach, den Paul, den werden wir wohl niemals wiedersehen", erwiderte Mutter traurig. Paul hatte sich nach seiner Flucht vor dem hartherzigen Fleischermeister nicht wieder gemeldet. Seit acht Jahren war er verschollen, und jeder im Ort glaubte, er sei ausgewandert oder gar gestorben. So schob auch Martha den Gedanken an ihn wieder beiseite. Am Abend des selben Tages aber wurde sie plötzlich in Köthen auf der Flaniermeile von einem jungen Mann angesprochen. "Guten Abend, Martha!" Weil er ihr unbekannt vorkam, argwöhnte sie, jemand der ihren Namen durch irgend einen Zufall wußte, wollte mit ihr anbändeln. Sie ließ ihn einfach stehen. Er kam aber wieder. Da fragte sie, fast ein wenig grob: "Was wollen Sie denn von mir?" "Erkennst du mich denn nicht?" erwiderte er. Da erst sah sie ihn sich genauer an und - fiel ihm mit einem Freudenschrei um den Hals. Paul war tatsächlich zurückgekehrt. Aus dem kleinen, schmächtigen Jungen aber hatte sich ein großer, kräftiger Mann mit breiten Schultern entwickelt. "Wie werden sich unsere Eltern freuen!" rief Martha begeistert aus. "Komm! Laß uns gleich zu ihnen hingehen!" Er indes wehrte ab: "Ich kann doch jetzt dort nicht einfach so ins Zimmer treten, nach all den Jahren, nach allem, was geschehen ist!" "Natürlich kannst du das!" beharrte sie. "Du mußt sogar." Sie hängte sich an ihn und hielt ihn ganz fest, damit er ja nicht wieder davonliefe, und brachte ihn schließlich dazu, mit ihr nach Geuz hinüberzugehen. 55 Vater und Mutter lasen gerade Zeitung. Als die jungen Leute sie begrüßten, blickten sie nur kurz auf. Martha brachte öfter Freunde mit. Sie duldeten das, denn dadurch lernten sie den Umgang ihrer Tochter kennen und konnten einigermaßen kontrollieren, was sich da abspielte. Sie wurden erst aufmerksam, als der junge Mann mit Nachdruck sagte: "Guten Abend, Mutter!" Vater glaubte immer noch, ein Betrüger wollte ihn überlisten. Allmählich aber begriffen sie beide nun, daß ihr kleiner Paul sich tatsächlich so sehr verändert hatte. Später erzählte er uns von seinem Schicksal seit der Flucht aus Köthen. Zunächst war er nach Hamburg gefahren und hatte dort in einem Hotel gearbeitet, am Ende als Liftboy. Das befriedigte ihn aber nicht. Nach Feierabend blickte er oft im Hafen sehnsüchtig den Ozeanriesen nach, wenn sie in See stachen. Schließlich heuerte er auf einem Handelsschiff als Heizer an. Das war Knochenarbeit, und zudem fühlte er sich dort tief unten im Schiffsbauch wie ein Gefangener. "Wenn es ein Unglück gibt, ertrinken wir Heizer hier unten wie die Ratten", dachte er manches Mal bei sich. Wenn er aber in der Freizeit auf dem Deck stand, die herbe Meeresluft durch die Nase zog und den weiten Sternenhimmel betrachtete, dann sagte er sich: "Ich werde mich umsehen in der Welt, und ich werde Vater beweisen, daß ich nicht aus Feigheit ausgerissen bin." Er schwor sich, ein richtiger Mann zu werden, einer auf den die Eltern stolz sein könnten. Diesen Schwur vergaß er niemals während seiner Odyssee. Manchmal überkam ihn in den fremden Häfen der Wunsch, sich eines der hübschen Mädchen dort zur Frau zu nehmen und Deutschland den Rücken zu kehren. Sobald das Schiff dann aber ablegte, war er wieder an Bord. Nachdem er mit der Seefahrt aufgehört hatte, war er noch ein paar Jahre lang Bergmann gewesen - weil man dort viel Geld verdienen konnte, und weil er nicht arm und 56 abgerissen wie ein verlorener Sohn in seine Heimatstadt zurückkehren wollte. Nun hatte er sein Ziel erreicht. Seine Eltern sahen ihn mit anderen Augen. Er war nicht mehr der mißhandelte Junge, dessentwegen sie sich Vorwürfe machen mußten, sondern ein würdiger Schulzesohn. Vater und Mutter umarmten ihn noch einmal, und es fiel kein einziges Wort des Vorwurfs. Seit ich wieder in Köthen arbeitete, unternahm ich wie in der Kindheit vieles mit Martha gemeinsam. Die Zeit, da wir altersbedingt verschiedene Interessen gehabt hatten, war vorbei. Wir fühlten beide, daß uns nicht mehr viel Zeit blieb, um die Ungebundenheit zu genießen. So stürzten wir uns mit Heißhunger in alle Vergnügungen hinein, welche eine kleine Stadt wie Köthen uns bieten konnte. Sehr schnell fanden wir dabei Gleichgesinnte. Zu der Gruppe, der ich mich anschloß, gehörten je vier Jungen und Mädchen. Wir sahen uns nicht nur am Sonntag zum Tanzen sondern trafen uns auch noch einmal innerhalb der Woche. Einer der Jungen stellte seine Wohnung für diese geselligen Abende zur Verfügung. Er lebte mit seiner Mutter allein dort. Marthas Treue zu Willi stand dabei nie in Frage. Wenn er Urlaub hatte, brachte sie ihn mit. Kam sie ohne ihn, wußte sie immer genau, wie weit sie gehen durfte. Das respektierten auch die anderen. Jeder konnte sich leicht ausrechnen, daß er gegen den schmucken Matrosen wenig Chancen hatte. Es gab allerdings einen jungen Mann, der sich trotzdem um Martha bemühte. Willis kräftigen Fäuste konnten ihn zwar auf Distanz halten, nicht aber seine Hoffnungen zerstören. Mit einer Beharrlichkeit, wie sie sonst fast nur in Romanen vorkommt, wartete er auf den Tag, an dem sich seine Aussichten verbessern würden. Er gehörte nicht zu unserer Gruppe. Da er sich aber als Musiker recht und schlecht durchs Leben schlug, trafen wir ihn häufig bei den Tanzveranstaltungen. Übrigens war er Willi verblüffend 57 ähnlich, angefangen von den blonden Haaren über die blauen Augen bis hin zu der unbeschwerten, fast leichtsinnigen Art, durchs Leben zu gehen. Auch ich hatte bald einen Verehrer. Ich lernte ihn kennen, als er mit Paul an der Theke stand und ein Bier trank. Die beiden kannten sich von Hamburg her. Mein Bruder stellte uns beiden einander vor, und es entwickelte sich eine Liebelei von jener Oberflächlichkeit, wie sie in unserer Gruppe üblich war. Der junge Mann hatte einen etwas sonderbaren Namen - Ernst Max. Er war charakterlich ein ruhiger, fast zurückhaltender Typ, besaß aber viele Freunde. Wirklich ernst nahmen wir unsere Beziehung zu dieser Zeit beide nicht. Immerhin aber begleitete er mich ab und an von Köthen nach Geuz bis vor die Haustür. Das Nachhausegebrachtwerden hatte eine besondere Bewandtnis. Auf den am späten Abend stockdunklen Landstraßen und in den unübersichtlichen Parks spielten sich zuweilen gruselige Dinge ab. Manche Geschichten erzählte man sich nur, andere konnte man aber tatsächlich erleben. Wir Mädchen suchten also nicht nur Unterhaltung für den langweiligen Rückweg, sondern auch einen Beschützer. Als Martha einmal mit Willi auf einer Bank im Fasanenbusch saß, einer bei Verliebten sehr beliebten Grünanlage, da tauchte plötzlich aus dem Gebüsch ein Mann mit geschwärztem Gesicht auf. Er trug seine Schuhe in der Hand und hatte es offenbar sehr eilig. Nachdem er die beiden jungen Leute kurz starr angesehen hatte, verschwand er wieder in der Dunkelheit. Willi wollte ihn verfolgen, doch Martha hinderte ihn daran, um nicht allein zurückzubleiben. Mir und Ernst passierte es einmal, daß uns jemand von hinten ein Lasso überwarf. Wir konnten es rechtzeitig wieder abstreifen. Ob das nur ein Streich von Kindern war oder einen ernsteren Hintergrund hatte, fanden wir nie heraus. Wenn ich es gewollt hätte, wäre ich in den Genuß eines ganz besonderen Schutzes gekommen. Zu unserer Gruppe gehörte 58 auch ein wahrhaft hünenhafter Bursche mit Namen Fritz Heinemann. Sein Respekt war so groß, daß er mühelos Prügeleien schlichten konnte. Er nahm die Kampfhähne einfach beim Kragen und schüttelte sie durch. Zugleich aber war er gutmütig wie ein Bernhardiner. Dieser Fritz begann sich eines Tages für mich zu interessieren. Ich wollte ihn aber nicht, weil er nicht tanzen konnte und es auch nicht lernen wollte. Das war mir damals furchtbar wichtig. So nahm er sich an meiner Stelle eine andere und zog mit ihr fort. Erst Jahre später hörte ich durch Zufall wieder von ihm. Eine Frau aus dem Nachbardorf erzählte mir: "Oh, Heinemanns Fritz! Der ist jetzt unser Bürgermeister. Dem geht es gut. Der hat zwei gesunde Kinder und wohnt in einem wunderschönen Haus." Eine verpaßte Gelegenheit. Franz war inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt. Er arbeitete in Hannover bei einer Buchdruckerei, wo er sich in wenigen Jahren bis zum Abteilungsleiter hinaufgearbeitet hatte. In eine der ihm unterstellten Frauen verliebte er sich. Sie hieß Henny, war recht hübsch, hatte allerdings bereits ein uneheliches Kind. Sei es nun, daß er sich nach den Abenteuern der zurückliegenden Jahre nach Geborgenheit sehnte, sei es, daß ihm tatsächlich endlich die wirklich zu ihm passende Partnerin begegnet war - er verhielt sich diesmal anders als zuvor bei Hertha, Charlotte und den anderen Freundinnen, die er sich jeweils nur für eine mehr oder minder kurze Zeitspanne genommen hatte. Schon während seines ersten Besuchs bei Hennys Familie kam das Gespräch wie selbstverständlich auf das Thema Heirat, und Franz, der immer so sehr auf seine Freiheit bedacht gewesen war, ließ sich überrumpeln. Die Hochzeit fiel weit weniger prächtig aus als jene von Gustav und Emma, vielleicht weil die Brauteltern eingedenk des unehelichen Kindes Peinlichkeiten vermeiden wollten. Von den Schulzes fuhren lediglich die Eltern nach Hannover. Der 59 Ehe schadete das aber keineswegs. Franz zog sofort mit in die große Wohnung der Schwiegereltern und fühlte sich durchaus wohl dort. 60 3. Kapitel Liese erzählt Es war ein Sonntag, ein schöner Tag, ein ruhiger Tag. Willi hatte für eine Woche Urlaub bekommen und spielte mit Vater und Karl am Stubentisch Karten. Paul werkelte unten im Keller. Max, der sich seit seinem Mißerfolg am Gymnasium immer öfter absonderte, saß allein in der Küche und las in einem Buch. Martha hatte sich mit ihren Freunden auf der Köthener Flaniermeile verabredet, denn es war Anfang August, die beste Zeit also für die kleinen, wichtigen Abenteuer junger Mädchen. Auch ich wollte dorthin gehen. Weil ich mich aber zwischen zwei Kleidern nicht entscheiden konnte, wurde ich nicht fertig mit dem Anziehen. Wo Hedwig steckte, wußte niemand. Dreizehnjährig hatte sie inzwischen ebenso wie wir Geschwister ihre Geheimnisse. Mutter schließlich, die niemals sein konnte, ohne etwas Nützliches zu tun, besserte Kleider aus, wobei sie ihre verkrüppelte Hand erstaunlich geschickt zu gebrauchen wußte. Ab und an warf sie einen Blick hinüber zu den kartenspielenden Männern, denen sie übrigens ihren Müßiggang durchaus gönnte. Inmitten dieser friedlichen Stimmung wurde plötzlich die Tür aufgerissen. Martha kam hereingestürzt, blaß und in heller Aufregung. In der Hand hielt sie eine Zeitung. "Das Extrablatt!" keuchte sie, außer Atem vom schnellen Laufen. Fünf Augenpaare hefteten sich verwundert auf sie. "Was steht denn drin in dem Extrablatt?" Martha hatte sich ein wenig gefaßt, trat an Vater heran und breitete die Zeitung vor ihm aus. "Es ist Krieg!" Wilhelm las schweigend den Leitartikel. 61 "Warum nur?" sagte er schließlich und trat ans Fenster, so als hoffte er, draußen vor dem Haus die Antwort auf seine Frage zu finden. Er dachte angestrengt nach, wobei der Blick seiner klar-blauen Augen nicht nur bis zu dem Baum auf der Straße gerichtet war sondern sehr viel weiter. Kerzengerade stand er da wie ein Kapitän, der fühlt, daß sein Schiff unterzugehen droht, der ratlos ist und nicht frei von Schuldgefühlen aber entschlossen, auf der Kommandobrücke auszuharren bis zuletzt. Mit wieviel Hoffnung hatte alles angefangen, damals vor 24 Jahren nach den Sozialistengesetzen! Und wieviel war erreicht worden! Wilhelm hatte fest daran geglaubt, daß nichts mehr die neue Zeit würde aufhalten können. Eine Ära der Vernunft und der Eintracht, der Arbeit und der Gerechtigkeit! Und nun dieser Krieg! Was wird er übrig lassen von all dem so mühsam Errungenen? Martha war zu Willi gegangen und strich ihm zärtlich über den Kopf. "Du mußt jetzt zurück aufs Schiff, nicht wahr?" "Ja, sicher!" antwortete er gereizt. Die gedrückte Stimmung behagte ihm nicht. Sie widersprach seiner Natur, denn er war ein fröhlicher Bursche, der die traurigen Dinge gern rasch verdrängte. "Ach, was ihr nur gleich wieder denkt! Ja - es ist Krieg! Aber er muß ja nicht wieder so schlimm werden wie der von 1870. Der Spuk geht bestimmt in ein paar Wochen vorbei. Wir gewinnen und ..." "Gewinnen?" unterbrach ihn Karl, der sich wie unter Schock bisher nicht gerührt hatte, den Blick starr auf die Zeitung fixiert. "Gewinnen? Gegen wen denn? Du bekommst ein Gewehr in die Hand gedrückt, und damit sollst du dann auf Leute schießen, die du überhaupt nicht kennst, die dir nichts getan haben. Das kann doch nicht richtig sein!" Nun wußte selbst Willi nichts mehr zu entgegnen, und es breitete sich eine für alle nahezu unerträgliche Stille aus. 62 Durchbrochen wurde sie erst durch Mutter, die in ihrer praktischen Art die Flickarbeit beiseite legte und zum Schrank ging mit den Worten: "Es hilft ja alles nichts! Ich packe euch eure Sachen zusammen." Einige Tage nachdem Willi auf sein Schiff zurückgekehrt war, bekam Karl seinen Einberufungsbefehl. Paul, der noch nicht gedient hatte, sollte sich bei einer Ausbildungseinheit melden. Es nutzte ihm nichts, daß er sich versteckte. Die Gendarmerie suchte ihn, spürte ihn rasch auf und brachte ihn auf direktem Wege in die Kaserne. Neben Max, der noch zu jung war, blieb von den Schulzesöhnen lediglich Franz verschont, wegen seiner starken Kurzsichtigkeit. Der Krieg brauchte Soldaten, Tausende und Abertausende in kürzester Zeit. Noch im August unternahmen fünf deutsche Armeen den sogenannten "Schwenkungsangriff" durch Belgien nach Frankreich. Anfang September tobte die Schlacht an der Marne. Die Angehörigen im Hinterland litten währenddessen unter der ständigen Ungewißheit. Die Feldpostbriefe trafen unregelmäßig ein und enthielten - der Geheimhaltung wegen - oft nur unbestimmte Angaben. Die Siegesmeldungen, die bis in den Herbst hinein noch reichlich eintrafen, konnten uns nicht recht freuen, denn jeder gewonnene Hektar Land vergrößerte die Zahl der Gefallenen. Endlich traf wenigstens von Karl ein Lebenszeichen ein. Er schrieb: "Liebe Eltern, liebe Geschwister! Es geht mir gut. Morgen werden wir an die Westfront verlegt. Wenn ihr lange nichts mehr von mir hört, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Es wir alles gut." Das war eine rätselhafte Nachricht. Offenbar wollte er uns zwischen den Zeilen irgend etwas mitteilen, was er nicht offen ausdrücken durfte. Martha vermutete, er plane, sich gefangen nehmen zu lassen, und erinnerte uns daran, wie er auf die Nachricht vom Kriegsausbruch reagiert hatte. Aber das war nur 63 eine Spekulation. Wir hörten tatsächlich lange Zeit nichts mehr von ihm. Je mehr sich das Jahr seinem Ende entgegenneigte, desto deutlicher zeigte der Krieg sein wahres Gesicht. Auch an Willi ging er nicht so vorüber, wie er erwartet hatte. Eine erste Seeschlacht fand bei Helgoland statt. Bei den Falklandinseln gingen am achten Dezember die Kreuzer "Karlsruhe", "Emden" und "Königsberg" verloren. Auf dem Lande kam unterdessen der deutsche Angriff zum Stehen. Unter gewaltigen Opfern versuchte von nun an mal die eine, mal die andere Seite irgend einen strategisch wichtigen Berg oder irgend ein Dorf zu erobern. Durch den Krieg wurde alles anders, vor allem natürlich für die jungen Männer, die ihr Leben aufs Spiel setzen mußten, aber auch für uns jungen Mädchen, die wir im Hinterland bleiben konnten und von den schrecklichen Geschehnissen an der Front nur aus der Zeitung erfuhren. Die Zeit unbeschwerter Vergnügungen war vorbei. Ich hatte das Glück, daß mein Liebster noch nicht die Uniform trug. Doch das bedeutete nur Aufschub. Ernst war gesund und mußte täglich mit der Einberufung rechnen. So bekamen die Stunden, die wir miteinander verbrachten, ein ganz anderes Gewicht. Wir alberten seltener, redeten dafür öfter über wichtige Dinge. Als Ernst den Weg ins Dessauer Ausbildungslager antrat, waren wir ein vertrautes Paar und schworen uns, spätestens nach dem Krieg zu heiraten. Da wußten wir noch nicht einmal, daß sich dafür neben unserer Zuneigung noch ein zusätzliches Motiv anbahnte. Jetzt wird es Zeit, daß ich die Familie meines späteren Ehemanns beschreibe. Sein Vater Friedrich Max hatte sich als Beamter bei der Bahn zu einem verhältnismäßig hohen Posten hinaufgearbeitet und galt bereits als ein angesehener Mann, als er sich entschloß zu heiraten. Deshalb waren alle, die ihn kannten, sehr verwundert, als er sich - anstatt auf eine gute Partie zu warten - für die mittellose und zudem bescheidene, 64 unauffällige Marie Ziegenhals entschied. Er hatte sich aber durchaus überlegt, was er tat. Ihm ging es nicht um Reichtum sondern um ein bequemes Leben. Die kleine, zierliche Frau war ohne Mutter unter der Zucht eines strengen Vaters aufgewachsen. Friedrich fiel es nicht schwer, sie sich zu unterwerfen und fortan zumindest in seiner Wohnung zu regieren wie ein orientalischer Pascha. Für Marie brachte die Ehe wenig Gutes. Die vier Söhne, die sie ihrem Mann gebar, nahmen, von ihrem Vater darin bestärkt, die Wohltaten, die sie empfingen, mit gleichgültiger Gelassenheit hin. Nur einer von ihnen war zarteren Gemüts und fühlte, daß er seiner Mutter Dank schuldete. Als einziger überraschte er sie zu ihrem Geburtstag und zu Weihnachten mit kleinen Geschenken. Schon äußerlich unterschied er sich von Mariens anderen Söhnen. Er hatte ein zartes Mädchengesicht, feingliedrige Hände und dunkle, verträumte Augen. Als der Krieg begann, war Paul - er trug den selben Namen wie mein Bruder - knapp neunzehn Jahre alt. Er wurde sofort einberufen und nach einer kurzen Ausbildung an die Westfront geschickt. Von dort traf wenige Wochen später die Nachricht ein: "Auf dem Felde der Ehre gefallen." Als Marie die lakonische Mitteilung las, verzog sie keine Miene. Sie weinte nicht, erledigte ihre Arbeit wie sonst und legte sich ins Bett, als wäre nichts geschehen. Über Nacht aber wurden ihre dunklen Haare vollständig weiß. Auch die Schulzes bekamen die Schrecken des Krieges zu spüren. Auch sie erhielten nach den Schlachten des Herbstes eine jener patriotisch-verlogenen Todesbotschaften. Unser Karl war "für Kaiser und Vaterland" in Frankreich gestorben. Über die Umstände seines Todes erfuhren wir allerdings zunächst nichts. Die amtlichen Stellen verweigerten uns jede Auskunft. Gegen Ende des Jahres 1914 kehrten die ersten Soldaten von der Westfront für ein paar Tage Erholung in die Heimat zurück. Sobald sie die Straße betraten, wurden sie umringt und 65 mußten unzählige Fragen beantworten, denn Tausende wollten so wie wir etwas über das Schicksal verschollener Söhne oder Brüder erfahren. Auf diesem Wege gelangte auch die Wahrheit über Karl zu uns. Er hatte sich an seinen Schwur gehalten und tatsächlich niemals auf einen Menschen geschossen. Als man seine Einheit an die Front verlegte, unternahm er einen Fluchtversuch. Zu seinem Unglück lief er dabei jedoch einer Patrouille in die Arme. In normalen Zeiten wäre er nun als Vaterlandsverräter vor ein Kriegsgericht gestellt worden. Da die Front indes jeden Mann brauchte, versetzte man ihn in eine Strafkompanie. Deren Aufgabe bestand darin, in vorderster Linie nach Minen zu suchen. Bei einem der Einsätze wurde er in Stücke gerissen. In die Statistik ging er als Held ein. Fahnenflüchtige konnte die Propaganda nicht gebrauchen. Von Paul wußten wir monatelang noch weniger. Wir erhielten keinen Brief von ihm, aber es deutete auch nichts eindeutig darauf hin, daß er nicht mehr leben würde. Hin- und hergerissen zwischen Bangen und Hoffnung fragten wir jeden Uniformierten, dem wir begegneten. Niemand wußte etwas von einem Paul Schulze. Dann hörte ich beim Einkaufen zufällig, wie sich zwei Frauen über ihn unterhielten. Ich stellte mich sofort zu ihnen und erfuhr so, wie es ihm ergangen war. Nach Abschluß der Ausbildung brachte man die frisch zusammengestellte Einheit mit der Bahn bis wenige Kilometer vor die Front. Offensichtlich war die Truppenbewegung jedoch von gegnerischen Aufklärern bemerkt worden. Kaum hatte der Zug den Behelfsbahnhof erreicht, da setzte heftiger Granatenbeschuß ein. Mehr als die Hälfte der Soldaten fand keine Zeit mehr, sich in Sicherheit zu bringen. Die Waggons zersplitterten. Zentnerschwere, stählerne Achsen wirbelten wie Kreisel durch die Luft. Ein Hagel von Einschlägen wühlte die Erde um. In diesem Inferno ging jede Ordnung verloren. Die Sanitäter waren hoffnungslos überfordert und rannten - selbst halb irre vor Angst - kopflos umher. Paul blieb mit 66 aufgerissenem Bauch liegen. Er starb einsam unter unsäglichen Schmerzen. Pauls Tod traf unsere Eltern besonders hart, denn sie hatten ihn gewissermaßen ein zweites Mal verloren. Einmal wurde ich im Nebenraum zufällig Zeuge eines Gesprächs zwischen beiden. "Warum nur trifft es uns schon wieder?" fragte Vater. "Vielleicht, weil du nicht zur Kirche gehst", versetzte Mutter. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte Vater darauf wohl mit einer ironischen Bemerkung reagiert. Vielleicht wäre er sogar ärgerlich geworden. Diesmal jedoch blieb er nachdenklich. "Nein, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube also auch nicht daran, daß er uns bestrafen kann. Die Frage war dumm gestellt von mir. Der Zufall ist blind. Aber vielleicht hätten wir mehr für unsere Kinder tun müssen, solange sie noch am Leben waren. Verstehst du, was ich meine, Auguste? Wir dachten immer: Sie sollen es einmal besser haben als wir. Nun sind sie tot, und es nutzt ihnen nichts mehr, wenn es den Schulzes eines Tages einmal so richtig gut gehen sollte." "Was willst du? Sie hatten satt zu essen. Sie hatten ordentliche Kleidung. Sie brauchten sich nicht zu schämen." "Vielleicht reicht das nicht. Erinnerst du dich denn nicht mehr? Paul ist nicht zu uns gekommen, als er nicht mehr weiter wußte. Er hat uns nicht vertraut. Auch später, als Matrose ist er uns nicht besuchen gekommen." "Er hatte eben seinen Stolz." "Ja - der verdammte Stolz der Schulzes! Wir wollen immer vorn mit dabei sein, immer zu den Besten gehören, keine halben Sachen machen. Keiner von uns wird je eine Schwäche zugeben. Wir beiden haben uns niemals beklagt, und unsere Kinder tun es auch nicht. Hoffentlich wird uns das nicht eines Tages zum Verhängnis. Der Stolz hat nämlich bösartige Geschwister - Einsamkeit, Kälte, Machtbessenheit ..." Er seufzte, und damit war das Gespräch beendet. 67 Je mehr der Krieg sich in die Länge zog, desto mehr geriet auch das Hinterland mit in seinen Strudel hinein. Gustav, Emmas Mann, hatte es dabei noch recht gut. Weil er als Eisenbahner unabkömmlich war, brauchte er nicht an die Front. Seine Arbeit veränderte sich kaum, sieht man einmal davon ab, daß er jetzt hauptsächlich für den Transport von Soldaten, Waffen und Munition Sorge trug. Auch Vater arbeitete weiter in seinem Beruf, denn die Kriegsindustrie brauchte neue Werkhallen, und für die Gefangenen mußten Unterkünfte aus dem Boden gestampft werden. Aber er hatte keine Freude daran. Zum einen war ihm der Verwendungszweck seiner neuen Häuser zuwider, zum anderen litt er darunter, daß er wegen der irrwitzig kurzen Termine statt der in Köthen fast sprichwörtlichen Schulzeschen Qualität nur noch Pfusch übergab. Max wurde in den etwa fünfzehn Kilometer von Köthen entfernten Braunkohlentagebau von Edderitz dienstverpflichtet. Dort mußten die Halbwüchsigen an die Stelle der zur Front geschickten Männer treten. Wie es ihm dort erging, das weiß ich nicht genau, denn er redete kaum noch mit uns. Sicher fiel ihm die schwere Arbeit nicht leicht, denn er war zwar groß, aber schlank und keineswegs so kräftig wie seine Brüder. Sicher fühlte er sich auch nicht glücklich, wenn er zum Feierabend in die als Unterkunft dienenden, überfüllten Baracken zurückkehrte. Alles in allem aber biß er sich offenbar recht tapfer durch. Ich arbeitete zu dieser Zeit in der Köthener Maschinenfabrik, in der nun Granaten gedreht wurden. Die monotone Arbeit, bei der wir nicht reden durften, bedrückte mich sehr, denn während meine Hände wie im Reflex immer wieder die selben Bewegungen ausführten, war der Kopf frei für endlose Grübeleien. Was tat Ernst gerade? Dachte er oft an mich oder nur manchmal? Hatte man ihn womöglich schon an die Front versetzt? Wird er sich freuen, wenn er erfährt, daß ich ein Kind von ihm erwarte? Oh, dieses Kind! Warum mußte es 68 ausgerechnet in diesen schlimmen Zeiten auf die Welt kommen wollen?! Noch wußte niemand von meiner Schwangerschaft. Wie lange aber würde sie sich noch verheimlichen lassen? Dabei war es nicht einmal die "Schande", vor der ich mich fürchtete. Ich hatte vor allem Angst, sitzengelassen zu werden und dann blamiert wie ein dummes Ding dazustehen. Am schlimmsten freilich traf es Martha. Sie mußte in einer Fabrik arbeiten, die mit hochgiftigen Chemikalien Schwarzpulver produzierte. Ihr schönes, schwarzes Haar bekam eine eigenartige, rötliche Färbung. Dann begann sie zu husten, und schon nach zwölf Wochen war sie ernsthaft krank. Sie magerte in erschreckendem Tempo ab und spuckte Blut. Spätestens nun wußte Vater , daß ihn der Krieg ein drittes Kind kosten würde, wenn er nichts unternähme. Es war ein harter Kampf, den er nun auszutragen hatte, denn den Behörden galt ein Menschenleben nicht mehr gar zu viel. Er ließ aber nicht locker und erreichte endlich die Dienstentbindung aus gesundheitlichen Gründen. Martha durfte zurückkehren in die Farbenfabrik Musche, wo sie sich zum Glück rasch wieder erholte. Von Willi trafen mit erstaunlicher Regelmäßigkeit Briefe ein, in denen er versicherte, daß es ihm gut gehe, daß er mit einem baldigen Kriegsende rechne, und natürlich daß er immerzu an seine daheimgebliebene Liebste denke. Das war immerhin ein Trost. Dennoch litt Martha unter der Einsamkeit. Das wiederum hatte ihr Verehrer, dem es irgendwie gelungen war, sich sowohl vor dem Soldatsein als auch vor dem Arbeitsdienst zu drücken, schon bald erkannt. Und diesmal war er erfolgreich. Ohne daß ihr dabei einfiel, ihrem Willi wirklich untreu zu werden, klammerte Martha sich mehr und mehr an diesen Lebenskünstler fest. In einem Kriegswinter, in dem alle nur noch von Tod und Verwundung redeten, riß er unbekümmert seine Witze wie eh und je. Seine Unbeschwertheit hielt sie für Optimismus. 69 Eines Tages aber nahm Vater sie sich zu einem Gespräch unter vier Augen beiseite. Zweifellos sagte er ihr dabei nicht viel mehr, als ihr andere zuvor schon oft genug gesagt hatten. Was sie denn suche bei solch einem Bruder Leichtfuß. Ob sie nicht zu alt sei für derlei Kindereien. Ob sie für die Albernheiten eines dummen Jungen ihr Glück aufs Spiel setzen wolle. Wenn Vater das sagte, war das jedoch etwas ganz anderes, zumindest für Martha, die ihn mehr liebte als jeden anderen sonst. Schon am nächsten Wochenende erklärte sie ihrem Verehrer, daß aus ihm und ihr nie ein Paar werden könne, und daß es deshalb besser sei, erst gar nicht miteinander anzubändeln. Er nahm das zwar nur als weiteren Aufschub seiner Pläne zur Kenntnis, bedrängte sie aber in der Folgezeit nicht mehr gar so sehr. Am 24. Januar des neuen Jahres erhielt Martha von ihrem Willi Glückwünsche zum Geburtstag. Bis dahin waren allerdings noch immerhin sechs Tage Zeit. Er entschuldigte sich damit, daß er wahrscheinlich in der kommenden Woche keine Gelegenheit zum Schreiben haben werde und lieber zu früh als zu spät gratulieren wolle. Als Martha Tags darauf zur Arbeit in die Farbenfabrik ging, empfing sie ihr Chef bereits am Werkstor. "Haben Sie das Extrablatt schon gelesen?" fragte er. "Nein", entgegnete sie zögernd. "Warum?" "Gehen Sie zum Zeitungsverlag! Dort hängt es aus." "Jetzt gleich? Sie meinen ... ?" "Gehen Sie nur! Ich stelle Sie für heute frei." Es kam selten vor, daß jemand von der Arbeit freigestellt wurde, obwohl er gesund war. Dafür mußte ein gewichtiger Grund vorhanden sein. Martha lief die Strecke bis zum 70 Verlagsgebäude so schnell, daß sie ganz außer Atem kam. Schon von Weitem sah sie, daß sich vor den Schaukästen eine ungewöhnlich große Menschenmenge drängte. Als jemand die junge Frau erkannte, ging ein Tuscheln durch die Reihen. Dann gaben die Leute ihr den Weg frei. Spätestens jetzt bestand kein Zweifel mehr, daß sie unmittelbar betroffen war von dem, was sich da ereignet hatte. "Panzerkreuzer Blücher gesunken!" konnte Martha noch lesen, dann wurde ihr schwindlig. Trotz des Todes ihrer beiden Brüder hatte sie niemals für möglich gehalten, daß es auch Willi eines Tages treffen könnte. Zu optimistisch waren seine Briefe immer gewesen. Die ab und an in ihr aufflammende Angst hatte sie jedes mal verdrängt. Nun half kein Selbstbetrug mehr. Wie sie nach Hause gekommen war, konnte sie später nicht mehr sagen. Erst am Abend fühlte sie sich stark genug, um sich den Hergang erzählen zu lassen. Vater hatte inzwischen Einzelheiten erfahren. An der Doggerbank, einer etwa dreißig Kilometer langen und hundert Kilometer breiten Untiefe mitten in der Nordsee, ankerte ein größerer englischer Flottenverband. Die deutsche Admiralität faßte daraufhin den Beschluß, diesen Verband überraschend anzugreifen und zu vernichten. Der Funkspruch, der den entsprechenden Befehl an die Schiffe weiterleitete, wurde jedoch abgehört und entschlüsselt. Die Engländer hatten dadurch genügend Zeit, sich in Schlachtordnung aufzustellen und Verstärkung heranzuführen. Das Überraschungsmoment in der Seeschlacht lag also nicht wie geplant auf der Seite der Deutschen sondern auf der ihrer Gegner. Der Angriff wandelte sich rasch in ungeordnete Flucht. Während die kleineren und wendigeren Kreuzer mit knapper Not entkamen, wurde die "Blücher", das schwer gepanzerte Flaggschiff des Verbandes, von mehreren Torpedos und Dutzenden Granaten getroffen. Zu allem Unglück war die Nordsee an diesem Tag stürmisch. Das Schiff sank derart schnell, daß nicht einmal mehr Zeit blieb, die Rettungsboote 71 ins Wasser zu lassen. Es gab keinerlei Versuche, die Matrosen zu retten. Wahrscheinlich wäre angesichts des eiskalten Wassers ohnehin jede Hilfe zu spät gekommen. Von den über 900 Besatzungsmitgliedern überlebte kein einziger. In Frankreich standen sich die Heere Anfang 1915 in einer völlig festgefahrenen Frontlage gegenüber. "Im Westen nichts Neues" hieß es dazu in den Zeitungen. Aber das war eine Lüge. Der Krieg brachte Woche für Woche perversere Waffen hervor. Die Hirne größenwahnsinniger Generäle und Staatenlenker erdachten sich immer skrupellosere Methoden, um das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden. Hatte Europa nach dem Jahrhundert der Aufklärung die Barbarei des Feudalzeitalter für immer überwunden gewähnt, stand im Frühling diesen Jahres aller moralischer Fortschritt wieder in Frage - bei Ypern, als zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ein Massenvernichtungsmittel zum Einsatz kam. Nach Ansicht mancher Wissenschaftler und auch mancher Künstler war es der Chemie vorbestimmt, der Motor des Fortschritts zu sein, des Wirtschaftlichen wie auch des Gesellschaftlichen. Nun hatte sie für alle Zeit ihre Unschuld verloren. Eine weitere Illusion war zerplatzt in diesem unseligen Krieg. Im Osten, wo inzwischen auch Ernst kämpfte, unternahmen die Deutschen gemeinsam mit ihren Verbündeten aus Österreich nach einem Erfolg in der Schlacht bei Tarnów und Gorlice eine Offensive auf breiter Front. Die freilich blieb stecken, so daß auch auf diesem Kriegsschauplatz keine Entscheidung fiel und kein rasches Ende des Sichabschlachtens zu erhoffen war. Eine der selten gewordenen Gründe zur Freude für unsere Eltern war die Geburt ihres ersten Enkelkindes. (Charlottes Sohn, den sie kaum kennengelernt hatten, zählten sie nicht.) Emma war Mutter eines Mädchens geworden, eines ungewöhnlich niedlichen Babys mit großen, dunklen Augen, das jeder, der es sah, sofort ins Herz schloß. Es erhielt den 72 Namen Gretchen. Als meine Schwester mit der etwa ein dreiviertel Jahr alten Kleinen zum ersten Mal zu Besuch nach Geuz kam, kannte das Glück keine Grenzen. Ein so wunderschönes Kind in so häßlicher Zeit erschien uns wie ein Wunder, wie ein unerklärliches Leuchten in einer verfinsterten Welt. Solche Worte klingen heute ein wenig theatralisch, wir dachten damals aber wirklich so. Auch nachdem die beiden wieder abgereist waren, schwang dieses Gefühl noch in uns nach. Lediglich Martha vermochte sich nicht zu freuen. Sie geriet wieder in jenen Zustand, bei dem sie wie von einer fremden Macht gesteuert wirkte. "Ich bin ganz unruhig", erklärte sie auf unsere besorgten Fragen hin. "Es muß etwas geschehen sein, irgend etwas mit Emmas Mädchen." Am nächsten Tag traf die Nachricht von Gretchens Tod ein. Emma hatte etwas zu erledigen gehabt. Wie schon mehrmals zuvor gab sie das Baby für diese Zeit zu einer Nachbarin, die ihm Kartoffelpuffer fütterte. Als Emma nach ein paar Stunden ahnungslos zurückkehrte, übergab sich die Kleine und litt unter Erstickungsanfällen. Ihr Zustand verschlimmerte sich bltzschnell. Auf dem Wege zum Arzt starb sie. Die wahre Todesursache wurde nie geklärt. Gretchen hatte den Kartoffelpuffer fast ohne zu kauen heruntergeschlungen. Vielleicht war er ihr deshalb nicht bekommen. Vielleicht stimmte etwas mit den Zutaten nicht. Auf dem Totenschein stand lediglich "Zahnkrämpfe", eine damals weitverbreitete Floskel, die nichts aussagt. Daß bereits ein weiteres Enkelkind unterwegs war, wußten meine Eltern da noch nicht. Bald aber konnte ich mein Geheimnis beim besten Willen nicht mehr für mich behalten. Ich wunderte mich ohnehin schon, daß meinen Zustand noch niemand bemerkt hatte. Wohl oder übel mußte ich also beichten. Hinterher war ich verblüfft, wie gelassen Vater und Mutter reagierten. Auch meine zweite Befürchtung, nämlich 73 daß Ernst mich verlassen würde, traf zum Glück nicht zu, wenngleich er nicht gerade in Begeisterung ausbrach. Am ersten Juni gebar ich einen Jungen, der auf Mutters Vorschlag hin den Namen Rudolf erhielt. Im Alltag nannten wir ihn kurz Rudi. Ernst war zu dieser Zeit in der Garnison von Danzig stationiert. Weil in Deutschland alles seine Ordnung braucht, befahl man ihn in voller Dienstuniform zum Standesamt, um dort in aller Form die Vaterschaft anzuerkennen. Es war typisch für die Verhältnisse in der Familie Max, daß Marie von der Geburt ihres Enkelkindes, ja über die Existenz einer festen Freundin ihres Sohnes, erst durch Zufall über Dritte erfuhr. Sie zögerte nun keine Minute mehr, um nach der Familie ihrer künftigen Schwiegertochter zu suchen. Als sie den kleinen Rudi zum ersten Mal sah, meinte sie unwillkürlich: "Wie unser Paul als Baby." So hatte sie ihn auf Anhieb lieb, und das blieb auch so. Etwas später lernten meine Eltern auch Friedrich, den Vater meines Freundes kennen. Dabei vereinbarten sie, mich und Ernst so schnell wie möglich miteinander zu verheiraten. Obgleich sie uns unsere Voreiligkeit niemals vorwarfen, wollten sie doch vermeiden, in dem kleinen Ort gar zu sehr ins Gerede zu kommen. Die Formalitäten waren schnell erledigt. Ernst bekam ein paar Tage Sonderurlaub zugesprochen. Dann gaben wir uns auf dem Standesamt das Jawort und besiegelten den Bund mit einem kleinen Essen im Kreise der beteiligten Familien. Das alles war zwar durchaus feierlich, aber keinesfalls so erhebend, daß die Erinnerung daran lange wach bleiben konnte. Mir erschien das alles viel zu nüchtern. Wenn ich schon meine Freiheit aufgab, so sollte das wenigstens mit irgend etwas Besonderem verknüpft sein. Schließlich setzte ich mir in den Kopf, Ernst noch ein zweites Mal zu heiraten - in der Kirche. Dabei konnte ich freilich nicht auf die Unterstützung meiner Eltern rechnen. Vater war aus Prinzip gegen alles 74 Religiöse, und Mutter ordnete sich ihm unter. So ging ich denn also persönlich zum Pfarrer und überredete ihn mit hundert guten Worten, uns wider jede Bestimmung ohne Aufgebot von einem Tag zum anderen einen Termin zu geben. Am nächsten Morgen schlichen wir uns wie zu einer krummen Tour heimlich aus dem Haus, Ernst in seinem Alltagsanzug, ich in einem gewöhnlichen Sonntagskleid. In der Kirche gab es weder Trauzeugen noch sonstige Gäste. Nachdem der Pfarrer uns vermählt hatte, spielte der Organist uns einen Choral. Das war schon die ganze Zeremonie. Dennoch freute ich mich. Ich hatte meinen Willen durchgesetzt. War während der erfolgreichen Offensive in Belgien noch bei einem Teil der Bevölkerung ein gewisses Maß an Kriegsbegeisterung vorhanden gewesen, bei der Mehrheit zumindest Einsicht in die Notwendigkeit des Angriffs, so sank jetzt, achtzehn Monate später, die Stimmung spürbar. In den Zeitungen standen kaum noch Erfolgsmeldungen, dafür fast täglich lange Listen mit Namen gefallener Soldaten. Tanzveranstaltungen wurden verboten, die Säle zu Lazaretten umfunktioniert. In einem dieser neuen Lazarette meldete ich mich als Küchenhilfe. Für die Verwundeten - es waren mehrere hundert allein dort - mußten frühmorgens Brote geschmiert und abends Suppen gekocht werden. Die Chefin, eine ehemalige Gastwirtin, die bei ihrer neuen Aufgabe die Nächstenliebe mit einem gerüttelt Maß Geschäftsinteresse verband und sich binnen weniger Monate ein Vermögen verdiente, achtete streng darauf, daß sich ihre Untergebenen nicht dem Müßiggang hingaben. Sie duldete auch keinen engen Kontakt zu den Verwundeten. Mit mir war sie offenbar zufrieden, denn sie steckte mir ab und zu abgezweigte Lebensmittel zu, ließ mich also gewissermaßen teilhaben an ihrem Glück. In der Tat war diese Zusatzration ein nicht zu unterschätzendes Privileg. Die 75 Versorgung funktionierte längst nicht mehr so wie vor dem Krieg. Durch die Arbeit im Lazarett konnte ich mich um Rudi nur abends und am Sonntag kümmern. In der übrigen Zeit blieb er Mutters Obhut überlassen. Das wiederum war nur möglich, weil sich Hedwig, nachdem sie die Schule verlassen hatte, mit einer Halbtagsstelle begnügte und so weiterhin im Haushalt helfen konnte. Über fast fünfzehn Jahre hinweg war die Aufgabe, Mutter gewissermaßen die Hand zu ersetzen, einem Staffelstab gleich von einem Geschwisterkind zum anderen gewandert. Nun blieb sie bei der jüngsten Tochter hängen. Man könnte freilich auch sagen, daß sie auf diese Weise Mutters Nachfolge antrat. Tatsächlich sollte die kleine, eher unscheinbare Hedwig mit ihrer späteren Familie die Chronik der Schulzes und ihrer Nachkommen wesentlich mitbestimmen. Dabei blieb vieles nicht so wie es einmal war, und es wurde auch anders, als Vater es sich erträumt hatte. Doch das gehört schon ins nächste Kapitel hinein. Das Jahr 1916 war das schrecklichste des ganzen Krieges - nachdem die Menschen schon geglaubt hatten, die Greuel der zurückliegenden Monate ließen sich gar nicht mehr steigern. Am 21. Januar begann die Schlacht um Verdun. Sie dauerte volle fünf Monate und forderte unzählige Opfer auf beiden Seiten. Ebenso lange und kaum weniger erbittert wurde an der Somme gekämpft. Auf See verlegte man sich nach dem unentschieden endenden Gefecht vor dem Skagerak auf den heimtückischen Minen- und U-Bootkrieg. Es gab kaum noch Familien, die nicht wenigstens einen ihrer Angehörigen verloren hatten. Und noch immer war kein Ende abzusehen. 76 In jenem Jahr gebar Emma ihren Sohn Werner. Wir alle hatten nun natürlich Angst, daß ihm ein ähnlich trauriges Schicksal widerfahren könnte wie seiner Schwester. Die Sorge war nicht unbegründet. In den Geschäften gab es fast nur noch minderwertige oder gestreckte Lebensmittel. Wie konnten die Eltern da sicher sein, daß sie ihr Kind nicht mit dem Breichen vergifteten? Diesmal jedoch hatten die Schulzes endlich wieder einmal ungetrübtes Glück. Das Baby entwickelte sich trotz aller widriger Umstände gut. Martha erholte sich allmählich von dem nach Willis Tod erlittenen Schock und gewann ihren Charme zurück. Da sie an Schönheit ohnehin kaum eingebüßt hatte, geschah es schon bald, daß sich wieder ein Mann, der auch ihr gefiel, in sie verliebte. Er hieß Karl Poschke und gehörte zu den wenigen Glücklichen seines Alters, die selbst jetzt, da die Behörden kaum noch Hinderungsgründe anerkannten, nicht an die Front geschickt wurden. Er war ein so ausgezeichneter Facharbeiter, daß die Rüstungsfirma, die ihn eingestellt hatte, auf ihn nicht verzichten wollte und sich für ihn einsetzte. Nunmehr galt Martha im Ort nicht mehr länger als bedauernswertes Geschöpf sondern ganz im Gegenteil als Glückspilz. So schnell kann die Meinung der Leute umschlagen! Sie wurde plötzlich nicht mehr bedauert sondern regelrecht beneidet. Immerhin waren junge Männer knapp geworden in Deutschland. Kämpften sie nicht als Soldaten in Frankreich, in Rußland oder bei der Marine auf hoher See, dann hatten sie zumeist ein Gebrechen. Dem einen fehlte ein Arm, dem anderen ein Bein. Wieder andere hatten ihr Augenlicht verloren. Es gab folglich allen Grund für unsere Eltern, den neuen Bekannten ihrer Tochter freundlich aufzunehmen. Das taten sie dann auch. Vater meinte, es sei ein gutes Zeichen, daß es nun wieder einen Karl in der Familie gäbe, ein Zeichen dafür nämlich, daß das Leben weitergeht trotz Krieg. Von einer schnellen Heirat allerdings wollte Martha nichts wissen. Die 77 Erinnerung an Willi sei noch immer zu lebendig. Karl hatte Verständnis dafür und versprach zu warten. Die Kämpfe der deutschen Truppen an der Ostfront im Jahre 1916 gingen als die erste bis vierte Brussilow-Offensive in die Geschichte ein. Sie brachten Geländegewinne, weil das Russische Heer demoralisiert auseinanderzubrechen begann. Letztlich aber war das für den Kriegsausgang belanglos. Die Ostfront verlor zu Gunsten der Westfront zunehmend an Bedeutung. Eine Einheit nach der anderen wurde verlegt, schließlich auch jene, zu der Ernst gehörte. In Frankreich geriet er bald mitten in ein mörderisches Gefecht hinein. Gleich zu Beginn bekam er bei einem Erkundungsgang einen Beinschuß. Die Wunde wurde von den Sanitätern der vordersten Linie verbunden. Es gab aber zunächst keine Möglichkeit, die Verletzten nach hinten in Sicherheit zu bringen. Ernst mußte also mit den anderen im Schützengraben bleiben. Als dieser Graben unter heftigem Granatenbeschuß einstürzte, gelang es ihm im Unterschied zu seinen Kameraden nicht mehr, rechtzeitig herauszuspringen. Er wurde verschüttet und erlebte die wohl schlimmsten Stunden seines Lebens. Man fand ihn erst bei Anbruch der Dunkelheit, als die Kämpfe abgeflaut waren und Suchtrupps das Gelände durchstreiften. Allerdings rettete ihm sein vermeintliches Unglück wahrscheinlich das Leben. Von seiner Kompanie kehrte nicht ein einziger in die Heimat zurück. In seiner Meinung über den Krieg erinnerte Ernst mich an meinen gefallenen Bruder Karl. Allerdings ging er nicht das Risiko einer Fahnenflucht ein, sondern verweigerte sich so, daß die Offiziere es nicht merkte, zum Beispiel indem er beim Schießen absichtlich falsch zielte. Er sah nie einen Sinn in den Kämpfen und dachte weit mehr ans Überleben als ans Siegen. Nachdem er aus dem Lazarett entlassen werden konnte, bekam einen kurzen Genesungsurlaub. Dann schickte man ihn nach Duisburg zur Arbeit in einer Rüstungsfabrik. Duisburg liegt weit weg von Köthen. Ich hätte ihn dort nur alle paar 78 Wochen besuchen können. Das hielt ich nicht aus, zumal damit zu rechnen war, daß die Militärs sich bald wieder an ihn erinnerten und ihn zurück an die Front schickten. Also beschloß ich, ihn im fernen Duisburg zu suchen und alles Menschenmögliche zu unternehmen, um in seiner Nähe bleiben zu können. Die Adresse des möblierten Zimmers, das er zusammen mit einem Arbeitskollegen bewohnte, kannte ich. Die Wirtin erwies sich als eine freundliche, verständnisvolle Frau und ließ mich auf die Rückkehr der beiden Männer warten. Ernst war ziemlich verblüfft, als er sich mir am Abend plötzlich gegenübersah, obwohl er ja inzwischen eigentlich an die schnellen Entschlüsse seiner Frau hätte gewöhnt sein müssen. Wir bummelten noch knapp zwei Stunden durch die Stadt und plauderten miteinander. Dann verabschiedeten wir uns bis zum nächsten Tag. An diesem nächsten Tag gab es für mich eine Menge zu erledigen, denn ich war schließlich nicht nur für einen kurzen Besuch gekommen. Zunächst fragte ich bei der Rüstungsfabrik nach, ob sie dort noch Arbeitskräfte suchten. Man brauchte tatsächlich noch Leute, und weil ich gesund und kräftig aussah, wurde ich eingestellt. Anschließend redete ich mit der Wirtin. Jetzt kam mir zugute, daß ich Ernst gegen den Willen meiner Eltern auch kirchlich geheiratet hatte. Die Frau war streng katholisch und ließ sich auf mein Ansinnen nur ein, weil offenkundig die rechte Moral gewahrt blieb. Alles Weitere regelte sich fast von selbst. Der Arbeitskollege wechselte in ein Mansardenzimmer. Ich zog zu Ernst. Wir konnten die Abende, die Nächte und die Sonntage miteinander verbringen und sogar gemeinsam zur Fabrik gehen. So hatten wir uns mitten im Kriegsinferno eine Nische für unser junges Eheglück geschaffen. Anfang 1917 verschob sich das Kräftegleichgewicht der Kriegsparteien zu Ungunsten Deutschlands. Im Februar begann in Frankreich der Rückzug in die sogenannten "Siegfriedstellung". Die Generäle waren nur noch bemüht, von 79 dem über zwei Jahre zuvor eroberten Gebiet so viel wie möglich zu behalten. Anfang April trat die USA in den Krieg ein. Es nutzte den Deutschen nicht mehr viel, daß in Rußland eine Revolution ausbrach und die Armee an planvollen Operationen gegen äußere Gegner hinderte. Spätestens jetzt, unter dem Eindruck dieser Ereignisse, verweigerte auch das deutsche Volk mehr und mehr seinem Kaiser die Gefolgschaft bei dessen wahnwitzigen Weltherrschaftsplänen. So sehr die Propaganda auch dagegen anzukämpfen versuchte, konnte doch bald jeder erkennen, daß dieser Krieg sich nicht mehr gewinnen ließ, und daß folglich die Tausenden Gefallenen völlig sinnlos gestorben waren. Es gährte vor allen unter denen, die am meisten zu leiden hatten, unter den Arbeitern und unter den Frontsoldaten. Im Sommer feierten wir den zweiten Geburtstag des kleinen Rudi. Er hatte inzwischen laufen gelernt und brauchte nicht mehr Tag und Nacht betreut zu werden. Die junge Frau, an die Vater die Wohnung im Obergeschoß vermietet hatte, nahm ihn hin und wieder zu sich und versorgte ihn dann zusammen mit ihrem eigenen Kind. Das alles war eine spürbare Entlastung für Mutter, so daß sie nunmehr auf die ständige Hilfe ihrer jüngsten Tochter verzichten konnte. Hedwig gab die Halbtagesstelle auf und begann, wie ihre Schwester Martha in der Köthener Farbenfabrik zu arbeiten. Ein paar Monate später bekam sie jedoch ein anderes Angebot. Die Frau des Fabrikbesitzers war an den Rollstuhl gefesselt. Das Dienstmädchen, das sie bisher gepflegt hatte, erwartete ein Kind und stand nicht mehr zur Verfügung. Bei der Wahl für eine Nachfolgerin wollte der Unternehmer nicht dem glücklichen Zufall vertrauen und suchte sich deshalb jemanden aus unter seinen Arbeiterinnen. Er sprach Hedwig an, und die erklärte sich nach kurzer Bedenkzeit einverstanden. Freilich erwies sich die Aufgabe bald als unerwartet schwierig. Die unheilbar kranke Frau war launisch und neigte zu 80 Depressionen. Wer mit ihr über längere Zeit gut auskommen wollte, brauchte viel Geduld. Als ich eines Abends mit Ernst in unser Zimmer in Duisburg zurückkehrte, fanden wir auf dem Tisch ein amtliches Schreiben. Da wußte ich sofort, daß die schöne Zeit, die wir miteinander verbracht hatten, nun vorbei war. Unsere Hoffnung, der Krieg werde rechtzeitig zu Ende sein, erfüllte sich nicht. Ernst mußte sich schon am nächsten Tag bei seiner neuen Einheit melden. Ich kündigte das Zimmer und setzte mich in den nächstbesten Zug in Richtung Köthen. Vor mir lagen neue Monate der Ungewißheit und der Angst. Im Sommer des Jahres 1918 waren die Heere der "Mittelmächte" Deutschland und Österreich so weit ausgeblutet, daß sich die Niederlage endgültig nicht mehr abwenden ließ. Darüber konnte auch der Friede von BrestLitowsk nicht hinwegtäuschen. Er kam nur zustande, weil das junge Sowjetrußland den Frieden um nahezu jeden Preis brauchte. Die Westfront stand unmittelbar vor dem Zusammenbruch und hielt nur noch Dank der über Jahre hinweg ausgebauten Verteidigungsstellungen. Anfang Oktober unterbreitete die deutsche Regierung Waffenstillstandsangebote an die Engländer, Franzosen und Amerikaner, um zu retten, was längst nicht mehr zu retten war. In den folgenden Wochen überstürzten sich die Ereignisse. Die Meuterei in der Hochseeflotte vor Wilhelmshaven löste eine Kette weiterer Aufstände aus. Überall im Land bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte. Das war die Revolution. Am 9. November erklärte Kaiser Wilhelm II seinen Thronverzicht. Tags darauf floh er nach Holland ins Exil. In Berlin konstituierte sich gleichzeitig eine provisorische Regierung, die sich aus je drei Mitgliedern der SPD und der kurz zuvor gegründeten USPD zusammensetzte. Einen weiteren Tag später wurde ein Waffenstillstand ausgehandelt. Er schloß die Räumung der besetzten Westgebiete und des linken Rheinufers sowie die Aufhebung des Vertrages von Brest-Litowsk ein. 81 Wir alle waren überglücklich über das Ende des Krieges, der uns Schulzes so viel Leid gebracht hatte. Es war uns dabei völlig gleichgültig, wie teuer er hatte erkauft werden müssen, dieser Frieden. Selbst, daß die Versorgung mit Lebensmitteln katastrophal blieb, nahmen wir gelassen hin. Wichtig war nur, daß Ernst gesund nach Hause zurückkehrte und daß Karl nun endgültig nicht mehr befürchten mußte, doch noch eingezogen zu werden. Martha sträubte sich auch nicht mehr gegen die Heirat. Natürlich konnten wir keine prächtige Feier organisieren. Doch nicht immer ist es der materielle Glanz, der ein Ereignis mehr oder minder wertvoll erscheinen läßt. So auch in diesem Falle. Wir feierten mit der Trauung zugleich den Neubeginn - im weitesten Sinne. 82 4. Kapitel Liese erzählt Es herrschte wieder Frieden in Europa. Wer jedoch Ende 1918 geglaubt hatte, daß es eine leichte Sache sein würde mit diesem Frieden, den belehrte schon der Januar des neuen Jahres eines Schlechteren. Noch immer starben junge Deutsche mit der Waffe in der Hand im Vertrauen, einer guten Sache zu dienen, nur verbluteten sie nicht mehr auf den Schlachtfeldern von Frankreich und Rußland sondern mitten im eigenen Land in den Straßen von Berlin. Wie hatten die Menschen auch glauben können, daß ein so schreckliches Ereignis wie der Weltkrieg mit ein paar wenigen Erklärungen vorüber sei und in Vergessenheit gerate. Nein, die Geister dieses Krieges gingen noch um, und sie sollten noch viele Jahre lang umgehen. Schon schrien die ersten nach Vergeltung. Eine Schmach gelte es zu tilgen. Immerhin fanden sich die maßgeblichen deutschen Parteien in Weimar zur Nationalversammlung zusammen, um sich auf einen Konsens zu einigen und auf diese Weise dem Land nach dem äußeren endlich auch den inneren Frieden zu geben. Es war am Ende eine recht halbherzige Verfassung, auf die man sich verständigen konnte, ein Kompromiß, der künftiges Unheil im Keime schon enthielt. Doch die meisten Leute damals waren zufrieden damit. Friedrich Ebert, der Sozialdemokrat, wurde zum Reichspräsidenten gewählt, und in diesem Amte blieb er bis zum Jahre 1925. Schon aber wehte ein Unglück ganz anderer Art heran - die Grippeepidemie. Ganz sicher wäre sie zu anderen Zeiten weit weniger verheerend verlaufen. Die von den Entbehrungen der Kriegsjahre ausgezehrten Menschen jedoch besaßen nicht mehr genügend Widerstandskraft gegen die Krankheit und starben 83 familienweise. Im Volk munkelte man, die Lungenpest sei zurückgekehrt. In vielerlei Hinsicht erinnerte das Bild tatsächlich an die Seuchenkatastrophen des Mittelalters. Die Leute brachen auf der Straße zusammen und starben oft binnen weniger Stunden. Die Leichenhäuser waren überfüllt. Viele Tote wurden hastig in Massengräbern verscharrt. Und niemand durfte sich gefeit fühlen gegen den allgegenwärtigen Virus. Wüßte ich nicht genau, daß das Schicksal blind ist, so würde ich meinen, es hätte uns Schulzes gegenüber ausgleichende Gerechtigkeit geübt - nach den schweren Prüfungen im Kriege verschonte es uns diesmal. Schon recht bald hielt wieder ein gewisses Maß an Normalität Einzug bei uns. Alltag bedeutete freilich nicht, daß es von nun an nur noch glückliche Stunden gab. Vater hatte in den Wirren des Krieges fast sein gesamtes Vermögen verloren. Er mußte ganz von vorn wieder beginnen, sein Bauunternehmen praktisch neu gründen und wußte nicht, woher er das Geld dafür nehmen sollte. Oft fehlten die einfachsten Dinge. Nicht einmal, daß wir genügend zum Essen hatten, war eine Selbstverständlichkeit. Auch alte Wunden rissen wieder auf. Das Verhältnis zwischen Vater und Max spitzte sich zu. Der eine konnte nicht verwinden, daß sein Sohn, in den er so große Hoffnungen gesetzt hatte, sich nun damit zufrieden gab, als ungelernter Arbeiter sein Leben zu fristen. Der andere fühlte sich von seinem Vater verraten und verzieh ihm seinen Mangel an Einfühlungsvermögen nicht. Beide hatten in gewisser Weise recht und in gewisser Weise unrecht. Max war wegen seinem Fleiß und seiner Zuverlässigkeit auch ohne höhere Bildung gut angesehen. Anderseits glaube ich, daß er aus reinem Trotz schon die geringste Weiterbildung ablehnte. Indem er Gelegenheitsarbeiten annahm, die der Vater als Schande empfand, wurde er gewissermaßen zu einer lebendigen Anklage. Der Kampf der beiden gegeneinander belastete am Ende den Frieden der ganzen Familie. So waren wir - ich muß es gestehen - recht froh, als Max sich eine kleine Wohnung 84 suchte und uns verließ. Von diesem Moment an kam er nur noch zu Besuch, wenn er wußte, daß Vater nicht da war. Mit Mutter verstand er sich Zeit seines Lebens gut. Großes Glück hatte Vater dagegen, als sich für unser Grundstück in Geuz ein Mann interessierte, der im Krieg so reich geworden war, daß Geld für ihn keine entscheidende Rolle mehr spielte. Der günstige Preis erlaubte ihm, zum einen ein neues Haus zu kaufen und zum anderen den Grundstock zum Aufbau einer neuen Existenz zu legen. Für mich und Ernst war das der letzte Anstoß, uns nach einem eigenen Heim umzusehen. In dem neuen Haus hätten wir zusammen mit unserem inzwischen vierjährigen Rudi ohnehin nicht genügend Platz gefunden. Freilich waren es nicht allein die praktischen Gründe, die mich anspornten, recht bald eine passende Wohnung zu finden. Ich bin ein Mensch, der sich nicht unterordnen mag. Es hätte also früher oder später Unfrieden mit den Eltern gegeben. Wie sich bald herausstellte, bot schon allein die Tatsache, daß wir in der selben Stadt wohnten und nach wie vor manches gemeinsam erledigten, genügend Anlaß für kleinere und auch größere Streitereien. Für uns alle hieß es also nun, Abschied zu nehmen von unserem geliebten Geuz. Leicht fiel das wohl niemandem. Zwanzig Jahre unseres Lebens hatten wir dort verbracht. Jedes Zimmer, jeder Winkel des Gartens, jede Straße des kleinen Ortes erinnerten an irgend eine Begebenheit. Wieviel Male waren wir an heißen Tagen im Dorfteich baden gegangen?! Diese Wand dort hatte ich seinerzeit in tiefer Empörung über einen bösen Spielkameraden mit großen, schwarzen Buchstaben verunziert. In jenem Haus wohnte ein Mann, der für ein paar Wochen einmal meine große Liebe gewesen war. Ich lief umher und mußte schmunzeln und weinen zugleich. Die Eltern zogen gemeinsam mit Martha und Hedwig, den beiden letzten noch bei ihnen lebenden Kindern, sowie Schwiegersohn Karl vom Dorf gewissermaßen direkt ins Herz Köthens, an den Schloßplatz. Seitlich des Hauses liegt das 85 ehemalige Prinzessinnenpalais. Direkt gegenüber führt eine breite Brücke, die den Ringgraben überspannt, zum Hauptportal des eigentlichen Schlosses. Freilich hatten sich die altehrwürdigen Gemäuern seit dem Auszug derer von KöthenAnhalt manch demütigenden Nutzungswandel gefallen lassen müssen. Der prächtige, im Stile des Rokoko ausgestaltete Spiegelsaal wurde immerhin noch gelegentlich für Konzerte genutzt. Der Marstall jedoch, ehemals Quartier edler Rösser und schmucker Kutschen, beherbergte jetzt die Zugpferde eines Fuhrunternehmers. In einem anderen Flügel wurden Gymnasiasten mit mathematischen Formeln und lateinischen Vokabeln vollgestopft. Am schlimmsten hatte es jene Gebäude erwischt, die sich zum Amtsgericht und zum Untersuchungsgefängnis degradiert sahen. Es war also längst vorbei mit der einstigen Herrlichkeit, als die Schulzes zum Schloßplatz zogen. Das hieß aber nicht, daß man sich dort nicht wohl fühlen konnte. Ganz im Gegenteil! Wer vorn aus dem Fenster blickte, der sah soviel Grün, daß er kaum glauben mochte, inmitten einer Stadt zu sein. Die hohen Bäume und dichten Sträucher, die sich um das Denkmal des Fürsten Ludwig gruppierten, vertrieben rasch die Sehnsucht nach dem Dorf. Übrigens hat sich jener Fürst Ludwig Verdienste erworben für die Verbesserung der deutschen Sprache. Unglücklicher Weise sind seine Bemühungen ausgerechnet in seiner Heimat nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Wer einmal in die Gegend kommt und dabei Gelegenheit findet, sich mit Einheimischen zu unterhalten, kann sich davon noch heute leicht überzeugen. Das Haus am Schloßplatz hatte eine verhältnismäßig große Grundfläche, war jedoch deutlich niedriger als die Nachbargebäude und wirkte dadurch ein wenig geduckt. Vater störte das nicht, denn er wollte, sobald er genügend Geld besäße, auf dem Grundstück ein neues, viel schöneres Haus bauen, eines aus soliden Klinkersteinen, das sich dann nicht 86 mehr bescheiden und verschüchtert ausnehmen würde. Das blieben allerdings Wunschträume. Das Haus steht noch heute so wie damals an seinem Fleck und wird es wohl inzwischen auf ein stattliches Alter von rund 300 Jahren gebracht haben. Bekanntlich kommt es gar nicht so selten vor, daß ganz unscheinbaren Menschen irgend ein Geheimnis innewohnt, durch das sie schlagartig äußerst interessant erscheinen, sobald jemand davon erfährt. Ähnlich verhält es sich mitunter auch mit leblosen Dingen. Im Keller jenes niedrigen, grauen Hauses begann ein Geheimgang, der direkt ins Schloß führte. Als die Behörden von seiner Existenz erfuhren, stellten sie das ansonsten völlig unbedeutende Gebäude unter Denkmalsschutz, vorsorglich gewissermaßen. Später wurde der Eingang solide zugemauert - weil vor allem Hedwig sich schier zu Tode graulte bei der Vorstellung, die Bösewichte aus dem Untersuchungsgefängnis könnten durch die eigene Wohnung Fluchtversuche unternehmen. Es war damals nicht die Zeit danach, romantischen Phantasien nachzuhängen. Ganz vergessen allerdings konnten wir sie nie, jene mysteriöse Verbindung. Wer mochte einst gewohnt haben in dem kleinen Haus am Schloßplatz? Ein Geheimagent des Fürsten vielleicht? War womöglich einmal einer der hochadligen Herren auf diesem Wege einem Ring von Belagerern entkommen? Ich weiß es nicht, und ich werde es wohl auch nicht mehr herausfinden. Obwohl die Eltern vorerst keine hohen Ansprüche stellten, konnten sie das Haus nicht sofort nutzen, denn es war in einem ziemlich heruntergekommenen Zustand. Hier mußte der Putz ausgebessert, dort eine Zwischenwand neu gezogen werden. Hinzu kamen das Malern und Tapezieren. Kaum jedoch war die Farbe getrocknet, wurde umgezogen. Viele Arbeiten blieben liegen und konnten erst im Laufe der Jahre nach und nach erledigt werden. Im Erdgeschoß waren die Räume zu beiden Seiten eines Korridors verteilt. Links befand sich vorn die Küche. Dahinter 87 lag ein Zimmer, welches Mutter und Hedwig zum wohnen und schlafen nutzten. Gegenüber zogen Martha und Karl, die beiden jungen Eheleute, ein. Karl, der goldene Hände besaß und sich in fast allen Gewerken auskannte, verwandelte die weitestgehend abgeschlossene Wohnung in ein Schmuckkästchen. Martha unterstützte ihn dabei tatkräftig. Das Obergeschoß bestand eigentlich aus vier Zimmern. Drei davon jedoch waren praktisch unbewohnbar und ließen sich so rasch auch nicht sanieren. Nur den größten der Räume brachte Vater in Ordnung und richtete sich darin sein Büro ein. Zumeist schlief er auch dort. Vaters Bauunternehmen kam ganz langsam wieder in Gang. Freilich hatte er dabei ständig mit unzähligen ungewohnten Schwierigkeiten zu kämpfen. Das Baumaterial war zumeist entweder minderwertig oder überteuert. Auch gute Maurer ließen sich kaum mehr auftreiben. Zu viele von ihnen hatte der Krieg verschlungen. Wichtig aber war vorerst nur, daß Vater überhaupt wieder Häuser bauen und verkaufen konnte, wichtig für ihn selbst und für die Familie. Muß man schon das Haus am Schloßplatz bescheiden nennen, so traf dies erst recht zu für die kleine Wohnung, in die ich zusammen mit Ernst einzog. Auch die erste Einrichtung war nicht gerade vom Feinsten. Mir jedoch kam es vor allem darauf an, daß ich mein eigenes Reich hatte und darin schalten und walten konnte, wie ich mochte. Natürlich zögerte ich auch nicht, meinen kleinen Rudi zu mir zu holen. Er war ein wirklich niedlicher Junge geworden, mit zartem, feingliedrigen Gesichtchen und hellblondem, seidigem Haar. Ich kaufte ihm die hübschesten Anziehsachen und war richtig vernarrt in ihn. Da tat es mir schon ein wenig weh, daß ich ihn frühmorgens in den Kindergarten geben mußte, um arbeiten gehen zu können. Ohne meinen Zuverdienst hätte das Geld jedoch nicht gereicht. Schlimmer freilich als diese Trennung für wenige Stunden war etwas anderes, etwas, das es schon lange gab - nicht 88 wahrgenommen von mir - und das noch lange fortwirken sollte. Bis heute kann ich es nicht recht benennen. Ganz sicher hatte ich irgend etwas falsch gemacht. Vielleicht war ich manchmal ungerecht zu ihm gewesen, unbewußt. Daß das niemals in meiner Absicht lag, das zumindest kann ich schwören. Wie dem auch gewesen sein mochte - wir wurden einander fremd. Zuerst merkte ich es nur daran, daß er seine Großmutter mehr liebte als mich. Nach einem Besuch auf dem Schloßplatz kam es vor, daß er nicht nach Hause zurückkehren wollte. Dann wurde er widerspenstig und überempfindlich. Durch den Krieg bedingt, war ich oft abwesend von Köthen. Vielleicht hatte er dadurch zu lange in der Familie meiner Eltern gelebt. Später bekam ich ein besseres Verhältnis zu ihm. Er war ein guter Schüler, zielstrebig und verlässlich. Er half mir beim Zeitungaustragen und betreute liebevoll seine kleinen Geschwister. Frieden hieß natürlich auch, daß es wieder erlaubt war, sich in aller Öffentlichkeit zu amüsieren. Vor allem die Jugend machte davon reichlich Gebrauch. Die teilweise zweckentfremdeten Tanzsäle hatte man schnell wieder hergerichtet. Kapellen gab es ohnehin genug. Das war eine ziemlich verrückte Zeit damals. Neue Tänze kamen auf, von denen die älteren Leute meinten, man solle sie verbieten. Von uns Schulzegeschwistern konnte nur Hedwig dieses Vergnügen gänzlich auskosten, denn nur sie war noch ungebunden. Tatsächlich brach sie fast jeden Sonntag zu irgend einer der zahlreichen Veranstaltungen auf. Die Eltern ließen sie gewähren. Eines Tages wurde ein junger Mann auf sie aufmerksam. Er stand an der Theke und trank gerade ein Glas Bier, als es über ihn kam wie ein Blitz. Zu seinem Freund sagte er, jeden Zweifel von vornherein ausschließend: "Sieh mal die Kleine dort! Das wird meine Frau." Der Freund jedoch lachte nur. 89 "Nie im Leben schaffst du das!" meinte er und streckte die Hand zur Wette aus. Otto Bartlitz, so hieß der junge Mann, war ein kräftiger Bursche, etwas derb aber nicht ungebildet, sehr selbstsicher im Auftreten, kurzum ein Typ, wie viele Frauen ihn mögen. Nur an diesem Ort gab er keine so glückliche Figur ab, denn - er konnte nicht tanzen. Was sollte er nun tun? Verzichten? Sich dem Gespött seines Freundes aussetzen? Nein, das war nicht nach seiner Art. Statt dessen nötigte er seine Schwestern, ihm in einem Schnellkurs die Grundzüge beizubringen von all dem, was man so können mußte auf dem Tanzboden. Walzer, Rheinländer, Polka. Er wollte alles wissen und lernte verbissen wie ein Student vor dem Abschlußexamen. Dann kam der große Tag. Otto zog sich seinen besten Anzug an und trat heran an seine Liebste, die ihn noch gar nicht kannte. Galant, wie er es vor dem Spiegel einstudiert hatte, forderte er sie auf. Dann ließ er keinen Tanz mehr aus. Sobald ein anderer sich in ihre Nähe wagte, trat er dazwischen. Er bewachte sie geradezu, und da er einer war, mit dem sich niemand gern anlegte, hatte er tatsächlich die junge Frau für diesen Abend ganz für sich allein. Hedwig wurde das alles allmählich ein wenig unbehaglich. Obwohl sie leidenschaftlich gern tanzte, war sie im Grunde scheu und schüchtern. Sobald sie spürte, daß ein Mann es ernst mit ihr meinte, wurde sie feuerrot und suchte das Weite. Diesen Bären jedoch wurde sie nicht so leicht wieder los. Sie schwankte hin und her zwischen Angst und Vergnügen. Er war wirklich drollig, wie er sich verzweifelt bemühte, so schwerelos zu wirken wie die geübten Tänzer ringsum, und dennoch immer wieder seiner Partnerin auf die Füße trat. Zugleich aber brachte er einen Besitzanspruch zur Geltung, der sich eigentlich durch nichts rechtfertigen ließ. Je länger der Abend dauerte, desto mehr gewann die Angst die Oberhand. Ein Gespräch kam nicht einmal im Ansatz zu Stande. Als Hedwig endlich zu Hause in ihrem Bett lag, fühlte sie sich wie 90 aus der Gewalt eines bösen Drachen erlöst - und träumte dennoch höchst angenehm von dem jungen Mann, für den es auf der großen, weiten Welt offenbar nur sie gab. Am nächsten Sonntag ging Hedwig mit klopfendem Herzen zum Tanz. Was wünschte sie sich eigentlich? Wollte sie ihn wiedersehen oder nicht? Im Saal brauchte sie nicht lange nach ihm zu suchen. Er hatte auf sie gewartet und begrüßte sie schon an der Tür. Selbstverständlich verlief der Abend wieder genau so wie der eine Woche zuvor. Eifersüchtig gab er sie keine Minute frei. Bald schon wußte Otto, wo Hedwig wohnte und zu welcher Familie sie gehörte. Er erforschte, worüber sie sich freute und welche Sorgen sie hatte. Dabei entging ihm auch nicht, wie schwer Mutter Schulze das Wirtschaften noch immer fiel. Lebensmittel waren nach wie vor knapp, gute und gesunde allemal. Das brachte ihn auf eine Idee. Er arbeitete als Fleischer auf einem Schlachthof und kam dadurch an manches heran, wovon viele andere nur träumen konnten. Drei Tage später stand er mit einem dicken Paket vor dem Haus und klopfte an die Fensterscheibe. Hedwig ging hinaus, wurde furchtbar verlegen, als er das Geschenk überreichen wollte, und lehnte entschieden ab. Drinnen fragte die Mutter sie, was der fremde Herr gewollt habe. "Auch, der verfolgt mich schon seit Wochen. Jetzt glaubt er, daß er mich mit einem Fleischpaket ..." "Du hast ihn doch nicht einfach so wieder weggeschickt?!" "Natürlich habe ich das!" "Aber Mädel! Er hat dir nichts getan, also darfst du ihn nicht beleidigen." Mutter sah nur die praktische Seite der Angelegenheit, und Hedwig blieb nichts anderes übrig, als erneut nach draußen in den Vorgarten zu gehen, wo Otto geduldig noch immer wartete. Die Annahme des Geschenkes bedeute nun aber auch, daß gemäß Sitte und Anstand der Verehrer den Eltern vorgestellt 91 werden mußte. Vater führte ihn sofort hinauf ins Obergeschoß und zeigte ihm die drei ungenutzten Räume. Wahrscheinlich dachte er: 'Wenn er zu unserer Familie gehören will, so soll er auch sehen, daß es bei uns viel Arbeit gibt.' Während sie von einem Raum zum anderen schlenderten, kamen sie miteinander ins Gespräch. Otto war zwar kein Handwerker aber ein Praktiker und ein Mensch der Tat. "Da kann man was draus machen", versicherte er und hatte auch gleich etliche gute Vorschläge parat. Die kleine Fachsimpelei wurde zum Ausgangspunkt einer echten Männerfreundschaft. Was die beiden so fest miteinander verband, ist nicht ganz leicht zu verstehen, vor allem wenn man Vaters Vergangenheit mit Ottos späterer Entwicklung vergleicht und dabei die landläufigen Wertungen zu Grunde legt. Pauschalurteile sind aber ohnehin selten geeignet, einem Menschen gerecht zu werden. Offensichtlich hatten die beiden Männer eine Reihe Gemeinsamkeiten: die Tatkraft, den Mut zum kalkulierbaren Risiko, schließlich das Talent und den Willen zu führen und Verantwortung zu übernehmen. Damit war nicht nur entschieden, daß Otto sein Ziel erreichen und Hedwig heiraten würde, es war auch das künftige Familienoberhaupt gefunden. Die Hochzeit wurde im Kreise der Familie gefeiert. Außer den Köthenern kamen aus Berlin Emma und Gustav mit dem kleinen Werner sowie aus Hannover Franz und Henny, bei denen es inzwischen einen Sohn mit Namen Kurt gab. Nach der Feier begannen Otto und Hedwig gleich mit dem Ausbau der Zimmer im Obergeschoß, die einmal ihre Wohnung werden sollten. Bis es dort ähnlich gemütlich war wie im Erdgeschoß, vergingen allerdings noch ein paar Jahre. 92 Kinder sind zweifellos der deutlichste Ausdruck der Zuversicht. Im ganzen Land stieg in den Jahren nach dem Krieg die Geburtenrate stark an. Die Schulzes bildeten dabei keine Ausnahme. Bei ihnen wuchs gewissermaßen eine neue Generation heran. Unser Rudi, Emmas Werner und Franzens Kurt bekamen neun Geschwister, Cousins und Cousinen. Franz nannte seine beiden jüngsten Kinder nach seinen beiden Lieblingsgeschwistern - Karl den Jungen und Hedwig das Mädchen. Martha und ihr Mann Karl - ein Name der sich bei den Schulzes in einer recht verwirrenden Weise häufte - wurden durch die Geburt der kleinen Marthe, die eigentlich genau so hieß wie ihre Mutter, bei der man aber zur Unterscheidung den letzten Buchstaben änderte, zu einer vollständigen Familie. Geburten waren freilich auch gefährlich. Zwar hatte sich die Medizin in den zurückliegenden Jahrzehnten so entwickelt wie in den Jahrhunderten des gesamten Mittelalters nicht, doch war der Wissensstand anderseits noch längst nicht mit dem heutigen vergleichbar. Bei Emma, die schon einmal ein Kind verloren hatte, gab es Komplikationen. Trotz tagelanger Wehen, kam das Baby nicht auf die Welt. Der Hausarzt wußte keinen Rat mehr und zog einen Spezialisten zu Rate. Selbst der aber sah sich bald am Ende seiner Möglichkeiten. Daß schließlich trotzdem sowohl Mutter als auch Kind überlebten, grenzt an ein Wunder. Emma erholte sich nur langsam wieder von den übermenschlichen Anstrengungen und dem furchtbaren Blutverlust. So blühend wie bei ihrer glanzvollen Hochzeit sollte sie nie wieder aussehen. Sie blieb hager und wirkte fortan immer kränklich. Das Baby, es war ein Mädchen, erhielt den Namen Irmgard. Bald nach der Geburt ihres Töchterchens wurde Martha ein zweites Mal schwanger. Die beiden jungen Eheleute freuten sich sehr auf ihr zweites Kind und hofften, daß es diesmal ein Sohn sein würde. Im achten Monat jedoch wurde Martha plötzlich krank. Anfangs hatten alle noch gehofft, daß es nicht 93 allzu schlimm und noch vor dem Entbindungstermin vorüber sein würde. Das hohe Fieber jedoch ging nicht zurück, was immer man auch unternahm. Als ich meine Schwester besuchen ging, sah sie schon so schlecht aus, daß ich erschrak. Kreidebleich und reglos lag sie in ihrem Bett. Ihre Augen hielt sie geschlossen. Schlief sie? War sie bewußtlos? Nicht die geringste Reaktion von ihr verriet mir, ob sie mein Eintreten überhaupt bemerkt hatte. Ich setzte mich zu ihr und strich ihr behutsam ein paar Strähnen ihrer Haare aus der Stirn, jener wunderschönen schwarzen Haare, derentwegen die Jungen verrückt nach ihr gewesen waren. Dann drückte ich ihr behutsam die Hand. Endlich bemerkte sie, daß sich jemand in ihrer Nähe aufhielt. Sie behielt zwar die Augen geschlossen, wandte aber den Kopf ein klein wenig mir zu. "Lieschen?" fragte sie. Ihre Stimme klang fremd. Es war, als spräche sie aus einem tiefen Brunnen heraus. Sie ging auch mit keinem Wort ein auf das, was ich ihr sagte - als Trost gedachte Lügen, die zu erfinden mir unglaublich schwer fiel. Offensichtlich hing sie einer ihrer Visionen nach. Mit ihren geschlossenen Augen blickte sie in eine mir verschlossene Welt. "Sieh, Lieschen - dort steht ein großer Sarg und gleich daneben ein kleiner. Es ist schade um den kleinen Jungen." Als ich mich wenig später hinausschlich, zitterten mir die Knie. 'Nein, diesmal wird sie nicht recht behalten!' redete ich mir wieder und wieder ein. 'Diesmal nicht! Diesmal nicht!' Martha war meine Lieblingsschwester. Ich konnte mir eine Welt ohne sie nicht vorstellen. Drei Tage später hatte Martha ihren dreißigsten Geburtstag. Ich kaufte eine Flasche Rotwein für sie. 'Ganz sicher geht es ihr schon wieder besser', sagte ich zu mir. 'Durch den Wein wird sie wieder zu Kräften kommen. Alles wird wieder gut.' Am Schloßplatz jedoch erfuhr ich, daß in der vorangegangenen Nacht die Wehen eingesetzt hatten und Martha nun im 94 Krankenhaus lag. Ich lief zum Krankenhaus. Eine Schwester bat mich höflich, einen Moment im Wartezimmer Platz zu nehmen. Nach etwa einer Viertelstunde kam Karl. "Vor ein paar Minuten ist sie eingeschlafen", sagte er nur. Martha war genau an ihrem dreißigsten Geburtstag gestorben. Ihr Sohn überlebte sie nur um wenige Stunden. Auch diese Weissagung also hatte sich erfüllt. Allerdings bekam das Baby keinen eigenen Sarg sondern wurde mit in den der Mutter gebettet. Es war geplant, Martha in aller Stille nur im Beisein der nächsten Angehörigen zu beerdigen. Die Nachricht von ihrem Tode hatte sich jedoch in Windeseile verbreitet. Als wir zum Friedhof kamen, war dort schon eine solche Menge von Menschen versammelt, daß es so aussah, als gelte es, einer hochgestellten Persönlichkeit die letzte Ehre zu erweisen. So viele Freunde hatte sich Martha im Laufe ihres kurzen Lebens erworben. Selbst das Wetter schien zu trauern. Gegen Abend begann ein erbärmlicher Regen. Es war, als hätte der Himmel all seine Schleusen geöffnet, und alle fürchteten, daß das Wasser bis in den Keller liefe. In dieser abscheulichen Nacht hörte Mutter plötzlich jemanden singen. Sie ging ans Fenster und sah verschwommen dem Haus gegenüber eine Gestalt. Ein Mann stand dort. Der Regen durchweichte seine Kleider, doch er wich nicht von der Stelle. Wie auf einer Bühne stand er dort und sang inbrünstig sein Lied. Es war eine Opernarie: "Martha, Martha, du entschwandest und mit dir mein ganzes Glück." Er sang nicht etwa wie ein Betrunkener. Seine Stimme klang hell und klar. Nur das Pfeifen des Windes und das Peitschen des Regens verunstalteten sie. Es war ein schauerlicher Gesang. Der Musiker hatte Martha niemals vergessen können, nicht nach ihrer Heirat, nicht nach ihrer ersten Geburt, nicht einmal nach ihrem Tode. Allerdings war ihr Tod auch mir lange Zeit unbegreiflich. Etwas in mir weigerte sich, ihn als Tatsache hinzunehmen. 95 Statt am Schloßplatz besuchte ich meine Lieblingsschwester eben nun auf dem Friedhof. Alles, was ich erlebte, Freudiges wie auch Trauriges, das erzählte ich ihr an ihrem Grabe, und manchmal war mir so, als hätte sie mir geantwortet. So hielt ich mich viel öfter dort auf, als die Pflege, zu der ich mich verpflichtet hatte, es erforderte. Die kleine Marthe wuchs bei den Poschkegroßeltern heran. Im Laufe der Jahre verloren wir mehr und mehr den Kontakt zu ihr. Martha, die so sehr an ihrer Familie gehangen hatte, wäre darüber gewiß sehr traurig gewesen. Karl verheiratete sich wieder. So recht glücklich jedoch wurde er nicht. Die Erinnerungen überschatteten die neue Ehe. Seine Frau, die sehr wohl fühlte, was in ihm vorging, verlangte von ihm, daß er sämtliche Bilder von Martha aus dem Hause schaffe. Damit erreichte sie freilich eher das Gegenteil von dem, was sie bezweckte. Die frei gewordene Wohnung im Haus am Schloßplatz wurde an fremde Leute vermietet. Bevor Martha starb, hatten unsere Eltern schon fünf ihrer Kinder verloren - Richard und Agnes als Babys, Minna durch eine heimtückische Krankheit, Karl und Paul schließlich im Krieg. Dennoch traf dieser letzte Verlust sie wohl am härtesten. Dieser Tod erschien ihnen besonders sinnlos. Er war zu einem Menschen gekommen, der durch seine Fröhlichkeit gewissermaßen die Personifizierung des Lebens zu sein schien, und er war gekommen zu einer Zeit, als niemand von uns mehr mit einem solchen Schicksalsschlag rechnete. Mutter wurde noch stiller und verschlossener, als sie ohnehin schon war. Vater löste wenig später sein Bauunternehmen endgültig auf und übernahm nur noch Aufträge, die er allein bewältigen konnte. Allerdings bedeutet dies nicht, daß am Schloßplatz nun nur noch Trübsal geblasen wurde. Es gab bald immerhin auch wieder einen Grund zur Freude. Hedwig und Otto wurden Eltern eines kräftigen Jungen. Er erhielt den selben Namen wie 96 sein Berliner Cousin: Werner. Eigenartiger Weise hatte er als einziger in der Familie rotblondes Haar. Nun wird es Zeit, daß ich von meinen eigenen Kindern berichte. Auch Rudi bekam nämlich Geschwister. Wenige Monate vor Marthas Tod kam die kleine Elly auf die Welt. Ich hatte mir als zweites Kind ein Mädchen gewünscht, und mein Wunsch war somit in Erfüllung gegangen. Meine Freude aber wurde schon bald von Sorgen überdeckt. Mein Töchterchen erbrach sich bei fast allem, was ich ihr fütterte. Ich lief mit ihr von einem Arzt zum anderen. Keiner von ihnen konnte mir einen Rat geben. Elly wurde immer schwächer und es fehlte nicht mehr viel, daß sie mir weggestorben wäre. Buchstäblich im letzten Moment fand ein bekannter Frauenarzt die Ursache heraus. Die Diät, die er anordnete, bestand im Wesentlichen aus einer mit Kalbsknochen zubereiteten Kraftbrühe und schloß Milchnahrung in jeder Form aus. Als die Diät Wirkung zeigte, glaubte ich, daß nun alles überstanden sei und Elly sich künftig ganz normal entwickeln würde. Leider war das eine verfrühte Hoffnung. Ein paar Monate später bedeckte sich der Körper des Kindes plötzlich mit Geschwüren. Die Kleine schrie fast ununterbrochen. Damit sie wenigstens ab und an zum Schlafen kam, mußte ich sie in Watte einpacken. Ernst unterstützte mich, so gut er konnte. Dennoch war ich bald mit meinen Nerven am Ende. Ich richtete mich innerlich schon darauf ein, meine Tochter niemals gesund zu sehen. Dann aber verschwanden die Geschwüre plötzlich. Die Ernährungsstörungen hörten auf, ohne daß die Ärzte eine schlüssige Erklärung dafür wußten, und traten auch nicht wieder auf. Elly wurde zu unserer Erleichterung ein rechtes Pummelchen. Margarete, unsere zweite Tochter, war wesentlich robuster. Sonst hätte sie wahrscheinlich nicht überlebt, denn unglücklicher Weise brach ein halbes Jahr nach ihrer Geburt die Geldwirtschaft in Deutschland zusammen. Die Inflation entwertete den Lohn so schnell, daß die Frauen ihre Männer 97 jeden Abend am Fabriktor abfingen und sofort einkaufen gingen. Die Arbeiter und kleinen Angestellten traf die Krise am härtesten. Eine Hungersnot brach aus. Wie sollte ich unter diesen Bedingungen einem Kind all das geben, was es brauchte für seine Entwicklung? Die politische Entwicklung der Weimarer Republik von ihrer Gründung 1919 bis zu ihrem Untergang 1933 ist Gegenstand unzähliger Geschichtsbücher. Immer wieder in den vergangenen fünfzig Jahren dachten Menschen darüber nach, wie es zu einer so schrecklichen Erscheinung wie der Nazidiktatur hatte kommen können. Immer wieder entzündeten sich kontroverse Diskussionen daran. Gibt es im deutschen Volk einen Naturdrang zum Bösen? Sind die Großkapitalisten schuld gewesen? Trägt womöglich eine kleine Gruppe von Abenteurern aus der Umgebung Hitlers die alleinige Verantwortung? War alles nur Zufall, nur ein Betriebsunfall der Geschichte? Zu welcher Sicht jeder Einzelne neigt, hängt zweifellos von seinen ganz persönlichen Erlebnissen ab. Manchmal stellt man im Nachhinein fest, daß man sich geirrt hat. Hinterher ist jeder schlauer. Wir wurden damals überrollt von den Ereignissen. Oft kämpften wir um die nackte Existenz und trafen unsere Entscheidungen von einem Tag auf den anderen. Wenn es besonders schlimm für uns aussah, sehnten wir uns nach einer einfachen Lösung. Wer sie uns versprach, dem vertrauten wir. Ist das unmoralisch? Vielleicht. Aber wer von denen, die uns heute verurteilen, könnte so viele Entbehrungen auf sich nehmen wie wir damals? Bis 1923 verging kein Jahr ohne wenigstens ein bedrohliches Ereignis, sei es ein wirtschaftliches, sei es ein politisches. Nur 98 ein paar Monate nach der Gründung der Republik gab es unter General Kapp bereits den ersten Putschversuch. 1921 legten die Siegermächte des Weltkriegs die von Deutschland zu zahlende Reparation fest - 269 Milliarden Reichsmark. Das war eine gewaltige Summe. Wie sollte unser Volk das jemals erarbeiten? Der Vertrag von Rapallo, der die Beziehungen zu Rußland regelte, fiel verglichen damit recht günstig aus. Dennoch gab es radikale Gegner. Der jüdische Außenminister Walter Rathenau wurde deswegen ermordet. Dann kam das Krisenjahr 1923. Wir konnten die Nachrichten gar nicht so schnell begreifen, wie sie eintrafen. Die Inflation schuf eine Not, die mancherorts selbst die Situation der letzten Kriegsjahre übertraf. Die Franzosen besetzten das Ruhrgebiet. Hitler unternahm seinen ersten Umsturzversuch, der als "Marsch auf die Feldherrenhalle" in die Geschichte einging. Die Kommunisten lieferten sich in Hamburg Straßenschlachten mit der Polizei. Im September verhängte die Regierung den Ausnahmezustand über das Reich. In schlechten Zeiten halten die Familien enger zusammen als in guten. Das ist eine Notwendigkeit und heißt nicht, daß alle einander im Grunde ihres Herzens wirklich mögen. Die Spannungen entladen sich später, wenn der Zwang zum Gemeinsinn nicht mehr besteht. Wir drei noch lebenden Schulzetöchter hatten inzwischen geheiratet und damit den Namen der Eltern abgelegt. Zwischen den neuen Familien gab es jedoch so enge Verbindungen, daß man in gewisser Hinsicht von einer Großfamilie reden kann. Wir besuchten einander regelmäßig. Wir erwiesen einander kleine Gefälligkeiten. Wenn es jemandem einmal besonders schlecht ging, standen die anderen für ihn ein. Die umfangreichen Vorhaben bewältigten wir gemeinsam. Die Großfamilie - die ich noch heute in Gedanken ganz selbstverständlich "die Schulzes" nenne, obwohl das, wie gesagt, eigentlich gar nicht berechtigt ist - bot eine gewisse 99 soziale Sicherheit. Die Ärmsten profitierten davon natürlich am meisten, und das waren eindeutig wir, die Maxens. So recht glücklich war ich aber dennoch nicht. Wer am meisten nimmt, hat am wenigsten zu sagen. Ein Mensch mit einem gewissen Maß angeborener Unterwürfigkeit im Charakter mag sich in eine solche Rolle vielleicht noch mit Gelassenheit schicken. Ich aber war leider von gänzlich anderer Art. Ich litt schrecklich darunter, die arme Verwandte zu sein, kam mir oft geradezu vor wie eine Bettlerin. Der Mittelpunkt der Schulze-Großfamilie war das Haus am Schloßplatz. Dort trafen wir uns, wenn es etwas Wichtiges zu bereden gab. Dort fanden die Feiern zu Ostern und Weihnachten statt. Dort lernten die Kinder ihre Cousins und Cousinen kennen. Kurzum - dort spielte sich im Wesentlichen das Gemeinschaftsleben ab. Emma kam deshalb mit ihrer Familie wenigstens fünfmal im Jahr für ein paar Tage von Berlin aus dorthin. Ich war fast jeden Abend dort - sofern ich mich nicht nach einem Streit aus Protest demonstrativ fernhielt, was ziemlich regelmäßig vorkam. Emma hatte seltener Streit als ich. Sie bewunderte Hedwigs Mann Otto und akzeptierte jedes seiner Worte als unumstößliches Gesetz. Für sie war das freilich auch leicht, denn sie wohnte weit weg in Berlin. Otto Bartlitz übernahm am Schloßplatz mehr und mehr das Regiment. Das bedeutete, daß er zunehmend auch versuchte, seine Vorstellungen von Familienleben durchzusetzen. So gefiel es ihm unter anderem nicht, daß seine Frau außer Haus arbeiten ging. Hedwig wiederum wollte sich aber nicht in die Küche verbannen lassen. Deshalb überredete sie ihren Mann, auf dem großen Grundstück Stallungen zu errichten. So konnte sie Verantwortung übernehmen und zum Unterhalt der Familie beitragen. Auch sie hatte eben ihren Stolz. In den Stallungen, die nun entstanden, konnten zehn Schweine gehalten werden. Das Futter brachte Otto größtenteils vom Schlachthof mit. Waren die Tiere dann schön fett, kamen acht von ihnen auf den 100 Markt. Die übrigen beiden lieferten Fleisch und Wurst für alle "Schulzens". Allerdings muß im Zusammenhang mit den Veränderungen im Haus am Schloßplatz auch gesagt werden, daß Otto und Hedwig die Eltern weiterhin sehr in Ehren hielten. Von der Freundschaft zwischen den beiden Männern war schon die Rede. Hedwig kochte für alle das Essen. Dafür durfte die junge Familie mietfrei wohnen. Da gerade von Otto die Rede war, möchte ich die Gelegenheit nutzen, seine Familie kurz vorzustellen. Die Bartlitzeltern waren aus Schlesien nach Köthen gekommen. Zur Familie gehörten neben zwei Söhnen noch vier Töchter. Ottos Bruder Hermann hatte zunächst einige Jahre lang in einer Fleischerei gearbeitet, wo er seine Frau Bertha kennenlernte. Ihr Meister hielt viel von ihnen. Das Verhältnis zu ihm war schließlich sogar so gut, daß er ihnen mit einem Kredit zu einem eigenen Geschäft verhalf. Weil sie mit etwas Glück ziemlich erfolgreich wirtschafteten, konnten sie den Kredit schon bald zurückzahlen und gelangten zu einem gewissen Wohlstand. Ida, die älteste der Schwestern, besaß einen kleinen Gemüseladen. Ihr Mann arbeitete als Dachdecker. Emma kann ich nicht gut einschätzen, denn ich kenne sie praktisch nur von Erzählungen her. Diese Erzählungen wiederum waren fast alle recht bösartig und vermutlich zumindest zum Teil unwahr. Offensichtlich hatte sie sich in Berlin beim Inhaber der bekannten Firma "Osram" vom einfachen Dienstmädchen hochgearbeitet zu einer angesehenen Hausdame. Darüber, wie ihr das gelungen war, mag ich hier nicht spekulieren. Auf jeden Fall ging es ihr damals ausgezeichnet. Frieda fürchteten alle ein wenig ihrer spitzen Zunge wegen. Sie arbeitete in einer Fabrik und brachte von dort eine Menge Selbstbewußtsein mit. Das übertrug sich später auf ihre Tochter Hilde, deren Einfluß auf Elly und Gretchen mir manchmal Sorgen bereitete. Sehr viel sensibler war dagegen Elschen, das jüngste der Geschwister. 101 Als sie ein uneheliches Kind erwartete, nahm sie sich das Leben. Sie wurde gerade zwanzig Jahre alt. Ein Höhepunkt im Leben unserer Großfamilie war das Schlachtfest. Zu diesem Ereignis kamen immer auch die Berliner. Jeder packte mit an, die Kinder eingeschlossen, sobald sie das entsprechende Alter hatten. Die schweren Arbeiten teilten sich Otto, Gustav und Ernst. Die Frauen mußten für saubere Schüsseln und Töpfe sorgen und halfen beim Zubereiten der Wurst. Die Kinder schließlich wurden auf Zuruf mal hier, mal da eingesetzt. Selbstverständlich bekam am Ende jede Familie einen Anteil an Fleisch und Wurst. Das war ein unschätzbarer Vorzug in jenen schlechten Zeiten. Um die Nachbarn, die uns natürlich beneideten, ein wenig zu versöhnen, erhielt jeder von ihnen als Geschenk einen Topf mit einer kräftigen Suppe, in der eine Wurst schwamm. Ein anderes Beispiel für die familienübergreifende Arbeitsteilung waren die großen Waschtage. Da Otto auf dem Schlachthof immer tadellos sauber gekleidet erscheinen mußte, anderseits aber die Arbeit recht schmutzig war, fiel bei ihm immer ein ganzer Berg Wäsche an. Ich half gern. Immerhin gab mir das eine Gelegenheit, mich für die mir erwiesenen Zuwendungen erkenntlich zu zeigen. Beim Wäschewaschen kannte ich mich aus. Ernst arbeitete Anfang der Zwanziger in der Köthener Maschinenfabrik. Dadurch waren wir von den Unruhen jener Jahre unmittelbar betroffen. Sobald es eine der im Mitteldeutschen besonders häufigen politische Auseinandersetzungen gab, wurde in den großen Industriebetrieben gestreikt. Das bedeutete nahezu vollständigen Verdienstausfall, denn anders als heute hatten die Gewerkschaften viel zu wenig Rücklagen, um ihren Mitgliedern einen Ausgleich zahlen zu können. Wir mußten oft wochenlang von dem Wenigen leben, was ich als Lohn für meine Gelegenheitsarbeiten bekam. 102 Für die Kinder wäre es gewiß besser gewesen, wenn ich zumindest eine gewisse Zeit lang hätte zu Hause bleiben können. Gleich nachdem Elly sich von ihren Verdauungsstörungen erholt hatte, brachte ich sie stundenweise am Schloßplatz unter. Rudi fuhr sie frühmorgens im Sportwagen dorthin. Nachmittags holte ich die beiden zusammen wieder ab. Gretchen versuchte ich, so zeitig wie möglich in den Kindergarten zu schicken. Als sie achtzehn Monate alt war, gelang es mir, eine Erzieherin wenigstens zu einer Probezeit zu überreden. Ich versicherte, daß die vierjährige Elly selbständig genug sei, um auf die kleine Schwester aufzupassen. Das wollte sie mir zuerst nicht glauben, konnte sich dann aber überzeugen, daß es die Wahrheit war. Auch unsere Wohnverhältnisse in jenen Jahren waren nicht sehr erfreulich. Am Anfang hatten wir zwei winzige Zimmer, in denen wir uns kaum drehen konnten. Dann zogen wir in eine Wohnung, die zwar etwas größer, dafür aber dunkel und feucht war. Sie lag im Erdgeschoß zum Hof hin, und direkt vor einem der Fenster befand sich ein Misthaufen. Viel Hilfe bekamen wir von meiner Schwiegermutter. Als Gretchen geboren wurde, nahm sie Elly für ein paar Wochen zu sich. Die Kinder überraschte sie oft mit kleinen Geschenken, mit Süßigkeiten oder mit von ihr selbst gestrickten Strümpfen und Handschuhen. Manchmal schenkte sie uns sogar Geld, was ihr Mann, der Bahnbeamte, nicht erfahren durfte. Welch ein gütiger Mensch sie war, zeigte sich noch deutlicher an einer Episode, die nicht uns sondern Ernstens Bruder Fritz betraf. Der hatte als Milchfahrer gearbeitet und sich dabei in eine Bauerstochter verliebt. Das Verhältnis hielt ein paar Wochen, dann mußte er zum Militärdienst, und die beiden trennten sich. Das Mädchen aber war schwanger geworden. Ohne Mann mit einem Kind dazustehen, brachte damals auf einem Dorf eine Menge Nachteile mit sich. So hatte 103 die junge Mutter nicht viel übrig für dieses Kind, obwohl es ein gesunder, hübscher Junge war. Eines Tages stand sie bei den Eltern ihres untreuen Liebhabers vor der Tür und gab ihren Sohn einfach dort ab. Sie behauptete zwar, ihn bald wiederzuholen, ließ sich aber nie wieder blicken. Die Großmutter zog den kleinen Otto groß und schenkte ihm zweifellos mehr Liebe, als die leibliche Mutter es getan hätte. Mitte der zwanziger Jahre verbesserte sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland vorübergehend. Die Währung hatte sich wieder stabilisiert. Der Dawesplan verringerte die Reparationsforderungen. In den Industriebetrieben wurde wieder durchgehend gearbeitet. Die Männer brachten wie vor dem Krieg regelmäßig ihren Lohn nach Hause. Die Familien konnten wieder an die Zukunft denken und nach Befriedigung der Tagesbedürfnisse ein paar Spargroschen beiseite legen. Politisch allerdings blieben die Verhältnisse instabil. Es gab in Deutschland leider Kräfte, die an einer endgültigen Beruhigung nicht interessiert waren. Die Rufe nach Vergeltung für die im Weltkrieg erlittenen Verluste hörten nicht auf, wurden eher immer lauter. Nur der "Dolchstoß" der Kommunisten hätte die Niederlage herbeigeführt. Gemeint war die Novemberrevolution. Daran, daß Deutschland den Krieg begonnen und damit das Unglück herausgefordert hatte, wollten sich kaum noch jemand erinnern. Dabei behandelte uns das Ausland freundlicher als zuvor. Durch die Locarnoverträge zum Beispiel gewannen wir das Ruhrgebiet von den Franzosen zurück. Von rechts und links attackiert, scheiterte eine Regierung nach der anderen. Die Minister kamen und gingen, kaum daß man sich ihre Namen hatte einprägen können. Neue Parteien 104 schossen wie Pilze aus dem Boden. Wir verloren allmählich jede Orientierung, kamen uns verschaukelt vor, wußten nicht mehr, wem wir glauben sollten und wem nicht. Sicherlich ging es vielen anderen Leuten ähnlich. Als 1925 der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert starb, wurde Hindenburg zu seinem Nachfolger gewählt. Der Aufschwung kam natürlich auch uns, den Maxens zugute. Ab 1924 ging es uns spürbar besser. Das ermutigte mich, an die Verwirklichung eines schon lange im Stillen gehegten Traumes zu gehen. Ich wünschte mir ein eigenes Haus. Das war für mich fast so etwas wie eine fixe Idee. Bald kam ich mir in meiner feuchten, finsteren Parterrewohnung vor wie in einem Gefängnis. Ich meinte ersticken zu müssen im Gestank des Misthaufens. Endlich fand sich eine Gelegenheit. Ich entdeckte die Verkaufsanzeige für ein Vierparteienhaus. Es sollte 1000 Reichsmark als Anzahlung kosten. Das war zwar viel Geld, doch rechnete ich mir aus, daß ich den Betrag in wenigen Jahren würde hereinwirtschaften können. Da wir ja nur eine der Wohnungen für uns selbst brauchten, hätten wir Mieteinnahmen. Ein großer Obstgarten versprach ebenfalls Gewinn. Der Rest der Kaufsumme konnte als Hypothek stehen bleiben. Um mein großes Projekt verwirklichen zu können, mußte ich allerdings jemanden finden, der mir die 1000 Reichsmark vorstreckte. Am Schloßplatz wußte ich schon nach den ersten Andeutungen, daß ich erst gar nicht nachzufragen brauchte. Für die Bartlitzens war ich die arme Verwandte, und das sollte ich gefälligst auch bleiben. Mehr Glück hatte ich bei meinen Schwiegereltern. Indem ich all meine Überredungskunst aufbot, gelang es mir schließlich, den Bahnbeamten für meine Sache zu gewinnen. Das Haus wurde also gekauft, und ich war sehr stolz. Allerdings sammelte ich schon recht bald einmal mehr die bittere Erfahrung, daß bei Lichte besehen selbst die schönsten 105 Dinge ihre Schattenseite aufweisen. Am Schloßplatz verübelte man mir, daß ich mich über die mir zugedachte Rolle erhoben hatte, und ließ mich das gelegentlich auch fühlen. Reichlich Ärger gab es zudem mit den Mietern. Die Familie aus der hinteren Wohnung bediente sich heimlich aus unserem Garten. Die Leute aus dem Dachgeschoß stellten unverschämte Forderungen und verhielten sich auch sonst reichlich anmaßend. Sogar das Zurückzahlen des Kredits erwies sich als schwieriger als gedacht. Ich hatte manche Ausgaben einfach nicht eingeplant. Obwohl die Verhältnisse besser geworden waren, mußte ich weiterhin hart arbeiten. Ich trug zwei verschiedene Zeitungen aus, eine frühmorgens, eine am Nachmittag. Oft kam noch eine dritte Arbeit dazu. Das Wochenende gehörte dem Garten. Beim Austragen der Morgenzeitung half Elly mir, bevor sie in die Schule ging. Einmal fragte mich ein Lehrer, woran es liege, daß sie in den ersten Stunden immer etwas abwesend wirkte. Sie wußte zwar eine ganze Menge, arbeitete aber nicht mit, wollte nur ihre Ruhe haben. Vielleicht war ich zu ehrgeizig. Rudi wirft mir das bis zum heutigen Tage vor. Ob ich mein Leben anders gestaltet hätte ohne die ständige Rivalität mit den erfolgreicheren Schwestern? Immerhin ließ Otto kaum eine Gelegenheit vorbeigehen, mich zu provozieren. Einmal ließ er mir durch seinen Sohn Werner zu Silvester ein "Glückspaket" überreichen. Als ich es in freudiger Erwartung auspackte, fand ich ein totes, gerade geborenes Schweinchen. Ich ekelte mich fast zu Tode. Otto wußte das ganz genau. So war er eben. Emma war sehr kinderlieb und holte regelmäßig im Wechsel ihre Nichten und Neffen zu sich nach Berlin. Für die kleinen Jungen und Mädchen, die ansonsten nur ihr Köthen kannten, bedeutete das jedes mal eine Zeit voller aufregender Abenteuer. Allein schon der lärmende Verkehr auf den Straßen war etwas Besonderes. Das Mietshaus der Tante in Charlottenburg bestand aus Dutzenden Wohnungen. Da mußte 106 man als kleiner Fratz schon mächtig aufpassen, um immer die richtige Tür zu erwischen. Onkel Gustav, der noch immer bei der Eisenbahn arbeitete, bekam zweimal im Jahr einen Familienfreifahrtschein. Damit konnte er gemeinsam mit seiner Frau und beliebig vielen Kindern so weit fahren, wie er mochte. Rudi kam auf diese Weise einmal in den Genuß eines Ausflugs bis nach Berchtesgaden. Davon erzählte er noch Jahre später mit leuchtenden Augen. Viel Spaß hatten die Kinder auch auf dem Grundstück, das die Familie Schatz bei Falkensee am Rande Berlins besaß. Es lag inmitten einer großen Kolonie. In einem Holzhäuschen konnte man essen, kurze Regengüsse abwarten und zur Not auch übernachten. Etliche Leute, die in der Stadt ihre Miete nicht mehr bezahlen konnten, wohnten sogar ständig in Kleingärten dieser Art. Natürlich kam es auch vor, daß es einmal der Aufregung mehr gab, als allen Beteiligten lieb sein konnte. Als Werner Schatz zehn Jahre alt war, erhielt er den Auftrag, seine fünfjährige Schwester Irmchen und die sechsjährige Elly auf dem Spielplatz in der Nähe der Charlottenburger Wohnung zu beaufsichtigen. Er hätte zwar lieber etwas anderes getan, fügte sich dann aber murrend in sein Schicksal. Um die beiden zu amüsieren, spielte er mit ihnen "Wilder Westen". Als Requisit diente ein Stück Holz, das entfernt an eine Pistole erinnerte. Einige Zeit ging das gut, dann fing Irmchen plötzlich zu quengeln an. Sie langweile sich, zu Hause sei es viel schöner, die Beine täten ihr weh. Werner überraschte das nicht. Irmchen, die unter so dramatischen Umständen auf die Welt gekommen war, wurde von den Eltern maßlos verwöhnt. Was sie haben wollte, das bekam sie auch. Da sie unglücklicher Weise eine nervöse, reizbare Grundveranlagung besaß, verbog sich ihr Charakter immer mehr. Sie war an manchen Tagen wirklich unausstehlich. 107 Eingedenk dessen entschloß sich Werner zu einer Radikalkur. Er richtete die Holzpistole auf seine zeternde Schwester und herrschte sie an: "Entweder du parierst jetzt oder ich schieße dich tot." Irmchen konnte noch nicht so recht zwischen Spiel und Wirklichkeit unterscheiden und erschrak so sehr, daß sie mit gellendem Geschrei davonlief. Elly ließ sich von ihrer Panik anstecken und folgte ihr. Werner dachte sich zu diesem Zeitpunkt noch nichts Böses. Er war sogar recht zufrieden mit dem erzielten Ergebnis. Erst nach etwa einer Stunde wurde er unruhig. Warum kamen die beiden nicht zurück? Wo steckten sie? Er suchte im nächsten Umkreis. Vergeblich. Er lief nach Hause. Auch dort waren sie nicht. Als er in der Nähe eines Teiches einen von Irmchens Schuhen fand, erfuhr er am eigenen Leib, wie es ist, wenn man Angst hat. Er schwor sich hoch und heilig, nie wieder dergleichen Schabernack zu treiben. Eigentlich war er ja auch alles andere als ein Rüpel. Er gehörte zu den besten Schülern seiner Klasse und bereitete seinen Eltern fast nur Freude. Doch das alles zählte nicht in diesem Moment. Die Dunkelheit brach herein. Er mußte nach Hause gehen und beichten. Emma und Gustav gerieten bei der Nachricht in helle Aufregung und alarmierten die Polizei. Ein verständnisvoller Diensthabenden rief sofort bei allen Revieren der Umgebung an. Dabei hatte er schließlich Erfolg. Die beiden Mädchen waren einer Streife aufgefallen und saßen inzwischen wohlverwahrt auf einer Wache. Dort hatten sie den Schreck vom Nachmittag längst überwunden und genossen es nun, mit den freundlichen Männern in Uniform spielen zu dürfen. Weihnachten war in jedem Jahr ein großes Ereignis. Auch wenn es uns manchmal schwer fiel, versuchten wir zu diesem Fest immer, den Kindern irgend eine besondere Freude zu bereiten. Wenn wir ihnen nichts kaufen konnten, dann bastelten wir ihnen wenigstens etwas. Immerhin steckte in diesen einfachen Gaben mehr Liebe als in manchen teuren 108 Geschenken von heute. Umgekehrt lösten die kleinen Spielzeuge bei den Kindern wahre Begeisterungsstürme aus und wurden lang in Ehren gehalten. Auch das hat sich geändert. Die Feier fand im Haus am Schloßplatz statt. Wo auch sonst? Die gesamte Großfamilie kam dort zusammen - die Eltern, die Bartlitzens, die Berliner und wir Maxens. Nur Franz fehlte. Er feierte mit der Familie seiner Frau in Hannover. Die besondere Stimmung des Heiligen Abends glättete alle Wogen, die im Laufe des Jahres aufgeschäumt sein mochten. Es ging immer recht harmonisch zu. Einmal allerdings gab es einen - zumindest für die Kinder - ziemlich aufregenden Zwischenfall. Als wir in der Stube beim Kaffeetrinken beieinandersaßen, ging plötzlich die Tür auf und eine große Gestalt mit weißem Gewand und schwarzen Stiefeln kam herein. Die Kinder kreischten auf und versteckten sich. Selbst der sonst ziemlich freche Werner Bartlitz krallte sich im Rock seiner Mutter fest. Lediglich Rudi, der schon etwas älter war, hielt tapfer die Stellung. So ganz wohl in seiner Haut fühlte freilich auch er sich nicht. Da stand der Weihnachtsmann nun da mit seinem großen Sack und vermochte kein Kind dazu bewegen, sich ihm wenigstens auf einen Meter zu nähern. Am Ende blieb ihm nichts anderes übrig, als die Geschenke auf den Tisch zu legen und dann wieder zu gehen. Vater hatte es gut gemeint, aber in seiner Verkleidung war er einem Gespenst sehr viel ähnlicher als einem Weihnachtsmann. In gewisser Hinsicht ist diese kleine Episode typisch für Vaters Verhältnis zu seinen Enkeln. Er mochte sie eigentlich von ganzem Herzen. Da er jedoch eine gewisse Strenge, die das Leben ihn als Notwendigkeit gelehrt hatte, niemals ganz abzulegen vermochte, gingen ihm die Kinder mit ehrfürchtiger Scheu aus dem Wege. Er war inzwischen über siebzig Jahre alt. Noch immer nahm er hin und wieder kleine Aufträge an. Noch immer genoß er 109 einen so guten Ruf, daß er trotz der schlechten Wirtschaftslage auch welche bekam. Doch mehr und mehr verweigerte der Körper den Dienst. Da nutze schließlich auch die Berufserfahrung nichts mehr, ebenso wenig wie der unbändige Wille, der Familie nützlich zu bleiben. Eines Tages bat Hedwig ihn, das auf kleinem Feuer kochende Essen zu beaufsichtigen. Sie wollte die frisch gewaschene Wäsche zur Heißmangel bringen. Nach einer dreiviertel Stunde kehrte sie zurück. Sie fand alles ordentlich vor. Als sie Vater jedoch zu Tisch rief, kam er nicht. Daraufhin ging sie, noch immer nichts Schlimmes ahnend, zu ihm ins Zimmer. Er lag auf dem Sofa ausgestreckt und sah aus, als schliefe er. Sie Gesichtszüge waren entspannt. Hedwig rief ihn, rüttelte ihn. Er reagierte nicht. Da erst begriff sie, daß er nicht mehr lebte. Vermutlich hatte er sich einen solchen Tod gewünscht. Er war gestorben, ohne zuvor starke Schmerzen ertragen zu müssen und ohne anderen durch langes Siechtum zur Last zu fallen. Er verließ die Welt mit der selben Würde wie er dreiundsiebzig Jahre darin gelebt hatte. Kaum jemand, der mit ihm verwandt war oder ihn näher kannte, versäumte es, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Die Köthener Verwandten bildeten die Spitze des langen Trauerzuges: Mutter, Hedwig, Otto und der inzwischen siebenjährige Werner Bartlitz; dahinter Ernst und ich mit Rudi, Elly und dem sechsjährigen Gretchen. Aus Hannover waren Franz und Henny mit ihren drei Söhnen gekommen, aus Berlin Emma und Gustav mit Werner Schatz und Irmchen. Stellungslose Arbeiter erinnerten sich am Grab jener Jahre, in denen sie noch guten Lohn verdient hatten. Geschäftspartner verabschiedeten einen stets redlichen Unternehmer. Auch Nachbarn waren unter den Trauergästen auf dem Friedhof. Aus heutiger Sicht erscheint mir das Jahr 1929 wie ein Schicksalsjahr für die Schulzes. Am 24. Oktober, nicht lange nach Vaters Tod, begann mit dem "Schwarzen Freitag" die 110 Weltwirtschaftskrise. Die Hochachtung vor Vater konnte nicht ganz verdecken, daß seine Hoffnungen sich nicht erfüllt hatten, seine Voraussagen nicht eingetroffen waren. Nach dem Weltkrieg hatte die Sozialdemokratie immerhin die Macht errungen - ein Erfolg, wenngleich ein viel zu teuer erkaufter. Nun aber war auch dieser Versuch, eine bessere Gesellschaft aufzubauen, allem Anschein nach gescheitert. Die alten Ideale galten nicht mehr, neue gab es noch nicht. In diese Leere drangen die Nazis ein. So ging es zweifellos nicht nur den Schulzes. Bei uns aber war eben zur gleichen Zeit auch derjenige gestorben, der uns jahrzehntelang ganz persönlich Rat und Halt gegeben hatte. 111 5. Kapitel Gretchen erzählt Nachdem ich drei Kapitel lang meine Mutter habe berichten lassen, werde ich ab jetzt den Erzählfaden wieder selbst aufnehmen. Ich bin in der Handlung nunmehr sechs Jahre alt. Um diese Zeit begann ich, bewußt wahrzunehmen, was in meiner Umgebung geschah. Meine frühesten Erinnerungen reichen freilich noch weiter zurück. Zum Beispiel sehe ich ganz deutlich die Küche unserer Parterrewohnung vor mir. Sie erscheint mir riesengroß, was sicher ein falscher Eindruck ist. An der Tür hing eine Petroleumlampe, vor der ich großen Respekt hatte, weil Kinder sie unter keinen Umständen berühren durften. Einmal war ich über eine Leiter einen Baum hinaufgeklettert. Als ich nun hoch oben auf einem Ast saß, nahmen meine Geschwister die Leiter weg. Dafür wurden sie dann vom Maxgroßvater tüchtig ausgeschimpft. Ein andermal hatten wir einen Bienenschwarm im Garten. Da kam dann der Imker mit Maske und Umhang, um sie zurückzuholen. Weil er in seiner Arbeitskleidung so gar nicht aussah wie ein Mensch, erschrak ich ganz furchtbar vor ihm. Dies alles sind aber nur Splitter ohne Zusammenhalt. Geordnete Erinnerungen setzen erst etwa zu dem Zeitpunkt ein, als der Schulzegroßvater starb. Ich trug ein schwarzes Kleid und begriff nicht, wie ein so großer Mensch in eine so kleine Urne hineingelangen konnte. Überhaupt vermochte ich mir den Tod nicht recht vorzustellen. Ganz genau wußte ich nur, daß der Großvater nun nicht mehr am Schloßplatz wohnte. Das nämlich hatte mein Muttchen mir erklärt. Selbstverständlich entging mir in jenen Jahren noch so manches. Viele Themen wurden in Gegenwart von Kindern 112 grundsätzlich nicht angeschnitten. Damit aber die ohnehin schon komplizierte Geschichte der Schulzefamilie nicht noch unübersichtlicher wird, berichte ich in chronologisch richtiger Reihenfolge auch jene Begebenheiten, von denen ich erst später erfuhr oder deren Bedeutung ich erst später verstand. Ein Jahr nach Großvaters Tod lernte mein Onkel Max eine Frau kennen und wollte heiraten. Das war eines von den Themen, bei denen man mich zum Spielen nach draußen schickte. Zu Onkel Max pflegten wir kaum Kontakt. Wenn ich ihm begegnete, hatte ich immer ein bißchen Angst - wegen seiner dichten, tiefschwarzen Haare, wegen seiner buschigen, dunklen Augenbrauen, die ihn sehr ernst erscheinen ließen, und auch weil Muttchen ihn nicht mochte. Heute kenne ich sein Schicksal und bereue meine Reserviertheit. Ich vermochte mich leider nie zu überwinden, bis zu seinem Tode nicht. Seine Frau lernte ich kaum kennen. Sie hieß Änne, war eine Bauerstochter und hatte schon jung ihre Eltern verloren. Weil sie einen ansehnlichen Hof erbte, stellten sich reichlich Freier bei ihr ein. Zum Mann nahm sie sich schließlich einen, der ihr durch sein unbeschwertes Wesen die düsteren Erinnerungen vertrieb. Er führte sie zum Tanz und brachte sie mit lustigen Streichen zum Lachen. Kaum jedoch war er Bauer geworden, entpuppte er sich als notorischer Faulpelz. Bis Mittags räkelte er sich im Bett. Am Abend zechte er mit Kumpanen im Gasthof. Änne hielt allein den Hof in Schwung. Sie beaufsichtigte die Dienstleute, faßte selbst mit zu. Als sie dann aber zwei Kinder hatte, konnte sie sich beim besten Willen nicht mehr um alles kümmern und verlor den Überblick. Schließlich war der Hof derart verschuldet, daß er versteigert werden mußte. Änne ließ sich scheiden, doch sie hatte praktisch durch die Ehe ihr gesamtes Vermögen verloren. Als Großmutter von diesem Schicksal hörte, tat Änne ihr von Herzen leid, vor allem weil die junge Frau trotz allem sanft und freundlich war. Deshalb rang sie sich zu etwas recht Ungewöhnlichem durch - sie warnte vor ihrem eigenen Sohn. 113 "Er ist kein Familienmensch. Sie werden nicht glücklich sein mit ihm." Änne indes glaubte ihr nicht. "Er ist fleißig, und er ist nett zu mir. Warum also soll er kein Familienmensch sein?" "Ich liebe ihn und gönne ihm alles erdenklich Gute. Aber es gibt nun einmal manches, wozu er nicht geschaffen ist." Änne nahm trotz Großmutters Abraten ihr Versprechen an Max nicht zurück. Ihren fast schulpflichtigen Sohn ließ sie bei einer Tante. Ihre dreijährige Tochter Ilse brachte sie mit in die neue Ehe. Nach wenigen Wochen merkte Änne, was ihre Schwiegermutter gemeint hatte. Max verbrachte viel Zeit außer Haus. Er betrank sich zwar nicht, doch er wollte die langen Abende mit seinen alten Freunden nicht missen. Seine junge Frau fühlte sich - nicht ganz zu Unrecht - hintangesetzt. In einer Zeit, in der das Eheleben eigentlich noch gänzlich von der Liebe geprägt sein müßte, kam es immer wieder zu Streitereien zwischen den beiden. Ännes Lebensweg ist einer von jener Art, die ein Beweis für die Ungerechtigkeit des Schicksals zu sein scheinen. Ihre Sanftheit wurde niemals belohnt. Als sie ein Kind von Max bekam, erging es ihr ähnlich wie zuvor meiner Tante Martha. Sie erkrankte im achten Schwangerschaftsmonat und starb wenig später bei der Entbindung. Einen Unterschied allerdings gab es - diesmal überlebte das Kind. Es war ein Mädchen und erhielt den Namen Helga. Ich erinnere mich gut daran, wie ich Helga zum ersten Mal sah. Wir besuchten sie im Krankenhaus, wo sie noch ziemlich lange bleiben mußte, weil sie sehr schwach war. Sie blickte uns aus großen, ernsten Augen an, und es hatte den Anschein, als wüßte sie, daß sie ohne Eltern aufwachsen würde. Offenbar wollte sie auf den Arm genommen und geschmust werden, doch ihre Ärmchen griffen immer wieder ins Leere. 114 Da sich niemand fand, das Baby zu betreuen - Max mußte arbeiten und hatte auch kein rechtes Interesse, die Großmutter traute sich mit ihrer verkrüppelten Hand eine so verantwortungsvolle Aufgabe nicht mehr zu und Ännes Verwandten bekamen ohnehin schon die kleine Ilse - suchte das Jugendamt nach einer Pflegefamilie. Da Helga noch sehr klein war, fand sich bald ein geeignetes Ehepaar. Die beiden konnten keine eigenen Kinder bekommen und wollten das Mädchen später adoptieren. Die Weltwirtschaftskrise veränderte auch das Leben unserer Familie von Grund auf. Nachdem der Streit mit ihren Mietern ins Unerträgliche entartet war, hatte Muttchen ihr Haus wieder verkauft und für den Erlös ein anderes, gerade fertig gebautes, nur für zwei Parteien eingerichtetes erworben. So brauchte sie nur noch mit einer fremden Familie unter einem Dach auszukommen. Nun tauchten plötzlich leise Gerüchte auf, daß mit der Baugesellschaft, die das gesamte Viertel projektiert hatte, irgend etwas nicht mehr stimme. Daraufhin verkauften meine Eltern das Haus wieder und zogen in eine Mietwohnung. Wenig später brach die Gesellschaft zusammen. Das Viertel wurde nicht fertiggestellt. Viele Leute verloren eine Menge Geld. Hatten wir bei dieser Sache noch Glück, so teilten wir in anderer Hinsicht das Schicksal der meisten Arbeiterfamilien. Vater wurde entlassen und bekam nur noch eine geringe Unterstützung. Muttchen, deren Gelegenheitseinkommen nun wichtiger war denn je, übernahm jede Beschäftigung, die man ihr anbot. Als Frau wurde sie zwar erbärmlich bezahlt, hatte aber immerhin noch hier und da Chancen. Natürlich war sie völlig überlastet. Vater durfte ihr nicht helfen. Überall lauerten Schnüffler. Hätte man ihn nur ein einziges mal ertappt, wäre ihm für alle Zeit die Unterstützung gestrichen worden. Für uns Kinder gab es dagegen keine Einschränkungen. Inzwischen hatte auch ich das Alter, um wie meine Geschwister Zeitungen auszutragen. Mir fiel dabei eine Nachmittagstour zu, bei der 115 ziemlich viele Treppen zu bewältigen waren. Elly ging stundenweise zu einer alten Frau. Sie bekam dort zwar so gut wie keinen Lohn, dafür aber Essen und Kleidung. Die materiellen Einschränkungen waren allerdings nicht das Schlimmste. Wir litten vor allem darunter, daß das Familienleben völlig aus den Fugen geriet. Vater saß zu Hause und kam sich nutzlos vor. Anfangs versuchte er, seine Frau wenigstens in der Wohnung zu unterstützen. Den Haushalt aber wollte Muttchen sich aus Prinzip nicht aus der Hand nehmen lassen. Beide gerieten darüber in Streit, und es gab manch unschöne Szene. Überhaupt war Muttchen ständig gereizt. Für uns Kinder setzte es schon beim kleinsten Anlaß Ohrfeigen. Anderseits hatten unsere Eltern durchaus Verständnis für uns und versuchten gelegentlich, uns ein wenig zu entschädigen. Wenn Schützenfest oder Jahrmarkt in Köthen war, dann gingen sie mit uns hin, selbst wenn sich erst nach Einbruch der Dunkelheit die Gelegenheit dafür bot. Wir durften Karussell fahren und bekamen jeder eine Bockwurst oder eine kleine Tüte gebrannter Mandeln. Im Übrigen ging es nicht nur uns Maxens schlecht. In der weiteren Umgebung von Halle und Leipzig konzentrierten sich viele Industriebetriebe. Etliche davon gingen in der Wirtschaftskrise bankrott. Andere reduzierten drastisch ihre Belegschaft. Daraus ergab sich eine Arbeitslosigkeit in nie dagewesenem Ausmaß. Mehr noch als während der Inflation 1923 suchten die Menschen verzweifelt nach einem Ausweg. Mehr noch als damals tendierten sie zu extremen Entscheidungen. Den kleinen Parteien vertraute kaum noch jemand. Auch das Ansehen der SPD und des christlichen "Zentrums" sank dramatisch. Dafür gewann Hitlers NSDAP gewaltig an Zulauf. Da aber auch die Kommunisten stärker wurden, bahnte sich ein erbarmungsloser Entscheidungskampf zwischen dem äußersten linken und dem äußersten rechten Lager an. 116 Selbst in unserer kleinen, einstmals so ruhigen Stadt Köthen schlossen immer mehr Leute sich den verschiedenen radikalen Organisationen an. Menschen, von denen man geglaubt hatte, sie könnten keiner Fliege etwas zuleide tun, bewaffneten sich plötzlich mit Schlagringen, Stöcken, Steinen und noch schlimmeren Instrumenten und gingen damit auf Andersdenkende los. Zu bestimmten Veranstaltungen wagten sich friedliebende Bürger schon gar nicht mehr hin, weil mit handfesten Krawallen zu rechnen war. Manchmal eskalierten die Auseinandersetzungen zu regelrechten Straßenschlachten. Es hatte den Anschein, als stände das Land kurz vor einem Bürgerkrieg. Allerdings dachten die Parteien auch daran, daß sie gewählt werden mußten, um auf legalem Wege an die Macht zu kommen. Kommunisten wie auch Nazis buhlten um die Unentschlossenen und entfesselten jeder für sich eine ungeheure Propagandawelle. Die Versprechungen wurden dabei immer märchenhafter, die Beschimpfungen des Gegners immer unflätiger. Meine Eltern gerieten einmal durch Zufall in eine Versammlung der KPD. Gleich am Eingang begrüßte sie jemand überaus freundlich, und weil der Saal überfüllt war, holte man eilig zwei zusätzliche Stühle von irgendwo her. Muttchen allerdings ließ sich mehr von den Bartlitzens beeinflussen als von jedem noch so glänzenden Redner. Manchmal verstand ich sie einfach nicht. Es verging kaum ein Tag, an dem sie sich nicht über Onkel Otto oder über Tante Hedwig oder über beide gleichzeitig bitter beklagte. Dennoch lief sie mindestens dreimal in der Woche zum Schloßplatz und war todunglücklich, wenn man dort eine ihrer Entscheidungen nicht ausdrücklich guthieß. Onkel Otto hatte eine klare Meinung zu den Ereignissen im Land. Die Gesetze seien viel zu liberal. Jeder dürfe tun und lassen, was er wolle. Dadurch müsse ständig draufzahlen, wer ehrlich und fleißig ist, während leicht zu Reichtum komme, wer betrügt und aus Faulheit auf Kosten anderer lebt. 117 "Schaut euch doch nur den Reichstag an! Da wird geredet und geredet. Jeder Schwätzer darf da seinen Senf dazugeben. Dabei müßten endlich mal ein paar vernünftige Gesetze verabschiedet werden." Damit waren im Grunde die Weichen gestellt. Gemeinsam mit seinem Bruder Hermann trat er schon bald der NSDAP bei. Welche Konsequenzen solche Entscheidungen einmal haben würden, das ahnten damals meine Eltern genau so wenig wie meine Onkels und Tanten. Ein Kind wie ich verstand die politischen Zusammenhänge natürlich erst recht nicht. Ich spürte aber, daß sich da etwas sehr Bedrohliches zusammenbraute. Die Schlägereien auf der Straße verfolgten mich bis in die Träume hinein, obwohl mir persönlich nie jemand zu nahe trat. Als ich einmal in Berlin bei Tante Emma zu Besuch war, antwortete ich auf die Frage, was es denn in Köthen Neues gebe, mit einer Aufzählung aller Krawalle, von denen ich in der zurückliegenden Woche erfahren hatte. Die Erwachsenen fanden das lustig. Übrigens interessierte sich Tante Emma damals generell für Politik nicht so besonders. Ihr Mann hatte als Eisenbahner einen krisensicheren Arbeitsplatz, so daß die Familie keine Not zu leiden brauchte. Vielleicht mutet es eigenartig an, wenn ich nach den Beschreibungen der Not und der Gewalt jener Jahre jetzt versichere, daß ausgerechnet in diese Zeit hinein das schönste Weihnachtsfest meines ganzen Lebens fiel. Was war eigentlich so anders an Heiligabend 1930? Wie immer stand in der Stube ein prächtig geschmückter Tannenbaum. Wie immer saßen wir im Kreis und sangen Lieder. Wie immer wurden Geschenke verteilt. Wenn ich jedoch die Augen schließe, dann sehe ich eine verzauberte Welt vor mir. Die Kugeln am Baum sind so bunt wie nie. Das Silberpapier glitzert und blitzt, daß es fast blendet. Kleine, rotbäckige Äpfel lugen dazwischen hervor, spiegelblank poliert. Und auch von den Geschenken geht ein eigenartiger Glanz aus. Vater hat ein 118 Hexenhäuschen gebastelt. Durch die Fenster schimmert rötliches Licht. Die Puppenstube bekommt neue Möbel - Schränkchen und ein winziges Tischchen mit Stühlchen darum. Mein Bruder Rudi hat neue Kleider genäht für meine Puppen. Das großartigste Geschenk aber ist ein Kaufmannsladen, viel schöner als je einer in einem Geschäft stand. Einer meiner Cousins väterlicherseits, ein Tischler von Beruf, hat ihn aus Margarinekisten angefertigt. Die Schubladen sind gefüllt mit Süßigkeiten - Zuckerzeug der Maxgroßmutter. Während wir Kinder mit unseren Geschenken spielen, bedient Vater ein altes Grammophon. Es stammt von einer Versteigerung und ist nicht viel wert. Dauernd müssen die Nadeln ausgewechselt werden, und wenn man nicht gleichmäßig an der Kurbel dreht, hört sich die Musik schauerlich an. Aber niemanden stört das. Muttchen sieht uns eine Weile zu, dann schläft sie auf dem Sofa ein. Wir verhalten uns mucksmäuschenstill, damit sie nicht wach wird und uns ins Bett schickt. Ich öffne die Augen und sehe mich um in meiner schönen Neubauwohnung, in der es an nichts fehlt, zumindest an nichts, was ich vermisse. Und dennoch - verglichen mit der fürstlichen Pracht jener Erinnerung erscheint sie mir nahezu ärmlich. Anfang 1931 tauchte am Schloßplatz ein Mann auf, der Otto Bartlitz sprechen wollte, unter vier Augen, wie er betonte. Er war ein Parteifreund aus der NSDAP. Die Unterredung dauerte knapp eine Stunde. Dann ging der Mann wieder, allem Anschein nach sehr zufrieden. Zum Abschied sagte er: "Etwas anderes hätte ich auch gar nicht erwartet." Drei Tage später eröffnete Otto seiner Frau, daß er der SS beigetreten sei. 119 "Wir schützen unsere Versammlungen vor Überfällen der Kommunisten, viel mehr passiert da nicht", beschwichtigte er. "Der Hermann macht auch mit." Tante Hethe war dennoch zunächst nicht sonderlich begeistert. Sie fürchtete, ihr Mann würde in gefährliche Krawalle verwickelt und dabei womöglich ernsthaft verletzt werden. Erst als sie ihn zum ersten mal in seiner schmucken neuen Uniform sah, änderte sie ihre Meinung. Nun war sie stolz auf ihn. Die Nationalsozialisten holten Deutschland aus dem Elend heraus, und er leistete einen Beitrag dazu. Das jedenfalls glaubte sie. Die gemeinsamen Einsätze mit ihrer SS-Gruppe brachten die Brüder einander näher. Sie trafen sich auch außerhalb des Dienstes regelmäßig, meistens am Schloßplatz. Dabei redeten sie natürlich vor allem über Politik. Darüber hinaus schmiedeten sie aber auch erste gemeinsame Zukunftspläne. Immerhin hatten sie den selben Beruf. Nun sollte allerdings nicht der Eindruck entstehen, die beiden wären einander wie Zwillinge ähnlich gewesen. Das stimmte allenfalls, was die Statur angeht. Hermann hatte eine sehr viel leichtere Lebenseinstellung als sein Bruder. Er nahm es mit der ehelichen Treue nicht so genau, liebte das Abenteuer und amüsierte sich, wie und wo er nur konnte. Nachdem die Bartlitzmänner in die SS eingetreten waren, dauerte es nicht mehr allzu lange, da redete auch Muttchen ständig davon, daß Deutschland, wenn überhaupt, nur durch Hitler und seine Partei gerettet werden könne. Dabei sah sie jedesmal bedeutungsvoll zu Vater hinüber. Der allerdings war von ganz anderer Art als Onkel Otto. Direkt angesprochen, meinte er nur: "Warum sollen wir uns da vordrängen? Wer weiß, ob das gut geht!" Muttchen indes ließ nicht locker. 120 "Tritt wenigstens in die Partei ein! Wenn du da schon jetzt mitmachst, gehörst du, wenn es wieder aufwärts geht mit der Wirtschaft, gleich zu den ersten, die Arbeit kriegen." Arbeit haben, wollte Vater gern. Mit Muttchen sich streiten, wollte er nicht. Also ließ er sich einschreiben. Ein so strammer Nationalsozialist freilich wie sein Schwager wurde er, zu Muttchens Kummer, nie. Ich konnte Vater verstehen und war froh, daß er nicht wurde wie Onkel Otto. Den nämlich konnte ich nicht leiden. Er ärgerte nicht nur Muttchen sondern auch mich. Wahrscheinlich spürte er, daß ich gegen seine grobe Art kein Mittel wußte. Wenn er seine Uniform trug, hatte ich richtig Angst vor ihm. Ich mußte dann sofort an die Schlägereien auf den Straßen denken. Überhaupt war mir nicht wohl bei dem Gedanken, daß die Männer mit den braunen Hemden bald das Sagen im Land haben sollten. Muttchen allerdings versicherte mir, daß ich mich überhaupt nicht zu sorgen brauche. Vater werde wieder Arbeit bekommen. Mit den Krawallen sei es auch in ein paar Wochen vorbei. Ich solle nur Vertrauen haben und ein wenig Geduld. Für einen kurzen Moment beruhigte mich das. Dann packten mich wieder die Zweifel. An Hitlers Staatsstreich erinnere ich mich noch gut. Muttchen ließ es sich nicht nehmen, am 30. Januar 1933 beim großen Fackelzug in Berlin als Zuschauer dabeizusein, obgleich wir gewiß nicht genug Geld hatten, um es zum Fenster hinauswerfen zu können. Wahrscheinlich glaubte sie ganz fest, daß schlagartig eine bessere Zeit anbrechen würde. Kaum waren die Nazis an der Macht, da begannen sie gegen die Juden zu hetzen. Auf dem Wege zur Schule kam ich an einem Schaukasten vorbei, wo die Zeitung "Der Stürmer" aushing. Als ich einigermaßen lesen konnte, blieb ich dort regelmäßig stehen. Da wurde zum Beispiel davon berichtet, wie manche Juden deutsche Arbeiter und Angestellte ausbeuteten. Das konnte ich mir durchaus vorstellen. Es gab im 121 ganzen Land riesige Warenhäuser, die jüdischen Unternehmern gehörten. Wenn Eltern in Köthen eines ihrer Kinder ermahnen wollten, sich in der Schule anzustrengen, dann sagten sie manchmal: "Wenn du nichts lernst, mußt du später bei »Cohn« die Schaukelpferde füttern." Dann war die Rede davon, daß jüdische Ärzte häufig deutsche Frauen unter der Narkose vergewaltigten. Das konnte ich nicht nachprüfen. Daß sämtliche Juden schlechte Menschen seien, ohne Unterschied, von Geburt her schon, das mochte ich jedoch nicht recht glauben. Immerhin kannte ich auch einige sehr nette Juden. Letztlich machten mich diese Artikel ganz wirr im Kopf. Wäre Muttchen zu Ohren gekommen, daß ich sie lese, hätte sie mir das gewiß verboten. Ich erzählte ihr aber nichts davon. Bald begnügten sich die Nazis nicht mehr mit bösartigen Artikeln. Damit die Leute ihrem Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte auch wirklich Folge leisteten, stellten sich SAMänner davor auf. Wollte nun jemand, sei es aus alter Gewohnheit, sei es aus Trotz, weiterhin dort einkaufen, weil er immer dort eingekauft hatte, dann mußte er die übelsten Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Spätestens von nun an taten die Juden mir leid. Dann kam die sogenannte Reichskristallnacht. Die Synagoge ging in Flammen auf. Geschäfte wurden zertrümmert und geplündert. SA und SS veranstalteten regelrechte Hetzjagden. Als Muttchen tags darauf durch die Stadt ging, erschrak sie. Sosehr sie den Nazis auch vertraute - das konnte selbst sie nicht verstehen. "Das sind doch Zeitungskunden von mir gewesen", sagte sie fassungslos. "Die haben immer pünktlich bezahlt und uns zu Weihnachten ein Festpaket geschenkt." Allerdings hatte sie rasch ein Argument zur Selbstberuhigung parat: "Davon wußte der Führer nichts. Das hätte er bestimmt nicht zugelassen." 122 Für Onkel Otto hatte die Nacht noch ein kleines persönliches Nachspiel. Er war am Vorabend nicht am Treffpunkt seiner SSGruppe erscheinen. Prompt stellte sich jener Herr, der ihn einst geworben hatte, abermals am Schloßplatz ein. Diesmal dauerte die Unterredung mehr als zwei Stunden. Onkel Otto war freilich nicht auf den Mund gefallen. Als der Parteifreund wieder ging, hatte er bei ihm sämtliche Zweifel an seiner Linientreue gründlich zerstreut. "Hättest du uns rechtzeitig Bescheid gesagte, wäre uns mancher Ärger erspart geblieben." "Alles klar! Heil Hitler!" "Heil Hitler!" Zu seiner Frau sagte Otto hinterher halblaut: "Was soll dieser Unfug? Wie denken die sich das? Ich gehe zu den Juden schlachten und verdiene dabei gutes Geld. Wer schlägt denn seinen eigenen Kunden die Scheiben ein?" Die Repressalien gegen die Juden gingen nun aber erst richtig los. An den Eingängen der Grünanlagen standen plötzlich Schilder mit der Aufschrift: "Für Juden betreten verboten." Die großen, Juden gehörenden Warenhäuser wurden enteignet und an "arische" Unternehmer übergeben. Niemand konnte mehr ernsthaft glauben, daß dies alles gegen Hitlers Willen geschehe. Auch die Juden selbst nicht. Wer reich genug war, floh ins Ausland. Die Mehrheit hatte diese Möglichkeit nicht und traute sich kaum noch aus dem Haus. Bis zur systematischen Ermordung war es nur noch ein kleiner Schritt. Die Pläne dafür lagen längst an geheimer Stelle in Stahltresoren bereit. Wir wurden auch Zeugen von Verhaftungen. Von manchen der Festgenommenen wußten wir, daß sie Kommunisten waren. Bei anderen kannten wir den Grund nicht. Wohin diese Leute kamen, das erzählte man sich "im Vertrauen". Es gäbe neuerdings eine besondere Art von Gefängnissen, solche in denen die Häftlinge ans Arbeiten gewöhnt werden sollten. 123 "Für manche ist so etwas gar nicht schlecht", meinte Muttchen. Daß nicht nur Juden, Kommunisten und Arbeitsscheue in die Mühlen der Faschisten geraten konnten, erfuhren wir einmal am eigenen Leibe. Wir standen am Straßenrand und sahen zu, wie ein SA-Trupp mit Hakenkreuzfahne vorneweg vorbeimarschierte. Dabei vergaßen wir glatt, die Hand zum Hitlergruß zu erheben. Als wir weitergehen wollten, versperrte eine Frau uns den Weg und beschimpfte uns. Zum Glück zeigte sie uns nicht an. Manch anderer wurde auf Grund ähnlicher Bagatellen zum "Volksfeind" abgestempelt. Leider vergißt der Mensch Szenen, die nicht in sein Wunschbild hineinpassen, sehr schnell wieder. So war es auch bei Muttchen. Mehr und mehr wurde der Alltag beherrscht von Ritualen, die wir Kinder ziemlich albern fanden. Beim Betreten eines Geschäftes mußte man einen Hitlergruß mit angewinkeltem Arm entrichten. Hielt der Führer eine Rede, trafen sich alle Schüler in der Turnhalle. Dort hörten wir sie uns dann gemeinsam an. Außerhalb der Schule sollten wir bestimmten Organisationen beitreten - die Jungen der "Hitlerjugend", die Mädchen dem "Bund deutscher Mädchen". Dort bleute man uns ein, daß wir ein "Volk ohne Raum" seien, und daß der Versailler Vertrag Deutschland in unerträglicher Weise gedemütigt habe. Uns Mädchen erzählte man, wir müßten uns darauf einrichten, als "aufrechte, deutsche Frauen" an der Seite "tapferer Männer" Opfer für das "Vaterland" zu bringen. Eine sonderbare Verordnung war auch der "Eintopfsonntag", der die "Volksgemeinschaft zusammenschweißen" sollte. Die Familien hatten zu diesem Anlaß auf den üblichen Braten zu verzichten und das eingesparte Geld zu spenden. Der Blockleiter lief Mittags mit einer Sammelbüchse herum, und wenn er ein Eifriger war, drang er bis in die Küche vor, um zu überprüfen, ob dort auch wirklich nur Eintopf auf dem Herd stand. Mit List und Tücke versuchten viele Leute, sich ihren Braten zu retten. Sie bereiteten ihn am Vorabend zu, 124 versteckten ihn, lüfteten gut durch und holten ihn nach der Kontrolle wieder hervor, um ihn aufzuwärmen und endlich zu essen. Nach und nach drangen die Nazis in alle Bereiche des Lebens ein. Selbst die Kirche blieb dabei nicht ausgespart. Das Alte Testament galt nunmehr als jüdisches Machwerk voller Abartigkeiten und blutrünstiger Szenen. Daraus vorzulesen, war plötzlich ein Verbrechen. An der Jacobskirche in Köthen gab es zwei Pfarrer. Der eine unterstützte Hitler mit seinen Predigten. Der andere stand im Verdacht, ein heimlicher Gegner zu sein. Wahrscheinlich gehörte er der "Bekennenden Kirche" an. Deshalb wurden seine Post und sein Telefon ständig überwacht. Äußerlich versuchten die Nazis, sich als vorbildliche Christen auszugeben. Hitler schloß jede seiner Reden mit der Bitte an Gott, ihm zu helfen. Faschistische Rassenlehre und Evangelium aber passen nicht gut zusammen. Wahrscheinlich dienten die religiösen Phrasen nur dazu, die wahren Ziele zu verschleiern und beim Volk vertrauenswürdiger zu erscheinen. 1935 fand in Berlin auf dem Tempelhofer Feld eine Großkundgebung statt. Hitler wollte aller Welt zeigen, wie sehr das deutsche Volk hinter ihm stand. Vorgesehen war auch eine Parade mit Hunderten Teilnehmern. Dafür ausgewählt zu werden, galt als große Ehre. Zu den in dieser Weise Ausgezeichneten gehörte auch Onkel Otto. Bei der Vorbereitung des für sie ungemein wichtigen Ereignisses scheuten die Nazis keine Kosten. Aus dem ganzen Land wurden Busse mobilisiert, um Leute in die Hauptstadt zu bringen. Wer mitfahren wollte, brauchte sich nur anzumelden. Die Fahrt war unentgeltlich. Tante Hethe bestellte Plätze für sich selbst, Muttchen, Werner Bartlitz und mich. Alles an jenem Tag überstieg meine damalige Vorstellungskraft, anfangs im Guten, später im Bösen. Es begann schon damit, daß ich noch nie zuvor im Leben eine so lange Strecke mit dem Bus gefahren war. Tante Hethe hatte für 125 alle dick mit Wurst belegte Brötchen geschmiert und auch Thermoskannen mit Kaffee und Tee mitgebracht. Sie war ganz außer sich vor Glück über den Auftritt ihres Mannes vor dem Führer. Auf der Landstraße trafen wir immer wieder andere Busse, die wie der unsere mit Fähnchen geschmückt waren und ebenfalls Berlin als Ziel hatten. Die Leuten winkten einander zu und lachten. Obwohl wir verhältnismäßig zeitig auf dem Tempelhofer Feld eintrafen, waren wir keineswegs die ersten. Nur mit größter Mühe gelang es uns, bis in die Nähe der Ehrentribüne vorzudringen. Und immer mehr Menschen strömten auf den Platz. Wir wurden ausweglos eingekeilt. Als mich Muttchen einmal hochhob, so daß ich über die Köpfe der Umstehenden hinwegblicken konnte, kam ich mir vor wie ein winziges Schiff inmitten des Meeres. Als Hitler erschien, setzte ohrenbetäubender Jubel ein. Dann sprach er mit seiner heiseren Stimme, und es wurde still auf dem weiten Platz. Die Leute sogen jedes Wort gierig auf. In den Pausen dröhnte "Sieg-Heil"-Gebrüll, das sich von mal zu mal steigerte. Dann schwieg er, und es geschah etwas, das ich nie, niemals in meinem Leben vergessen werde. Das Tempelhofer Feld verwandelte sich in ein Inferno tobender Menschen. Junge Frauen kreischten gellend wie Trillerpfeifen. Die Augen traten ihnen hervor, Tränen liefen ihnen über die Wangen. Etliche von ihnen fielen schließlich in Ohnmacht. Sie brachen zusammen, und niemand kümmerte sich um sie. Wohin ich mich auch wandte, überall blickte ich in unnatürlich weit aufgerissene Münder. Einen Mann sah ich wie irrsinnig mit den Armen fuchteln. Was war geschehen mit diesen Leuten, die doch eine halbe Stunde früher noch ganz gewöhnlich ausgesehen hatten? Wie sollten wir diesem Hexenkessel jemals entkommen. Ich suchte nach Muttchen und Tante Hethe. Daß beide noch so aussahen wie sonst, beruhigte mich ein wenig. 126 Dann begann die Parade. Werner hatte sich einen Platz an der Absperrung gesichert, so daß er seinen Vater gut beobachten konnte. Ich sah die Marschblöcke nur von Weitem. Die SS bildete den Auftakt. Bei ihrem Stechschritt dachte ich, daß sie jeden Augenblick nach hinten umfallen müßten. Ihnen schloß sich die SA an. Am Schluß kam die Hitlerjugend. "Führer, wir gehören dir, wir sind dir treu bis in den Tod", sangen die Jungen. Später nahm er sie beim Wort. Mitte der dreißiger Jahre verlor die kleine Helga ein zweites Mal ihre Eltern. Das Ehepaar, das sie bisher betreut hatte, war durch Invalidität des Mannes in eine schwierige Lage geraten. Max weigerte sich, die Alimente zu bezahlen. Warum er sich in dieser Situation so schäbig verhielt, weiß ich nicht. Möglicher Weise beeinflußten ihn die Männer, mit denen er sich nach wie vor regelmäßig abends traf und die er für seine Freunde hielt. Obwohl die Pflegeeltern ihren Zögling sehr liebten - vielleicht sogar gerade deshalb - wandten sie sich ans Jugendamt mit der Bitte, nach einer besseren Lösung zu suchen. Das Jugendamt wiederum schrieb die noch lebenden nächsten Verwandten an. Tante Hethe erklärte sich nach langem Zögern schließlich bereit, die Kleine erst einmal bei sich aufzunehmen. Sie betonte aber, daß sie nur vorübergehend die Verantwortung übernehmen könne. Neue Pflegeeltern zu finden, war nicht leicht. Das Mädchen hatte nun schon eine gewisse Vergangenheit. Das schreckte die adoptionswilligen Ehepaare ab. Genau genommen wurde Helga von Tante Hethe nur versorgt. Die meiste Zeit des Tages verbrachte sie bei ihrer Großmutter. Das war nicht besonders vergnüglich für sie. 127 Anstatt lachen und herumtollen zu können, wie es ein Kind in diesem Alter nun einmal will, mußte sie sich auf die Gewohnheiten einer alten Frau einstellen. Wenn es draußen dunkel wurde, ging die Großmutter mit ihr zusammen ins Bett, auch im Winter. Als nun Tante Emma erfuhr, wie die arme Helga schon wieder herumgestoßen wurde, bot sie sich aus Mitleid selbst als Ersatzmutter an. Im Grunde sprach nichts dagegen, in die Familie Schatz noch ein drittes Kind einzugliedern. An Geld mangelte es nicht. Onkel Gustav hatte über seine Arbeitsstelle eine neue Wohnung in einer Eisenbahnersiedlung am Stadtrand bekommen. Dort gab es weniger Verkehr als in Charlottenburg. Auch das Grundstück in Falkensee besaßen die Schatzens noch. Ganz so unbeschwert, wie man jetzt glauben könnte, lebte Helga in Berlin aber dennoch nicht. Irmchen nämlich, die bisher immer im Mittelpunkt gestanden hatte, wurde plötzlich dazu angehalten, auf ein jüngeres Geschwisterkind Rücksicht zu nehmen. Dazu war sie nicht bereit. Vielmehr setzte sie alles daran, den ungebetenen Gast durch Niederträchtigkeiten aller Art wieder zu vergraulen. Daß Helga, die eine ähnlich sanftmütige Natur hatte wie ihre Mutter, sich nicht provozieren ließ, heizte die Eifersucht noch mehr an. Zwischen dem ewig erfolgreichen Werner, der inzwischen das Gymnasium mit glänzenden Noten beendet und ein Studium begonnen hatte, und der ewig braven Helga geriet das ewig böse Irmchen völlig außer Rand und Band. Offenbar besaß Tante Emma trotz ihrer Kinderliebe nicht das nötige pädagogische Geschick, ihrer Problemtochter durch kleine Erfolgserlebnisse eine Motivation zu geben, sich in die Familie einzufügen. Als Kind dachte ich über diese Zusammenhänge noch nicht nach. Irmchen war in Berlin meine beste Freundin. Wir verstanden uns glänzend, und ich kann mich nicht an einen einzigen bösartigen Streit erinnern. Auseinandersetzungen innerhalb der Familie wurden bei den Schatzens generell nicht 128 in Gegenwart Fremder ausgetragen. Zu den Fremden zählten in diesem Falle auch wir Köthener. Tante Emma war es wohl peinlich, daß ihr bei Irmchens Erziehung nicht alles so gelang, wie sie es wollte. Daß Irmchen sich rabiat wehren konnte, wenn sie es für notwendig hielt, das freilich wußte ich. Wegen ihrer dunkelroten Haare wurde sie auf der Straße manchmal gehänselt. Dann setzte es Erwiderungen, die sich gewaschen hatten. Die Berliner Kinder waren berüchtigt für ihr großes Mundwerk. Irmchen aber übertrumpfte sie alle. Wagte sich jemand zu nahe an sie heran, konnte sich leicht eine regelrechte Prügelei entwickeln. War ein Gegner körperlich überlegen, hieß das noch längst nicht, daß Irmchen unterlag. Mit ihren dunklen, blitzenden Augen, die wunderbar zu ihren roten Haaren paßten, erinnerte sie mich an eine Wildkatze: wem es gelingt, ihr Vertrauen zu gewinnen, von dem läßt sie sich alles gefallen; wehe aber dem, der ihre Kreise stört, sie womöglich sogar zu ärgern versucht. Ich bewunderte sie. Manchmal wäre ich gern selbst so ein Raufbold gewesen wie sie. Was hatte ich nicht alles für Abenteuer erlebt an ihrer Seite! Falkensee ist umgeben von weiten Wäldern und Dutzenden Seen. Bei unseren Streifzügen wagten wir uns mitunter so weit weg, daß wir kaum noch vor Anbruch der Dunkelheit den Rückweg schafften. Wir verzapften natürlich auch eine Menge Unfug, von dem Tante Emma nichts erfahren durfte, Muttchen schon gar nicht. Einige Male mußte uns Werner aus der Klemme helfen. Heute staune ich, mit welcher Geduld er uns immer wieder half. Schließlich hatten wir uns unsere Schwierigkeiten fast immer selbst geschaffen. Der Ort Falkensee war übrigens sehr reizvoll. Hier hatten zahlreiche Filmschauspieler sich prächtige Villen bauen lassen. Da viele von ihnen jüdischer Abstammung waren, lebten sie inzwischen im Ausland. Nun gehörten die Villen hohen Nazifunktionären. Daß grundsätzlich keine Namen an den 129 Türen standen, drängt die Vermutung auf, daß es sich um wirklich ziemlich bedeutende Leute gehandelt hatte. Eine Prachtvilla konnte Onkel Gustav sich selbstverständlich nicht leisten. Er plante aber durchaus ernsthaft, eines Tages die Gartenlaube durch ein massives Steinhaus zu ersetzen und dann ständig dort zu leben. Manchmal erzählte er uns ganz genau, wie das alles einmal werden sollte. Wir mochten ihn sehr gern. Er war ein richtiger Kindernarr und schimpfte nie. Mit Helga traf ich in den Ferien selten zusammen. Sie blieb zumeist bei Tante Emma, wenn Irmchen mit mir loszog. Großmutter zog sich allmählich aus der Hauswirtschaft zurück. Sie spürte einerseits, daß Tante Hethe am Schloßplatz gut zurecht kam, und anderseits, daß ihr selbst allmählich die Kräfte schwanden, so daß sie, wenn sie ihre Hilfe aufdrängte, eher behinderte als nutzte. An schönen Tagen ging sie Nachmittags in den Schloßpark und setzte sich dort auf eine Bank. Häufig traf sie dabei Leute, mit denen sie Erinnerungen an längst vergangene Zeiten austauschen konnte. Da sie ein sehr geduldiger Mensch war, hatte sie sich damit abgefunden, nicht mehr im Mittelpunkt des Lebens zu stehen, und begehrte nicht auf gegen ihr Schicksal. Als Heldin empfand sie sich nicht. Deshalb erschien es ihr wie ein schlechter Scherz, als ihr eines Tages ein NSDAP-Funktionär mit pathetischer Geste die Einladung zu einer Muttertagsveranstaltung überreichte. Die Nazis wollten ein hohes Bevölkerungswachstum, und das versuchten sie zu erreichen, indem sie bei jeder Geburt einen bestimmten Betrag an die Eltern bezahlten und kinderreiche Familien in besonderer Weise förderten. Der Volksmund nannte das respektlos "Zuchtprämien". Großmutter, die elf Kinder zur Welt gebracht und neun davon großgezogen hatte, sollte nun im Rathaus im Beisein des Bürgermeisters in ganz besonderer Weise geehrt werden - durch Auszeichnung mit dem "Mutterkreuz". 130 Am Tage, als die Feierstunde stattfand, ging Großmutter wie immer aus dem Haus. Sie schlug aber nicht den Weg zum Rathaus ein sondern setzte sich auf ihre Bank. Während im prunkvoll geschmückten Ratssaal ganz in der Nähe markige Musik erklang, blickte sie unverwandt zum Schloß hinüber. Auf ihrem von unzähligen Schicksalsschlägen zerfurchten Gesicht ließ sich keine Gefühlsregung ablesen. In ihrem strengen, schwarzen Kleid wirkte sie ein wenig wie eine Statue. All ihre Freude und all ihre Trauer waren tief in ihrem Innern eingeschlossen. Dort lebten nicht nur Franz und Max, nicht nur Emma, Liese und Hedwig, sondern auch noch die anderen sechs: Richard und Agnes, die sie schon als Säuglinge verloren hatte, Minna, der sie dankte für ihre Opferbereitschaft in den frühen Jahren, Martha, die so fröhlich und zugleich so rätselhaft gewesen war, Karl und Paul schließlich, die der Krieg ihr genommen hatte, deren Tod der sinnloseste war. Aus dem Schloß, wo kein Fürst mehr residierte, kam lärmend eine Gruppe Jungen heraus, Schüler aus dem Gymnasium. Seit jeher nahmen die Regierenden sich das Recht heraus, den Müttern ihre Kinder wegzunehmen, um sie für ihre persönlichen Ziele zu benutzen. Da im Deutschland jener Zeit mehr noch als ohnehin alles seine Ordnung haben mußte, entging Großmutter der fragwürdigen Ehrung trotz allem nicht. Man brachte ihr den Orden ins Haus. Sie nahm ihn mit würdevollem Schweigen entgegen. Was sie danach damit tat, das weiß ich nicht. Zu Gesicht bekommen habe ich das Kreuz nie. Nach dieser Episode lebte Großmutter ruhig weiter wie zuvor. Sie schonte sich, nahm sich in Acht. Dennoch geschah es, daß sie in der Küche ausrutschte und sich den Oberschenkel brach. Das Gefährliche dabei war, daß sie nun lange liegen mußte, was bei alten Menschen oft zu einer tödlich verlaufenden Lungenentzündung führte. Alle hatten große Angst um Großmutter. Sogar Onkel Franz kam aus Hannover. Um die alte Frau nicht zu überanstrengen, 131 gingen immer nur zwei Familienmitglieder gleichzeitig sie im Krankenhaus besuchen. Einmal ergab es sich, daß ich gemeinsam mit Onkel Franz an der Reihe war. Weil ich ihn kaum kannte, brachte ich anfangs vor Schüchternheit kein Wort heraus. Er nahm mir dann aber allmählich die Scheu. Zuerst erzählte er mir von Dänemark und Norwegen, wo er ja einige Jahre lang gelebt hatte. Das fand ich sehr interessant. Dann fragte er mich nach der Schule, nach meinen Lieblingsfächern, nach meinen Freundinnen. Ich merkte gar nicht, wie die Zeit verging. Daß er schon bald wieder abreisen mußte, war schade. Dadurch fand das Gespräch nie eine Fortsetzung. Großmutter erholte sich wieder. Sie konnte auch wieder laufen, mußte aber nun immer einen Stock benutzen. Im Frühjahr 1935 beendete ich die sechste Klasse der Grundschule. Weil ich ziemlich gute Zensuren hatte, veranlaßte Muttchen, daß ich in die Mittelschule kam, die damals bis zur zehnten Klasse führte. Im Unterschied zur Realschule, die den Jungen vorbehalten blieb, stand sie auch Mädchen offen. Allerdings waren innerhalb der Schule Jungen und Mädchen noch streng voneinander getrennt. In gewissem Grade stand ich nun vor einer ähnlichen Situation wie 25 Jahre zuvor mein Onkel Max. Die meisten meiner Mitschülerinnen kamen aus reicheren Familien als ich. Zudem war Muttchen generell sehr sparsam, wenn es um Dinge ging, die sie für nicht wichtig hielt. Was ihr unwichtig erschien, konnte aber für mich sehr wohl wichtig sein, zum Beispiel um in der Klasse nicht in eine Außenseiterrolle zu geraten. Auf den Einfall, einfach die Schule zu schwänzen, kam ich trotzdem nie. Ich versuchte vielmehr, die Nachteile durch Erfolge beim Lernen auszugleichen. Natürlich gab es überhebliche Gänse, die ich selbst damit nicht beeindrucken konnte. Insgesamt aber war ich nach einiger Zeit in meiner Klasse durchaus geachtet. 132 Übrigens mußte ich mir abfällige Bemerkungen nicht nur in der Schule anhören. Wie zuvor bei Muttchens erstem Hauskauf sahen auch diesmal Tante Emma und Tante Hethe nicht ein, wieso die armen Maxens eine Tochter an einer höheren Schule haben mußten. Daß Werner Bartlitz die Mittelschule besuchte, das ging in Ordnung. Bei mir war das etwas ganz anderes. Mein Verhältnis zu dem annähernd gleichaltrigen Werner verschlechterte sich dadurch allerdings nicht. Ich spielte mit ihm sogar ziemlich oft. Das lag daran, daß Muttchen häufig am Abend nach der Arbeit noch zum Schloßplatz ging. Uns Kinder nahm sie dabei mit, damit wir zu Hause keinen Unfug anstellen konnten. Werner war um diese Zeit gerade fertig mit seiner Arbeit im Stall. Er mußte seiner Mutter beim Füttern der Tiere helfen, eine Pflicht, die er haßte. Wenn sich die Frauen dann zum Plaudern ins Wohnzimmer setzten, dann hatten wir Kinder frei und zwar gleich für ein paar Stunden, denn so rasch wurden die beiden nicht fertig. Rudi spielte nicht mehr mit uns. Er hatte inzwischen die Schule beendet und ging bei einem Schneider in die Lehre. Dafür stieß häufig Werners Cousine Hilde zu uns, ein waschechtes Arbeiterkind, das es faustdick hinter den Ohren hatte und uns über Zusammenhänge aufklärte, über die unsere Mütter uns noch mindestens bis zu unserem achtzehnten Geburtstag im Unklaren lassen wollten. Nach Einbruch der Dunkelheit war der Schloßplatz mit seinen vielen Bäumen und Sträuchern ziemlich gruselig. Manchmal graulte ich mich ganz schrecklich, ließ mir aber nichts anmerken. Vielleicht ging es den anderen ähnlich. Anderseits hatten diese Abenteuer auch ihren Reiz. Im Nachhinein kamen wir uns vor wie Helden aus einem Märchen. Auch Muttchen war der Schloßpark zu später Stunde nicht geheuer. Eigentlich sollte ja Vater sie auf dem Heimweg begleiten. Ein paarmal hatte er das auch getan. Da die Schwestern aber nie ein Ende finden konnten, war ihm das schließlich zu dumm geworden. Muttchen mußte also ohne 133 männlichen Beistand auskommen. Sie rannte fast und spähte wie ein Reh ständig rundherum nach Angreifern. Welche Haltung zu den Nazis hatten eigentlich Franz und Max, meine beiden damals noch lebenden Onkels? Ich weiß es nicht. In die NSDAP traten sie beide nicht ein. Mit Otto verstand Max sich überhaupt nicht. Wenn er seine Mutter besuchte, wählte er einen Tag, an dem er ihm nicht über den Weg laufen konnte, ähnlich wie zuvor bei seinem Vater. Spielten dabei auch politische Gründe ein Rolle oder nur persönliche? Was hätte wohl Martha gesagt zu diesem Deutschland? Sie war fast noch konsequenter sozialdemokratisch gesinnt gewesen als Großvater. Aber ich will mich nicht in Spekulationen verlieren. Was Vaters Arbeit anging, erfüllten sich Muttchens in die Nazis gesetzten Hoffnungen. Er fand sogar eine für ihn geradezu ideale Anstellung. Seine Aufgabe bestand darin, im Schichtbetrieb die Köthener Kläranlage zu überwachen. Der Großteil der in der Stadt anfallenden Abwässer kam dort an. In verschiedenen Becken verdunstete allmählich das Wasser und zurück blieb ein zur Düngung gut geeigneter Schlamm, den sich die Bauern der Umgebung für ihre Felder holten. In der Nachtschicht war ein einziger Angestellter für die gesamte Anlage verantwortlich. Im Unterschied zu den meisten seiner Kollegen, gefiel Vater das außerordentlich gut. Daß er sich nicht fürchtete, wird mir ewig ein Rätsel bleiben. Die Anlage lag inmitten ausgedehnter Gärten weitab jeder menschlichen Behausung. Allerdings kann ich mir vorstellen, daß mein jüngerer Sohn die Dinge genau so wie er gesehen hätte. Welches Gen mag wohl dafür verantwortlich sein? Daß es im Klärwerk keine NSDAP-Parteigruppe gab, war Vater gleichfalls sehr angenehm. Die Wohngebietsgruppe, der er ersatzweise zugeschlagen wurde, belastete ihn nicht sonderlich. Allerdings hatte man ihm das Amt des Kassierers aufgedrängt. War er in dieser Funktion unterwegs, stand Muttchen immer Ängste aus. Da seine Haltung zu den Nazis 134 sich eher zum Negativen als zum Positiven hin entwickelt hatte, befürchtete sie, daß er die abfälligen Kommentare, die er zu Hause abgab, auch einmal vor Fremden riskierte. Manchmal mußte er Plaketten verkaufen. Das war eine Arbeit, die zumeist an uns Kindern hängen blieb. Jetzt wird es Zeit, daß ich wieder einmal über unsere Wohnverhältnisse berichte. Muttchens Umzüge könnten gut und gern für sich allein ein Buch füllen. Kaum hatte sie sich irgendwo niedergelassen, da störte sie schon wieder irgend etwas. Manchmal waren die Mieter oder die Nachbarn die Ursache, manchmal plagte sie einfach nur der Ehrgeiz. Ich könnte über die kuriosesten Geldbeschaffungsaktionen berichten und sogar über Gerichtsverhandlungen. Damit würde ich aber das Schwergewicht verschieben und die Chronik bekäme einen anderen Charakter. So werde ich mich auf Andeutungen beschränken. Unser zweites Haus hatten wir aufgegeben, als die für das Viertel verantwortliche Baugesellschaft zusammenbrach. Die Mietwohnung, in die wir auswichen, war ziemlich klein. Als sich die Wirtschaftslage im Land verbesserte, fand sich eine Firma, welche die halbfertige Siedlung vervollständigte. Das brachte Muttchen auf den Gedanken, dorthin zurückzuziehen. Tatsächlich fand sie eines Tages ein entsprechendes Angebot in der Zeitung und griff sofort zu. Damit sie nicht wieder mit Dauermietern Ärger bekäme, vergab sie den entbehrlichen Wohnraum nur noch befristet. Interessenten zu finden, bereitete keine Schwierigkeiten. Vor allem Studenten nahmen gern möblierte Zimmer. Selbstverständlich ließ sich auch an jenem Haus ein Mangel feststellen. Es lag ein wenig am Rande. Gleich hinter dem Garten begannen die Felder. Muttchen fürchtete nun, diese exponierte Stellung könne Einbrecher anlocken. So zogen wir abermals in eine Mietwohnung, diesmal allerdings in eine ziemlich große. Wir mußten uns nicht einschränken. Muttchen konnte sogar weiterhin vermieten. 135 Mitte der dreißiger Jahre ließen die Nazis die Köthener Maschinenfabrik beträchtlich vergrößern. Künftig sollten dort Motoren für die Dessauer Junkers-Flugzeugwerke montiert werden. Weil das für die Kriegsvorbereitung sehr wichtig war, holte man Bauarbeiter von überall her. Dadurch wiederum stieg der Bedarf an möblierten Zimmern, und wir hatten gute Einnahmen. Dieses Geld investierte Muttchen sofort in ein neues Projekt. Wieder einmal sollte es ein Haus sein, und zwar ein nagelneues, eines, das erst noch gebaut werden mußte. Dabei fielen ziemlich viel Eigenleistungen an. Ab 1936 steuerte Deutschland immer offensichtlicher auf einen großem Krieg zu. Ein Netz von Autobahnen für den Truppentransport entstand. Zum selben Zweck wurde die Eisenbahn modernisiert. Die Produktion von Rüstungsgütern aller Art lief auf Hochtouren, angefangen von auf den ersten Blick harmlos erscheinenden Kraftfahrzeugen bis hin zu schweren Granaten. Auf der Suche nach Verbündeten schloß Hitler mit Japan, Italien und Spanien den "Antikominternpakt". Sein Name spiegelte den Franzosen, Briten und Amerikanern vor, daß er sich ausschließlich gegen die Sowjetunion richte. Daß das nicht stimmte, hätten die Westmächte sich eigentlich denken können. Die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland, die einseitige Aufkündigung der Locarno-Verträge durch die Nazis - verbunden mit dem Einmarsch in das entmilitarisierte Rheinland - sowie der "Anschluß" Österreichs ließen wahrhaftig nichts Gutes ahnen. Von Politikern erwartete man Weitblick. Ist das vermessen? Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, lautet ein Sprichwort. Von 1936 bis 1939 wütete in Spanien der Bürgerkrieg. Daß die rechtmäßig gewählte Volksfrontregierung 136 sich gegen die putschenden Nationalisten letztlich nicht behaupten konnte, lag zu einem wesentlichen Teil an der massiven Einmischung anderer Länder. Von deutscher Seite beteiligte sich die Legion Condor. Ihre Fliegerstaffeln erlangten bei der Bombardierung Guernicas traurige Berühmtheit. Picasso hat das schreckliche Ereignis in seinem vielleicht berühmtesten Gemälde dokumentiert. Vor diesem Hintergrund ist es mehr als peinlich, zugeben zu müssen, daß die an diesem und zahlreichen anderen Verbrechen beteiligten Flugzeuge auch vom Köthener Militärflughafen starteten und daß wir die Piloten dort nach ihrem fragwürdigen Sieg als Helden bejubelten. Die Kinder bekamen schulfrei. Die Menschen standen zu Hunderten am Straßenrand und warfen Blumen. Die Fliegerei hatte in Köthen übrigens Tradition. Vor dem Machtantritt der Nazis war der Flugplatz für zivile Zwecke genutzt worden. Es gab einen Verein, in welchem Studenten aus wohlhabenden Familien den Flugschein erwerben konnten. Ab und zu fanden Kunstflugveranstaltungen statt. Im Rahmen der Kriegsvorbereitung übernahm dann Göhrings Luftwaffe das Gelände. Nun wurden eilig Kasernen und Offiziersunterkünfte errichtet. Auch der Flugplatz selbst erhielt etliche neue Gebäude und Einrichtungen. Die Angehörigen dieser Truppen nannte der Volksmund etwas salopp "die Schlipssoldaten". Tatsächlich gehörte zu ihrer Uniform eine Krawatte. Schon das zeichnete sie als Elitesoldaten aus. Die Luftwaffe sollte den kommenden Krieg zu Gunsten Deutschlands entscheiden. Nachdem Rudi seine Schneiderlehre beendet hatte, wurde er zum "Reichsarbeitsdienst" eingezogen. Gar zu traurig war er darüber nicht. Seines Berufes wegen brachte man ihn in einer Kleiderkammer unter. Dort hatte er seine Ruhe. Nach Dienstschluß amüsierte er sich in den Tanzlokalen der Umgebung. Die Uniform stand ihm ausgezeichnet, und da er 137 auch elegant aufzutreten verstand, brauchte er sich über zu wenig Chancen bei den Mädchen nicht zu beklagen. Leider nahm die schöne Zeit für ihn ein jähes Ende. Der Winter war streng. Die Wasserleitungen des Arbeitsdienstobjektes froren zu. Die Versorgung sicherte ausschließlich eine Pumpe, vor der Tag und Nacht ein Feuer brannte. Als Rudi einmal mit einem Eimer dorthin unterwegs war, rutschte er auf der spiegelglatten Straße aus und brach sich ein Bein. Er kam nach Dessau ins Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, daß es sich um einen sehr ungewöhnlichen, schwer zu heilenden Bruch handelte. Das Bein wuchs zweimal falsch zusammen und mußte jeweils noch einmal künstlich gebrochen werden. Erst nach fast einem Jahr konnte Rudi das Krankenhaus wieder verlassen. Während der vielen Wochen, die er im Bett zubrachte, litt er nicht nur körperlich sondern auch seelisch. Er hatte viel Zeit zum Nachdenken. Würde er jemals wieder laufen können, fragte er sich. Die Ärzte trösteten ihn, wagten sich aber auf keine Prognose festzulegen. Er trauerte den Tanzabenden nach, sah sich schon als Krüppel sein restliches Leben fristen. Um ihn ein wenig aufzurichten, besuchten wir ihn regelmäßig. Zumeist fuhren wir mit dem Fahrrad, manchmal benutzten wir den Zug. Muttchen buk Kuchen für ihn und beschenkte die Krankenschwestern, damit sie sich seiner besonders annehmen. Nach über einem Jahr konnte er endlich entlassen werden. Völlig gesund war er da noch immer nicht. Das hatte aber immerhin in dieser Zeit auch einen Vorteil. Er mußte nicht zu den regulären Truppen sondern wurde nach Stendal versetzt, wo er nun eine Kleiderkammer leitete. Elly begann nach Beendigung der achten Klasse eine Blumenbinderlehre. Wenig später wurde sie plötzlich krank. Sie bekam Fieber und Hautausschlag. Die Ärzte vermuteten zunächst, daß sie unter einer Empfindlichkeit gegen Blumen leide. Dann aber stellte sich heraus, daß sie sich mit Scharlach infiziert hatte. Treten Kinderkrankheiten erst im 138 Erwachsenenalter auf, verlaufen sie oft besonders schwer. So war es auch bei meiner Schwester. Das Fieber, das wochenlang nicht weichen wollte, was immer wir auch unternahmen, griff sogar die Herzklappen an. Nach der Genesung rieten die Ärzte zu einem Aufenthalt an der See. Muttchen fuhr deshalb mit ihr für ein paar Tage nach Swinemünde. Das war natürlich nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Sollte Elly für längere Zeit dort an der Küste bleiben, brauchte sie Arbeit in der Stadt. Glückliche Umstände bewirkten, daß sie sich bei dieser Gelegenheit sogar einen geheimen Wunsch erfüllen konnte. Sie erhielt einen Ausbildungsplatz im Krankenhaus. Swinemünde war wirklich eine schöne Stadt. Zweimal bekam ich sie selbst zu sehen, beide Male im Zusammenhang mit einem Besuche bei Elly. Am Strand standen ganze Ketten von Hotels für Kurgäste. Über die breite Promenade flanierten vornehm gekleidete Leute. Im Hafen bewunderte ich die großen Hochseeschiffe, die einer Landratte wie mir wie Ungetüme von einem anderen Stern vorkamen. Einmal sah ich sogar ein Kriegsschiff. Ein freudiges Ereignis gab es am Schloßplatz. Werner Bartlitz bekam mit fünfzehn Jahren noch einen kleinen Bruder, der den Namen Heinz erhielt. Innerhalb meiner Generation von Schulzekindern sollte er das jüngste Mitglied bleiben. Seine ersten Lebensmonaten verliefen ziemlich dramatisch. Im achten Schwangerschaftsmonat auf die Welt gekommen, wog er am Anfang gerade drei Pfund. Die Ärzte wollten ihn in einen Brutkasten stecken. Dagegen aber sträubte sich Tante Hethe. "Ich habe ihn zu Hause geboren und gebe ihn auch jetzt nicht weg", sagte sie. "Wenn er sterben muß, dann kann er das auch hier." Diejenigen, die sie daraufhin als altmodisch und uneinsichtig hinstellten oder sogar als Rabenmutter titulierten, belehrte sie eines Besseren. Sie schaffte es tatsächlich, ihr Frühchen ohne fremde Hilfe aufzupäppeln. Nach etwa einem Jahr hatte sie das 139 Baby außer Gefahr. Nun entwickelte sich der Kleine ganz normal und wurde ein hübscher Junge. Einmal bekamen wir unerwartet Besuch. Vor der Tür standen zwei junge Männer. Muttchen glaubte, sie nicht zu kennen, und behandelte sie zunächst recht förmlich. Dann stellte sich aber heraus, daß sie zwei meiner Cousins waren, Karl und Kurt, die Söhne von Onkel Franz. So selten kamen wir mit unseren in Hannover lebenden Verwandten zusammen! Die beiden hatten Köthen bei einer großen Fahrradtour gestreift. Sie wollten auch noch nach Berlin radeln und dort Tante Emma überraschen. Wenig später brach Werner Bartlitz mit ein paar Freunden nach Hannover auf, zum Gegenbesuch gewissermaßen. Das Jahr 1937 brachte für Werner Bartlitz und mich den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Wir wurden am Palmsonntag konfirmiert. Die Feier nahmen wir damals tatsächlich sehr ernst. Schon der äußere Rahmen deutete auf die besondere Bedeutung des Ereignisses hin. Werner trug zum ersten mal in seinem Leben einen Anzug sowie ein weißes Hemd und eine Krawatte. Ich bekam ein langes schwarzes Kleid aus gutem Stoff geschenkt. Selbstverständlich reiste Tante Emma mit ihrer Familie an. Daß ich plötzlich in dieser Weise im Mittelpunkt stand, war mir gar nicht so sehr angenehm. Die Erwachsenen erwarteten tadelloses Benehmen, und ich hatte ständig Angst, daß mir ein Fehler unterliefe. Wir waren damals mit vierzehn Jahren fast alle noch recht schüchtern. Für mich bedeutete dieses Jahr aber noch in anderer Hinsicht einen Einschnitt im Leben. Muttchen meldete mich nach der achten Klasse von der Mittelschule ab, und damit brach für mich eine Welt zusammen. Die Entscheidung war ebenso ungerecht wie unnötig. Ich hatte ausgezeichnete Zensuren und war deshalb vom Schulgeld befreit. Auch die Lehrbücher kosteten meine Eltern keinen Pfennig. Der Familie ging es wieder gut. Niemand brauchte dringend meinen geringen 140 Lehrlingslohn. Warum also nahm Muttchen mich vorzeitig von der Schule, so wie das normalerweise nur mit sehr dummen Schülern geschah? Zwei Tatsachen gaben zweifellos den Ausschlag: ich war ein Mädchen und ich war eine Max. Wahrscheinlich hatte Muttchen den Sticheleien von Tante Hethe und Tante Emma schließlich nachgegeben. Für Werner Bartlitz wurde eine ähnliche Entscheidung nicht einen Augenblick lang erwogen. Diese Demütigung war für mich besonders schlimm. Als ich mich von meinen Lehrern und Klassenkameradinnen verabschiedet hatte und zum letzten Mal die Treppen am Eingangsportal der Schule hinunterging, standen mir Tränen in den Augen. Danach bekam ich eine Lehrstelle in einer Drogerie, wo ich zur Fotolaborantin ausgebildet wurde. Dort hatte ich eine strenge Lehrmeisterin. Sie war deutlich größer als ich, und wenn sie vor mir stand und mich aus ihren schwarzen Augen durchdringend ansah, wurde ich unwillkürlich noch ein paar weitere Zentimeter kleiner. Mit ihrem Mann, dem eigentlichen Inhaber des Ladens, verstand ich mich dagegen sehr gut. Wenn die Frau zu ihren Freundinnen Kaffeetrinken ging, was genau einmal in der Woche vorkam, dann kaufte er für das Ladenmädchen und mich ein paar Stücken Kuchen und gewährte uns eine freie Stunde zusätzlich. An den traditionellen Sommerausflügen dagegen beteiligten sich alle. Wir fuhren zu viert mit dem Auto hinaus in den Wald. Dort wurde für jeden eine Hängematte aufgespannt. Das sah recht lustig aus. Die große Leidenschaft des Chefs war sein Schützenverein. Er hatte Talent und besaß etliche Auszeichnungen. Seinen größten Triumph feierte er genau in der Zeit, als ich bei ihm lernte. Er wurde Schützenkönig von Köthen. Das Schützenfest war alljährlich ein besonderes Ereignis in der Stadt. Somit brachte der Sieg große Anerkennung mit sich. 141 Natürlich unterliefen mir in meiner Unerfahrenheit auch Mißgeschicke. Eines davon mündete in ein beinahe drehbuchreifes Desaster. In der Woche nach dem Pfingstfest, der wichtigsten Zeit für das Fotogeschäft der Drogerie, verfing sich mein Kleid in der Dunkelheit des Labors am Hahn des großen Entwicklertanks. Der Hahn riß ab, der Tank lief aus. Verzweifelt versuchte ich, das Gefäß zu reparieren, stand aber auf verlorenem Posten. Der Schaden war gewaltig. Für eine neue Füllung mußte telegrafisch neuer Entwickler bei AGFA Wolfen bestellt und per Kurier herangeschafft werden. Sämtliche während des Auslaufens im Tank befindlichen Filme hatten sich nicht mehr retten lassen. Um die betroffenen Kunden zu besänftigen, mußte ich zu jedem von ihnen nach Hause gehen und ausdrücklich alle Schuld auf mich nehmen. In Berlin hatte meine Cousine Irmgard inzwischen eine Friseurlehre begonnen. Währenddessen bekam Tante Emma immer größere Schwierigkeiten mit ihr. Was im Einzelnen vorgefallen war, weiß ich nicht. Offensichtlich aber befürchtete die Mutter ernsthaft, daß ihre Tochter auf die schiefe Bahn gerate. In ihrer Ratlosigkeit erwog sie mal den einen, mal den anderen Plan. Am Ende hielt sie es für das Beste, sie in einem Internat erziehen zu lassen. Ich nehme an, daß sie sich für eine kirchliche Einrichtung entschied. Wie es dort zuging, kann ich wiederum nur vermuten. Zweifellos herrschte ein strenges Regiment. Die Mädchen lernten kochen, nähen und noch manch anderes, was man damals für wichtig hielt, und mußten sich selbstverständlich in eine größere Gemeinschaft einfügen. Irmgard, die gewohnt war, im Mittelpunkt zu stehen, dürfte letzteres sehr schwer gefallen sein. Vielleicht brachte sie sich mit ihrer Angewohnheit, schon auf geringste Angriffe mit rabiater Verteidigung zu reagieren, frühzeitig in eine Außenseiterrolle. Wie dem auch gewesen sein mochte, fest steht, daß sie eines Nachts tränenüberströmt vor der elterlichen Wohnung stand. 142 Sie war aus dem Internat geflüchtet und flehte nun ihre Mutter an, sie nicht wieder dorthin zurückzubringen. Es werde von nun an bestimmt nie wieder Ärger mit ihr geben, versicherte sie. Tante Emma jedoch glaubte ihr nicht und blieb hart. Von diesem Tage an verschlimmerte sich das Verhältnis zwischen beiden dramatisch. Irmgard war nun nicht mehr nur widerspenstig sondern haßte ihre Mutter regelrecht. Von gewissen Schwankungen abgesehen, blieb das über die Jahrzehnte hinweg auch so. 1938 verkündeten die Nazis ihre These vom "Volk ohne Raum" buchstäblich Tag und Nacht über sämtliche, ihnen verfügbaren Wege. Zeitungen und Rundfunksender berichteten reißerisch über die angebliche Drangsalierung der deutschen Bevölkerung in Polen und im tschechischen Sudetenland. Die massive Propaganda blieb nicht ohne Wirkung. Bald glaubten die meisten Leute, geradezu körperlich zu spüren, wie ihnen der Platz in den bestehenden Grenzen fehlte. Auf den Straßen marschierte die Hitlerjugend und sang "Nach Ostland laßt uns reiten" und "Die Fahne ist mehr als der Tod". Das Ausland unternahm nichts, um Hitlers Ehrgeiz zu dämpfen. Im Gegenteil. Im September erklärten sich Champerlein und Daladier im Namen Großbritanniens und Frankreich durch das "Münchener Abkommen" mit der Abtrennung des Sudetenlandes von der Tschechoslowakei einverstanden. Wie jeder Räuber nahmen auch die deutschen Faschisten am Ende mehr, als man ihnen anbot. Anfang 1939 besetzten sie auch noch die restlichen Gebiete des Nachbarlandes und gründeten das "Reichsprotektorat Böhmen und Mähren". Von Krieg sprachen die Nazis noch immer nicht. Das "Münchener Abkommen" habe den Weltfrieden gerettet, versicherten sie. Die Eingliederung der "Rest-Tschechei" ins Reich sei mit Willen der dort lebenden Menschen auf Grund eines Abkommens mit dem Präsidenten Hacha erfolgt. Überhaupt könne es gar keine bessere Friedensgarantie geben 143 als ein starkes Deutschland. Aus heutiger Sicht äußerst plumpe Lügen, damals nur von wenigen Menschen durchschaut. 144 6. Kapitel Margarete erzählt Im Sommer des Jahres 1939 häuften sich die Meldungen über angebliche Greueltaten an "Volksdeutschen" in Polen. Vor allem der "Blutsonntag von Bromberg", ein angebliches Pogrom an Deutschen in einer polnischen Stadt, wurde von den Medien weidlich ausgeschlachtet. Der letzte Akt in der Vorbereitung auf den großen Krieg hatte begonnen. Über Nacht wurden ohne Begründung Lebensmittelkarten eingeführt. Minister Göring fragte suggestiv in einer seiner Reden: "Wollt ihr Kanonen oder Butter?" Dennoch gaben die meisten Leute sich noch immer der Illusion hin, die Dinge würden sich irgendwie schon wieder einrenken, ohne daß der einzelne ernsthaft betroffen wäre. Ich erinnere mich noch genau, wie es war, als Muttchen eines Morgens in die Küche kam und sagte: "Es ist Krieg." Mir gingen so viele Gedanken zugleich durch den Kopf. Krieg war immer etwas Schreckliches für mich gewesen. Ich mochte mich nie damit abfinden, daß Menschen sterben sollten für irgend ein Ideal oder irgend eine Religion. Nicht, daß ich das schreckliche Ende vorausgesehen hätte. Ich wäre damals kaum fähig gewesen, meine Empfindungen zu begründen. Ich hatte einfach Angst, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Unbekannten, welches sich hinter dem Wort "Krieg" verbarg. Ob es vielen anderen Leuten in Deutschland ähnlich ging wie mir? An jenem ersten Kriegstag vielleicht. In den nächsten Wochen beruhigten sich die meisten wieder. Der Polenfeldzug kam schnell zum erfolgreichen Abschluß. Hitler und Stalin einigten sich in einem Vertrag auf Interessensphären, so daß von Osten her nichts mehr zu befürchten war. England und 145 Frankreich traten zwar in den Krieg ein, weil ein Beistandspakt mit Polen sie dazu verpflichtete, doch unternahmen sie aus Feigheit oder Kalkül so gut wie nichts. Die Tatsache, daß Verdunklung befohlen wurde - mit schwarzen Rollos, die es plötzlich überall zu kaufen gab - verharmloste Göring mit den Worten, er wolle Meier heißen, wenn auch nur ein einziges feindliches Kampfflugzeug in den deutschen Luftraum eindringe, ohne abgeschossen zu werden. Mehr oder minder zog der Krieg freilich jeden in seinen Strudel. Onkel Otto half im Westen beim Bau von Befestigungsanlagen. Keine Grenze in der Welt war damals auch nur annähernd so aufwendig gesichert wie jene zwischen Deutschland und Frankreich, den "Erzfeinden". Dem Westwall auf der einen Seite stand die Maginolinie auf der anderen gegenüber, Tonnen von Beton, gespickt mit Tausenden Kanonen aller Kaliber. Einer traute dem anderen nicht. Immerhin bewahrte der Arbeitseinsatz unseren Onkel vor der Front. Werner Bartlitz lernte an der Fachhochschule in Magdeburg. Er war noch zu jung für den Krieg. Das empfand er allerdings durchaus nicht als Vorteil. Mit seinen Freunden träumte er von Heldentaten an der Front. Die Jungen beschlossen, sich freiwillig zu Eliteeinheiten zu melden, sobald sie das konnten. Werner bewarb sich bei der Marine und wurde dort auch angenommen. Als Einziger überlebte er den Krieg. Vater gehörte zu den Jahrgängen, die man (noch) nicht einzog. Mein Bruder Rudi hatte als Soldat wieder das Glück, in einer Kleiderkammer eingesetzt zu werden, und zwar in Magdeburg. Werner Schatz erreichte seines Studiums wegen eine Zurückstellung. Auf meiner Arbeitsstelle hatte ich nun eine ganz andere Sorte Bilder zu entwickeln als früher. Die Fotos von spielenden Kindern und fröhlichen Familienfeiern wurden seltener. Jetzt waren heroische Motive gefragt. Portraits junger Männer in Paradeuniformen gingen zu Hunderten durch meine Hände. 146 Manche der Soldaten trugen Blumenschmuck nach glanzvollem Sieg. Viele ließen sich auch mit Freunden zusammen ablichten. Die in der Heimat Zurückgebliebenen sollten sich überzeugen, daß sie bei der Einnahme diesen oder jenen Ortes dabei gewesen waren. Als ich in Swinemünde meine Schwester Elly besuchte, sah ich die Soldaten mit eigenen Augen - junge Matrosen voller Siegeszuversicht. Die schändliche Niederlage von 1918 wird sich nicht wiederholen, sprachen ihre Gesichter. Übrigens gab es immer noch eine Menge normalen Alltags. Zum Beispiel wurde mir eine Kur an die Nordsee verschrieben. Ich verbrachte vier Wochen in Wyk auf der Insel Föhr und sammelte viele Eindrücke dort. Schon die Anreise war ein Erlebnis, denn es blies eine steife Brise und das Fährschiff schaukelte reichlich in den Wellen. Das Phänomen von Ebbe und Flut beeindruckte mich sehr, kannte ich doch bis dahin nur die Ostsee. Schnell lernte ich neue Freundinnen kennen, mit denen zusammen ich mehrere Wanderungen über das Wattenmeer unternahm. Den Krieg hätte ich dabei wohl glatt vergessen, wären nicht die Routinebelehrungen über das Verhalten bei Fliegeralarm gewesen. Nach dem leichten Sieg über Polen und vor allem angesichts der Unentschlossenheit der stärksten Gegner fühlten sich die Nazis im Frühjahr 1940 stark genug für neue, größere Feldzüge. Sie besetzten Dänemark und Norwegen. Dann fielen sie über Holland und Belgien in Frankreich ein. Die mit so viel Aufwand gebaute Maginolinie nutzte nichts, weil sie von den deutschen Truppen einfach umgangen wurde. Nachdem sie sich schon politisch so gründlich verrechnet hatten, scheiterten die westlichen Verbündeten nun auch militärisch in kläglichster Art und Weise. Bei Dünkirchen wurden die geschlagenen Reste ihrer Armee ins Meer getrieben. Das stolze Paris fiel am 14. Juni kampflos. Inzwischen hielten die Nazis sich nicht mehr mit langen Begründungen auf, wenn sie einen neuen Feldzug begannen. 147 Auf dem Balkan schufen sie im Frühjahr des folgenden Jahres einfach nur "Ordnung". In Afrika eilte General Rommel den Italienern zu Hilfe. Die versuchten dort schon seit ein paar Monaten, sich ein paar zusätzliche Quadratkilometer Land zusammenzuräubern, kamen aber nicht so recht voran. Allerdings wurde das Volk zur Wachsamkeit ermahnt. In den Hausfluren hingen eines Tages Plakate, auf denen ein großer, menschenähnlicher Schatten und die Aufschrift: "Achtung, Feind hört mit!" zu erkennen waren. Für die Schulzes brachten die ersten beiden Kriegsjahre nicht allzu viel Neues. Von Onkel Franz erfuhren wir durch einen Brief, daß seine Söhne zwar an der Front seien, sich aber noch bester Gesundheit erfreuten. Irmgard entging nur knapp einer Zwangsverpflichtung in die Rüstungsindustrie. Onkel Gustav verschaffte ihr einen Ausbildungsplatz bei der Bahn. Die galt als ebenso wichtig. An den Lokomotiven stand in großen Buchstaben geschrieben: "Räder müssen rollen für den Sieg". Über das Schicksal von Irmgards Bruder Werner während des Krieges weiß ich bis heute nicht gut Bescheid. Er wurde eingezogen, aber offenbar aus irgend einem Grund nicht an die Front geschickt. Muttchen gelangte in dieser Zeit zu der Erkenntnis, ihre Tochter Elly brauche einen Mann. Weil sie bekanntlich ein Mensch schneller Entschlüsse war, und weil sie es sich - wie damals die meisten Leute - abgewöhnt hatte, Unternehmungen auf die Zeit nach dem Krieg zu vertagen, setzte sie im Namen ihrer Tochter eine Anzeige in die Zeitung. Nun war es nicht so, daß meine Schwester und ich keine Gelegenheit fanden, auf direktem Wege Bekanntschaften zu schließen. Tanzveranstaltungen wurden nur während der Feldzüge untersagt. Zwischendurch gab es für junge Leute durchaus Möglichkeiten, sich zu amüsieren. Aber das, was sie für sich selbst ganz selbstverständlich in Anspruch genommen hatte, das wollte Muttchen für ihre Kinder keineswegs gelten lassen. 148 Die waren zweifellos viel zu unaufmerksam, um die richtige Wahl zu treffen. Das mußte sie selbst erledigen. Die Anzeige erschien. Zuschriften trafen ein - ein ganzer Waschkorb voll. Damit, daß so unglaublich viele "nette, anständige Männer" dringend ein "junges, bescheidenes Mädchen" suchten, hatte Muttchen nicht gerechnet. Die Sache wuchs ihr über den Kopf. Sie brauchte einen Helfer - mich. Während Elly ahnungslos in Swinemünde weilte, arbeiteten wir uns zu Zweit durch den Berg der Bewerber. Die Auswahlkriterien, die wir anlegten, waren stahlhart: Ohne Bild - ab in den Papierkorb; einmal verschrieben - das selbe. Wer die erste Runde überstanden hatte, fand sich in einem von drei Haufen wieder und konnte immerhin damit rechnen, einer gründlichen Bewertungsdiskussion unterzogen zu werden. Bis zu diesem Punkt fand ich das alles noch recht vergnüglich. Nun aber kam die eigentliche Arbeit. Um den erfolgversprechendsten Herren gründlicher auf den Zahn fühlen zu können, mußte eine Korrespondenz mit ihnen geführt werden. Elly stand dafür nicht zur Verfügung. Sie wußte noch immer nichts von ihrem sich anbahnenden Glück. Ich war Elly. Selbstverständlich durfte ich nicht schreiben, was ich wollte. Die Worte wurden mit Bedacht gewählt, die Sätze gewissermaßen wie Monumente gemeißelt. Bis in die tiefe Nacht hinein ging das so. Nach drei Wochen hatte ich Ringe unter den Augen, und meine Kolleginnen argwöhnten ein Doppelleben. Am Ende blieben fünf Bewerber übrig. Um die mußte sich Elly nun wohl oder übel persönlich kümmern. Nach eindringlichen Ermahnungen ließ sie sich auch herbei, nacheinander jedem von ihnen eine Audienz zu gewähren. Selbstverständlich gefiel ihr keiner. Nicht einmal als einer ihr bis Swinemünde nachreiste, die Verlobungsringe siegessicher schon in der Jackentasche, ließ sie sich erweichen. Muttchen war außer sich über diesen jämmerlichen Ausgang ihres mit so viel Aufwand betriebenen Unternehmens. Die Zeiten, in denen 149 es auf das Einverständnis der Betroffenen nicht ankam, lagen zu ihrem Ärger weit zurück. Dann aber wendete sich das Blatt überraschender Weise doch noch einmal. Ein gewisser Richard Flöter, ein wegen Unentbehrlichkeit vom Kriegsdienst zurückgestellter Spezialarbeiter aus den Dessauer Junkerswerken, hatte - aus welchen Gründen auch immer - noch Wochen später auf die Anzeige geschrieben. Auswahlkriterien gab es nun nicht mehr. Elly fand den Brief akzeptabel und traf sich sofort mit dem jungen Mann. Bald danach heirateten beide. Elly kehrte aus Swinemünde zurück und nahm eine Schwesternstelle am Köthener Krankenhaus an. Ich war damals noch nicht einmal achtzehn Jahre alt. Deshalb hatte Muttchen beim Durchsehen der Zuschriften an mich auch noch nicht gedacht. Mir selbst aber fiel einer der Briefe auf. Er war so ordentlich geschrieben wie keiner sonst. Die Druckbuchstaben standen exakt wie von einer Maschine gesetzt. Eine in die rechte, obere Ecke geklebte Blüte und die netten Formulierungen deuteten wiederum auf ein herzliches Wesen hin. Auch war der junge Mann, dem Foto nach zu urteilen, nicht häßlich, wenngleich es durchaus noch hübschere Bewerber gab. Kurzum - ich bat Muttchen, ihm in meinem eigenen Namen schreiben zu dürfen. Daraus entwickelte sich eine ziemlich regelmäßige Korrespondenz. Wegen des Krieges dauerte es allerdings noch fast ein Jahr, bis ich Werner - er hieß tatsächlich genau so wie schon zwei meiner Cousins - endlich persönlich kennenlernte. Ja, es war noch immer Krieg! Wir planten unsere Zukunft, schmiedeten die abenteuerlichsten Pläne, aber es war Krieg. Auch Urlaubsreisen wurden unternommen. Nachdem ich die Nordsee kennengelernt hatte, ging es nun ins Hochgebirge. Das Quartier verdankte ich meinem Chef. Es lag in Tirol, malerisch inmitten gewaltiger Berge. Und dennoch: Es war Krieg. Als ich von einer Wanderung zurückkehrte, hörte ich in den Nachrichten vom Einmarsch in die Sowjetunion. Von diesem 150 Tage an wechselten nicht mehr schnelle Feldzüge mit glanzvollen Siegesparaden. Vom frühen Morgen des 21. Juni 1941 an gab es keine Ruhepause mehr. Die Heeresgruppen rückten zügig vor, auf Leningrad, auf Moskau, auf Kiew. Mitten im Siegen aber hatte, unmerklich noch für die meisten, die Niederlage begonnen. Die Nazis indes hielten ein Ende ihrer Herrschaft für gänzlich undenkbar. Nachdem sie halb Europa besetzt hatten, genügten ihnen die militärischen Erfolge allein nicht mehr. Sie wollten die totale "Neuordnung". "Deutsches Kulturgut" sollte sich ausbreiten. Dahinter verbarg sich natürlich das Ziel, die Eroberungen abzusichern. Mit Militärverwaltungen und "Reichsbevollmächtigten" allein ließ sich das nicht bewerkstelligen. Deshalb riefen sie dazu auf, im Osten auf ehemals polnischem Land zu siedeln. Denjenigen, die sich darauf einließen, winkten zahlreiche Vergünstigungen. Häuser und Grundeigentum waren spottbillig. Junge Männer wurden vom Militärdienst befreit. Auch den Bartlitzens erschien das Angebot verlockend. Als Onkel Otto ganz konkret vor der Wahl stand, in Südwestpolen in der Nähe der Stadt Kalisch eine Fleischerei zu übernehmen, wurde am Schloßplatz ein Großfamilienrat einberufen. In einer schier endlosen Diskussion wägte man Vor- und Nachteile gegeneinander ab. Am Endsieg der Deutschen bestand kein Zweifel. "Eines Tages werden alle nach dem Osten drängen. Wenn wir den anderen zuvor kommen, haben wir Vorteile." Das waren Ottos Argumente. Tante Hethe und Tante Emma pflichteten ihm bei. Es wäre geradezu eine Dummheit, die große Chance aus Trägheit vorbeigehen zu lassen. Muttchen und Vater dagegen vermochten sich für den Plan dennoch nicht zu erwärmen. Vielleicht fürchteten sie - zweifellos nicht ganz zu Unrecht - sich damit auf Gedeih und Verderb den Bartlitzens auszuliefern. Onkel Franz hatte schon zuvor in einem Brief höflich abgesagt. Eine endgültige Entscheidung 151 fiel freilich noch nicht. Erst einmal sollte Otto sich an Ort und Stelle überzeugen, ob das Angebot auch wirklich redlich war. In den nun folgenden Wochen brach ein wahres Umsiedlungsfieber aus. Ottos Bruder Hermann bekam eine Pferdeschlächterei in der selben Gegend in Aussicht gestellt. Schwester Ida wollte ein Gemüsegeschäft eröffnen. Ihr Mann erklärte sich bereit, für seine beiden Schwager auf den Dörfern Vieh aufzukaufen. Onkel Gustav, der Bahnarbeiter, war sowieso wenig zu Hause, so daß es ihm leicht fiel, einem Umzug zuzustimmen. Tante Emma hatte noch keine genauen Vorstellungen über ihre Zukunft in Polen, aber sie war überzeugt, daß man auch sie gut würde gebrauchen können. Auf ihre Kinder brauchten die Schatzens keine Rücksicht mehr zu nehmen. Werner und Irmgard wohnten beide nicht mehr bei ihnen. Helga sollte in eine deutsche Schule gehen, von deren Vorhandensein Otto sich überzeugt hatte. Am Ende war nur noch unklar, was aus Großmutter werden sollte. Ein Sprichwort besagt: "Einen alten Baum verpflanzt man nicht". Muttchen bot unser überzähliges Zimmer an, das wir sonst vermieteten. Dort wäre Großmutter nicht nur in ihrer vertrauten Heimatstadt geblieben sondern auch in der Nähe ihres geliebten Problemkindes Max. Letztlich aber entschied sie sich dann doch dafür, ihre jüngere Tochter Hedwig zu begleiten und mit ihr die lange Reise nach Polen anzutreten. Für Hermann, der in Köthen bereits eine Fleischerei besaß, gab es einen besonderen Grund, sein Glück in der Fremde zu wagen. Daß er es mit der Treue zu seiner Frau Bertha nicht allzu genau nahm, davon war schon einmal kurz die Rede. Meistens gingen die Affären verhältnismäßig schnell vorüber. Bertha wußte oft sogar davon und verzieh ihm. Einmal aber verliebte er sich während eines Urlaubs in Thüringen mehr als sonst. Ein gemeinsames Kind kam zur Welt und die Beziehung blieb - trotz der räumlichen Trennung - über Jahre hinweg von Bestand. 152 Hermann brachte das in größte Verlegenheit. Bertha wollte er nicht verlieren, weil sie eine vorzügliche Geschäftsfrau war. Seine Freundin hatte ihm sein einziges Kind geboren. Der Umsiedlungsplan nun brachte ihn auf einen großartigen Einfall. Was in einer deutschen Kleinstadt wie Köthen geradezu ungeheuerlich und allemal geschäftsschädigend gewesen wäre, das ließ sich in Polen unauffällig in die Tat umsetzen. Er beschloß, künftig mit beiden Frauen zusammen zu leben. Für Bertha war das natürlich eine Zumutung ersten Ranges. Am Ende aber ließ sie sich darauf ein. Ihre Liebe zu Hermann besiegte ihren Stolz. Die Verträge für die Übernahme der polnischen Geschäfte wurde nun unterschrieben. Wegen des großen Interesses der Nazis am Gelingen ihres Siedlungsprojektes gab es ungewöhnlich wenig bürokratische Hindernisse. Die meisten Formalitäten erledigten sich praktisch von selbst. Nur um den Verkauf des Hauses am Schloßplatz mußte Onkel Otto sich selbst kümmern. Allzu hoch war der Erlös nicht, denn das alte Haus bedurfte dringend einer ganzen Reihe von Reparaturen. Dann kam bald der Tag des großen Aufbruchs. Muttchen wurde erst in diesem Moment die Tragweite ihrer Entscheidung gegen den Plan ihres Schwagers richtig bewußt. Die regelmäßigen Zusammenkünfte am Schloßplatz gab es nun nicht mehr. In den vertrauten Räumen wohnten fremde Leute. Die Besuche in Berlin fielen weg. Wir waren eben die Zurückgebliebenen. Am Ende vermißte Muttchen wohl gar Onkel Ottos wüste Späße. Um sich abzulenken, suchte sie sich eine neue Arbeit in der Flugplatzkantine. Den Weg am Schloß vorbei vermied sie noch wochenlang. Daß sich gleichzeitig tief in Rußland Ereignisse abspielten, die unser Schicksal sehr viel einschneidender und nachhaltiger beeinflussen sollten, das war uns ebenso wenig bewußt wie den meisten unserer Landsleute. An der Ostfront hatte sich die Lage dramatisch geändert. Der deutsche Angriff war ins Stocken geraten. Vor den Toren Moskaus versteifte sich der 153 Widerstand. Schließlich gingen die Russen gar zum Gegenangriff über und eroberten einen beträchtlichen Teil ihres Landes zurück. Die deutsche Armee verlor den Nimbus der Unbesiegbarkeit. Allerdings konnte die Propaganda der Nazis diese Tatsache noch erfolgreich bemänteln. Des ungewöhnlich strengen Winters wegen habe man die Offensive wohldurchdacht unterbrochen und sich geordnet in strategisch vorteilhafte Stellungen zurückgezogen. Moskau werde im nächsten Frühjahr fallen. Der Endsieg stünde dicht bevor. Tatsächlich gelang es den deutschen Truppen im Sommer des Jahres 1942 noch einmal, die Initiative an sich zu reißen. Die Russen wurden bei Charkow geschlagen. Dann fiel die Krim mitsamt der Festung Sewastopol. Die Spitzen der 17. Armee erreichten den Kaukasus. Ein zweiter Keil stieß in Richtung Stalingrad vor. Die deutschen Soldaten marschierten also wieder, unaufhaltsam, wie es schien. Durch den Krieg und seine Folgeerscheinungen verlor ich meine Verwandten, die "Schulzes", deren Schicksal darzustellen, ich mir vorgenommen habe, ein wenig aus den Augen. Die einen wohnten nun fern in Polen, die anderen dienten irgendwo als Soldaten. Erst später - ich bin geneigt "sehr viel später" zu sagen, obwohl es nur um wenige Jahre geht - erfuhr ich, wie es ihnen ergangen war. Manches blieb mir, aus unterschiedlichen Gründen, bis heute rätselhaft. So werde ich jene schicksalhafte Zeit zunächst nur aus meinem eigenen Erleben beschreiben und hoffe, daß dies niemand als Selbstsucht mißversteht. Als ich Werner zum ersten Mal in seiner Heimatstadt Dresden besuchte, wußte ich schon eine ganze Menge über ihn 154 und seine Familie und hatte mir im Kopf bereits ein bestimmtes Bild gebastelt. Nun war ich gespannt, inwieweit dieses Bild mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Zwischen Werners Eltern bestand ein Altersunterschied von dreißig Jahren. Der Vater hatte als Witwer ein zweites mal geheiratet. Er entstammte sehr armen Verhältnissen. Seine Mutter mußte sich allein mit sechzehn Kindern durchschlagen. Jedoch, er schaffte das, wovon viele in ähnlicher Lage inbrünstig träumen und wobei fast alle scheitern - den gesellschaftlichen Aufstieg. Auf dem Höhepunkt seines Lebensweges besaß er zwei Hotels, eines in Stettin und eines in Swinemünde. In den Wirren der Inflation verlor er allerdings den Großteil seines Vermögens wieder. Nun, alt und nicht mehr ganz so unternehmungslustig wie einst, führte er ein gutbürgerliches Leben. Werners Mutter hatte im ersten Weltkrieg ihren Verlobten verloren. Damit sie mit ihrem Kummer nicht allein bliebe, holte ihr Onkel sie nach Stettin. Dort arbeitete er als Verwalter in einem Hotel und nutzte seine Beziehungen, sie als Pflegerin für die schwerkranke Frau des Besitzers zu vermitteln. So lernte sie ihren späteren Ehemann kennen. Daß er dem Altersunterschied nach hätte ihr Vater sein können, empfand sie nie als ernsthaften Nachteil. Die Ehe war durchaus glücklich. Meine ersten Erfahrungen mit Werners Familie waren ein bißchen zwiespältig. Mit seinen Eltern verstand ich mich recht gut. Die übrigen Verwandten hatten sich wohl mehr von mir versprochen. Aber letztlich belastete mich das nicht besonders. Viel wichtiger war mir, daß ich viel Zeit mit Werner verbringen konnte. Wir unternahmen ausgedehnte Wanderungen durch die bizarre Bergwelt der Sächsischen Schweiz, besichtigten die Sehenswürdigkeiten Dresdens, gingen ins Theater. Daß wir so bald nicht wieder so unbeschwert zusammentreffen würden, ahnten wir natürlich nicht. Werner, 155 der von Beruf Vermessungstechniker war, wurde einer auf Artilleriebeobachtung spezialisierten Einheit zugeordnet und nach Rußland geschickt. Von der Ostfront gab es nur selten Urlaub. Selbst die eigene Hochzeit war oft kein ausreichender Grund. Die Heeresleitung hatte sich nämlich die "Ferntrauung" ausgedacht. Während die Braut in der Heimat auf dem Standesamt saß, wurde im fernen Rußland der Bräutigam von seinem Vorgesetzten in den Stand der Ehe versetzt. Ein blumengeschmückter Stuhl ersetzte den jeweils fehlenden Partner. Eine reichlich perverse Idee. Werner und mir blieb dieses Possenspiel zum Glück erspart, aber davon wird später die Rede sein. Ende 1942 bekam ich die Einberufung zum Reichsarbeitsdienst. Mein Einsatzort lag irgendwo in der Slowakei. Dort sollte ich den "volksdeutschen" Bauern helfen. Ich mußte mich auf dem Magdeburger Hauptbahnhof einfinden und wurde dann gemeinsam mit Hunderten anderen in einen Sonderzug gesetzt. Für die meisten von uns begann ein völlig neuer Lebensabschnitt. Nur wenige waren schon einmal für längere Zeit von zu Hause fort gewesen. Kaum einer von uns kannte den anderen. Als sich der Zug in Bewegung setzte, flossen die Tränen. Wir waren ein ziemlich kläglicher Haufen bei unserem Aufbruch. Dabei wußten wir noch nicht einmal, welch gefährliche und ungewisse Reise wir tatsächlich angetreten hatten. Nicht einmal ein halbes Jahr früher war der "Reichsprotektor" Heydrich von Exiltschechen erschossen worden. Die Nazis hatten darauf mit unvorstellbaren Greueltaten an der Zivilbevölkerung reagiert. Noch immer wußte niemand genau, ob das zu lähmender Angst oder zu einem allgemeinen Volksaufstand führen würde. In dieser politischen Lage rollte unser Zug quer durch die Tschechei. Wir merkten nichts und wunderten uns nur, daß bei der Fahrt durch Prag die Türen verschlossen und die Vorhänge zugezogen wurden. 156 Nach stundenlanger Fahrt stiegen wir tief in der Slowakei aus dem Zug und wurden mit Autobussen an unsere Bestimmungsorte verteilt. Die Bauern, bei denen wir später arbeiten sollten, erwarteten uns schon. Sie musterten uns wie Pferde, die zu verkaufen waren, und ihr Urteil fiel vernichtend aus: Blasse, viel zu magere Stadtpflänzchen. Unser Lager war nicht besonders komfortabel und lag zudem ziemlich einsam auf einer Anhöhe. Es bestand aus vier Schlafbaracken, der Führerbaracke und einem Wirtschaftsgebäude mit dem Speiseraum. Eine Woche lang hatten wir Zeit, uns einzurichten. Wir bekamen unsere Uniformen und brachten die Quartiere in Ordnung. Dann gingen wir jeden Tag acht Stunden zu den Bauern arbeiten. Der Begriff "Volksdeutsche" ist irreführend. Die meisten Familien, die ich kennenlernte, lebten schon seit etlichen Generationen in der Slowakei und fühlten sich dort durchaus heimisch. Das bewahrte sie freilich nicht davor, daß sie nach dem Krieg vertrieben wurden. Uns blieben sie bis zuletzt fremd. Die Arbeit fiel uns am Anfang sehr schwer. Beim Dreschen beispielsweise mußte ich die großen Ährenbündel über den schwankenden Tennenboden schleppen, die Halteseile entfernen und dann die losen Garben auf den Tisch der Dreschmaschine werfen. Dort nahm die Magd sie in Empfang. Die ausgedroschenen Körner fing der Bauer in Säcken auf. Die Säcke wiederum trug der Knecht fort. So ging das den ganzen Tag. An Ablösung war nicht zu denken. Es fehlte allenthalben an Arbeitskräften. Wenn wir am Abend ins Lager zurückkehrten, spürten wir jeden Knochen im Leib und konnten uns vor Erschöpfung kaum noch auf den Beinen halten. Unangenehm war auch der Dreck, den wir nie mehr ganz los wurden. Wenn Gerste gedroschen wurde, verhakten sich die langen Grannen in der Kleidung und in den Haaren. Alles in allem allerdings schadete 157 die Arbeit uns nicht. Allmählich gewöhnten wir uns an die körperliche Anstrengung und wurden sichtbar kräftiger. Einige Mädchen blieben im Lager zurück. Dadurch fanden die Zurückkehrenden heißes Wasser zum Waschen und eine warme Mahlzeit vor. Das war sehr angenehm. Auch das Waschen der schmutzigen Kleidung übernahmen die Diensthabenden. Das Weihnachtsfest hat in der Fremde einen völlig anderen Charakter als zu Hause im Kreise der Familienangehörigen. Wir alle empfanden es viel tiefer als in anderen Jahren. Am Vormittag gingen wir zu den Bauern, bei denen wir arbeiteten, sangen ihnen Lieder und schenkten ihnen Adventskränze, die wir zuvor selbst gebunden hatten. Danach wanderten wir ein Stück. Die Tannen trugen ein Kleid aus Schnee. Ringsum herrschte tiefe Stille. Sacht fielen Flocken. Uns umgab eine Atmosphäre, wie für einen kitschigen Film arrangiert. Gegen Abend kehrten wir zum Lager zurück. Der Speiseraum war mit einem großen Weihnachtsbaum geschmückt. Darunter lagen die Päckchen aus der Heimat, welche die Lagerleitung für diesen Augenblick zurückgehalten hatte. Wir heulten und waren zugleich irgendwie glücklich. Vor allem fühlten wir einander so nah wie noch nie zuvor. Als sich herausstellte, daß ein Mädchen kein Paket bekommen hatte, gaben die anderen ihm von ihrem etwas ab. Ganz anders verlief Silvester. Eine meiner Zimmerkameradinnen besorgte eine Milchkanne mit zehn Litern Obstwein und schmuggelte sie ins Lager. Jeder nahm sich nun seinen Zahnputzbecher, und es begann ein lustiges Gelage. Uns fehlte jede Erfahrung mit Alkohol, und wir konnten nicht viel davon vertragen. Folglich waren wir blitzschnell betrunken. Die Lagerleitung ließ uns gewähren, indem sie sich taub stellte. Bestraft wurden wir von Mutter Natur - mit fürchterlichen Brummschädeln. Unterdessen tobte bei Stalingrad jene Schlacht, die dem Krieg die Wende bringen sollte. Die 6. Armee unter General 158 Paulus hatte bis Mitte November etwa 90 Prozent der Stadt eingenommen, als die Gegenoffensive begann. Nach der Vereinigung der beiden russischen Stoßkeile westlich von Stalingrad waren die deutschen Truppen eingeschlossen. Ein Entsatzversuch scheiterte Mitte Dezember. Seitdem verschlechterte sich die Lage von Tag zu Tag. Diese Schlacht betraf mich aber auch ganz persönlich, denn zu den Soldaten der 6. Armee gehörte Werner, mit dem ich inzwischen verlobt war. Seine Einheit operierte zwar weit entfernt von den feindlichen Linien, doch nutzte ihm das wenig, als sich der Kessel schloß. Ich bekam plötzlich keine Briefe mehr von ihm. In großer Sorge verfolgte ich jede Meldung, doch mißtraute ich bald den Wehrmachtsberichten, die wie schon bei der Schlacht um Moskau die Lage völlig verzerrt darstellten. Das, was da behauptet wurde, konnte gar nicht stimmen. Weil die Bauern, bei denen ich arbeitete, auch verbotene Sender hörten, erfuhr ich zumindest andeutungsweise die Wahrheit. Der Untergang der 6. Armee war ein Ereignis, das niemanden in Deutschland unberührt ließ. Erstmals wurde Volkstrauer ausgerufen. Viele Menschen begannen, ihre Meinung zum Krieg zu überdenken. Für Hitler und seine Gefolgsleute allerdings traf das nicht zu. Sie wollten siegen, gleich um welchen Preis. Um der schlechter werdenden Stimmung entgegenzuwirken, hielt Propagandaminister Göbbels eine Rede, die in die Geschichte eingehen sollte. Sie gipfelte in dem Ausruf: "Wollt ihr den totalen Krieg?" Eine ausgewählte Menge brüllte: "Ja!" Ich hörte die Rede gemeinsam mit den anderen Mädchen im Essensaal. Meine Empfindungen ähnelten denen bei der Kundgebung auf dem Tempelhofer Feld. Allerdings war ich inzwischen kein Kind mehr und erlebte das Geschehen viel bewußter. Auch umgaben mich diesmal nicht ausschließlich 159 bedingungslos begeisterte Leute. Der Glaube an den Endsieg ließ sich mehr als Selbstverständlichkeit verkaufen. Die Lagerleitung tat deshalb alles, um uns bei großdeutscher Gesinnung zu halten. Der militante Charakter des Arbeitsdienstes drückte sich nicht nur in den Uniformen aus. Regelmäßig fanden politische Schulungen statt. Die Morgenappelle, bei denen feierlich die Hakenkreuzfahne gehißt wurde, glichen Ritualen. Der "Totale Krieg" veränderte den Alltag der Menschen auch in Deutschland selbst. Alles wurde ihm untergeordnet. Nur noch der Krieg zählte. Wer darüber öffentlich murrte, konnte schnell in den Ruf eines Vaterlandsverräters kommen. Zudem litten die Leute in den Städten unter den immer häufigeren anglo-amerikanischen Bombenangriffen. Die deutsche Luftabwehr erwies sich als machtlos gegen die feindlichen Geschwader. Göring änderte seinen Namen trotzdem nicht. Es dauerte mehrere Monate, bis ich wieder ein Lebenszeichen von Werner erhielt. Fast unglaubliche Glücksumstände ließen ihn nahezu unversehrt dem Inferno entkommen. Bei einem Einsatz in vorderster Linie - mit dem Dienst weit hinten war es inzwischen vorbei - traf ihn ein Granatsplitter am Kinn. Er büßte einen Großteil seine Zähne ein, litt aber kaum Schmerzen. Da das Kinn bekanntlich zum Kopf gehört, fiel er unter jene Kategorie Verwundeter, die man mit Flugzeugen zu retten versuchte. Unter den Kopf- und Bauchverletzten wiederum war er aber einer derjenigen, die sich selbst behelfen konnten. Das verhalf ihm zu einem der erbittert umkämpften Plätze an Bord. Wenig später errangen die Russen die absolute Lufthoheit, und die Versorgungsflüge für die Eingekesselten mußten eingestellte werden. Werners erster Brief nach der Rettung erreichte mich aus einem Lazarett in Krakau. Dann verlegte man ihn nach Göttingen, wo ihn katholische Ordensschwestern betreuten, die sich sehr fürsorglich um die Kranken kümmerten. Angenehm 160 war auch, daß ich ihn dort besuchen konnte. Ich beantragte Urlaub außer der Reihe, und weil ich einen Stalingradhelden seelisch aufrichten wollte, bekam ich ihn wider Erwarten tatsächlich genehmigt. Stannern, mein Einsatzort, lag so ziemlich am Ende der Welt. Lediglich einmal in der Woche fuhr ein Autobus zur zehn Kilometer entfernten Kreisstadt Iglau, die einen Eisenbahnanschluß besaß. Deshalb benutzten wir Fahrräder, um dorthin zu gelangen. Diese wurden an einem bestimmten Gasthof abgestellt. Diebstahl kam praktisch nie vor. Nach einer strapaziösen Reise traf ich in Göttingen ein. Das Wiedersehen mit Werner war glücklich aber leider viel zu kurz. Schon am Morgen danach mußte ich mich wieder in den Zug setzen. In Iglau erlebte ich dann eine böse Überraschung. Jemand hatte das Fahrrad nach Stannern zurückgebracht. Dramatisch war das insofern, als wir am nächsten Tag verlegt werden sollten. Ich mußte also bis zum Morgen um jeden Preis wieder im Lager sein. Diesen Fußmarsch durch die Nacht sehe ich noch heute in allen Einzelheiten vor mir. Am Ortsausgang von Iglau traf ich ein kleines, weinendes Mädchen. Als ich die Kleine fragte, was ihr Kummer sei, stellte sich heraus, daß sie das selbe Ziel hatte wie ich. Sie war eine Volksdeutsche, absolvierte ihr Pflichtjahr beim Bürgermeister von Stannern und hatte sich aus Heimweh davongestohlen. So taten wir uns also zusammen. Ein Bauer nahm uns freundlicher Weise ein Stück auf seinem Pferdewagen mit. Unterwegs erzählte er uns, daß es in der Gegend von Partisanen nur so wimmle. Das war nicht gerade beruhigend. Das letzte Stück des Weges mußten wir beiden wieder mutterseelenallein gehen. Hinter jedem Baum glaubten wir einen Mann mit Maschinenpistole zu sehen. Da ich aber die Große war, durfte ich mir meine Angst nicht anmerken lassen. Ich erzählte lustige Geschichten und behauptete überdies 161 entschieden, daß Partisanen an Montagen in ihren Verstecken blieben. Am Schluß glaubte ich mir sogar selber. Als ich mich weit nach Mitternacht in der Führerbaracke meldete, bekam ich einen strengen Tadel. Alles in allem aber ging das Abenteuer glimpflich für mich aus. Meine Stubengefährtinnen hatten meine Habseligkeiten längst für die Abreise vorbereitet. Die Verlegung bedeutete für uns allerdings die Trennung. Mit ihr ging der "Reichsarbeitsdienst" in den "Kriegshilfsdienst" über, und wir wurden völlig neu verteilt. Ich kam in die "Mariankaschule". Das war ein großes Gebäude am Stadtrand von Prag. Ich schlief dort mit meinen neuen Kameradinnen in den ehemaligen Klassenzimmern. Die Wände entlang standen zwanzig Betten. Die Mitte füllte ein langer Tisch mit Stühlen aus. Dann gab es noch zwei große Gemeinschaftsschränke und für jeden einen Nachttisch für die persönlichen Dinge. Gegessen wurde in der ehemaligen Turnhalle. Es war unbehaglich in der zweckentfremdeten Schule, sogar verglichen mit dem Lager in Stannern. Wenigstens durften wir jetzt Zivil tragen. Eingesetzt wurde ich in einem Forschungsinstitut. Woran man dort arbeitete, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, möchte ich es so genau auch gar nicht erfahren. Wenn ein Mitarbeiter seinen Raum verließ, mußte er abschließen und den Schlüssel einstecken. Meine konkrete Aufgabe bestand darin, im Auftrage eines jungen Doktor der Physik zu einem anderen Institut zu fahren und dort Vergrößerungen wissenschaftlicher, für einen Laien kaum zu deutender Aufnahmen anzufertigen. Die Freizeit verbrachte ich hauptsächlich mit Ruth, dem einzigen Mädchen aus dem Lager von Stannern, das ebenso wie ich in der Mariankaschule gestrandet war. Wir schlenderten durch Prag und sahen uns die Sehenswürdigkeiten an, den Wenzelsplatz und den Veitsdom, die Karlsbrücke und den Hradschin - ganz so wie Touristen. Wenn ich heute daran denke, wie naiv wir das damals taten, kann ich nur den Kopf schütteln und unserem Schutzengel danken. Wir fragten 162 Einheimische nach dem Weg, in Deutsch, versteht sich. Wir scherten uns nicht darum, wenn wir uns einmal ein wenig verspäteten und die Dunkelheit uns überraschte. Wir fanden nicht einmal etwas dabei, daß wir für die Rüstungsindustrie jenen Landes arbeiteten, das nun schon seit mehr als drei Jahren ganz Europa mit Krieg überzog. Werner wurde nach Arnsdorf bei Dresden verlegt. Es ging ihm inzwischen wieder so gut, daß er ab und zu Urlaub bekam. Einmal besuchte er mich in Prag. Als romantische Umgebung für unser Stelldichein schlug ich einen großen Erholungspark am Stadtrand vor. Als wir dort jedoch ankamen, fanden wir halb Prag versammelt. Es herrschte ein solches Gewimmel, daß wir gleich wieder umkehrten und mit einer gewöhnlichen Parkbank irgendwo in der Stadt vorlieb nahmen. Die Zeit, die Werner noch frontuntauglich war, wollten wir nutzen, um zu heiraten. Gleich bei der nächsten Gelegenheit leiteten wir die Formalitäten ein. Unter anderem mußte ein Nachweis der "Deutschblütigkeit" erbracht werden. Das dauerte seine Zeit. Um die Vorbereitung der Feier kümmerte sich unterdessen Muttchen. Obwohl sie mitten im "Totalen Krieg" stattfand, hatte ich eine wirklich prächtige Hochzeit. Mit einer weißen Kutsche fuhren Werner und ich zur Jakobskirche in Köthen. Als wir einzogen, spielte die Orgel "So nimm denn meine Hände". Nach dem Gottesdienst erwarteten uns vor dem Portal viele Leute, die uns beglückwünschten. Kinder spannten nach alter Tradition vor uns ein Band, um den Bräutigam aufzufordern, eine Hand voll kleiner Münzen in die Menge zu werfen. Über Blumen schritten wir schließlich zur Kutsche zurück. Auch bei der anschließenden Feier bei uns zu Hause fehlte es an nichts, was sich irgendwie auftreiben ließ in dieser Zeit. Muttchen hatte sich buchstäblich aufgerieben dafür. Entsprechend war dann allerdings auch ihre Verfassung. Ich fürchte, sie hatte von uns allen am wenigsten Spaß. 163 Gleich am nächsten Morgen brachen Werner und ich zur Hochzeitsreise in den Harz auf. Ein ganzer Schwarm von Verwandten begleitete uns zum Bahnhof. Nach einer nicht ganz hindernisfreien Fahrt - wir erwischten beim Umsteigen einen falschen Zug, landeten spätabends in einem uns völlig unbekannten Ort und mußten ein außerplanmäßiges Nachtquartier beziehen - erreichten wir das lieblich gelegene Städtchen Gernrode. Acht Tage lang vergaßen wir dort den Krieg. Wir wanderten durch die Umgebung und durch das wildromantische Bodetal und unternahmen Ausflüge zur Roßtrappe und zum Hexentanzplatz. Mit dem Trauschein in der Hand beantragte ich meine Versetzung nach Dresden. Dem Gesuch wurde stattgegeben, und ich arbeitete von nun an für das Serumwerk der Stadt. Das hatte den Vorteil, daß ich oft mit Werner zusammen sein konnte. Der Nachteil war, daß ich täglich acht Stunden lang Etiketten auf Ampullen kleben mußte. Eine Idiotenarbeit! Ich entsinne mich nicht, jemals im Leben etwas monotoneres getan zu haben. Eines Tages dann blieb nur noch der Nachteil übrig, denn Werner wurde zurück nach Meißen versetzt. Dort diente er ein halbes Jahr als Ausbilder. Anschließend wurde er zu einem Offizierslehrgang nach Frankreich geschickt. Glücklicherweise lief meine Verpflichtung zum Kriegshilfsdienst wenig später aus. Nun mußte ich allerdings befürchten, in eine Waffen- oder Munitionsfabrik geschickt zu werden. Um das zu vermeiden, sah ich mich selbst nach einer neuen Anstellung um und fand schließlich eine an der Luftkriegsschule Klotzsche bei Dresden. Dort konnte ich wieder in meinem Beruf als Fotolaborantin arbeiten, und das war natürlich eine gewaltige Verbesserung gegenüber dem Serumwerk. Unterkunft fand ich bei meiner Schwiegermutter. Werners Vater lebte inzwischen nicht mehr. Einige Monate später fuhr ich zu einem Lehrgang nach Hildesheim. Dort sollte ich lernen, Karten zu lesen und mit großen Luftbildfilmen umzugehen. Die Schule befand ich auf 164 dem Gelände des Fliegerhorstes der Stadt. Deshalb sammelte ich zugleich meine ersten ernsthaften Erfahrungen mit den anglo-amerikanischen Bombardements. Hildesheim, das nach dem Krieg fast vollständig zerstört war, hatte wegen seiner militärischen Einrichtungen schon zu dieser Zeit sehr unter den Angriffen zu leiden. Die Nächte verbrachte ich häufig im Luftschutzkeller. Gab es tagsüber Alarm, mußten wir uns im Gelände verteilen. Ich hatte furchtbare Angst vor Tieffliegern. Denen nämlich waren wir praktisch wehrlos ausgeliefert. Interessant fand ich die Werksbesichtigungen, die man mit uns durchführte. Einmal erlebte ich einen Hochofenabstich mit. Es sah gespenstisch aus, wie das flüssige Metall grellweiß und zischend in die bereitstehenden Formen floß. Ein andermal fuhren wir zu einer Talsperre. Man erklärte uns, daß bei Fliegeralarm das Tal vernebelt werde, um eine Zerstörung der Staumauer zu verhindern. Der Gedanke, in den Wassermassen des Stausees zu ertrinken, war nicht sehr angenehm. Allerdings sollten die Besichtigungen ohnehin nicht dem Vergnügen dienen. Vielmehr ging es darum, die auf den Luftbildern erkennbaren Objekte mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Echte Freizeit gab es wenig. So hatte ich leider auch kaum Gelegenheit, mir die schöne, alte Stadt mit ihren berühmten Kirchen und Fachwerkhäusern anzusehen. Immerhin besuchte mich Werner dort. Er war inzwischen von Frankreich zurückgekehrt und absolvierte gerade den zweiten Teil seines Offizierslehrganges in Großborn, einem kleinen Ort irgendwo in Mecklenburg. Jedoch nicht einmal diese Episode blieb frei von häßlichen Zwischenfällen. Mitten in der Nacht klopften zwei uniformierte Männer an die Tür des Hotelzimmers und wollten unsere Ausweise und Werners Urlaubsschein kontrollieren. 165 Jetzt wird es aber allerhöchste Zeit, daß ich nachtrage, wie es den anderen "Schulzes" in dieser Zeit ergangen ist. Ich will beginnen mit meine Schwester Elly. Sie wurde bereits im April 1942 Mutter eines Sohnes, dem sie den Namen Helmut gab. Da man sie kurz nach der Geburt, ihrer Vorkenntnisse wegen, zum Roten Kreuz einzog und ins Baltikum abkommandierte, konnte sie sich um das Baby nicht selbst kümmern. An ihrer Stelle übernahm Muttchen die Pflege. Von unseren nach Polen übergesiedelten Verwandten wußten wir durch gelegentlich eintreffende Briefe lange Zeit nur vage, daß es ihnen recht gut ging. Im Übrigen luden sie uns regelmäßig zu einem Besuch ein. Muttchen war nicht abgeneigt, die Einladung anzunehmen, schob die Reise aber immer wieder auf. Vor allem hinderte sie der kleine Helmut, dem sie die Strapazen einer so langen Fahrt noch nicht zumuten wollte. Eines Nachts aber hatte sie einen bösen Traum. Sie sah ihre Mutter schwerkrank im Bett liegen und hörte sie nach ihr rufen. Nun fand sie keine Ruhe mehr, traf schon am nächsten Tag alle notwendigen Vorbereitungen und setzte sich dann in den nächsten, nach Osten rollenden Zug. Tante Hethe verschlug es glatt die Sprache, als ihre Schwester so unvorbereitet vor der Tür stand. Die beiden Frauen umarmten sich und tauschten erst einmal die wichtigsten Neuigkeiten aus. Dabei erfuhr Muttchen, daß ihr Traum sie nicht belogen hatte. Die inzwischen 83 Jahre alte Mutter lag tatsächlich im Bett. Als Folge eines Schlaganfalls konnte sie nicht mehr sprechen. Allerdings nahm sie noch sehr genau wahr, was um sie herum geschah. Muttchen setzte sich mit dem kleinen Helmut zu ihr ans Bett und erzählte ihr, was sich in den zurückliegenden Jahren in Köthen ereignet hatte. Ab und zu lächelte die alte Frau. Am späten Abend sprachen Hethe und Muttchen noch darüber, ob es notwendig sei, einen Arzt zu holen. Das war in dieser Gegend kein so leichtes Unterfangen. Der nächste wohnte immer noch weit genug entfernt, daß er mit dem 166 Pferdewagen geholt werden mußte. Deshalb entschlossen sich die Schwestern, nichts zu überstürzen und erst noch die Entwicklung am nächsten Tag abzuwarten. Als Tante Hethe die Mutter aber am Morgen wecken wollte, fand sie sie tot auf dem Bettrand sitzen. Wahrscheinlich hatte sie noch versucht, Hilfe zu holen. Das war für alle Familienmitglieder ein harter Schicksalsschlag, obwohl sie im Grunde schon seit mehreren Monaten ständig hatten damit rechnen müssen. Am tiefsten von allen traf es zweifellos Max, der - telegrafisch benachrichtigt - schon einen Tag später eintraf. Die Mutter war der einzige Mensch gewesen, der ihn mit all seinen Charakterschwächen geachtet und geliebt hatte. Er nahm keinen Bissen Essen an und blieb bis in die Nacht hinein an ihrem Bett sitzen. Er streichelte sie und redete auf sie ein, so als könne er ihren Tod damit ungeschehen machen. Großmutters Beerdigung fiel weit weniger prächtig aus als die des Großvaters. Die Familien befanden sich, wenn sie es sich auch nicht recht eingestehen wollten, in einem fremden Land. Ein nicht geringer Teil der einheimischen Bevölkerung sah in ihnen nichts als Eroberer und stand ihnen unverhohlen feindselig gegenüber. Die politische Entwicklung nach Kriegsende löschte dann die letzten Spuren der Ruhestätte meiner Großmutter aus. Max reiste am nächsten Tag wieder ab. Muttchen blieb noch etwas länger und erfuhr dadurch einige Einzelheiten über das Schicksal der Bartlitzens und Schatzens während der ersten Kriegsjahre. Onkel Otto war mit seinem Fleischerladen recht erfolgreich. Er hatte einen fleißigen und ehrlichen polnischen Gesellen, mit dem er sich auch über die Arbeit hinaus gut verstand. Tante Hethe bediente im Geschäft. Dabei fiel ihr auch die recht komplizierte Abrechnung der Lebensmittelkarten zu. Von Tante Emma erhielt Otto ebenfalls viel Hilfe. Allerdings wohnte sie nicht mit im selben Haus sondern hatte für sich und ihre Familie eine eigene Wohnung. Da Gustav und Irmgard dienstlich oft unterwegs waren, kam 167 sie sich in ihren drei Zimmern manchmal ein bißchen verloren vor. Auch Hermanns Pferdeschlächterei im Nachbardorf ging gut. An altersschwachen Pferden herrschte kein Mangel, und die Käufer bekamen auf ihre Lebensmittelkarten die doppelte Menge. Wie der Schwerenöter mit seinen zwei Frauen zurecht kam, und wie die sittenstrengen polnischen Katholiken darauf reagierten, danach fragte Muttchen lieber nicht. Werner Schatz wohnte mittlerweile im westfälischen Hamm. Dorthin hatte er geheiratet. Inzwischen gab es auch schon einen Sohn mit Namen Claus. Werner Bartlitz dagegen war ein schmucker Marinesoldat geworden. Ob er ähnlich viele Mädchen hatte wie etliche seiner Waffenbrüder? Niemand wußte das so genau. Von einer festen Verbindung jedenfalls war noch nicht die Rede. Helga blieb die ganze Woche über in einem Internat. Die deutsche Schule, die sie besuchte, lag ziemlich weit entfernt. Als Muttchen nach Köthen zurückkehrte und von ihren Erlebnissen berichtete, sagte Vater: "Nur gut, daß wir hier geblieben sind." Es fällt mir heute oft schwer, jüngeren Menschen, die jene Jahre nur aus Geschichtsbüchern kennen, unsere Reaktionen, Gedanken und Gefühle zu begründen. Wenn ich sage: "Wir haben vieles verdrängt und deshalb nicht wahrgenommen", dann entsteht leicht der Eindruck, wir seien auf diese Weise vor unserem eigenen Gewissen geflohen. Wir verdrängten aber nicht nur das Leid der anderen sondern auch die Gefahr, die uns selbst drohte. Ich glaube, wir verfielen, je länger der Krieg dauerte, immer mehr in einen Zustand chronischer Abstumpfung, der die sonderbarsten Erscheinungen mit sich brachte. Zum Beispiel sprachen Muttchen, Tante Hethe und Tante Emma in Polen nicht ein einziges Mal über die Entwicklung an der Ostfront. Dabei war die im zurückliegenden Jahr äußerst beängstigend verlaufen. Im Juli 1943 unternahmen die 168 deutschen Truppen bei Kursk ihre letzte große Offensive. Die Operation "Zitadelle" mündete in eine gigantische Panzerschlacht, bei der jene Eliteeinheiten zu Grunde gingen, die zwei Jahre zuvor noch die russische Verteidigung in wenigen Tagen hunderte Kilometer tief aufgerissen hatten. Seitdem lag die Initiative ausschließlich auf der Seite der Russen. Ende des Jahres erreichten sie den Dnjepr und befreiten Kiew. Nun näherten sie sich mit nahezu pausenlosen Angriffen in großem Tempo der ehemaligen polnischsowjetischen Grenze. Die Bartlitzens und Schatzens waren akut gefährdet, doch sie kümmerten sich nicht darum. Der Führer wird's schon richten! Im September 1944 landeten die westlichen Alliierten in der Normandie. In Italien, wo sich die Amerikaner und Briten schon im Jahr davor festgesetzt hatten, verlief die Front kurz vor Bologna. Die Russen waren in Bulgarien und Rumänen eingedrungen. In Polen standen sie nur wenige Kilometer vor Warschau. Es sah nicht mehr gut aus für Deutschland. Durch hektische Truppenverlegungen versuchte das Oberkommando der Wehrmacht, die Lage zu verbessern. Auch Rudi wurde nun häufig versetzt. Jedes dieser taktischen Manöver aber brachte nur örtlich eng begrenzte und zeitweilige Entlastung und riß an anderen Stellen Löcher auf. Dennoch war Vaters plötzliche Einberufung zur Wehrmacht sonderbar. Sein Jahrgang wurde noch verschont zu dieser Zeit. Später erfuhren wir die Zusammenhänge. Er hatte zu einem Nachbarn gesagt, daß seiner Ansicht nach der Krieg nicht mehr zu gewinnen sei, und war denunziert worden. Allein weil er zu den frühen NSDAP-Mitgliedern zählte, entging er der Verhaftung und kam "nur" zu den Marinepionieren an die Nordsee. Im Frühsommer 1944 merkte ich, daß ich schwanger war. Als ich es Muttchen erzählte, bat sie mich, nach Köthen zurück zu kommen. Ich konnte das verstehen und stimmte zu. Das wiederum ärgerte aber meine Schwiegermutter. Zwischen den 169 beiden Frauen spielten sich nahezu ständig kleine Eifersüchteleien ab. Jede Mutter versuchte, das eigene Kind gegen den Partner zu "beschützen". Da ich zwischen beiden stand, kostete es mich viel diplomatisches Geschick und vor allem viel Nerven, einen bösartigen Streit zu vermeiden. Mitte Dezember 1944 kam Manfred, mein erstes Kind, auf die Welt. Man könnte beinahe sagen, daß ich damit eine Tradition fortsetzte, eine nicht sehr schöne Tradition freilich. Manfred verbrachte sein erstes Lebensjahr ebenso wie ich einst in einer Zeit des Zusammenbruchs und des Hungers. Zum Glück gab es bei der Geburt keine Komplikationen. Das Gesundheitswesen, mit der Versorgung der Verwundeten hoffnungslos überlastet, war nicht mehr sehr vertrauenswürdig. Gegen Ende des Jahres besuchte uns Werner Bartlitz. Er war in großer Sorge um seine Angehörigen, von denen er seit zwei Monaten nichts mehr gehört hatte. Niemand wußte, wann die Russen ihre nächste Offensive beginnen würden. Das von der Nazipropaganda versprochene Wunder durfte sich nicht mehr sehr viel Zeit lassen. Leider konnten wir Werner nicht beruhigen. Uns ging es nicht anders als ihm. Drei Wochen später klopfte es an die Tür. Vor uns standen Tante Hethe, Heinz und Helga. Onkel Otto kam ein wenig später. Abgehärmt, wie sie alle vier waren, erkannten wir sie kaum wieder. Wir empfanden Freude und Trauer zugleich - Freude darüber, daß sie überhaupt noch lebten, Trauer über die Art unseres Wiedersehens. Ein Pferdewagen mit ein paar geretteten Habseligkeiten, mehr gab es nicht mehr von ihrem großen Traum. Die Geflüchteten hatten nicht einmal mehr eine Wohnung. Wir nahmen sie vorläufig in unserem Haus auf. Sie zogen in das große Zimmer im Obergeschoß, das wir für sie räumten. Otto hatte sich zu allem Unglück am Fuß verletzt und brauchte dringend ärztliche Hilfe. Vier Familien waren einst fröhlich in Richtung Osten gezogen. An jenem kalten Januartag trafen aber nur die Bartlitzens und Helga wieder in Köthen ein. Die Flucht hatte 170 die Menschen voneinander gerissen. Als Tante Hethe uns berichtete, was in den zurückliegenden Wochen mit ihnen geschehen war, mußte sie viele Fragen offen lassen. Der Befehl zur Flucht nach Deutschland kam von einem Tag zum anderen. Da die Züge längst nur noch Soldaten und Kriegsmaterial transportierten und auch das Benzin nahezu ausschließlich den unersättlichen Bedürfnissen der Front zur Verfügung stand, blieben die Zivilisten auf einfache Fuhrwerke angewiesen. Was man nicht zurücklassen wollte, wurde in hektischer Eile in Säcke, Kisten und Körbe verstaut. Es war ein chaotischer Aufbruch. Für Sentimentalitäten blieb kein Platz. Der polnische Geselle flehte Otto an, ihn mitzunehmen. Er fürchtete sich wohl vor der Rache seiner Landsleute, weil er sich mit einem Deutschen gut verstanden hatte. Sein Flehen jedoch nutzte ihm nichts. Er mußte zurückbleiben. Die drei Bartlitzgeschwister und ihre Familien fuhren mit je einem eigenen Wagen. Emma und Helga wurden von Otto mitgenommen. Von einem geordneten Zug konnte man allenfalls ganz am Anfang reden. Die Ost-West-Straßen waren hoffnungslos mit Flüchtlingstrecks verstopft. Gleichzeitig mußte das Tempo gesteigert werden, denn die Offensive stand allem Anschein nach unmittelbar bevor. Weil die völlig erschöpften Pferde die überladenen Wagen schließlich nicht mehr zogen, landeten von den ohnehin spärlichen Habseligkeiten der Familien immer mehr Säcke im Straßengraben. Noch schlimmer war, daß auch die Menschen die Strapazen schließlich nicht mehr aushielten. Sie starben an Entkräftung, und ihre Verwandten hatten oft nicht einmal genügend Zeit, sie würdig zu beerdigen. Daß Menschen in diesem Inferno spurlos verschwanden, war beinahe alltäglich. So geschah es auch mit Tante Emma. Sie suchte während einer Rast nach Wasser, um sich ein wenig zu waschen. Die Kolonne setzte sich aber früher als erwartet wieder in Bewegung. Auszuscheren war nicht möglich. Es blieb nur die Hoffnung, daß Emma sie noch einholte. Sie kam 171 aber nicht. Anfang Januar wußte noch niemand der Verwandten, was mit ihr geschehen war. Die Fuhrwerke Hermanns und Idas hatten Hedwig und Otto ebenfalls aus den Augen verloren. Die waren aber zumindest noch als Familien zusammen gewesen. Deshalb sorgten wir uns um deren Schicksal nicht ganz so sehr. Onkel Otto brach sich seinen Fuß, als ihm ein Wagen darüber fuhr. Da die Verletzung unterwegs nur notdürftig versorgt werden konnte, mußte er unter großen Schmerzen weiter laufen. Es war erstaunlich, daß er überhaupt so viele Kilometer noch durchhielt. In Köthen dann wurde der Knochen endlich gerichtet und ruhig gestellt. Ich hatte den Onkel etwa vier Jahre lang nicht mehr gesehen, und mein Verhältnis zu ihm war nun völlig anders. Ob es daran lag, daß ihm nach den Erlebnissen der vergangenen Monate nicht mehr der Sinn nach seinen gefürchteten groben Späßen stand, oder ob er mich nun, als erwachsene, verheiratete Frau mit Kind ganz einfach ernster nahm, das kann ich schwer beurteilen. Jedenfalls unterhielt ich mich mit ihm einige Male über den Krieg und über Deutschlands Zukunft. Irgendwie hielt ich ihn für jemanden, der sich auskennt und die Zusammenhänge besser versteht als andere. Er vertraute auf die "Geheimwaffe" und glaubte noch immer an den Endsieg. Beruhigen konnte mich das freilich nicht. Was sollte die Geheimwaffe noch bringen? Weitere sechs Jahre des Abschlachtens? Ich hatte genug davon. Ab wann wußte ich, daß dieser Krieg für Deutschland in einer Katastrophe enden mußte - trotz der noch immer großspurigen Wehrmachtsberichte? Ab wann gelang der Selbstbetrug nicht mehr? Vielleicht im Februar 1945, als ich meine Schwiegermutter besuchte und mich in der völlig zerstörten Innenstadt von Dresden nicht mehr zurechtfand, obwohl ich hier einmal jede Straße gekannt hatte. Daß die Familie meines Mannes verschont geblieben war, weil ihr Haus ein wenig außerhalb lag, nahm dem Eindruck nur einen 172 geringen Teil seines Schreckens. Die Bomben hatten nicht nur unersetzliche Kunstschätze vernichtet sondern auch Tausende Menschen getötet, fast ausschließlich Zivilisten. Die Stadt war vollgestopft gewesen mit Flüchtlingen aus dem Osten. Bis zum heutigen Tage kennt niemand die Zahl der Opfer. Auch für Werner wendete sich das Schicksal zum Schlechten. Bis Ende 1944 hatte er sich noch als Ausbilder in Meißen halten können. Dann aber war er mit einer neu aufgestellten Einheit zuerst nach Coswig und dann direkt an die Front verlegt worden. Die Russen standen jetzt an der Oder und bereiteten den Sturm auf die Reichshauptstadt Berlin vor. Die allerletzte Phase des Krieges hatte begonnen. Sie sollte noch einmal Tausenden Soldaten das Leben kosten. Für mich blieb lange unklar, ob auch Werner zu diesen letzten Opfern gehörte. Im Durcheinander des Zusammenbruchs verlor ich die Verbindung zu ihm. Im Frühjahr 1945 erreichte uns der Krieg in Köthen. Wir hörten in der Ferne Artilleriefeuer. Auf den nahegelegenen Landstraßen rollten in den Nächten nahezu ununterbrochen die Panzer. Fuhren sie in Richtung Front oder kamen sie von dort? Die Männer über 60 und die Jungen ab 15 wurden zum Volkssturm einberufen. Mit Panzerfäusten sollten sie die feindlichen Truppen aufhalten, jene Truppen, vor denen die regulären Einheiten längst auf der ganzen Linie flüchteten. Das letzte Aufgebot. Die allerletzte Steigerung des Wahnsinns. In diesen Tagen setzte Elly sich ab von ihrer Sanitätseinheit, die nach Berlin verlegt werden sollte. Sie hatte wenig Verlangen, beim "Endkampf" dabeizusein und stand plötzlich bei uns vor der Tür. Zeitweilig erwogen wir, mit den Kindern zu flüchten. Aber wohin sollten wir flüchten? Deutschland war klein geworden. Vom Osten näherten sich die Russen, vom Westen die Amerikaner. So beschlossen wir am Ende, in der Stadt zu bleiben und uns im Keller einzurichten. Wir schafften Bettzeug und Lebensmittel hinunter. Dann versteckten wir uns selber 173 dort. Nur Onkel Otto blieb in der Wohnung und bezog dort gewissermaßen Beobachtungsposten. Auf Befehl irgend eines Kommandanten wurden nun überall am Stadtrand Barrikaden errichtet. Dahinter bezog der Volkssturm Stellung. Die Amerikaner, die inzwischen wenige Kilometer entfernt standen, waren daraufhin fest entschlossen - wie in vielen Fällen zuvor - die Luftwaffe anzufordern. Auf diese Weise pflegten sie ihre Opfer gering zu halten, zu Lasten der Zivilbevölkerung des Gegners. Zum Glück für Köthen rissen buchstäblich in letzter Minute mutige Leute die Barrikaden wieder ab. Die Amerikaner konnten kampflos einmarschieren, und es kam zu keinen nennenswerten Zerstörungen. Wir hatten bewußt die Türen nicht verschlossen, um zu zeigen, daß wir keinen Widerstand leisten wollten. Ein wirksamer Schutz wären unsere banalen Schlösser ohnehin nicht gewesen. Besonders sicher fühlten wir uns so natürlich nicht, und als wir Maschinengewehrfeuer in unmittelbarer Nähe hörten, gingen uns viele Gedanken durch den Kopf. Wir hatten keine Vorstellung, was das Schicksal uns bringen würde. Alles war möglich. Durch das Kellerfenster sahen wir Soldatenstiefel. Der Krieg hatte also unseren Garten erreicht. Als Muttchen sich für einen Moment in die Küche wagte, um Milch für den kleinen Manfred aufzuwärmen, berichtete sie entsetzt, daß überall "Schwarze" herumlaufen. Bald aber wurde es ruhiger in unserem Viertel. Die Soldaten hielten sich hauptsächlich in der Innenstadt auf. Zu uns kam nur noch einmal ein Lautsprecherwagen, der uns aufforderte, vorläufig in den Häusern zu bleiben und weitere Anweisungen abzuwarten. Wir fürchteten aber, daß die Kämpfe erneut ausbrechen könnten. Immerhin sprachen die Nazis davon, daß dem Feind an der Elbe erbitterter Widerstand entgegen schlagen werde. Dabei ergingen sie sich in vage Andeutungen über Mittel, die sie bisher noch gar nicht ins Feld geführt hätten. Erst die Meldung von der bedingungslosen Kapitulation 174 zerstreute diese letzte Sorge. Wir konnten endlich wieder ruhig schlafen. 175 7. Kapitel Margarete erzählt Wir unterstanden nun der amerikanischen Besatzungsmacht. Später war in den Geschichtsbüchern zu lesen, dies sei die Befreiung gewesen, die Befreiung vom Faschismus. Objektiv ist das zweifellos eine richtige Einschätzung. Die Nazis hatten uns zu Komplizen beispielloser Verbrechen werden lassen. Wer aber empfand das damals schon so? Onkel Otto hatte erst an das Ende des "Großdeutschen Reiches" geglaubt, als sich die Meldung von Hitlers Selbstmord verbreitete. Tante Hethe trauerte ihren zerplatzten Träumen nach. Auch Muttchen liebte sie nicht, die Fremden, die mit Lautsprecherwagen durch die Straßen fuhren, Befehle erteilten und Ausgangssperren verhängten, bei denen sich alle wehrfähigen Männer zur Registrierung melden mußten, bei denen sämtliche Rundfunkempfänger abzuliefern waren. Nur in einer Hinsicht fühlten wir alle uns befreit: Wir waren befreit vom Krieg. Sieben Jahre, die (von ein paar Monaten der Siegtrunkenheit abgesehen) Jahre des Schreckens gewesen waren, sie hatten die Menschen zermürbt. Sie wollten nicht den Nazigrößen in den Tod folgen. Sie wollten Frieden, Frieden nahezu um jeden Preis. Jeder war verunsichert. Jeder fragte sich, wie die Soldaten, die praktisch mit uns tun konnten, was sie wollten, sich verhalten würden. Wenn sie nach Einbruch der Dunkelheit mit schußbereiten Maschinenpistolen durch die Straßen patrouillierten, wagten sich die Leute nicht einmal mehr in ihren eigenen Vorgarten hinaus. Unseren Nachbarn geschah einmal Folgendes. Sie hatten sich gerade ins Bett gelegt, da hörten sie plötzlich Geräusche, lautes Reden in einer fremden Sprache, Gelächter. Der Großvater faßte sich ein Herz und 176 schlich sich bis zum Küchenfenster. Von dort aus sah er, daß sich in der Veranda mindestens fünfzehn Uniformierte gemütlich niedergelassen hatten. Sie aßen, tranken und sangen. Ihre Waffen lagen vergessen auf der Erde. Nach kurzer Beratung beschlossen die Leute, sich nicht zu rühren. Tatsächlich waren die Soldaten am nächsten Morgen verschwunden. Sie hatten ihren Sieg gefeiert, ohne das Haus zu betreten. Daß wir Maxens ein paar Jahre zuvor nicht mit den Bartlitzens und Schatzens gen Osten aufgebrochen waren, erwies sich jetzt als großer Glücksfall für die Schulzes insgesamt. Niemand sah uns mehr als die armen Verwandten an. Niemand wollte mehr zu uns gesagt haben, es sei eine Dummheit, das großzügige Angebot des Führers auszuschlagen. Wir bildeten nun den Punkt, um den sich das Großfamilienleben drehte, und Muttchen genoß ihre neue Rolle. Weil wir immer Wert auf einen kleinen Vorrat gelegt hatten, gab es in unserem Keller noch einige Gläser Obst und Pflaumenmus. Sogar Kartoffeln besaßen wir noch. Wurst und Fleisch steuerten die Bartlitzens bei. Es war dies ein letzter Rest ihres einst unerschöpflich scheinenden Reichtums an Lebensmitteln. So ging es uns besser als vielen anderen in dieser Zeit. Nur die Beschaffung der Milch für die kleinen Kinder stellte ein Problem dar. Auch für Brot mußten wir uns in die langen Schlangen der Hungernden einreihen. Eine Dauerlösung war das Zusammenleben in unserem kleinen Haus natürlich nicht. Zum Glück hatte Otto in Köthen viele Freunde. Trotz seiner Grobheit war er eben doch immer ein hilfsbereiter Mensch gewesen. Mit Hilfe jener Freunde trieben die Bartlitzens schon recht bald eine eigene Wohnung auf. Auch mit Möbeln wurden sie versorgt. So hatten sie schließlich zumindest wieder ein Heim, wenngleich kein besonders komfortables. 177 An eine Arbeit im Schlachthof oder gar eine eigene Fleischerei war freilich nicht zu denken. Otto mußte versuchen, auf andere Weise den Lebensunterhalt zu verdienen. Als der Mann seiner Schwester Ida ihm anbot, seine Obstplantagen zu bewachen, nahm er ohne Zögern an. Das war damals übrigens ein gar nicht so leichtes Unterfangen. Die hungernden Menschen stahlen die Früchte schon unreif und schlangen sie ohne Rücksicht auf die Folgen in sich hinein. Ehe sie sich allerdings mit Otto anlegten, plünderten sie lieber woanders. Von den Schatzens hatten wir noch nichts gehört, und das bereitete uns Sorgen. Als eines Tages wenigstens meine Cousine Irmgard vor der Tür stand, waren wir deshalb sehr froh. Unsere Hoffnung, durch sie Neuigkeiten über Tante Emma zu erfahren, erfüllte sich jedoch nicht. Irmgard wohnte inzwischen in Bitterfeld. Es ging ihr nicht schlecht, zumal sie bei der Bahn nach wie vor einen sicheren Arbeitsplatz hatte. Wahrscheinlich aber fühlte sie sich einsam, denn sie bat darum, Helga zu sich nehmen zu dürfen. Das Mädchen lebte noch immer wie selbstverständlich bei uns und fühlte sich allem Anschein nach auch recht wohl. Daß es da noch einen Vater gab, davon war nie die Rede. Helga hatte ihn wohl für alle Zeit aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Erstaunlich aber war, daß sie sich auf Irmgards Ansinnen sofort einließ. Als hätte es zwischen den beiden nie Streit und Eifersüchteleien gegeben, bedrängte die Vierzehnjährige unser Muttchen so lange, bis sie sich einverstanden erklärte. Deutschland war noch weit davon entfernt, zur Ruhe zu kommen. Flüchtlinge aus den verloren gegangenen Gebieten im Osten irrten umher auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Junge Soldaten flüchteten vor der Kriegsgefangenschaft. Auch sie wußten nicht, wohin sie sich wenden sollten. Frauen reisten viele Kilometer weit, um etwas zu Essen für sich und ihre Familien aufzutreiben. Ein ganzes Volk war in Bewegung geraten. Weil es keinen regelmäßigen Eisenbahnverkehr gab, konnten die Züge den Ansturm nicht 178 bewältigen. Die Menschen hingen an den Türen, saßen auf den Puffern, kletterten auf den Waggondächern herum. Manch einer fand dabei den Tod. Allerdings erzeugte das allgemeine Elend auch eine erstaunliche Form von Solidarität. Klopfte zum Beispiel jemand abends bei wildfremden Leuten an und bat um ein Nachtquartier, so konnte er fest damit rechnen, es auch zu bekommen. Die Soldaten wurden mit Zivilkleidung und mit Ratschlägen über die sichersten Schleichwege versorgt. Arbeit war knapp. Als Elly und ich zum Arbeitsamt gingen, hatten wir nicht allzu viel Hoffnung auf Erfolg. Plötzlich aber kamen amerikanische Soldaten und erklärten, daß sie drei Frauen brauchten. Selbstverständlich gewährten die Beamten ihnen die Bitte, sich unter den Anwesenden selbst die ihrer Meinung nach am besten geeigneten auszusuchen. Unter denen, für die sie sich schließlich entschieden, waren auch Elly und ich. Wir wurden gleich mit einem Auto mitgenommen. Weil uns niemand sagte, wohin die Reise eigentlich gehen sollte, fühlten wir uns recht unwohl. Immerhin hätte unser Ziel ein Bordell sein können. Am Ende aber erwies sich unser Los doch als ein Glückstreffer. In einer beschlagnahmten Villa war ein Kasino eingerichtet worden. Es gab eine Küche und zwei Speiseräume für die Offiziere der hier stationierten Einheit. Elly half in der Küche, ich servierte das Essen. Für die Reinigung war ein Mann angestellt. Wir konnten uns also über zu schwere Arbeit nicht beklagen. Außerdem bekamen wir etwas ab von den vorzüglichen Gerichten, deren Zutaten zu einem großen Teil direkt aus Amerika eingeflogen wurden. Allerdings durften wir nichts mit nach draußen nehmen. Was übrig blieb, landete auf dem Müll, denn die Deutschen waren ja die Feinde. Uns, die wir für sie arbeiteten, behandelten die Amerikaner nicht so sehr als Feinde. Es kam sogar vor, daß ich auf meinem Platz einen Blumenstrauß fand. 179 Auf der Grundlage von Verträgen zwischen den vier Siegermächten übergaben die Amerikaner und Briten im Juni 1945 Teile Mecklenburgs, Thüringens, Anhalts und Sachsens im Austausch für die Berliner Westsektoren an die UdSSR. In den Gebieten, die auf diese Weise eine neue Besatzungsmacht erhielten, lag auch Köthen. Für uns, die wir wegen der Nazipropaganda die Russen fürchteten wie kaum sonst etwas auf der Welt, war die Nachricht ein Schock. Viele sahen sich bereits nach Sibirien abtransportiert. Wie schon nach der Kapitulation nahmen sich wieder einige Menschen aus Angst vor der Zukunft das Leben. Ich erlebte gemeinsam mit Elly den Wechsel am Rande einer Landstraße unmittelbar mit. Auf der einen Seite fuhren die Amerikaner in gepflegten Uniformen auf großen Autos davon. Auf der anderen Seite kamen, sehr viel ärmlicher ausschauend, die Russen herein. Die Vorhut bildeten Panjewagen. Die kleinen, stämmigen, äußerst zähen Pferde aus dem Osten sah ich an diesem Tage zum ersten Mal. Auch die Soldaten, die auf den Wagen saßen, gaben mir das Gefühl, unvermittelt in einen sonderbaren Film hineingeraten zu sein. Sie kamen aus dem asiatischen Teil der endlosen Sowjetunion. Hinter ihnen marschierten russische Soldaten in Kolonne. Die sahen im Gesicht so ähnlich aus wie unsere Männer - immerhin. Als sie uns jungen Frauen ein paar Scherzworte zuwarfen und dazu gutmütig lachten, schöpften wir Hoffnung. Mit so wenig waren wir schon zufrieden in dieser Situation. Am Tage nach dem Einmarsch klebten an den Häuserwänden und Litfaßsäulen Plakate mit einem Aufruf Stalins. Er versicherte darin, sein Ziel sei die Vernichtung des deutschen Faschismus, nicht aber die Vernichtung des deutschen Volkes. Das war schon ein konkreterer Anhaltspunkt für die Annahme, daß wir uns selbst mit den Russen würden irgendwie arrangieren können. Uns hatte ein gehöriges Maß Schicksalsergebenheit zu beherrschen begonnen. 180 Inzwischen war zum Glück auch Werner, mein Mann, wieder bei mir. Die Leute seines Vermessungstrupps hatten sich gemeinsam kurz nach Beginn der russischen Offensive gegen die Seelower Höhen heimlich abgesetzt. Wenige Tage später versanken sie in einem Strudel des Chaos, in welchem nichts ehedem Normales mehr Gültigkeit besaß und dafür das Wahnwitzigste so normal wurde, daß kein Mensch sich mehr darüber wunderte. In einer Villa trafen sie Außenminister von Ribbentrop. Er hatte Hitlers besonderes Vertrauen besessen. Er hatte mit den Mächtigen der Welt verhandelt. Vor hunderttausenden Menschen hatte er im Scheinwerferlicht gestanden. Jetzt war er ein vorzeitig gealterter Mann, der etwas schier Unmögliches versuchte - seine Haut zu retten. Mit widersinniger Besorgtheit um lieb gewonnene Begleiter zeichnete er Werner mit seinem kostbar verzierten Spazierstock aus, ehe er kopflos davonrannte. Es war der Zusammenbruch. Sie waren jämmerlich, jene allerletzten Wochen des Reiches, nicht nibelungenheroisch, wie die Nazigrößen es gern gehabt hätten. Von den Russen ebenso gehetzt wie von der eigenen Militärpolizei trieben die Geflüchteten immer weiter nach Westen. Manchmal sahen sie auf den befestigten Straßen die auf Berlin zurollenden Panzerspitzen. Endlich erreichten sie jene Gebiete, in welche die Amerikaner vorstießen. Dort wurden sie festgenommen und voneinander getrennt. Werner kam in ein Auffanglager. Von dort flüchtete er abermals. Als Termin für das Unterfangen suchte er sich den 12. Mai aus, unseren Hochzeitstag. Am 28. Mai, seinem Geburtstag, traf er dann wohlbehalten in Köthen ein. Für Werner brachte die neue Besatzungsmacht ebenfalls neue Risiken mit sich. Er war im Krieg als Leutnant immerhin Offizier gewesen und konnte keine Entlassungspapiere vorweisen. In der Hoffnung, in seiner Heimatstadt seine Angelegenheiten besser regeln zu können, ging er nach 181 Dresden. Ich blieb mit Manfred in Köthen zurück. Später wollten wir dann hier oder dort wieder zusammenziehen. Das Leben mußte irgendwie weitergehen. Muttchen suchte sich Arbeit in einer russischen Küche. Die Nahrungssuche hatte Vorrang vor allem anderen. Wir glichen emsigen Tieren. Die Russen erlaubten ihren Bediensteten, Essenreste für ihre Familien mitzunehmen. Das half uns sehr. Freilich waren die Gerichte weit weniger auserlesen als bei den Amerikanern. Auch Elly ging zu den Russen. Ihr Arbeitgeber war in seiner Heimat Bauer gewesen und verwaltete nun als Offizier ein Rittergut. Die enteigneten Besitzer hatten sich in den Westen abgesetzt. Ellys Aufgabe bestand darin, einen dreijährigen Jungen zu betreuen. Das Kind war verhältnismäßig artig, gewöhnte sich rasch an die neue Tante und lernte ihr zuliebe sogar ein paar deutsche Worte. Der Haken bei der Sache bestand in der panischen Angst des russischen Ehepaars vor ansteckenden Krankheiten. Elly wurde praktisch wie eine Gefangene gehalten. Sie durfte sich mit dem Kind nur im Herrenhaus und im angrenzenden Park aufhalten. Der Verwalter war überhaupt ein sonderbarer Mensch. Hatte sich jemand auf dem Hof etwas zu Schulden kommen lassen, mußte er mit seiner gesamten Familie reisefertig auf dem Hof vor ihm erscheinen, um in die Verbannung geschickt zu werden. Standen die armen Menschen dann angstschlotternd vor ihm, hielt er ihnen eine Strafpredigt in Russisch. Anschließend entließ er sie wieder nach Hause. Als die Köchin einmal die Suppe versalzen hatte, zwang er sie, den gesamten Topf allein leerzuessen. Sein Lieblingswort war "Sabotasch". Das verstand man auch ohne Übersetzung. Onkel Otto fand einmal auf der Obstplantage, die er bewachte, eine Pistole. Sie gefiel ihm, und er zeigte sie seinem Schwager. "Bist du von allen guten Geistern verlassen?!" rief dieser. "Schmeiß das Ding weg! Wer weiß, was es damit auf sich hat." 182 "Was soll es damit auf sich haben? Sie ist jemandem bei der Flucht aus der Tasche gerutscht. Sieh doch mal: Sie ist wirklich schön und gut erhalten." "Mach damit, was du willst! Von meinem Grund und Boden jedenfalls verschwindet sie." Otto nahm sie mit nach Hause. Seine Frau riet ihm ebenfalls, sich mit der Waffe nicht zu belasten. Leider war er mitunter stur wie ein Panzer. Er versprach, die Pistole in einen See zu werfen, in Wirklichkeit versteckte er sie in der Wohnung. Drei Tage später bekamen die Bartlitzens unerwartet Besuch von einem ihrer alten Freunde. Der gehörte zu den wenigen, die sich nicht mit den Nazis eingelassen hatten und deshalb das Vertrauen der Besatzungsbehörden besaßen. Jetzt arbeitete er für eine Polizeidienststelle und verfügte dadurch über Informationen, die anderen verborgen blieben. Zu Otto war er gekommen, um ihn zu warnen. "Verschwinde von hier! Du stehst auf der Schwarzen Liste. Die wollen dich abholen." Otto bedankte sich, doch zu seiner Frau sagte er hinterher: "Das muß ein Mißverständnis sein. Ich bin doch kein Verbrecher. Ich brauche mich nicht zu verstecken. Das wird sich alles aufklären." Kaum aber hatte er am darauffolgenden Morgen das Haus verlassen, da standen Polizisten mit einem Durchsuchungsbefehl vor der Tür. Die Pistole wurde schnell gefunden, der illegale Waffenbesitz weisungsgemäß an die russische Kommandantur gemeldet. Noch am selben Vormittag verhaftete man Otto und dessen Schwager auf der Plantage. Beim Verhör erfuhren sie dann die Geschichte jener unglückseligen Pistole. Nahe der Plantage befand sich ein Friedhof. In der dazugehörigen Kapelle war ein russischer Soldat erschossen aufgefunden worden. Der wahre Täter hatte sich der Mordwaffe dann offenbar bei seiner Flucht auf einfache Art und Weise entledigt. Dieser Hergang ließ sich aber schwer 183 beweisen. Für die russischen Militärs bestand kein Zweifel bei diesem Fall. Sie tödlichen Schüsse waren eindeutig aus der fraglichen Pistole abgegeben worden. Auf dem Griff hatte man die Fingerabdrücke eines SS-Mannes gefunden. Wer also sollte der Mörder sein, wenn nicht jener Otto Bartlitz? Der Schwager kam bald wieder frei. Otto wurde in ein Gebäude gebracht, das als Spezialgefängnis der Kommandantur berüchtigt war. Als Tante Hethe von dieser schlimmen Entwicklung der Dinge erfuhr, lief sie verzweifelt von einer Behörde zur anderen und bettelte um Gnade für ihren Mann. Überall aber wurde sie kalt abgewiesen. Schließlich stellte sie sich vor das Gefängnis, um vielleicht wenigstens zu erfahren, wie es ihm gerade ging. Dort traf sie noch andere Frauen, deren Männer ebenfalls inhaftiert waren. Jeden Tag gaben sie ein Paket mit Lebensmitteln oder warmer Kleidung bei den Wachposten ab. Ob sie ihr Ziel erreichten, blieb ungewiß. Es gab zahlreiche Verhaftungen in dieser Zeit und wenige faire Prozesse. Nicht immer lag der Fall zumindest dem Anschein nach so eindeutig wie bei Onkel Otto. Oft reichte eine einfache Denunziation. Gefährdet war so gut wie jeder. Wer schon immer einmal Rache nehmen wollte an irgend jemandem für irgend etwas, jetzt hatte er reichlich Gelegenheit dazu. Tante Hethe litt vor allem unter ihrer völligen Ohnmacht gegenüber den Mühlsteinen des Schicksals. Nach ein paar Wochen befahl man den Frauen in einer gewissen Entfernung stehen zu bleiben. Eines Tages wurden ihnen auch die Pakete nicht mehr abgenommen. Leute aus den Nachbarhäusern berichteten, in der Nacht sei eine Anzahl Gefangener auf Lastkraftwagen abtransportiert worden. Werner Bartlitz war nach der Entlassung aus der Marine nicht nach Köthen zurückgekehrt sondern hatte sich in Bremen niedergelassen. Ab und zu kam er illegal über die Zonengrenze, um seine Mutter zu überreden, mit Heinz zu ihm zu ziehen. Tante Hethe wollte sich zunächst aber noch nicht 184 damit abfinden, ihren Mann nie wieder zu sehen, und blieb. Je unwahrscheinlicher ein glückliches Ende wurde, desto mehr klammerte sie sich an absurden Hoffnungen fest. Bei jedem Geräusch in der Nacht wachte sie auf und glaubte, ihm sei die Flucht gelungen. Auch Hermann hatte sich nicht wieder in seiner Geburtsstadt blicken lassen. Ich vermute, daß weniger seine SSZugehörigkeit als sehr private Gründe dafür ausschlaggebend gewesen waren. Er zog zu seiner Freundin nach Thüringen. Die besaß dort ein Haus. Bertha fand endlich den Mut, sich von ihm zu trennen. Sie suchte sich in Köthen eine neue Bleibe. Die Ironie des Schicksals wollte es nun, daß sie, die Gattin des Nazis, schließlich zusammenzog mit einer Jüdin, deren Mann im Konzentrationslager ermordet worden war. Als sich die Verhältnisse ein klein wenig zu normalisieren begannen und die Züge wieder halbwegs regelmäßig verkehrten, stand plötzlich Tante Emma vor unserer Tür. Wir umarmten sie einer nach dem anderen und waren überglücklich, denn wir hatten kaum noch damit gerechnet, daß sie noch lebte. Sie suchte nach Irmgard und Helga. Über ihren Mann Gustav, der gesund über den Krieg gekommen war, und ihren Sohn wußte sie schon Bescheid. Gegen Ende des Krieges hatte man meinen Cousin Werner Schatz nach Peenemünde abkommandiert. Er sollte dort beim Bau der so genannten Geheimwaffen mithelfen. Weil er aber an den Endsieg nicht mehr glaubte und ihn im Grunde auch gar nicht wünschte, und weil er nicht mitschuldig werden wollte an der Vernichtung weiterer Menschenleben, setzte er sich ab. Um niemanden zu gefährden, verbarg er sich in den Wäldern. Als der Krieg zu Ende war, ging er zu seiner Familie nach Hamm, nachdem er noch einmal kurz seine Eltern besucht hatte. Am meisten aber interessierte uns natürlich Tante Emmas ei genes Schicksal. Als sie auf dem Wege von Polen zurück nach Deutschland nach Wasser gesucht hatte, war sie an ein von den Bewohnern offenbar unmittelbar zuvor überstürzt verlassenes 185 Haus geraten. Auf dem Herd stand noch warme Suppe. Diese märchenhafte Gelegenheit wollte sie sich nicht entgehen lassen. Sie aß sich satt, wärmte sich ein wenig auf und schlief schließ lich ein. Beim Aufwachen stellte sie entsetzt fest, daß der Treck schon nicht mehr zu sehen war. Auf der Straße rollten jetzt Wehr machtswagen vorbei. Als sie nun so verlassen am Rand stand, bekam ein Soldat Mitleid mit ihr und zog sie auf ei nen der Wagen hinauf. Die Kolonne hatte Berlin als Ziel. Das war eine glückliche Fügung. In Falkensee besaß sie ja noch ihr Garten häuschen. Etliche Kilometer vor Berlin mußte sie dann aber von dem Wagen wieder herunterklettern. Sie bekam noch ein wenig zum Essen, dann war sie wieder ganz auf sich gestellt. Von nun an wurde der Weg zur Tortur. Nur selten nahm ein Fahrzeug sie mit. Nur selten konnte sie unter einem soliden Dach übernachten. Und der Winter war bitterkalt. Als sie end lich ihr Häuschen erreichte, hatte sie schwere Erfrie rungen an Händen und Füßen. Es war, als habe in den zurückliegenden Jahren trotz aller Zuversicht im Unterbewußtsein ständig eine Ahnung sie beglei tet. Während der gesamten Flucht hatte sie den Schlüssel zur Tür des Häuschens stets in einem Brustbeutel bei sich getragen. Beim Eintreten fand sie die Möbel aus ihrer Wohnung vor. Vor dem Aufbruch nach Polen waren sie hierher gebracht worden wie auf einen Speicher. Im Schuppen hatte sie Gustav eine große Menge Holz aufstapeln lassen, vorsorglich für einen Fall, an den niemand glaubte. Dennoch wäre Emma beinahe noch gestorben. Die Flucht hatte sie ausgelaugt, körperlich und vor allem seelisch. Sie heizte den Ofen, bis er glühte. Dann schmolz sie sich Schnee und trank gierig das so gewonnene Wasser. Dann legte sie sich ins Bett. Drei Tage lang tat sie nichts anderes, als Schneewasser zu trin ken und immer wieder den Ofen zu heizen. Essen konnte sie nichts. Das hohe Fieber versetzte sie 186 in eine Art Delirium. End lich entdeckten Nachbarn sie und holten einen Arzt. Später kam Gustav, und beide bauten sich gemeinsam wieder ein Heim auf. Mit Hilfe der Nachbarn brachten sie das Häus chen so gut in Schuß, daß sie sich darin wohl fühlen konn ten. Jenen Rest ihrer Habe aus Polen, der auf dem Wagen der Bart litzens bis nach Köthen gelangt war und nun bei uns la gerte, konnten sie natürlich gut gebrauchen. Emma wollte bald mit ihrem Mann wiederkommen und die Körbe abholen. Gegen Ende des Jahres 1945 faßte ich den Entschluß, wie der zu meinem Mann nach Dresden zu ziehen. Das war keine so ganz leichte Entscheidung. Erstens mußte ich mich dabei ge gen Muttchen durchsetzen, der es ganz und gar nicht paßte, ihr En kelchen Manfred wieder herzugeben. Zweitens erinnerte ich mich noch recht gut daran, daß auch mit meiner Schwie germut ter nicht immer gut auszukommen war. Anderseits wußte ich, daß Muttchen niemals in mir eine erwachsene Frau sehen würde. Ich suchte nach einem Weg, mein Leben in meine eige nen Hände zu nehmen, und dabei fiel mir nichts Besseres ein. Nach langem zähen Tauziehen gab Muttchen nach. Sie be stand lediglich darauf, daß Manfred noch in Köthen getauft werde. So geschah es dann auch. Am Heiligen Abend wollten wir noch einmal als Familie vollzählig zusammen sein. Wir packten die beiden Kinder in ihre Wagen und zogen los, Elly zu besuchen. Das war ein Fußmarsch von zwei Stunden. Des besonderen Anlasses wegen wurde meiner Schwester sogar erlaubt, am Gottesdienst in der Dorfkirche teilzunehmen, trotz der Ansteckungsgefahr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag brach ich mit Manfred nach Dresden auf. Muttchen begleitete mich mit Helmut. Wir benutzten die Eisenbahn. Damals fuhren nur Personenzüge, und aus Sparsamkeit gab es kein Licht. Mit Einbruch der Dunkelheit saßen wir also in einem völlig finsteren Abteil. Plötzlich riß jemand die Tür auf. Männer, die wir nur schemenhaft wahrnahmen, drangen ein, griffen nach unseren 187 Taschen und verschwanden wieder. Dabei gingen auch alle Wertsachen und Papiere verloren. In Leipzig meldeten wir den Vorfall der Bahnhofspolizei. Die Beamten jedoch zuckten nur mit den Schultern. Die Räuber waren von Trittbrett zu Trittbrett gesprungen und hatten den ganzen Zug heimgesucht. Sie zu verfolgen, erwies sich als unmöglich. Die Bande besaß Schußwaffen, die Ordnungshüter besaßen keine. Letztlich beschränkte man sich darauf, den Menschen, die zu Dutzenden das Dienstzimmer umlagerten, ihre Verluste auf Zuruf und Gutglauben zu bescheinigen. Für Werner hatte sich die Lage tatsächlich wie gehofft zum Besseren gewendet. Zwar mußte er sich einmal im Monat bei der Kommandantur melden, doch besaß er endlich ordnungsgemäße Papiere und brauchte nicht mehr zu befürchten, in Kriegsgefangenschaft geführt zu werden. Da das Vermessungsamt wieder zu arbeiten begann und im Zuge der Bodenreform sogar zu großer politischer Bedeutung gelangte, bekam er als Vermesser eine Anstellung. Bei mir lief nicht alles so glatt. Ich mußte ziemlich bald feststellen, daß ich von einer Abhängigkeit in eine andere geraten war. Daß ich meine Interessen gegen die Schwiegermutter entschlossener durchsetzte als zuvor gegen Muttchen, brachte mir vor allem ein, daß ich immer mehr in Ungnade fiel. Da nutzte es am Ende auch nicht mehr viel, daß Werners Mutter ihr Enkelchen Manfred von ganzem Herzen liebte und mir viel bei der Betreuung half. Wieder brauchte ich eine gute Idee. Die beste Lösung war zweifellos eine eigene Wohnung. Woher aber sollte ich die nehmen im völlig zerstörten Dresden? Werner glaubte, daß ich das nie und nimmer schaffen würde. Ich versuchte es trotzdem. Auf dem Wohnungsamt bettelte ich so lange, bis die Beamten meinen Antrag annahmen. Nach erstaunlich kurzer Zeit erhielten wir ein Angebot: zwei Zimmer zur Untermiete mit Küchenbenutzung. Das reichte uns erst einmal. Meine 188 Schwiegermutter war darüber zunächst sehr böse. Sie fühlte sich regelrecht verraten. Später aber verbesserte sich mein Verhältnis zu ihr. Seit wir einander nicht mehr jeden Tag sahen, gab es nicht mehr so viele Gelegenheiten zum Streit. Eine große Überraschung erlebte ich, als es eines Tages klingelte, und ich mich Muttchen und Elly gegenübersah. Beide waren ohne Gepäck, hatten also offenbar keine lange Reise hinter sich. "Wo kommt ihr denn her?" wollte ich wissen. "Na, aus Pirna, wir wohnen doch jetzt dort", bekam ich zur Antwort. Mir verschlug es die Sprache. Muttchen war tatsächlich wieder einmal umgezogen. Sie hatte mit einem Fuhrunternehmer getauscht. Der Beruf des Tauschpartners war praktisch. Die gesamte Wohnungseinrichtung konnte mit seinen Wagen bequem und preisgünstig von Köthen nach Pirna transportiert werden. Es gab aber trotzdem einen Pferdefuß. Der Keller war noch nicht geräumt worden. Vereinbart hatte Muttchen Folgendes. Der Fuhrunternehmer schafft alles dort unten Gelagerte - mehr als dreißig Zentner Kohlen, regelrechte Berge von Holz, eine Zinkbadewanne, Kartoffeln, Eingekochtes, vieles mehr - nach Roßlau zum Elbhafen. Dort wird es auf ein Frachtschiff geladen. In Pirna holen wir es selbst ab. So weit, so gut. In der Realität war das Ganze ein gewaltiges Unternehmen. Das begann schon in Köthen, wo bis auf die Kohlen jedes Stück in Säcken verstaut werden mußte. In Roßlau halfen uns ein paar kräftige Männer beim Verladen. Ganz dick kam es für uns aber dann in Pirna. Dort stand uns niemand zur Seite. Dort mußten wir drei Frauen - Muttchen, Elly und ich - jeden Sack und jeden Zentner Kohlen mühsam mit einfachen Handwagen von der Elbe hinauf in die Stadt bringen. Als wir endlich damit fertig waren, hatte ich wahrhaftig kein Verlangen, dergleichen so bald noch einmal zu erleben. 189 Elly fand Arbeit im Pirnaer Zellstoffwerk. Ihrem Köthener Arbeitgeber, dem russischen Offizier, war sie bei Nacht und Nebel entflohen. Freiwillig hätte er sie nicht gehen lassen. Für Tante Hethe war der Umzug fast so etwas wie ein neuer Schicksalsschlag. Die Schulzes hatten Köthen den Rücken gekehrt. Nur sie war noch dort, weil sie auf ihren Mann wartete, und sie kam sich ziemlich verloren vor. Während sie uns beim Füllen der Säcke half, weinte sie viel. Die Teilung Deutschlands, die schon unmittelbar nach Kriegsende mit der Bildung der Besatzungszonen begann, und die sich in den folgenden Jahren immer mehr festigte, trennte auch die Schulze-Familien. Solange Tante Hethe und Tante Emma noch lebten, sorgten sie gemeinsam mit Muttchen dafür, daß die Verbindungen nicht abrissen. In der nächsten und übernächsten Generation aber versandeten die Wege zueinander allmählich. Das war kein böser Wille. Es ergab sich so. Die Politik tat ein Übriges. Somit wäre ich, wollte ich die Chronik bis in die Zeit der unabhängigen deutschen Staaten hinein fortführen, auf vage Vermutungen und Spekulationen angewiesen. Vieles weiß ich überhaupt nicht. Deshalb werde ich meinen Bericht mit dem Jahr 1948 beenden. Zu dieser Zeit bekamen wir Post aus Bremen. Tante Hethe war schließlich doch in den Westen übergesiedelt. Werner Bartlitz hatte inzwischen ein Haus gekauft und geheiratet. Das Haus finanzierte er über einen großzügig verzinsten Kredit, den ihm sein Vertriebenenstatus einbrachte. Seine Frau hieß Margot Büntemeyer und stammte aus Bremen. Da im Obergeschoß des Hauses eine abgeschlossene Wohnung lag, die das junge Paar nicht brauchte, konnte Tante Hethe dort mit dem mittlerweile zwölfjährigen Heinz gut leben. 190 In Köthen hatte Hethe eine Nachricht für ihren Mann hinterlassen. Noch immer glaubte sie daran, daß er zurückkehrte. Genau aufgeklärt ist Ottos Schicksal übrigens bis heute nicht. Tante Emma erkundigte sich beim Roten Kreuz und anderen Organisationen. Nach vielen vergeblichen Versuchen erhielt sie die Adresse eines Mitgefangenen. Der war aber wenig auskunftsbereit. Offensichtlich hatte er Angst. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann man jedoch davon ausgehen, daß mein Onkel in einem russischen Lager an einer Krankheit zu Grunde ging. Interessant ist, daß sich auch nach Ottos Tod noch ein guter Teil schulzeschen Gemeinsinns auf die Bartlitzens konzentrierte. Jetzt stellte sich heraus, daß keineswegs in erster Linie der Mann, der das große Wort geführt hatte, der ruhende, den Zusammenhalt herstellende Pol gewesen war, sondern vielmehr die zierliche, unscheinbare Hedwig. Es gibt Ursachen, die sich nicht mit den gewohnten formal logischen Begriffen erklären lassen. Man erkennt ihr Vorhandensein an den Wirkungen. Vielleicht war der Samen für Tante Hethes magische Anziehungskraft auf die Geschwister schon vor dem ersten großen Krieg in Geuz gelegt worden, damals als alle sie als das Nesthäkchen geliebt und verwöhnt hatten. Zum Beispiel fuhr Onkel Franz aus Hannover öfter nach Bremen. Seine Familie hatte sich um mehrere Enkelkinder vergrößert. Von seinen Söhnen war nur Kurt aus dem Krieg nicht zurückgekehrt. Eine enge Verbindung gab es auch zwischen den Wernercousins. Tante Emma und Onkel Gustav mußten für eine Reise an die Nordsee viele bürokratische Hindernisse überwinden. Aber selbst das konnte sie nicht an einer Reihe von Besuchen hindern. Und Muttchen stand den beiden nicht nach. Ihr Haus in Falkensee hatten sich Emma und Gustav im Laufe der Jahre immer mehr ausgebaut. Man mochte kaum noch glauben, daß es einmal eine kaum winterfeste Laube gewesen war. Gustav bewies dabei erstaunlich viel 191 handwerkliches Geschick. Auch die Nachbarn, die an rechtschaffenen Dauerbewohnern großes Interesse hatten, halfen gern. Es gab in der Siedlung zahlreiche Grundstücke, um die sich niemand kümmerte und die allmählich verkamen. Sie waren dadurch ideale Verstecke für Kriminelle, nach denen die Polizei suchte. Entsprechend häuften sich die Einbrüche in unerträglichem Maße. Dagegen half nur ständige Anwesenheit möglichst vieler Siedler. Irmgard war mit Helga nach Berlin zurückgekehrt. Hier lernte sie einen elternlosen jungen Mann kennen, der seit seiner Vertreibung aus Schlesien in einem Flüchtlingslager lebte. Als Tante Emma davon erfuhr, erfaßte sie Mitleid mit ihm, und sie bot ihm an, der fünfte Hausbewohner zu werden. Die Zeit unter einem Dach brachte ihn und Irmgard immer näher. Sie verliebten sich schließlich so sehr ineinander, daß sie heirateten. Kurz darauf begünstigte das Schicksal sie noch einmal. Ein reicher Unternehmer aus Westberlin suchte für seine Villa in Falkensee ein Hausmeisterehepaar. Außer einer mietfreien Wohnung bot er eine gute Bezahlung an. Dafür mußten das Haus und der Garten in Ordnung gehalten werden. Wer wäre da abgeneigt gewesen? Als ich die beiden einmal besuchte, hatte ich den Eindruck, daß sie sehr glücklich waren. Werner Schatz wohnte noch in Hamm. Er war Vater von Zwillingen geworden. Eines der Kinder aber hatte nicht überlebt. So blieb den Eltern - neben Sohn Claus - nur die kleine Heidi erhalten, die sich allerdings gut entwickelte. Auch Werner war wohl recht zufrieden mit seinem Leben, so wie er es sich nach dem Krieg eingerichtet hatte. Wenigstens einmal im Jahr kam er mit seiner Frau und den Kindern nach Falkensee zu Besuch. Als wir in Köthen gewesen waren, um Muttchens Umzug nach Pirna zu bewerkstelligen, hatten wir dort einen Brief von unserem Vater vorgefunden, demzufolge es ihm verhältnismäßig gut ging. Als Kriegsgefangener der Engländer 192 arbeitete er auf einem Flugplatz. Dort wurden Frachtflugzeuge für die Versorgung Westberlins beladen. Wie wir aus seiner kurzen Mitteilung entnahmen, wollte er möglichst nicht in die sowjetische Besatzungszone kommen. Vielmehr sollten wir zu ihm übersiedeln. Muttchen war von dem Plan nicht sonderlich begeistert. Dennoch riskierten wir ein paar Monate später einen illegalen Grenzübergang. Diesem ersten "langen Marsch" folgten noch eine Reihe anderer. Teilweise ging es darum, bezüglich unseres künftigen Wohnortes endlich zu einer Einigung zu gelangen, häufiger freilich um ganz profane Dinge, mit denen wir unseren Nachkriegsalltag ein wenig angenehmer zu gestalten versuchten. Die Abenteuer, die wir dabei erlebten, wären es eigentlich wert, ebenfalls aufgeschrieben zu werden. Vielleicht widme ich ihnen einmal eine eigene Erzählung. Hier sei nur gesagte, daß wir Vater schließlich doch dazu überreden konnten, uns in den Osten zu folgen. Meine Schwester Elly hatte dagegen noch kein Lebenszeichen von ihrem Mann Richard erhalten. Nach der Verkündung des "totalen Krieges" war er doch noch eingezogen worden. Das Chaos der letzten Kriegsmonate hatte die Verbindung zu ihm abreißen lassen. Dadurch wußten wir nicht einmal so genau, an welchem Frontabschnitt er am Ende eingesetzt worden war. Freilich existierte auch keine Anzeichen dafür, daß er gefallen wäre. Das gab uns Hoffnung. Mein Bruder Rudolf hatte gleich nach Kriegsende die Gelegenheit erhalten, an einem Lehrgang teilzunehmen und den Meisterbrief zu erwerben. Aus seinem Durchgang erreichten (aus unterschiedlichen Gründen) nur wenige das Ziel. Rudolf gehörte zu denen, welche die Prüfung bestanden. Eine Anstellung fand er über eine Zeitungsanzeige bei einer Frau aus Seußlitz, einem kleinen Ort an der Elbe auf halber Strecke zwischen Meißen und Riesa, deren Mann aus dem Krieg noch nicht zurückgekommen war. Die Behörden 193 drohten, ihrer Schneiderei die Konzession zu entziehen, weil sie selbst keinen Meisterabschluß hatte. Das Arbeitsverhältnis dort stand jedoch unter keinem guten Stern. Nach ein paar Monaten wurde die Frau von der russischen Militärpolizei verhaftet. Sie hatte einem russischen Offizier einen Zivilanzug genäht und sich dadurch der Beihilfe zur Fahnenflucht schuldig gemacht. Die Schneiderei schloß man sofort. Mein Bruder mußte froh sein, nicht mit angeklagt zu werden. Erneut stand ihm aber das Glück zur Seite, so daß er ziemlich schnell einen Ausweg fand. Er hatte inzwischen eine junge Frau aus dem Ort kennengelernt. Sie hieß Marga Heinrich. Ihre Vater war - vermutlich auf Grund einer Denunziation - von der Straße weg verhaftet worden und aus einem russischen Lager nicht zurückgekehrt. Die Familie besaß ein verhältnismäßig geräumiges Haus. Die Mutter bot deshalb dem Schneidermeister an, sich darin einen eigenen Betrieb einzurichten. Die Einladung zur Hochzeit kam für uns alle ziemlich überraschend. Rudolf hatte zwar öfter einmal ein Mädchen mitgebracht, sich aber nie fest binden gewollt. Inzwischen war er schon über dreißig. Vielleicht hatte das ihm den Sinn geändert. Bald kam ein Kind zur Welt - Barbara. Mit ihr hatten meine Eltern nun also nach den beiden Enkelsöhnen Helmut und Manfred auch eine Enkeltochter. Auch für mich war der Neubeginn nach dem Krieg eine Zeit voller Höhen und Tiefen. Vieles mußte ich allein bewältigen, denn Werner, mein Mann, wurde schon bald versetzt, erst nach Weißwasser und dann nach Großenhain. Man brauchte im Rahmen der Bodenreform Leute als Leiter für die neugegründeten Vermessungsämter. Abends wurde der Strom abgeschaltet. Der Ofen spendete nur spärlich Wärme, denn es fehlte an Brennmaterial. An kalten Winterabenden ging ich mit dem kleinen Manfred schon bei Anbruch der Dunkelheit ins Bett und erzählte ihm Geschichten. Erst im Jahre 1948 ergab 194 sich für uns über einen ziemlich komplizierten Ringtausch die Möglichkeit, mit Werner in Großenhain wieder zusammenzuziehen. 195