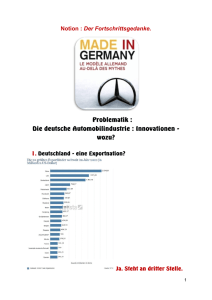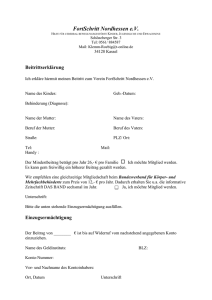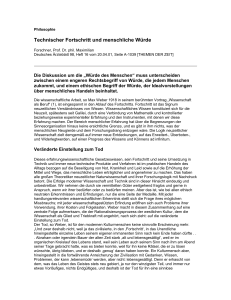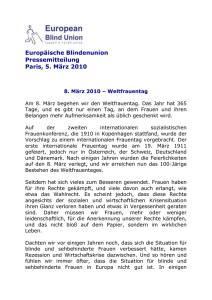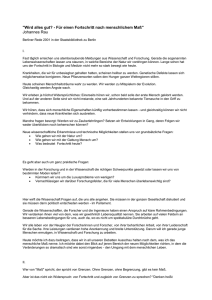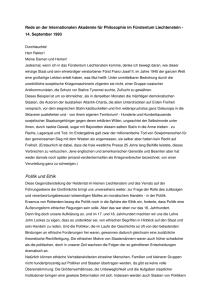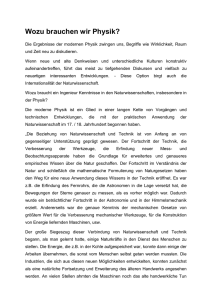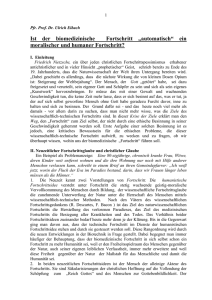Vom Fortschritt in der Geschichtswissenschaft
Werbung

Vortragsfassung Sehr geehrter Herr Dekan, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, meine Damen und Herren, Üblicherweise kommt der Dank zum Schluß, aber gestatten Sie, daß ich ihn heute an den Anfang setze. Danken möchte ich Ihnen, Herr Dekan, für die freundlichen Worte der Einleitung, Ihnen allen möchte ich danken, daß Sie sich an diesen stress-reichen Tagen knapp vor dem Semesterabschluß die Zeit genommen haben, mir zuzuhören – wobei ich meine Freude nicht unterdrücken will, daß Sie so zahlreich und zum Teil aus größerer Ferne gekommen sind - , danken möchte ich auch den beiden Instituten für Geschichte und für österreichische Geschichtsforschung, daß sie für nachher zu einem Empfang eingeladen haben, und last but not least möchte ich herzlich den Musikern unter der Leitung von Anna Obermayer, einer früheren Wohnungsnachbarin, danken, daß sie die Feierlichkeit dieser Abschiedsvorlesung mit ihrem Können verschönen. Vom Fortschritt in der Geschichtswissenschaft Abschiedsvorlesung - Mittwoch, 27. Juni 2012, Kleiner Festsaal Ludwig Wittgenstein setzte als Motto vor sein zweites, zu seinen Lebzeiten freilich nicht mehr veröffentlichtes Buch „Philosophische Untersuchungen“ein Zitat aus Nestroys Posse „Der Schützling“: Überhaupt hat derFortschritt das an sich, daß er viel größer ausschaut, als er wirklich ist. Diese beiden Bezüge zu prominenten Österreichern eignen sich vorzüglich zu einer Captatio benevolentiae, die ein Mediävist, dessen Quellen von Rhetorik durchsetzt sind, sinnvoller Weise an den Beginn seiner Rede stellt. Erwarten Sie sich bitte nicht, meine Damen und Herren,eine unwiderlegbare und unwiderstehliche Summe der Erkenntis am Ende einer mehr als vierzigjährigen akademischen Karriere. Stellen Sie sich nicht auf grundlegende Entschlüsselungen des Wesens der Geschichtswissenschaft ein, wie sie etwa Wilhelm Windelband in seiner berühmten Straßburger Rektoratsrede von 1894 über „Geschichte und Naturwissenschaft“ lieferte und eine nach wie vor haltbare Unterscheidung in nomothetische und ideographische Wissenschaften vorschlug. Ein Wittgenstein-Zitat aus den schon genannten „PhilosophischenUntersuchungen“ kommt mir wieder zu Hilfe: „Nach manchen mißglücktenVersuchen, meine Ergebnisse zu einem solchen Ganzen zusammenzuschweißen, sah ich ein, daß mir dies nie gelingen würde“. Lassen Sie mich vielmehr einige Beobachtungen über die Geschichtswissenschaft, wie ich sie als zukunftsträchtig oder als ab- oder umwegig, eben als Fortschritt, einzuschätzen lernte, vor Ihnen ausbreiten. Dabei soll ein erster, ein mehr theoretischer Teil verdeutlichen, was ich unter den Begriffen des Titels meines Vortrages meine, und in einem zweiten, einem exemplarischen Teil, hoffe ich meine Position zu verdeutlichen. Daß die Mediävistik dabei im Vordergrund steht, schulde ich der Spezialisierung unseres Faches „Geschichte“, aber der ferne Spiegel des Mittelalters, wie Barbara Tuchmann ihren Bestseller überdas 14. Jahrhundert nannte, ist kein Zerrspiegel. Ich hoffe, daß dies nicht den Eindruck hervorruft, den man mit einer etwas anderen Übersetzung des lateinischen Begriffes progressio, progressus erreichen könnte. Statt Fortschritt könnte man auch Fortgang, Fortgehen sagen und meine Abschiedsvorlesung wäre tatsächlich nicht in meinem Sinn, wenn Sie über den progressus, das Fortgehen des Redners, zufrieden wären. „Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, daß er viel größer ausschaut, als er wirklich ist“. Diese ironische Bemerkung über Anspruch und Realität des Zuwachses an wissenschaftlicher Erkenntnis trifft in einem gewissen Sinn die eigene Befindlichkeit gegenüber dem wissenschaftlichen Fach, der ich einen Großteil meines Lebens gewidmet habe. Ist das sichere Wissen um das Mittelalter und die Methode zu seiner Erforschung wirklich mit den Jahren kontinuierlich gewachsen, seitdem ich vor fünfzig Jahren mit klopfendem, ängstlichem Herzen erstmalig die Innsbrucker Universität betrat ? Es wäre töricht, die von Nestroy verspottete Distanz zwischen Anspruch und Realität anzuzweifeln, aber wenn die vielen Seiten zur mittelalterlichen Geschichte, die ich im Laufe der Jahre vollgeschrieben habe, mehr als nur Windhauch im Sinn des alttestamentarischen Predigers Kohelet sind, dann komme ich zu einem weiteren Bild, das mein Tun hier nach wie vor kennzeichnet: Johannes von Salisbury zitierte in dem 1159 fertiggestellten „Metalogicon“ seinen Lehrer Bernhard an der Domschule von Chartres: „Wir sind wie Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen, um mehr und Entfernteres als diese sehen zu können, nicht dank eigener scharfer Sehkraft oder Körpergröße, sondern weil die Größe der Riesen uns emporhebt“. Dieses Dictum, das freilich nicht genuin mittelalterlich ist, sondernseine antiken Wurzeln hat, trifft zu und es ist jetzt also der Platz, an dem ich meinen Lehrern und den anderen Forschern meinen Dank abstatten möchte, einigen davon, daß sie, um im Bild zu bleiben, mich auf ihren Schultern Platz nehmen ließen. Namentlich unter den vielen, denen ich Dank schulde, möchte ich nur einen nennen, der mir auch die Ehre seiner persönlichen Anwesenheit gewährt hat, mein Vorgänger auf der Wiener Professur, Othmar Hageneder. Seine Innsbrucker Jahre zwischen 1976 und 1980 waren die für mich als seinen damaligen Assistenten die prägendsten in wissenschaftlicher Sicht und mein hier öffentlich und ausdrücklich bekundeter Dank erstreckt sich auch auf Führung und liebevolle Hilfe in persönlichem, ganz persönlichem Bereich. Alle hier im Saal, die sich in den vergangenen drei Jahrzehnten mit Geschichtswissenschaft beschäftigt haben, pflichten mir sicher bei, wenn ich zunächst von einem praktischen und einem quantitativem Fortschritt in unserer Disziplin spreche. Beim praktischen Fortschritt habe ich die radikal geänderte Arbeitstechnik im Visier, die uns bisweilen wie ein Quantensprung vorkommt, der auch inhaltlich neue Welten historischer Erkenntnis erschließen kann. Der Zettelkasten meiner Dissertation ist ferne Erinnerung, der zeitraubende Tippfehler der Schreibmaschine hat seinen Schrecken verloren, die seinerzeit fast unmöglichen Nachträge oder Veränderungen in einem Aufsatz- oder Buchmanuskript sind kein Problem mehr, seitdem wir alle ganz selbstverständlich mit Computern hantieren. Das „Abstürzen“ ist zwar nicht mehr so lebensgefährlich wie in der Welt des Kletterns meiner Tiroler Jugendzeit, aber alle, auch die Flachlandbewohner, hatten mit diesem Unfall in der Computerwelt zu tun und können von einer Art Bergrettung berichten, die in Form von unseren Computerbeauftragten zu Hilfe eilten. Aber der radikalste praktische Fortschritt der Geschichtswissenschaft erwuchs zweifellos aus der Digitalisierung von Bibliothekskatalogen, von Bibliographien, von umfangreichen Quellencorpora, von älteren Standardwerken und ihrer jederzeitigen Verfügbarkeit im Internet. Was für ein unvergeßlicher Eindruck, als ich in der Mitte der Sechzigerjahre zur Arbeit an meiner Dissertation zum ersten Mal in der Pariser Bibliothèque Nationale in den Katalograum unter dem großen Lesesaal kam und die Abertausende von Schubern des Nominal- und des Schlagwortkatalogs vor mir sah. Heute ist dies alles verschwunden und hat einer aufgefädelten Reihe von Bildschirmen Platz gemacht. Als ich 1989 nach Graz kam, konnte man schon das seit einigen Jahren eingerichtete elektronische Katalogisierungssystem GRIBS vom eigenen Schreibtisch ausbenützen, da die Universität weitläufig verkabelt war, aber der Altbestand mußte noch immer über die Zettelkästen konsultiert werden. Und wie oft bin ich die zwei Stockwerke hinunter, quer über den Vorplatz der Universität und die zwei Stockwerke zum Katalograum der Grazer UB wieder hinauf, um einen schlampig aufgenommenen Titel zu vervollständigen ! Es trug zur Fitness bei. In den frühen Neunzigerjahren machte mich ein Grazer Kollege darauf aufmerksam, daß es nun ein neues geheimnisvolles Medium namens Internet und ein anderes namens World Wide Web gebe, mit deren Hilfe man den gesamten digitalisierten Katalog der Congress Library in Washington auf den eigenen PC übertragen könne. Schlagartig hörten die Spaziergänge zur UB auf und die revolutionäre Weiterentwicklung nützen wir täglich alle. Analoges gibt es aus dem Bereich der Bibliographien zu berichten. Waren früher jene Historiker und natürlich Historikerinnen uneinholbar voraus, die zu einem bestimmten Thema die passenden Bücher oder Aufsätze aus dem Gedächtnis zu nennen wußten oder zumindest die betreffenden Bibliographien kannten und ihren Standort im Kopf hatten, so ist dieses Wissen auf die Verfügbarkeit von elektronischen Bibliographien geschrumpft. Heute ist der zwölfbändige gedruckte Dahlmann-Waitz, dessen letzter Band 1999 erschien, eigentlich nur mehr eine Reminiszenz an vor-digitale Zeiten, und mit einer gewissen Entrüstung konstatieren wir, daß es noch immer so etwas wie traditionelle Bibliographien gibt, die nicht digital abrufbar sind, wie etwa die Bibliographie annuelle de l’histoire de France. Daß die Mediävisten mit den digitalen Bibliographien besonders verwöhnt sind, sei nur en passant erwähnt und möge als Beleg dafür dienen, daß auch ein Neo-Emeritus des Jahres 2012 schon seit langem auf dem digitalen Highway mitfährt. Als dritten und letzten Ort des praktischen Fortschritts möchte ich die umfangreichen Quellencorpora nennen, die uns elektronisch aufbereitet wurden. In vergangenen Zeiten erregte die Fähigkeit eines Editors, klassische oder nachklassische Zitate, Bezüge zum römischen oder kanonischen Recht, Vorurkunden oder Diktateigenheiten eines Kanzleinotars in einem Text aufzuspüren, die Bewunderung des Benützers. Heute ist’s auch mit diesem Beweis der Belesenheit und Gelehrsamkeit vorbei, seitdem wir beispielsweise alle 221 Bände von Migne’s Patrologia Latina und die etwa 450 Bände der Monumenta Germaniae Historica vom Computer am Schreibtisch aus nach allen denkbaren Richtungen hin durchsuchen können. Für meine eigene Habilitationsschrift musterte ich eine größere Zahl der genannten Migne-Bände durch und benötigte dafür Monate. Heute wär’s an einem Nachmittag erledigt. In den geschilderten Bereichen ist der Fortschritt mit Händen greifbar. Der quantitative Fortschritt der Geschichtswissenschaft ist evident und, wie alle menschliche Errungenschaft, Segen und Fluch zugleich. Allen Klagen über den „Verlust der Geschichte“ zum Trotz erschienen noch nie so viele geschichtswisenschaftliche Werke jedweden Umfanges wie heute. Verzeichnete der letzte gedruckte Band der „Jahresberichte für deutsche Geschichte“, der laufenden Bibliographie zur deutschen Geschichte, der Band von 2008, 25953 Nummern, so waren es zehn Jahre zuvor „nur“ 17904 Nummern. Der Rezensionsteil des „Deutschen Archivs“, der wichtigsten deutschsprachigen Zeitschrift für die mittelalterliche Geschichte, umfaßt beim letzterschienenen Band 646 Seiten, vor zehn Jahren hingegen 488 Seiten, und im fernen 1962, als ich mein Studium begann, kam man dort mit 246 Seiten aus. Bei jeder der 14-tägigen Ausstellungen der Neuerscheinungen im Institut für österreichische Geschichtsforschung frage ich den Bibliothekar, wann er endlich Bücher kaufe, bei denen die Zeit zur Lektüre mitgeliefert würde. Jetzt komme ich zur Frage des qualitativen Fortschrittes in der Geschichtswissenschaft, die vordergründig eine einfache Antwort bereithält, aber etwas tiefer überlegend in die Fragen um zentrale Begriffe der Geschichtswissenschaft, um das Wesen der Geschichte, um die Bedingungen ihrer Erkennbarkeit, um die historische Methode, um Ziel und Zweck der Erkenntnis führt. Vorweg sei gleich gesagt, daß hier nicht vom Fortschritt in der Geschichte gesprochen werden soll, daß also die aus der Aufklärung stammende Überzeugung, die Geschichte der Menschheit sei ein zielgerichteter, in bessere Verhältnisse führender Prozeß, hier nicht erörtert werden wird. Diese optimistische Geschichtsauffassung, beruhend auf einer Fortschrittserfahrung auf politischem, sozialen und naturwissenschaftlichen Gebiet, sah die Menschheit auf einem Weg, der letztlich zu größerer Vollkommenheit führe. Hegels Dictum, daß die Weltgeschichte „Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit“ sei, war im frühen 19. Jahrhundert trotz des Erlebnisses der napoleonischen Verwüstungen ein Mut machender Gedanke, aber die Erfahrungen, die die Menschheit im 20. Jahrhundert mit den staatlich garantierten marxistischen Geschichtsauffassungen vom historischen Materialismus mit seinen Gesetzmäßigkeiten des Klassenkampfes und den dialektischen Sprüngen von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen machen mußte, hat dieser Art von Fortschrittsidee viel von ihrer Attraktivität genommen. Heute dominiert Skepsis gegenüber einem emphatischen Fortschrittsbegriff, der sich am ehesten noch im Hinblick auf zivilisatorische Gegebenheiten – Rechtssicherheit, materieller Wohlstand, sozialer Ausgleich, politische Gewaltenteilung – plausibel machen läßt und die Lebenssituation der Individuen verbessert. Die vordergründigen einfachen Antworten auf die Frage nach dem qualitativen Fortschritt in der Geschichtswissenschaft lauten: Neue Quellen, besseres Verständnis der Quellen, überzeugendere Auswahl der Quellen, attraktivere Sichtweisen, klarer begründete theoretische Ansätze, plausiblere Argumente bei der Rekonstruktion bzw. Konstruktion der historischen Abläufe, versiertere Beherrschung der Forschungsdiskussion, vollkommeneres Handwerk, größere Eleganz bei der Darstellung, klarerer Aufbau der Gedankenführung, kurz: größeres Wissen und breitere und tiefere Erkenntnis. Es ist natürlich kein Zufall, daß der Komparativ das logische Bindeglied dieser Aussagen ist, es also um eine qualitative Steigerung gegenüber früheren Zuständen geht. Der durchaus banale Kern heißt also „besser“. Um diese Aussage nicht völlig zur Leerformel verkommen zu lassen, wird es sich empfehlen, auf die Kriterien zur Beurteilung dieses „besser“ zurückzukommen. Die in größere Tiefen führenden Antworten will ich im Folgenden nicht in geschichtstheoretischen Erörterungen versuchen, und dies auch deshalb, weil ich nicht in Konkurrenz zu Pflichtmodulgruppe 5 des Bachelor-Studiums „Geschichte“ an der Universität Wien namens „Geschichtswissenschaftliches Arbeiten“, Modul 1 „Wissenschaftliches Denken und Arbeiten“, Lehrveranstaltung „Theorien in der Geschichtswissenschaft und Wissenschaftstheorie“ bzw. das Pflichtmodul „Eingangsphase“ des Masterstudiums „Geschichte“ an der Universität Wien, Aufbaumodul „Geschichtswissenschaftliches Denken und Arbeiten“, Lehrveranstaltung „Wissenschaftstheorie, Theorien in der Geschichtswissenschaft“ treten möchte. Vielmehr möchte ich einige Sätze meines wissenschaftlichen Credos kundtun, sie etwas kommentieren und mit persönlichen Erfahrungen versehen. 1. Ich halte an der Erkennbarkeit der Geschichte fest, postuliere gar die Möglichkeit der Erkennbarkeit von historischer Wahrheit. Selbstverständlich setze ich mich dabei von Wahrheit im metaphysischen Sinn ab, die sich, wie in den Abschiedsreden Jesu im JohannesEvangelium nachzulesen, nur dem Glaubenden erschließt und auch nicht auf ein System von Aussagen, sondern auf eine Person bezieht. Wahrheit meine ich eher in der Nähe von und basierend auf Richtigkeit und als ein Bündel von Teilwahrheiten mit einem festen, gesicherten Kern und weicheren, nach Plausibilität abgestuften Aussagen am Rande. Die Definition des Thomas von Aquin Veritas est adaequatio rei et intellectus – Die Wahrheit ist eine Angleichung von Sache und erkennendem Geist scheint mir auch auf die Historie anwendbar. Der Wahrheit der Historiker möchte ich mich mit einem Bild nähern: die Vergangenheit als unser Erkenntnisgegenstand als eine silva inextricabilis, deren Pflanzen, Tiere und Bodenbeschaffenheit die historischen Fakten sind. Der Historiker gliedert, ordnet, schreitet ab, bewertet nach Wichtigem und Unwichtigem, setzt sein ganzes Wissen über Werden und Vergehen, über Ursache und Wirkung, ein. Der eine Historiker wird seine Kriterien so, der andere anders wählen, der dritte wird bisher unentdeckte Blumen hervorheben, der vierte als das Wichtigste irgendwelche unbeachtete Tiere betonen, aber es bleibt immer eine Teilwahrheit, die nicht das Ganze erfaßt, aber nicht unwahr ist. Anders gesagt: die Wahrheit des Historikers ist die Summe der Teilwahrheiten. Absetzen möchte ich mich damit von der tiefen, wohl aus der analytischen Sprachphilosophie kommenden Skepsis, die zwischen sprachlichen Aussagen und der Realität keine feste Verbindung erkennen möchte. Sie ist die Ursache von einer letztlich in Beliebigkeit führenden Auflösung von Aussagen über die Vergangenheit, deren sprachliche Gestalt keine Verbindlichkeit beanspruchen kann. Alles wird zum Text, der wohl verstanden wird, der aber keine Gültigkeit fordern darf, oder, wie Wolfgang Reinhard, Emeritus der Neueren Geschichte in Freiburg und einer der klügsten und produktivsten Historiker meiner Generation, kritisierend formuliert hat: „Danach wissen wir nichts über Geschichte, sondern nur etwas über Texte, die von Geschichte handeln, und produzieren keine Untersuchungen über historische Wahrheit, sondern nur neue Texte über andere Texte“. Zum Glück sind diese radikalen Vertreter der erkenntnistheoretischen Zweifler in der Geschichtswissenschaft selten und es gehört in die Kategorie der philosophisch motivierten Gedankenspielerei, beispielsweise bei der Geschichte der frühmittelalterlichen Burgunder eine Gleichwertigkeit zwischen den entsprechenden Passagen bei Gregor von Tours, im Nibelungenlied, in den Wagner-Opern, im Drehbuch von Fritz Langs Nibelungenfilm und dem diesbezüglichen Artikel im Reallexikon der germanischen Altertumskunde zu postulieren. Es ist mir nach wie vor wichtig, wissenschaftlich begründete Geschichte nicht als ein Glasperlenspiel mit gradueller Unverbindlichkeit zu begreifen. 2. Ich verweigere mich der Debatte um die Relevanz der Geschichtswissenschaft und der Geisteswissenschaft im allgemeinen. Es ist unbestreitbar, daß unsere moderne Gesellschaft einen nicht zu stillenden Hunger nach historischen Gegebenheiten und Tatsachen hat, gleichgültig, ob es sich um neue Erkenntnisse über den Nationalsozialismus, über die Genese und Geschichte des Islam oder über die Interpretation der neuen Ausgrabungen von Troja handelt. Vom Verantwortlichen der Ö 1 – Sendung „Betrifft Geschichte“ , jener täglichen Fünf-Minuten-Sendung um 17 h 55, die die unterschiedlichsten Themen in 5 – Tages- Folgen abhandelt, erfahre ich, daß sie nach den Nachrichtensendungen die am meisten gehörte ist und täglich etwa 80 bis 100.000 Menschen erreicht. Auch ohne diesen Nachweis eines Bedarfs an Historie halte ich es für ein Zeichen einer Gesellschaft mit Hochkultur, daß sie sich Wissenschaft auch ohne direkte oder indirekte kommerzielle Nutzung leistet, ganz im Sinne der Nikomachischen Ethik des Aristoteles, nach der die größte Glückseligkeit des Menschen in der Weisheit, in der Erkenntnis, im Gebrauch der Vernunft besteht. Dem Minderwertigkeitsgefühl der Geisteswissenschaftler will ich mit der Bemerkung abhelfen, daß auch die Naturwissenschaften oft im Rechtfertigungsnotstand sind. Es sollte einmal schlüssig nachgewiesen werden, daß „Funktionsanatomische Untersuchungen am Schädelskelett und der Kopfmuskulatur verschiedener Arten der Familie Gekkonidae“ – das ist das Dissertationsthema des Wiener Bürgermeisters Michael Häupl - gesellschaftlich relevanter ist als „Ciceros Staatsschrift im Unterricht“ – das ist das Dissertationsthema unseres Ministers Karlheinz Töchterle - , einmal abgesehen von der Sinnhaftigkeit des 27 km langen Ringtunnels in 50 bis 75 Metern Tiefe am CERN bei Genf, mit dem das berüchtigte HiggsTeilchen gefunden werden kann oder auch nicht gefunden werden kann, und der mindestens drei Milliarden Euro kostet. 3. Die vielen Perspektivenwechsel, die ich im Laufe meiner Karriere als Historiker erlebte, halte ich alle für gerechtfertigt und für ein Zeichen von Vitalität und Zukunftsträchtigkeit unseres Faches. Verschließen möchte ich mich jedoch einem Ranking dieser unterschiedlichen Zugriffe, dieser inkludierenden und exkludierenden Fragestellungen auf die eine Geschichte. Was für Ansätze waren in den letzten Jahrzehnten nicht zu erleben, einige von ihnen mit dem Epitheton „neu“: Alltagsgeschichte, Geschichte als historische Sozialwissenschaft, Psychohistorie, Mentalitätsgeschichte, Frauen- und Geschlechtergeschichte, Kriminalitätsgeschichte, Mediengeschichte, historische Anthropologie, neue Kriegsgeschichte, neue Diplomatiegeschichte, neue Politikgeschichte, neue Kulturgeschichte. Viele ihrer Vertreter traten und treten mit missionarischem Eifer auf, manche der Perspektiven haben es sogar zu Nominalfächern innerhalb der Institute für Geschichte gebracht. Skeptischer bin ich gegenüber all den turns, die zumeist aus der angloamerikanischen Geisteswissenschaft über den Atlantik schwappen und oft wie kurzatmige Versuche anmuten, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die linguistic, cultural, narrative, performative, iconic, pictural, sensitive, emotional, topographical usw. turns erweisen sich doch manchmal als vorübergehende Modeerscheinungen und als Bekanntes in neuen, schnittigen Kleidern. 4. Wenn man gewichtige Werke dieser neuen Richtungen analysiert, dann stellt man rasch fest, daß sie zumeist auf einer sehr traditionellen Quellenanalyse beruhen, oft auch auf die vielgeschmähte hermeneutische Methode zurückgreifend. Damit zeigt sich erneut, daß die Interpretation der Quellen unser eigentliches Kerngeschäft ist und daß die an die Quellen gestellten traditionellen W-Fragen – wer, wann, wo, warum, wie, wozu – nicht bohrend genug sein können. Jegliche Geschichtswissenschaft, die dies als antiquierte Detailklauberei denunziert, koppelt sich vom Fortschritt ab. Gerade aus der Mediävistik gibt es eine Reihe von Beispielen, die aus der stringenten Quellenanalyse und besonders der sich daraus ergebenden Gedächtniskritik neue, überraschende Einsichten verschafften: Johannes Fried, der frühere Frankfurter Mediävist, hat gleich mehrfach die Diskussion angestoßen, indem er durch einen intensiven Vergleich der im Namen Papst Gregors des Großen überlieferten Schriften die Existenz des Hl. Benedikt von Nursia in Zweifel zog, indem er durch Aufwertung einer bisher wenig beachteten Kölner Quelle das Kaisertum Karls des Großen als byzantinische Initiative hinstellte, und letzthin umfangreich das Ereignis von Canossa im Januar 1077 nicht als Unterwerfung des deutschen Königs unter Papst Gregor VII., sondern als Vertragsabschluß zwischen den beiden Kontrahenten interpretierte. Werner Hechberger verwies die Dauerfeindschaft zwischen Staufern und Welfen im 12. Jahrhundert ins Reich der Legende, Susan Reynolds krempelte unsere Vorstellungen von der geradlinigen Entwicklung des Lehnswesens seit dem Frühmittelalter um und strich die Bedeutung der Fachdiskussionen von Juristen des 12./13. Jahrhunderts aus der Lombardei und Bologna bei den Vorstellungen von Lehn und Vasallität heraus. Und ein Beispiel vom Beginn der Neuzeit: Erwin Iserloh machte vor genau 50 Jahren durch eine sorgfältige Auswertung aller Quellen deutlich, daß Martin Luther am 31. Oktober 1517 nicht seine berühmten 95 Thesen an der Türe der Schloßkirche zu Wittenberg angeschlagen hat, sondern an diesem Tag einen Bief an seine kirchlichen Vorgesetzten schrieb, denen er die 95 Thesen beilegte. Vielleicht hat er an der Kirchentüre auch eine Einladung zu einer Disputation befestigt. 5. Das von Erasmus von Rotterdam in seiner 1511 erschienen programmatischen Schrift De ratione studii ac legendi interpretandique auctores als zentrale Aussage gebrauchte Ad fontes hat für mich nichts von seinem Wert eingebüßt. Aber nicht allein Quellenbenützung, sondern Quellenerschließung durch kritische Edition und hilfswissenschaftliche Aufbereitung im Vorfeld sind für mich unabdingbare Aufgabe des Historikers. Ich will dabei nicht so weit gehen wie der berühmte Paul Fridolin Kehr, der die wissenschaftliche Forschung des Historikers fast exklusiv in der Quellensammlung und Quellenkritik sah, fast nur Urkunden als historische Quellen gelten lassen wollte, sich selbstironisch als einen „Regestenschuster“ bezeichnete und die historische Darstellung eigentlich den Lehrern an Mädchenlyzeen überlassen wollte. Der große Jakob Burckhardt nannte diese Spezies von Historikern ironisch und in Anlehnung an frühmittelalterliche Adelsgeschlechter die Urkundionen.Da ich mich in besonderer Weise dem Institut für österreichische Geschichtsforschung verbunden fühle, wird es wohl niemanden überraschen, daß ich eine Lanze für die Historischen Hilfswissenschaften breche und es als eine Chance der Wiener Universität ansehe, wenn dieser fundamentale Zweig der Historie hier besonders gepflegt und gehegt wird, zumal bei unserem bundesrepublikanischen Nachbarn ein hilfswissenschaftliches Universitätsinstitut nach dem anderen geschlossen wird, während unsere Nachbarn im Süden, Südosten und Norden nicht so kurzsichtig agieren. Daß es sich dabei nicht um eine Spielwiese der Mediävisten handelt und hilfswissenschaftliche Erkenntnisse auch und gerade in der Zeitgeschichte ihre Bedeutung haben, mögen zwei Beispiele erläutern: Ein hilfswissenschaftlich auch nur oberflächlich Angehauchter mußte die stümperhafte Fälschung der Hitler-Tagebücher durch Konrad Kujau, die dieser im Frühjahr 1983 um immerhin 9,3 Mill. DM der Illustrierten „Der Stern“ verkauft hatte, nach wenigen Minuten der Untersuchung der sogenannten äußeren Merkmale erkennen und nicht, wie der berühmte englische Hitler-Forscher und Professor in Oxford, Hugh Trevor-Roper, sie zu 99,5 % für echt erklären. Das berüchtigte Protokoll der Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942, bei der die schon beschlossene Ermordung der europäischen Juden koordiniert und bürokratisch durchgeplant wurde, wurde wohl in 30 Exemplaren ausgefertigt und verteilt, aber nur eines, jenes des Unterstaatssekretärs im Auswärtigen Amt, Martin Luther, blieb mehr zufällig erhalten und wurde bei der Vorbereitung des „Wilhelmstraßen-Prozesses“ in Nürnberg 1947/49 vom amerikanischen Ankläger Robert Kempner aufgefunden. Von Holocaust-Leugnern wurde es als Fälschung angeprangert, aber dann in einer erst vor wenigen Jahren erschienenen ausgefeilten hilfswissenschaftlichen Untersuchung als echt erwiesen. 6. Selbst auf die Gefahr hin, daß ich offene Türen einrenne, möchte ich diese Sätze meines Credos als Historiker mit dem Hinweis auf die fundamentale Verbindung von Forschung und Lehre abschließen. Eine Reihe von eigenen Arbeiten, die ich höher als andere Arbeiten einschätze, sind aus Lehrveranstaltungen hervorgegangen. Die Notwendigkeit, die eigenen Gedanken und methodischen Schritte Studierenden plausibel zu machen und mit ihnen zu diskutieren, sie auch in das Sammeln der Quellen und ihre Bewertung einzubinden, sie in dialogische Erkenntnisweise einzubeziehen und die Haltbarkeit von Thesen durch sie überprüfen zu lassen, hat oft zur Qualität beigetragen. Auch dies wird vielen von den hier Anwesenden vertraut sein: ein anspruchsvoller Vortrag auf einer anspruchsvollen Tagung profitiert immer von einer vorausgehenden oder nachfolgenden Lehrveranstaltung, am besten von einem Seminar, das einem spezifischen Quellencorpus gewidmet ist. Das hier entwickelte Programm – Überzeugung von der Erkennbarkeit der Geschichte mit Annäherung an die historische Wahrheit – Keine Debatten über die Sinnhaftigkeit von Geschichtswissenschaft - Positive Einstellung zu den vielen unterschiedlichen Annäherungsweisen an die eine Geschichte – Quellenanalyse als Kerngeschäft des Historikers – Hochschätzung von Quellenedition und ihrer hilfswissenschaftliche Zubereitung – Einheit von Lehre und Forschung – könnte durchaus das Etikett „althergebracht“ oder „konservativ“ erhalten. Wenn dies als Vorwurf gedacht ist, werde ich ihn aushalten und den Ruf nach dem „Neuen“ – der Zentralbegriff der Antrags- und Gutachtenslyrik heißt „innovativ“ - mit einer Anekdote beantworten. Ernst Curtius, der Ausgräber von Olympia und Erzieher des preußischen Kronprinzen, des kurzzeitigen Kaisers Friedrichs III., erzählte: Er war zu einem intimen Zirkel ins Berliner Schloß geladen, die Kaiser Wilhelm I., mit dem ihn eine tiefe, respektvolle Freundschaft verband, regelmäßig um sich versammelte. Der Kaiser begrüßte den Gelehrten mit der Frage: „Nun, lieber Curtius, was Neues aus Olympia?“ Als Curtius noch seine Antwort überlegte, sagte der Kaiser lächelnd: „Nicht wahr, es geht Ihnen wie Argelander, dem Direktor der Sternwarte in Bonn? Als ich ihn einst besuchte und fragte: 'Nun, lieber Argelander, was gibt's Neues am gestirnten Himmel?’, antwortete mir dieser ruhig: 'Kennen Königliche Hoheit schon das Alte?'» Vorhin habe ich einige Überlegungen zu den Kriterien angekündigt, mit denen der Fortschritt in der Geschichtswissenschaft beurteilt werden kann. Was verschafft uns die Sicherheit, daß das Ergebnis des jetzigen Forschens „besser“ als jenes des früheren Forschens ist ? Das Experiment, das der Physik und der Chemie zur Verfügung steht, scheidet natürlich aus, ebenso wie die genaue Beobachtung und das Messen, das die Biologie und die Astronomie anwenden. Der praktische Nutzen, der die technischen Wissenschaften und die Medizin in ihrer Richtigkeit bestätigt, ist selbstverständlich nicht gegeben, obwohl wir Historiker uns manchmal wünschen würden, daß der Nonsens einer Prüfungsarbeit oder ein schludrig gemachtes Buch wie eine einstürzende Brücke oder wie eine Infektion mit Fieberschüben wirken würden. Da wir uns der differenzierten Sprache zur Darstellung der Vergangenheit bedienen, fällt auch die Formelhaftigkeit der Mathematik aus, die sich der universell gültigen Logik bedient. Da die Konstruktion-Rekonstruktion der Geschichte auf den konstruierendenrekonstruierenden Historiker verweist, ist die Beurteilung der Tragfähigkeit der Konstruktion zwei Instanzen anvertraut: dem tätigen Historiker selbst und der kompetenten Kollegenschaft oder, wie man im Jargon gerne sagt, der scientific community. (Daß dies übrigens auch auf die sogenannten exakten Wissenschaften in hohem Maße zutrifft, sei hier nur gestreift). Wenn dieser Fortschrittsparameter aber dem eigenen Wissen und Gewissen und dem der ausgewiesenen Fachleute anvertraut ist, dann ist der Fortschritt der Geschichtswissenschaft nicht mehr nur ein erkenntnistheoretisches Problem, sondern auch ein moralisches oder, wenn Ihnen das zu fromm ist, ein ethisches Problem. Es werden Werturteile verlangt, bei denen die geforderte Rationalität in hohem Maße von Tugenden gestützt wird. Bekanntermaßen einigt man sich bei Tugenden, also Charaktereigenschaften, die zum sittlich Guten befähigen, viel leichter als bei rationalen Urteilen über Ursache und Wirkung bei historischen Prozessen. Während es für die verschiedensten Bereiche Tugendkataloge gibt – die christlichen Kardinaltugenden, die ritterlichen Tugenden, die bürgerlichen Tugenden, die sogenannten preußischen Tugenden -, fürchte ich, daß die Tugenden der Wissenschaftler noch genauer definiert, ja vielleicht sogar gelehrt werden müßten. Bei der Selbsteinschätzung der wissenschaftlichen Arbeit rechne ich jedenfalls dazu: Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt, Geduld, Ausdauer, Genauigkeit, Fleiß, ja Demut, Bescheidenheit, Hingabe. Wer von den Wissenschaftlern im Saal vermag hier diesbezüglich eine ganz reine Weste vorzuweisen ? Die kleine Ungenauigkeit da, der anscheinend nebensächliche Schwindel dort, das ungeschaut übernommene Zitat an dieser Stelle, der unter Zeitdruck entstandene unausgegorene Gedanke an jener – wer kennt das nicht, wenn er wissenschaftlich arbeitet ? Bei der Einschätzung der wissenschaftlichen Arbeit anderer ist selbstverständlich ebenfalls nicht nur die fachliche Rationalität, sondern Interaktion, Beziehung zueinander, und damit sittlich geprägtes Verhalten im Spiel. Zu diesen Tugenden der Wissenschaftler rechne ich: Fairness, Gerechtigkeit, Mäßigung, Wohlwollen, Friedfertigkeit, Verzicht auf Ehrgeiz und Eitelkeit, Humor, und Ihnen fällt sicher auch noch eine Serie von Tugenden ein. Alle kennen wir Kolleginnen und Kollegen, die diese Postulate in hohem Maße erfüllen, aber vom Gegenteil wissen wir wohl auch zu berichten: von einer gehässigen Rezension, von einem oberflächlich gelesenen und vorschnell abgeurteilten Werk, von der wissenschaftlichen Abwertung, weil uns die politische oder weltanschauliche Einstellung des Autors nicht paßt, vom Netzwerk, das keinen Eindringling zuläßt, vom Gutachterkartell, vom sakrosankten Lehrer-SchülerVerhältnis, und so fort. Ich wiederhole: Hier handelt es sich nicht um allzu menschliche Ausrutscher, sondern um eine Gefährdung der Bedingung der Möglichkeit, ein geschichtswissenschaftliches Werk nach seiner Qualität zu beurteilen. Dies berührt sich wohl mit der Kritik Friedrich Nietzsche’s an der Geschichte und an der Geschichtswissenschaft, die in den 1880erjahren besonders vehement den Anspruch auf Objektivität erhob. Seiner Überzeugung nach ist geschichtswissenschaftliche Objektivität etwas ganz anderes als sie zu sein vorgibt. Sie ist nichts als ein Ausdruck des Willens zur Macht. Tatsächlich kennen wir alle diese Versuche, in der Historie bestimmte Deutungen durchzusetzen, Begriffe zu kanonisieren, andere Meinungen zu denunzieren und Monopole „korrekter“ Anschauungen aufzubauen. Nun schließe ich in einem zweiten, sehr gestrafften Teil, ein praktisches Beispiel an, in dem ich einen der Motoren des wissenschaftlichen Fortschritts zum Laufen bringe. Davon war bisher noch nicht die Rede. Es ist dies das Feststellen eines Irrtums, also das Widerlegen einer Aussage, die entweder wegen methodischer Unzulänglichkeit, falscher Prämissen oder wegen vorschnellen, nicht sorgfältigen oder nicht folgerichtigen Schlußfolgerungen oder wegen unzureichendem Verarbeiten des Materials als falsch erwiesen werden kann. Dieses Falsifizieren als einen der Motoren der geschichtswissenschaftlichen Erkenntnis demonstriere ich freilich nicht an den Überlegungen und Ergebnissen eines anderen, sondern an einer eigenen Arbeit. Indem ich mich selbst widerlege und meinen Irrtum eingestehe, erspare ich damit meinen Kollegen aus der scientific comunity die Anwendung der Tugenden, die ich vorhin für die Beurteilung der Qualität einer Arbeit in der Historie postuliert habe. In einem gewissen Sinn verdanke ich der Hl. Klara von Assisi, dessen 850. Jahrestag ihrer conversio im Jahre 1212 heuer übrigens in der franziskanischen Familie gefeiert wird, meine Wiener Professur, denn beim Vorstellungsvortrag innerhalb des Berufungsverfahrens 1995 stellte ich eine hilfswissenschaftlich unterfütterte Untersuchung zuden Quellen der Heiligen vor, die damals gerade abgeschlossen war und die dann in einem umfangreichen Aufsatz erschien. Auf diese quellenkritischeArbeit will ich hier kurz zurückkommen. Ich tue dies nicht, weil mir seither wissenschaftlich nichts mehr eingefallen ist, sondern weil sie in der breiten, manchmal ausufernden Literatur zu den Anfängen des weiblichen Zweiges der Minoriten im 13. Jahrhundert einen starken Wirbel ausgelösthat, der bis heute nicht abgeklungen ist, und weil sie zur Demonstration eines wissenschaftlich fruchtbaren Irrtums recht gut geeignet ist. Es geht um die Authentizität des Testamentes der Klara von Assisi, eines zentralen Dokumentes für die Spiritualität der Ordensgründerin, das auch heute noch in vielen der heute etwa 800 weltweit bestehenden Konventen regelmäßig am Freitag bei Tisch vorgelesen wird. Im Gegensatz zu Franziskus, zu dem ein umfangreiches und in seinen inneren Verflechtungen teilweise nicht durchschaubares Quellencorpus vorliegt, stellt sich die Quellenlage zu Klara viel einfacher dar. An seinem chronologischen Beginn steht meistens eine undatierte päpstliche Urkunde, das sogenannte Privilegium paupertatis Papst Innocenz‘ III. (1198-1216), welches freilich nicht als Original, sondern nur in einigen Abschriften erhalten ist, von denen eine wohl aus dem späten 13./frühen 14. Jh., die anderen aus dem späten 15./frühen 16. Jahrhundert stammen.Dieses Priv. paup. weckt beim Diplomatiker schnell den Verdacht einer Verfälschung, d. h. der Manipulation einer vorliegenden echten Papsturkunde. Es sollte ein feierliches Privileg, eine besondere Form einer Papsturkunde mit einer Anzahl von graphischen Symbolen, den Unterschriften des Papstes und der Kardinäle, hervorgehobenen Schriftteilen vorgetäuscht werden, wobei man sich einer echten Papsturkunde Gregors IX. für Klara und ihre Gefährtinnen vom 17. September 1228 bediente und nur wenige Teile änderte. Diese Papsturkunde von 1228 ist unter den zahlreichen derartigen Produkten der hochmittelalterlichen päpstlichen Kanzlei als sensationell zu bezeichnen, denn sie bestätigt nicht wie die meisten von ihnen Besitz und Rechte, sondern sie gewährt ausdrücklich das Recht auf Armut und auf die Zurückweisung von angebotenem Besitz. Die Fälschung ist unschwer durch die Analyse des Textes nachzuweisen, aber hauptsächlich paßt ein feierliches Privileg überhaupt nicht in die historische Situation der Anfangsjahre Klaras und ihrer Gemeinschaft von Büßerinnen, von denen es im damaligen Mittelitalien Dutzende von vergleichbaren gab. Es ist schwer vorstellbar, daß die päpstliche Kanzlei eine Urkunde ausstellte, die dann alle an der Kurie anwesenden Kardinäle und der Papst persönlich zu unterschreiben hatten, um damit einer jungen, an der Kurie damals völlig unbekannten jungen Frau von etwa 23 oder 24 Jahren und ohne kirchenrechtlich relevante Dignität einsonderbares Recht zu gewähren.Dazu kommt, daß alle diese Privilegien, von ganz vereinzelten Ausnahmen abgesehen, auf die Initiative der Empfänger zurückgingen, die dafür einen Prokurator an der päpstlichen Kurie – heute würde man so einen Mann einen Lobbyisten oder Anwalt nennen – bezahlten und dann für die Aushändigung der Urkunden nochmals eine saftige Taxe zu erlegen hatten. Heikel wird der Fälschungsnachweis deshalb, weil im Testament der Klara, das man besser als „geistliches Testament“ bezeichnen sollte, ein Bezug zu Innocenz III. und einem von diesem ausgestellten Dokument genannt wird. Im mittleren Teil, Vers 42/43, heißt es: „Ja zur größeren Vorsorge wurde ich von Papst Innocenz, zu dessen Zeit wir anfingen, und von seinen anderen Nachfolgern veranlaßt, unser Bekenntnis zur heiligsten Armut, die wir dem Herrn Jesus Christus und unserem seligen Vater Franziskus versprachen, durch ihre Privilegien bekräftigen zu lassen, damit wir zu keiner Zeit und auf keine Weise von ihr abwichen“. Wenn sich das Testament der Hl. Klara ausdrücklich auf eine apokryphe Papsturkunde bezieht, dann läßt dies nur zwei Folgerungen zu: Entweder das Priv. paup. wurde schon vor 1253, dem Todesjahr der Heiligen, fabriziert oder das Testament ist selbst ein apokrypher Text, der zu einem späteren Zeitpunkt, wohl zusammen mit dem inkriminierten Priv. paup., hergestellt wurde. Für das eine fehlen jegliche Hinweise, und es ist auch schwer vorstellbar, daß quasi unter den Augen der Heiligen und ihrer Gefährtinnen ein Falsum hergestellt wurde, dessen Zweck zu Lebzeiten Klaras auch nicht erkennbar ist. Das andere hat schon mehr Wahrscheinlichkeit für sich und unter der Reihe von Argumenten nenne ich nur eines: In keiner zeitgenössischen Quelle wird es erwähnt und keine der 13 zu Zeugen im Kanonisationsverfahren aufgerufenen Schwestern weiß davon, obwohl sich das Testament ausdrücklich an sie richtet. Wenn die Beurteilung des Priv. paup. Innocenz’ III. als einer Verfälschung der Urkunde Gregors IX.als sehr sicher gelten kann und die Argumente gegen die Echtheit des Testaments der Heiligen schwer wiegen, dann fehlt als Schlußstein eines Fälschungsnachweises noch immer die den Urkundenforschern vertraute methodische Regel, daß plausibel gemacht werden muß, wer fälschte, und wann und warum gefälscht wurde. In meiner Untersuchung von 1995 kam ich zu dem Schluß, daß beide Dokumente Produkte der observanten Reform des Klarissenordens im Umbrien des 15. Jahrhunderts seien, die die Abkehr von der lascheren Regel Papst Urbans IV. von 1263 und die Rückkehr zur strengen Regel der Hl. Klara verlangten. In dieser Erneuerungsbewegung schien nicht nur der Rückgriff auf Innocenz III., der für den Beginn der Minoriten überhaupt entscheidend gewesen war, sondern auch auf die schriftliche Hinterlassenschaft der Ordensgründerin plausibel und besonders der laute Ruf nach Armut, der eines der wesentlichen Elemente des Testamentes ist. Dabei diente als wichtiges Argument die handschriftliche Überlieferung des Testamentes. Es ist mit einer Ausnahme in Abschriften des späten 15./ frühen 16. Jhs. überliefert, und auch die Ausnahme, jene aus dem Klarissenkloster Montevergine in Messina, hatte ich - wohlgemerkt, durch die Expertise einer illustren Runde von deutschen und italienischen Paläographen gestützt – in diese Zeit datiert. Aber leider, dieses Argument der Datierung trägt nicht, die Handschrift ist aus dem späten 13./frühen 14. Jh. Damit ist die schöne, gut argumentierte These von einer spätmittelalterlichen Fälschung während der observanten Reform zusammengebrochen. Damit bin ich nach Johann Nestroy und Ludwig Wittgenstein beim dritten Österreicher, der mir bei der Frage nach dem Fortschritt in der Geschichtswissenschaft das passende Zitat liefert. Karl Popper hat im Vorwort seiner „Logik der Forschung“ postuliert: „Wann immer wir nämlich glauben, die Lösung eines Problems gefunden zu haben, sollten wir unsere Lösung nicht verteidigen, sondern mit allen Mitteln versuchen, sie selbst umzustoßen." und damit hat Popper das Falsifikationsprinzip als eine der Grundlagen des Aufstellens einer vernünftigen Theorie hingestellt. Ich folge also Karl Popper. Mit einer gewissen Genugtuung stelle ich fest, daß mir kein Kritiker – und es waren nicht wenige - den Irrtum vor die Nase gehalten hat, sondern daß ich selbst daraufgekommen bin. Erravi, und darum kann die Suche nach der Wahrheit weitergehen. Als ich unsicher wurde und bei Kollegen aus Italien nachfragte, entstand der Plan einer Untersuchung der fraglichen Handschrift vor Ort. Wir, fünf Professoren aus Italien und einer aus Wien, fanden uns also an einem schönen Frühjahrstag des Jahres 1998 im Klarissenkloster von Messina ein und nahmen vor dem Sprechgitter des Besucherzimmers Platz und erhielten von der Äbtissin den berühmten Codicetto, wie er wegen seines MiniFormates von 7,5 x 5 cm genannt wird, ausgehändigt und blätterten ihn Seite für Seite durch, wobei eine junge Klarissin auf der anderen Seite des Gitters alle unsere Bewegungen aufmerksam verfolgte. Ersparen Sie mir bitte die paläographischen Argumente, die die Schrift ins späte 13. Jahrhundert, frühe 14. Jahrhundert weisen. Die offenen Fragen sind nicht viel geringer geworden und besonders die Zeit der Entstehung und des vermutlichen Motivs des Fälschers / oder der Fälscherin müssen hypothetisch bleiben. Ich plädiere für einen Minoriten oder eine Klarissin der nächsten oder übernächsten Generation, die die wachsende materielle Sicherheit des nun nach der milderen Regel Urbans IV. lebenden Konventes in Assisi als Ärgernis empfanden und die radikale Armut der Anfangszeit dagegen hielten. 1265 wurde der Altar einer neuen Kirche in Assisi eingeweiht, wohl an der Stelle, wo sich heute der prachtvolle, auf Betreiben des Königs Robert von Neapel und seiner Frau Sanchia seit 1310 aufgeführte Bau der Kirche S. Chiara und des daneben stehenden Protomonastero erhebt. Die Wallfahrt zum Grab der heiligen Ordensgründerin setzte rasch ein und spülte ununterbrochen Geld in die Kassen, die Annahme von Besitz war – entgegen der radikalen Bestimmung der Urkunde Gregors IX. von 1228 – nun gestattet und das Archiv des Konventes sammelte Papsturkunden und andere Dokumente, die Recht und Besitz sicherten. Unbestritten soll aber auf jeden Fall bleiben, daß das Testament die aus anderen Quellen gut bezeugte Geistigkeit der Hl. Klara gut trifft. Einer der Kritiker meines Aufsatzes von 1995 hat dazu bemerkt: „Sollte es sich bei dem Testament um eine Fälschung handeln, dann ist sie so schön und so gut konstruiert, daß es einer zweiten heiligen Klara bedurft hätte, um sie so niederzuschreiben“. Wozu also, so kann man sich fragen, der ganze gelehrte Aufwand, um die Autorschaft eines Textes nur geringfügig zu verschieben ? Diese kritische Bemerkung rührt freilich zutiefst an das Selbstverständnis des Wissenschaftlers und an seine Überzeugung, daß es auf dem Weg der Erkenntnis einen Fortschritt gibt - und sei er noch so klein - , für den sich der Einsatz von Zeit, Energie, Geld, manchmal sogar Gesundheit, lohnt. Die Sinnfrage drängt sich auf. Bei dieser, die natürlich auch für die Naturwissenschaften gilt – man denke nur, wie trostbedürftig beispielsweise ein Biologe ist, der als Ergebnis einer monatelangen Reihenuntersuchung das Wort nihil aufschreiben muß -, nehme ich Zuflucht bei Max Weber, der in einem 1917 gehaltenen Vortrag ‘Wissenschaft als Beruf’ gerade diese Hartnäckigkeit um Kleines als Wesensmerkmal des Wissenschaftlers gekennzeichnet hat: ‘Und wer also nicht die Fähigkeit besitzt, sich einmal sozusagen Scheuklappen anzuziehen und sich hineinzusteigern in die Vorstellung, dass das Schicksal seiner Seele davon abhängt: ob er diese, gerade diese Konjektur an dieser Stelle dieser Handschrift richtig macht, der bleibe der Wissenschaft nur ja fern’. Zum Abschluß sei mir gestattet, nochmals auf die Kernaussage des hier vorgelegten, mehr theoretischen Teiles meiner Überlegungen zum Fortschritt in der Geschichtswissenschaft zurückzukommen. Der Fortschritt in der Geschichtswissenschaft ist weniger ein epistemologisches, sondern vielmehr ein moralisches Problem. Man könnte hier nun unseren fernen Kollegen der Universität Jena, Friedrich Schiller, variieren und seine Rede von der „Schaubühne als moralische Anstalt“ auf die Historischen Institute als moralische Anstalt übertragen – und im weiteren Sinn Historische Institute als Schaubühne bezeichnen - , aber es kommt mir eher darauf an, jetzt nicht zu scherzen, sondern den nachwachsenden Historikern Mut zu machen. Der Fortschritt der Geschichtswissenschaft hängt nicht so sehr von kalter Rationalität und unbarmherzigem Falsifizieren, vom Nachweis von Irrtümern, sondern von menschlichem Wohlwollen ab, das jedoch das kritische Urteil nicht in einem Brei von angeblich wohlmeinenden Worten erstickt, sondern dieses als Hilfe auf einem gemeinsamen Weg der Wahrheitssuche anbietet. Ich habe gerne in dieser Fakultät der Universität Wien und am Institut für österreichische Geschichtsforschung geforscht, gelehrt und gelebt, ich danke Ihnen für die Möglichkeit dazu und wünsche weiterhin alles Gute.