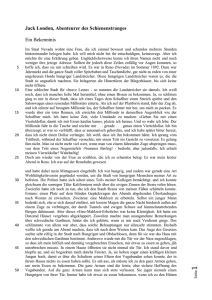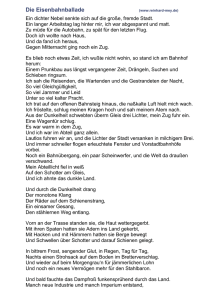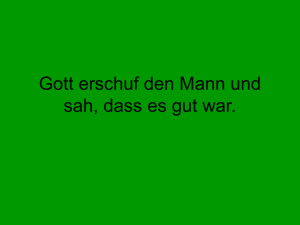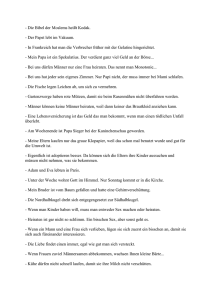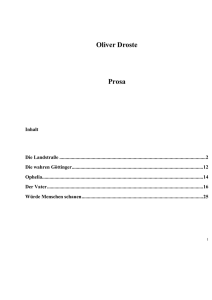Gerechtigkeit A.Basina 9b
Werbung
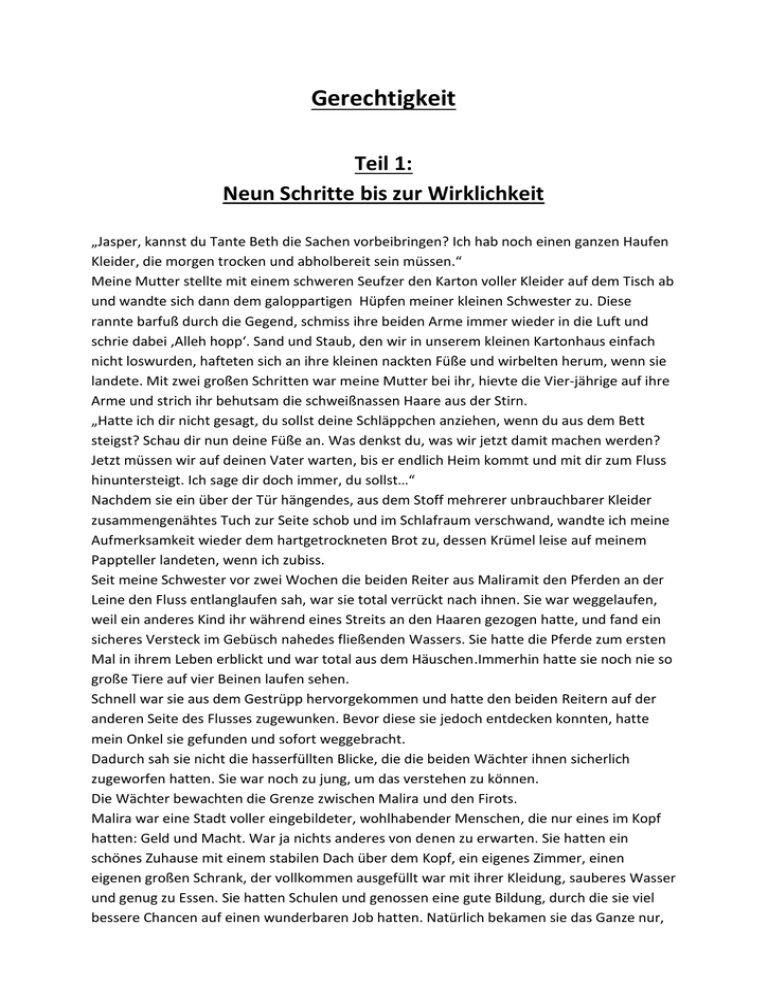
Gerechtigkeit Teil 1: Neun Schritte bis zur Wirklichkeit „Jasper, kannst du Tante Beth die Sachen vorbeibringen? Ich hab noch einen ganzen Haufen Kleider, die morgen trocken und abholbereit sein müssen.“ Meine Mutter stellte mit einem schweren Seufzer den Karton voller Kleider auf dem Tisch ab und wandte sich dann dem galoppartigen Hüpfen meiner kleinen Schwester zu. Diese rannte barfuß durch die Gegend, schmiss ihre beiden Arme immer wieder in die Luft und schrie dabei ‚Alleh hopp‘. Sand und Staub, den wir in unserem kleinen Kartonhaus einfach nicht loswurden, hafteten sich an ihre kleinen nackten Füße und wirbelten herum, wenn sie landete. Mit zwei großen Schritten war meine Mutter bei ihr, hievte die Vier-jährige auf ihre Arme und strich ihr behutsam die schweißnassen Haare aus der Stirn. „Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst deine Schläppchen anziehen, wenn du aus dem Bett steigst? Schau dir nun deine Füße an. Was denkst du, was wir jetzt damit machen werden? Jetzt müssen wir auf deinen Vater warten, bis er endlich Heim kommt und mit dir zum Fluss hinuntersteigt. Ich sage dir doch immer, du sollst…“ Nachdem sie ein über der Tür hängendes, aus dem Stoff mehrerer unbrauchbarer Kleider zusammengenähtes Tuch zur Seite schob und im Schlafraum verschwand, wandte ich meine Aufmerksamkeit wieder dem hartgetrockneten Brot zu, dessen Krümel leise auf meinem Pappteller landeten, wenn ich zubiss. Seit meine Schwester vor zwei Wochen die beiden Reiter aus Maliramit den Pferden an der Leine den Fluss entlanglaufen sah, war sie total verrückt nach ihnen. Sie war weggelaufen, weil ein anderes Kind ihr während eines Streits an den Haaren gezogen hatte, und fand ein sicheres Versteck im Gebüsch nahedes fließenden Wassers. Sie hatte die Pferde zum ersten Mal in ihrem Leben erblickt und war total aus dem Häuschen.Immerhin hatte sie noch nie so große Tiere auf vier Beinen laufen sehen. Schnell war sie aus dem Gestrüpp hervorgekommen und hatte den beiden Reitern auf der anderen Seite des Flusses zugewunken. Bevor diese sie jedoch entdecken konnten, hatte mein Onkel sie gefunden und sofort weggebracht. Dadurch sah sie nicht die hasserfüllten Blicke, die die beiden Wächter ihnen sicherlich zugeworfen hatten. Sie war noch zu jung, um das verstehen zu können. Die Wächter bewachten die Grenze zwischen Malira und den Firots. Malira war eine Stadt voller eingebildeter, wohlhabender Menschen, die nur eines im Kopf hatten: Geld und Macht. War ja nichts anderes von denen zu erwarten. Sie hatten ein schönes Zuhause mit einem stabilen Dach über dem Kopf, ein eigenes Zimmer, einen eigenen großen Schrank, der vollkommen ausgefüllt war mit ihrer Kleidung, sauberes Wasser und genug zu Essen. Sie hatten Schulen und genossen eine gute Bildung, durch die sie viel bessere Chancen auf einen wunderbaren Job hatten. Natürlich bekamen sie das Ganze nur, wenn ihre Familie genug Geld hatte, um sich den Aufenthalt dort leisten zu können, ansonsten empfingen wir auch ab und zu neue Bewohner, die wie Hunde ausgesetzt wurden und nicht wussten, wohin. Malira war eine riesige Oase, mitten in einer Halbwüste. Wir konnten nur von Glück reden, dass es eine Meile von unseremZuhause entfernt einen Fluss gab, sonst wären alle in den Firots natürlich irgendwann letztendlich verreckt. Ist ja nicht so, als würden die Menschen aus Malira sich um uns Sorgen machen. Ihnen wäre es schlicht weg egal, wenn tausende Tote ein paar Meilen weiter weg einen Großteil der Halbwüste mit ihren Leichen bedecken würden. Mit diesen Gedanken wurde ich jedenfalls erzogen und es war nur viel zu leicht dem Ganzen Glauben zu schenken. Wieso sollte man uns belügen wenn wir doch ohnehin in der bitteren Wahrheit lebten? Ich stand – immer noch hungrig und mit einem gefühlt leeren Magen – auf, hob den Korb auf meine rechte Schulter, und schritt, ohne mich zu verabschieden, nach draußen. Das grelle Licht der Sonne traf mich wie eine Faust aufs Auge. Skrupellos und ohne jegliches Mitgefühl brannte es sich sekundenschnell in meine Haut ein und ließ meinen Korb schwerer erscheinen, als er es eigentlich war. Ich trottete und schlängelte mich auf den vielen kleinen Wegen und Pfaden durch die Firots, begegnete viel zu vielen Leuten auf einer viel zu kleinen Fläche, wich viel zu oft aus und fiel dafür viel zu wenig hin. Wo konnte man schon landen, wenn man bei jedem Stolpern mit irgendeinem Menschen zusammenstieß, der einen wieder auf die Beine brachte, oder jedes Mal an irgendeinem Karton oder irgendeiner Zeltplane halt fand, sobald man sich nur zur Seite lehnte. „He, pass doch auf!“, schrie mich ein großgewachsener Mann an, als es mal wieder soweit war. Er drückte mich mit Schwung von sich, sodass ich in das gegenüberliegende Zelt flog, direkt in einen blonden Jungen, der gerade rausgehen wollte. Sofort rollte ich mich von ihm weg und rappelte mich auf. Dabei klopfte ich mit einer Hand den Schmutz, der in seinem Zelt genauso verbreitet zu sein schien, wie in unserem, von meiner Kleidung, und hielt ihm die andere Hand hin. Dieser schlug sie jedoch weg, stand von alleine auf, und schaute mich aus kalten, blauen Augen an. „Du weist, wo der Ausgang ist“, zischte er und verschwand mit eiligen Schritten aus dem Zelt, nicht ohne mich noch mit einer barschen Geste darauf hinzuweisen, die verteilten frischgewaschenen Sachen, die nun auf dem sandigen Boden verstreut lagen, aufzuheben – sehr freundlich von ihm. Für diese Aufmerksamkeit würde ich wohl für immer in seiner Schuld stehen. Es war keine große Sache, dass er mich in seinem Zelt alleinezurückgelassen hatte. Er war arm. Ärmer als die Meisten, wenn man sich in seinem Zelt umsah. Ein Bett aus getrocknetem Gras, ein kleiner Schrank, den er wahrscheinlich bei den Abfällen Maliras gefunden hatte. Ohne die Schranktüren zu öffnen, wusste ich, dass es nur wenige Kleiderstücke sein konnten, die er dort aufhob. Welcher Mensch würde es denn wagen, ihn bestehlen? So ehrlos konnte doch niemand sein, oder? Nach dem ich den Schmutz von Tante Beths Sachen abgeschüttelt, sie zusammenfaltet und wieder sicher in dem Korb verstaut habe, setzte ich meinen Weg fort. Tante Beth – die nicht wirklich meine Tante war, sondern einfach von jedem so genannt wurde – wohnte weiter entfernt vom Fluss, weshalb ich immer weniger Menschen auf meinem Weg zu ihr traf. Die Abstände der Hütten wurden größer, die Durchgänge wurden breiter und man hatte nicht mehr das Bedürfnis, nach Luft ringen zu müssen, in der Hoffnung, dass das letzte bisschen Sauerstoff nicht von einem anderen weggesaugt wurde. Man fühlte sich … freier. Und einsamer. Es war unglaublich still in dieser Gegend. Hier wohnten die Alten. Die Ältesten der Alten. Die Weisen. Meine Mutter sagte, dass der Große Konjai, der, der über Leben und Tod bestimme, diese Menschen auserwählt hatte, umuns zu helfen. Sie sollten lange leben, viel Erfahrung sammeln, sie an die nächsten Generationen weitergeben, und schließlich sterben. Sie sagte, Tante Beth wäre eine dieser Außerwählten und dass ihr Wort und ihr Rat heilig seien. Tat man etwas Gutes, so war man es wert, ihre alte Stimme zu hören. Und genauso überlebten die Alten auch in diesem weiten Abstand zum Fluss. Menschen aus allen Ecken und Gegenden der Firots kamen hierher, um ihnen ihre Hilfe anzubieten, und erhofften dafür einen weisen Rat zu bekommen. Wenn man nichts zu bieten, aber gute Taten in seinem Leben begangen hatte, war es nur einen schlimmen Streit zu beenden oder jemanden solange zu trösten, bis er aufhörte zu weinen, wurde man bei ihnen ebenfalls herzlich empfangen. Woher sie wussten, dass jemand eine gute Tat begangen hatte? Fragt mich nicht, ich habe keinen blassen Schimmer. Gerüchten zufolge können manche von ihnen hellsehen, andere Lüge von Wahrheit unterscheiden, und ein paar wenige sogar Gedanken lesen, aber für solche Kinderfantasien hatte ich mich noch nie interessiert. Gedankenverloren starrte ich vor mich hin, als ich einen beängstigenden Schrei einer Frau aus einer der Behausungenwahrnahm, die irgendwo in meiner Nähe platziertsein musste. Wie angewurzelt blieb ich stehen und sah mich erschrocken um. Und von einem auf den anderen Moment verstummte er plötzlich und meldete sich nicht wieder. Seltsam … aber nicht weiter wichtig für mich, dachte ich, setzte mich in Bewegung und ging langsamer als zuvor weiter, bereit, beim nächsten Schrei sofort zur Stelle zu sein. Denken und dann etwas anderes tun, hörte ich meinen Stiefvater abermals sagen. Ist ja mal wieder ganz typisch für dich. Ich lauschte. Die Stille erfüllte die ganze Gegend der Alten. Würden Menschen dreißig Meter weiter ein leises Gespräch führen, würde ich vielleicht sogar jedes Wort mithören und verstehen können. Doch ich vernahm immer noch nichts. Nicht das leiseste Geräusch. Wo waren denn all die Menschen? Und diese beunruhigende Totenstille, die alles verschluckte? Was war denn hier nur los? Und plötzlich durchbrach der Schrei der Frau abermals die Stille. Nur war er diesmal viel schriller, viel heftiger, erfüllt von Panik und Todesangst. Ich rannte los, schneller, als ich es mir mit meinem schweren Korb zugetraut hätte. Trotz des Kreischens, das die leere Gegend zu erschüttern schien, fand ich den Karton erst nach einer sehr, sehr langandauernden Minute. Ich hatte doch tatsächlich gedacht, er wäre in meiner Nähe. Vierhundert Meter weiter hätte es wohl besser getroffen. Ich hoffte innständig, dass ihre Stimmbänder nicht zu sehr beschädigt werden würden; dieser Schrei war wirklich ohrenbetäubend, wenn man in seiner Nähe war. Abrupt brach er ab und stattdessen hörte ich ein Geräusch, als würde man jemandem beim Sprechen die Hände auf den Mund pressen. „Ach, halt doch endlich die Klappe, du kleines Miststück!“, brüllte eine Männerstimme. Die Frau war also nicht allein. Ich presste mich an die Kartonwand, um zu lauschen. Vielleicht waren dort noch mehr Männer. „Beruhige dich, Rano“, sagte ein anderer. „Du hast eine Aufgabe, also solltest du aufhören zu schimpfen und sie endlich beenden.“ „Wie bitte? Mich beruhigen? Diese Frau hat sie nicht mehr alle. Schreit so, als würden wir kurz vor dem Weltuntergang stehen.“ „Dann hätte sie ja Glück, dass sie ihn nicht mehr miterleben würde“, erwiderte der zweite Mann und schon setzte die Frau mit der Kopfstimme ihr Gekreische fort. „Ach, verdammt, die hat ja echt Nerven, hier so rumzuschreien. Mirin, was sollen wir mit ihr machen? Wir können sie jetzt noch nicht töten.“ Dochanstatt einer Antwort hörte ich nur ein dumpfes Geräusch, als würde jemand am Boden aufschlagen. Gleichzeitig verstummte der Schrei. Schon wieder. Ich vermutete, dass sie die Frau niedergeschlagen hatten. War es denn falsch, dass es sogar mir ein erleichtertes Seufzten entlockte? „So geht das. Und jetzt hebe sie auf! Wir verschwinden von hier.“ „Fehlt uns noch etwas?“ „Ein roter Haarschopf. Nichts Besonderes. In der Nähe des Flusses wohnt eine Rothaarige. Aber zuerst bringen wir die hier weg. Sie muss gewaschen und zurechtgemacht werden. Die Opfergabe muss den Göttern doch gerecht werden.“ Ich hielt inne, um zu verarbeiten, was der Mann, Mirin, gerade eben gesagt hatte. Dann verdrehte ich genervt und leicht angewidert die Augen. Tachen. Mir wurde übel. Von denen hatte meine Mutter mich schon gewarnt. Ich bin erst ein Mal einem von ihnen begegnet und hatte inständig gehofft, dass es kein nächstes Mal geben würde. Vor fünf Jahren hatten wir eine alleinerziehende Mutter als Nachbarin. Sie hatte vor kurzem ein kleines Baby zur Welt gebracht und ab da war meine Mutter jeden Tag bei ihr, um zu helfen. Sie hatten sich angefreundet, unternahmen sogar etwas gemeinsam, wenn sie Zeit fanden. In einer warmen Sommernacht wurde ich von Kampfgeräuschen wach. Eine Frau schrie. Ein Mann fluchte. Ein Baby weinte. Als ich verstand, rannte ich sofort zu meiner Mutter und rüttelte sie wach. Sie war noch nicht mit beiden Füßen am Boden, als ich aus unserem Karton herausstürmte, und direkt in einen Mann lief. Ich fiel hin, rappelte mich jedoch sofort auf, um eine Kampfstellung einzunehmen, so wie ich es bei unserem täglichen Training gelernt hatte. Der Mann war groß und muskulös und wirkte gehetzt und aggressiv. In der Dunkelheit konnte ich erkennen, was er in den Händen hielt. Die eine Hand umklammerte fest den Griff eines Messers. Die Klinge spiegelte den Mond wieder, dessen kalter Schein in mir eine Gänsehaut auslöste, die mir über den Rücken lief, als wäre er der Feind, den ich erst jetzt bemerkte und der mir mit seinem scharfen Licht über den Rücken schnitt. Etwas Rotes und Flüssiges lief die Schneide entlang, sammelte sich an der Spitze des Messers und tropfte auf den sandigen Boden. Ich hatte die Zähne zusammengebissen, als ich verstand, dass es bestimmt kein Saft irgendeiner roten Frucht war. In der anderen Hand hielt er etwas Dunkles und Dichtes, in dem sich seine Finger verloren. Es sah weich aus und ich vermutete, dass das in seiner Hand ein Fellbüschel war. Der Mann lachte mich aus und erst da bemerkte ich, dass ich alleine einem Erwachsenen gegenüber stand, mit nichts, außer meinen kleinen Fäusten. Dann fragte er mich, ob ich ein Mädchen oder ein Junge sei. Ich hatte damals schulterlanges blondes Haar und es war Nacht. Von daher konnte ich es ihm wohl kaum verübeln, mir diese Frage gestellt zu haben. „Junge“, hatte ich geantwortet, leicht verwundert über die Festigkeit in meiner Stimme. Im schwachen Mondlicht sah ich, wie ein leichtes Lächeln seine Lippen umspielte. Und dann nickte er und das Letzte, was er zu mir sagte war: „Gut.“ Dann rannte er davon. Meine Mutter lief aus dem Karton heraus und sah sich etwas panisch um. Andere aus unserer Nachbarschaft kamen aus ihren Kartons und ihren Zelten, um zu sehen, was passiert war. Vor jedem Eingang standen Menschen, die unruhig hin und her blickten und miteinander tuschelten. Vor jedem Eingang, außer einem. Als es auch die anderen, einschließlich meiner Mutter, bemerkten, schlug diese sich die Hand vor den Mund und stürmte in das Zelt ihrer Freundin. Ein paar Erwachsene folgten ihr, einer mit einer Fackel in der Hand. Daraufhin ertönte ein erschrockener Ausruf. Eine Frau rannte heraus und übergab sich. Ein Mann folgte ihr und konnte sie noch rechtzeitig auffangen, als sie in sich zusammensank. Die einen kamen mit erstarrten Mienen aus dem Zelt, die anderen gingen hinein, um sich selbst von dem zu überzeugen, was erzählt wurde. Meine Mutter kam nicht heraus. Die ganze Nacht blieb sie im Zelt. Ein paar Tage später erzählte sie mir, was passiert war. Ich war elf Jahre alt, erwachsen genug, um das Geschehene zu verstehen. Die Leiche ihrer Freundin hatte weder Haare, noch Nägel, noch Kind. Sie wurde nackt aufgefunden und zudem wurde ihr Gesicht zu etwas verstümmelt, was sich nicht beschrieben ließ. „Tachen“, hatte meine Mutter das Wort voller Ekel ausgespuckt. „Männer, die der Meinung sind, Frauen müssten sich ihnen unterwerfen. Sie seien das Mittel zum Zweck. Jedes Jahr im Hochsommer verschwinden Frauen für immer oder werden verstümmelt aufgefunden.“ Tränen liefen wieder über ihre Wangen. „Widerliche Perverslinge, die Frauenorgane als Opfergaben für ihre Götter benutzen.“ Mir war übel geworden, als ich michan das Fell erinnert hatte, das der Mann mit dem Messer in seiner Hand gehalten hatte. Musste ich wirklich noch erwähnen, was es in Wirklichkeit war? Ich schüttelte den Kopf – ein vergeblicher Versuch, meine Gedanken zu ordnen und mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Ich war nicht mehr elf Jahre alt. Ich war größer, stärker, erfahrener. Irgendetwas würde mir schon einfallen, um diese Männer zu verjagen. Ich musste diese Frau beschützen, was es auch kostete. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals. Langsam hob ich den Korb mit der Kleidung von meinen Schultern und stellte ihn geräuschlos am Boden ab. Ich glaubte kaum, dass er eine große Hilfe wäre und ein zweites Mal wollte ich die Wäsche sicherlich nicht sauberklopfen. Dann begann ich mich vorsichtig umzusehen. Die Männer waren mitten am helllichten Tag unterwegs. Sie würden es niemals schaffen, die Frau ungesehen von einem Ort zum anderen zu befördern. Niemals. Sie mussten etwas dabei haben, das transportfähig und praktisch, aber gleichzeitig auch unauffällig war, die Leute nicht irritierte und auch nicht auf sich aufmerksam werden ließ. Ich schaute durch die Gegend, überprüfte alles genauestens, aber ich konnte nichts finden, was meinen Vorstellungen entsprach. Sie mussten dieses Transportmittel irgendwo außerhalb ihrer Sichtweite abgestellt haben. Ein leises Lächeln schlich sich auf meine Lippen. So würden sie mir bei meinem Vorhaben nicht im Wege stehen. Ich ging auf leisen Sohlen um den Karton herum und siehe da, wie erwartet: Eine Schubkarre … Und ein Mann. Mein Lächeln erlosch und ich ging schnell in die Hocke. Das machte alles ein wenig schwieriger. Ein Mann draußen. Zwei Männer drinnen. Drei Männer insgesamt, die höchstwahrscheinlich alle bewaffnet waren. Und ich. Mit einem Korb voller Kleider . Und nichts außer meinen Fäusten. Schon wieder. Ich lehnte meinen Kopf an die Wand und versuchte, mich zu beruhigen. Es war nicht dieselbe Situation, wie vor fünf Jahren. Diesmal würde alles besser laufen. Das schwor ich mir. Diesmal würde ich vorbereitet sein. Ich presste meine Handflächen gegen die Schläfen und ließ meinen Kopf leicht gegen den Karton schlagen. Denk nach, Jasper. Denk nach. Dann lugte ich über die Kartonwand auf den Mann und kniff meine Augen zusammen. Er stand mit dem Rücken zu mir und gab mir somit die Möglichkeit, ihn genauer zu betrachten. Ich schaute auf seine Körperhaltung, schaute auf seinen Körperbau, versuchte, ihn einzuschätzen. Er war eher schmächtig – seine übergroße Kleidung hing schlaff an ihm herab – und etwas kleiner als ich. Sein Rücken war nicht so krumm wie bei den meisten Erwachsenen, die lebenslang hart arbeiten mussten, und er schien auch nicht so gebrechlich zu sein, daher vermutete ich, dass er ungefähr in meinem Alter sein musste, vielleicht sogar jünger. Kein Mann, ein Junge. Er stand aufrecht und sicher, doch würde er nicht die ganze Zeit mit seiner Fußspitze wie verrückt auf den Boden tippen, könnte man sogar annehmen, er wäre kein harmloser Anfänger. Aber genau das war er: Ein Neuling. Hoffnung breitete sich in mir aus. Vielleicht würde ich das alles ohne große Probleme hinter mich bringen können... Und dann ich trat aus meinem Versteck hervor. Der Junge drehte sich um, sah mich aus seinen großen Augen an und setzte schon zu einem Schrei an, als ich schnell meinen Finger an die Lippen hielt und meinen Arm mit der offenen Handfläche nach oben hob, um zu zeigen, dass ich nichts bei mir hatte. Etwas erleichtert und verwirrt atmete der Junge aus. Dann legte er die Stirn in Falten und schaute mich fragend und leicht misstrauisch an. „Bist du ein Tach?“, fragte er leise, mit einer hohen Stimme. Erst da erkannte ich: Kein Mann, kein Jugendlicher, ein Kind. Groß, aber noch sehr jung. „Bist du hier, um zu helfen?“ Ich entspannte mich ein wenig, blieb aber auf der Hut. Die Männer würden bald kommen. Bis dahin musste ich den Jungen hier weghaben. Aber niederschlagen würde ich ihn nicht. Nicht, wenn es nicht sein musste. „Ja“, log ich. „Ich bin hier um zu helfen. Ich muss dich ablösen.“ Der Junge schüttelte zweifelnd den Kopf. „Aber ich bin doch hier. Das reicht doch. Und mir hat niemand etwas davon gesagt. Also, dass ich eingetauscht werden sollte.“ „Dann weist du es ja jetzt. Ich bin dran. Du sollst zurückgehen, haben die gesagt. Sie haben eine neue Aufgabe für dich.“ Zögernd machte der Junge Anstalten, zu gehen, hielt jedoch inne und drehte sich dann um. „Bist du dir wirklich sicher? Sie haben gesagt, dass wenn ich mich vom Platz bewege, sie mit mir böse Sachen anstellen werden.“ Leicht erstaunt sog ich die Luft ein und hob die Augenbrauen. Fragen bildeten sich in meinen Gedanken. Ein junges unerfahrenes Kind. Bei den Tachen. „Wie lange arbeitest du denn schon für die Tachen … für uns?“ Er zuckte nur leicht mit den Schultern. „Seit einem Jahr, vielleicht zwei. Weiß ich nicht genau.“ „Was ist mit deiner Mutter?“ „Weiß ich nicht.“ „Und mit deinem Vater?“ „Ist gestorben, als ich sieben war.“ „Was ist mit Freunden?“ „Was?“ „Freunde? Hast du irgendwelche Freunde?“ „Ich hatte mal einen. Aber der musste Silbermünzen schlucken. Hat sich verschluckt.“ Ich runzelte die Stirn und hoffte innständig, dass mein Verdacht sich als falsch herausstellte. „Silbermünzen? Schlucken?“ „Ja, sonst hätte ihn ja jemand auf dem Weg überfallen können, ihn ausrauben. Das wollten die nicht zu lassen.“ „Wer?“ „Die Tachen.“ „Natürlich, die Tachen...“ Plötzlich hörte ich Schritte. Gehetzt blickte ich mich um. Mir musste etwas einfallen. Und zwar schnell. Ich hatte jetzt nicht nur einen Menschen zu beschützen. Jetzt waren es schon zwei. „Wieso muss dieses Weib überhaupt meine Schultern belasten? Sie müsste wie ein Hund vor mir laufen, nicht wie eine eingebildete Göre von mir getragen werden“, hörte ich Ranos Stimme nörgeln. „Rano!“, rief Mirin. „Komm zurück. Hier liegt ein Sack rum. Steck sie da rein.“ Sein dreckiges Lachen hallte durch die Gegend. „Die Leute sollten keine nackte Ware sehen.“ Angewidert verzog ich den Mund und drehte mich zu dem Jungen um, der mich immer noch verwirrt anstarrte. Ich nahm ihn an den Schultern und schaute ihm tief und fest in die Augen. „Siehst du das Zelt dahinten?“, flüsterte ich und der Junge folgte meinem Blick. „Ja, genau das. Ich will, dass du jetzt dahin läufst – leise dahin läufst – und dich versteckst. Und komme nicht heraus, bis ich dich rufe. Alles klar? Wie heißt du?“ „Malik.“ Malik, sein Name war alt. Sehr alt sogar. Genauso wie meiner. Ich fragte mich, in welcher Familie er aufgewachsen war. „Malik, hast du vielleicht ein Messer bei dir?“ Er nickte, holte das Messer hervor und legte den Griff in meine Handfläche. „Ich werde dich rufen, in Ordnung? Und bis dahin bist du leise und sitzt still hinter diesem Zelt, ja?“ Wieder nickte er, diesmal etwas überfordert, wahrscheinlich von der Situation, in der er sich gerade befand. Vielleicht verstand er, dass ich kein Tach war. Vielleicht verstand er, dass ich seine Rettung war. Vielleicht verstand er, dass er mir vertrauen konnte. Vielleicht verstand er aber auch gar nichts. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass der Junge genau meinen Anweisungen folgte, und leise hinter dem Zelt verschwand. Und ich wusste, dass er mir kurz davor einen erschrockenen Blick zuwarf und auf etwas hinter mir deutete. Dann war er weg. Und es wurde totenstill. Zeltplanen hörten auf zu flattern, Sandkörnchen rollten nicht mehr über den trockenen Boden. Nichts bewegte sich. Kein Wind. Wo blieb der Wind? Und wenn es keinen Wind gab, wieso spürte ich dann einen warmen Luftzug in meinem Nacken? Toll, dachte ich. Der Typ steht jetzt hinter meinem Rücken und kann mir jeden Moment ein Messer sonst wohin stechen. Das Schicksal wollte mir wirklich keine Zeit zum Nachdenken geben. Würde ich eine Sekunde zögern, war alles verloren. Es würde keinen Kampf geben, nein, dazu brauchte man den Abstand zueinander, um seinen Gegner genauer abwägen zu können. War er groß oder eher klein? War er hager oder muskulös? Arbeitete er besser mit den Fäusten, oder war er flink? Da ich seinen Atem in meinem Nacken spürte, musste er ungefähr so groß sein wie ich. Das Schlimmste an der ganzen Situation war, dass der Mann hinter mir die besseren Chancen hatte, mich zu beurteilen. Das bedeutete, ich musste schnell und unerwartet für einen Jungen meines Alters – war er ein kluger Kämpfer, würde er nach seinem Einschätzen wissen, dass ich natürlich unerfahrener war als er – handeln. Ich zwang mich zur Ruhe. Atmete ein und aus … schellte herum und rammte dem Mann das Messer ins Herz. Völlig erschrocken riss er seine Augen weit auf und stand wie erstarrt da. Dann plumpste der Sack in seiner Hand zu Boden und er fiel um. Das … ging ja wirklich sehr schnell. Ich stand noch einige Sekunden geschockt und etwas unschlüssig da, vor mir ein Mann, der von einem auf den anderen Moment zu einer Leiche wurde, und neben mir ein Sack, in dem vermutlich die bewusstlose Frau lag. Ich vermutete, dass er sich an mich herangeschlichen hatte, mich zu Tode erschrecken, vielleicht etwas herablassendes sagen und mich dann umbringen wollte, wer weiß. Die Tachen spielen gerne mit ihren Opfern hatte meine Mutter mir einmal erzählt. Wirst du irgendwann einem begegnen, bedenke das. Und spielen sie unehrenhaft, spielst du unehrenhaft. Nur dann ist das Spiel gerecht. Unehrenhaft? Gerecht? Bis heute kann ich nicht verstehen, was sie damit meinte. Wie man das Wort unehrenhaft und gerecht auf diese Weise miteinander vergleichen kann. So sah meine Mutter das Ganze. So sahen viele das Ganze. Ich dagegen konnte es immer noch nicht verstehen. Nicht, wenn ein Toter und eine Halbtote vor mir lagen. War es denn dann noch als Spiel zu betrachten? Ein unfaires Spiel? Aber musste ein Spiel denn nicht fair sein? Wenn man ehrenhaft spielte, spielte man gerecht. Wenn man unehrenhaft spielte, spielte man ungerecht. Eine ganz einfache Formel, die jedes Kind versteht. Wie sollte man denn unehrenhaft gerecht spielen können? Ich hatte bis dahin noch nie jemanden umgebracht. Ich dachte, mein Herz würde nie wieder aufhören, so schnell zu rasen, dass ich nie wieder aus meiner Starre herauskommen würde. Nur langsam bewegte ich meinen Kopf, blickte hinunter zu dem blutigen Messer, dessen Griff ich so fest hielt, als könnte mein Leben davon abhängen. Obwohl alles, was ich in dem Moment wollte, war, das Messer im weiten Bogen wegzuwerfen und nie wieder einen todbringenden Gegenstand anzufassen. Meine Handknöchel traten weiß hervor und mein Arm begann leicht zu zittern. Aber es war noch nicht vorbei. Da war noch einer. Und auch ihn musste ich ausschalten. Das wäre doch nur gerecht … oder? Ich stand da, zwang mich wieder zur Ruhe. Das Zittern hörte auf. Mein Herz schlug dafür noch schneller. Ich hatte das Gefühl, keine Luft in die Lungen zu bekommen. Aber ich würde es durchstehen müssen. Noch einmal, und dann nie wieder, dachte ich. Und dann hörte ich wieder Schritte. Tipp, tapp, tipp, tapp. Sie waren langsam, gemächlich, als hätte der Läufer alle Zeit der Welt. Ich drehte mich um und wartete und zählte. Eins, zwei… Ich zählte die Schritte … drei, vier…Wie lange würde Mirin oder Rano – wen auch immer ich gerade nicht umgebracht hatte – wohl brauchen … fünf …wenn man doch alle Zeit der Welt hatte? … sechs …Aber die Strecke nicht lang war? … sieben, acht …Nicht lang. Neun. Ich schaute den Mann an, den Perversling, der mir nun gegenüber stand. Ich schaute auf seinen Gesichtsausdruck, der von Überrascht, zu Unglauben, zu Verwirrung, und dann schließlich zu Zorn wanderte. Er beobachtete mich genau aus seinen schmalen Augen, taxierte mich. Ließ sich Zeit. Dachte nach. Dann nahm er eine angespannte Kampfhaltung an. Und verzog seine Lippen zu einem zahnfletschenden Lächeln, das wie eingefroren einige Sekunden auf seinem Gesicht prangte. Und dann fragte er mich: „Neun?“ Mit einem leichten Nicken, verborgener Beschämung, meine Angst praktisch laut ausgesprochen zu haben, und einem Wort, sagte ich: „Neun.“ Dann stürzte er sich auf mich. Sein Angriff erfolgte mit solcher Wucht, dass ich sekundenlang den Boden unter den Füßen verlor und der Länge nach hinfiel. Er hatte mir den Kopf in den Brustkorb gerammt, und ich schnappte nach Luft. Dann rappelte ich mich auf, bereit zurückzuschlagen, als etwas Metallisches im Sonnenlicht aufblitzte und auf mich runtersauste. Meine Augen weiteten sich vor Schreck und ich keuchte auf, als das Messer mich nur um einige Millimeter verfehlte, stolperte nach hinten und begann zu rennen. Weg von der Schubkarre, weg vom Zelt, hinter dem sich Malik versteckte, weg von der Leiche und von dem Sack, in dem die Frau lag. Nur weg. Allem Anschein nach wollte Mirin – ich erkannte seine Stimme, als er mir die Ein-Wort-Frage stellte – mir keine Zeit zum Nachdenken geben. Er würde sich weiterhin pausenlos auf mich stürzen, bis ich zu müde oder zu geschafft dafür sein würde, seinen Schlägen und seinem Messer auszuweichen. Also verschaffte ich mir eben Zeit. Ich rannte und dachte. Versuchte, mich gleichzeitig auf den Weg vor mir und auf meinen Überlebensplan in meinem Kopf zu konzentrieren, eine keinesfalls leichte, miteinander kombinierbare Sache. Als ich dann soweit war, meinen Plan in die Tat umzusetzen, war ich schon am Rande der Firots angelangt. Wie lange war ich gerannt? Scheinbar eine halbe Ewigkeit. Ein paar vereinzelte Zelte standen in der Gegend und drehte man sich einmal um, so würde man die scheinbar endlosweite Halbwüste erblicken. Schweißtropfen liefen über meine Schläfe zum Hals und verschwanden dann unter meinem alten Hemd, schlossen sich den anderen Tropfen an, die den Stoff an meinem Körper kleben ließen. Alles um mich herum schien mir auf einmal verschwommen, so, als würde ich unter einer Wasseroberfläche nach oben ins Freie starren. Und dann ließ ich mich kraftlos zu Boden fallen, meine Muskeln erschlaffen, meine Augen zufallen. Ich hörte keine Schritte mehr hinter mir, aber ich wusste, sie würden noch kommen. Dann wartete ich, dankbar für die kurze Pause, die ich mir verschafft hatte. Ich drehte meinen Kopf, der ein leises Rascheln im Sand verursachte, drehte ihn solange, bis mein Ohr auf den Boden gepresst war. Keine Schritte. Nichts. Als würde die ganze Gegend in einem dichten Vakuum versinken. Ich wartete noch eine Weile. Noch eine ganze Weile. Als nichts geschah, beschloss ich mich aufzurichten. …Und dann sah ich ihn. Wie er mit genauso sicheren Schritten wie vorhin auf mich zukam. Er sah mich aus seinen schmalen Augen an, und verzog den Mund, als wäre ich etwas Erbärmliches, das seine Aufmerksamkeit und seine Kräfte nicht einmal wert war. Und trotzdem: In seinem eisernen Blick sah ich Wut. Eine Menge Wut. Aber kein Gefühl von Verlust. Keine Trauer um seinen Freund, seinen Kameraden, oder wie auch immer seine Beziehung zu Rano gewesen war. Ich sah nur den Zorn. Und den sollte ich zu spüren bekommen, ganz gewiss. Ich wischte den Schweiß von meiner Oberlippe, der sich in den letzten paar Sekunden gebildet hatte. Verdammt, er war stark. Sehr stark sogar. Aber nicht unbesiegbar, sagte ich mir, wankte rückwärts, stolperte, und fiel hin, wobei mein Kopf hart auf dem Boden aufschlug. Sofort schnellten meine Hände zu meinem Fuß, er könnte ja umgeknickt sein, als ich hinfiel. Meine Sicht vernebelte sich, als ich die Beine des Mannes immer näherkommen sah, und ich packte meinen Fuß stärker, vielleicht ja aus Angst, vielleicht aus reiner Verzweiflung, vielleicht aber auch einfach nur, weil ich irgendeinen Halt brauchte und am Boden keinen fand. Starke Hände ergriffen mich von hinten und hoben mich hoch. Ich spürte Mirins Finger, jeden der zehn, die sich an meine Schultern krallten, sich in sie bohrten, und an diesen Stellen Wunden hinterließen. Sein übelerregender Atem streifte meinen Nacken, so hoch hatte er mich gehoben. Ich stand immer noch nicht auf meinen Beinen; sie hingen kraftlos von mir herab, als würden sie mir nicht gehören, als wären sie kein Teil von mir, und meine Füße strichen schlaff über den Boden. „Hast du irgendeine Ahnung, was du da gerade angerichtet hast?“, fragte mich Mirin mit einer bedrohlich ruhigen Stimme. Ich öffnete den Mund, doch als ich erkannte, dass ich nicht wirklich eine Antwort darauf wusste, oder sie mir gerade nicht einfiel, beschloss ich, einfach ruhig zu bleiben und gar nichts zu sagen. „Nein, hast du nicht“, beantwortete er seine eigene Frage für mich. „Dann bin ich mal so nett, und fasse es kurz für dich zusammen: Du hast meinen … kleinen Helfer was weiß ich wohin verschleppt, der dafür zuständig gewesen war, unser Opfer unauffällig in sichere Hände zu befördern, hast einen der besten Kämpfer bei den Tachen in wenigen Sekunden erdolcht, den ich für meine Zwecke gebraucht habe und ohne den ich wahrscheinlich meine Arbeit verlieren werde, hast mit dieser Tat nicht nur die nötigsten Vorbereitungen für das wichtigste Ritual des Jahres behindert, nein, du hast sogar wahrscheinlich mein Todesurteil unterschrieben. Also, kannst du mir nun erklären, wieso so ein nichtsnutziger, dreckiger Feigling wie du, der sich in die Hosen pisst, wenn er sich einem wahren Kämpfer gegenübersieht, und dann wie ein verängstigter Hase um sein Leben rennt, auf die Idee kommt, mein Leben kaputt zu machen?“ Seine Stimme war von Satz zu Satz lauter geworden, aggressiver. Es wunderte mich, dass mich seine Worte kein bisschen trafen. Keine Schuldgefühle kamen in mir auf. Und dafür, dass ich hilflos über dem Boden hing, fühlte ich fast keine Hilflosigkeit, nur aufsteigende Wut. Alle meine Gefühle verschmolzen miteinander, entwickelten sich zu einem Ganzen. Vor meinem inneren Auge entstand eine Gleichung. Hilflosigkeit, Todesangst, Beschützerinstinkt, Schmerzen, das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. All das wurde zu einem: Zorn. Unglaublicher Zorn. Wie konnte dieser egoistische Dreckskerl, der Frauen verstümmelte und ermordete, der Kinder misshandelte und lebensgefährliche Sklavenarbeit für sich erledigen ließ, der kaltblütig über Leichen gehen würde, um sein eigenes Ziel zu erreichen … wie konnte dieser Kerl sich für so wichtig halten, mir vorwerfen, dass ich, ein dreckiger Feigling, der sich in die Hosen pisst, sein Leben kaputt gemacht hätte, nachdem er doch so viele Leben nach stundenlangen Quälereien unverschont ließ? Wie konnte dieser Mensch von sich behaupten ein wahrer Kämpfer zu sein? Ich kannte wahre Kämpfer! Mein Vater war einer. Ehrlich, mutig und hilfsbereit. Das war ein wahrer Kämpfer. Nicht der Mann, der hinter mir stand und mich über dem Boden schlabbern ließ. Mein Hals begann zu brennen, ich konnte es nicht mehr aushalten. Dieser Mann hier warf mir vor, sein Leben zu zerstören, dabei hatte er es doch sich selbst zuzuschreiben, dass er hier stand und für die Tachen arbeitete. Ich konnte nicht verstehen, was das alles sollte: er hielt mich fest, schleifte mich über den Boden, aber diese Demütigung reichte ihm noch nicht? Da konnte er sich auf etwas gefasst machen! Ich umfasste das blutverklebte Messer, das ich unter meinen Ärmel geschoben hatte, fester. Als der Mann bei mir ankam, dachte er wahrscheinlich, ich sei wehrlos. Ich hatte gar nichts in der Hand, war umgefallen, als wäre ich ein Schwächling, dem die ganze Situation ausweglos erschienen war. Dabei hatte ich das Messer die ganze Zeit in meinem zerflederten Stiefel versteckt und es dann unauffällig rausgezogen, als ich vorgab, Schmerzen in meinem Fuß zu haben. Mirin wirbelte mich herum, als wäre ich eine große Stoffpuppe, die man von allen Seiten betrachten konnte. Er packte mich am Kragen und zog mich so nah zu sich heran, dass ich seine gelblichen Zähne und seine grauen Augen, die die Grimasse, die er schnitt, besonders zur Geltung brachten, von Nahem betrachten konnte. Kein schöner Anblick. Eine Person mehr auf seiner Liste, die er zu den Gequälten zählen konnte. „Dachtest du wirklich, dass ich nach einer solchen Demütigung kampflos aufgeben würde?“ Langsam verzog ich meine ausgetrockneten Lippen zu einem schiefen Lächeln. Dann antwortete ich. „Dachtest du wirklich, dass ich kampflos aufgeben würde?“ Zum zweiten Mal an diesem Tag schnellte meine Hand nach vorne, um zuzustechen. Zum zweiten Mal an diesem Tag kam mein Angriff überraschend. Zum zweiten Mal an diesem Tag versuchte ich jemanden zu erstechen. Zum ersten Mal in meinem Leben hoffte ich, dass ich mein Ziel auch wirklich treffen würde. Sein Blut spritzte auf mein Hemd, als die Klinge über seinen Bauch schnitt. Sofort ließ er mich los, strauchelte rückwärts und verzog sein Gesicht zu so etwas wie Entsetzen, Panik und Verständnislosigkeit. Als hätte er es für unmöglich gehalten, überhaupt einmal von jemandem verletzt zu werden. Als dachte er, er wäre unbesiegbar. „Was hast du getan?“, flüsterte er ungläubig, und ich wich ihm aus, als er auf mich zustolperte. Gleich darauf keuchte er laut vor Schmerz und ließ sich auf die Knie fallen. Sein Rücken verkrümmte sich und er begann zu zittern. Dann sah er mit aufgerissenen Augen und gebleckten Zähnen wieder zu mir auf, voller Hass und Mordlust. „WAS HAST DU GETAN!?“ Ich musste mir entsetzt ansehen, wie Blut aus seinem Mund quoll und sein Kinn runterlief. Und dann wurde es mir zu viel. Ich drehte mich auf dem Absatz um und rannte wieder zurück in die Firots. Als ich zurück zu dem Platz fand, an dem ich den ersten Mord in meinem Leben beging, war Ranos Leiche nicht mehr da. Der Sack, in dem die Frau liegen müsste, war leer. Ich sah mich um. Die Abendsonne hatte die Gegend der Alten in ein warmes rotes Licht getaucht und nun sah ich auch Menschen die Straßen entlanglaufen, miteinander lachen und reden. Als wäre nichts passiert. Als wären die Tachen gar nicht hier gewesen. Woher kamen denn die ganzen Menschen auf einmal wieder? Wieso war die Stimmung so fröhlich? Wie lange war ich denn überhaupt weg gewesen? Es mussten Stunden sein. Ich wettete, Malik war schon längst über alle Berge. Er war frei. Aber durch mich hatte er kein richtiges Zuhause mehr. Ich fragte mich, was er in diesem Moment wohl gerade tat. Wahrscheinlich schlich er herum, erkundete neue Wege, suchte nach jemandem, der ihm etwas zu Essen geben würde. War es denn fair, dass ein Junge, der jahrelang die Drecksarbeit für die Tachen leistete und auf einmal seine verdiente, grenzenlose Freiheit bekam, plötzlich obdachlos war? Welche arme Familie würde ihn denn noch aufnehmen, bei den Bedingungen, mit denen wir hier lebten? Ich schüttelte den Kopf; ein Versuch, auf andere Gedanken zu kommen. Mein Wäschekorb. Wo stand er gleich nochmal? Ich ging zu dem Zelt, von wo die Frau entführt werden sollte, aber er war weg. Alles weg. Ich fasste mit beiden Händen an den Kopf. Meine Mutter würde mich umbringen … Also, nicht wirklich umbringen, aber wahrscheinlich würde sie sehr enttäuscht sein. Sie hatte sich auf mich verlassen und ich hatte es vermasselt. Ich war eine einzige Enttäuschung für meine Familie, aber das wurde ja bereits laut von meinem Stiefvater ausgesprochen, als meine Mutter gerade nicht da war. Von daher war es nichts Neues. Als ich gerade dabei war, zu verschwinden, tippte mir jemand an die Schulter, aber ich musste mich gar nicht erst umdrehen, denn die junge Frau kam um mich herum und stellte sich mir direkt in den Weg. „Guten Abend“, sagte sie freundlich lächelnd, und ich fragte mich, womit ich mir das verdient hatte. „Ähm, hallo“, kam es mir ein wenig unsicher über die Lippen. In den Firots war es ungewöhnlich, dass wir Fremde einfach so auf der Straße ansprachen, deshalb verwirrte es mich ein kleinwenig. Und dann folgte ein sehr langandauerndes Schweigen, von Beginn an unangenehm für mich, aber wohl nicht für die Frau vor mir, denn sie strahlte mich mit einem Lächeln an, das sogar die Sonne schwach aussehen lassen würde. „Ist was?“, fragte ich schließlich. „Oh, ja … Entschuldigung, ich … ähm, ist das dein Korb?“ Sie hob ihn mir plötzlich direkt vor die Nase, und ich wich instinktiv aus. Sofort zog sie ihn an ihre Brust, als wäre es eine Waffe, die sie ausversehen auf mich gerichtet hatte. Und ehrlich gesagt, in den letzten paar Stunden hatte ich mich schon daran gewöhnt, die ganze Zeit einer Gefahr ausgesetzt zu sein. Von daher war es mir nur recht, wenn sie mir nicht gleich alles vor mein Gesicht hielt. Ich betrachtete den Korb, den ihre kleinen Hände fest an sich pressten. Und tatsächlich: Es war meiner. Meine Miene hellte sich mit einem Mal auf. Wenigstens etwas Gutes heute. „Ja“, antwortete ich überrascht und etwas erleichtert und bekam den Korb nun gegen meine Brust gepresst. Diese Frau war wirklich sehr stürmisch. „Ich wusste es, als du vor meinem Zelt rumgelungert bist. Du hast mich gerettet, oder? Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich mir da ein paar Sachen herausgenommen habe. Die Männer haben meine alle verbrannt.“ Ich betrachtete die Frau, die unentwegt geschrien hatte, als die Männer versuchten, sie ruhigzustellen, dass sie sogar mehrere hundert Meter entfernt zu hören war. Ja, das würde wirklich zu ihr passen. Eine verrückte, aber andererseits auch mutige Frau, die nicht die Hoffnung aufgab, dass in den menschenleeren Straßen vielleicht doch jemand war, der sie retten könnte. „Äh, ja natürlich. Schon in Ordnung.“ Dann wurden wir von einer dahergelaufenen Gruppe überrascht, die lauthals lachend an uns vorbeiging. Ich beobachtete die Gruppe die ganze Zeit, bis sie irgendwann aus meinem Sichtfeld verschwanden. Dann wandte ich mich wieder an die junge Frau. „Weißt du, wieso diese Leute hier alle so … so fröhlich sind?“, fragte ich leicht verwirrt und erstaunt. Soweit ich weiß, hatte ich in meinem Leben noch nie so strahlende Gesichter gesehen. Nicht im Zentrum der Firots, nicht bei meinen Freunden und auch nicht Zuhause in unserem kleinen Karton. Sie schaute mich verdutzt an. „Was? Wie meinst du das?“ Und da erkannte ich, dass diese Frau mich nie verstehen würde. Egal, wie gleichgestellt wir alle auch waren, die Firots waren riesig. Und in viele kleinere und größere namenlose Gebiete aufgeteilt. Meine Gegend war eine der größten. Menschen kamen dort zusammen, die oftmals unfreundlich einem gegenüber waren, an ihr Überleben und ihre Familie dachten, und meistens in ihrer Trauer und ihrer Wut auf Malira, die Tachen oder andere versanken. Die Stimmung dort war erbarmungslos erniedrigend. Hier war es völlig anders. Sie waren freundlich zueinander. Lachten, trotz der Probleme und Armut, in der sie Lebten. Ich erkannte, dass die Leute hier versuchten, das Leben so gut es ging zu genießen. Sie machten das Beste daraus. Und verdienten sich damit meinen Respekt. Ich fragte mich, ob es in anderen Gegenden vielleicht auch so etwas wie Lebensfreude gab. „Nichts. Ich habe nichts gemeint.“ „Aha, nichts also, ja? Na gut, dann sag es mir eben nicht. Ist ja dein eigenes Geheimnis und du hast das volle Recht darauf, es für dich zu behalten. Du musst es mir nicht sagen. Wirklich nicht. Ich will dich ja nicht stören oder sowas. Lag gar nicht in meinen Absichten, nein.“ Leicht eingeschüchtert über das Plappermaul, das die Frau da hatte, drehte ich den Kopf weg. Ich war es nicht gewohnt, dass jemand so direkt war. „Ja … alles klar.“ Sie sah mich noch einige Sekunden an, dann seufzte sie und ließ ein klein wenig die Schultern hängen. „Tut mir leid. Weißt du, ich bin vor einigen Jahren hier hergezogen. Ich hatte davor ein Gespräch mit einem der Alten. Er hatte gesagt, ich wäre eine der Wenigen, bei der er eine unmittelbare, einzigartige, ungebändigte Energie spürte. Aber ich bin nun mal nicht sehr geduldig und oftmals irgendwie nervös oder neugierig oder sowas. Auf jeden Fall denke ich, dass er vielleicht damit gemeint haben könnte, dass ich möglicherweise eine der Alten werden würde. Ich glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher. Was soll‘s. Ich bringe mir gerade ein wenig Disziplin bei und so.“ Ich nickte einfach nur, um nichts Falsches zu sagen. Das mit der ungebändigten Energie, die sie ausströmte, konnte ich ganz gut nachvollziehen. „Eine Frage noch.“ Sie ließ mir nicht einmal eine Atempause, bevor sie weiterredete. „Was hattest du hier zu suchen?“ Augenblicklich fiel mir meine Aufgabe wieder ein. Die Wäsche hatte ich nicht umsonst hierher getragen. „Tante Beth“, antwortete ich. „Ich wollte zu Tante Beth.“ „Ach so! Na dann, folg mir. Ich werde dich zu ihr hinbringen.“ Ein wenig dankbar und überrascht über ihre Hilfsbereitschaft, ging ich ihr hinterher. Bei mir würden die Leute wahrscheinlich eine einfache grobe Wegbeschreibung geben und der Arme müsste dann ein paar Stunden herumirren, bis er endlich den richtigen Ort gefunden hätte. In meinem Kopf bildete sich eine wichtige Frage, die unausgesprochen und unbeantwortet war. „Wo wart ihr alle? Als ich gekommen bin, war die Gegend hier menschenleer.“ Ein selbstfälliges Lächeln erschien auf ihrem Gesicht, als sei sie stolz darauf, dass sie etwas wusste, von dem ich keine Ahnung hatte. „Das liegt daran, dass heute der Tag des Garin ist. Genau heute vor ein paar Millionen Jahren…“, aha, „brachte der, der zuständig für Licht und Finsternis, die Sonne zur Erde und erhellte uns Menschen den Weg in die Welt“, zitierte sie. „Siehst du, wie schön die Gegend der Alten heute im roten Licht der Sonne erstrahlt, wie sie alles in eine kraftgebende Farbe taucht und uns Hoffnung bringt? Nur einmal im Jahr erscheinen uns die Sonnenstrahlen in dieser Röte, in dieser Intensivität. Nur einmal im Jahr verlieren wir uns in dieser Farbe, baden im Licht der Sonne, um sogar die am tiefsten in uns sitzenden Sorgen auszuwaschen und das Jahr von vorn zu beginnen. Deswegen waren die Alten auch weg, und nahmen ihre Helfer mit. Sie waren zum Sonnenritual hinaus in die weite Wüste gezogen. Ich hatte gehört, es soll wunderbar gewesen sein. Sie haben gesungen, getanzt und dabei den Sand aufgewirbelt, sodass die winzigsten Körnchen hoch in die Lüfte stiegen. Damit wollen sie Garin zum Dank für das Licht und die Finsternis, sozusagen die Hand reichen, verstehst du?“ Nachdenklich nickte ich. Eine schöne Vorstellung, in gewisser Weise naiv, da sie an diese Götter und das Ganze glaubten, aber schön. Wie befreiend müsste sich so etwas denn anfühlen? „Und warum warst du nicht dabei?“ Sie zuckte mit den Schultern. „Ich … Ich hab … hab es irgendwie verplempert.“ Oh, na gut. „Wir sind da.“ Dann drehte sich die junge Frau um und ging einfach. Ich wusste nicht einmal ihren Namen. Sie war schon längst verschwunden, als ich aus meiner Starre erwachte. Manche Menschen würde ich wohl nie verstehen können. Ich schob einen Teil der Zeltplane beiseite, und betrat Tante Beths Behausung. Es war klein, aber gemütlich. Sie hatte ein Bett und einen relativ stabilen Schrank. Sogar ein eingerahmtes altes Gemälde stand in ihrem Zimmer, etwas, was nur die wohlhabendsten der Firots besaßen. Oben an der Zeltplane gab es ein ausgeschnittenes Loch, das das rote Licht der Sonne ins Zelt einfallen ließ und groß genug war, um nicht anzubrennen, wenn der Rauch eines Feuers aufstieg. Mir lief das Wasser im Mund zusammen, als ich daran dachte, was für warme Speisen man mit einem solchen Feuer zubereiten konnte. Ich sah sie, wie sie auf ihrem gebrechlichen Bett saß und irgendetwas strickte. Sie wandte sich nicht von ihrer Strickerei ab, jedoch ahnte ich, dass sie sich über meine Anwesenheit im Klaren war. Und ich wollte sie unter keinen Umständen ablenken. Also stellte ich den Korb ab … und wartete. Ich wusste nicht, wieso ich warten wollte, aber das schien mir irgendwie angemessen zu sein. Ich wartete und die Zeit schien sich endlos dahinzuziehen, und die Alte sah immer noch nicht auf und sagte auch nichts, das mich gehen lassen ließ, als würde sie wollen, dass ich dablieb. Ich beschloss, mich auf den Boden niederzulassen, zog meine Beine an sich und legte mein Kinn auf die Knie. Dann wartete ich nochmal eine halbe Ewigkeit, während die Sonne immer weiter versank und es im Zelt immer dunkler wurde. Irgendwann schloss ich die Augen, ich würde wohl ein Nickerchen machen müssen. Ich fragte mich, warum ich nicht einfach ging, aber irgendwas schien mich festzuhalten und zu sagen Nein, du musst dableiben. Also hörte ich auf dieses Etwas und blieb. Irgendwann spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Als ich aufsah, stand Tante Beth vor mir und bedeutete mir mit einer Handbewegung, aufzustehen. Gleich darauf erhob ich mich und verbeugte mich leicht vor ihr. Von meiner Mutter wusste ich, dass es ein Zeichen des Respekts gegenüber den Alten war. Tante Beth war ziemlich schmächtig und klein und sah geradezu gebrechlich aus. Ihre warmen braunen Augen spiegelten Traurigkeit und endlos schwere Erfahrungen wider. Jedoch wiesen die ausgeprägten Lachfältchen an ihren Augen darauf hin, dass sie auch glücklich gewesen war und zuvor wahrscheinlich sogar ein fröhliches Leben geführt haben könnte. „Wie ist dein Name?“, fragte mich die Alte mit ihrer bebenden Stimme und ich antwortete ohne zu zögern. „Jasper. Ich … Ich bin hier, um Ihnen Ihre Kleidung zu bringen. Meine Mutter hat sie für Sie gewaschen.“ Ich übergab ihr den nun halbvollen Korb mit der Kleidung, ohne zu vergessen, das Wichtigste zu erwähnen. „Sie müssen wissen, dass Sie wahrscheinlich ein paar ihrer Kleidungsstücke nicht mehr vorfinden werden. Wissen Sie, vorher, als Sie und die anderen aus ihrem Gebiet in die Wüste zogen, für ihr Ritual, ist hier etwas passiert. Aber wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich nicht genau darauf …“ Mit einer erneuten Handbewegung brachte sie mich zum Schweigen. „Ich danke dir, Jasper, dafür dass du den Weg auf dich genommen hast, um zu mir zu kommen. Ich hatte dich erst morgen erwartet, aber da du ja schon mal da bist, kann ich es dir schon heute zeigen.“ Sie ging hinaus und ich folgte ihr mit einer gerunzelten Stirn. „Was denn zeigen?“ Eine andere Frage fiel mir ein. Sie hatte mich erwartet? Aber da kam mir der Gedanke, dass meine Mutter ihr wahrscheinlich gesagt haben könnte, dass ich kommen würde. „Das wirst du schon sehen.“ Und dann schritt sie los und ich verstand, dass ich mit ihr gehen musste. Nach einer Stunde des Schweigens und des Scharrens unserer Füße auf dem Boden, erreichten wir (ich heute zum zweiten Mal) den äußerten Rand der Firots. Ich sah wiedermal die endlose Weite der Halbwüste vor mir. Aber anstatt stehen zu bleiben oder umzukehren, ging Tante Beth einfach weiter. „Wartet!“, rief ich ihr hinterher. Ich war noch nie außerhalb der Firots gewesen und wollte auch, ehrlich gesagt, meine Heimat nicht verlassen und dort draußen verrecken. Die Wüste war eine der wenigen Dinge, die mir wirklich Angst machten. Unglaubliche Angst. Bei der Vorstellung, ohne Wasser in dem Meer aus Sand zu verrecken, wurde mir schlecht. Ich wollte da auf gar keinen Fall hinauslaufen, wie ein Lamm, das seinem Jäger direkt in die Arme läuft. „Überwinde deine Angst, mein Kleiner. Die sitzt in dir fest verankert. Verschaff dir Klarheit darüber und lass sie dann los. Und wenn es dir hilft: Ich kenne den Weg zu dem Ort, an den wir gehen, in und auswendig … ich werde ihn nie vergessen können.“ Wieder tauchten Fragen auf, aber die würde ich wohl von Zeit zu Zeit beantwortet bekommen. Ich sollte einer der Alten vertrauen. Meine Mutter tat es, ihre Bekannten taten es, die halben Firots taten es. Und ich sollte es auch tun. Dann trat ich hinaus … naja, nicht nach draußen, da war ich ja schon. Eher trat ich hinaus, über die Grenze der Firots, über die Grenze meiner Ängste, in das in der Dämmerung liegende, weite Gebiet der Wüste. Wir gingen in einem gemächlichen Laufschritt; nicht zu schnell, nicht zu langsam. Vor mir sah ich nichts als harten sandigen Boden. Ich hatte keine Vorstellung davon, an welchen „Ort“ in dieser Wüste sie mich hätte bringen können. Und zu meinem Unbehagen wurden die letzten Zelte am Rande der Firots immer kleiner und kleiner, bis sie so winzig waren, dass ich nichts mehr erkennen konnte. „Wie geht es deiner Mutter, Jasper?“, durchbrach die Alte endlich die Stille und ich merkte aus meiner Angst auf. „Ganz gut, denke ich.“ „Und deiner kleinen Schwester?“ „Auch gut.“ „Wie geht es deinem Vater?“ „Er ist nicht mein Vater“, antwortete ich nach einigem Zögern. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Alte wirklich mit meinen Problemen konfrontieren wollte. „Ach wirklich?“, fragte mich Tante Beth nach einem Zögern ihrerseits. „Wer ist er dann?“ Ich wusste sofort die Antwort auf diese Frage: Stiefvater, Fiesling, Quäler meines Lebens, Teufel … „Ein Fremder“, antwortete ich schließlich und erst da bemerkte ich, wie weh es doch tat, dieses Wort ausgesprochen zu haben. Ja, der Mann, der jeden Tag spät nach Hause kam, der jede Woche mindestens viermal mit uns aß, der Mann, der im Bett an der Seite meiner Mutter lag, der der Vater meiner Halbschwester war, genau dieser Mann war ein Fremder für mich. Er war mein neuer Vater und ich war ein Nichts für ihn. Er fand, ich war nichts wert. Nichts. Wieso sollte ich auch? Ich hatte weder seine Nase, noch seine Augen, noch seine strenge und sichere Art, sich zu präsentieren; ich hatte überhaupt nichts von diesem Mann, der jetzt ein festes Mitglied meiner Familie war. Und er machte mich hinter dem Rücken meiner Mutter zur Schnecke, sagte, ich sei ein wertloses … Ding, zu nichts zu gebrauchen. Er sagte, dass ich Glück hätte, überhaupt geboren worden zu sein und fragte, wie meine Mutter nur bei ihrem eigenen Kind übersehen konnte, wie gering meine Lebenserwartung war. Er hielt mir jeden Tag vor, dass er es kein bisschen verstehen konnte, wie ich der Sohn meiner Mutter sein konnte, die doch so eine wunderbare Frau war. Woher nahm ich die Berechtigung zu leben? Er hatte den Traum, dass der große Konjai ihm sagte, ich würde früh sterben, weil ich ein schrecklicher Mensch sei. Ab da fing ich an, mich zu fragen, was ich denn so Schreckliches in meinem Leben getan hatte. Ich habe immer noch keine Antwort gefunden. Wieso sollte ich denn ein schrecklicher Mensch sein? Ich habe doch gar nichts gemacht! Dieser Mann war sicherlich kein Vater für mich. Er war der Teufel in Person. Ich verstand nicht, was meine Mutter an ihm finden konnte. Er hatte nichts an sich, was mich dazu brachte, ihn liebenswert zu finden. Ich hatte alles versucht, um ihn dazu zu bringen, dass er mich mochte. Ich hatte die ersten Wochen alles getan, was er verlangte. Doch alles, was mir das eingebracht hatte, war weiterer Hohn und Spott. Keine Dank, nicht ein nettes Wort, seit ich ihn kannte. Ich hatte es nicht verdient, dass er mich so behandelte. Er kannte mich überhaupt nicht. Er war bloß ein Fremder. „Scheint, als würdest du dich nicht so gut mit ihm verstehen, nicht wahr?“ Ich nickte, aber ich wusste nicht, ob sie mein Nicken überhaupt gesehen hatte. „Ich hatte auch eine Zeit lang einen Fremden in unserem Haus, als ich bei meiner Mutter lebte. Vielleicht haben wir ja beide eine ähnliche Erfahrung durchmachen müssen, Kleiner.“ Etwas interessiert wandte ich meinen Kopf in ihre Richtung. „Und was haben Sie dann gemacht?“ Ein leises Lächeln schlich sich auf ihre Lippen. „Aufgehört, mir das Geplapper eines Dahergelaufenen anzuhören.“ Auch ich lächelte, aber es erlosch augenblicklich, als ich dachte, wer der Fremde in meinem Haus eigentlich war. Er war nicht irgendein Dahergelaufener. Er war ein Anführer. Einer, der vorhatte, eine von drei großen Gruppen aus freiwilligen Männern unter den Mauern von Malira hindurchzuführen und die Stadt zu erobern. Mehr wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass der Angriff in ein paar Wochen stattfinden würde, aber das war genau das, was jeder Zweite in den Firots wusste. „Er wird eine der Truppen anführen, die bald in Malira einfallen sollen“, sagte ich bedrückt und unglücklich darüber, dass Tante Beths Worte mich nicht trösten konnten. „Er ist ein großer Mann.“ Langsam und nachdenklich schüttelte die Frau den Kopf. „Die wahre Größe eines Menschen hängt nicht von seinem Rang ab, sondern von seiner Achtsamkeit, Großzügigkeit und Dankbarkeit. Ein Mensch, der wütend und nicht dankbar für die Welt ist, in der er lebt, nur die schlechten Dinge im Leben sieht und rücksichtslos andere seinen Zorn spüren lässt, der hat keine Größe. Tatsächlich ist er innerlich in Stücke zerrissen und verliert sich in seiner Wut. Das ist traurig und wir erkennen, wie klein und in sich zurückgekehrt dieser Mensch doch ist. Und wenn wir das begreifen, können wir ihn viel besser verstehen, und uns gleichzeitig emotional gegen unsere Wut auf ihn wehren, und Mitgefühl empfinden, das viel wertvoller ist, als man denkt.“ Grüblerisch starrte ich auf den – wie mir allmählich bewusst wurde – immer fester werdenden Wüstenboden. Und wirklich. Ich begann so etwas wie Mitgefühl für meinen Stiefvater zu empfinden. Wie viel Wut musste man in sich tragen, um einen unerfahrenen, unschuldigen Jugendlichen jeden Tag aus bloßem Zorn und Rücklosigkeit in Grund und Boden zu beschimpfen? Aber war seine Wut auf die Welt denn nicht gerechtfertigt? War nicht jeder aus den Firots über die Umstände wütend, in denen wir leben, oder besser gesagt, überleben mussten? Ich war auch wütend, aber nicht auf die ganze Welt. Ich war wütend auf die Bewohner Maliras. Auf die Regierung Maliras. Auf das Vermögen und die Macht Maliras. Einfach auf alles, was mit Malira zutun hatte. Aber am meisten war ich wütend über die Tatsache, dass uns, die Armen und die Reichen, nur ein langer Spaziergang und ein leichtüberquerbarer Fluss trennte. Es war einfach nicht fair. „Ich kann ihn aber verstehen, Tante Beth“, sagte ich letztendlich ein wenig verständnislos. „Sie etwa nicht? Finden Sie es in Ordnung, dass die dort alles zum Überleben haben, genug zu Essen, genug zu Trinken, genug Heilmittel, genug Bildung, genug Freizeit, genug alles? Sie wissen, wie schlecht es uns hier geht, dass jeden Tag hier hunderte von Menschen sterben, und das es nicht an Altersschwäche liegt. Dass wir tagsüber beinahe verbrennen und nachts vor Kälte nicht aufhören können zu zittern. Aber nein, natürlich helfen sie uns nicht. Sie beobachten unser Elend, unsere Schwäche und fühlen sich dadurch noch stärker, als würden sie sich von unserem Leid ernähren.“ Sie runzelte die Stirn und wandte das erste Mal an diesem Tag ihren Blick vom Weg ab. „So denkst du also?“ „Ja, so denke ich“, sagte ich schließlich nach ein paar Sekunden. Und ich war völlig entschlossen mit meiner Antwort. Ich bekam ein leises Lachen zu hören. „Deine Antwort scheint dir so selbstverständlich vorzukommen, wie der Sand in der Wüste.“ „Ist es das denn nicht?“ „Naja, du hast die Oasen vergessen.“ „Das verstehe ich jetzt nicht.“ „Dann denke darüber nach und finde eine Antwort für dich selbst.“ Ergeben senkte ich den Kopf; wie sollte man denn jemandem seine Meinung klar machen, wenn diese immer auf eine Art und Weise antworteten, die das Ganze nochmal in Frage stellen ließ? Ich sah ein, dass meine Mutter recht hatte: Diese Frau war wirklich … weise. Clever und weise. Aber weise Menschen zu verstehen war irgendwie immer so kompliziert. Ob sie wohl jemals sprachlos gewesen war und nicht wusste, was sie Schlaues zu erwidern hatte? Ich glaubte kaum. Ich betrachtete wieder den Boden unter meinen Füßen … und mir stockte der Atem. Im letzten Licht des Tages konnte ich nun auf der harten festen Fläche erkennen, dass da längst nicht mehr nur Sand und Steinchen den Boden überdeckten. Etwas Schwarzes und pulvriges, das meine teilweise auseinanderfallenden Schuhe schwarz färbte, mischte sich mit dem rötlichen Ton des Sandes und wurden zu einem dreckigen Braun. Erschrocken sah ich auf und suchte mit meinen Augen die Umgebung nach einem Ende dieser ewigen Schwärze ab, aber das einzige Ende, das ich überdeutlich erkennen konnte, war das, an dem ich stand. Oder stand ich erst am Anfang? „Das ist verbrannte Erde.“ Ungläubig schaute ich mit aufgerissenen Augen zu ihr rüber. Das was sie sagte, versetzte mich für kurze Zeit in einen Schockzustand. Verbrannte Erde. Davon hatte ich schon einmal gehört, als ich meinen Stiefvater mit einem der anderen Anführer reden gehört habe. Eine grausame, politische und militärische Kriegstaktik. Uralt und unvergesslich. „Die Schlacht um dieses Stück Land hatte begonnen, da war ich noch ein kleines Mädchen“, begann die Alte zu erzählen. „Noch lange vor meiner Geburt fanden einige Menschen heraus, dass der Wüstenboden nur ein paar Kilometer weiter entfernt fester, stabiler und fruchtbarer war, als der in den Firots oder in Malira. Es war nur ein kleiner Landstrich, eine zu geringe Fläche, um eine Stadt aufzubauen, aber groß genug, um ein Dorf entstehen zu lassen. Die Entdecker dieses Landes behielten das Geheimnis für sich. Sie wollten, dass ihre Familien und die Freunde ihrer Familien überlebten, also begannen sie heimlich mit den Planungen und den Bauarbeiten. Sie bauten Häuser und Straßen, und als die ersten Behausungen fertig waren, begannen sie allmählich, umzusiedeln und einzuziehen. Doch das Ganze wurde nicht mehr so unauffällig, wie sie es sich anfangs vorgestellt hatten. Andere Menschen wurden neugierig, kamen herüber, um zu sehen, was ihre Augen aus der weiten Entfernung nicht erkennen konnten: die Errichtung einer neue Siedlung … viel zu weit in der Wüste und viel zu weit vom Flusswasser entfernt. Sie fingen an, sich zu fragen, was das sollte, fingen an, zu spotten. Wieso sollten denn Menschen im größeren Abstand zum Fluss leben wollen, als sie es eh schon taten? Waren die denn lebensmüde? Das würde nicht lange halten, und dann würden diese alle nacheinander verrecken. Die Menschenmengen verzogen sich und ließen die Einsiedler alleine. Die neuen Bewohner hatten anfangs jedoch nur wenig Versorgung in der trostlosen Umgebung und fragten nach Unterstützung und Hilfe. Diejenigen, die ihnen das Notwendigste geben und ihnen helfen würden, wären eingeladen, später in ihrem kleinen Dorf zu leben. Doch die meisten Leute wanden ihnen den Rücken zu; sie sollten doch selbst mit ihrer schwachsinnigen Idee zurechtkommen. Sie fingen an, den hintersten Teil ihres kleinen Dorfes zu bepflanzen und nach ein paar sehr anstrengenden und harten Jahren hatten sie ihr Ziel erreicht. Alle Bewohner hatten einen stabilen Wohnraum und ausreichend Nahrung, und das jeden Tag. Auch die medizinische Versorgung wurde besser, durch die Heilkräuter, die man angebaut hatte. Jeden Tag wanderten zwanzig Dorfbewohner den weiten Weg zum Fluss hinunter, um Wasser zu holen. Natürlich entging es den Menschen aus den Firots und aus Malira nicht, dass diejenigen, von denen sie dachten, dem Tod ausgesetzt worden zu sein, plötzlich noch lebendiger wirkten, als vorher. Erst in vielen Jahren, als das Dorf gewachsen, die Einwohnerzahl sich vervierfacht hatte und die Bäume in den hintersten Ecken des Dorfes immer höher wurden, kamen die Menschen darauf, diese Siedlung mal wieder genauer zu betrachten. Als sie dann erkannten, wie wertvoll dieser Landstich in Wirklichkeit war, wurden diese wütend. Wie konnten denn diese nichtsnutzigen Leute ihnen gegenüber so rücksichtslos sein? Wie konnten sie so habgierig und egoistisch gegenüber ihrer eigenen Art sein? Sie waren doch alle aus Fleisch und Blut, alle Lebewesen, alle eine große Familie. Der Sohn des Begründers dieses Dorfs, Kitan, traf sich mit einem der Anführer, Zakin, und sagte ihnen, dass die Bewohner sich bereiterklären würden, umzusiedeln, aber nur unter der Bedingung, ihre Kranken und Alten dort wohnen zu lassen. Außerdem verlangte er auch sonst, dass nur Menschen mit gesundheitlichen Problemen dort wohnen durften und es nur einen Zutritt für Heiler und Helfer gab. Es könnten mehr Menschen von ihren Krankheiten geheilt werden, viel mehr Geburten würden erfolgreich verlaufen, viel mehr Alte würden einen friedvollen Tod finden und die Sterberate würde endlich sinken. Jedoch schlug Zakin den Vorschlag ab, mit der Begründung, dass es ein viel zu großer Aufwand wäre, alle Alten und Kranken in die kleine Siedlung zu befördern. Am besten wäre es doch, diejenigen dort wohnen zu lassen, die am meisten für das Allgemeinwohl taten, die, die einen hohen Rang besetzten. Nur das wäre wirklich gerecht. Damit ließ sich Kitan jedoch nicht überzeugen, und brach die Verhandlung ab. Darauf ließ Zakin die restlichen Anführer zu sich kommen, um zu besprechen, welche Maßnahmen sie nun ergreifen würden. Einer von ihnen, Faga, ein alter rachsüchtiger Mann, der vor vielen Jahren einen schlimmen Streit mit Kitans Vater gehabt hatte, schlug vor, in dieser Siedlung ein größeres Massaker zu verüben, um die restlichen Dorfbewohner zu verjagen und das Gebiet einzunehmen. Sie würden die hundert Stärksten und Cleversten ihrer Männer anheuern, um jeden Bewohner ausnahmslos umzubringen. Am übernächsten Tag fand die Schlacht um den kleinen Landstrich statt. Unvorbereitet trafen die Dorfbewohner auf die Angreifer, wehrten sich mit allen Mitteln. Kinder und Frauen, Alte und Kranke wurden erbarmungslos ermordet; sie nahmen viel zu viel Platz in ihrem zukünftigen Wohnort ein und diesen Platzverlust konnten sie sich nicht leisten. Die hundert stärksten und cleversten Männer kamen gut voran, bis sie sich von einem auf den anderen Moment in einem eigenartigen Nebel wiederfanden. Plötzlich bekamen sie Brechreiz. Ihre Haut begann zu jucken und sie kratzen so lange, bis sie das Blut unter ihren Fingernägeln spürten. Der Drang, sich selbst noch mehr zu verletzten, weil das Jucken einfach nicht aufhören konnte, war stark und nahm ihnen die Kraft zumWeiterkämpfen. Über die Hälfte der Männer waren im Nebel umgekommen. Die anderen schafften es noch rechtzeitig, zu fliehen. Jedoch hatten sie nicht vergessen, was sie im Falle eines Rückzugs zu tun hatten. Sie rannten zu den Häusern, die noch nicht vom Nebel verdeckt waren, steckten ALLES komplett in Brand, zerstörten, was man zerstören konnte, vernichteten, was vom Zerstörten übriggeblieben war. Wenn die das Land nicht haben konnten, dann würde es niemand. Das Land sollte nie wieder bewohnbar sein. Das Land sollte nie wieder fruchtbar sein. Alles, was der nachrückende Gegner sich zu Nutze machen könnte, sollte endgültig vernichtet werden.“ Tante Beth nahm einen tiefen Atemzug, als wäre es schon anstrengend genug, darüber zu sprechen. Und ich konnte es ziemlich gut nachvollziehen; ich brachte kein einziges Wort heraus. „Ein paar Wochen später, als der Nebel verschwand und der vordere Teil der Siedlung in Schutt und Asche lag, kehrte Zakin mit seinen Männern wieder zurück, auf der Suche nach überlebenden ehemaligen Bewohnern, die man noch umzubringen oder zu befragen hatte. Sie fanden niemanden. Es schien, als hätten die letzten Dorfbewohner ihr unglaubliches Wissen über die Pflanzen dazu genutzt, einen reizenden Nebel zu erstellen. Jedoch sahen die verfaulten Leichen der Männer von ihren selbstverursachten Verletzungen so entstellt aus, dass man nicht erkennen konnte, ob ein paar wenige Dorfbewohner darunter waren, oder ob sie vielleicht in die Weiten der Wüste geflohen sind. So oder so mussten sie ohne Vorräte schon längst umgekommen sein. Zakin unternahm noch einige Versuche, den unversehrten Boden, der während der Schlacht vom Nebel verdeckt war, zu bepflanzen. Jedoch wuchs nichts mehr. Es war, als würde der Nebel das letzte Bisschen Fruchtbarkeit aus dem Boden ausgesaugt haben. Also ließ Zakin aus Wut auch noch den restlichen Teil der kleinen Siedlung zerstören und die Spitzen der brennenden Flammen den Himmel berühren … Ich hatte noch nie in meinem ganzen Leben solche gewaltigen Flammen gesehen. Es ist die unglaublichste und zugleich schrecklichste Erinnerung meines ganzen Lebens.“ Die alte Frau hörte auf zu sprechen und machte kehrt, ich hinter ihr, wie benebelt auf die schwarze Fläche starrend. Ich spürte kaum, dass ihre Hand sich liebevoll auf meine Schulter gelegt hatte, und mich sachte umdrehte. Erst als die ersten Kartons und Zelte der Firots wieder in Sicht kamen, fand ich meine Sprache wieder. „Hat dieser Ort, dieses Dorf, je einen Namen gehabt?“ Traurig schüttelte die Frau den Kopf. „Man braucht für den Ort, an dem man ein wunderbares Leben verbracht hatte, keinen Namen. Und deswegen hatte es auch nie einen gegeben. Erst nach dem Massaker und der völligen Vernichtung , gab man dem Ort einen Namen. Es ist nach der militärischen Taktik benannt worden, die Zakin und Faga angewendet hatten. Verbrannte Erde. Manche nennen sie auch Tote Erde.“ Ja, ich fand auch, dass Tote Erde besser zu der Landschaft passte. Sie kam mir tatsächlich tot vor. „Wie kann es sein, dass die Leute aus Malira es immer wieder schaffen, mich wütender zu machen, als ich es eh schon bin?“, fragte ich mich aufgeregt und nun auch zornig. „Du denkst also, dass Zakin und Faga aus Malira stammten? Was lässt dich so denken?“, fragte sie mich in einem Ton, den ich nur als unbestimmt werten konnte. Ich wusste nicht, ob es überrascht, verwirrt, wütend, oder verständnisvoll wirken sollte. „Ja, natürlich denke ich so. Maliras Bevölkerung ist doch immer auf so etwas aus. Elend und Zerstörung sind ihre beiden anderen Namen, die sie erfolglos versucht, zu verbergen. Das ist doch klar“, sagte ich, beinahe voll und ganz von meinen Worten überzeugt. Beinahe. Nach einer Stunde, die mir gar nicht mal so lang vorkam, standen wir wieder vor Tante Beths Zelt. Die Sonne war schon längst untergegangen, die Silhouetten der wenigen Menschen, die noch unterwegs waren, waren schwarz und unscheinbar in der Dämmerung, bis man denjenigen näher kam, und ihre Gesichter erkennen konnte. Genauso, wie bei dem Gebiet der Toten Erde. Die Alte Frau wandte sich das letzte Mal an diesem Tag an mich: „Ich hoffe sehr, dass du irgendwann noch einmal kommst. Ich glaube, in dir steckt noch viel mehr, als du glaubst.“ Auch wenn es für mich immer noch ein Rätsel war, wieso sie genau mich auserwählt hatte, um sie an diesen unheilvollen Ort zu begleiten, so war ich froh, in ein offenes Geheimnis eingeweiht worden zu sein. Von diesem Massaker hatte uns Jugendlichen und Kindern niemand etwas erzählt. Aber ich fragte mich: Wieso? Wir sollten doch wissen, was für Dreckskerle die aus Malira sind. Wieso verschwiegen sie es also? „Könntest du mir etwas versprechen?“, fragte mich Tante Beth. Überrascht hob ich beide Augenbrauen, nickte jedoch. „Wenn du wieder Zuhause bist, denke über das nach, was du heute gesehen hast, ja? Und nicht nur über das schwarze Pulver, dass an deinen Schuhen festhält. Denke über den ganzen Tag nach. Und dann finde ein einziges Wort, das ihn zusammenfasst.“ Wieder nickte ich, drehte mich um und ging los, als ich sie nochmals rufen hörte. „Ach, und Jasper. Ich finde es wichtig, dass du es weißt: Die Entdecker des neuen fruchtbaren Lands, die Gründer der kleinen Siedlung. Die Leute waren Ausgesetzte aus Malira. Und Kitan, der, der die Alten und Kranken und Hilflosen beschützen wollte: Er war ein Nachkomme eines Menschen aus Malira und eines aus den Firots. Und er wollte mehr Gerechtigkeit und Frieden in die Welt bringen, als es je einer in unserem Zeitalter versucht hatte. Aber leider muss ich auch noch erwähnen, warum die Geschichte unter uns Firots sehr verbreitet ist. Fara und Zakin stammten nicht aus Malira. Sie waren eine von uns.“ Damit die Alte zurück in ihr Zelt und ließ mich sprachlos und beschämt in der Dunkelheit stehen. Den ganzen Weg bis zu mir nach Hause, hatte ich mir überlegt, um was mein Tag sich heute gedreht hatte. Nach ausführlichen Gedankengängen, kam ich dann auf mein Ergebnis: GERECHTIGKEIT. … oder vielleicht besser gesagt UNGERECHTIGKEIT. Ich hatte beschlossen, dass es für das Wort ‚Gerechtigkeit‘ viel zu wenig Beispiele auf der Welt gab. Ungerechtigkeit dagegen, da könnte man den ganzen Tag nur über das eine Wort nachdenken. Ich hatte heute gesehen, wie wenig Gerechtigkeit auf dieser Welt wert ist, oder wie wenig sie von den Menschen wertgeschätzt wird. Aber ich habe auch gesehen, dass Gerechtigkeit eine Ansichtssache ist. Es ist nicht gerecht, dass manche Männer einen großen Unterschied zwischen ihnen und Frauen sehen, und die Frau herablassend behandeln, als wären sie eine völlig andere Rasse, die unter ihnen stehen würde. Sie nutzen sie für ihre Zwecke, bis sie der Meinung sind, sie wäre nicht mehr brauchbar. Andersherum scheint es für den Perversling, der die Frau ausnutzt, gerecht zu sein, denn er wurde auf eine schlechte Art und Weise erzogen, oder war mit den falschen Leuten in Kontakt getreten. Damit kommen wir zu einer weiteren wichtigen Feststellung: Gerechtigkeit ist nicht angeboren. Als Tante Beth mir von der „Entstehung“ der Verbrannten – oder Toten Erde erzählt hatte, fand ich es ungerecht, dass die Entdecker des Landes das Geheimnis für sich behielten, aber dann betrachtete ich es aus ihrer Sichtweise: Sie waren verzweifelt, ausgestoßen aus der eigenen Heimat, und hatten ein neues Zuhause entdeckt. Dabei lagen ihnen nur das Wohl und das Überleben ihrer Familie am Herzen. Sie fanden es gerecht. Ungerecht fand ich das Massaker und das völlige Auslöschen von etwas Wunderbarem oder von etwas, dass noch viel wunderbarer hätte werden können. Dafür finde ich für Zakin keine Ausrede. Nur, dass er sich selbst angelogen haben muss, wenn er das als Gerechtigkeit betrachtet hatte. Und – natürlich – finde ich die Umstände, in den wir leben, schrecklich. Es ist ungerecht, dass es nur ein paar Meilen weiter von den Firots entfernt, eine Stadt gibt, die jedem Menschen das Überleben sichern könnte. Andererseits – und es war wirklich sehr schwer, es mir selbst einzugestehen – kann ich die Bewohner Maliras nach dem Vorfall, der sich zeitlich gesehen, erst vor kurzem ereignet hatte, verstehen. Wie sollen sie uns denn mit offenen Armen begrüßen, wenn manche von uns vor Eifersucht und Machtsucht, die Grüßenden gewissenlos überrennen würden. Sie mussten es nur gerecht finden, uns aus ihrer Welt auszuschließen. Also bin ich zum Entschluss gekommen, dass es keine echte Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit auf der Welt gibt. Es sind Worte, mit denen wir in einer Auseinandersetzung leicht unsere Meinung widergeben können, sie besser ausdrücken können. Und wenn es keine echte Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gibt, dann komme ich nur zu einer Antwort: Gerechtigkeit ist eine Illusion. Fortsetzung folgt…