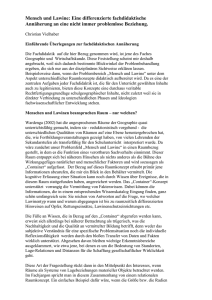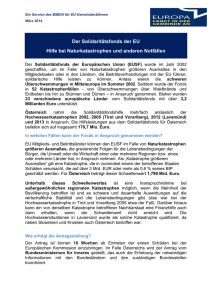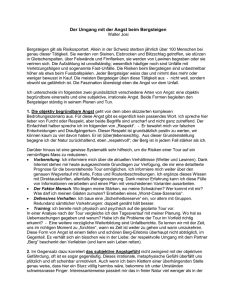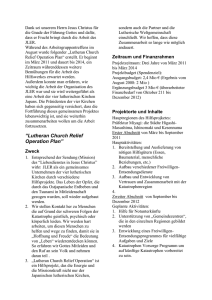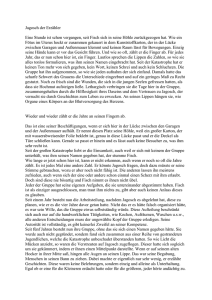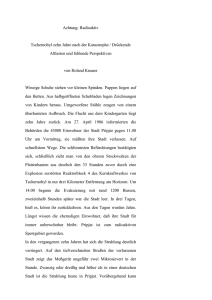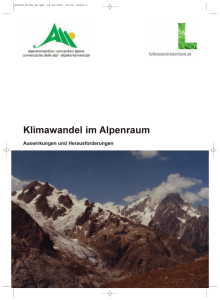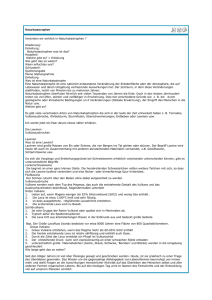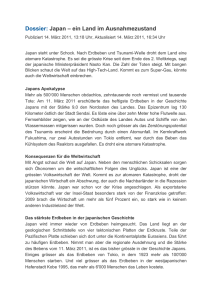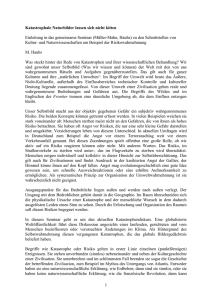Vortrag: Psychoanalytisch-ethnologische Katastrophenforschung
Werbung
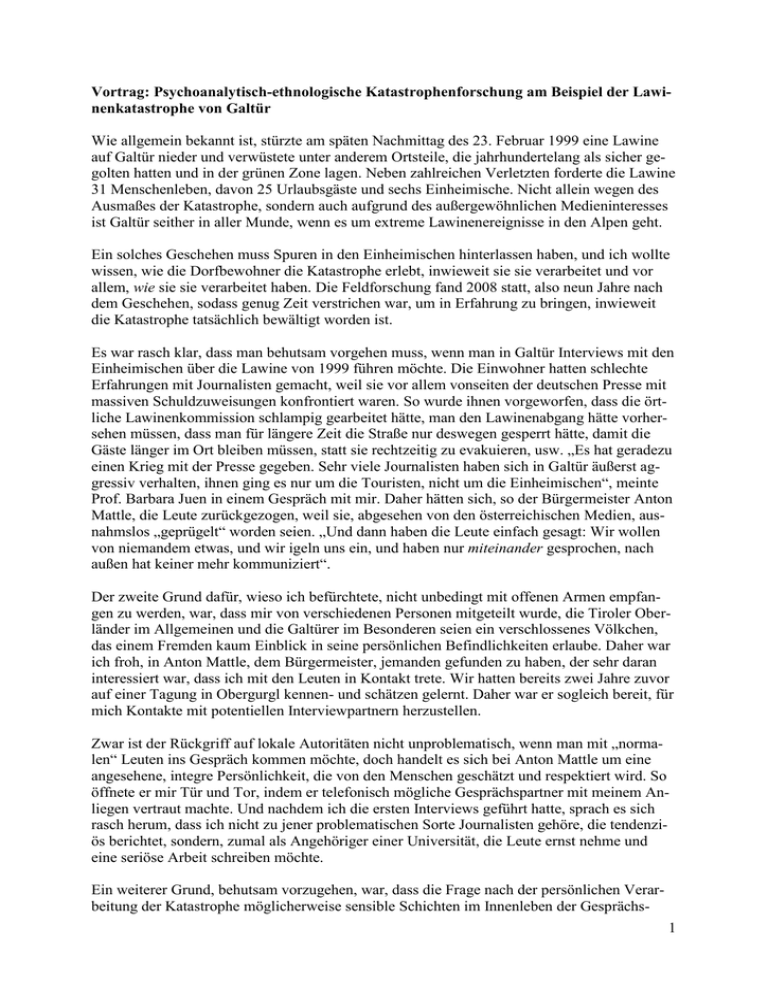
Vortrag: Psychoanalytisch-ethnologische Katastrophenforschung am Beispiel der Lawinenkatastrophe von Galtür Wie allgemein bekannt ist, stürzte am späten Nachmittag des 23. Februar 1999 eine Lawine auf Galtür nieder und verwüstete unter anderem Ortsteile, die jahrhundertelang als sicher gegolten hatten und in der grünen Zone lagen. Neben zahlreichen Verletzten forderte die Lawine 31 Menschenleben, davon 25 Urlaubsgäste und sechs Einheimische. Nicht allein wegen des Ausmaßes der Katastrophe, sondern auch aufgrund des außergewöhnlichen Medieninteresses ist Galtür seither in aller Munde, wenn es um extreme Lawinenereignisse in den Alpen geht. Ein solches Geschehen muss Spuren in den Einheimischen hinterlassen haben, und ich wollte wissen, wie die Dorfbewohner die Katastrophe erlebt, inwieweit sie sie verarbeitet und vor allem, wie sie sie verarbeitet haben. Die Feldforschung fand 2008 statt, also neun Jahre nach dem Geschehen, sodass genug Zeit verstrichen war, um in Erfahrung zu bringen, inwieweit die Katastrophe tatsächlich bewältigt worden ist. Es war rasch klar, dass man behutsam vorgehen muss, wenn man in Galtür Interviews mit den Einheimischen über die Lawine von 1999 führen möchte. Die Einwohner hatten schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht, weil sie vor allem vonseiten der deutschen Presse mit massiven Schuldzuweisungen konfrontiert waren. So wurde ihnen vorgeworfen, dass die örtliche Lawinenkommission schlampig gearbeitet hätte, man den Lawinenabgang hätte vorhersehen müssen, dass man für längere Zeit die Straße nur deswegen gesperrt hätte, damit die Gäste länger im Ort bleiben müssen, statt sie rechtzeitig zu evakuieren, usw. „Es hat geradezu einen Krieg mit der Presse gegeben. Sehr viele Journalisten haben sich in Galtür äußerst aggressiv verhalten, ihnen ging es nur um die Touristen, nicht um die Einheimischen“, meinte Prof. Barbara Juen in einem Gespräch mit mir. Daher hätten sich, so der Bürgermeister Anton Mattle, die Leute zurückgezogen, weil sie, abgesehen von den österreichischen Medien, ausnahmslos „geprügelt“ worden seien. „Und dann haben die Leute einfach gesagt: Wir wollen von niemandem etwas, und wir igeln uns ein, und haben nur miteinander gesprochen, nach außen hat keiner mehr kommuniziert“. Der zweite Grund dafür, wieso ich befürchtete, nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen zu werden, war, dass mir von verschiedenen Personen mitgeteilt wurde, die Tiroler Oberländer im Allgemeinen und die Galtürer im Besonderen seien ein verschlossenes Völkchen, das einem Fremden kaum Einblick in seine persönlichen Befindlichkeiten erlaube. Daher war ich froh, in Anton Mattle, dem Bürgermeister, jemanden gefunden zu haben, der sehr daran interessiert war, dass ich mit den Leuten in Kontakt trete. Wir hatten bereits zwei Jahre zuvor auf einer Tagung in Obergurgl kennen- und schätzen gelernt. Daher war er sogleich bereit, für mich Kontakte mit potentiellen Interviewpartnern herzustellen. Zwar ist der Rückgriff auf lokale Autoritäten nicht unproblematisch, wenn man mit „normalen“ Leuten ins Gespräch kommen möchte, doch handelt es sich bei Anton Mattle um eine angesehene, integre Persönlichkeit, die von den Menschen geschätzt und respektiert wird. So öffnete er mir Tür und Tor, indem er telefonisch mögliche Gesprächspartner mit meinem Anliegen vertraut machte. Und nachdem ich die ersten Interviews geführt hatte, sprach es sich rasch herum, dass ich nicht zu jener problematischen Sorte Journalisten gehöre, die tendenziös berichtet, sondern, zumal als Angehöriger einer Universität, die Leute ernst nehme und eine seriöse Arbeit schreiben möchte. Ein weiterer Grund, behutsam vorzugehen, war, dass die Frage nach der persönlichen Verarbeitung der Katastrophe möglicherweise sensible Schichten im Innenleben der Gesprächs1 partner berührte. Dabei geht es um Grundfragen der menschlichen Existenz, etwa der Frage nach dem „Sinn des Lebens“. Dazu eignen sich am ehesten qualitative Interviews, bei denen den Gesprächspartnern – im Gegensatz zu einem Fragebogen – die Möglichkeit gegeben wird, sich ausführlich äußern zu können. Die Informanten wurden dabei gebeten, den Ablauf und das Erleben der Katastrophe aus ihrer Sicht zu schildern. Es sollte darüber hinaus eingehend die Frage nach der Verarbeitung und nach einem möglichen Sinn des Geschehens zur Sprache kommen. Das ist eine besonders heikle Frage, weil der gesunde Menschenverstand sofort entgegnet, dass etwas Schreckliches prinzipiell sinnlos sei. Das ist aber mehr die Sicht von nicht Betroffenen, denn als Betroffener ist es wichtig, sich mit Leid, das einen selber betrifft, auseinanderzusetzen und es in die Lebensgeschichte zu integrieren. – Abgesehen von diesen grundsätzlichen Themen, wurden zusätzlich einige Einzelfragen gestellt, welche spezifische Themen berühren, zum Beispiel ob es charakteristische mentale Merkmale der Galtürer gebe, ob das Walsertum für einen selber von Bedeutung sei, ob man den Klimawandel als persönliche Bedrohung betrachte etc. Ich habe den Bürgermeister Anton Mattle sowie elf weitere Personen interviewt, zu denen er den Kontakt ermöglicht hat. Der Bürgermeister war bemüht, sowohl junge und alte, vermögende und weniger vermögende, weibliche und männliche, weniger und stärker betroffene Einwohner zu einem Gespräch zu bewegen – und vor allem auch jene, die selber Angehörige verloren hatten. Das sind in Galtür drei Familien, doch habe ich nur mit zweien Gespräche führen können, weil die dritte mit mir über das Geschehen nicht sprechen wollte. Darüber hinaus habe ich aus eigenem Antrieb zwei weitere Personen interviewt, stand mit einer dritten in E-Mail-Verbindung, die zwar selbstständig zu mir den Kontakt gesucht hatte, aber leider erst, nachdem ich wieder daheim war. Außerdem habe ich ein Gespräch mit Prof. Barbara Juen geführt, die als Spezialistin für Notfallpsychologie direkt in das Geschehen involviert war, sowie mit einem Studienkollegen aus Wien, der zur Zeit des Unglücks in Galtür weilte. Insgesamt habe ich 17 Gespräche geführt, ein üblicher Wert für qualitative Interviews. Das Sprechen über die Katastrophe In Anbetracht dessen, dass sich die Galtürer systematisch von der Außenwelt abschirmten, war natürlich die Frage von primärem Interesse, ob und inwieweit sie die Katastrophe überhaupt verarbeitet haben, denn wenn man sich nach einem traumatischen Geschehen zurückzieht, liegt der Verdacht nahe, dass die belastenden Ereignisse verdrängt werden. In der einschlägigen Fachliteratur wird eindringlich darauf hingewiesen, dass im Katastrophenfall eine psychologische Weiterbetreuung für all jene notwendig sei, welche „besonders belastenden Situationen ausgesetzt waren“, und dazu zählten insbesondere „Lebensgefahr, direkter Anblick enormer Zerstörung, Bergung von Schwerverletzten oder Toten, persönlicher Bezug zu Schwerverletzten oder Toten“. Das war bei vielen Einheimischen der Fall, weil sie sofort nach dem Lawinenabgang begannen, die Verschütteten zu befreien, zumal wegen des Schlechtwetters Hilfe von außen – die erst anderentags einsetzte –, nicht möglich war. Handelt es sich im Falle von Galtür daher um eine kollektive Traumatisierung infolge Verdrängung? Mitnichten, denn die Einwohner haben nach der Katastrophe über einen längeren Zeitraum hinweg untereinander über das Geschehen gesprochen, und das in sehr ausführlicher, intensiver und entlastender Weise. Das haben mir alle Informanten bestätigt, unter anderem auch der Bürgermeister: „Ich kann Ihnen sagen, im ersten Jahr haben wir in Galtür nur über das gesprochen. Und wenn man über die Heuernte gesprochen hat – im dritten Satz war man dann irgendwo wieder beim Lawinenopfer, bei der Lawine, das war unwahrscheinlich. Es hat eigentlich kaum ein Gespräch gegeben, wo man nicht irgendwo wieder dahingekom2 men ist“. Ein anderer Informand, der nach drei Stunden des Verschüttet-Seins als Letzter lebend aus der Lawine geborgen wurde, danach ins Spital kam und dort von Psychologen besucht wurde, meinte: „Ich habe eine Familie hinter mir, eine Mutter und einen Taufpaten, auch ganz wichtig, die genau wissen, wo es lang geht, und die helfen mir sicher am meisten. Hier war die Familie als psychologischer Beistand […] viel mehr wert wie ein unbekannter Mensch, der natürlich auch vielleicht ein sehr guter Psychologe ist. Ich wollte das selber verarbeiten, selber schaffen, nicht mit Riesen-Unterstützung von jemandem, der mir im Leben noch nie begegnet ist“. Galtür ist eine 800-Seelen-Gemeinde, in der jeder jeden kennt. Mit Fremden spricht man nicht über persönliche Probleme, sondern nur im Familien- und Freundeskreis. Hinzukommt, dass man mit Angehörigen der psychologischen Berufe nichts zu tun haben möchte, weil man anderenfalls in ein schiefes Licht geraten würde. Psychologen werden umgangssprachlich als „Vogeldoktor“ bezeichnet, wie mir Barbara Juen mitgeteilt hat. Daher wäre es für einen Tiroler oder Galtürer „noch einmal absurder [gewesen], dass einer an der Tür klopft und fragt, ob er psychologische Hilfe braucht – weil ihm ist ja nur eine Katastrophe passiert, er ist ja nicht verrückt“. Tatsächlich sind die Galtürer den Umgang mit Lawinen gewöhnt, und auch der Tod ist, im Gegensatz zu dem Großstädten, integraler Bestandteil des Lebens, denn die Leichen werden daheim aufgebahrt, und an den Beerdigungen nimmt das ganze Dorf teil. Außerdem ist in einem Hochgebirgsdorf der Umgang mit der Natur und ihrem ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen direkter als in den dicht besiedelten und verstädterten Gegenden des Flachlandes. Insofern muss die oben erwähnte Auffassung der Psychotraumatologie relativiert werden, dass der direkte Anblick von Zerstörung, Verletzten oder Toten in jedem Fall so belastend sei, dass psychologische Weiterbetreuung erforderlich sei. Auf der anderen Seite entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass die Galtürer trotz ihrer Vorbehalte gegenüber den „Psy-Berufen“ genau das getan haben, was ihnen jeder Psychotherapeut empfohlen hätte, nämlich solange über das Desaster zu sprechen, bis es nicht mehr die Lebensqualität entscheidend belastet. Unbewusste Inhalte Die Gespräche wurden mit einer offenen Frage eröffnet, nämlich mit „Wie war das damals? Erzählen Sie doch bitte“, oder in ähnlicher Weise. Das hat den Vorteil, dass sich die Personen frei entfalten können und man erfährt, was für sie wichtig gewesen ist. Oftmals sprechen sie dann relativ lange, ohne nachfragen zu müssen, sodass sich Inhalte nicht nur kognitiv, sondern möglicherweise auch assoziativ aneinanderreihen. Ist das der Fall, kommt man unter Umständen in die Nähe unbewusster Schichten, denn assoziative Verknüpfungen gehorchen dem Denken in Ähnlichkeitsbezügen, das in der psychoanalytischen Technik als Prinzip der freien Assoziation bezeichnet wird. Die dabei oft gestellte Frage, was einem denn spontan zu diesem oder jenem Ereignis einfalle, eröffnet Verknüpfungen, die nicht unbedingt kognitiver Kontrolle gehorchen. Dazu zunächst ein Beispiel: Als ich zu Beginn des Gesprächs einen Interviewpartner, der in der Lawine drei Angehörige verloren hat, frage, wie er die Katastrophe erlebt hat, antwortet er zunächst nicht darauf, sondern erzählt, wie Jahrzehnte zuvor drei Tourengeher in einer Lawine umgekommen seien, die auf dem Weg zu ihm gewesen seien. Also kann man sich fragen, ob für den Interviewpartner mental, das heißt assoziativ ein Zusammenhang zwischen diesen objektiv nicht zusammenhängenden Ereignissen besteht und worin dieser begründet sein könnte. Im Laufe des Interviews stellt sich nämlich heraus, dass die Tourengeher nicht ganz ohne sein Zutun auf dem Weg zu ihm waren und sich für ihn die Frage nach der eigenen möglichen Schuld gestellt hat. Da er ein gläubiger Katholik ist, der an eine strafende Instanz glaubt, ist es demnach nicht auszuschließen, dass er den Tod der eige3 nen Verwandten, bewusst oder unbewusst, als Sühne erlebt, zumal es sich jeweils um drei Personen gehandelt hat. Ein weiteres Beispiel: Die Frage nach einem etwaigen Sinn der Katastrophe habe ich, neben den anderen Informanten, auch dem katholischen Geistlichen, Louis Maria AttemsHeiligenkreuz, gestellt: Rieken: Sagen Sie, diese Katastrophe, würden Sie sagen (Pause), hat die Katastrophe einen Sinn gehabt? Attems: Mein Gott, das kann man bei Katastrophen nicht sagen. Rieken: Kann man bei Katastrophen nicht sagen? Attems: Kann man doch nicht beurteilen, nicht, ich sage, […] das ist eine Riesenkatastrophe, nach dem Sinn zu fragen, das kann man doch nicht. Es kommt, es ist auch nicht eine Bestrafung vom lieben Gott, das ist primitiv zu sagen, Gott hat sie bestraft, kein Mensch würde so etwas sagen, nicht, weil, weil das ist ja unsinnig, weil es ist erst einmal ein gefährlicher Boden, das ist er immer schon gewesen, das ist ja nichts Neues“. Die Pause in meinem ersten Satz zeigt an, dass es mich ein wenig Überwindung gekostet hat zu fragen, ob die Lawine einen Sinn gehabt habe. Durch das bisherige Gespräch war mir nämlich deutlich geworden, dass Attems-Heiligenkreuz keine extremen Ansichten vertritt und er eine solche Frage eher mit Befremden quittieren würde, und genau das tut er dann auch („Mein Gott, das kann man bei Katastrophen nicht sagen“). Er argumentiert sachorientiert und rational, indem er auf die potentiellen Gefahren hinweist, welche das Siedeln in dieser Extremlage seit jeher mit sich bringt. Eines ist aber doch auffällig: Das Stichwort „Sinn“ führt ihn direkt zur Verneinung der Katastrophe als Strafe Gottes. Auch mehrere andere Interviewpartner haben bei der Frage nach dem Sinn sogleich assoziativ geantwortet, dass es sich bei der Lawine keinesfalls um eine Strafe Gottes handeln könne. Das aber muss kein zwingender Zusammenhang sein, denn es existierten auch ganz andere Verknüpfungen zur Frage nach dem Sinn, etwa dass man nun bewusster und intensiver lebe und das Leben mehr zu schätzen wisse, dass der Zusammenhalt im Ort größer geworden sei oder dass man gelernt habe, über persönliche Probleme zu reden. Ferner wurden verschiedentlich ökologische Zusammenhänge vermutet, etwa dass der Natur die Umweltbelastungen zu groß würden und sie sich bisweilen „entladen“ müsse, wobei es dann aber mitunter die Falschen treffe, in dem Fall die Galtürer. All diese Argumente wurden mir mitgeteilt, und sie zeugen nicht nur von einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Desaster, sondern machen auch deutlich, dass für eine umfängliche Verarbeitung Sinnfragen wichtig sind. Die Verbindung Sinn/Gottesstrafe ist daher nicht ein unbedingt notwendiger, aber er fällt mehreren Informanten sogleich ein. Wenn einem aber zu einer allgemein gestellten Frage etwas Konkretes in den Sinn kommt, dann ist dieses Konkrete bereits ein Thema, mit dem man sich beschäftigt hat. Wäre es völlig außerhalb der eigenen Gedankenwelt, dann würde und könnte man es gar nicht erwähnen. Demnach ist es möglich, dass der Gedanke an die Strafe Gottes abgewehrt werden muss, indem man sie verneint, obwohl man gar nicht direkt darauf angesprochen worden ist. Denn abgewehrt bzw. zurückgewiesen muss dann etwas werden, wenn es einem zu nahe gekommen ist. Das Strafe-Gottes-Argument mag in weltlichen Kreisen veraltet sein, in katholisch-konservativen ist das keineswegs so. Außerdem steht in Gestalt der unbewussten Intentionalität (= Absicht, Was möchte man erreichen?) ein mächtiger Impetus dahinter, indem man der Umwelt, das heißt Gott oder der Natur, Absichten unterstellt, wenn man von etwas Schrecklichem betroffen ist („Gott oder die Natur will uns etwas sagen“). Insofern sind die oben skiz4 zierten Ausführungen über assoziative Zusammenhänge zwischen „Sinn“ und „Strafe Gottes“ plausibler, als sie auf den ersten Blick vielleicht erscheinen mögen. Sie werden darüber hinaus auch von der Psychotraumatologie bestätigt, heißt es dazu doch in einem diesbezüglichen Lehrbuch: „Subjektive Schuldgefühle können auch dann auftreten, wenn kein Verschulden des Betroffenen erkennbar ist“ (Hausmann 2006: 36). Das gilt für entführte Personen genauso wie für vergewaltigte Frauen und ebenso für all jene, welche von einer Katastrophe heimgesucht werden. Logisch betrachtet handelt es sich um einen Widerspruch, da die betroffenen Personen gewissermaßen eine Wende um 180 Grad machen, indem sie von der Opfer- in die Täterrolle schlüpfen. Aber hier geht es nicht um formale Logik, sondern um Tiefenpsychologie, um „Psycho-Logik“, und diese vermag, weil das Gefühlsleben anderen Gesetzen als denen der Rationalität folgt, die widersprüchlichsten Regungen unter einem Dach zu vereinen. Am ehesten lässt sich das aus tiefenpsychologischer Sicht verständlich machen. Wer traumatisiert wird, erlebt sich als extrem hilflos und ausgeliefert – ein Zustand, der kaum zu ertragen ist, weil er mit heftigen Gefühlen der Unsicherheit, Kleinheit und mangelnder Kontrolle einhergeht. Diese aber rufen kompensatorische, ausgleichende Wünsche hervor, und das geschieht mithilfe von Schuldgefühlen, denn Schuld tragen, bedeutet als Ursache zu fungieren, und wer ursächlich für etwas verantwortlich ist, verfügt auch über Macht. Es erübrigt sich wohl hinzuzufügen, dass es sich dabei um unbewusste Dynamiken handelt. Angst Ein anderer Bereich, der eher in den Tiefenschichten der Persönlichkeit angesiedelt ist, ist Angst. Mit Angst befasst man sich nicht gern, und man gibt auch nicht gern zu, Angst zu haben, denn Mut und Tapferkeit haben einen höheren Stellenwert. Das hängt mit psychischen Bedürfnissen genauso wie mit der Entwicklung der Wissenschaft zusammen. Dass Europa seit der Frühen Neuzeit einen Großteil der Welt erobern und ihr seinen Stempel aufdrücken konnte, hängt nämlich neben anderem mit der Erfolgsgeschichte der Wissenschaft zusammen, die auf Grundlage der Physik die Beeinflussung der Natur zum Ziel hat. „Wissen ist Macht“, lautet eine eingängige Formulierung, die auf den Philosophen Francis Bacon zurückgeht und andeutet, dass es nicht nur um das Erkennen der Natur geht, sondern auch um ihre Beherrschung. Ganz im Banne der zeitgenössischen Aufklärungsphilosophie formulierte zum Beispiel der ostfriesische Deichbauexperte Albert Brahms bereits 1767, dass Gott die Natur nur mit einer „endlichen Kraft“ versehen habe, weswegen ihr „durch eine endliche Kraft, dergleichen der Mensch ist, wol widerstanden werden [kann]; mithin die Bemühung, sich dawider Sicherheit zu verschaffen, ihren gewünschten Endzweck erreicht“. Auch wenn der Vernunftglaube der Aufklärungsphilosophie mittlerweile relativiert wurde, spielt die Vorstellung, die Welt objektiv erkennen und sie systematisch beeinflussen zu können, in den Naturwissenschaften weiterhin eine prägende Rolle und sorgt dafür, dass die Kluft gegenüber den Geisteswissenschaften weiterhin beträchtlich ist. In einem solchen Weltbild, bei dem es um die Beherrschbarkeit der Natur geht, gibt es natürlich keinen Platz für die Angst. Ein typisches Beispiel ist die Risiko-Diskussion in diesen Disziplinen. So wird etwa behauptet, dass Risikoanalysen „mit wissenschaftlichen Methoden zu […] objektiv richtigen Aussagen führen“ müssen, wobei „Risiko“ definiert wird als das mathematische „Produkt aus der Häufigkeit bzw. Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ereignisses und dem Schadensausmaß, das bestimmt wird durch die Anzahl der Personen und die Sachwerte, die einem gefährlichen Ereignis zum Zeitpunkt seines tatsächlichen Eintretens ausgesetzt sind“. Der Hinweis auf die Mathematik suggeriert präzise Eindeutigkeit, aber verwendet wird dazu ein unscharfer Begriff, nämlich „Wahrscheinlichkeit“. Das Schadensausmaß der Lawine von Galtür, die vor allem in der grünen Zone Unheil angerichtet hat, konnte jedoch niemand vorhersehen. Und die Höhe der Februar-Sturmflut 1962, bei der in Hamburg mehr als 300 Menschen ertrunken 5 sind, war ebenfalls jenseits des Vorhergesagten, weil eine Fernwelle aus dem Atlantik den Meeresspiegel zusätzlich in die Höhe trieb. Auf der anderen Seite ist zuzugeben, dass Forschungsergebnisse, die unmittelbaren Einfluss auf die Praxis ausüben sollen, ein vermeintlich sicheres Fundament benötigen, weil der Praktiker begründete Entscheidungen mit realen Auswirkungen treffen muss und darüber hinaus Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit bzw. seinen Klienten hat. Das gilt für Geologen genauso wie für Ärzte oder Psychotherapeuten. Aber erkauft wird dieser Objektivitätsglaube mit Verdrängung, und ein wichtiges Indiz dafür ist, dass sich zwar die wissenschaftliche Diskussion mit dem Risiko befasst, aber nicht mit der Angst. Zum Beispiel findet man im aktuellen Standardwerk zur geografischen Katastrophenforschung im Schlagwortregister Dutzende Verweise auf „Risiko“, aber keinen einzigen Verweis auf „Angst“. Das hat eine innere Logik: Zum einen widerspricht die Angst dem Objektivitätsideal der Wissenschaft, die von subjektiven Befindlichkeiten unberührt bleiben möchte. Während das Risiko sich unschwer in der Umwelt lokalisieren lässt und das eigene Innenleben davon unberührt bleiben kann, ist das bei der Angst als emotionalem Phänomen nicht möglich. Zum anderen ist sie schwer definierbar, ein oftmals untergründiges Gefühl, mehr eine Ahnung, die unbewusst oder halbbewusst an unserem Selbstwertgefühl und am Bedürfnis nach Sicherheit nagt. Dieses ist in der Tat zentral für die menschliche Spezies, und es spielt eine ebenso zentrale Rolle in jener Wissenschaft, die für sich in Anspruch nimmt, nicht an der Oberfläche zu verweilen, sondern einen „Blick hinter die Kulissen“ zu werfen, nämlich der Tiefenpsychologie. Unbewusste „Minderwertigkeitsgefühle“ und „Grundängste“ spielen in ihr eine wesentliche Rolle, vor allem in der Individualpsychologie und Neopsychoanalyse, aber auch in psychoanalytischen Objektbeziehungstheorien. So unterscheidet beispielsweise Michael Balint zwischen jenen Menschen, die primär nach Schutz und Sicherheit streben („Oknophile“), und jenen, die immer aufs Neue Spannung und „Angstlust“ suchen („Philobaten“), etwa gefährliche Sportarten oder die Fahrt in einer atemraubenden Achterbahn. Doch auch diese Personen gehen in der Regel Wagnisse nur dann ein, wenn sie darauf setzen können, aus der entsprechenden Situation wieder heil herauszukommen, was bedeutet, dass auch bei ihnen ein Bedürfnis nach Sicherheit im Hintergrund steht, das als Reaktion auf tief liegende Ängste zu verstehen ist. Damit stellt sich die Frage, worin ein Mehr an subjektivem Schutzgefühl begründet ist: in der Vorstellung eines „objektiv“ messbaren Risikos, das vermeintliche Sicherheit erwarten lässt, oder in der Akzeptanz, dass wir mit einer gewissen Angst leben müssen? Aus meiner Sicht ist diese Frage rhetorisch, da Verdrängung in der Regel einen höheren Energieaufwand benötigt als eine realistischere Sicht, die bereit ist, mit einem bestimmten Maß an Angst zu leben. Das ist auch die mehrheitliche Sicht jener Galtürer, mit denen ich Interviews geführt habe, um in Erfahrung zu bringen, ob und wie sie die Katastrophe von 1999 verarbeitet haben. Und dass sie unumwunden zugeben können, mit einer gewissen Angst leben zu können, macht deutlich, dass sie sich intensiv mit dem Geschehen auseinandergesetzt haben. Dazu zwei Beispiele, zunächst der Gemeindearzt Fritz Treidl: Er sagt: „Ich bin fest überzeugt, dass der Teil der Bedrohung [durch Schutzmaßnahmen] kleiner geworden ist. Ich bin überhaupt nicht davon überzeugt, dass es nicht trotzdem bei bestimmten Windsituationen dann sein kann, dass es sich halt da oben anstaut. Ich meine, für mich ist es nach wie vor ein bedrohter Lebensraum, ich meine, das Hochgebirge ist ein bedrohter Lebensraum […]. Die Lawinenverbauungen, die zeigen einem eher nur, wo die Gefahr entschärft worden ist, aber so punktförmig ist es immer gefährlich“. Ergänzend fügt Dr. Treidl hinzu, dass er trotz der potentiellen Gefahr nie auf die Idee käme, von Galtür wegzuziehen, denn er arbeite dort seit vielen Jahren, sei sehr zufrieden 6 und habe das Gefühl, in der Gemeinde gebraucht zu werden. Außerdem lebten seine Frau und seine Kinder gern in dem Dorf. Einen ähnlichen und doch etwas anderen Akzent setzt Franz Lorenz, ein 82-jähriger Hotelier, der durch die Lawine seine Frau und seine Schwiegertochter verloren hat. Er meint, er habe sich oftmals die Frage gestellt, warum ausgerechnet seine Familie betroffen gewesen sei: „Aber das wird man nie verstehen: warum – das ist dann die höhere Macht, und das ist das Schicksal eines Bergbewohners, der immer in diesen Risiken lebt oder existiert. Es gibt keinen Tag, an dem man ganz sicher ist vor einem Naturgeschehen […]. Andererseits hat man […] das Privileg, dass man an einem der schönsten Plätze auf der ganzen Welt leben darf. Ich sage das immer wieder, jeden Schritt, den ich vor die Haustür mache – […], alles hat seine Schönheiten und hat auch seine Risiken. Und wenn man da sicher ist, dass man weiß, ich lebe am wirklich schönsten Platz auf der ganzen Welt, dann überkommt einen doch so eine gewisse Zufriedenheit, die einem Mut macht“. Beide Interviewpartner akzeptieren, dass man, wenn man in Galtür wohnen möchte, ein gewisses Risiko einkalkulieren und mit einer gewissen Angst leben muss. Bei Dr. Treidl, der Jahre zuvor aus dem Tiroler Unterland in das Dorf gekommen ist, spielt dabei die Gewohnheit eine Rolle, nämlich dass er schon längere Zeit in Galtür lebt, mit seiner Arbeit zufrieden ist und auch seine Familie nicht wegziehen möchte. Franz Lorenz setzt den Akzent etwas anders, denn er begründet seinen Verbleib in Galtür nicht mit dem Hinweis, dass er dort schon lange wohnt – er ist dort aufgewachsen –, sondern damit, dass er Vor- und Nachteile gegeneinander abwägt und zum Schluss kommt, dass die Vorteile überwiegen. Er dürfe „an einem der schönsten Plätze auf der ganzen Welt leben“, und dieser Faktor hat so viel Gewicht, dass er ihm ermöglicht, bis zu einem gewissen Grad sogar den Verlust der Ehefrau und Schwiegertochter zu verkraften. Es sind zwei Aspekte, die der persönlichen Verarbeitung in beiden Interviews dienlich sind: zum einen ein konstruktiver Umgang mit dem Unvorhergesehenen, in der Resilienzforschung als „Lernen, mit Wandel und Unsicherheit umzugehen“ definiert und im SalutogeneseKonzept Antonovskys als „Verstehbarkeit“ bezeichnet, womit die Überzeugung gemein ist, dass es selbst für extreme Erlebnisse eine Erklärung gibt. Zum anderen kommen in beiden Interviewauszügen eine starke lokale Identität bzw. starke Identifikation und Verbundenheit mit der unmittelbaren Umgebung zum Ausdruck. Letzteres ist ein durchgängiges Merkmal in allen Interviews, die ich geführt habe und beinhaltet noch weitere Aspekte. Auf die Frage, was dazu beigetragen habe, die Erlebnisse in der Katastrophennacht zu verarbeiten, wurden mir nahezu einhellig drei Faktoren mitgeteilt: 1.) das familiäre Netz, 2.) die Dorfgemeinschaft und 3.) der katholische Glaube. Die Galtürer haben, wie bereits erwähnt, im ersten Jahr nach der Katastrophe in einer Vielzahl von Gesprächen ihre Erlebnisse aus der Schreckensnacht einander mitgeteilt, und das solange, bis sie das Gefühl hatten, die Probleme seien nun „von der Seele geredet“. Hilfreich war dabei für die meisten auch die Religion, wobei nicht die Frage primär war, wie Gott Derartiges zulassen kann, sondern der Umstand, dass das Leben trotzdem einen Sinn ergibt. Diese Ergebnisse lassen sich natürlich nicht eins zu eins auf die großstädtischen Gesellschaften der säkularisierten Postmoderne umlegen, aber in einer etwas abstrakteren Perspektive wird deutlich, dass sowohl ein soziales Netz als auch eine Sinn stiftende Weltanschauung hilfreich sind, um Katastrophen zu verarbeiten, was auch in Einklang steht mit den Ergebnissen der Psychotraumatologie. Notwendig ist es allerdings ebenso, im Sinn von Resilienz dem Unvorhergesehenen konstruktiv zu begegnen, was in dem Fall bedeutet zu akzeptieren, dass es keine absolute Sicherheit gibt, dass man daher den Versprechungen der „objektivistischen“ 7 Risikoforschung mit einer gewissen Skepsis entgegentreten sollte und demzufolge mit einer gewissen Angst vor einer neuerlichen Katastrophe leben muss. Andererseits ist damit nicht intendiert, in steter Sorge sein Dasein fristen zu müssen, denn das würde die Lebensqualität nachhaltig beeinträchtigen. So betrachtet käme Katastrophennachsorge in exponierten Gegenden einem behutsamen Navigieren zwischen zwei Extremen gleich, das auf sensible Weise Zuversicht und Skepsis zugleich vermitteln sollte. Die Lawine von Blons im Großen Walsertal, Jänner 1954 Zwischen dem 10. und 12. Jänner 1954 gingen in Vorarlberg insgesamt 57 Lawinen ab und begruben 268 Personen unter sich, von denen 122 nur mehr tot geborgen werden konnten. Besonders hart traf es Blons im Großen Walsertal, wo am 11. Jänner mehrere Lawinen niedergingen und einen Großteil des Ortes dem Erdboden gleichmachten. Von den 367 Personen, die damals in 90 Häusern lebten, wurde fast ein Drittel, nämlich 115, verschüttet; davon starben 47, acht erlagen später ihren Verletzungen, zwei wurden vermisst, und 29 Häuser wurden vollständig zerstört. Demnach kam fast jeder sechste Einwohner ums Leben, jedes dritte Haus war verwüstet. „Es ist, als wären in New York über anderthalb Millionen Menschen in einer unvorstellbaren Katastrophe umgekommen und weitere zwei Millionen verletzt oder auf Lebenszeit verkrüppelt worden“, schreibt Joseph Wechsberg, der 1938 von Prag in die USA emigrierte, in seinem 1959 erschienenen Buch über die Katastrophe von Blons. Inwieweit das Ereignis im Laufe der Jahrzehnte verarbeitet worden ist, lässt sich anhand der vorliegenden Literatur nur erahnen. In einer neueren Arbeit aus dem Jahre 2004 von Helga Nesensohn-Vallasters heißt es im Vorwort von Peter Strasser, dass die Autorin im letzten Teil des Buches „auf die Bewältigung der Naturkatastrophe“ eingehe, worunter er einen „Innovationsschub auf verschiedenen Ebenen [versteht]: Erstmals wurden Hubschrauber zur Rettung eingesetzt, Funkverbindungen aufgebaut und das Radio als stets aktuelles Medium verstärkt herangezogen“. Weiters erwähnt er die zeitgenössischen Lawinenverbauungen und ein „Krisenmanagement als moderne Bewältigungsstrategie“, mit dem die Autorin „schließlich eine Brücke zur Gegenwart“ schlage. Liest man die entsprechende Passage Nesensohn-Vallasters, so erfährt man, dass „die Entwicklung von Krisenmanagementplänen als neue Wege der aktiven Sicherheitspolitik“ eine viel versprechende Möglichkeit sei, um „die Bevölkerung schneller und effizienter in Gefahrensituationen zu informieren und zu leiten“. Bemerkenswert ist, was Strasser unter „Bewältigung der Naturkatastrophe“ versteht, nämlich ausschließlich technische Schritte sowie effizientere Informations- und Leitungsmaßnahmen. Dagegen ist nichts einzuwenden, das ist notwendig und als wichtiger Grundstein der Katastrophenvorsorge und des Katastrophenmanagements zu verstehen. Aber es ist eine einseitige Sicht, weil sie erstens technizistische Machbarkeit im Stil der wissenschaftlichen RisikoDiskussion suggeriert und weil zweitens die Innenseite der betroffenen Individuen, die persönliche Auseinandersetzung mit dem Desaster, außer Acht gelassen wird. Um diese muss es aber auch gehen, wenn man sich mit der Frage befasst, wie eine Katastrophe bewältigt werden kann. Um das in Erfahrung zu bringen, machten im Oktober 2009 Michael Simon, der an der Universität Mainz die Abteilung Kulturanthropologie/Volkskunde leitet, und ich gemeinsam eine Feldforschung in Blons. Es können an dieser Stelle noch keine detaillierten Ergebnisse präsentiert werden, aber ich kann einige Eindrücke aus der Feldforschung mitteilen. Da die Katastrophe zum Zeitpunkt der Interviews 55 Jahre zurücklag, konnten wir natürlich nur mit Leuten reden, die damals Kinder bzw. relativ jung waren und das Leben noch vor 8 sich, das heißt eine Zukunftsperspektive hatten – nicht aber mit den damals bereits alten Menschen, von denen wir nur sporadisch aus den Erzählungen ihrer Kinder etwas erfahren haben. So erwähnte ein Informant, der seine Schwester durch die Lawine verloren hatte, dass seine Mutter seither nur noch „wenig gelacht“ und „bei vielen Gelegenheiten ihr Bedauern darüber geäußert“ habe, dass ihre einzige Tochter in der Lawine umgekommen sei. Als die Mutter vor einigen Jahren gestorben sei, sei „ein Stück Düsternis“ von der Familie gewichen. Eine andere Informantin, die das Unglück selber nicht erlebt hatte, meinte, dass ihr Mann, der durch die Katastrophe seine Eltern und einen Bruder verloren hat, traumatisiert worden sei, da er fortwährend Alpträume gehabt habe und von den Jahrestreffen der Lawine in Blons am 11. Jänner stets betrunken heimgekehrt sei. Erst nachdem sie ihn bewogen habe, die Erlebnisse der Schreckensnacht aufzuschreiben, hätten sich die Alpträume gelegt, und er sei fortan nüchtern von den Gedenkfeiern nach Hause gekommen. Das sei allerdings erst im Jahre 1987 gewesen, 43 Jahre nach der Katastrophe. Einer weiteren Informantin sind wir mit einer gewissen Scheu begegnet, weil uns mitgeteilt worden war, dass man sie pfleglich behandeln müsse aufgrund ihres schrecklichen Schicksals, habe sie doch ihre beiden Kinder in der Unglücksnacht verloren und das nie verwunden. Wir befragten die Frau daher sehr behutsam, wobei sie dann allerdings von allein sehr ausführlich über die damalige Situation berichtete. Hinsichtlich ihres Zustands war sie sich im Klaren, denn sie meinte bereits zu Beginn des Interviews, dass sie damals einen Psychiater benötigt hätte. Bereits diese knappen Skizzen machen einen Unterschied zu Galtür deutlich, wo die Einheimischen sich sehr ausführlich mit dem Desaster befasst haben. Das betrifft auch die Art und Weise, wie man öffentlich mit der Lawine umgeht. Das markanteste Zeichen dafür ist in Galtür das Alpinarium, welches als Teil der Schutzmauer ein Museum ist, das in würdiger Weise an die Katastrophe von 1999 und ihre Opfer erinnert. In Blons existiert zwar auch ein „Lawinendokumentationszentrum“, aber es ist im Gemeindeamt untergebracht und besteht einzig und allein aus einer Zeitleiste an der Wand (!), welche den Zeitpunkt der verschiedenen Lawinenabgänge markiert. In dieses Bild passt, dass der Bürgermeister sich im Gespräch mit uns darüber beklagt hat, dass man, wenn man in Vorarlberg den Namen „Blons“ höre, stets nur an die Lawine von 1954 denke. Ihm sei demgegenüber an einem positiven Image gelegen, denn der Ort sei die jüngste Gemeinde Vorarlbergs, viele junge Leute würden sich heute dort ansiedeln. Aus meiner Sicht ist das ein Akt der Verdrängung, zumal Innovationsbereitschaft keinen Widerspruch dazu bilden muss, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Anscheinend sind es unbewusste Mechanismen, die dafür Sorge tragen, dass man sich heute genauso wenig wie damals mit dem Geschehen auseinandersetzt. Seinerzeit war das noch eher verständlich, denn 1954 war der Zweite Weltkrieg erst neun Jahre vorbei, und man war nicht darauf erpicht, auf die Schreckensjahre zwischen 1939 und 1945 zurückzublicken, sondern nach vorne zu schauen und sich ganz und gar dem Wiederaufbau zu widmen. Diese mentale Struktur wird sich auch auf die Lawine von Blons ausgewirkt haben, statt über seelische Belange zu sprechen. Obwohl die Galtürer traditionellen Werten und der katholischen Religion eine große Bedeutung beimessen, sind sie, was die Aufarbeitung der Katastrophe angeht, sehr modern vorgegangen, denn sie haben die Angelegenheit nicht unter den Teppich gekehrt, sondern haben sich „psychotherapeutisch“ verhalten, indem sie sich intensiv und aktiv mit dem Geschehen auseinandergesetzt haben. Man kann den Einwand erheben, dass die Zeit um die Jahrtau9 sendwende eine modernere war als 1954 und dass man in der Gegenwart aufgeschlossener ist. Das ist sicher richtig, aber selbstverständlich ist es auch heute noch nicht, dass man sich nach einem Desaster ausführlich damit auseinandersetzt. Der Vortrag wurde anhand der folgenden Literatur zusammengestellt: Rieken, Bernd: Schatten über Galtür? Gespräche mit Einheimischen über die Lawine von 1999. Ein Beitrag zur Katastrophenforschung. Münster, New York: Waxmann 2010 [215 Seiten]. Rieken, Bernd: Die Lawine von Galtür und der Risikodiskurs. In: Jahrbuch für europäische Sicherheitspolitik 2009/2010, S. 99–104. Rieken, Bernd: Die Lawinenkatastrophe von Galtür. Über mentale Bewältigungsmechanismen beim Siedeln am „Rande der Welt“. In: zoll+ | Österreichische Textedition für Landschaft und Freiraum Nr. 16, 2010, S. 73–77. Rieken, Bernd: „Hast du die Sorge nie gekannt?“ Tiefenpsychologische Zugänge zur Bedeutung von Angst, Aggression, Intentionalität, Ganzheit. Theoretische Überlegungen und qualitative Interviewauswertung. In: Alexander Siedschlag u. Rosemarie Stangl (Hg.): Methodenhandbuch ziviler Sicherheitsforschung. In Druck. 10