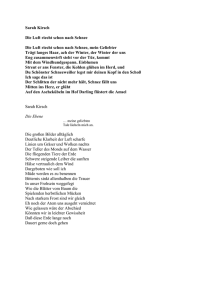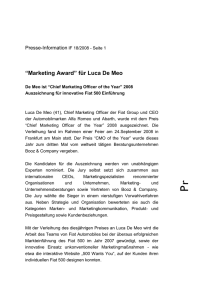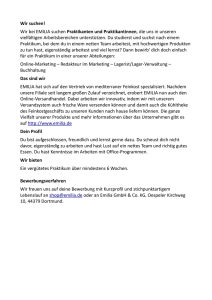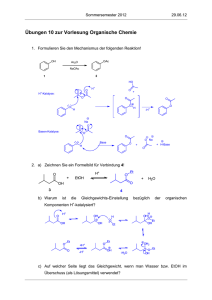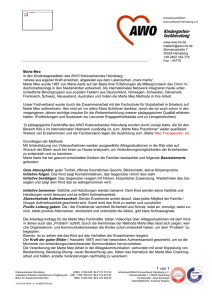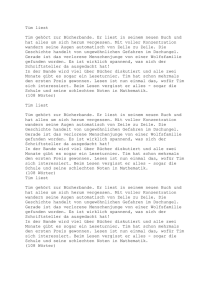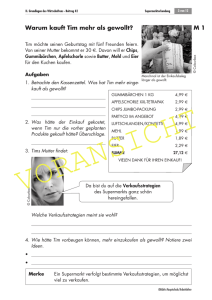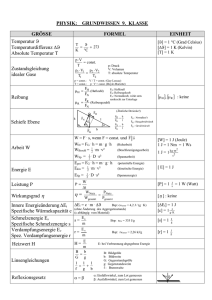BUCHMANUSKRIPT__TEIL 1 98KB Jul 04
Werbung
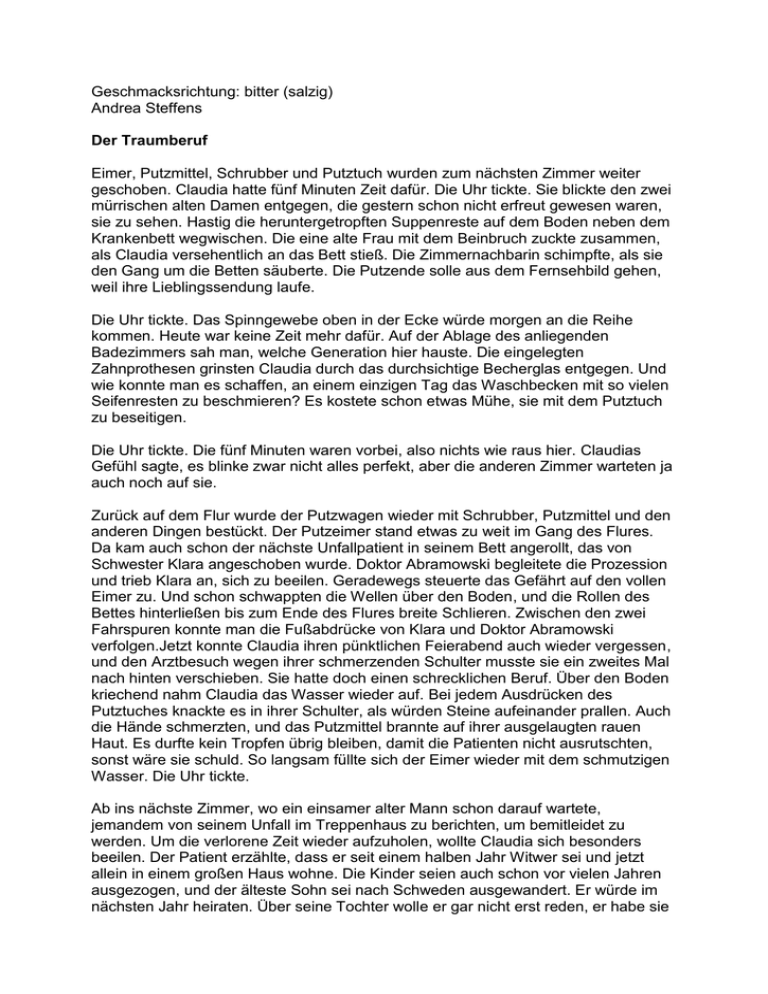
Geschmacksrichtung: bitter (salzig) Andrea Steffens Der Traumberuf Eimer, Putzmittel, Schrubber und Putztuch wurden zum nächsten Zimmer weiter geschoben. Claudia hatte fünf Minuten Zeit dafür. Die Uhr tickte. Sie blickte den zwei mürrischen alten Damen entgegen, die gestern schon nicht erfreut gewesen waren, sie zu sehen. Hastig die heruntergetropften Suppenreste auf dem Boden neben dem Krankenbett wegwischen. Die eine alte Frau mit dem Beinbruch zuckte zusammen, als Claudia versehentlich an das Bett stieß. Die Zimmernachbarin schimpfte, als sie den Gang um die Betten säuberte. Die Putzende solle aus dem Fernsehbild gehen, weil ihre Lieblingssendung laufe. Die Uhr tickte. Das Spinngewebe oben in der Ecke würde morgen an die Reihe kommen. Heute war keine Zeit mehr dafür. Auf der Ablage des anliegenden Badezimmers sah man, welche Generation hier hauste. Die eingelegten Zahnprothesen grinsten Claudia durch das durchsichtige Becherglas entgegen. Und wie konnte man es schaffen, an einem einzigen Tag das Waschbecken mit so vielen Seifenresten zu beschmieren? Es kostete schon etwas Mühe, sie mit dem Putztuch zu beseitigen. Die Uhr tickte. Die fünf Minuten waren vorbei, also nichts wie raus hier. Claudias Gefühl sagte, es blinke zwar nicht alles perfekt, aber die anderen Zimmer warteten ja auch noch auf sie. Zurück auf dem Flur wurde der Putzwagen wieder mit Schrubber, Putzmittel und den anderen Dingen bestückt. Der Putzeimer stand etwas zu weit im Gang des Flures. Da kam auch schon der nächste Unfallpatient in seinem Bett angerollt, das von Schwester Klara angeschoben wurde. Doktor Abramowski begleitete die Prozession und trieb Klara an, sich zu beeilen. Geradewegs steuerte das Gefährt auf den vollen Eimer zu. Und schon schwappten die Wellen über den Boden, und die Rollen des Bettes hinterließen bis zum Ende des Flures breite Schlieren. Zwischen den zwei Fahrspuren konnte man die Fußabdrücke von Klara und Doktor Abramowski verfolgen.Jetzt konnte Claudia ihren pünktlichen Feierabend auch wieder vergessen, und den Arztbesuch wegen ihrer schmerzenden Schulter musste sie ein zweites Mal nach hinten verschieben. Sie hatte doch einen schrecklichen Beruf. Über den Boden kriechend nahm Claudia das Wasser wieder auf. Bei jedem Ausdrücken des Putztuches knackte es in ihrer Schulter, als würden Steine aufeinander prallen. Auch die Hände schmerzten, und das Putzmittel brannte auf ihrer ausgelaugten rauen Haut. Es durfte kein Tropfen übrig bleiben, damit die Patienten nicht ausrutschten, sonst wäre sie schuld. So langsam füllte sich der Eimer wieder mit dem schmutzigen Wasser. Die Uhr tickte. Ab ins nächste Zimmer, wo ein einsamer alter Mann schon darauf wartete, jemandem von seinem Unfall im Treppenhaus zu berichten, um bemitleidet zu werden. Um die verlorene Zeit wieder aufzuholen, wollte Claudia sich besonders beeilen. Der Patient erzählte, dass er seit einem halben Jahr Witwer sei und jetzt allein in einem großen Haus wohne. Die Kinder seien auch schon vor vielen Jahren ausgezogen, und der älteste Sohn sei nach Schweden ausgewandert. Er würde im nächsten Jahr heiraten. Über seine Tochter wolle er gar nicht erst reden, er habe sie schon seit dem Tod seiner Frau nicht mehr gesehen. Am besagten Morgen habe der alte Mann nur kurz draußen auf der Treppe Salz streuen wollen, da habe er wohl einen Moment nicht aufgepasst. Wie lange wollte der Mann noch erzählen? Claudia hatte doch keine Zeit mehr. Nach ihrer Armbanduhr hätte sie schon seit einer Viertelstunde fertig sein müssen. Eigentlich tat ihr der Mann Leid, weil er doch niemanden hatte, der ihm zuhörte oder seine Geschichte hören wollte. Aber die Uhr tickte. Claudia entschuldigte sich, sie müsse weiter und würde morgen den zweiten Teil der Geschichte hören. Aber er schien das überhört zu haben, denn er erzählte noch, als Claudia aus dem Zimmer ging. Endlich fertig. Es blieb zwar keine Zeit mehr, sich vor dem Arztbesuch noch einmal zu Hause frisch zu machen, aber der Arzt würde bestimmt Verständnis haben. Vielleicht würde sie es so auch noch rechtzeitig zum Termin schaffen. Zügigen Schrittes ging Claudia bis zum Aufzug am Ende des Flures. Der Aufzug war , wie die elektronische Anzeige verriet, noch fünf Stockwerke von ihrer Etage entfernt, aber trotzdem würde sie mit ihm schneller im Wartezimmer sein als über die Treppe. Es schien Ewigkeiten zu dauern, bis sich die Aufzugtüren öffneten. Oh nein! Heute hatte man es aber auf sie abgesehen. Dicht gedrängt standen Frauen und Männer im Fahrstuhl. Jetzt musste Claudia doch die Treppe nehmen. Schwitzend und nach Luft schnappend kam sie im Wartezimmer an. Mit einem Blick auf die Uhr stellte Claudia fest, dass sie auf die Minute pünktlich war. Von Doktor Abramowski war noch keine Spur. Nach unendlich vielen Blicken auf die Uhr musste der Doktor doch endlich kommen. Oder hatte der Notfallpatient ihn aufgehalten? Hatte der Arzt vielleicht schon Feierabend und war nicht mehr im Haus, sondern auf dem Weg nach Hause? Langsam kam Doktor Abramowski zum Empfang und plauderte noch mit der Arzthelferin, nahm seine Jacke von der Garderobe und sagte im Vorbeigehen zu Claudia: „Kommen Sie morgen noch einmal wieder, Sie haben doch ein ernsteres Problem mit Ihrer Schulter. Das würde jetzt zu lange dauern. Sie sind ja eh im Haus. Ich habe jetzt Feierabend. Bis morgen.“ Geschmacksrichtung: umani (salzig) Andrea Steffens Die Schifffahrt Emil war sieben Jahre alt und lebte zusammen mit seiner Mutter in einer kleinen Wohnung in Bonn. Von seinem Zimmer aus beobachtete er jeden Tag die großen und kleinen Schiffe, die vor seinem Haus auf dem Rhein auf und ab fuhren. Emil hatte den Traum, einmal Matrose zu werden und die Sommertage auf dem Deck seines eigenen Schiffes zu verbringen. Das Schiff sollte blau angestrichen sein und der Name „Flipper“ sollte - mit gelber Schrift geschrieben - schon von weitem sichtbar sein. Nachts träumte Emil von den manchmal tagelang andauernden Fahrten auf dem Rhein. Er ging dann zusammen mit seinem Teddy Krümel zur Schiffsanlegestelle vor seinem Haus und stellte sich in der Schlange der Matrosen hinten an. In ihren blauweißen Uniformen sah seine Mutter ihn und Krümel immer besonders gerne. Als er das Schiff bestieg, fühlte er, wie es unter seinen Füßen zu schwanken und zu wackeln begann. Aufgeregt zeigte er Krümel das Deck des Schiffes, den großen Anker und das Wasser, das hinten aus dem Schiff zu sprudeln schien. Neben dem Schiff bildeten sich Wellen, die auf das Ufer zuschwappten und kleinere Boote auf dem Wasser zum Hüpfen brachten. Vögel kreisten am blauen Himmel über ihnen und unten im Wasser sahen sie einen großen Fischschwarm. Darunter waren kleine und große Fische. Es waren bestimmt mehrere Familien, die gemeinsam flussabwärts schwammen. Ein paar Minuten konnten sie mit der Geschwindigkeit des Schiffes mithalten. Emil setzte Krümel auf eine Bank nahe der Rehling, damit er die Fahrt weiter genießen konnte, denn er schien es zu mögen. Dann wollte er nachsehen, wie er das Schiff beim nächsten Halt festbinden konnte. Er suchte ein dickes Tau, das das Schiff halten konnte. Als er keines fand, warf er fürs erste die Bälle zu den Seiten des Schiffes hinaus, die verhindern sollten, dass das Schiff gegen die Hafenmauern donnerte. Danach kehrte er zu Krümel zurück. Doch wo war der? Emil rief seinen Name mit lauter Stimme, aber es kam keine Antwort. Krümel konnte doch nicht schwimmen! Das Schiff wankte heftig, und es schüttelte Emil am ganzen Körper. Die Wellen wurden immer kräftiger, der Wind peitschte Emil um die Ohren. Wo war Krümel nur? Das Dröhnen einer Sirene riss ihn aus seinen Gedanken. Sein Wecker klingelte. Ängstlich schlug Emil die Augen auf. Er erschrak. Wo war Krümel? War er ertrunken? Vielleicht hatten die Fische ihn ja gesehen, aber sie waren nicht mehr da. Vor Emils Augen wurde es nebelig, und er konnte nicht einmal die eigene Hand vor den Augen sehen. Der Wellengang wurde sanfter. Emil tastete um sich, doch nirgendwo konnte er seinen flauschigen Freund finden. Das Bild wurde schärfer. Die Bettdecke bis zur Nase gezogen. Neben seinem Kopfkissen lag Krümel nicht. Auf dem Boden war keine Spur von ihm. Dann erinnerte sich Emil, er hatte den kleinen Teddy ja bei seinem Freund Max vergessen. Geschmacksrichtung: bitter (sauer) Andrea Steffens Der Schatten Seit etwa einem Jahr waren ihre Eltern jetzt schon fort. Linh konnte sich noch genau an die Szene erinnern. Da waren diese großen Männer gewesen, das Brummen eines Lastwagens und die vielen Schreie auf der Straße vor dem Haus. In der nächsten Minute war alles still geworden. Linh drückte ihre beiden kleinen Schwestern Youna und Nuri an ihren Körper. Ihre Körper waren warm. Auch wenn es so dicht aneinandergedrängt wärmer war, durchdrang die Kälte der Lehmwand langsam ihre Körper. Sie teilte das alte Bett, das aus nichts als einer Matratze bestand, mit Youna und Nuri. Die ersten Sonnenstrahlen suchten sich den Weg durch die Ritzen der Wand hindurch. Linhs Magen knurrte, als sie ihre zierlichen Hände auf die Schultern der Schwestern legte und sie wachrüttelte. Noch verschlafen rieben sie sich den Sand aus den Augen und nahmen auf den kleinen Holzstühlen, die der Vater einst für sie gebaut hatte, am klapprigen Tisch Platz. In der Mitte des Tisches stand der Tonteller mit den letzten Brotkrumen. Linh konnte ja heute einmal weniger essen, damit die Kleinen wenigstens etwas mehr hatten. Es würde schließlich ein langer Tag werden.Die Brotkrumen waren so trocken, dass man sie fast nicht herunterschlucken konnte, aber die letzte Ziegenmilch hatten sie gestern schon ausgetrunken. Damit die Kleinen nicht an ihren Hunger denken mussten, nahm Linh sie mit aufs Feld, wo sie helfen sollten, das Unkraut zwischen den Reispflanzen herauszuziehen. Weil der Monsun zu wenig Wasser gebracht hatte, vertrockneten die Reispflanzen. Der Wind wehte Nuri mit einer leichten Brise entgegen und ließ ihre Haare tanzen. Außer Staub wurde vom Wind keine noch so kleine Wolke zu ihrem Feld herübergetragen. Sie mussten also noch bis zum nächsten Frühjahr auf Regen warten. Und diese Zeit konnte lang werden. Im letzten Jahr, als ihre Eltern noch da waren, war die Reisernte ausnahmsweise gut ausgefallen. Aber dieses Jahr würde das anders sein. Die Dämme um das Feld waren an einigen Stellen undicht geworden, und es war schon viel Wasser verloren gegangen. An einer größeren Wasserlache tranken die Kinder. Sie hatten gelernt, beim Trinken nicht zu viel Schlamm aufzuwirbeln und die Wasserläufer und andere Tierchen vorher beiseite zu schieben. Geschickt formten die Kleinen mit ihren Händchen eine Schale, aus der sie das Wasser schlürften. Es wurde Zeit zu arbeiten. Lehm, Steine, Gräser und Äste heranschaffen und die Löcher, die die Kühe aus der Nachbarschaft in die Dämme hereingetreten hatten, flicken. Nuri und Youna sammelten, wie Linh es ihnen gezeigt hatte, lange Grashalme und biegsame Äste, die auf dem Boden lagen. Dabei begegnete ihnen immer wieder eine Kraits, die sich aus ihrem Loch im Boden herausschlängelte. Ihr Vater hatte erklärt, dass sie giftig sei, aber wenn sie ihr nichts tun würden, würde ihnen auch die Schlange nichts antun. Zum Glück schlängelte sie sich auf das Nachbarfeld, und die Arbeit konnte weitergehen. Als die Sonne schon tief stand, war ein seltsames Brummen aus dem nahegelegenen Wald zu hören. Es wurde immer lauter. Äste knackten und Männerschreie waren zu hören: „Du Idiot, fahr nicht immer durch die Schlaglöcher! Rechts… links!“ Linh schaute vom Boden auf und reckte sich. Erst war nichts zu sehen, doch dann bahnte sich ein großer schwarzer Wagen den Weg durch die Sträucher und erreichte den Waldrand. Ein langer Schatten begleitete ihn. Was wollten diese Männer denn hier? Es kam doch fast nie ein Wagen hierher. Der Lastwagen verdeckte die Sicht auf Nuri. Er machte Halt. Aus dem offenen Fenster schrie ein dickbäuchiger Mann Linh mit rauchiger Stimme entgegen: „Wo geht es nach Krong Koh Kong?“ Der konnte einem vielleicht Angst einjagen! Unfähig zu sprechen streckte Linh zitternd den Arm aus und zeigte die Richtung an. Warum fuhr er denn nicht weiter? Er schien auf ein Signal aus dem Laderaum des Lastwagens zu warten und drehte seinen Kopf immer wieder nach hinten um. Nach etwa einer Minute setzte sich der Wagen mit einem lauten Knattern in Bewegung. Er hinterließ eine dicke schwarze Wolke. Jetzt war es wieder still. Linh machte einen tiefen Atemzug und ließ dann ihre Schultern fallen. Als die Sonne schon fast untergegangen war, schlief Linh mit einer dicken Träne, die ihre Wange herablief, nur noch mit ihrer Schwester Youna im Arm ein. Geschmacksrichtung: süß (umani) Andrea Steffens Erwachen Dunkel war es um mich herum. Kälte zog durch die Erde. Die letzten Kräfte nahm ich aus meinen Reserven. Aber bald würden auch sie aufgebraucht sein. Eine schwere Last lag auf mir. Dann wurde es etwas wärmer, und ein kleines Wasserrinnsal schoss an mir vorbei, das den Ritzen der Erde folgte. Mit meinen kleinen Armen krallte ich mich im Boden fest, um nicht weggespült zu werden. Plötzlich begann die Erde unter mir zu wanken, und neben mir erschien eine riesig große, mit schwarzem Fell überzogene Pranke. Und dann eine feuchte Nase, die immer wieder kleine Luftstöße zu mir herüberstieß. Oh - das war aber knapp! Beinahe hätte mich die riesige Pranke erwischt. Konnte dieser Wühler denn nicht aufpassen? Neben mir schob er die Erde nach oben. Ich schaute ihm noch eine Weile bei seiner Arbeit zu und bekam immer wieder einen kleinen Schrecken, wenn er seine Arme in meine Richtung ausstreckte, bis er schließlich wieder in den Tiefen des Erdbodens verschwand. Dann war wieder alles still. Nach einigen kalten Tagen und Nächten folgte ein wärmerer Morgen. Dumpfe Kinderschreie waren über mir zu hören. Ein Trampeln, das zarte Rauschen einer Windböe. Ein besonderer Geruch lag in der Luft. Irgendwoher kannte ich ihn. Frühling. Das war mein Signal. Ich machte einen langen Hals, reckte und streckte mich und schüttelte meine steifen Glieder aus. Vorsichtig bahnte ich mir einen kleinen Weg durch das Erdreich. Es war endlich so weit. An den schlafenden Insekten vorbei, an den kleinen Wurzeln der Gräser, durch die dicht verzweigten, fast undurchlässigen Mooswürzelchen. Auch sie drängten nach oben. Gerangel. Und dann erblickte ich zum ersten Mal in diesem Jahr das Sonnenlicht. Auch wenn es noch ein wenig kalt um mich herum war, spürte ich die Kraft der Sonne auf meiner Haut. Ich tankte neue Energie, und von unten drängte mein Hals nach: Er wollte auch an die Sonne. Die Grashalme rechts und links neben mir wehten im Wind. Bald konnte ich schon über sie hinwegschauen. Die Gesänge der Vögel und Schreie der Kinder wurden lauter und deutlicher. Jetzt konnte ich schon einem Jungen und einem kleinen Mädchen beim Ballspielen zuschauen. Hatte ich sie nicht schon im letzten Jahr gesehen? Sie mussten im Sommer gewachsen sein. Ich kannte sie. Aus dem obersten Teil meines grünen Halses formte ich zarte, weiße Blütenblätter. Und strahlte in voller Pracht der Sonne entgegen. Ich, das kleine Schneeglöckchen. Christoph Schneider Der entwickelte Mensch Schwupp. Der Bildschirm flackert auf, Stimmen ertönen. Er lässt sich mit einem lauten Stöhnen in den Sitz fallen. Das Leder knackt. Kalt fühlt es sich an. Schnell befindet er sich in seiner Sitzkuhle. So nennt er diese gemütliche Position im Sessel. Die Kuhle wird nicht mehr vom Leder ausgeglichen. Sie bleibt, auch wenn er aufsteht. Er muss sich strecken, um an die Fernbedienung zu gelangen, die ihm Tag und Nacht ein treuer Begleiter ist. Diese Anstrengung bringt ihn wieder zum Stöhnen. Dann, endlich, hat er sich wieder in seiner Sitzkuhle zurechtgefunden. Nun kann er durch die Fernsehwelt schalten. „Jetzt nur noch die Kräuter der Provence hacken und sie über die Kartoffeln geben. Fertig ist das Filet, serviert mit Kartoffeln und Rotkohl. Dazu empfehle ich einen Rotwein von dezenter Süße. - Wer aus dem Publikum möchte einmal probieren? Sie? - Liebe Zuschauer, ich bedanke mich für ihr Einschalten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zur nächsten Woche. Dann werde ich Ihnen zeigen, wie Ihnen ein perfektes Hähnchen gelingt…“ Die Titelmusik der Sendung erklingt wie immer zum Ende. Werbung. Er drückt sich mit den Armen aus dem Sessel und trottet in die Küche. Es ist wie ein langer, harter Weg. Er zieht die Tür auf und fühlt die Kälte auf seinen rundlichen Wangen. Wie von selbst streckt sich der Arm und ergreift den Schokoladenpudding. Die schmelzende Schokolade fast schon im Mund, nimmt er einen Esslöffel und wankt zurück. Den Puddigbecher fest umschlossen. Seine Beine geben nach, er fällt in den Sessel. Er schluckt kräftig. „…Im Anschluss folgt eine Dokumentation über die Hungerkatastrophe in Zentralafrika. Und nun zum Wetter. In der Nacht gibt es deutschlandweit Frost, und es ist leicht bewölkt. Im Verlauf des Tages jedoch wird es wärmer, und die Wolken ziehen fort. Vormittags sind Höchstwerte von 10 °C zu erwarten. Am Abend ziehen wieder Wolken auf, und es ist mit Regen zu rechnen. Außerdem kühlt es deutlich ab, sodass mit glatten Straßen gerechnet werden muss. Die nächste Nachrichtensendung folgt nach der Dokumentation…“ - Wieder erklingt eine sendungstypische Titelmusik. „Eine Milliarde Menschen hungern auf der Welt. Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind an Unterernährung…“ Der Löffel klackt gegen die Zähne. Der Mund füllt sich. Die Schokolade zerfließt im Mund. Schokolade. Süße. Nächster Löffel. Wieder füllt sich der Mund. Die Schokolade zerfließt im Mund. „…die Menschen hungern. Hier sehen Sie 9-jährige sudanesische Kinder, die kilometerlange Wege gehen müssen, um ein Wasserloch zu erreichen. Das sind Bilder aus einem größeren Ort. Die UN hatte geplant, Lebensmittel zu verteilen. Doch Unruhen innerhalb der Schlange der wartenden, hungernden Menge behinderten die Lebensmittelvergabe, sodass die Blauhelme die Verteilung stoppten und…“ Der Löffel bleibt im Pudding stecken. Er hat den Blick auf den Fernseher gerichtet, den Löffel zwischen den Fingern. Makaber. Da muss etwas getan werden. Es ist doch unfair. Er hat ein Leben im Überfluss, und sie dort? Was macht ihn besser, dass er dieses Leben hat? Also da muss etwas getan werden. Die Politiker sollten mal etwas tun. Diese armen Kinder. Diese Blauhelme… wie kann man die Vergabe einfach beenden… das geht doch nicht. „Nun stehen die Mütter und Väter mit leeren Händen da. Die Kinder hier sind bis auf die Knochen abgemagert, wie die Eltern auch…“ Schrecklich. Ekelhaft. Er stellt den Schokopudding auf den Tisch. Warum tut nicht mal jemand etwas? Die Geschäfte werfen so viel weg. Pure Verschwendung. Die Kinder wären froh, wenn sie etwas hätten. Dieses Elend auf der Welt. Dass es das heute noch gibt. Man mag es nicht glauben. So ein schreckliches Bild. Dann streckt er müßig seinen Arm zur Fernbedienung. Er zappt um. „So sieht Beatrice, das ehemalige Model, heute aus. Ihre Hüften sind deutlich breiter und es bildet sich schon ein Bäuchlein, wie man auf diesem Bild sehen kann. Peinlich, peinlich.“ Sein Blick wandert zum Schokopudding. Wie von selbst streckt sich der Arm. Der Schokopudding ganz nah. Der Löffel klackt gegen die Zähne. Der Mund füllt sich. Die Schokolade zerfließt im Mund. Schokolade. Süße. Christoph Schneider Ohne Titel Autos brüllen, Menschen knattern. Lärm umgibt mich. Hart knallt die Sohle auf den Asphalt. Der Schnee knirscht bei jedem der schnellen Schritte. Ein wunderbares Gefühl beim Blick durch den weißen Wald. Mein Blick schweift bis zum Ende des Weges, der nicht immer nur in eine Richtung weist. Er hat Kurven, Winkel, Kreuzungen. Doch alle führen hinaus, auf ihre Art und Weise. Zwar gibt es Umwege, doch Ruhe und ein klarer Kopf bringen einen auf den richtigen Weg. Der Wald ist dicht bewuchert. Wenn man überlegt, dass es kein Netz gibt, niemanden, der einem helfen könnte. Niemanden. Von unten steigt ein Gefühl bis hoch in den Kopf. Panik. Bin ich hier nicht schon vorbei gekommen? Laufe ich etwa im Kreis? Stopp! Anhalten. Das regelmäßige Knirschen der Schritte stoppt abrupt. Ich blicke mich um. Der Schnee spiegelt die strahlende Sonne. Das wunderbare Gefühl beschleicht mich wieder. Der Schnee knirscht bei jedem meiner Schritte. Ich weiß, wo ich hin will. Das Knirschen wird lauter, schneller, ruhiger. Ich gehe einen neuen Weg, einen anderen. Mitten durch die Baumlandschaft, das Ziel fest im Blick. Der Schnee schmilzt in meinen Schuhen. Zweifel durchzucken mich, ob das der richtige war? Vor mir bahnt sich ein neuer Weg, dem ich folge bis ans Ende. Die Sonne blendet mich. Hart knallt die Sohle auf den Asphalt. Autos flüstern, Menschen wispern. Christoph Schneider Der Kampf ums Vergessen Er sitzt am Tisch. Die Uhr tickt Sekunde für Sekunde. Tick, Tack, Tick, Tack. Der Kopf kippt. Die Wange wird gequetscht, die Haut wellt sich. Handknochen drücken gegen den Kiefer. Sein Blickfeld umgeben von Braun. Dunkel, eintönig wirkt es. Doch es rückt näher, und plötzlich es ist ganz und gar nicht mehr eintönig. Oben ist es heller als unten. Minimal, und doch sichtbar. Streifen durchziehen die Fläche. Sie sind kurz oder lang, waagerecht oder senkrecht. Eins, zwei, drei senkrechte Linien. Sechs, sieben, acht waagerechte. Dazu diagonale. Vier? Nein, Fünf. Drei plus acht plus fünf ist gleich sechszehn. Der Kopf hebt sich. Sein Blickfeld ist jetzt geflutet von verschiedensten Farben. Auf etwas Viereckiges an der Wand treffen seine Augen. Von oben bis unten stehen Zahlen links am Rand. Dazu rechts: große weiße leere Flächen. Gähnende Leere. So viel Zeit. Sein Blick entdeckt einen weiteren Teil der Wand. Wieder etwas Viereckiges. Der Rand ist silbern glänzend. Im Inneren wird das Licht der Lampe gespiegelt. Dahinter befindet sich ein Oval. Oben, am Rand des Ovals befinden sich kurze, braune Streifen. Sie wirken geordnet, in eine Richtung verlaufend. Keiner der Streifen sticht hervor, alle liegen flach auf dem Oval und verlaufen bis kurz vor zwei Kreisen in der Mitte des Ovals. Einer liegt rechts, der andere links, symmetrisch zueinander. Der Anblick ist ihm bekannt. Seine Brust schwellt sich. Die gleichen Augen wie er. Die Haare von der Mutter. Sein Blickfeld, durchflutet von Schwarz. Er kann nur zwei helle Punkte erkennen. Sie kommen plötzlich auf ihn zu. Laute Geräusche um ihn herum. Er blickt hinter sich. Das kleine Geschöpf liegt im Kindersitz. Die Augen schwammig. Er fühlt die Haut in dem kurzen Moment, bis die zwei Punkte direkt vor ihm...grau... Sein Blickfeld ist wieder durchflutet von verschiedensten Farben. Etwas Rundes fällt ihm ins Auge. Der bekannte Anblick, das bekannte Geräusch. Tick, Tack, Tick, Tack. Zeit. Greifbar und doch unantastbar, wenn sie vergangen ist. Es bleiben vielleicht Fotos und Filme. Doch sie sind niemals so greifbar und umfassend wie Erinnerungen. Diese können nicht erlöschen. Nein, niemals. Er wird sie niemals vergessen. Er blickt zum Viereck mit dem Oval zurück. Seine Brust hebt sich. Doch dann kommt wieder ein Stich ins Herz. Sein Blickfeld wird schwarz. Die hellen Punkte direkt vor ihm. Er streckt den Arm nach hinten. Die Fingerspitzen berühren etwas Weiches, Zartes. Ein kurzer Moment der Berührung, des Glücks. Die Hupe dröhnt im Schädel. Sie kommt aus der Richtung der Scheinwerfer. Sein Blickfeld ändert sich wieder so plötzlich wie schon zuvor. Er fühlt sich, als habe ihn jemand kurz in eine andere Welt transformiert. Einige Wasserperlen rutschen entlang seiner Wange. Die Augen sind weit aufgerissen. Er hört die Schläge seines Herzens. An seinen Zähnen spürt er den heftigen Luftzug, den seine Lunge erzeugt. Seine Wirbelsäule ist gestreckt, er sitzt steif. Dieses Gefühl beschleicht ihn wieder. Immer wieder. Seit Wochen. Wo sind die Erinnerungen an gute Zeiten? Seine Stirn kräuselt sich. Im Innern seines Kopfes herrscht ein großer Druck. Er fühlt sich an, als wolle der Kopf auseinanderspringen. Wo waren sie? Er blickt wieder zum Viereck. Sein Blickfeld ist schwarz. Den Kopf zurückgewendet, die Fingerspitzen des Menschen hinter ihm berührend, in die großen, schwammigen Augen blickend, das laute Dröhnen hörend, verzweifelt schreiend, prallen die zwei hellen Punkte auf die Karosserie seines Autos und reißen den wichtigsten Menschen seines Lebens hinfort. Christoph Schneider Heikle Welt Schon wieder. Er drückt die Klinke der Tür hinunter und es überschwemmt ihn ein Tsunami von Geräuschen. Er kämpft dagegen an und tritt ein. Die Tasche zerrt an seinem Arm. Er bringt ihn ins Schwingen und öffnet seine Hand. Der Schall prallt durch den Raum und kämpft gegen den Tsunami an. Keine Chance. Er dreht sich um, hebt die Hand und spreizt die Finger. Er übt Druck auf die Fläche hinter ihm aus. Die Fingernägel kratzen über die Fläche. Der schrille Ton kämpft gegen den Tsunami an und siegt. Es wird ruhig im Raum. Alle Blicke sind nun auf ihn gerichtet. Manche Gesichter zeigen ein überhebliches Grinsen. Andere eine gekräuselte Stirn, verengte Augen und schmale Lippen. Die meisten jedoch zeigen weder das eine noch das andere. Die Botschaft ist eindeutig an ihn. Er weiß es. Sie wissen es. Was soll er mit ihnen anfangen? „So Leute. Wie sieht’s aus? Hat jemand die Aufgaben für heute gemacht?“ - Stille… - “Das war wohl zu erwarten. Na gut, ich denke, dann wird es für die Damen und Herren auch kein Problem sein, heute wieder einmal länger zu bleiben.“ Da kommt er wieder. Der Tsunami der Geräusche. Dumpf und grollend fällt er über ihn her. „Ruhe!“ Seine Stimme droht fast unterzugehen, kann sich der Monsterwelle aber doch noch erwehren. Es wird wieder ruhiger. „Nun zum Stoff.“ Ein dumpfes Vibrieren erfasst seine Ohren. Er blickt sich um. Im selben Moment geht es los. Hip Hop schallt ihm entgegen, zudem eine Welle spöttischen Gelächters. „José?! Ist das schon wieder dein Handy?“ „Kann sein. Ja. Wichtiger Anruf. Muss raus.“ „Ne, Ne, Ne. Setz dich, José. Ich möchte, dass du das Handy ausmachst und weiter an meinem Unterricht teilnimmst.“ „Das kannste vergessen. Ich hab hier keinen Bock drauf und der Anruf is wichtig.“ „Ich kann hier nichts vergessen, José. Mach das Handy jetzt bitte aus. Ansonsten werde ich es mir nehmen müssen.“ Mit schnellen Schritten durchquert er den Raum. Alle Blicke auf ihn gerichtet. Sein Herz pocht. Vor dem Tisch von José bleibt er stehen, streckt den Arm und öffnet die Hand. Sein Herz springt ihm fast aus der Brust. Woher kommt dieser Geruch nach… nach Tequila? José macht keinerlei Anstände, irgendetwas zu tun, und tippt seine SMS weiter. „Mach du da weiter deinen Mist und ich mache hier meinen.“ „José, das reicht jetzt. Du weißt, dass eingeschaltete Handys während des Unterrichts verboten sind. Gib es mir jetzt.“ Seine Hand wird zurückgeschlagen, und vor ihm baut sich José auf. „ Alter Mann, geh!“ „José, ich bleibe, bis ich das Handy habe, hier stehen“. Tequila? Nein, Wodka. „José hast du etwa…“ Blitze donnern gegen seine Augen. Einen Moment später spürt er die harten Knochen gegen seine Backen prallen. Seine Beine geben nach. Er knallt auf den Boden. Was war das? Ist er jetzt völlig übergeschnappt? Er blickt nach oben und sieht Josés Gesicht. „Das wollte isch schon immer mal machen!“ Er verliert das Gesicht aus den Augen und hört nur noch die Springerstiefel auf den Boden knallen. Dann wird die Tür aufgerissen und er hört wieder einen Knall. „Verdammt. Geh mal jemand nen Sanitäter holen. Das sieht übel aus“ „Krass! Voll auf die Zwölf.“ Er zieht sich am Tisch hoch. Einige Mädchen helfen ihm. Sein Schädel dröhnt, die Wangen schmerzen. Er wankt zum Pult, nimmt seine Tasche, gefolgt von den Blicken der Schüler. „Ich bin gleich wieder da“, zischelt er ihnen noch zu. Dann öffnet er die Tür und geht durch den Flur. Dieser kleine Mistkerl. Jetzt ist Schluss. Er geht schnurstracks ins Büro des Direktors. „Sir, ich habe wieder einen Vorfall zu vermelden.“ „Oh mein Gott. Setzen sie sich. Ist bei Ihnen alles in Ordnung?“ „Ja, ja. Es war wieder José. Sir, ich bitte Sie, geben Sie ihn ab. Bringen Sie ihn sonstwohin, aber ich schaffe das nicht mehr.“ „Ja… Sie haben wohl recht.“ Am selben Abend. Er beendet gerade seinen letzten Termin des Elternsprechtags und begibt sich auf den Heimweg. Es ist bereits dunkel, typisch für diese Jahreszeit. Er steigt in sein Auto und macht sich auf den Weg. Die erste Ampel: Oh nein, er hat Pech. Rot. Einmal Rot, wird er wohl nur rote Ampeln erwischen. Klasse. Nach einer gefühlten Ewigkeit schaltet die Ampel ganz langsam auf Grün. Endlich. Doch einige Momente später, wie erwartet: wieder rot. Er blickt rechts aus dem Fenster und erkennt im Schein der Straßenlampe eine kleine Gruppe. Die Kapuzen sind hochgezogen, und es schüttelt ihn bei der Vorstellung, diese Typen auf freier Straße zu treffen. Plötzlich drehen sie sich um und laufen auf ihn zu. Sie haben Baseballschläger in der Hand. Und das einzige, woran er sich erinnern kann, ist der Geruch von Wodka. Nein, von Tequila. Sabrina Jütten Die Überraschung Es war Montagmorgen, ein schöner, sonniger Tag in den Sommerferien. Draußen konnte man dem Gezwitscher der Vögel lauschen. Drinnen saß Tim mit seiner Familie am frisch gedeckten Küchentisch und frühstückte. Sein Vater Rudolf saß wie gewöhnlich am Kopf des Tisches. Auch seine Mutter Elisabeth sowie seine beiden jüngeren Schwestern Miriam und Lisa waren an diesem Morgen um den Küchentisch versammelt. Tim betrachtete gähnend den gedeckten Frühstückstisch. Die selbst gemachte Erdbeermarmelade, die frischen Brötchen aus der Nachbarsbäckerei Spoden, der Käse, die frische Wurst vom Metzger, die Butter, der Geruch des dampfenden Kaffees und der Kakao ließen ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. „Miriam reichst du mir mal bitte die Butter?“, bat der Vater mit freundlicher Stimme Tims Schwester, die seiner Bitte direkt folgte. Es kam selten vor, dass Tim mit der ganzen Familie zusammen am Tisch saß, da sowohl sein Vater als auch seine Mutter berufstätig waren. Umso mehr genossen seine Eltern es, wenn sie einmal in Ruhe mit all ihren Kindern zusammen frühstücken konnten. An diesem Montag schienen sich Rudolf und Elisabeth komischerweise frei genommen zu haben. Was mochte das nur zu bedeuten haben? Tim und seine beiden jüngeren Schwestern wussten es nicht, aber es hatte bestimmt nichts mit ihnen zu tun. Früher oder später würden sie den Anlass sicher noch erfahren. Plötzlich fragte die neugierige Lisa auch schon mit vollem Mund: „Warum habt ihr euch eigentlich frei genommen?“ „Lisa, man spricht nicht mit vollem Mund!“, wies die Mutter Lisa sofort zurecht und schaute sie dabei vorwurfsvoll an. Lisa senkte ihren Kopf und schaute beschämt und eingeschüchtert zu Boden. Warum müssten Eltern immer so streng zu ihren Kindern sein? Man würde doch wohl einmal gegen die alten Tischmanieren verstoßen dürfen - immer diese blöden Vorschriften! Sowohl Tim als auch seine Schwester Miriam beobachteten mitleidig die traurige Reaktion Lisas, und Miriam betonte mit ernster Stimme: „Ich würde aber auch gerne wissen, weshalb ihr euch frei genommen habt. In den Ferien kommen wir nämlich auch ganz gut ohne euch zurecht! Sonst müssen wir auch immer gucken, wie wir klar kommen.“ Da musste Tim seiner Schwester ausnahmsweise auch einmal Recht geben. Schließlich waren sie ja keine Babys mehr. Doch es gab keine Zeit mehr, weiterhin über die Äußerung von Miriam nachzudenken, denn die laute Stimme des Vaters riss alle aus ihren Gedanken. „Jetzt mach aber mal halblang, Miriam!“, rief er, machte danach eine kurze Pause, nahm einmal tief Luft und verkündete mit einem Lächeln auf den Lippen: „Wir dachten, es wird Zeit, dass wir noch einmal etwas mit der ganzen Familie unternehmen. Aus diesem Grunde machen wir heute einen Familienausflug mit euch. Um 11.00 Uhr werden wir gemeinsam nach Bonn ins Haus der Geschichte fahren und anschließend in der Stadt shoppen gehen. Es sollte eine Überraschung für euch sein.“ Tim und seine beiden Schwestern konnten kaum glauben, was sie da soeben gehört hatten, und schauten sich erstaunt an. Das war ja der Hammer. Was wollten die Eltern denn da mit ihnen machen? Das war doch lachhaft… ins Haus der Geschichte fahren! Wollten die Eltern sie dort wie kleine Hündchen an der Leine herumführen? Und als ob das noch nicht genug wäre, sollten sie danach auch noch shoppen gehen. Ne, danke, das war wirklich zu viel verlangt, oder nicht? Nachdem Tim die Pläne seiner Eltern halbwegs aufgenommen hatte, rief Miriam auch schon entsetzt: „Aber ich bin doch… Autsch, du Blödmann!“ Miriam wurde abrupt unterbrochen, weil Tim ihr unterm Tisch einen Fußtritt ins Schienbein versetzt hatte. Er wusste nämlich genau, dass Miriam heute schon eine „wirklich wichtige Verabredung“ mit ihrer Freundin hatte. Allerdings war er der Meinung, dass sie den Familienausflug mit ihren Eltern machen sollten, auch wenn er selbst nicht so richtig begeistert davon war. Seine Schwester Miriam schaute ihn indes wütend an. Wahrscheinlich war sie jetzt stinksauer auf ihn, weil er ja wusste, dass sie heute schon etwas Besseres vorhatte. Sie fand ihn bestimmt mal wieder so richtig gemein. Große Brüder sollten ja immer gemein sein. Dafür konnten kleine zickige Schwestern ihm aber manchmal auch so richtig auf die Drähte gehen. Na ja, Miriam würde schon drüber hinwegkommen. Das Treffen mit ihrer Freundin konnte sie ja nachholen. Sie sollte sich also nicht so anstellen. Ein bisschen Zeit musste man schließlich auch für die Familie haben. So ließ Tim den tötenden Blick seiner Schwester gelassen auf sich ruhen, der wahrscheinlich wieder so viel bedeutete wie “Das kriegst du noch zurück, großer Bruder!“ Tim war der Ansicht, dass es vielleicht wirklich das Beste für alle Beteiligten wäre, wenn er und seine beiden jüngeren Schwestern ihre Eltern nicht enttäuschen würden. Schließlich hatten seine Eltern sich extra frei genommen, um einmal etwas mit ihren Kindern zu unternehmen.Die Eltern wollten doch letztendlich nur das Beste für ihre Kinder, oder? Tim war sich da – ehrlich gesagt – etwas unsicher. Um die gereizte Stimmung am Küchentisch endlich aufzuheitern, wandte Tim sich seinen Eltern zu und sagte: „Die Überraschung ist euch aber gelungen!“ Sofort stimmte ihm seine jüngste Schwester Lisa mit fröhlich erregter Stimme zu: „Genau, das find ich auch! Ich wollte schon immer einmal ins Haus der Geschichte.“ So schien Lisa wohl die einzige zu sein, die von den Plänen der Eltern begeistert war. Tims Eltern schauten sich zufrieden an, und die Mutter sagte zu Tim und seinen beiden jüngeren Schwestern: „Das freut uns natürlich, dass euch die Überraschung gut gefällt. Um 11.00 Uhr seid ihr dann bitte alle startbereit, okay?“ Tim und seine Schwestern nickten mit den Köpfen und antworteten im Chor: „Ja, Mama, dann sind wir fertig …und keine Minute später!“, bevor sie dann noch zu Ende frühstückten. Tim schaute diesem Familienausflug nun mit gemischten Gefühlen entgegen. Einerseits hätte er an diesem Tag lieber etwas anderes gemacht als irgendwo mit seiner Familie herumzuhängen. Aber andererseits zeigte er sich auch optimistisch. Vielleicht würde dieser Familienausflug ja auch schöne Erinnerungen an die Familie bei ihm hinterlassen. Man wusste ja nie. Zum vereinbarten Zeitpunkt saßen aber alle – Tim, seine jüngere Schwester Miriam, seine jüngste Schwester Lisa, Vater Rudolf und Mutter Elisabeth – im Auto, egal ob sie jetzt Lust hatten mitzufahren oder nicht. Miriam und Mutter Elisabeth hatten beide ihre großen Handtaschen und Lisa ihre kleine, pinkfarbene Umhängetasche dabei. Tim und sein Vater brauchten natürlich nichts außer ihr Portemonnaie, das sie in ihrer Hosentasche verstaut hatten. Außerdem hatte Tim aber auch noch sein nagelneues Smartphone eingepackt, das er auf jeden Fall dabei haben musste. Davon würde ihn wohl nichts und niemand abhalten können. Schließlich musste er ja immer erreichbar sein. So saß Tim also mit seiner ganzen Familie im Auto und es konnte endlich losgehen. Sabrina Jütten Eiseskälte Hunderte Schneeflocken tanzen durch die Luft. Jeder Versuch, sie zu zählen, scheitert, weil man die Orientierung verliert. Es sind einfach zu viele, die in der Winterluft ihre Tänze vollführen. Hinzu kommt, dass die Schneeflocken sich so sehr ähneln wie eineiige Zwillinge. Egal, wie viele es nun sein mögen, irgendwann landet schließlich jede von ihnen irgendwo auf der gefrorenen Erde. Dort treffen sich alle Schneeflocken, die vom Himmel zur Erde geschickt werden, wieder. Die kalten Temperaturen machen es ihnen möglich, dass sie auf dem Boden liegen bleiben und nicht sofort schmilzen. So bilden sie eine geschlossene Schneedecke, und ihr Aufenthalt auf der Erde ist für eine begrenzte Zeit gesichert, fast so wie bei den Menschen, die nur für eine kurze, viel zu kurze Zeit auf dieser Erde leben dürfen. Katharina sitzt in ihrer Wohnung am Esstisch und beobachtet durch das Küchenfenster diesen Tanz der Schneeflocken. Langsam schlürft sie ihren Pfefferminztee, den sie sich soeben zubereitet hat, aus ihrer orangefarbenen Lieblingstasse, auf der in großen schwarzen Buchstaben TEATIME steht. Ab und zu wärmt sie ihre dünnen Hände an dem Tee. Draußen türmt der Schnee sich langsam Schicht auf Schicht und wird immer höher und höher. Die Welt scheint im Schnee zu versinken, und man verliert den Überblick. Für einen Moment sieht es so aus, als wenn dieser Winter niemals enden würde. Während Katharina so an dem Esstisch sitzt, schaut sie gedankenverloren in den Himmel, von dem die Schneeflocken hinabrieseln. Tausende Gedanken schwirren dabei durch ihren Kopf. Es ist fast wie eine lange Schneelawine. Dieser Winter erschien Katharina merkwürdig, aber warum? Was unterschied ihn eigentlich von all den anderen Wintern, die sie bisher erlebt hatte? Ein Winter mit viel Schnee war für die Menschen in Deutschland doch normal. Trotzdem war es dieses Jahr etwas anderes. Dieser Winter hatte eine extreme Kälte mit sich gebracht, die Katharina und wohl auch allen anderen Menschen auf dieser Erde in Deutschland vorher noch nicht bekannt gewesen war. Katharina mochte diese Kälte nicht, weil sie selbst eine echte ´Frostbeule´ war, wie ihre Mutter immer zu ihr gesagt hatte, als Katharina noch ein Kind war. Aber Katharina war bestimmt nicht die Einzige auf dieser Erde, die höchst empfindlich darauf reagierte. Diese Minustemperaturen durchdrangen die Menschen bis ins Mark und ließen die Erde frieren. Ohne dicke Winterkleidung wagte man es nicht einen Schritt nach draußen. Wie mochte es wohl all den Tieren gehen, die Winterschlaf hielten? Waren sie auf die extreme Kälte vorbereitet gewesen? Bestimmt nicht, aber wer wusste das auch schon? Na ja, zum Glück war sie jetzt in ihrer gemütlichen, warmen Stube vor der bitteren Kälte, die draußen herrschte, sicher. Katharina war dankbar dafür, dass sie hier leben durfte. Sie war sich nämlich bewusst, dass es nicht selbstverständlich war in einer solchen Stube zu leben. Viele Menschen auf dieser Welt hatten kein Dach über dem Kopf oder sie hatten keine Möglichkeit sich und ihre Familien bei diesen hohen Minustemperaturen warmzuhalten. Erst gestern hatte Katharina einen Zeitungsartikel gelesen, in dem die Leser darüber informiert wurden, dass diese Kälte schon 50 Todesopfer gefordert hatte. Das war doch kaum zu fassen – 50 Todesopfer! Katharina taten die betroffenen Menschen leid. Hoffentlich mussten nicht noch mehr Menschen sterben. Warum gab es eigentlich immer so viel Unglück auf dieser Erde? Was würde in Zukunft noch alles geschehen? Würde die Menschen im nächsten Jahr wieder so ein bitterkalter Winter erwarten? Bitte nicht! Diese Kälte war doch eine Zumutung für die Menschen auf dieser Erde. Würde Katharina im nächsten Jahr auch noch in einer gemütlichen, warmen Stube leben? Leider konnte sie sich diese Fragen nicht beantworten. Es würde ihr wohl nichts anderes übrig bleiben als über mögliche Antworten zu spekulieren. Sie musste „abwarten und Tee trinken“, wie ihre Oma immer so schön zu ihr gesagt hatte, wenn sie als Kind bei ihr am Küchentisch saß und einen Früchtetee trank. Irgendwann würde man ja schon sehen, was einem die Zukunft noch alles bringen würde. Unglücklicherweise gehörte Katharina aber zu den Menschen, die ungeduldig waren und nicht gut abwarten konnten. Na ja, zuerst müssten die Menschen diesen Winter einmal überstehen, dann konnte man weiter sehen. Katharina schaut noch immer nachdenklich und ein wenig ungeduldig in den Himmel, als wenn dieser ihr eine Antwort auf all die Fragen geben könnte. Plötzlich wird sie durch entsetzliche Schreie, die von irgendwo zu ihren Ohren dringen, aus ihren Gedanken gerissen. Dabei wirft sie vor Schreck fast ihre Lieblingstasse um, die vor ihr auf dem Esstisch steht und noch zur Hälfte mit Pfefferminztee gefüllt ist. Katharina schreckt auf. Was war hier los? War Katharina jetzt etwa völlig verrückt geworden? Sie musste unbedingt herausfinden, woher die Schreie kamen. Vielleicht war ja jemand verletzt, konnte ja sein. Es kam ja nicht selten vor, dass im Schnee kleinere oder größere Unfälle passierten. Sie eilt zum Küchenfenster und schaut hinaus. Doch im ersten Moment sieht Katharina nur Schneeflocken und den hohen Schnee. Sie wird unruhig, und ihre Hände verkrampfen sich. Bei jedem Schrei zuckt ihr ganzer Körper vor Angst leicht zusammen. Wer schrie da nur so entsetzlich? Katharina schaut jetzt angestrengt aus dem Küchenfenster, und vor ihren Augen zeichnet sich langsam ein deutliches Bild ab, das nicht mehr nur von Schnee und Schneeflocken geprägt ist. Na endlich, die Quelle, von der die Schreie an ihre Ohren dringen, ist gefunden. Katharinas Aufregung lässt allmählich nach, und ihre Erleichterung steht ihr mitten ins Gesicht geschrieben. Draußen sieht Katharina drei Kinder aus der Nachbarschaft zwischen sieben und zehn Jahren, die ausgelassen im Schnee spielen und dabei vor Freude aufschreien. Alle drei sind in dicke Winterkleidung Mütze, Schal, dicke Handschuhe, hohe Winterstiefel, Schneeanzug - eingemummelt und haben schon rote Bäckchen von der Kälte. Katharina seufzt leise auf. Puh, das Geschrei hatte ihr ja einen Schrecken eingejagt, aber Gott sei Dank war keiner verletzt. Es freute Katharina, dass die Kinder so viel Spaß hatten. Mit einem Lächeln im Gesicht schaut Katharina den Kindern noch eine Weile beim Spielen im Schnee zu. Auch sie hatte das Spielen im Schnee - die Schneeballschlachten, das Schneemann oder Schneeburgen bauen und das Schlittenfahren - als Kind über alles geliebt. Früher konnte sie sich einfach unbeschwert im Schnee austoben. Es war einfach wunderbar. Doch heute war das anders, der Schnee war oftmals eine Qual für sie seitdem sie Erwachsen war. Nach ein paar Minuten wendet Katharina ihren Blick von den spielenden Kindern ab und schaut wieder in den Himmel. Langsam werden die Schneeflocken seltener. Sie fallen nicht mehr in großen Scharren von dem blauen Himmel. Katharina setzt sich wieder an den Esstisch und trinkt noch den Rest ihres Pfefferminztees, der mittlerweile stark abgekühlt ist. Nachdem ihre Lieblingstasse ganz leer ist, stellt Katharina sie auf die Spüle und wirft noch einen letzten Blick nach draußen. Jetzt hat es ganz aufgehört zu schneien. Doch der weiße Schnee bleibt hartnäckig auf der Erde liegen. Er weicht nicht von seiner Stelle. Nur der kalte Wind weht noch durch die Luft und das schwarze Thermometer, das an einer der Küchenwände hängt, zeigt, dass die Minustemperaturen wieder ansteigen. Wann war dieser Winter endlich überstanden? Allzu lange würde es aber nicht mehr dauern, oder etwa doch? Mit einem fragendem Blick macht Katharina sich auf den Weg in ihr Arbeitszimmer und wendet sich den Akten zu. Sabrina Jütten Mit einem Schlag war alles anders Einsam sitzt Daniel an dem großen Küchentisch, auf dem sich nur ein Frühstücksbrettchen, ein geflochtenes braunes Brotkörbchen mit einem Brötchen, die Butter, die Marmelade und eine Tasse, die bis obenhin mit Kaffee gefüllt ist, befinden. Daniel nimmt das Brötchen aus dem Körbchen und schneidet es langsam auf, beschmiert es mit Butter und Marmelade und trinkt vorsichtig einen Schluck vom dampfenden Kaffee. Danach nimmt er seine Lesebrille von dem leeren Stuhl rechts neben sich, setzt sie auf und nimmt die Morgenzeitung von dem leeren Stuhl links neben sich. Daniel überfliegt kurz die Artikel auf der Titelseite und schlägt anschließend die Zeitung auf. Zwischendurch beißt er in sein Brötchen und trinkt noch einen Schluck Kaffee. Im Innenteil der Morgenzeitung liest er einige Artikel, die sein Interesse wecken, und blättert weiter, bis er schließlich auf die Seite mit den Todesanzeigen stößt. Sofort springt ihm die Anzeige einer jungen Frau ins Auge. Sie hieß mit Vornamen ALINA. Wie gebannt schaut Daniel auf diesen Namen in der Zeitung. Sein Blick haftet fest daran. Er will seinen Blick von diesem Namen losreißen, doch es geht nicht. Seine Augen wollen es einfach nicht zulassen, und ein Schauer fährt Daniel durch den ganzen Körper. Seine Hände fangen leicht an zu zittern, und mit ihnen auch die Morgenzeitung, die er in seinen Händen hält. Mit einem Schlag werden in ihm Wunden, die noch keineswegs vollständig verheilt sind, ein wenig tiefer und weiter geöffnet. Tränen beginnen über seine Wangen zu laufen. Erst eine, dann zwei, dann immer mehr. Die Buchstaben verschwimmen vor seinen Augen. Die Tränen kullern über seine Wangen, tropfen auf die Morgenzeitung und dringen in das Zeitungspapier ein, wo sie einen feuchten Abdruck hinterlassen. „Meine kleine Alina“, stößt Daniel schluchzend hervor, faltet die Morgenzeitung zusammen, legt sie beiseite, nimmt seine Lesebrille wieder ab und legt auch diese beiseite. Danach wischt Daniel sich einige Tränen mit seinem rechten Handrücken von seinen Wangen ab. Was für ein Zufall - Alina – so hieß auch seine vierjährige Tochter. Es ist noch gar nicht so lange her – vielleicht zwei Monate oder etwas mehr – da waren genau in diesem Teil der Zeitung auch die Todesanzeigen seiner Tochter und seiner geliebten Frau Heike abgedruckt. Daniel kann sich noch genau an alles erinnern. Seine Frau und seine kleine Tochter starben an schweren Kopfverletzungen, die sie sich bei einem Autounfall zugezogen hatten. Es war an einem eisigen Montagmorgen im Winter passiert. Wie immer hatte Daniel in der Kanzlei gearbeitet und viel zu tun gehabt. Als das Telefon klingelte, legte er seinen Kugelschreiber, den er in der Hand hielt, beiseite, nahm den Hörer ab und meldete sich wie gewöhnlich. Am anderen Ende der Leitung meldete sich Heike. Daniel freute sich sehr, die Stimme seiner Frau zu hören. Sie wollte ihm nur kurz Bescheid sagen, dass sie mit Alina ins Einkaufszentrum Jumbo fahren würde. Sie hätte noch ein paar größere Einkäufe zu erledigen, und Alina wolle sie dabei nicht alleine zu Hause lassen. Daniel bat sie, vorsichtig zu fahren, obwohl er wusste, dass sie das immer tat. Aber bei diesen Straßenverhältnissen im Winter konnte man ja nie wissen, was auf einen zukam. Heike versicherte ihm, dass sie vorsichtig fahren werde, und bevor er das Telefonat mit seiner Frau beendete, sagte er ihr noch, dass er sie über alles liebe. Auch seine Frau versicherte ihm, dass sie ihn sehr liebe. Danach legte er den Telefonhörer wieder auf und widmete sich erneut seiner Arbeit. Nie im Traum hätte Daniel sich gedacht, dass er bei diesem Telefonat zum letzten Mal mit seiner Frau sprechen würde. Seine Frau Heike und seine Tochter Alina kamen nicht mehr im Einkaufszentrum an. Auf dem Weg dorthin war es auf der Straße wegen der zunehmenden Schneestürme zu einem schweren Unfall gekommen, an dem insgesamt fünf Autos beteiligt waren. Seine Frau starb auf der Stelle an den schweren Kopfverletzungen, die sie sich bei dem Unfall zugezogen hatte. Jegliche Hilfe für sie kam zu spät. Daniel konnte es nicht fassen, dass Heike sofort tot war. Doch der Notarzt konnte nichts mehr für sie tun. Das musste doch alles nur ein böser Albtraum sein, aus dem er bald wieder aufwachen würde. Doch es war kein Albtraum. Es war die bittere Realität, und es kam noch schlimmer, als Daniel es sich je gedacht hätte. Auch seine Tochter hatte schwerste Verletzungen bei dem Autounfall erlitten. Sie wurde sofort mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen, als die herangeeilten Rettungskräfte ihren lebensgefährlichen Zustand feststellten. Dort starb auch sie wenige Tage später. Daniel kann sich noch genau an diese schrecklichen Momente erinnern. Sie werden wohl nie aus seinen Erinnerungen weichen, und so erscheinen die Bilder dieser Momente jetzt wieder wie ein Film vor seinem geistigen Auge. In der Uniklinik führten die Ärzte zahlreiche Operationen an seiner Tochter durch. Daniel musste währenddessen auf dem Flur vor der OP warten, wo seine Tochter um ihr Leben kämpfte. Die Ärzte ließen ihn nicht zu Alina. Das konnte und durfte doch nicht wahr sein. Sie ließen ihn nicht zu seiner eigenen Tochter. So ging er mit großen Schritten auf dem Flur auf und ab. Er fand einfach keine Ruhe. Was machten die Ärzte eigentlich in der OP mit seiner Tochter? Das konnte doch nicht so lange dauern. Irgendwann - nach endlosen Stunden des Wartens - ging die Tür der OP auf und zwei Ärzte kamen heraus. Tatsächlich versicherten sie Daniel, dass Alina die schwersten Stunden überstanden hätte. Jetzt müsse sie nur noch die nächste Nacht überstehen. Dann sei sie über den Berg. Sie wurde auf die Intensivstation gebracht und Daniel wachte, solange er nur konnte, am Bett seiner Tochter. Alina war an zahlreiche Geräte angeschlossen. Es brach ihm das Herz, seine Tochter so da liegen zu sehen, so hilflos, wo sie doch sonst immer so ein fröhliches Mädchen gewesen war. Auch in der Nacht wachte Daniel am Bett seiner Tochter und schlief nur für ein paar Stunden ein. - Ein greller Piepston riss ihn aus seinem Schlaf. Daniel schreckte auf und rieb sich die müden Augen. Zuerst musste er sich einmal orientieren. Wo war er eigentlich? Doch ehe er sich versah, kamen schon vier Ärzte durch die Tür des Zimmers geströmt. Oder waren es sogar fünf Ärzte? Jedenfalls sah Daniel seine Tochter vor sich auf dem Krankenbett liegen. Plötzlich konnte er sich wieder erinnern. Er war auf der Intensivstation bei seiner Tochter am Bett eingeschlafen. Noch immer hörte Daniel den Piepston. Warum wollte das grelle Piepsen einfach nicht enden? Plötzlich schaute Daniel wie gebannt auf einen Apparat, der neben dem Bett stand. Hier waren nur Linien zu sehen, die immer waagerechter wurden. Allmählich wurde Daniel bewusst, was das bedeutete. HERZSTILLSTAND. Nein, das konnte doch nicht sein. Seine Tochter durfte nicht auch noch sterben. Der Apparat zeigte doch bestimmt nur irgendwelchen Unsinn an. Von der einen auf die andere Sekunde zerrten ihn zwei kräftige Hände eines Arztes aus dem Raum der Intensivstation. Daniel sträubte sich dagegen, begann um sich zu schlagen und wollte die fremden Hände von sich abschütteln. Er konnte seine Tochter doch jetzt nicht alleine lassen. Das ging überhaupt nicht. Doch der Arzt war stärker als Daniel und brachte ihn einfach vor die Türe. Hier auf dem Gang durfte er warten. Durch die Fensterscheibe des Zimmers konnte er vom Gang her alles mitverfolgen. Drinnen im Raum versuchten die Ärzte mit allen Kräften um das Leben seiner kleinen Tochter zu kämpfen. Doch vergeblich. Es schien keine Rettung mehr für Alina zu geben. Aber warum nicht? Die Ärzte mussten seiner Tochter doch helfen können. Wofür waren sie denn sonst eigentlich da? Allmählich stellten die Ärzte die Geräte ab, auch sie konnten Alina nicht mehr retten. Es war der schlimmste Moment in seinem Leben. Es war, als wenn Daniel der Boden unter den Füßen weggezogen würde. Nach ein paar Minuten kam eine junge Ärztin aus dem Zimmer. Sie schüttelte leicht den Kopf. Das sollte wohl so viel heißen wie „Wir haben alles versucht, aber es hat nicht funktioniert.“ Danach kam der Arzt, der Daniel aus dem Zimmer gezerrt hatte zu ihm und teilte ihm mit, dass es bei einer der Operationen zu Komplikationen gekommen sein musste und sie ihrer Tochter jetzt nicht mehr helfen konnten. Es täte allen Ärzten Leid. Wusste dieser Arzt eigentlich, was er da zu ihm sagte? War er sich dessen in irgendeiner Weise bewusst? Nach dieser Nachricht wollte er sofort zu seiner Tochter – nur noch ein letztes Mal. Die Ärzte führten ihn zu Alina. Friedlich lag sie dort vor ihm im Krankenbett. Tränen rannen über seine Wangen und über seine Nase. Dieser Anblick zerbrach ihm das Herz. Sie hatte die Augen geschlossen und schlief tief und fest. Wie sehr sie nur seiner Frau glich. Er nahm die Hand seiner Tochter in die seine und fing wieder ununterbrochen an zu schluchzen. Das war alles zu viel für ihn gewesen. Erst hatte man ihm seine Frau Heike und wenige Stunden später seine Tochter Alina genommen. Sein Leben erschien ihm plötzlich sinnlos, ohne seine Frau und seine Tochter. Schuldgefühle plagten und plagen ihn noch bis heute. Hätte er seiner Frau doch von der Fahrt ins Einkaufszentrum abgeraten, denn in den Wetterberichten hatte er doch gehört, dass es zu schweren Schneestürmen kommen würde. Vielleicht würden seine Frau und seine Tochter dann heute noch leben. Daniel weiß nicht mehr, wie lange er so bei seiner kleinen Tochter gelegen hatte, die jetzt wohl, genau wie seine Frau Heike auch, in einer anderen Welt lebte. Er sitzt noch immer am Küchentisch. Seine Augen sind ganz rot geworden. Auf dem Frühstücksbrettchen liegt noch immer ein Stück von dem Brötchen, das mit Butter und Marmelade beschmiert ist. Doch Daniel hat keinen Hunger mehr. Er lässt alles so stehen und liegen, wie es ist, steht langsam und niedergeschlagen auf und schaut sich flüchtig in der Küche um. Viele schöne Erinnerungen an seine kleine Familie werden in ihm wach. Seine Augen füllen sich erneut mit Tränen. Daniel beißt so fest, wie er nur kann, auf seine Zähne, damit er nicht wieder anfängt zu weinen. Schluss jetzt! Er hat doch heute schon genug Tränen vergossen, oder nicht? Aber in diesem Haus erinnert ihn einfach alles an seine kleine Familie. Daniel hält es jetzt hier nicht mehr aus. Er muss sofort hinaus an die frische Frühjahrsluft. Vielleicht eine Möglichkeit, auf andere Gedanken zu kommen. Also geht Daniel in den Flur, zieht seine Windjacke an und nimmt seinen Schlüssel vom Haken neben der Haustüre. Danach verlässt er das Haus. Im Hof bleibt er eine Weile stehen und atmet einmal tief durch. Sein Gehirn wird mit frischem Sauerstoff gefüllt. Die frische Frühlingsluft tut Daniel gut. Langsam beruhigt er sich. Doch er weiß genau, dass dieses schicksalhafte Ereignis sein Leben immer prägen wird. Egal, was er tut oder in Zukunft tun wird, seine Frau und seine Tochter werden niemals aus seinem Gedächtnis weichen. Sie werden immer in seinen Gedanken sein. Daniel schaut in den Himmel. Vielleicht muss er einfach akzeptieren, was passiert ist. Seine Frau und seine Tochter hätten bestimmt nicht gewollt, dass er für den Rest seines Lebens um sie trauern und dabei die Lust am Leben verlieren würde. Plötzlich blitzt ein Strahl der Frühlingssonne in seine Augen. Daniel wendet seinen Blick langsam vom blauen Himmel ab. Was steht er hier noch so lange herum? Wollte er nicht eigentlich spazieren gehen? Mit zügigen Schritten macht er sich auf den Weg. Franziska Krewinkel Einordnung: sauer oder salzig Land Früher war vieles anders. Das ganze Leben. Irgendwie anders. Nicht unbedingt besser oder schlechter. Handys und Computer: Wir kannten diesen neumodischen Kram nicht. Wozu braucht man sowas überhaupt? Wir sind auch ohne diese Technik groß geworden. Ein Blick aus dem Fenster: Bäume. Große und kleine. Wiesen und Felder. Tiere. Einige Kinder spielten draußen auf dem Hof. Andere halfen ihren Eltern, beispielsweise im Stall bei der Versorgung von all den Kühen, Hühnern, Schweinen, Pferden und Eseln. An Beschäftigungen fehlte es nie, da immer genügend Arbeit erledigt werden musste. Ein erneuter Blick aus dem Fenster: Bäume, Wiesen, Felder und Tiere. Doch wo sind die Kinder? Die Natur wurde bebaut. Kinder und Erwachsene zeigen sich nicht oft. Lediglich für ein paar Sekunden, allenfalls Minuten am Morgen oder am Abend. Doch was tun sie in der Zwischenzeit? In die Schule gehen und möglichst viel lernen, das ist wichtig in dieser Generation. Und am besten ist es, wenn man viel Geld verdient. Sehr viel Geld. Doch wie war das alles zu unserer Zeit? Wir gingen acht Jahre zur Schule. Manche jungen Männer gingen danach auf Baustellen arbeiten, meistens ohne dort eine Ausbildung zu machen. Das verdiente Geld musste man an die eigene Familie abgeben. Meine Freundin Maria arbeitete auf dem Bauernhof ihrer Eltern. Täglich mistete sie den Stall aus, fütterte die Kühe, die Schweine und die Hühner, und manchmal erntete sie die Kartoffeln. Ab und zu gaben die Eltern ihr ein bisschen Geld. Fünfzig Pfennig, oder sogar eine Mark. Hildegard und Anna wurden im Krankenhaus ausgebildet. Dort lernten sie alles rund um den Haushalt. Kochen, Waschen, Bügeln und Kranke pflegen. Nach der Ausbildung arbeitete Hildegard im Krankenhaus und Anna bei einer wohlhabenden Familie im Haushalt. Ein Blick aus dem Fenster: Ich sehe Bäume, Wiesen, Felder und Tiere. Doch die Landschaft erscheint mir verschwommen und undeutlich. Graue Nebel und dunkle Wolken. Heute ist vieles anders. "Hallo!" ruft plötzlich eine Stimme, und ich weiß sofort, dass es meine Enkelin Emma ist. Sie besucht mich oft. Emma betritt das Zimmer. "Mensch Oma, heute war vielleicht was los... Ich hetzte von einem Termin zum nächsten. Die Mitarbeiter hatten Probleme bei der Ausführung eines neuen Projekts... Am besten bearbeite ich es gleich noch einmal..." - "Ach, Emma! Gönne dir doch wenigstens deinen Feierabend! Schau doch mal aus dem Fenster! Die blühenden Blumen auf den grünen Feldern, die Pferde und die Kühe, die auf den Wiesen grasen...“ Franziska Krewinkel Einordnung: süß oder bitter Kenia Antonia beginnt heute ihren Freiwilligendienst. Sie fährt zusammen mit Peter, dem Projektleiter, durch die Landschaft. Es ist heiß. Im Jeep sind alle Fenster heruntergedreht, damit ein bisschen Wind an ihnen vorbei zieht. Sie fahren durch die Savannen. Viele Gräser, Büsche und Bäume sind zu sehen. Vereinzelt auch ein paar Antilopen, Zebras und Giraffen. Nach einer Weile verlassen Peter und Antonia den Park und erreichen nach einer halben Stunde ein kleines Dorf. Kleine Hütten, die aussehen, als würden sie jeden Moment zusammenbrechen. In dem Dorf leben viele Menschen. Kinder spielen Fußball, Frauen tragen riesige Wasserbehälter auf ihren Köpfen. Sie gehen mit diesen zu einer weit entfernten Wasserstelle und holen dort Wasser, das sie zu ihren Hütten bringen. Sie benutzen es, um ein wenig zu kochen und um ihre Kleidung zu waschen. Die Kleidung von einigen Kindern hängt in Fetzen. Die Hosen haben Löcher. Wo das Auge hinblickt: Armut. Zu wenig Wasser. Zu wenig Nahrung. Doch die Kinder lachen beim Spielen und sehen glücklich aus. Auch die Frauen scheinen mit ihrer Arbeit zufrieden zu sein. Plötzlich laufen einige Kinder auf Antonia zu und rufen:"Karibu!". Peter erklärt Antonia, dass die Kinder sie soeben begrüßt haben, da "Karibu" eine kenianische Grußformel ist, die einen willkommen heißt. Aus einem etwas größeren Haus, etwas abgelegen von all den zerfallenen Hütten, kommt eine junge Frau zu Antonia und Peter gelaufen. Peter geht ins Büro und erledigt die dort anfallende Arbeit. "Hallo!“, sagt sie, "du musst Antonia sein... unsere neue Betreuerin. Schön, dass du da bist! Ich bin Sophia und betreue die Kinder schon seit zwei Monaten". "Hallo Sophia!", entgegnet Antonia. "Es wird dir hier gefallen“, sagt Sophia. „Das Spielen mit den Kindern macht mir sehr viel Spaß und es ist schön zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln. Sie haben keine Eltern mehr und brauchen viel Liebe und Zuwendung". Die Kinder kommen im Laufschritt auf Antonia und Sophia zu. Ein kleiner Junge, vier oder fünf Jahre alt, schießt Antonia den Ball zu. Sophia und Antonia spielen nun mit den Kindern Fußball. Sie haben viel Spaß. Die Kinder sehen glücklich aus, trotz der weit verbreiteten Armut. Es gibt Hoffnung für die Kinder. Die freiwilligen Helfer. Jeden Sonntag kommen neue Helfer ins Waisenhaus nach Kenia und kümmern sich liebevoll um die Kinder. Im Waisenhaus hier in Kenia spielen die Freiwilligen hauptsächlich mit den Kindern. Sie spielen mit ihnen Fußball, singen oder malen mit ihnen. Es gibt vielfältige Projekte für Freiwillige. Wildlife. Verletzte Tiere pflegen. Unterrichten. Das eigene Wissen weitergeben und den Kindern Neues ermöglichen. Sozialarbeit mit Kindern. Mit ihnen spielen, basteln, singen und vieles mehr... Es werden auch Exkursionen für die Kinder organisiert. Der nächste Tag hat begonnen. Es ist früh am Morgen. Antonia und die anderen Betreuer bereiten das Frühstück für die Kinder vor. Insgesamt leben 60 Kinder im Waisenhaus, die täglich versorgt werden müssen. Die Betreuer wecken die Kinder. Die meisten sind noch sehr müde. Sie ziehen sich an. Die Kleinen benötigen dabei noch Hilfe von den Betreuern. Jedes Kind hat seinen eigenen Platz am Tisch. Sie frühstücken und putzen sich danach die Zähne. Draußen scheint die Sonne. Die Kinder gehen zusammen mit ihren Betreuern auf den Spielplatz. Der Spielplatz sieht irgendwie anders aus. Das Klettergerüst und die Rutsche scheinen schon etwas älter zu sein. Die Kinder rutschen, spielen im Sandkasten und backen Kuchen aus Sand oder spielen Fußball. Sie freuen sich, wenn man mit ihnen spielt. Am Nachmittag basteln sie zusammen mit ihren Betreuern Giraffen und Elefanten aus Pappe, die anschließend neben der Eingangstür des Hauses befestigt werden. Am Abend wird gemeinsam gegessen. Danach singen die Kinder. Deutsche Lieder, die ihnen die Betreuer beigebracht haben. Sophia geht ins Büro und bringt von dort einen CD-Player mit. Sie schaltet ihn ein, und afrikanische Musik ertönt. Die Kinder und Sophia beginnen zu tanzen und bewegen sich im Rhythmus der Musik. Sie fordern Antonia auf, die Bewegungen nachzumachen. Antonia macht mit. Ihre Bewegungen sehen zwar noch nicht so gut aus wie die von den Kindern und Sophia, aber eins steht für sie fest: Sie möchte unbedingt so gut tanzen können, wie diese Kinder! Am nächsten Tag fahren die Kinder gemeinsam mit ihren Betreuerinnen in einem kleinen Bus in einen nahegelegenen Park. Im Park angekommen, werden die Kinder und die Betreuer auf mehrere kleine Jeeps verteilt und können die Savannen betrachten. Die Kinder sind froh, dass ihre Betreuer so viel mit ihnen unternehmen. Der Park ist groß, und man kann Giraffen, Zebras und Antilopen aus der Nähe sehen. Ein besonderes Highlight der Safari sind die Elefantenfamilien, die in den Wasserlöchern spielen und sich gegenseitig mit Wasser bespritzen. Am Ende der Safari-Tour durch den Park dürfen die Kinder noch auf Kamelen reiten. Ein Blick in die Gesichter der Kinder: Strahlendes Lachen. Zufriedenheit. Fröhlichkeit. . „Antonia! Wie hat es Dir im Park gefallen?" fragt Sophia, als sie am Abend wieder im Waisenhaus angekommen sind. „Es war großartig! Die Landschaft und die Tiere... Als ich hier angekommen bin, habe ich die Natur schon bewundert und ich muss sagen, dass sie mir sehr gut gefällt. So schön und so einzigartig. Es war auch sehr schön zu sehen, wie begeistert die Kinder die Tiere beobachtet haben". Den vorletzten Tag ihres Aufenthalts verbringt Antonia mit der Betreuerin Sophia am Meer. Beide haben einen freien Tag. Der indische Ozean. Die Endlosigkeit des Meeres. Sie genießen den Tag unter der Sonne Afrikas und gehen schnorcheln. Ein wunderschönes Korallenriff. Fische. Große und kleine. Rote, gelbe, blaue, weiße, grüne, gepunktete und gestreifte. Fischfamilien, sogar ganze Schwärme. Zwei Wochen später. Antonia ist wieder zu Hause. In ihrer ZweizimmerAltbauwohnung mitten in der Stadt. Ausreichend Wasser und Lebensmittel. Der Kühlschrank ist gefüllt. Joghurt, Käse, Salat, Paprika, Tomaten, Milch, Cola, Apfelsaft. Flachbildfernseher, Computer, Spülmaschine und Handy. Den ganzen Kram brauchte sie in Kenia nicht. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch und ärgert sich über die Präsentation, die bis morgen fertig sein muss. Die Erfahrungen bereichern das eigene Leben. Die Sehnsucht nach Afrika und den Kindern ist groß... Franziska Krewinkel Einordnung: sauer oder salzig Indien Samstagmorgen. 9.45 Uhr. Ich sitze auf meinem Bett im Schlafzimmer. Neben mir mein gepackter Koffer. In ihm befindet sich alles, was man für einen vierwöchigen Urlaub braucht. T-Shirts, Langarmshirts, kurze und lange Hosen, Sandalen, FlipFlops, eine Sonnenbrille, meine Kamera und vieles mehr. Nun kann es losgehen! 10:00 Uhr. Das Taxi steht pünktlich vor meiner Haustür und ich fahre zum Flughafen. Am Flughafen angekommen, checke ich ein und lade meinen Koffer aufs Fließband. Der Flughafen. Überfüllt mit Menschen, die verreisen wollen oder gerade braun gebrannt aus dem Urlaub zurückkehren. Noch schnell durch die Sicherheitskontrolle und dann kann es endlich losgehen! Ich steige ins Flugzeug. Mein Platz befindet sich direkt am Fenster. Neben mir sitzt ein älterer Herr, vermutlich Mitte bis Ende sechzig. Er nickt mir freundlich zu und liest danach sofort weiter in der Tageszeitung. Ich mache es mir gemütlich. Die Stewardess und der Pilot wünschen einen angenehmen Flug. Es geht los. Das Flugzeug startet, und ich spüre einen unangenehmen Druck auf meinen Ohren. Ich krame in meiner Tasche und suche meinen Kaugummi. Da ist er ja! Schnell mache ich die Verpackung, steckte ihn in den Mund und beginne zu kauen. Im Handumdrehen verschwindet der Druck auf meinen Ohren und ich beginne den Flug zu genießen. Ich schaue mir die Wolken und den Himmel durch das kleine Fenster an und mache schon einmal ein paar Erinnerungsfotos. Die Stewardess bringt mir ein Glas Wasser. Die Leute neben mir essen. Ich lese. In dem Buch geht es um eine junge Frau, die Probleme im Beruf und mit ihrem Mann hat. Sie fliegt zu ihrer Freundin nach Australien, die vor einem Jahr dorthin ausgewandert ist... Nach einigen Stunden, die mir vorkommen wie eine halbe Ewigkeit, kündigt der Pilot die Landung an. Vorsichtshalber greife ich jetzt schon einmal zu meinem Kaugummi... - Nach der Landung bleibe ich noch kurz auf meinem Platz sitzen, packe meinen Kram, meine Kamera und mein Getränk zusammen und lasse die anderen Passagiere zuerst aussteigen. Schließlich stehe auch ich auf und steige die Stufen der Gangway hinunter, bis ich endlich indischen Boden unter meinen Füßen spüre. Strahlend blauer Himmel. Die Sonne scheint und es ist heiß. Sehr heiß. Ein leichter, angenehmer Windhauch zieht an mir vorbei. Ich betrete das Flughafengebäude, um mir meinen Koffer zu holen. Da! Ich erkenne ihn schon aus der Ferne, an den bunten Aufklebern, die ich aus meinen Urlauben mitgebracht habe und als Erinnerung aufgeklebt habe. Ich nehme ihn vom Fließband und verlasse das Gebäude. Draußen steht auch schon ein Taxi. Ich setze mich hinein und erkläre dem Fahrer, dass er mich zu meinem Hotel fahren möchte. Die Fahrt beginnt. Nach einer Stunde bin ich am Hotel angekommen und beziehe zunächst mein Zimmer. Es ist klein, aber schön. Das Hotelpersonal hat es schön hergerichtet. Auf der Fensterbank und auf dem Tisch steht eine riesige Obstschale mit Bananen, Pfirsichen, Äpfeln, Kirschen, Erdbeeren, Birnen und Sternfrüchten. Ich habe mein eigenes, kleines Badezimmer, das durch einen kleinen Flur vom Wohnraum abgetrennt ist. Im Wohnraum befindet sich ein gemütliches Bett, ein Sofa und ein Fernseher. Über eine Glastür neben dem Sofa erreicht man den Balkon mit Blick aufs Meer... Es ist Abend, und ich beschließe, mich nach dem Abendbuffet direkt hinzulegen. Die lange Reise war ziemlich anstrengend, und schließlich möchte ich den nächsten Tag ja vollkommen ausgeschlafen beginnen, damit ich Indien erkunden kann. Am nächsten Morgen stehe ich früh auf, dusche und frühstücke. Draußen scheint bereits die Sonne, und ich freue mich auf den Tag. Nachdem ich gefrühstückt habe, nehme ich mir ein Taxi, um ein nahegelegenes kleines Dorf zu erkunden. Im Taxi ist es dank Klimaanlage kühl. Ich verlasse die Stadt und begutachte noch all die großen Bürogebäude und die Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit sind. Die meisten von ihnen tragen einen Anzug und eine Tasche. Einige halten noch ihre Handys am Ohr und telefonieren. Es dauert nicht lange, bis wir die Stadt verlassen haben. Die Straßen werden enger. Der Taxifahrer fährt langsam. Viel Verkehr und die Straßenverhältnisse erfordern eine langsame und vorsichtige Fahrt. Ich sehe viele Menschen, Tiere und Fahrzeuge, die sich alle eine Straße teilen. Es gibt keinen Bürgersteig für die Fußgänger. Die meisten Autos, die an mir vorbeifahren, sind sehr alt. Die Busse sind überfüllt mit Menschen. Enge. Ich habe die Fenster heruntergedreht, um ein bisschen von dem Geschehen mitzubekommen. Es ist laut. Die Abgase der Fahrzeuge stinken, und am Straßenrand liegt Müll. Ein unangenehmer Geruch kommt mir entgegen. Ich drehe die Fenster wieder hoch und erkläre dem Taxifahrer, dass ich aussteigen möchte. Ich steige aus, gebe dem Taxifahrer 500 indische Rupies und gehe nun zu Fuß weiter. Der Gestank verschwindet, und ich schaue mir die überfüllten Busse an und die wenigen Taxen die nur drei bis fünf Personen befördern. Mir begegnet ein Mann auf einem Elefanten. Der Mann bittet mich um ein Almosen. Ich suche mein Portemonnaie und gebe ihm ein bisschen Geld. Der Mann steigt von dem Elefanten und verbeugt sich. Er bedankt sich. Ich gehe weiter. Die Landschaft ist schön. Das Gras ist grün und die Sonne scheint. Strahlend blauer Himmel und keinerlei Wolken sind zu sehen. Es dauert noch eine Weile, bis ich ein kleines Dorf erreiche. Es besteht nicht aus Häusern. Lediglich ein paar kleine Hütten sind zu sehen. Die Frauen tragen riesige Wasserbehälter auf ihren Köpfen und gehen zum Fluss, um sie zu füllen. Die Kinder spielen Fußball. Der Ball ist schon sehr platt, doch das hindert die Kinder nicht daran, mit ihm zu spielen. Das Dorf ist klein, und doch leben dort so viele Menschen. Die Menschen sind arm. Lediglich an ein paar Hütten stehen alte Fahrräder. Manche von ihnen haben auch einen Motor. Die Familien fahren mit diesen Fahrrädern zum Markt und kaufen dort ein. Ich gehe weiter und verlasse das Dorf. Wieder befinde ich mich auf einer Straße. Überfüllte Busse, alte Fahrräder und ein Taxi fahren an mir vorbei. Mir kommt ein Mann mit einer Schubkarre entgegen, die mit Obst gefüllt ist. Er war wahrscheinlich für seine Familie einkaufen. Die Landschaft gefällt mir gut und ich mache noch ein paar Fotos, bis ich ein anderes Dorf erreiche. Dort ist Markt. Viele Menschen. Frauen tragen Saris in allerlei Farben. Rot, grün, blau, violett, gelb, orange... Die Männer tragen einen Turban. Ich sehe mir all die Köstlichkeiten an. Man kann Obst und Gewürze kaufen, sowie Saris. Ich wollte schon immer einmal einen eigenen Sari habe und beschließe mir einen zu kaufen. Eine Frau, die selbst geschneiderte Saris verkauft, ist sehr freundlich, so wie alle Menschen hier in Indien. Sie erklärt mir, wie sie die Saris näht und erzählt mir, dass sie ungefähr zwei Stunden braucht um einen Sari zu nähen. Beeindruckend. Wie schnell das geht! Es fällt mir nicht leicht, mich für eine Farbe zu entscheiden. Nach langem Überlegen entscheide ich mich für einen gelben Sari. Gelb passt zum Sommer und zu dem schönen Wetter. An einem weiteren Stand kaufe ich mir noch passenden Schmuck. Nachdem ich sehr lange auf dem Markt war und sehr viele indische Köstlichkeiten probieren durfte, beschließe ich zurück zum Hotel zu fahren. Es ist schon spät und ich bin ziemlich müde. Einen Teil des Weges lege ich wieder zu Fuß zurück, und für den Rest des Weges nehme ich mir ein Taxi. Ich verlasse die überfüllte Straße und beobachte noch eine Weile die Landschaft. Weite Felder. In der Stadt angekommen, verlassen die Männer und Frauen, die heute Morgen ins Büro gegangen sind, die Bürogebäude. Sie telefonieren wieder und viele Kinder in Schuluniformen verlassen die Schule. Im Hotel angekommen, ziehe ich zunächst meinen Sari an, bewundere den Schnitt und die Feinheiten und gehe anschließend noch ein bisschen spazieren. Das Meer glitzert in der Sonne. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Morgen möchte ich mir einige Tempel ansehen... Annkatrin König salzig, bitter Die Fahrt Es war ein herrlicher Tag, ein warmer, wolkenloser Sommertag. Die Steine am Ufer knirschten laut. Holz ächzte. Wasser plätscherte. Das Kanu war nicht mehr das neueste. Sein Holz war schon fast morsch und von der Sonne ausgeblichen, aber es hielt mich über Wasser. Es hatte einst meinem Großvater gehört. Damals war er damit immer am See oder auf den Flüssen gefahren. Es war sein Ein und Alles gewesen, denn er hatte es selbst aus einem dicken Stamm gebaut, wofür er mehrere Monate gebraucht hatte. Nach seinem Tod vor ein paar Wochen wurde es mir geschenkt, obwohl ich zuvor noch nie Kanu gefahren bin. Doch Großvater hatte es so gewollt. Bevor es dann im Kamin verbrannt werden sollte, wollte ich es dann doch lieber behalten und zu Großvaters Ehren wenigstens ein Mal ausprobieren. Ab und zu knackte es an der einen oder anderen Stelle. Schon bei der kleinsten Bewegung bog sich das Holz. Ich trieb sachte daher, immer weiter den Fluss hinab, zunächst vorbei an grünen Wiesen mit saftigem Löwenzahn und dann an schlammigen Ufern, wo man die Fußspuren verschiedenster Tiere erkennen konnte. Dahinter lag Gestrüpp und schattiger Wald mit großen krumm gewachsenen Bäumen. Lautes Vogelgezwitscher drang aus ihm heraus. Aber von Vögeln war weit und breit nichts zu sehen. Sie hatten sich bestimmt in den Ästen versteckt. Die Bäume standen eng bei einander, fast schon wie eine undurchdringliche Mauer. Häufiger kam es vor, dass ihre Wurzeln ins Wasser tauchten und ihre Äste wuchsen darüber hinweg. Ein Blick zum Himmel. Er hatte sich verdunkelt. Sonne, wo bist du? Sie war weg. An ihrer Stelle schwebten nun dicke graue Wolken über mir. Hatten sie heute nicht gutes Wetter mit viel Sonnenschein gemeldet? Aber davon war keine Spur; es wurde immer dunkler, und obwohl es mitten am Tag war, fing es an zu dämmern. Ich schauderte; über meinen ganzen Körper breitete sich eine Gänsehaut aus. Für einen Sommertag war es hier viel zu kalt. Bestimmt noch kälter als der Fluss unter mir. Ich zog das Paddel aus dem Wasser und legte es quer über mein Kanu, dann schlang ich die Arme um mich. Hoffentlich würde die Sonne gleich wiederkommen. Ich ließ mich einfach treiben. Der Fluss wies mir den Weg. Die Bäume am Ufer ragten immer höher dem Himmel entgegen. Wo war ich hier? Ich hatte weder eine Karte noch einen Kompass. Es ging weiter flussabwärts. Das Kanu trieb weiter. Die Bäume zogen immer schneller an mir vorbei. Das Wasser rauschte. Man konnte die Vögel schon gar nicht mehr hören, so laut war es. Aber das Schlimmste war die Kälte. Mir war so kalt; die Gänsehaut wollte einfach nicht verschwinden. Meine Finger färbten sich weiß und meine Lippen zitterten. Hätte ich mir nur einen Pullover mitgenommen. Aber wer hatte schon ahnen können, dass sich das Wetter so schnell änderte? Die Strömung nahm zu. Plötzlich ein Felsen nur wenige Meter vor mir. Im Dämmerlicht war er nur schwer zu erkennen. Schnell griff ich nach dem Paddel und versuchte mit aller Kraft das Kanu in eine andere Richtung zu steuern. Meine Finger schmerzten, aber das war mir egal. Immer wieder tauchte ich das Paddel ins Wasser und drückte mich dagegen. Mit einem letzten Stoß schob ich mich links am Felsen vorbei. Ganz knapp. Doch da tauchten sie auf. Große kantige Felsen. Es waren zu viele. Rechts und links versperrten sie mir den Weg, als wäre er dort zu Ende. Auch in der Mitte des Flusses ragten sie bedrohlich aus dem Wasser empor. Die Strömung trieb mich direkt auf sie zu. Wohin jetzt? Doch es war zu spät. Ein lautes Krachen. Wasser spritzte empor. Holzsplitter flogen umher, trafen mich an Kopf und Händen. Das Holz brach unter mir. Ein kräftiger Stoß, und dann umhüllte mich Kälte. Ich wurde in die Tiefe gezogen. Schnell war alles dunkel und ich hörte es nur noch rauschen. Die Wassermassen tauchten mich unter. Wo war Oben und wo Unten? Die Strömung war so stark. Mit den Armen versuchte ich mich an die Oberfläche zu drücken. Ich tauchte auf. Meine Füße berührten den steinigen Boden. Ich rutschte auf ihm aus, suchte nach Halt. Doch immer wieder stolperte ich. Von der Strömung wurde ich weiter gedrückt. Bis plötzlich eine lange Wurzel nur wenige Meter vor mir in das Wasser ragte. Mit den Armen ruderte ich ihr entgegen und schaffte es mit letzter Kraft, ihr näher zu kommen und mich an sie zu klammern. Ich zog mich an ihr entlang, auch wenn sie glitschig war. Meine Füße sanken in den schlammigen Untergrund und ich ließ mich einfach fallen. Ich hatte das Ufer erreicht. Vor mir lag nur noch Wald, und hinter mir der gefährliche Fluss. Alles war durchnässt. Mein Körper drückte sich in den Boden. Dann drehte ich mich auf den Rücken, ich sackte langsam ein. Ich musste husten, immer und immer wieder. Das Atmen viel mir schwer. Mein Herz pochte so stark, dass es schmerzte. Aber nicht nur mein Herz schmerzte. Die spitzen Steine hatten sich in meine Füße gebohrt und tiefe Schnittwunden hinterlassen, sodass das Blut in breiten Bahnen sich seinen Weg zum Boden bahnte. Ein Blick zum Himmel. Er war nun ganz von Wolken bedeckt. Aber wo war mein Kanu? Ich schaute zum Fluss. Dort waren nur die Felsen. Keine Spur von meinem Kanu oder vielmehr: von dessen Überresten. Der Aufprall hatte es komplett auseinander gerissen. Das Holz musste schon längst flussabwärts getrieben sein. Tränen liefen mein Gesicht hinunter. Es war fort, genauso wie mein Großvater. uami, sauer Kassenschlager Das Warten war zu Ende. Fast ein ganzes Jahr hatten sich die Massen gedulden müssen. Die Werbeplakate an den Straßenrändern hatten es groß angekündigt. Monate zuvor war in den Zeitungen schon davon berichtet worden. In den abendlichen Talkshows war es das Gesprächsthema Nummer eins gewesen. Eine Schlagzeile in den Tageszeitungen. Jeder wusste es, keiner kam daran vorbei. Wie ein Lauffeuer wurde die Nachricht verbreitet. In aller Frühe, als die Sonne gerade aufgegangen war, erschien der Lieferant mit den schweren Kartons. Nur mit aller Mühe hatte er sie vom Lieferwagen bis in den Laden geschleppt. Es wurden gleich hundert Exemplare bestellt, man wollte ja schließlich genügend zur Verfügung haben, denn man befürchtete einen großen Ansturm in den nächsten Tagen. Monate des Schreibprozesses und der Korrektur waren abgeschlossen. Die Geschichte war aufgeschrieben und somit jetzt für alle lesbar. Die ganze Vergangenheit, jedes besondere Ereignis, alles Intime. Abgedruckt auf 568 Seiten mit dem ein oder anderen Foto zwischendrin. Viele Male hatte man sie umgeschrieben, ergänzt und dann doch wieder verworfen. Ein paar Formulierungen geändert und danach mit aller Genauigkeit Grammatik und Rechtschreibung überprüft. Vom Verlag unter Vertrag genommen und schließlich von einem Lektor bearbeitet. Vor ein paar Tagen waren es noch leere Blätter in der Druckerei gewesen, und kurze Zeit später waren sie voll von Buchstaben. Dann hatte man sie gebunden und mit einem Buchdeckel versehen, in eine Folie gepackt und danach in Kartons verstaut und an die Buchhandlungen geliefert. Unzählige Lieferwagen hatten sich auf den Weg gemacht, zu all den Buchhandlungen, die auf ihre Bestellung warteten. Alles war genau berechnet, denn der Zeitplan ließ keine Verspätungen zu. Nun waren sie auf einem großen Tisch in der Mitte des Raumes zu vielen übereinander gestapelt. Bei jedem weiteren Buch, das auf den Stapel platziert wurde, schien sich das Holz allmählich zu wölben. Noch nie hatten die Verkäuferinnen so viele Bücher auf einmal tragen müssen. Die Bücher waren umhüllt von einer Folie, damit auch kein Kratzer den Deckel beschädigte, doch trotzdem gingen sie sehr behutsam mit ihnen um. Der Duft von Druckerschwärze verbreitete sich im Laden. Draußen kamen schon die ersten Menschen vorbei und blickten neugierig durch das Schaufenster und dann auf ihre Armbanduhren. Aber es blieben noch ein paar Minuten, bis der Laden endlich öffnete. Die Menschenmenge vor dem Geschäft wuchs von Minute zu Minute. Es zog sie magisch an. Ein einziges Buch erregte die ganze Nation, als wäre es etwas Heiliges. Doch war es nicht eines unter Tausenden? Ein Karton stand noch ungeöffnet da, die restlichen hatte man im Lager untergebracht, für die kommenden Tage musste man Reserven zu Verfügung haben. Auch sein Inhalt musste noch auf den Tisch. Zum letzten Mal packte man die Bücher aus und stapelte sie auf den hohen Turm. Er war dem Umkippen nahe. Hoffentlich hielt er stand. Endlich geschafft. Die Gesichter auf den Buchdeckeln schauten ernst. Das Cover war eine edle Schwarzweiß Fotografie; der Titel und der Name des Autors waren in goldenen Lettern gedruckt. Auf dem Foto war der Autor selbst abgebildet, ein älterer Mann mit Brille und buschigen Augenbrauen, die Arme hatte er vor seiner Brust verschränkt. Was er wohl zu erzählen hatte? Ein Blick auf die Uhr und dann ein Blick zum Fenster. Höchste Zeit, die Tür zu öffnen. Es war jetzt neun Uhr. Der Fußboden war frisch geputzt, die Kasse aufgeschlossen und die Bücher in den anderen Regalen standen an ihrem Platz. Von ihnen würden heute kaum welche verkauft werden. Das Klimpern des Schlüsselbundes war der Startschuss.. Die Tür öffnete sich. Eilig hasteten die Menschen vorbei an den Regalen. Das einzige, das sie interessierte, war der Tisch in der Mitte. Der Raum füllte sich schlagartig. Innerhalb von Sekunden war der Tisch umlagert von Menschen, die nach den Exemplaren griffen und dann hektisch versuchten, sich durch die Menge zu drängen. Immer mehr von ihnen drängten sich um den Tisch. Fast pausenlos ertönte die Kasse mit einem schrillen Klingeln. Geld und Bücher wechselten ihre Besitzer. Sobald die ersten das Geschäft verließen, kamen schon die nächsten Kunden. Dieser Rhythmus zog sich über den ganzen Tag. Der Tisch wurde von Stunde zu Stunde leerer. Um sechs Uhr abends war dann der letzte Kunde verschwunden. Der Laden war verlassen, bis auf die Verkäuferinnen, die das Geld in der Kasse zählten. Der Tag hatte sich wirklich gelohnt. Sie war bis oben hin gefüllt von Geldscheinen und Münzen. Diese Biographie hatte sich hervorragend verkauft. Nur noch ein einziges Exemplar befand sich auf dem Tisch. Er wirkte plötzlich viel zu groß für ein einziges Buch, verlassen von all den anderen, die jetzt auf den Nachttischen lagen oder von ihren Käufern in den Händen gehalten wurden. Vielleicht waren sie aber auch schon in den Bücherregalen der Wohnzimmer verstaut worden. Ganz allein lag das Buch dort auf dem Tisch. Die Lampen wurden ausgeschaltet und schließlich die Ladentür abgeschlossen. Der Tag war zu Ende. Morgen würden die restlichen Kartons ausgepackt und die Bücher erneut auf dem Tisch ausgebreitet werden. Ein halbes Jahr später, der gleiche Laden. Der Tisch war wieder in die Mitte des Raumes platziert und besetzt von unzähligen Büchern. Der Mann mit der Brille und den buschigen Augenbrauen war jedoch verschwunden. Schon längst hatte man ihn ersetzt. An seiner Stelle strahlte nun eine junge Frau mit kurzen blonden Haaren den Kunden entgegen. Ihre Biographie sah ganz anders aus, viel bunter und lebendiger als die ihres Vorgängers. Das farbenfrohe Cover mit der schwarzen Schrift stach einem sofort ins Auge. Der Sekundenzeiger der Wanduhr war gerade an der Zwölf vorbei, als auch schon die Ladentür aufgeschlossen wurde. Es hatte sich wieder eine große Menschenmenge vor der Buchhandlung versammelt. Alles begann von vorne. Und wer würde es nächstes Jahr sein? Katrin Jansen Umami, lässt sich schwer zuordnen Zukunft? Auf der Suche nach einem Augenblick für mich ziehe ich mich zurück von den lachenden Gesichtern, den Wunderkerzen und Knallfröschen, dem Sekt und den kleinen Leckereien. In eine Nische setze ich mich und beobachte für einen Moment die letzten Ausläufer des Feuerwerks. Dann wird es dunkel, und ich werde still. Frage mich, was mir dieses Jahr gebracht hat. Habe ich etwas erreicht? Ich weiß es nicht. Was heißt das schon, etwas erreicht zu haben? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, überhaupt ein Ziel vor Augen gehabt zu haben. Trotzdem ist das Jahr nicht ereignislos vorübergegangen. Es ist so viel passiert, dass ich es kaum ordnen kann, und in meinem Kopf beginnt etwas herumzuschwirren, das mich auch die letzten 12 Monate hindurch begleitet hat. Kaum hatte ich wieder Anschluss gefunden, ist schon etwas Neues geschehen, das mich und mein Leben durcheinander gebracht hat. Viel zu schnell vergeht die kostbare Lebenszeit. War nicht gestern noch mein Geburtstag? Ist er nicht morgen schon wieder? Bin ich denn noch dieselbe, die ich vor einem Jahr war? Wer ist das schon? Jedes Ereignis hinterlässt doch eine Spur, mag sie auch noch so klein sein. Und das ist auch gut so – denn neben der Kraft, die man aus schönen Ereignissen sein Leben lang schöpft, kann man aus schlechten Erfahrungen wunderbar lernen, das weiß ich jetzt. Ich lasse das Jahr einen Augenblick Revue passieren, und ziehe dann bewusst einen Schlussstrich darunter. Was mich jetzt interessiert, ist die Zukunft. Was wird das neue Jahr bringen? Wie kann ich es gestalten? Langsam werde ich mir meiner Möglichkeiten bewusst. Wenn ich will, kann ich so vieles verändern. Ich werde ein paar Entscheidungen treffen müssen, und das werde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Trotzdem, wenn mal etwas danebengeht, dann ist das menschlich. Ich spüre auch meine Grenzen. Ich kann nicht alles Leid in der Welt beenden, kann nicht immer für jeden da sein. Perfektion kann ich nicht erreichen. Aber das macht mich nicht mehr traurig. Nun stehe ich auf, blicke in die Nische zurück, in der ich das alte Jahr hinter mir gelassen habe. Nur eine angenehme Leere in meinem Kopf bleibt mir. Ich gehe ein paar Schritte. Zunächst habe ich das Gefühl, zu schwanken, doch dann wird der Untergrund fester. Da, plötzlich, spüre ich etwas in meiner Hand. Es ist eine kräftige, warme Hand. Vielleicht werde ich das neue Jahr nicht alleine gestalten müssen. Katrin Jansen Süß, Umami Sie Sie fiel ihm zum ersten Mal auf an einem Freitag, als er sich wie üblich den Weg durch die Menschenmassen zur Universität zu kämpfen suchte. Vorher hatte er sie noch nie bemerkt, trotz langen Studiums und trotz seiner Suche nach Geborgenheit in dieser lauten, vollen Stadt. Aber nun hatte er das Gefühl, als habe sie schon immer dort gestanden, nahm sie doch einen festen Platz im Getümmel ein. Er verlangsamte seine Schritte und schaute sie einen Augenblick an. Sie rührte sich nicht. Nur am Rande realisierte er, wie die Menschen vorbeiströmten, ohne ihr Beachtung zu schenken, in Eile immer wieder auf die Uhr blickend. Auch er tat das jetzt, nur um festzustellen, dass er spät dran war. Er riss sich los von ihrem Anblick, und sein Leben verlief wieder wie gewohnt. Sie fiel ihm nun immer wieder ins Auge, er blieb aber jedes Mal höchstens ein paar Minuten stehen. Passanten mussten ihn für einen komischen Vogel halten, doch für ihn stellte sie den Inbegriff der Schönheit dar. Diese Beständigkeit, und wie sie jedem Wetter trotzte, sich von nichts und niemandem beeindrucken ließ. Eines Montagmorgens war sie einfach verschwunden. Es musste am Wochenende passiert sein. Trostlos und kahl wirkte nun die Passage zwischen der S-Bahn-Station und der Universität, und ihm fehlte etwas. Er trat näher, um die Stelle genauer anzusehen. Dort, wo vorher die prächtige Buche gestanden hatte – mitten in der Großstadt – war nun nichts mehr als ein gerade abgeschnittener Baumstumpf zwischen Hochhäusern, auf den er sich nun setzte. Eine ganze Weile hatte er dort gekauert und nachgedacht. Plötzlich riss ihn eine Stimme aus seinen Gedanken. „Hey, wenn du nicht langsam aufstehst, verpassen wir die Vorlesung!“ „Wir?“, erwiderte er verdutzt. Er kannte dieses Mädchen nicht. „Du stehst nun schon seit Monaten jeden Morgen hier, stimmt’s?“ Er nickte mit offenem Mund. „Ich beobachte dich schon eine ganze Weile“, sagte sie schmunzelnd. „Ich wollte dich schon seit Längerem fragen, ob wir gemeinsam zur Uni gehen könnten, wenn wir schon die gleiche Bahn nehmen und das gleiche Fach studieren. Aber du warst irgendwie beschäftigt…“ Das war doch unmöglich, dass sie ihm nie aufgefallen war! Ihre grün-braunen Augen strahlten etwas Ruhiges, aber dennoch Lebendiges, Interessiertes aus. In ihnen spiegelte sich glänzend das Licht der Sonne. Mit ihren breiten Schultern behauptete sie sich gegen die rempelnden und eilenden Menschen. Sie schien so… natürlich? „Hallo, hörst du mich? Ich gehe jetzt los.“ Wie angewurzelt stand er immer noch da und blickte ihr hinterher, wie sie sich in der Menge verlor. Dann begann er zu laufen. Katrin Jansen Sauer, bitter (als „Überraschungseffekt“ – die Story selbst ist letztendlich nicht bitter, wirkt aber zunächst so) Schreck lass nach Ein dumpfes Knallen riss mich aus meinem Schlaf. Aus dem Augenwinkel sah ich noch, wie das Mädchen schräg vor mir mit der Hand nach etwas auf dem Boden langte, sich danach wieder ihrer Klausur widmete und mit dem anscheinend gerade aufgehoben Tintenkiller wie wild über das Papier fuhr, um dann etwas Neues, vielleicht Besseres aufzuschreiben. Mein Blick schweifte durch den Raum, über die anderen konzentrierten Köpfe hinweg. Scheiße. Ich fühlte mich, als hätte sich unter mir gerade eine Falltür aufgetan, als stürzte ich nun haltlos in die Tiefe. Meine Klausur! Ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Wie hatte das passieren können? Mein Blatt lag vor mir, wie es wohl zu Beginn der Klausur vor mir gelegen haben musste. Leer. Hektisch suchten meine Augen den Raum nach einer Uhr ab. Verdammt. Es war kurz vor zwölf. Kurz vor Abgabe. Es war mir unmöglich, auch nur zu lesen, denn die Buchstaben verschwammen vor meinen Augen. Vielleicht tanzten sie Wiener Walzer. Wenig später piepste die Eieruhr auf dem Pult des Lehrers. Ohne einen Blick herab nahm er mein Blatt vom Tisch. Ich blieb einfach sitzen und starrte ins Leere. Ich war noch wie betäubt, als ich auf dem Parkplatz vor dem Universitätsgebäude versuchte, mein Auto aus dem Chaos herauszumanövrieren. Von allen Seiten war ich zugeparkt worden, dabei konnte ich mich gar nicht erinnern, das Auto hier abgestellt zu haben. Die Politesse, auf die ich zuging, um mich zu beschweren, schien mich überhaupt nicht zu bemerken. Sie sah über mich hinweg und heftete ein Knöllchen – wie sollte es anders sein – an mein Auto. Meine Worte des Protestes blieben ungehört, wie es schien. Niemand drehte sich nach mir um. Klasse. Plötzlich fuhr ich. Aber nicht lange, denn an der Straßenecke durfte ich ein Schauspiel miterleben, das mir den Rest gab. Mein Freund stand da, an eine Häuserecke gelehnt, allerdings nicht alleine. Sie war blond, groß und hatte lange Beine, war perfekt gekleidet und hatte im Gegensatz zu mir keine Brille und keinen Bauchansatz. Händchen in Händchen schauten sie sich verliebt einander in die Augen, um dann zum Küssen überzugehen. War das noch zu toppen? Vielleicht. Durch das Klingeln meines Weckers zum Beispiel. Nach diesem Traum fühlte ich mich wie gerädert, das mochte jedoch auch daran liegen, dass es gestern Abend spät geworden war und ich heute die Aussicht auf einen stressreichen Tag hatte. Es war nicht besonders klug gewesen, vor der Klausur mit einem solchen Alkoholpegel zu einer so späten Zeit ins Bett zu gehen. Vielleicht war es besser, einfach im Bett liegen zu bleiben. Die Klausur konnte ich jetzt ohnehin nur noch versemmeln. Eigentlich war der Tag jetzt doch geradezu dazu prädestiniert, im Chaos zu enden. Andererseits hatte ich meinem Freund versprochen, ihn heute nach der Klausur zu treffen. Gestern hatte er ohnehin schon wütend gewirkt, und wenn ich noch eine Chance bei ihm haben wollte, sollte ich mich wohl schleunigst aufmachen. Seufzend quälte ich mich ins Badezimmer, würgte einen Toast runter und achtete penibel darauf, dass alles in meiner Tasche war, was hineingehörte. Ich vergaß nicht den Schlüssel, hatte ausreichend Tintenpatronen und Verpflegung für den Tag. Auch meine Busfahrkarte hatte ich dabei. Ich hatte beschlossen, einen früheren Bus zu nehmen als gewöhnlich, nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Es überraschte mich, dass dieser Bus ankam, als ich kaum eine Minute an der Haltestelle gestanden hatte. Eine Stunde zu früh stand ich mit einigen anderen Studenten vor dem Raum, in dem meine Klausur stattfinden würde. Ich schaute mir noch einmal die Formeln an, die wichtig waren, und die Stunde verging wie im Flug. Mit der Klausur selbst verlief es nicht anders. Ich war selten so entspannt gewesen. Vielleicht hatte mir jemand was in den Kaffee getan. Lächelnd gab ich ab und verließ leichtfüßig den Raum, um mich auf den Weg zu meinem Freund zu machen. Der Parkplatz war leer, und innerhalb weniger Minuten hatte ich das Stadtzentrum verlassen. Wie man sich doch täuschen konnte. Beim Chinesen wartete mein Freund schon auf mich. Bei seinem Anblick kehrte das mulmige Gefühl von heute Morgen langsam wieder zurück. Ich konnte schlecht leugnen, was gestern vorgefallen war, und noch weniger konnte ich ignorieren, dass er mir nicht in die Augen sah, als wir uns begrüßten. Auch ich senkte meinen Blick; das leichte Gefühl, das mich vorher durchströmt hatte, war nun komplett verschwunden. „Ich muss mit dir reden…“, murmelte er, und meine Befürchtungen schienen sich letztendlich doch noch zu bewahrheiten. Schade. Es hätte doch noch so ein schöner Tag werden können. Ich nickte traurig. „Du, in letzter Zeit ist das alles ein bisschen blöd gelaufen zwischen uns…“ Der Kloß in meinem Hals wuchs um das Dreifache. Ich kannte das alles schon. Und ich war kein Fan von Déjà-vus. „Tatsache ist…“ Bitte, sprich nicht weiter, dachte ich. Ich will es nicht hören. Lass uns hier und jetzt einfach die Zeit anhalten und diese komplizierte Welt vergessen. Ich will nicht, dass jetzt alles vorbei ist. Ich liebe dich doch! „…ich möchte mich entschuldigen wegen gestern. Ich war nicht wütend auf dich. Du weißt, wir haben das Fußballspiel verloren, und dann war ich auch noch gestresst, weil mein Chef so viel von mir fordert. Das tut mir Leid. Ich habe mich wie ein Idiot benommen. Hast du vielleicht Lust, dass wir uns heute einen richtig schönen Abend machen? Lass uns den Stress vergessen, einfach nur wir beide.“ Mein Gesicht in dieser Situation hätte ich gerne gesehen. Katrin Jansen Salzig, bitter Ans Meer Manchmal gab es Zeiten, in denen alles schiefging. Wie dieses Jahr zum Beispiel. Es hatte damit angefangen, dass ihr Hund gestorben war, und, schlimmer noch, sie hatte dabei zusehen müssen. Damals hatte er sich losgerissen und war auf die Hauptstraße gelaufen. Millisekunden später, bevor sie etwas hatte unternehmen können, war der Lastwagen – viel zu schnell – vorbeigerauscht, ihr Hund war erfasst worden. Die Bilder hatte sie heute noch im Kopf. Bei der ruckartigen Bewegung ihres Kopfes hatte sie sich den Nacken verstaucht, am selben Tag noch war sie deswegen beim Arzt gewesen. Der hatte nur gesagt, das würde sich schon wieder geben. Ihr Hund war schon alt gewesen, deshalb war sie damals relativ schnell darüber hinweggekommen. Seine Einschläferung hätte wenig später stattfinden sollen. Vielleicht war es besser so, hatte sie sich gesagt. Bei der Geschwindigkeit hatte es ein ähnlich kurzer und schmerzloser Tod sein müssen wie der durch die Spritze, der ihm bevorgestanden hatte. Und obwohl sie gewusst hatte, dass sie ihn vermissen würde, war sie sich sicher gewesen, dass der Tod ihres Hundes nicht so lang beschäftigen würde. Zumindest hatte sie das gedacht. Doch dann hatten sich ihre Noten rapide verschlechtert. Niemand konnte sich das so recht erklären, denn sie war eigentlich immer eine gute Schülerin gewesen, die meisten ihrer Noten hatten im Zweierbereich gelegen. Ohne große Mühe hatte sie bis dahin dem Unterricht folgen können. Dann folgten auf die erste unerklärliche Fünf in einer Mathearbeit weitere in Englisch und Geschichte. Sie konnte sich nicht erinnern, irgendetwas anders gemacht zu haben als sonst, auf der Suche nach Erklärungen für ihre plötzliche Verschlechterung blieb sie ratlos und verzweifelt. „Das ist normal, mal so einen Durchhänger zu haben“, meinte ihre Mutter, als sie eines Abends gemeinsam auf der Bettkante saßen und nach Lösungen für das Problem suchten. „Ich hatte das auch, als ich so alt war wie du, aber das gibt sich wieder. Manchmal braucht man einfach so eine Zeit, um danach wieder mit Interesse und Konzentration bei der Sache sein zu können.“ Diese Erklärung stellte sie wenig zufrieden. Sie konnte nicht sagen, was es war, aber irgendetwas fehlte ihr in letzter Zeit. Spätestens, als ihr Freund sich von ihr trennte, begann sie, das zu spüren. Er hatte eine andere. Das hatte sie schon seit einigen Wochen geahnt. „Ich wollte dich nicht verletzen… aber ich kann an meinen Gefühlen nichts ändern. Es tut mir wirklich leid für dich, das musst du mir glauben“, hatte er ihr versichert. Sie hatte nur genickt und die Tränen zurückgehalten. Bei ihrer Freundin hatte sie die dann rausgelassen. Gemeinsam hatten sie eine ganze Schüssel Schokoladeneis mit Schokoladensoße und -streuseln geleert, danach war es für diesen einen Tag gut gewesen. Doch dann war die Melancholie in ihr Leben zurückgekehrt. Einerseits vermisste sie ihn ungeheuer. Sie vermisste ihn, sie vermisste ihren Hund, sie vermisste ihre guten Noten. Doch da war noch etwas, was sie traurig und unkonzentriert machte, etwas, das sie nicht benennen konnte. Es legte sich wie ein grauer Schatten über ihr Leben und nahm ihr jegliche Hoffnung und Zuversicht. Ihr Nacken hatte nicht aufgehört zu schmerzen, im Gegenteil. Der Schmerz hatte sich in ihrem ganzen Körper ausgebreitet. Sie hatte es aufgegeben, Salbe darauf zu schmieren, und auf einen weiteren Arztbesuch hatte sie schlichtweg keine Lust. Was sollte das schon bringen? Ihr Hausarzt hatte gesagt, das würde sich wieder geben. Die Lehrer begannen, sich Sorgen zu machen, als sich auch die mündlichen Noten verschlechterten. Wieder und wieder suchten sie das Gespräch und wollten wissen, was los war. Sie konnte nur mit den Schultern zucken und ihnen signalisieren, dass sie auch keine Erklärung hatte. Irgendwann sagte sie einfach gar nichts mehr. Sie hatte das Gefühl, dass das Leben an ihr vorbeizog. Neigte sich mit dem Ende ihrer Jugend auch ihr Leben dem Ende zu? Es schien so. Wo war überhaupt der Sinn hinter dem Ganzen? Man ging zur Schule, lernte Menschen kennen. Freunde kamen und gingen wieder. Kaum etwas blieb konstant. Man musste sich entscheiden. Wer sind meine Freunde? Was will ich nach der Schule machen? Aber auch so banale Sachen wie: Was soll ich heute anziehen? Oder Welche Party will ich nächstes Wochenende besuchen? Auf Partys ging sie schon lange nicht mehr. Die laute Musik machte ihr zu schaffen, genau wie diese aufgesetzte Fröhlichkeit. Außerdem war sie um zehn schon viel zu müde. Spaß machte ihr sowieso kaum noch etwas. Die Fragen ihrer Freundin, was denn mit ihr los sei, ließ sie an sich abprallen. Irgendwann hörte sie auf, nach dem Grund für ihre Traurigkeit zu suchen, und sprach mit niemandem mehr. Nicht mit den Lehrern, die resigniert hatten, nicht mit ihrer Freundin, die nun mit jemand anderem ihre Wochenenden verbrachte, nicht mit ihren Eltern, die verzweifelt und hilflos die Entwicklung des Lebens ihrer Tochter beobachteten. Alles stimmte sie so traurig. Eine Zeit lang konnte sie sich kaum noch die Nachrichten ansehen, ohne in Tränen auszubrechen. Dann blieben die Tränen weg, abgelöst von einer Beklommenheit tief in ihrem Inneren. Eines lauen Sommerabends hatte sie das Fenster weit geöffnet. Sie konnte nach unten auf den harten Asphalt der Straße schauen. Um diese Zeit fuhr kaum noch ein Auto durch den ruhigen Wohnblock. Sie verlor sich in diesem Anblick. Sie hatte die Wahl… Das wäre so endgültig. Mehr noch, als ein Punkt hinter einem Satz, hinter einer Geschichte. Plötzlich hörte sie ein Geräusch hinter sich. Das laute Atmen eines Menschen. Die Stimme hörte sich an, als käme sie aus weiter Ferne. Sie hörte sich fremd an, aber sie musste wohl ihrem Vater gehören. Dann spürte sie eine Hand auf ihrem Arm, die sie sanft in Richtung Tür zog. Im Hausflur stand ihre Mutter. Hatte sie wirklich solche Ringe unter den Augen? Eine Tür neben ihr knallte zu. Sie saß auf dem Beifahrersitz des Autos, neben ihrem Vater. Er wirkte angespannt, wenngleich äußerlich ruhig. Seinen Blick hatte er starr auf die Straße gerichtet. „Wir fahren ans Meer“, log er. Sie verlor sich in diesem Gedanken. „Ans Meer…“ Dort würde es bestimmt schön werden. Einordnung: bitter, sauer Annika Esch: - ohne TitelEs war ein trister Sonntag, an dem Jakob und Tom hinunter zur Fulda gingen. Der Himmel war bedeckt von grauen Wolken, und der Nieselregen zerstörte Toms mühsam errichtete Frisur. Tom war trotz seines jungen Alters von 11 Jahren ein wenig eitel und legte viel Wert auf sein Äußeres. Das hatte er wohl von seiner Mutter. Dabei war seine Frisur grauenhaft. Jakob vermochte es nicht ihm dies zu sagen, er wusste, dass er nicht gut darauf zu sprechen war. Trotz gewisser Uneinigkeiten hatte Jakob in Tom einen recht guten Freund gefunden, der mit ihm auch die langweiligsten Sonntage verbrachte. „Los“, sagte Jakob, „wer zuerst unten am Fluss ist!“ und die beiden liefen los. Die Fulda war ein kleiner Fluss, der sich dennoch gewaltsam fortbewegte und sich hastig durch den Wald schlängelte. Jakob war erster und ließ sich seine Erschöpfung nicht anmerken, als auch Tom das Ufer erreichte. Dieser warf Jakob schnaubend einen kurzen mürrischen Blick zu, doch Jakob lächelte nur zurück. „Du magst vielleicht schneller sein als ich, aber feige bist du trotzdem“, sagte Tom. „Ich und feige?“, erwiderte Jakob, „ich bitte dich!“. „Ich wette, du traust dich nicht auf den Ast da zu klettern!“, sagte Tom und zeigte mit ausgestrecktem Arm auf einen großen Buchenzweig, der bis über den Fluss reichte. Gesagt, getan. Jakob lief auf den Baum zu und kletterte galant hinauf. Als er schließlich freihändig auf dem großen Ast stand, konnte in Toms riesige Augen blicken. Er war fassungslos. „Tja“, rief Jakob, „was sagst du nun?“ Tom war es nicht einmal mehr ermöglicht zu antworten, da passierte es. Jakob viel mit einem dumpfen Platschen in den reißenden Fluss und nirgends war eine mehr eine Spur von ihm. Er versuchte an die Oberfläche zu gelangen, doch wie eine Schlingpflanze hielt das Wasser ihn in seinen Ranken und machte es ihm unmöglich, sich zu bewegen. Er wirbelte umher und drehte sich endlos. Die Wassermassen hielten ihn gefangen, er wusste nicht wo oben und unten war. Das Einzige, was er vernahm, war das laute Rauschen des Wassers, und die Kälte, die ihn voll und ganz durchdrang. Doch plötzlich wurde alles um ihn herum still. Es wurde warm um ihn und er konnte die Sonne durch die Wasseroberfläche schimmern sehen. Er stieß nach oben und schnappte nach Luft. Es war ein süßer, lieblicher Duft, den er nahezu schmeckte, und die Sonne kitzelte sein Gesicht. Er wusste nicht, wo er war, er wusste nur, dass er sich an diesem Ort sehr wohl fühlte. Vögel zwitscherten, um ihn herum erblühten ihm unbekannte Pflanzen in ihrer vollen Pracht. Das Wasser hatte eine angenehme Temperatur angenommen, und das sanfte Plätschern eines etwas entfernten Wasserfalls erfüllte sein Ohr. Doch er blieb nicht lange in diesem Ort, langsam verschwamm diese Welt, in der er war, und es wurde dunkel und still. Jakob versuchte sich zu wehren, er wollte nicht weg von dort, aber plötzlich hörte er Toms Stimme. Seine verzweifelten Rufe kamen immer näher. Schließlich öffnete er seine Augen und blickte in Toms verängstigtes Gesicht. Er fand sich an einem kahlen Ufer wieder und wurde von Tom umarmt. „Gott sei Dank, du lebst!“, rief dieser und umarmte ihn fester. Jakob war leicht verwirrt, aber rappelte sich auf, nahm Toms Hand und sagte: „Komm mit, Tom, ich muss dir was zeigen!“. Einordnung: sauer, süß Annika Esch: Weil du leuchtest Sie war fort. Er hatte sie verloren. Hilflos und zusammengekauert lag er in dem kleinen, hölzernen Ruderboot. Regungslos trieb er auf dem stillen Wasser umher, auf dessen Oberfläche das Spiegelbild des Vollmondes schimmerte. Er war allein, allein in der Nacht. Nur das Leuchten des Mondes schien ihn am Leben zu erhalten. Die Augen weit aufgerissen, liefen Tränen an seiner Wange hinab. Er fand sie einfach nicht mehr… „Luna“ wimmerte er „Luna“. Panik breitete sich in ihm aus, und plötzlich saß er kerzengerade in seinem Bett. Die Sonnenstrahlen erhellten sanft sein Zimmer, doch er war erfüllt von Kälte. Seine Augen waren noch feucht, und mit leerem Blick starrte er an die gegenüberliegende weiße Wand. Plötzlich beugte er sich über die Bettkante und erbrach. Das konnte nicht sein. Sie konnte nicht weg sein. Nein, das ging nicht. Er dachte an ihre zarten Hände, wie sie sanft seinen Nacken streichelten, an ihren süßen Duft, der seine Nase erfüllte, während sich sein Gesicht in ihren langen blonden Haaren vergrub, an ihre blauen Augen, die immerzu funkelten. Sie konnte nicht weg sein. Irgendwo da draußen war sie, ganz bestimmt. Sie musste. Er schob die Bettdecke beiseite, stellte die nackten Füße auf die Fliesen und erhob sich langsam und schwerfällig. Mühsam schluffte er zum Küchentisch hinüber und schüttete sich ein Glas Wasser ein. Mit großen Schlucken trank er es in einem Zug aus und stellte das leere Glas zurück auf die Tischplatte. Er setzte sich auf den kleinen Stuhl neben dem Tisch und verweilte dort einige Minuten regungslos. Er musste sie finden, er musste. Er stand auf, nahm seine Jacke von der Garderobe, streifte sie sich über sein weißes T-Shirt, sodass nur noch ein Teil der karierten Boxershorts hervorblickte, und betrat barfuss, wie er war, den Hausflur. Als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, lief er los. Er rannte die vier Stockwerke hinunter und überschlug sich dabei fast. Das laute Knallen seiner nackten Fußsohlen auf die Stufen hallte durch das ganze Treppenhaus. Doch als er die Straße erreichte, stoppte er, überall so viele Menschen. In der Stadt war Jahrmarkt und die Straßen waren überflutet von lachenden, tanzenden Kindern, Liebespaaren, die Hand in Hand vorübergingen, Zuckerwatte aßen und ihr Glück kaum fassen konnten. Überall strahlte die Freude nur zu aus ihnen heraus. Er ging los, einfach gerade aus. Er wurde von vielen Menschen angerempelt, doch das störte ihn nicht, er musste sie finden. Die Bewegungen der anderen Menschen nahm er fast gar nicht wahr, sie bewegten sich in Zeitlupe. Mit seinen Augen suchte er alles ab, jede Person, jedes Gebäude, sogar auf dem Boden suchte er. Doch sie war nirgends zu finden. Seine Schritte wurden schneller, sein Atem kürzer. Schweißtropfen bildeten sich auf seiner Stirn und perlten herab. Er rannte. Hektisch blickte er in den Menschenmassen umher. Panik tat sich in ihm auf. Er lief und lief und würde laufen, bis er sie gefunden hatte. Seine Füße schmerzten bei jedem Schritt auf das Kopfsteinpflaster, doch das hinderte ihn nicht. Er rannte die komplette Jahrmarktmeile hinab, bis zum Ufer des kleinen künstlich angelegten Sees. Da war sie. Tatsächlich. Dort stand sie in ihrem weißen Sommerkleid, das schwungvoll im Wind wehte. Langsam ging er auf sie zu. Sie war wunderschön, wie immer. Sie stand mit ihren nackten Füßen im Wasser und lächelte ihn liebevoll an. Als er schließlich vor ihr stand, blickte er sie längere Zeit an. „Luna“ brachte er erleichtert und mir einem vorsichtigen Lächeln auf den Lippen hervor. Sie hob ihre Hand und er berührte mit seinen Fingerspitzen die ihrigen. Eine junge Frau, die auf einer Bank neben ihm saß, beobachtete ihn dabei, wie er seine Hand ins Leere streckte und fragte: „Was tun Sie da?“ – doch er antwortete nicht. Einordnung: süß, salzig Annika Esch: -ohne TitelEine frische Brise wehte ihr ins Gesicht und ließ ihre langen braunen Haare zurück wehen. Mit jedem Schwung kam sie dem Himmel ein Stückchen näher. Sie genoss es, diese kleine Gefühl von Freiheit. „Als Kind hab ich immer gedacht, dass ich irgendwann fliege, wenn ich immer höher schaukle“ sagte sie schmunzelnd. „Im Ernst?“ fragte Jonas, „Ja“ antwortete ihm Leila, „bis ich runtergefallen bin.“ „Das passt zu dir“ sagte Jonas und fing an zu lachen. Auch Leila stimmte mit einer leichten Röte auf den Wangen in sein Lachen ein. Sie liebte es. Das alles. Die alte Schaukel, die bei ihrer Großmutter im Garten stand und auf der sie als Kind schon immer für ihr Leben gern geschaukelt hatte, diese Frühlingsluft, die ihre Nase mit einem zauberhaften Blütenduft erfüllte, und Jonas, Gott, wie sie Jonas liebte. „Wollen wir uns ein wenig die Beine vertreten?“ fragte er und Leila nickte ihm lächelnd zu. Sie verließen den kleinen Garten und gingen die Dorfstraße hinaus. Am Rand kamen sie an vielen kleinen Häusern vorbei, von denen einige mit dichtem Efeu bewachsen waren. Es war früh am Abend und die Sonne stand schon tief am Himmel. „Weißt du eigentlich, wie schön das alles mit dir ist?“ fragte Leila strahlend. „Schöner als mit dir kann es gar nicht sein“ sagte Jonas, nahm ihre Hand und sah sie liebevoll an. Leila errötete wieder leicht, das tat sie immer, wenn er sie so ansah. Jonas war ein recht gut gebauter junger Mann, hatte kurze blonde Haare und leuchtend grüne Augen, die Leila immer wieder faszinierten. Wenn er lächelte, bildeten sich kleine Grübchen neben seinen Mundwinkeln, die ihn noch unwiderstehlicher machten, als er ohnehin schon war. So konnte Leila ihre Augen wieder einmal nicht von ihm lassen und tollpatschig, wie sie war, stolperte sie über die nächste Bordsteinkante und lag auf dem Bürgersteig. Jonas stimmte ein kurzes Lachen an und auch Leila konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Er sah sie zärtlich an und setzte sich zu ihr auf den warmen Asphalt. Von dort aus hatten sie einen Blick auf die untergehende Sonne, die zwischen zwei der kleinen alten Bauernhäuser hervor kam. Jonas legte den Arm um die Schulter seiner Freundin und sie legte ihren Kopf an seine Brust. „So soll es immer sein, ich will nicht, dass das aufhört“ brachte Leila leise hervor. „Ich auch nicht, ich auch nicht“ flüsterte Jonas und küsste sanft ihre Stirn. „Es sind nur zwei Jahre“ sagte er. „Ja!“ stieß Leila hervor, „zwei verdammt lange Jahre!“. Jonas würde für zwei endlose Jahre nach Neuseeland gehen, um dort in einem neuen Forschungszentrum für Meeresbiologie zu arbeiten. Zwei Jahre, die die beiden getrennt voneinander wären, zwei Jahre, in denen so viel passieren könnte. Doch Leila wäre es am liebsten gewesen, wenn dieser letzte Augenblick niemals enden würde. 497 Tage später war sie da. Mit all ihrem Hab und Gut stand sie dort. Mitten im Flughafen in Auckland. Sie hatte den Entschluss gefasst. Sie hielt es nicht länger aus, und war in das nächst beste Flugzeug nach Neuseeland gestiegen. Ein Ticket ohne Rückflug. Und da war sie, allein in einer Masse von hektisch umher laufenden Menschen und niemand, der auf sie wartete. Doch da, am Ende des riesigen Flughafengebäudes erschien eine vertraute Gestalt, die auf sie zukam. „Jonas!“ rief sie und rannte los. Auch Jonas lief seiner geliebten und zu sehr vermissten Freundin entgegen und sie fielen sich hingebungsvoll in die Arme. Leila weinte und sie standen lange Zeit eng umschlungen und voll Liebe erfüllt inmitten der vielen Menschen im Flughafen von Auckland. Und sie würden so lange dort stehen bleiben, bis es real würde. Einordnung: umami, bitter Annika Esch: Fliegen Er sprang. Ein letzter Atemzug, und er stürzte in die Tiefe. Meo ging es gut. Unter den anderen Schülern war er relativ beliebt, zu Hause gab es keinerlei Schwierigkeiten, und er hatte eine überaus reizende Freundin. Sein junges Leben war also recht sorgenfrei, was ihm auch nicht besonders missfiel. Eigentlich war er immer guter Laune und oft mit Freunden unterwegs, egal ob zum Sport oder zum allzu sehr verachteten Lernen für den nächsten Test, einsam war er nie. Dies hatte er größtenteils auch seiner Freundin Jenny zu verdanken, die so verknallt in ihn war, dass sie nicht mehr gerade denken konnte, wenn er bei ihr war. Meo mochte sie sehr, wie sie sich ihm hingab, wie sie sich ihm zu Füßen legte, ohne dass er irgendetwas tun musste. Im Prinzip war Meo glücklich. Er hatte alles, was er brauchte. Mehr sogar. Montagmorgen saß Meo an seinem gewohnten Platz in der hinteren Reihe des Klassenraumes. Jenny saß zwei Reihen vor ihm und folgte aufmerksam den Worten des Lehrers. Herr Loreck sprach über irgendwas mit Pythagoras, doch Meo war einfach zu müde ihm zuzuhören. Er war wieder mal zu lange rausgewesen, wäre er besser mal früher schlafen gegangen. Als seine Augenlieder kurz davor waren, zuzufallen, klopfte es. Nach einem zu lauten „Ja, bitte?“ des Lehrers wanderte Meos Blick zur Türklinke, die langsam herunter gedrückt wurde. Die Tür öffnete sich. Behutsam und ein zierliches Mädchen trat hervor. „Du musst Emilia sein!“ sagte Herr Loreck. Sie nickte. Sie war nicht besonders groß, und ihre langen braunen Haare fielen in leichten Wellen an ihren Schultern herab. Ihr Blick lag auf dem Boden, nur langsam wagte sie es, den Kopf zu heben und in die starrenden Gesichter der anderen zu schauen. „Emilia ist neu hier und wird ab jetzt in diese Klasse gehen“ erklärte Herr Loreck „soweit ich weiß, kommst du aus…“ doch Meo konnte ihm nicht folgen, so fasziniert war er von diesem Mädchen. Wie sie dort stand, sie sah so gebrochen aus, aber dennoch wunderschön. Ihre Haut schien so zart und weich zu sein, jedoch ein wenig zu blass für Mitte Mai. Ihre Lippen waren etwas schmal, doch gaben sie dem sonst so weichen Gesicht ein wenig Kontur. Sie sah so sinnlich aus. Ihre Augen liefen über die Gesichter der anderen, und als sie Meos Blick trafen, erstarrte er. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, so fesselnd war ihr Blick. Ihre blauen Augen leuchteten und ließen Meo nicht mehr los. Wie schön sie war. Irgendetwas war anders an ihr. Sie war nicht wie die anderen Mädchen, die er kannte. Sie war irgendwie zerbrechlich. Und wundersam. Trotzdem strahlte sie. Irgendetwas war nicht normal. „Such dir doch einen Platz“ sagte Herr Loreck und sie glitt sanft zu dem freien Stuhl in der ersten Reihe. Emilia. An nichts anderes konnte er mehr der denken, als Emilia. Der Unterricht endete überraschend schnell, doch mitbekommen hatte er gar nichts. Auch den Gong nahm er nicht wirklich wahr und bemerkte nur am Rande, wie die anderen ihre Sachen zusammenpackten und den Raum verließen. „Meo? Meeo?“ rief Jenny ihm strahlend zu. „Kommst du mit, oder was ist?“ und sie zwinkerte ihm grinsend zu. Er nahm seine Tasche, die er gar nicht erst ausgepackt hatte, und verließ mit seiner Freundin den Raum. Auf dem Flur hielt er verzweifelt Ausschau nach Emilia, doch sie war nirgends zu sehen. Auch auf dem Schulhof fand er sie nicht. Wo sie nur sein mochte, er wollte es wissen. „Was ist eigentlich los mit dir? Du bist total abwesend“ sagte Jenny und umfasste seinen Arm. Aus seinen Gedanken gerissen, entgegnete er ihr nur lächelnd: „Ach gar nichts, bin nur ein bisschen müde heute. War gestern wieder zu lange auf.“ Nachmittags lag er zu Hause im Bett und starrte regungslos an die Decke. Sie ging ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf, diese Emilia. Wie faszinierend sie war, ihr intensiver Blick. Der Gedanke an ihre tiefblauen Augen ließ ihn erneut erschaudern. Er war versunken, wirklich versunken in Gedanken an dieses zauberhafte Mädchen. Er rappelte sich auf und beschloss eine Runde rauszugehen. Er musste den Kopf frei bekommen, und wenn er an ein Mädchen dachte, sollte es doch Jenny sein. Er nahm sein Fahrrad und fuhr los. Ohne Ziel fuhr er einfach durch die Straßen. Irgendwann hatte er die kleine Stadt verlassen und fuhr auf die große Brücke zu, die über ein Tal aus Wiesen führte. Er fuhr schnell und achtete kaum darauf, was um ihn herum passierte, alles flog an ihm vorbei. Doch mitten auf der Brücke sah er sie. Das konnte doch nicht sein. Hier? Er kam näher und sah genauer hin. Sie war es. Emilia stand mitten auf der großen Brücke und blickte nachdenklich in die weite Landschaft. Meo hielt an. Emilia wandte sich ihm zu und blickte ihm tief in die Augen. Sie sahen sich eine Weile an, ohne dass jemand sich bewegte. Sag etwas. Los, sag etwas. „Was machst du denn hier?“ brachte Meo mühsam hervor. „Ich schaue mir ein bisschen die Landschaft an. Ist es nicht schön hier? Man kann so weit sehen“ sagte Emilia und drehte ihren Kopf wieder in Richtung der Aussicht. Ihre Haare wehten im Wind und ließen einen Hauch ihres süßen Duftes zu Meo herüber wehen. Er atmete tief ein und ihr lieblicher Duft benebelte ihn ein wenig. Sie schloss die Augen und breitete ihre Arme aus. „Wie schön muss Fliegen sein, meinst du nicht?“ sagte sie, doch Meo antwortete nicht. Emilia drehte sich zu ihm um und sah ihn fragend an. Doch Meo brachte immer noch kein Wort hervor. Er konnte nicht mehr, als sie anzusehen. Er hätte sie ewig ansehen können. „Würdest du mit mir fliegen?“ fragte Emilia ihn sanft. Ihr Blick war so fesselnd, dass Meo Mühe hatte, sie überhaupt zu verstehen. „Ich würde sehr gerne mit dir fliegen -“ antwortete er ihr leise - er flüsterte beinahe - „Nichts lieber als das“. Wie sie da stand, überhaupt nicht so gebrochen wie am heutigen Morgen in der Klasse. Sie wirkte nicht so schwach und zerbrechlich, aber dennoch wundersam. „Ich will frei sein“ sagte Emilia und schaute Meo fest an „Ich will nichts mehr, als frei sein“. Sie lächelte. Dann drehte sie sich um und ging. Sie ging die lange Brücke entlang, immer weiter. Meo sah ihr eine Weile nach, doch er riss sich los, stieg auf sein Rad und fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Er konnte nicht schlafen an diesem Abend. Er dachte nur an dieses wundersame Mädchen, das so schön war, auf seine Weise. Er hatte ein solches Verlangen nach ihr, wie er es noch nie gespürt hatte. Solch eine Sehnsucht nach jemandem, den er nicht einmal wirklich kannte, hatte er noch nie erlebt. Er wollte wissen, wie sich ihre Haut auf seiner anfühlte und wie ihre Lippen schmeckten. Er wollte wieder spüren, wie ihr zauberhafter Duft ihn ganz durchdrang. Und er wollte wieder in ihre tiefen blauen Augen blicken. Am nächsten Tag in der Schule war Emilia nicht da. Herr Loreck betrat mit bedrücktem Gesicht den Klassenraum und blickte ernst in die Gesichter der Schüler. Er nahm die Worte seines Lehrers gar nicht richtig wahr. Er glaubte es einfach nicht. Sprachlos starrte er auf den Mund, wie er sich immer wieder öffnete und wieder schloss. Das konnte nicht sein. Sie war tot. Tot. Sich selbst das Leben genommen. Das konnte nicht sein. „Nun bin ich frei, wirklich frei. Und darf endlich fliegen“. Das soll auf ihrem Abschiedsbrief gestanden haben. Das konnte doch nicht alles gewesen sein? Die Gesichter der Klasse erstarrten. Das konnte nicht sein. Sie flog. Allein, ohne ihn. Meo stand auf und verließ mit schnellen Schritten den Raum. Entschlossen machte sich auf den Weg zu seinem Fahrrad, das er auf dem Pausenhof abgestellt hatte. Er lief. An dem Fahrradständer angekommen, riss er sein Rad heraus und fuhr los. Er fuhr so schnell er konnte. So schnell war er noch nie gefahren war. Er fuhr zielstrebig zu der große Brücke. In der Mitte der Brücke angekommen, warf er sein Rad zur Seite und kletterte auf das Geländer. „Ich wollte mit dir fliegen!“ schrie er wutentbrannt. Er begann zu weinen. Noch einmal sagte er leise „Ich wollte mit dir fliegen.“ Und er sprang.