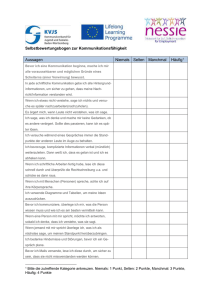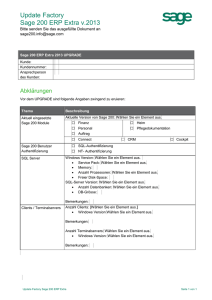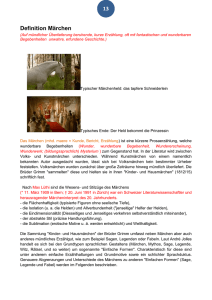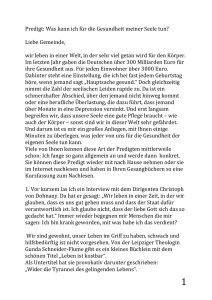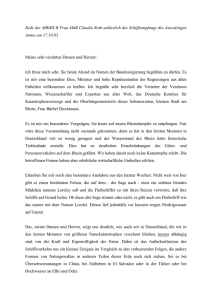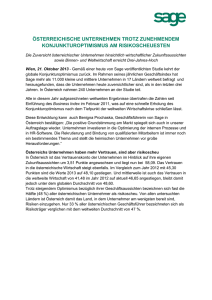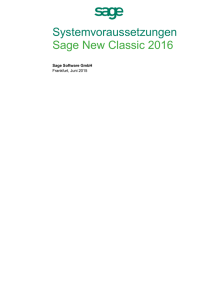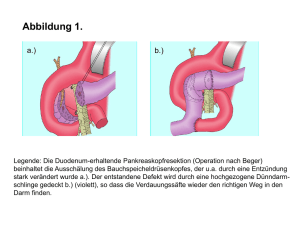Einführung in die Literaturwissenschaft
Werbung
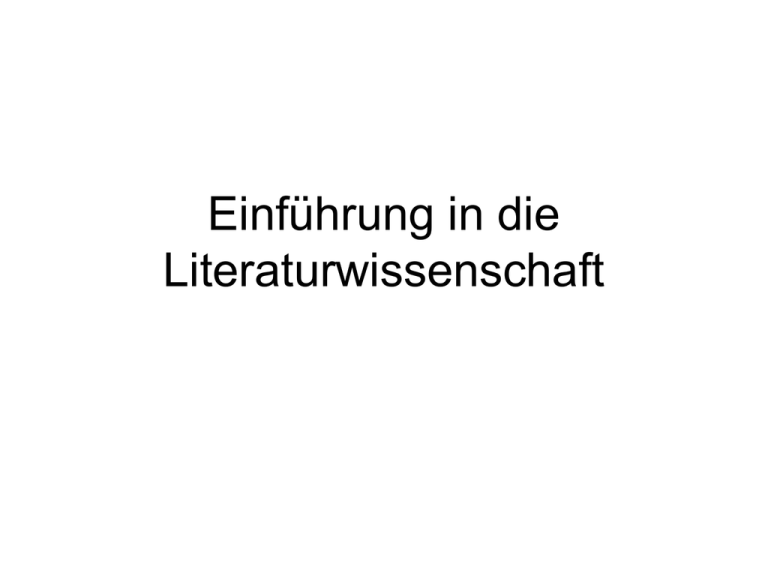
Einführung in die Literaturwissenschaft Was sind ›sprachliche Mittel‹? Rhetorik ist traditionell die Lehre von der Beredsamkeit. Sie unterweist in die Techniken und Mittel, mit deren Hilfe bestimmte Gedanken (res) mit geeigneten Worten (verba) einem jeweiligen Publikum (bei Gericht, bei einer politischen Versammlung, bei einem feierlichen Anlaß) zu Gehör gebracht werden. Aus dieser Perspektive betrachtet, sind Tropen (›Wendungen‹) und Figuren (griech. ›schemata‹, ›Haltungen‹) sprachliche Mittel. Sie dienen einem Zweck, den der Redner verfolgt. Schmuck (ornatus) (vgl. Göttert, S. 44-64) in Einzelwörtern in Wortverbindungen TROPEN (»Wendungen«) FIGUREN (griech. schemata, »Haltungen«) Wortfiguren Ersetzung Hinzufügung Auslassung Metapher Katachrese Metonymie Synekdoche Ironie Emphase Hyperbel Periphrase Antonomasie Litotes Anapher Ellipse Epipher Zeugma Paronomasie Polyptoton Synonymie Polysyndeton Asyndeton Sinnfiguren Umstellung Hyperbaton Parallelismus Antithese Chiasmus Lizenz Apostrophe rhetor. Fragen Konzession Anheimstellung Evidenz Hypotypose Personifikation Prosopopoiia Allegorie Die Figürlichkeit der Sprache Bei Quintilian hat sich allerdings gezeigt, daß ›Rhetorik‹, sofern sie von Tropen und Figuren handelt, mit mehr zu tun hat als nur mit dem Bereich der Eloquenz, der besonders kunstvollen Rede. Wollte man Tropen und Figuren in dieser Weise einschränken, dann müßte es so etwas geben wie ›schmucklose‹ Rede. Es gibt jedoch keine Rede ohne Tropen und Figuren. Die Sprache selber ist figürlich. Das zeigt sich insbesondere bei der Funktionsweise der Metapher als einer Katachrese. Sie bezeichnet durch einen übertragenen Ausdruck etwas, für das es keinen eigentlichen Ausdruck gibt (Beispiel: »Tischbein«). Die absolute Metapher ist kein Mittel Metaphern, die komplexe Vorstellungen zum Ausdruck zu bringen vermögen, welche nicht in ›eigentliche‹ Begriffe überführt werden können, nennt Blumenberg ›absolute Metaphern‹ (Beispiel: »das Buch der Natur«). Solche Metaphern müssen nicht explizit zur Sprache kommen, sondern können latent, im ›Hintergrund‹, Vorstellungszusammenhänge strukturieren. Kleists Anekdote »Der Griffel Gottes« führt eine solche Hintergrundmetaphorik vor. Eine absolute Metapher ist kein ›sprachliches Mittel‹, sondern geht dem Denken voraus. Genau in diesem Sinne ist auch die Figürlichkeit der Sprache generell eine Voraussetzung des Denkens. Gedanke (›res‹) und Wort (›verbum‹) sind nicht zu trennen. Themenübersicht • Literarizität: Was unterscheidet literarische Texte von anderen sprachlichen Äußerungen? • Zeichen und Referenz: Wie stellen literarische Texte den Bezug sprachlicher Äußerungen auf ›Wirklichkeit‹ dar? • Rhetorik: Was sind ›sprachliche Mittel‹? • Narration: Wie entstehen Geschichten? • Autorschaft und sprachliches Handeln: Wie greift Schreiben in Wirklichkeit ein? • Intertextualität und Intermedialität: Wie beziehen sich literarische Texte auf andere Texte / andere Medien? Wie entstehen Geschichten? 1. Grundformen des Erzählens Die Metapher erscheint bei Quintilian als eine elementare Funktion der Sprache, mit der Bezeichnungsmöglichkeiten hergestellt werden. Die Sprache ist ›poetisch‹, oder genauer: ›poietisch‹ (von griech. poiesis = das Machen, Hervorbringen). Eine solche ›produktive‹ Dimension sprachlicher Äußerungen ist auch auf anderer Ebene gegeben: beim Erzählen. Es lassen sich Grundformen des Erzählens unterscheiden, die es ermöglichen, Zusammenhänge von Ereignissen, das heißt Geschichten herzustellen. In einem ersten Schritt führt die Frage nach dem Entstehen von Geschichten insofern auf das Thema der Gattungen. André Jolles: »Einfache Formen« (1930) Grundformen des Erzählens, die nicht weiter zurückführbar, nicht weiter zerlegbar sind, nennt der Literaturwissenschaftler André Jolles ›Einfache Formen‹. Dazu zählen: Legende Sage Mythe Rätsel Spruch Kasus Memorabile Märchen Witz Jolles, »Einfache Formen«: Sprache als Arbeit Für Jolles sind Einfache Formen »jene[] Formen [...], die sich, sozusagen ohne Zutun eines Dichters, in der Sprache selbst ereignen, aus der Sprache selbst erarbeiten« (S. 10). ›Sprache‹ wird von Jolles als ›Arbeit‹ begriffen. Dabei ist die Tätigkeit des Dichters, die poetische Werke hervorbringt, nur die letzte von mehreren produktiven Instanzen. Die erste Instanz ist die »benennende Arbeit« der Sprache. Sie erzeugt Sachverhalte. Die zweite Instanz schafft eigenständige Gestalten, Fiktionen. Dies ist die Ebene der Einfachen Formen. Die dritte Instanz gibt Deutungen dieser Fiktionen. Dies ist die Arbeit der literarischen Werke, die einem Autor zugeschrieben werden können (Beispiele: Verarbeitung des Mythos bei Homer, der FaustLegende bei Goethe etc.). Legende Als erste Einfache Form nennt Jolles die mittelalterliche Heiligenlegende. Sie ist der deutlichste Fall einer ›schöpferischen‹ elementarliterarischen Form: »Was uns zunächst an der Weise auffällt, wie ein Heiliger – wir wollen sagen – zustande kommt, ist, daß er – ich muß mich wieder vorsichtig ausdrücken – selbst so wenig dabei beteiligt ist.« (S. 34) Ein Heiliger ist jemand, der nach seinem Tode in einem komplizierten rechtlich Verfahren der Kanonisation von der Kirche zunächst selig und dann heilig gesprochen wird. Anlaß für die Kanonisation sind die Geschichten, die, ebenfalls nach seinem Tode, über jemanden kursieren, und die besagen, daß er ein vorbildlich tugendhaftes Leben geführt hat, daß er Wunder bewirkt hat und daß er auch nach seinem Tode Wunder bewirken kann. Die Heiligenlegende ermöglicht es, den Heiligen anzurufen und ihn nachzuahmen. Sie erschafft den Heiligen. Legende »Der Heilige, in dem als Person die Tugend sich vergegenständlicht, ist eine Figur, in der seine engere und seine weitere Umgebung die imitatio erfährt. Er stellt tatsächlich denjenigen dar, dem wir nacheifern können, und er liefert zugleich den Beweis, daß sich, indem wir ihn nachahmen, die Tätigkeit der Tugend tatsächlich vollzieht.« (S. 36) »Die abendländisch-katholische Legende [...] gibt das Leben des Heiligen, oberflächlich gesagt seine Geschichte – sie ist eine Vita. Diese Vita als eine sprachliche Form hat aber so zu verlaufen, [...] daß sich in ihr dieses Leben noch einmal vollzieht. Es ist nicht damit getan, daß sie Ereignisse, Handlungen unparteiisch protokolliert, sondern sie muß diese in sich zu der Form werden lassen, die sie von sich aus noch einmal verwirklicht.« (S. 39) »Die Vita, die Legende überhaupt zerbricht das ›Historische‹ in seine Bestandteile, sie erfüllt diese Bestandteile von sich aus mit dem Werte der Imitabilität und baut sie in einer von dieser bedingten Reihenfolge wieder auf. Die Legende kennt das ›Historische‹ in diesem Sinne überhaupt nicht, sie kennt und erkennt nur Tugend und Wunder.« (S. 40) Legende Die Legende erzählt das Leben einer Person so, daß sie streng nach Beispielhaftigkeit – den Kriterien des Wunders und der Tugendhaftigkeit – selektiert. Dabei verwirklicht sie narrativ das Prinzip der Wiederholung: indem sie Tugendhaftigkeit nachahmbar macht und indem sie Wunder so darstellt, daß sie als jederzeit wieder möglich erscheinen. Im Weitererzählen der Legende werden die Beispiele von Tugendhaftigkeit und von Wundern vermehrt. So kann etwa ein Märtyrer aus dem 3. Jahrhundert schließlich zum Heiligen Georg werden, der die Jungfrau vor dem Drachen errettet etc. Sage Die Sage ist für Jolles diejenige einfache Erzählform, in der sich eine Geschichte nach dem Selektionskriterium der Genealogie, des Familenzusammen-hanges konstituiert. »Nirgends sind die Leidenschaften und die Schicksale einer Familie so unentwirrbar und so sprechend, wie im Nibelungenliede. Hier ist alles Familie. Gibichungen, Walisungen, Nibelungen, Burgunden sind Familien. Aber auch die Hunnen sind es, sie bilden kein feindliches Volk, sie bilden Etzels Stamm. [...] [Etzel] ist Ehemann, er ist Familienhaupt, er ist durch sein Eheweib an den Zwist einer anderen Familie gebunden, oder er ist lüstern nach dem Schatz, in dem sich Familienbesitz vergegenständlicht. – [...] [H]ier trifft [...] alles zusammen, was zur Familie gehört: Besitz und Fehde, Blutrache, Verwandtenmord, Brudertreue, Eifersucht, Frauenzank, Beischlaf«. (S. 85f) Sage Das Nibelungenlied ist für Jolles nicht selbst Sage, aber es sind Sagen in das Nibelungenlied eingegangen. Jolles betont immer wieder, daß Einfache Formen wie die Sage an das Weitererzählen, die mündliche Tradierungen gebunden sind und daß man sie als Text immer nur in verarbeiteter, reflektierter, in größere Zusammenhänge eingebundener Gestalt finden kann. Jolles verfolgt die Sage bis hin zu modernen Ausprägungen der sogenannten ›Familiensaga‹ (eigentlich eine Doppelung), etwa bis hin zu Emile Zolas vielbändigem Romanzyklus Les RougonMacquart (18-18). Für das 20. Jh. könnte man auch an entsprechende Filmformate denken. Auch in den Aussagen des Darwinismus (»Der Mensch stammt vom Affen ab«) erkennt Jolles Auswirkungen der Sage wieder. Mythe Beispiel: Genesis 1, 14-18 »Da sprach Gott: Es soll Leuchten entstehen an der Veste des Himmels, um den Tag und die Nacht voneinander zu trennen, und sie sollen dienen zu Merkzeichen und (zur Bestimmung von) Zeiträumen und Tagen und Jahren. Und sie sollen dienen als Leuchten an der Veste des Himmels, um die Erde zu beleuchten. Und es geschah so. Da machte Gott die beiden großen Leuchten: die große Leuchte, damit sie bei Tag die Herrschaft führe, und die kleine Leuchte, damit sie bei Nacht die Herrschaft führe, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Veste des Himmels, damit sie die Erde beleuchteten und über den Tag und über die Nacht herrschten und das Licht und die Finsternis voneinander trennten. Und Gott sah, daß es gut war.« Mythe Jolles’ Kommentar zu Genesis 1, 14-18: »Was haben wir hier vor uns? Schon in der Übersetzung hören wir, daß hier keine reine Aussage, keine Erzählung oder einfache Schilderung vorliegt. [...] Es ist etwas vorangegangen, und dieses Etwas war eine Frage, waren viele Fragen. [...] Was heißen diese Lichter des Tages und der Nacht? Was bedeuten sie uns [...]? Wer hat sie dahin gestellt ? [...] Und nun geht dem Fragenden eine Antwort zu. Diese Antwort ist so, daß keine weitere Frage gestellt werden kann, so, daß im Augenblicke, da sie gegeben wird, die Frage erlischt: Diese Antwort ist entscheidend, sie ist bündig. [...] Wo sich nun in dieser Weise aus Frage und Antwort die Welt dem Menschen erschafft – da setzt die Form ein, die wir Mythe nennen wollen.« (S. 96-97) »Mythe und Orakel gehören zusammen, sie gehören zur gleichen Geistesbeschäftigung. Beide sagen wahr.« (S. 98) Einfache Form und ›Geschichte‹ Legende Narrativ des Heiligen Sage Narrativ der Familie Mythe Narrativ des Ursprungs Narrativ der Historie Memorabile Memorabile »Der Freitod des Kommerzienrats S. Das Motiv für den Selbstmord des Kommerzienrates Heinrich S., der sich gestern abend in seiner Wohnung, Kaiserallee 203, erschoß, ist in pekuniären Schwierigkeiten zu suchen. S., der aus Turkestan stammt, besaß früher eine Wodka-Fabrik, die er jedoch bereits vor längerer Zeit verkauft hatte. Der 62jährige hatte schon vor längerer Zeit Selbstmordabsichten geäußert und den gestrigen Abend, an dem seine Frau sich im Konzert befand, zur Ausführung benutzt. Der Knall des Revolvers wurde von Asta Nielsen gehört, die die daneben gelegene Wohnung innehat. Frau Nielsen benachrichtigte dann als Erste Arzt und Polizei.« (S. 200) Memorabile Warum wird in diesem Beispiel erzählt, daß die Frau im Konzert war? Für den Ablauf der Ereignisse ist dies nicht wichtig. Der Kontrast ›Verzweiflung‹ und ›Kunstgenuß‹ ist geeignet, die Sache, um die es geht, hervorzuheben: den Selbstmord. Warum wird der Filmstar Asta Nielsen erwähnt? Auch dies ist für den Ablauf der Ereignisse nicht wichtig. Es ergibt sich aber daraus eine Kontrastierung von ›Spiel‹ und ›Realität‹, »[A]us freien Tatsachen verwirklicht[] sich eine gebundene Tatsächlichkeit. […] In diesem Sinne können wir sagen, daß das Memorabile die Form ist, in der sich für uns allerseits das Konkrete ergibt.« (S. 211) Jolles spricht von »Dokumenten des Geschehens […] wo es zu äußerster Tatsächlichkeit zusammengewachsen ist« (S. 212). Einfache Form (Jolles) und ›Realitätseffekt‹ (Barthes) Jolles‘ Überlegungen zum Memorabile erinnern an Barthes‘ Theorie des Realitätseffekts. In beiden Fällen geht es um die Frage der Referenz. Dennoch gibt es Unterschiede. Jolles zeigt, daß selbst das ›Tatsächliche‹ einer einfachen narrativen Form bedarf, durch die es geschaffen wird: durch Herstellung eines Zusammenhangs zwischen Einzelheiten. Jolles orientiert sich an der Kategorie des Sinns. Barthes hingegen zeigt, wie sich Erzählungen den Anschein des ›Realen‹ verleihen, indem sie im Gegenteil Unzusammenhängendes sprachlich exponieren. Barthes orientiert sich dabei eher an Schreibweisen der Irritation des Sinns. Texte und Folien im Netz unter: www.uni-erfurt.de/literaturwissenschaft/ Paßwort für die Texte: