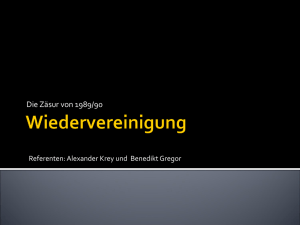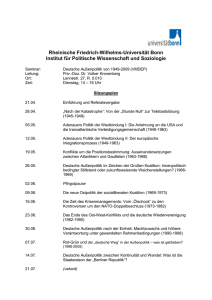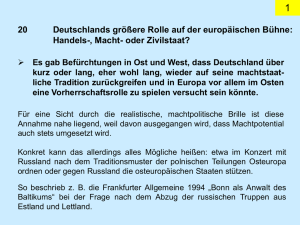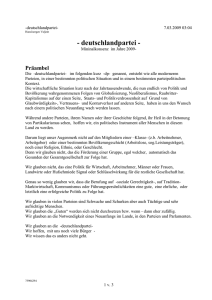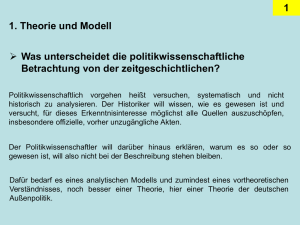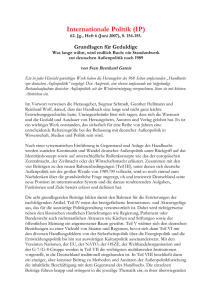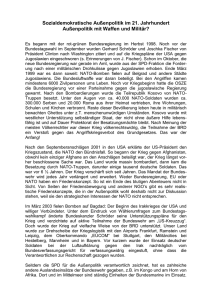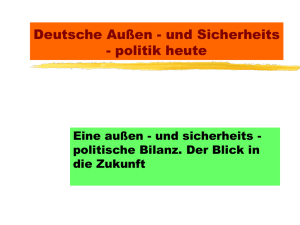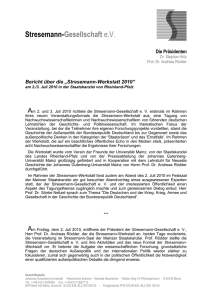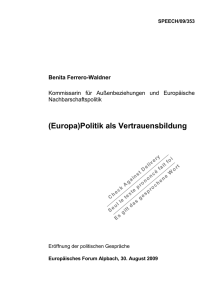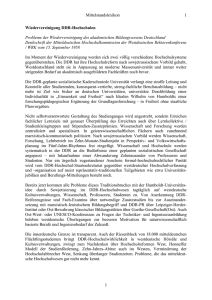1 14 Ziele und Werte Unser Modell des politischen Systems bliebe
Werbung
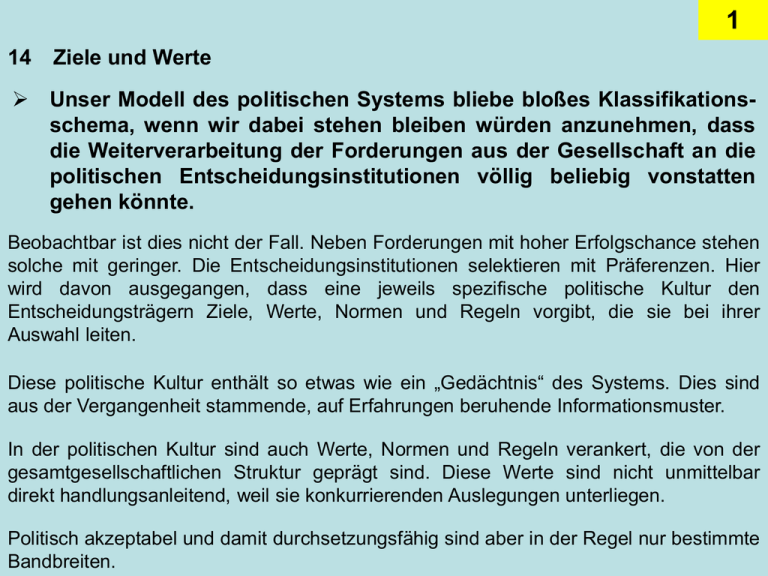
1 14 Ziele und Werte Unser Modell des politischen Systems bliebe bloßes Klassifikationsschema, wenn wir dabei stehen bleiben würden anzunehmen, dass die Weiterverarbeitung der Forderungen aus der Gesellschaft an die politischen Entscheidungsinstitutionen völlig beliebig vonstatten gehen könnte. Beobachtbar ist dies nicht der Fall. Neben Forderungen mit hoher Erfolgschance stehen solche mit geringer. Die Entscheidungsinstitutionen selektieren mit Präferenzen. Hier wird davon ausgegangen, dass eine jeweils spezifische politische Kultur den Entscheidungsträgern Ziele, Werte, Normen und Regeln vorgibt, die sie bei ihrer Auswahl leiten. Diese politische Kultur enthält so etwas wie ein „Gedächtnis“ des Systems. Dies sind aus der Vergangenheit stammende, auf Erfahrungen beruhende Informationsmuster. In der politischen Kultur sind auch Werte, Normen und Regeln verankert, die von der gesamtgesellschaftlichen Struktur geprägt sind. Diese Werte sind nicht unmittelbar direkt handlungsanleitend, weil sie konkurrierenden Auslegungen unterliegen. Politisch akzeptabel und damit durchsetzungsfähig sind aber in der Regel nur bestimmte Bandbreiten. 2 Das Modell des deutschen außenpolitischen Entscheidungssystems wird somit theoretisch aufgefüllt. Mit dem Konzept einer politischen Kultur als Zielgeber wird mehr als klassifiziert, es werden theoretische Annahmen über Inhalte eingebracht. Die Verknüpfung zwischen Modell und Theorie wird an dieser Stelle deutlich. Es wird angenommen, dass ein Zusammenhang zwischen der bürgerlich-liberalen Gesellschaftsstruktur der Bundesrepublik und den Sollwerten in ihrer politischen Kultur besteht. Spezifische Sollwerte angenommen. oder Ziele werden für bestimmte Politikbereiche 3 Allgemeine Ziele sind Frieden, Sicherheit, Gerechtigkeit, Einheit usw. Sie haben mehr als Rechtfertigungscharakter und sind auch nicht bloße Leerformeln. Dies heißt nicht, dass sie in der politischen Auseinandersetzung nicht auch so verstanden oder gemeint werden können. Über die allgemeinste Zielkategorie, das nationale Interesse, sind schon Aussagen gemacht worden. Das nationale Interesse hat viele Dimensionen und ist kaum objektivierbar. Es gibt keinen Konsens über das, was das deutsche nationale Interesse nach dem Zweiten Weltkrieg sei oder gewesen sei. Die Wandelbarkeit nationaler Ziele unterstreicht zugleich aber auch, dass ihnen für eine bestimmte Epoche sehr wohl Gültigkeit zukommen kann. 4 Zum Beispiel waren 1950 noch 80 Prozent aller Deutschen der Meinung, die Oder-Neiße-Linie sei nicht als deutsch-polnische Grenze akzeptabel. 1972 meinte dann schon die Mehrheit (61 Prozent), Deutschland habe sich mit dieser Grenze abzufinden. Hier wird der Definition von Frank Pfetsch zugestimmt, dass das nationale Interesse durch Ziele gekennzeichnet ist, „die von der politischen Führung eines Landes oder/und einer breiteren Öffentlichkeit als verbindlich angesehen und über eine bestimmte Zeit konstant gehalten werden“. Der Zeithorizont bleibt bei dieser Betrachtungsweise bewusst offen. Politische und außenpolitische Kulturen wandeln sich in der Kontinuität. Kontinuität oder Wandel wäre die falsche Frage, die richtige lautet, wie sich denn der Wandlungsprozess über Zeit dargestellt hat. 5 Gültige Ziele und Werte können nicht einfach über Meinungsbefragungen festgestellt werden. Die Demoskopie fördert zwar nützliche Einstellungsdaten über alles Mögliche, also auch Außenpolitik zutage. Aus methodischen Gründen lassen Umfragen nur stark vereinfachte Fragestellungen und Momentaufnahmen zu. Selbst Standardfragen, die über einen längeren Zeitraum gestellt werden, können den veränderten Kontext oder etwa die Widersprüche in den Einstellungen nur bedingt zutage fördern. Symptomatisch sind Ergebnisse von Meinungsbefragungen zu Sicherheitsfragen, wenn sich z. B. allgemein für Einsätze der NATO etwa auf dem Balkan oder anderswo Mehrheiten finden, bei konkreten Rückfragen deutscher Beteiligung dieselben Mehrheiten aber schnell schwinden. 6 Ziele existieren nicht unabhängig von den Mitteln ihnen näher zu kommen, also sie zu realisieren versuchen. Die Grundfrage lautet stets, ob ein Ziel auf friedlichem Weg oder nur mit kriegerischen Mitteln erreichbar wäre. Eine Grundkategorie besteht im ideologischen oder pragmatischen Charakter eines politischen Zieles. Die Mittel sind wahrscheinlich um so wichtiger, je pragmatischer ein politisches Ziel erscheint. Die Aufgabe des Zieles „Wiederherstellung Deutschlands in den Grenzen von 1937“ und das vorübergehende Zurücktreten des Zieles „Wiedervereinigung“ hatte bei den politischen Führungseliten und in der öffentlichen Meinung der Bundesrepublik zweifellos mit der Einsicht in die Möglichkeiten zu tun. Weltlage und westdeutsche Mittel ließen beide Ziele wenn überhaupt in großer Ferne erscheinen. 7 In diesem Zusammenhang ist auch darauf aufmerksam zu machen, dass es in der Außenpolitik häufig unterschiedliche Beurteilungen durch die politischen Eliten und die Bevölkerung gibt. Beide Teile steuern sich nicht direkt gegenseitig, sondern sind in ihrer Meinungsbildung voneinander abhängig. Grundsätzlich können sich sowohl die eine als auch die andere Seite schneller wandeln oder die Anpassung an den Wandel längere Zeit verweigern. 8 Ziele lassen sich in kurz- und langfristige Ziele unterscheiden. Arnulf Baring hat sie Fern- und Nahziele genannt. Kurzfristige oder Nahziele können selbst Mittelcharakter annehmen. Die Einstellung der Demontagen, die Vollmacht zur Aufnahme konsularischer Beziehungen und zum Abschluss internationaler Verträge, was Konrad Adenauer bei den Besatzungsmächten im Petersberger Abkommen erreichte, war z. B. zugleich ein Mittel, um mehr nationale Souveränität zu gewinnen. Die Wiederbewaffnung war gleichzeitig ein Mittel der militärischen Sicherheit, sie diente auch der westlichen Integration im Rahmen der EVG und der NATO. 9 Der Zusammenhang zwischen Zielfunktion und der instrumentellen Funktion lässt sich am Beispiel der deutschen Außenpolitik im Hinblick auf die europäische Einigung gut aufzeigen. Für Politiker, die der nationalen Frage der Wiedervereinigung oberste Priorität zuerkannten, folgte daraus mehr oder weniger zwingend die Idee eines bloßen Bündnisses souveräner Staaten für Europa. Jakob Kaiser und Kurt Schumacher wollten also die „Vereinigten Staaten von Europa“ im Sinne eines Staatenbundes. Deutsche Föderalisten hingegen wollten eher ein bundesstaatliches Europa, also ein weit höheres Integrationsniveau. Die Deutsche Frage sahen sie längerfristig auf dem Weg über eine westeuropäische Union als lösbar an. Europa als Ziel fungierte in diesen Vorstellungen als eigenständige Kategorie, zugleich war es aber auch ein potentielles Mittel auf dem Weg hin zur Wiedervereinigung. 10 Sucht man die Ziele der deutschen Regierungen aus den Regierungserklärungen der jeweiligen Bundeskanzler zu entnehmen, dann ergibt sich daraus nur ein recht grober Indikator für eine detaillierte Prioritätenliste. Adenauer, obwohl intensiver Außenpolitiker, ließ dieses Feld stets nur am Ende seiner Regierungserklärungen anklingen. Die Außenpolitik stand also am Schluss. Diesem Brauch folgten auch Ludwig Erhard und Kurt-Georg Kiesinger. Erst Willy Brandt setzte bei seiner Regierungserklärung die Außenpolitik an den Anfang. Helmut Schmidt packte den außenpolitischen Teil dann 1974 in die Mitte und 1976 an das Ende. Überhaupt geben Regierungserklärungen nicht unbedingt den tatsächlichen Zielkatalog wieder, sondern benennen nur die Politikbereiche mit dringendem Handlungsbedarf. 11 Alle westdeutschen Nachkriegsregierungen haben Frieden als großes Oberziel an die Spitze ihrer außenpolitischen Programmatik gestellt. An der hohen Wertepriorität dieses Zieles kann nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs kaum gezweifelt werden. Dennoch ist hier gerade die Konkretisierung, was denn Frieden als Ziel ausmache, von erheblichem Interesse. Hinter dieser plakativen höchsten Norm kann sich nämlich recht Vielfältiges verbergen. Die Kategorie Frieden kann rein deklaratorisch bleiben. Wenn sie mehr darstellen soll, muss klar sein, was als angestrebter Friedenszustand oder gar als Friedensordnung betrachtet wird. 12 Hier hat sich die Friedensforschung seit den siebziger Jahren in Deutschland um eine Klärung bemüht. Das klassische Friedensverständnis beschränkt sich auf den Zustand des NichtKriegs. Die Absenz von Krieg heißt dann nur keine militärischen Auseinandersetzungen, ohne dass über die Qualität dieser Friedensordnung und ihren längerfristigen Charakter etwas ausgesagt würde. Im Extremfall könnte ein solcher Friedenszustand als „Friedhofsruhe“ in einem System hoher Repressivität noch begrifflich eingeschlossen sein. Umgekehrt haben maximalistische Friedensforscher wie Johan Galtung Frieden als einen Zustand der völligen Gewaltfreiheit und der Gerechtigkeit definiert und damit das Ziel so hoch gehängt, dass Außenpolitik ihm eigentlich nie genügen könnte. 13 Czempiel hat Frieden als ein Prozessmuster des internationalen Systems definiert, das durch abnehmende Gewalt und zunehmende Gerechtigkeit gekennzeichnet ist. Damit wird immerhin der Prozesscharakter in den Mittelpunkt gerückt, also die Richtung angegeben, und nicht von vornherein utopische Zustände beschworen. Gelöst ist die qualitative Frage damit freilich nicht. Denn Gewalt gegen Menschen und Sachen lässt sich womöglich noch halbwegs konsensual definieren, was aber Gerechtigkeit sei, daran scheiden sich die Geister. In aller Praxis dürften die meisten deutschen Regierungen einen minimalistischen Friedensbegriff gemeint haben, der nicht vielmehr beinhaltete als die Aussage, selbst keine militärischen Mittel einsetzen zu wollen, um die eigenen Unterziele zu erreichen. Friede meinte damit wohl nicht viel mehr als den Ausschluss des militärischen Instrumentariums als Mittel der deutschen Außenpolitik. Damit befand sich die deutsche Demokratie in bester Gesellschaft, weil mittlerweile als relativ gesicherter empirischer Befund gilt, dass Demokratien (fast) keine Kriege gegeneinander führen. 14 Versucht man, den Zielkatalog der westdeutschen Außenpolitik in den vierzig Jahren der Existenz der Bundesrepublik zu bestimmen, dann sind Unterschiede nicht zu übersehen. Dies fängt bei den divergierenden Prioritätenskalen an, die verschiedene Autoren festgestellt zu haben meinen. Arnulf Baring sah die europäische Einigung an der Spitze, gefolgt von der Souveränität. Alfred Grosser kam zu einer anderen Skala, nämlich Sicherheit, europäische Einigung und Wiedervereinigung. Wolfram Hanrieder setzte auch die Sicherheit nach vorn, ließ dann aber den wirtschaftlichen Wiederaufbau vor der Wiedervereinigung rangieren. Hans Karl Rupp kam zu der Reihenfolge Souveränität, Wiedervereinigung und westeuropäische Integration. 15 Pfetsch macht sich mit der Bestimmung der Prioritätenskalen der Ziele der verschiedenen Bundesregierungen am meisten Mühe und systematisiert plausibel. Für die Adenauerphase kommt er zu folgender Reihenfolge des außenpolitischen Zielkatalogs: 1. Souveränität und Europäische Einigung, 2. Militärische Sicherheit, 3. Atlantisches Bündnis, 4. Wiederbewaffnung, 5. Wirtschaftlicher Wiederaufbau, 7. Wiedervereinigung, 8. Abbau der Vergangenheitsbelastung. Darin drückt sich die Westintegration und die Nachrangigkeit des Zieles der deutschen Wiedervereinigung aus. Sie konnte damals sinnvollerweise gar kein Nahziel sein, weil der Bundesrepublik auf dem Weg zu diesem Ziel adäquate Mittel fehlten. Die Beeinflussbarkeit der Sowjetunion von Bonn aus war gering, die Sicherheit des Bundesrepublik im Rahmen der NATO wurde als hohes Ziel begriffen. 16 Für die erste Hälfte der siebziger Jahre ändert sich dann die Zielrangfolge nach Pfetsch: 1. Entspannungspolitik und Ausbau des Westbündnisses, 2. Geregeltes Neben- bzw. Miteinander mit der DDR, 3. Abbau der Vergangenheitsbelastung, 4. Intensivierung multilateraler Zusammenarbeit (KSZE, Vereinte Nationen, EG, NATO usw.). Hier wurde also jetzt mit der Ostpolitik nachgezogen. Die Souveränität war erreicht, die militärische Sicherheit im Rahmen der NATO wurde nicht mehr unmittelbar als bedroht betrachtet. Statt der Rhetorik der Wiedervereinigung ging es jetzt um die Regelung des Verhältnisses zur DDR, ohne dieses Fernziel aufzugeben. Ob das Ziel dabei selbst ins Rutschen kam, ist zumindest eine berechtigte Frage. In den Absichten von Willy Brandt und Egon Bahr war dies nicht der Fall, die Ostpolitik wurde aber zum Teil so verstanden und unterhöhlte damit das Ziel. 17 Ab der zweiten Hälfte der siebziger Jahre sah der Zielkatalog nach Pfetsch dann so aus: 1. Internationale Koordination bei weltwirtschaftlichen Problemen, 2. Festigung und Ausbau des Westlichen Bündnisses, 3. Multinationalisierung des Ost-West-Verhältnisses, 4. Verhältnis zu Staaten der Dritten Welt, 5. Internationaler Terrorismus. Das neue Ziel Nummer Eins trug nicht nur die Handschrift des „Weltökonomen“ Helmut Schmidt, es entsprach auch den Bedürfnissen der Bundesrepublik, die sich zu einer Weltwirtschaftsmacht entwickelt hatte. Ihre Mitarbeit bei der Koordination der Weltwährungspolitik und Welthandelspolitik war unerlässlich geworden. Die Wiedervereinigung war jetzt in die Entspannungspolitik und die Multinationalisierung des Ost-West-Verhältnisses eingebettet und zum kaum mehr griffigen Fernziel geworden. 18 Der gleiche Zielkatalog lässt sich auch für die Phase unter Helmut Kohl bis 1989 fortschreiben. Erst danach kam durch den Kollaps im Osten die Vereinigung plötzlich an die Spitze der Skala. Die Bundesrepublik und ihre Regierung traf dies gänzlich unvorbereitet. Ein hehres Fernziel wurde quasi über Nacht zum Nahziel. Konkrete Pläne lagen nicht in den Schubladen. Deswegen trieb der Vereinigungsdruck die westdeutsche Politik mehr als dass diese gestaltet hätte. Gerade weil dabei in der Hektik viele Fehler, besonders im wirtschaftlichen Bereich, gemacht wurden, entstand hier neuer Stoff für Übernahmemythen. Tatsächlich hatte es keine Forschung und auch keine Konzepte von Planungsstäben gegeben, wie konkret zwei so unterschiedliche Systeme ohne destabilisierende Folgen verschmolzen werden könnten. Das ist sicherlich aus der Rückschau ein Versäumnis gewesen, doch üblicherweise bereiten sich Politik und Forschung auf das absehbare und nicht auf die großen Fernziele vor, weil die Alltagserfahrung nicht vermittelt, dass diese plötzlich zu schnell erreichbaren Nahzielen werden. 19 Für die neunziger Jahre verschob sich der Zielkatalog des vereinigten Deutschland wiederum, allerdings blieb mehr Kontinuität als im Ausland geargwöhnt wurde. Er sah jetzt folgendermaßen aus: 1. Internationale Koordination bei weltwirtschaftlichen Problemen, 2. Festigung und Erweiterung der EU und der NATO, 3. Multinationalisierung beim Aufbau in Osteuropa, 4. Weltordnungspolitik über die UNO, 5. Migration und Umwelt. Nach dem 11. September 2001 kam die Abwehr des islamistischen Terrorismus hinzu. Die Rangfolge dieses Ziels ist unklar. 20 Bei der Betrachtung der Ziele und Werte für außenpolitische Entscheidungen ist über die Ziel-Mittel-Problematik hinaus auch die Frage von Moral und Interessenpolitik von Bedeutung. Die instrumentelle Zweckrationalität legt nur die Kategorien rational und irrational nahe. Die ideengeschichtliche Debatte kennt aber auch den Gegensatz von „Realpolitik“ und „Idealpolitik“. Max Weber hatte dafür die Begriffe Verantwortungsethik und Gesinnungsethik geprägt. Verantwortungsethik ist dabei nicht identisch mit der machiavellistischen Abkoppelung der Politik von der Moral. Die reine Dichotomie Realpolitik versus Idealpolitik ist eher selten, meist handelt es sich um Mischtypen und Mischsituationen. Alltagspolitische Entscheidungen selbst neigen eher dem realpolitischen Typ zu. Die Idealpolitik etwa in Form der Menschenrechtspolitik bleibt vielfach rhetorisch, weil effiziente Mittel fehlen oder einfach zu teuer kämen, etwa bei Interventionen wie z. B. im Fall Bosniens. Während der angelsächsische Pragmatismus beide häufig recht gut zusammenbringt, indem idealistisch gedacht, aber dann pragmatisch-realistisch gehandelt wird, gibt es eine deutsche Tradition der romantisch-idealistischen Überforderung der Politik. So wurde z. B. Konrad Adenauer von der Opposition Unmoral vorgeworfen, weil er die Wiederbewaffnung in das Paket der Pariser Verträge einschnürte. 21 Adenauer selbst antwortete seinen Kritikern typisch realpolitisch wie folgt: „Ich will niemanden kränken, aber die Vorgänge in der Paulskirche erschienen mir wie ein rotes Gericht, das mit einigen grünen Salatblättern verziert war. Einige der Professoren, die dort das Wort ergriffen, waren zweifellos Männer mit lauterem Herzen. Aber auf ein so gefährliches Gelände, wie es die Außenpolitik in unserer Situation war, sollte man sich nicht begeben, wenn man nur ein lauteres Herz hat. Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass lautere Herzen allein auf diesem Gebiet nicht hochdiskontiert werden. Auf dem Gebiet der Außenpolitik muss man etwas von den Dingen wissen, man muss arbeiten und studieren und aus den Vorgängen der Vergangenheit die nötigen Konsequenzen ziehen, sehr kühl, sehr nüchtern und sehr klar. In der Außenpolitik hilft nur eine sehr realistische Betrachtungsweise, es hilft keine Romantik, keine Schwärmerei.“ 22 Die Ziele und Werte der Bundesrepublik Deutschland lassen sich auf einem hohen Abstraktionsniveau am plausibelsten mit den Kategorien „Handelsstaat“ und „Zivilmacht“ erfassen. Der neue Typ des modernen Handelsstaats, den Richard Rosecrance am Beispiel der Bundesrepublik und Japans analysiert hat, unterscheidet sich von traditionellen Machtstaaten wie den USA und Russland durch seine nicht-militärischen Ziele und Mittel. Dabei entsprechen seine Werte durchaus seinen Interessen und folgen nicht bloß einem moralischen Impetus. Hanns Maull hat den Akzent bei seiner Typologisierung noch stärker auf den in der Nachkriegsphase gewachsenen Werthintergrund und weniger auf die Wirtschaft gesetzt und deshalb den Begriff der „Zivilmacht“ vorgezogen. Beide Begriffe tragen den neuen deutschen Wertpräferenzen einer zivilen und auch nach außen gerichteten wohlfahrtsstaatlichen politischen Kultur Rechnung. Zivile und geschäftsorientierte Ziele und Werte wären nach diesen Annahmen zwar womöglich anfangs durchaus von außen durch die Siegermächte auferlegt, dann aber eifrig übernommen und in einem durch Erfahrung aufgeklärten Selbstinteresse fest prioritär in der deutschen Wertewelt verankert worden. Wie resistent diese westdeutsche Nachkriegstradition gegen neue machtstaatliche Versuchungen ist, wird sich zeigen.