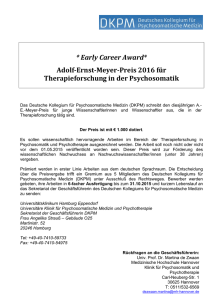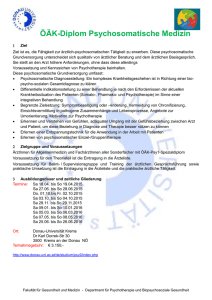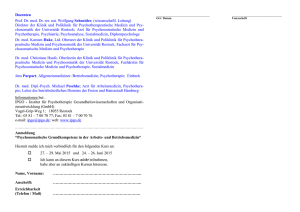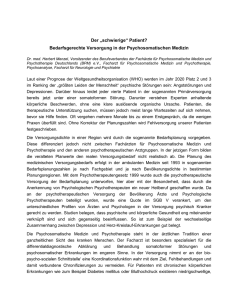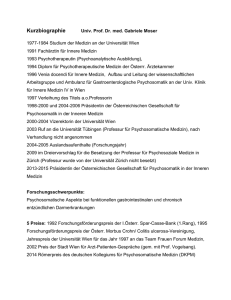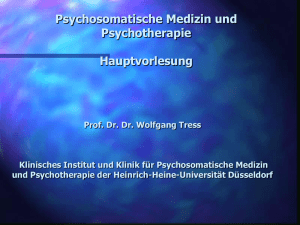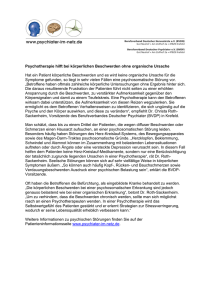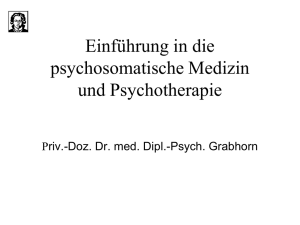Psychotherapeutische Forschung und
Werbung

60. Arbeitstagung des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin (DKPM) und 17. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM) Psychotherapeutische Forschung und Psychosomatische Praxis Tagungsleitung: Univ.-Prof. Dr. Manfred E. Beutel, PD Dr. Matthias Michal Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Mainz, 18.-21. März 2009 1 Inhaltsverzeichnis Übersicht .................................................................................................................................. 5 Plenarveranstaltungen ............................................................................................................ 5 Arbeitsgruppen des DKPM ..................................................................................................... 10 AG 1: Psychoonkologie ..............................................................................................................................10 AG 2: Persönlichkeitsstörungen..................................................................................................................10 AG 3: Bindungsforschung ..........................................................................................................................10 AG 4: Körperdiagnostik und Körpertherapie..............................................................................................10 AG 5: Psychokardiologie und Psychophysiologie (gem. Treffen) .............................................................11 AG 6: Künstlerische Therapien...................................................................................................................11 AG 7: Stationäre tiefenpsychologisch orientierte Therapie der Depression...............................................11 AG 8: Psychodermatologie und Psychoneuroimmunologie (gem. Treffen)...............................................11 AG 9: Konsil- und Liaison-Psychosomatik ................................................................................................11 AG 10: Familienpsychosomatik..................................................................................................................11 Sonderveranstaltungen und Foren ........................................................................................ 11 Sonderveranstaltung Psychosomatik in einem Medizinischen Versorgungszentrum ................................11 Sonderveranstaltung Psychosomatische Grundversorgung .......................................................................11 Sonderveranstaltung Transplantationsmedizin ...........................................................................................12 Sonderveranstaltung Psychosomatik und Allgemeinmedizin.....................................................................12 Sonderveranstaltung der DKPM Krankenhauskommission .......................................................................12 Sonderveranstaltung Psychosomatische Fallvorstellung ............................................................................12 Sonderveranstaltung Qualitätsmanagement in der psychosomatisch/psychotherapeutischen Praxis.........12 Forum Lehre................................................................................................................................................12 Forum Forschung ........................................................................................................................................12 State of the Art Symposien ..................................................................................................... 13 SOTA 1: Neurobiologie und Psychotherapie (DGPPN, DKPM, DGPM)..................................................13 SOTA 2: Quantitative Methoden: Was tun wo nichts ist?..........................................................................14 SOTA 3: Evidenzbasierte Leitlinien (S3) zur Diagnostik und Therapie von Essstörungen .......................15 SOTA 4: Diagnostik und Therapie bei Geschlechtsidentitätsstörungen.....................................................16 SOTA 5: International guidelines for medically unexplained symptoms (EACLPP) (English Track) ......16 SOTA 6: Psychotherapy for borderline personality disorder (English Track) ...........................................17 SOTA 7: Verhaltenssüchte..........................................................................................................................18 SOTA 8: S2-Leitlinien Persönlichkeitsstörungen (DGPPN, DKPM, DGPM, DGP, DGKJP) ..................19 SOTA 9: Versorgung ..................................................................................................................................19 SOTA 10: Stationäre Psychotherapie – Rehaklinik oder Krankenhaus? ....................................................20 SOTA 11: Vorstellung der neu erstellten S2k-Leitlinie zum Chronischen Unterbauchschmerz der Frau (DGPFG) ...........................................................................................................................................20 SOTA 12: Psychosomatische Schmerzbegutachtung (IGPS).....................................................................21 SOTA 13: Somatoformer Schwindel ..........................................................................................................22 Wissenschaftliche Symposien ............................................................................................... 24 S1: Migration ..............................................................................................................................................24 S2: Trauma, posttraumatische Belastungsstörung und körperliche Gesundheit.........................................25 S3: Entwicklung und Evaluation von DBT für PTBS – von der Neurobiologie zur Therapie...................27 S4: Betreuungsbedürfnisse von Patienten und Qualität klinischer Versorgung ........................................28 S5: Störungsbezogene stationäre psychosomatische Psychotherapie .........................................................29 S6: Psychoonkologie ..................................................................................................................................31 2 S7: Mentalisation-Based Treatment (MBT) in der Gruppe ........................................................................32 S8: Somatoforme Störungen gastrointestinaler Genese..............................................................................33 S9: Arbeitswelt und Gesundheit .................................................................................................................35 S10: SOPHO-NET: Verbundstudie zur Wirksamkeit psychodynamischer (SET) und verhaltenstherapeutischer (CBT) Kurztherapie der sozialen Phobie.................................................36 S11: Psychotherapieforschung im stationären Rahmen..............................................................................37 S12: Gehemmtes versus unterbrochenes Handeln – zur Weiterentwicklung der klassischen Psychosomatik in der Psychodynamik psychischer Traumatisierung...............................................38 S13: Wiederkehr des Verdrängten: Die naturwissenschaftliche Psychosomatik .......................................39 S14: Adipositas ...........................................................................................................................................40 S15: Symposium II der Arbeitsgruppe Bindungsforschung: Einfluss der Bindungsrepräsentation auf psychotherapeutische Prozesse..........................................................................................................41 S16: „Wenn chronisch Depressive ihre Therapie wählen…“ Psychoanalytische und kognitivverhaltenstherapeutische Langzeittherapie bei chronischer Depression.(LAC) (DGPT) .................43 S17: Psychosomatische Aspekte bei erblichen Tumorerkrankungen .........................................................43 S18: Cardiovascular risks in the general population and intervention strategies – cardiological and psychosomatic perspectives (English Track) ....................................................................................45 S19: Psychosomatische Aspekte von Schwangerschaft und Wochenbett (DGPFG) .................................45 S20: Aktuelle Forschungen der Künstlerischen Therapien in der Psychosomatik ....................................47 S21: Stationäre und teilstationäre Psychotherapie: Indikationsstellung und Therapieverlauf....................48 S22: Von der Genetik bis zur Gesichtswahrnehmung – Aktuelle Perspektiven der Alexithymieforschung .......................................................................................................................49 S23: Elektrosensitivität als „larvierte“ psychosomatische Erkrankung......................................................51 S24: Neurobiologie der Somatisierung .......................................................................................................52 S25: Misserfolge, Non-Response, negative Effekte und Nebenwirkungen von Psychotherapie (SPR).....53 S26: Spätfolgen des II. Weltkrieges – Epidemiologische, salutogenetische und therapeutische Aspekte (DGMP) .............................................................................................................................................54 S27: Developement of a New Generation of Patient-Reported Outcome (PRO) Measures (English Track).................................................................................................................................................56 S28: Ergebnisse imaginativer Psychotherapie in ambulanter und stationärer Versorgung ........................57 S29: Qualitative Psychotherapieforschung - ein Gewinn für die Praxis?..................................................58 S30: Diabetes und Depression – eine Herausforderung für die Psychotherapie und Psychosomatik (DIAMANT)......................................................................................................................................58 S31: Körper und Neurobiologie..................................................................................................................60 S32: Möglichkeiten und Ergebnisse der Aktivierung persönlicher Ressourcen in der Psychosomatik .....61 S33: Fibromyalgie: Neurobiologie und Psychotherapie .............................................................................62 S34: Evidence based psychosocial intervention that reduce somatic disease risk (ENPM / ISBM) (English Track) ..................................................................................................................................64 S35: Forschungsverbund zur Psychotherapie von Essstörungen (EDNET) ...............................................64 S36: Psychosomatik und Allgemeinmedizin ..............................................................................................66 S37: Depression und Kognition bei Diabetes (DECODIA)- Forschungsansätze im DECODIAForschungsverbund des Krankheitsbezogenen Kompetenznetz Diabetes mellitus (BMBF)............67 S38: Evidenzbasierte Körperpsychotherapie – Aktuelle Studien ...............................................................68 S39: Essstörungen: Anorexie und Bulimie .................................................................................................70 S40: Intervention bei somatoformen Störungen .........................................................................................71 S41: Psychoneuroimmunologie und Psychodermatologie..........................................................................72 S42: Elektronische Patienten-Tagebücher – Was bieten diese für die Psychosomatik?.............................74 S43: Psychosomatische Urologie ...............................................................................................................75 S44: Psychoneuroallergology – main branch of psychosomatics (English Track).....................................76 S45: Neurokognitive Befunde bei Essstörungen ........................................................................................77 S46: Placeboforschung: Vom Labor zur Klinik..........................................................................................79 S47: Instrumente .........................................................................................................................................80 S48: Psychosomatische Aspekte der Transplantationsmedizin ..................................................................81 3 S49: DISCOS – „Disorders and Coherence of the Embodied Self“ - Embodiment as crucial interface of the biological and psychosocial approaches to the human self and its disorders (English Track)....83 S50: Qualitätsmanagement in Praxis und Klinik (DÄVT) .........................................................................84 S51: Symposium I der Arbeitsgruppe Bindungsforschung: Neurobiologische und psychophysiologische Grundlagen ....................................................................................................84 Posterpräsentationen .............................................................................................................. 86 Begutachtung / Rehabilitation.....................................................................................................................86 Neue Medien ..............................................................................................................................................87 Neurobiologie .............................................................................................................................................88 Persönlichkeitsstörungen ...........................................................................................................................91 Prävention / Arbeitswelt .............................................................................................................................91 Psychokardiologie ......................................................................................................................................92 Psychotherapieforschung ............................................................................................................................96 Psychotraumatologie...................................................................................................................................100 Stationäre und teilstationäre Psychosomatik ..............................................................................................103 Alexithymie / Emotionsregulation .............................................................................................................105 Angst- und Zwangsstörungen ....................................................................................................................106 Bindungsforschung ....................................................................................................................................107 Dissoziative Störungen ..............................................................................................................................110 Konsil- und Liaisondienst ...........................................................................................................................110 Kreativverfahren in der Psychotherapie......................................................................................................112 Mentalisierung ...........................................................................................................................................112 Psychometrie / Diagnostik ..........................................................................................................................113 Psychoonkologie .........................................................................................................................................119 Psychosomatik in der inneren Medizin ......................................................................................................122 Sexualstörungen / Sexualforschung ...........................................................................................................122 Affektive Störungen ....................................................................................................................................123 Arzt-Patient-Kommunikation .....................................................................................................................124 Essstörungen ..............................................................................................................................................125 Psychosomatik in der Gynäkologie ............................................................................................................129 Schmerz und Somatoforme Störungen ......................................................................................................130 Transplantation ...........................................................................................................................................132 Autorenverzeichnis.................................................................................................................. 134 Sponsoren, Gutachter ............................................................................................................. 142 4 Übersicht Plenarveranstaltungen Donnerstag, 19.03.2009 Prozess und Outcome in der Psychotherapie Moderation: W. Tress (Düsseldorf) P. Fonagy (London, UK): What works for whom? Freitag, 20.03.2009 Psychotherapie in der Psychosomatischen Medizin Moderation: C. Subic-Wrana (Mainz) & H. Gündel (Hannover) R. Lane (Tucson, USA): Affect and Psychotherapy Samstag, 21.03.2009 Psychotherapie in der somatischen Medizin Moderation: W. Herzog ( Heidelberg) W. Söllner (Nürnberg): Psychodynamische (Einzel-)Psychotherapie mit Krebspatienten K. Reuter (Freiburg i. Brsg.): Möglichkeiten und Grenzen gruppentherapeutischer Interventionen für Krebspatienten Carus Lecture Moderation: Y. Gidron (Brunel University, West London, UK) D. Spiegel (Stanford, USA): „Mind over Matter“ Arbeitsgruppen des DKPM Mittwoch, 18.03.2009, 13:30-15:00 AG 1: Psychoonkologie AG 2: Persönlichkeitsstörungen (Teil I) AG 3: Bindungsforschung AG 4: Körperdiagnostik und Körpertherapie AG 5: Psychokardiologie & Psychophysiologie (gemeinsames Treffen) (Teil I) AG 6: Künstlerische Therapien AG 7: Stationäre tiefenpsychologisch orientierte Therapie der Depression (Teil I) Mittwoch, 18.03.2009, 15:30-17:00 AG 8: Psychosodermatologie & Psychoneuroimmunologie (gemeinsames Treffen) AG 2: Persönlichkeitsstörungen (Teil II) AG 9: Konsil- und Liaison-Psychosomatik AG 5: Psychokardiologie (Teil II) (internes Studientreffen der SPIRR-CAD-Gruppe) AG 7: Stationäre tiefenpsychologisch orientierte Therapie der Depression (Teil II) AG 10: Familienpsychosomatik 5 Sonderveranstaltungen und Foren Mittwoch, 18.03.2009, 11:00-12:30 Forum Lehre Mittwoch, 18.03.2009, 15:30-17:00 Sonderveranstaltung: Psychosomatik in einem Medizinischen Versorgungszentrum Sonderveranstaltung: Psychosomatische Grundversorgung Sonderveranstaltung: Transplantationsmedizin Donnerstag, 19.03.2009, 11:00-12:30 Sonderveranstaltung der DKPM-Krankenhauskommission: „Entgeltsystem Krankenhauspsychosomatik – quo vadis?“ Sonderveranstaltung: Psychosomatische Fallvorstellung Donnerstag, 19.03.2009, 14:00-15:30 Sonderveranstaltung: Qualitätsmanagement in der psychosomatisch / psychotherapeutischen Praxis Donnerstag, 19.03.2009, 17:45-19:15 Forum Forschung State of the Art Symposien (SOTA) Mittwoch, 18.03.2009, 13:30-15:00 SOTA 1: Neurobiologie und Psychtherapie (DGPPN, DKPM, DGPM) SOTA 2: Quantitative Methoden: Was tun wo nichts ist? Zum Umgang mit fehlenden Werten und Datensätzen Donnerstag, 19.03.2009, 11:00-12:30 SOTA 3: Evidenzbasierte Leitlinien (S3) zur Diagnostik und Therapie von Essstörungen SOTA 4: Diagnostik und Therapie bei Geschlechtsidentitätsstörungen SOTA 5: International guidelines for medically unexplained symptoms (EACLPP) (English Track) Donnerstag, 19.03.2009, 14:00-15:30 SOTA 6: Psychotherapy for borderline personality disorder (DGPPN) (English Track) Donnerstag, 19.03.2009, 16:00-17:30 6 SOTA 7: Verhaltenssüchte SOTA 8: S2-Leitlinien Persönlichkeitsstörungen (DGPPN, DKPM, DGPM, DGP, DGKJP) Freitag, 20.03.2009, 10:30-12:00 SOTA 9: Versorgung SOTA 10: Stationäre Psychotherapie – Rehaklinik oder Krankenhaus? Freitag, 20.03.2009, 15:30-17:00 SOTA 11: Vorstellung der neu erstellten S2k-Leitlinie zum Chronischen Unterbauchschmerz der Frau (DGPFG) SOTA 12: Psychosomatische Schmerzbegutachtung (IGPS) SOTA 13: Somatoformer Schwindel Wissenschaftliche Symposien Mittwoch, 18.03.2009, 13:30-15:00 S1: Migration S2: Trauma, posttraumatische Belastungsstörung und körperliche Gesundheit Mittwoch, 18.03.2009, 15:30-17:00 S3: Entwicklung und Evaluation von DBT für PTPS – von der Neurobiologie zur Therapie S4: Betreuungsbedürfnisse von Patienten und Qualität klinischer Versorgung S5: Störungsbezogene stationäre psychosomatische Psychotherapie Donnerstag, 19.03.2009, 11:00-12:30 S6: Psychoonkologie S7: Mentalisation-Based Treatment (MBT) in der Gruppe – Besonderheiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen MBT, Gruppenanalyse und Psychoanalytisch-interaktioneller Methode S8: Somatoforme Störungen gastrointestinaler Genese S9: Arbeitswelt und Gesundheit S10: SOPHO-NET: Verbundstudie zur Wirksamkeit psychodynamischer (SET) und verhaltenstherapeutischer (CBT) Kurztherapie der sozialen Phobie S11: Psychotherapieforschung im stationären Rahmen S12: Gehemmtes versus unterbrochenes Handeln – zur Weiterentwicklung der klassischen psychosomatik in der Psychodynamik psychischer Traumatisierung S13: Wiederkehr des Verdrängten: Die naturwissenschaftliche Psychosomatik Donnerstag, 19.03.2009, 14:00-15:30 S14: Adipositas S15: Symposium II der Arbeitsgruppe Bindungsforschung: Einfluss der Bindungsrepräsentation auf psychotherapeutische Prozesse 7 S16: „Wenn chronisch Depressive ihre Therapie wählen…“ Psychoanalytische und kognitivverhaltenstherapeutische Langzeittherapie bei chronischer Depression. Kurz- und Langzeitwirkungen bei präferierter und randomisierter Therapiezuweisung (LAC) (DGPT) S17: Psychosomatische Aspekte bei erblichen Tumorerkrankungen S18: Cardivascular risks in the general population and intervention strategies – cardiological and psychosomatic perspectives (English Track) S19: Psychosomatische Aspekte von Schwangerschaft und Wochenbett (DGPFG) S20: Aktuelle Forschungen der Künstlerischen Therapien in der Psychosomatik S21: Stationäre und teilstationäre Psychotherapie: Indokationsstellung und Therapieverlauf Donnerstag, 19.03.2009, 16:00-17:30 S22: Von der Genetik bis zur Gesichtswahrnehmung – Aktuelle Perspektiven der Alexithymieforschung S23: Elektrosensitivität als „larvierte“ psychosomatische Erkrankung S24: Neurobiologie der Somatisierung S25: Misserfolge, Non-response, negative Effekte und Nebenwirkungen von Psychotherapie (SPR) S26: Spätfolgen des II. Weltkrieges – Epidemiologische, salutogenetische und therapeutische Aspekte (DGMP) S27: Developement of a New Generation of Patient-Reported Outcome (PRO) Measures (English Track) S28: Ergebnisse imaginativer Psychotherapie in ambulanter und stationärer Versorgung S29: Qualitative Psychotherapieforschung – ein Gewinn für die Praxis? Freitag, 20.03.2009, 10:30-12:00 S30: Diabetes und Depression – eine Herausforderung für die Psychotherapie und Psychosomatik (DIAMANT) S31: Körper- und Neurobiologie S32: Möglichkeiten und Ergebnisse der Aktivierung persönlicher Ressourcen in der Psychosomatik S33: Fibromyalgie: Neurobiologie und Psychotherapie S34: Evidence based psychosocial interventions that reduce somatic disease risk (ENPM / ISBM) (English Track) S35: Forschungsverbund zur Psychotherapie von Essstörungen (EDNET) S36: Psychosomatik und Allgemeinmedizin Freitag, 20.03.2009, 13:30-15:00 S37: Depression und Kognition bei Diabetes (DECODIA) Forschungsansätze im DECODIAForschungsverbund des Krankheitsbezogenen Kompetenznetz Diabetes mellitus (BMBF) S38: Evidenzbasierte Körperpsychotherapie – Aktuelle Studien S39: Essstörungen: Anorexie und Bulimie S40: Intervention bei somatoformen Störungen S41: Pscyhoneuroimmunologie und Psychodermatologie S42: Elektronische Patienten-Tagebücher – Was bieten diese für die Psychosomatik? S43: Psychosomatische Urologie S44: Psychoneuroallergology – main branch of psychosomatics (English Track) S45: Neurokognitive Befunde bei Essstörungen 8 Freitag, 20.03.2009, 15:30-17:00 S46: Placeboforschung: Vom Labor zur Klinik S47: Instrumente S48: Psychosomatische Aspekte der Transplantationmedizin S49: DISCOS – „Disorders and Coherence of the Embodied Self“ Embodiment as crucial interface of the biological and psychosocial approaches of the human self and its disorders (English Track) S50: Qualitätsmanagement in Praxis und Klinik (DÄVT) S51: Symposium I der Arbeitsgruppe Bindungsforschung: Neurobiologische und Psychophysiologische Grundlagen Posterpräsentationen Postersession I: Mittwoch, 18.03.2009, 17:30-19:00 Postersession II: Donnerstag, 19.03.2009. 17:45-19:15 Begutachtung / Rehabilitation Neue Medien Neurobiologie Persönlichkeitsstörungen Prävention / Arbeitswelt Psychokardiologie Psychotherapieforschung Psychotraumatologie Stationäre und teilstationäre Psychosomatik Alexithymie / Emotionsregulation Angst- und Zwangsstörungen Bindungsforschung Dissoziative Störungen Konsil- und Liaisondienst Krativverfahren in der Psychotherapie Metalisierung Psychomethrie / Diagnostik Psychoonkologie Psychosomatik in der Inneren Medizin Sexualstörungen / Sexualforschung Postersession III: Freitag, 12.03.2009, 17:15-18:15 Affektive Störungen Arzt-Patient-Kommunikation Essstörungen Psychosomatik in der Gynäkologie Schmerz und Somatoforme Störungen Transplantation 9 Arbeitsgruppen des DKPM AG 1: Psychoonkologie Leitung: K. Fritzsche (Freiburg i. Brsg.), N. Grulke (Ulm), M. Keller (Heidelberg) AG 2: Persönlichkeitsstörungen Leitung: S. Doering (Münster), T. Bolm (Göppingen) AG 3: Bindungsforschung Leitung: H. Schauenburg (Heidelberg), A. Buchheim (Innsbruck, Österreich) AG 4: Körperdiagnostik und -therapie Leitung: H. Lausberg (Jena), T. Loew (Regensburg), C. Lahmann (München) Funktionelle Entspannung und Geleitete Imagination bei Asthma bronchiale 1 2 3 4 Lahmann C. , Nickel M. , Schuster T. , Sauer N. , 1 1 5 6 Ronel J. , Noll-Hussong M. , Tritt K. , Nowak D. , 7 5 Röhricht F. , Loew T. 1 Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Langerstrasse 3, 81675 München 2 Klinik Bad Aussee für Psychosomatik und Psychotherapie an der medizinischen Universität Graz, Sommersbergseestraße 395, A-8990 Bad Aussee, Österreich 3 Institut für Medizinische Statistik und Epidemiologie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Ismaninger Str. 22, 81675 München 4 Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistraße 52, 20246 Hamburg 5 Abteilung für Psychosomatische Medizin, Universitätsklinikum Regensburg, Franz-JosefStrauß-Allee 11, 93053 Regensburg 6 Institut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der LMU, München, Ziemssenstr. 1, 80336 München 7 Queen Mary University of London, Newham Centre for Mental Health, London , UK, Glen Road E13 8SP London, UK Hintergrund: Obwohl die Wirksamkeit körperpsychotherapeutischer Ansätze und hypnotherapeutischer Interventionen bei Asthma bronchiale in mehreren Studien belegt werden konnte, sind diese Ansätze noch nicht Bestandteil aktueller Therapieempfehlungen. In der vorliegenden Behandlungsstudie wurde die Wirksamkeit von Funktioneller Entspannung (FE) und Geleiteter Imagination (GI) bei erwachsenen Patienten mit allergischem Asthma bronchiale untersucht. Methodik: 64 Patienten mit allergischem Asthma bronchiale wurden über einen Zeitraum von 4 Wochen mit FE, GI, einer Kombination aus FE und GI (FE/GI) oder einem Placebo-Entspannungsverfahren (PE) behandelt. Der Behandlungseffekt wurde mittels Lungenfunktionsprüfung (FEV 1 und sRaw) gemessen. Ergebnisse: Die Behandlung mit FE, GI bzw. FE/GI führte zu einer Zunahme des FEV 1 (% vorhergesagt) von 7,6 ± 13,2; 3,3 ± 9,8 und 8,3 ± 21,0 bzw. einer Abnahme von –1.8 ± 11.1 in der PE-Gruppe am Ende der Therapiephase. Nach 4 Monaten lagen die Veränderungen bei 6,9 ± 10,3 in der FE-Gruppe; 4,4 ± 7,3 in der GI-Gruppe und 4,5 ± 8,1 in the FE/GI-Gruppe, während sich in der PE-Gruppe eine Abnahme von –2,8 ± 9,2 ergab. Die Veränderungen des Atemwegswiderstands (sRaw) entsprachen in ihrer Ausrichtung in allen Gruppen denen des FEV 1. Schlussfolgerung: Die Studie konnte die bereits aus früheren Studien bekannte Wirksamkeit der FE bei Asthma replizieren und die zeitliche Stabilität der Erfolge über die Zeit der Katamnese belegen. Körperbild und qualitatives Bewegungsverhalten bei BorderlinePersönlichkeitsstörungen Degener A. Fakultät für Rehabilitationswissenschaften, EmilFigge-Str. 50, 44221 Dortmund Das Krankheitsbild der BorderlinePersönlichkeitsstörungen (BPS) geht mit schwerwiegenden körperbezogenen Symptomatiken einher. Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse in Bezug auf das Körperbild, das Bewegungsverhalten und die Rolle bewegungsorientierter Therapieverfahren in der Behandlung von BPS sind trotz erster Studien (Haaf et al. 2001, Degener 2004) noch unzureichend. Daher ist eine Querschnittsstudie zum qualitativen Bewegungsverhalten und zum Körperbild von klinisch behandelten Patientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung unter besonderer Berücksichtigung der Symptomatik des offenen selbstverletzenden Verhaltens (SVV) geplant. Folgende Fragestellungen liegen der Studie zugrunde: •Geht die Erkrankung der Borderline-Persönlichkeitsstörung mit Störungen des Körperbildes einher? •Welche Besonderheiten existieren im Bewegungsverhalten von Patienten mit BPS? •Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Schweregrad/der Art des SVV, dem Körperbild und dem qualitativen Bewegungsverhalten? Methodisch wird die Überprüfung der Hypothesen u.a. durch die BewegungsAnalyseSkalen&Test (BAST), dem Dresdner Körperbildfragebogen-35, dem Körperbildstrukturtest und der BorderlineSymptom-Liste erfolgen. Interpersonal attunement in autism – from clinical findings towards research. How to 10 relate outcomes of dance movement therapy interventions to concepts of the social brain. 1 2 Samaritter R. , Payne H. 1 EDT Maastricht, Capucijnenstraat 92, 6211 RT Maastricht, Niederlande 2 University of Hertfordshire, Meridian House, 32 The Common, Herts AL10 ONZ Hatfield, UK Autism is a pervasive developmental disorder with a cluster of markers in social functioning. Origins of this disorder seem to be multilayered, resulting in atypical development of social engagement, empathy and formation of theory of mind. Recent theories show a particular interest in synergy of views and emphasise the involvement of shared neural circuits in the impairment of socialemotional functioning. The current project combines these concepts with findings from clinical dance movement therapy intervention. In dance movement therapy with autistic children contact is developed through non-verbal engagement. Highly attuned contact is offered which enables the child to combine a visual experience of its own movement with the proprioceptive experience. As we can observe that these children come to adjust more frequently to the movements of the therapist we find as a consequence of dance movement therapy that the child’s capacities to maintain contact and relation through intentionally attuning to another person‘s movement are increased. In this presentation concepts on the disturbed interpersonal attunement in autism are presented. Vignettes of clinical dance therapy work are offered to highlight markers of change of the autistic patient’s capacities to attune to another person’s movement patterns. The perspectives of an interdisciplinary research project on the implications of the observed movement changes on concepts of the social brain will be discussed. are frequently missing in patients with depression. We employed „Hava Nagila“ - a traditional circle dance from Israel, in a version with and a version without jumping rhythms. Results suggest that jumping rhythms improved the well-being of patients suffering from depression by decreasing depressive affect and increasing positive affect and vitality. Results are encouraging the therapeutic use of circle dances as movement rituals under consideration of their specific effects. AG 5: Psychokardiologie & Psychophysiologie (gemeinsames Treffen) Psychokardiologie: Leitung: C. Herrmann-Lingen (Göttingen), C. Albus (Köln) Psychophysiologie: Leitung: H.-C. Deter (Berlin), B. Dahme (Hamburg) AG 6: Künstlerische Therapien Leitung: C. Schulze (Ottersberg), U. Elbing (Nürtingen), L. Neugebauer (Herdecke) AG 7: Stationäre tiefenpsychologisch orientierte Therapie der Depression Leitung: M. Franz (Düsseldorf), N. Hartkamp (Düsseldorf) AG 8: Psychodermatologie & Psychoneuroimmunologie (gemeinsames Treffen) Leitung: G. Schmid-Ott (Hannover), V. Niemeier (Hießen), C. Schubert (Innsbruck, Österreich) AG 9: Konsil- und Liaison-Psychsomatik Leitung: W. Söllner (Nürnberg), G. Hildenbrand (Lüdenscheid), T. Herzog (Göppingen) The Joydance II: Specific effects of movement rhythms on affect of psychiatric patients with depression 1 2 2 AG 10: Familienpsychosomatik 2 Koch S. C. , Glawe S. , Morlinghaus K. , Fuchs T. Leitung: F. Kröger (Schwäbisch Hall), G. Jantschek (Lübeck) 1 Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung, Universitätsklinikum Heidelberg, Voßstrasse 2, 69115 Heidelberg 2 Universität Heidelberg, Psychologisches Institut, Hauptstr. 47-51, 69123 Heidelberg This study is based on Embodiment Theorie (Niedenthal, Barsalou, Winkielmann, KrauthGruber & Ric, 2005), assuming body feedback from movement, postures, and gestures on affect and cognition, and theoretical assumptions of the Kestenberg Movement Profile (KMP; Kestenberg, 1995) that postulates ten observable basic movement rhythms reflecting basic needs and affect of a person. The jumping rhythm is characterized by high intensity, round reversal movements in the vertical plane reflecting joy that Sonderveranstaltungen Psychosomatik in einem Medizinischen Versorgungszentrum am Beispiel von Wirbelsäulenerkrankungen Moderation: J. Timmermann (Cuxhaven), T. Reindard-Huschle (Cuxhaven) Psychosomatische Grundversorgung Moderation: G. Heuft (Münster), I. Veit (Herne) 11 Weiterbildungsziele in der Psychosomatischen Grundversorgung Transplantationsmedizin Moderation: H. W. Künsebeck (Hannover), G. Greif-Higer (Mainz) Psychosomatik und Allgemeinmedizin Forum Forschung Moderation: E. Brähler (Leipzig), J. von Wietersheim (Ulm) Möglichkeiten der DFG-Förderung A. Golla (Bonn) (DFG) Schwerpunkte psychosomatischer Forschung W. Herzog (Heidelberg) Moderation: U. Schwantes (Berlin) Sonderveranstaltung der DGPM Krankenhauskommission: „Entgeltsystem Krankenhauspsychosomatik: quo vadis?“ Vorsitz: G. Hildenbrand (Lüdenscheid) Referenten: U. Cuntz (Prien), G. Heuft (Münster), G. Hildenbrand (Lüdenscheid), W. Merkle (Frankfurt a. M.) Psychosomatische Fallvorstellung: Psychotherapeutische Behandlung von zwei Patienten mit somatoformer Schmerzstörung. Moderation: I. de Vries (Hamburg) Referenten: U. Kahl (Mainz), M. Kemmerling (Iserlohn) Qualitätsmanagement in der psychosomatisch / psychotherapeutischen Praxis Vorsitz: I. Pfaffinger (München), M. Raidl-Dengler (Fischen a. A., Pähl) Foren Forum Lehre Von gemeinsamen Lernzielen zum interdisziplinären Prüfungsverbund in den psychosozialen Fächern Moderation: S. Zipfel (Tübingen), B. Strauß (Jena) Basel Consensus Statement C. Kiessling (Basel, Schweiz) Vom interdisziplinären Lernzielkatalog zum longitudinalen Curriculum J. Jünger (Heidelberg) Longitudinale Curricula im Vergleich W. Langewitz (Basel, Schweiz), S. Scheffer (Berlin), M. Fischer (Witten-Herdecke) Prüfungsverbund in den psychosozialen Fächern A. Hochlehnert (Heidelberg) 12 State of the Art Symposien SOTA 1: Neurobiologie und Psychotherapie (DGPPN, DKPM, DGPM) Moderation: F. Schneider (Aachen), M. E. Beutel (Mainz) Neuroplastizität und Psychotherapie Kircher T. Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Aachen, Pauwelsstr. 30, 52074 Aachen Die neuralen Effekte von Psychotherapie sind bisher erst sehr wenig erforscht. Dies gilt insbesondere für Angststörungen und im besonderen Masse für CBT bei Schizophrenie. CBT hat sich v.a. in angelsächsischen Ländern als Therapie bei Schizophrenen Patienten mit Positivsymptomatik etabliert. Im Vortrag werden neurobiologische Grundlagen für die Entstehung und den Verlauf von Halluzinationen, Wahn und formalen Denkstörungen bei Patienten mit Schizophrenie sowie eine Dysfunktion des „Angstkreislaufs“ (fear circuit; u.a. Amygdala, Cingulum, Insula) als eine wichtige Grundlage für die Entstehung und den Verlauf der Panikstörung referiert. Im Rahmen vom BMBF finanzierten multizentrischen Verbundprojekten werden fMRT Studien vorgestellt, die Patienten mit Schizophrenie und Panikstörung vor und nach einer manualisierten CBT untersucht haben. Weiterhin werden Methoden und neue eigene Ergebnisse zur Konzeption, Reliabiliäts- und Qualitätsmessungen referiert, die als Vorraussetzung für multizentrische fMRT Messungen notwendig sind. Es zeigt sich, dass derartige, deutschlandweite Verbundprojekte einen grossen Gewinn für die Psychotherapie- und Pathogeneseforschung psychiatrischer Störungen darstellen. Funktionelle Bildgebung in der Psychotherapieforschung Beutel M. Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz In jüngster Zeit werden funktionelle bildgebende Verfahren in der Psychotherapieforschung eingesetzt. Es soll ein Überblick über methodische Grundlagen und für die Psychotherapie relevante Forschungsansätze der Bildgebung mit funktioneller Kernspintomographie (fMRI) und Positronen Emissionstomographie (PET) gegeben werden. Aktuelle Befunde zu Veränderungen von Hirnfunktionen durch Psychotherapie werden im Hinblick auf ihre Aussagekraft kritisch diskutiert. Nachgewiesen wurden systematische Veränderungen in der Gehirnaktivierung nach erfolgreicher psychotherapeutischer, kognitiv- behavioraler und psychodynamischer Behandlung von Zwangsstörungen, Depressionen, Phobien, Panik und Borderline Persönlichkeitsstörungen, die teils Veränderungen nach psychopharmakologischer Therapie ähnelten, teils sich deutlich unterschieden. Damit ist die traditionelle Spaltung zwischen pharmakologischen Verfahren, die „auf das Gehirn wirken“ und psychologischen Verfahren, die bewirken, dass sich „der Patient besser fühlt“, obsolet. Verfahren der funktionellen Bildgebung können künftig genutzt werden, um Fragen zu untersuchen, die von großer Bedeutung für Psychotherapien sind, v.a. nach biologischen Grundlagen psychischer Störungen, der Plastizität neuronaler Netzwerke, Veränderungsmechanismen und Prognosefaktoren von Psychotherapie, etc.. Neuronale Veränderungen bei Patienten mit somatoformer Schmerzstörung Gündel H. Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Str. 1,, 30625 Hannover Entgegen dem früher vorherrschenden klinischen Verständnis können auch somatoforme Schmerzen mit morphologischen und funktionellen Veränderungen im peripheren und zentralen Nervensystem einhergehen. Ebenso zeigen moderne Bildgebungsbefunde die überlappenden und sich gegenseitig beeinflussenden neuroanatomischen Grundlagen von Emotionalität und Schmerzwahrnehmung. Manche dieser funktionellen fMRT-Befunde sprechen für eine erniedrigte Schmerzschwelle, eine stärkere subjektive Schmerzwahrnehmung sowie eine verstärkte zentralnervöse Aktivierung bei Patienten mit somatoformen Schmerzen. Es existieren demgegenüber nur wenige Studien zur Frage einer eher strukturellen zentralnervösen Veränderung (Neuronenzahl, Neuronendichte) bei dieser Patientengruppe. Über mehr emotionalintuitive Aspekte der Schmerzverarbeitung wie Schmerzempathie oder über evtl. Veränderungen der selbstreflexiven emotionalen Wahrnehmungsfähigkeit und deren neuronaler Korrelate bei den betroffenen Patienten ist äußerst wenig bekannt. Der Vortrag stellt einige Ergebnisse und Zwischenergebnisse aus aktuellen bzw. aktuell laufenden funktionell-bildgebenden Untersuchungen dar und gibt darüber hinaus eine Übersicht über wesentliche Ergebnisse der speziellen Bildgebungsforschung, die zu einem veränderten Verständnis somatoformer Schmerzen führen. 13 Neurofeedback und funktionelle Bildgebung als therapeutische Option? Mathiak K. Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Aachen, Pauwelsstr. 30, 52074 Aachen Funktionelle Bildgebungsverfahren wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend zur Untersuchung von Patientengruppen eingesetzt. Eine genaue Lokalisierung von neuralen Netzwerke, die in die Symptomatologie unterschiedlicher psychischer Erkrankungen involviert sind, kann mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) erreicht werden. Anhand von Echtzeit-fMRT besteht weiter die Möglichkeit Probanden über eine Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer (Brain Computer Interface, BCI) Aktivierungen in oben genannten Arealen als Feedback anzuzeigen. Anhand von Training können Probanden dann Aktivierungen in verschiedenen Arealen lernen zu kontrollieren und zu modulieren. Dies kann zu Änderungen von Stimmung, Gedächtnis oder Schmerzempfinden führen. Erste Pilotprojekte haben gezeigt, dass auch Patientenpopulationen dieses Feedbackverfahren erlernen können. Dieser direkte Transfer neuester Methodik der kognitiven Neurowissenschaften auf emotionale und kognitive Symptome, kann die Basis für die Anwendung von direkter und freiwilliger Neuromodulation in der Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen schaffen. Der Vortrag soll diskutieren inwieweit dieser therapeutische Optimismus trotz noch unreifer Methodik, unklarer neurophysiologischer Befunde und bisher begrenzten Erfolgen von Biofeedback sinnvoll erprobt werden kann. SOTA 2: Quantitative Methoden: Was tun wo nichts ist? Zum Umgang mit fehlenden Werten in Datensätzen Organisatoren: J. Hardt (Mainz), M. Blettner (Mainz) Missing at Random – was heißt das? Hardt, J. (Mainz) Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Mainz, Duisbergweg 6, 55099 Mainz Hintergrund: Eine Vielzahl Methoden zur Imputation fehlender Werte sind heute verfügbar. Eine wesentliche Entscheidung zur Anwendung dieser Methoden beruht auf dem Prozess, nach dem die fehlenden Werte im Datensatz entstanden sind. Traditionell wird unterschieden in Missing Completely at Random (MCAR), missing at random (MAR) und missing not at random (MNAR). Zusätzlich wird eine Unterscheidung eingeführt, ob die Missings in der Ziel oder in den Einflussgrößen sind. Methode: Es werden verschiedene simple ImputationsMethoden vorgestellt, wie zum Beispiel Ersetzung durch den Mittelwert oder Regressionschätzung. Weiterhin werden Ergebnisse von Simulationsstudien gezeigt, in der zufällig verschiedene Anteile eines Datensatzes gelöscht und anschließend mit einfachen Imputationen ergänzt wurden. Ergebnisse: Die einfachen Methoden funktionieren unter bestimmten Bedingungen recht gut, d.h. sie liefern unverfälschte Schätzer für Mittelwert und Regressionskoeffizienten. Standardabweichungen und Korrelationen hingegen sind verzerrt. Schlussfolgerung: Die einfache Imputation von fehlenden Werten ist eine Methode, mit ohne großen Aufwand unter Berücksichtigung einfacher Regeln gute Resultate erzielt werden können. Die Grenzen dieser Methoden werden aufgezeigt. Missing Values bei LISREL und Mplus: Optionen und Konsequenzen Knebel A. Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz Hintergrund: Bei Kovarianzstrukturanalysen (SEM) bringen fehlende Werte zuweilen noch Probleme eigener Art mit sich, die, je nach Studiendesign und Auswertungsplan, besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Bei multivariaten Analysen scheinen multiple Imputationsverfahren eine effiziente Methode darzustellen, dieser Probleme Herr zu werden. Methode: Die verschiedenen in LISREL und Mplus implementierten Algorithmen, z. B. im Falle von LISREL "Expectation Maximation (EM)" und "Markov Chain Monte Carlo (MCMC)", werden vorgestellt und die jeweilige Güte der Imputationen anhand eines Modelldatensatzes mit unterschiedlichen Anteilen fehlender Werte erörtert. Auch Elefanten (R, STATA und SPSS) können über Missings stolpern Hardt, J. (Mainz), Herke, M. Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Mainz, Duisbergweg 6, 55099 Mainz Hintergrund: Von den verschiedene Methoden zur Imputation fehlender Werte gelten heute multiple Imputationen als die besten Verfahren. Die großen Programme wie R, STATA oder SPSS bieten entsprechend alle Pakete an, mit denen Missings ersetzt werden können. Methode: Es werden verschiedene Imputations-Methoden aus den genannten Software Paketen vorgestellt. Dazu werden die Ergebnisse einer Simulationsstudien zur logistischen Regression gezeigt, in der zufällig verschiedene Anteile eines Datensatzes gelöscht und anschließend mit (multiplen) Imputationen ergänzt wurden. Ergebnisse: R bietet die meisten Algorithmen zur Ersetzung fehlender Werte an, darun- 14 ter mehrere „Expectation Maximization“ (EM) Pakete und eines zu „Multiple Imputationen by Chained Equations“. STATA bietet ein besonders freundlich zu bedienendes Packet zur „Multiple Imputationen by Chained Equations“ an. SPSS hat einen EM Algorithmus, allerdings können nur quantitative Variablen verwendet werden und multiple Imputationen lassen sich nicht unabhängig voneinander durchführen. Schlussfolgerung: Die multiple Imputation von fehlenden Werten ist eine Methode, mit der heute ohne großen Aufwand in verschiedenen Rechenprogrammen fehlende Werte ersetzt werden können. In der Regel sind darauf aufbauende Analysen der Methode der vollständigen Fälle überlegen. Evidenzbasierte Leitlinien zur Magersucht (Anorexia Nervosa) 1 1 2 3 Zeeck A. , Hartmann A. , Cuntz U. , Groß G. , 4 3 5 Friederich H. , Zipfel S. , Hagenah U. , Holtkamp 5 4 K. , Herzog W. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg, Hauptstr. 8, 79104 Freiburg 2 Klinik Roseneck, am Roseneck 6, 83209 Prien 3 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen, Osianderstr. 5, 72076 Tübingen 4 SOTA 3: Evidenzbasierte Leitlinien (S3) zur Diagnostik und Therapie von Essstörungen Klinik für Psychosomatik und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg Moderation: S. Herpertz (Bochum / Dortmund), A. Zeeck (Freiburg i. Brsg.), J. v. Wietersheim (Ulm) Große und methodisch gute Studien zur Behandlung der Anorexie nervosa durchzuführen erweist sich als sehr schwierig, sodass die Datenlage zu Therapieergebnissen und Prozessen bis heute sehr dürftig ist. Auch eine Meta-Analyse unter Einbeziehung nicht-randomisierter Untersuchungen zur Psychotherapie der Anorexie (N=55 Studien mit 2099 Patienten) leidet unter der Inhomognität der Studien und erzielt deshalb nur wenig belastbare Ergebnisse. Hinsichtlich des Behandlungszieles der Gewichtsrestitution findet sich kein Anhalt für die Überlegenheit eines bestimmten Therapieverfahrens. Der überwiegende Teil der Leitlinienempfehlungen basiert daher auf der klinischen Erfahrung von Experten. Es soll ein kurzer Überblick über die Studienlage gegeben sowie Auszüge aus den vorläufigen Behandlungsempfehlungen vorgestellt werden. Diese wurden in der Expertenrunde verabschiedet, durchliefen aber noch nicht das Konsensverfahren. Evidenzbasierte Leitlinien (S 3) für die Diagnostik und Behandlung von Essstörungen in Deutschland 1 2 3 Herpertz S. , Vocks S. , Tuschen-Caffier B. , 4 Pietrowsky R. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie; LWL Klinik Dortmund, Universitätsklinikum der Ruhr Universität Bochum, Marsbruchstr. 179, 44287 Dortmund 2 Fakultät für Psychologie der Ruhr-Universität Bochum, Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universtitätsstr. 150, 44780 Bochum 3 Institut für Psychologie Freiburg 4 5 Abt. Kinder- und Jugendpsychiatrie Aachen Institut für Experimentelle Psychologie, Heinrich-HeineUniversität, Gebäude 23.03, Universitätsstrasse 1, 40225 Düsseldorf 2005 konstituierte sich die Arbeitsgemeinschaft zwecks Erarbeitung der S 3-Leitlinien für die Diagnostik und Behandlung von Essstörungen in Deutschland, der Vertreterinnen und Vertreter der DGKJP, DGPM, DGPPN, des DKPM und der DGPs angehören. Das Konsensus-Verfahren der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) wird 2009 stattfinden. Bei der Erstellung der Leitlinien wurden insbesondere die schon existierenden Leitlinien des National Institute of Clinical Excellence, England (NICE 2004) und der American Psychiatric Association, USA (APA 2006) berücksichtigt. Der Aufbau der Leitlinien ist unterteilt in vier Kapitel: Epidemiologie, Diagnostik, somatische Aspekte, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Binge Eating Störung. Es werden die Ergebnisse zur Epidemiologie, medizinischer und psychologischer Diagnostik der Essstörungen sowie die Therapiestudien zur Binge Eating Störung dargestellt. Evidenzbasierte Leitlinien zur Bulimia nervosa 1 2 3 von Wietersheim J. , Dahme B. , Jacobi C. , Jäger 4 5 6 B. , Kersting A. , Rustenbach S. J. , Salbach7 8 Andrae H. , de Zwaan M. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Frauensteige 14a, 89075 Ulm 2 Fachbereich Psychologie, Universität Hamburg 3 Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden, Chemnitzer Str. 46, 01187 Dresden 4 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, CarlNeuberg-Strasse 1, 39625 Hannover 5 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster, Albert-Schweitzer Strasse 11, 48149 Münster 6 Privat, Wandsbeker Allee 72, 22041 Hamburg 15 7 Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Charité 8 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinik Erlangen, Es liegen aus den U.S.A. und Großbritannien ausgearbeitete Behandlungsleitlinien vor (APA 2006, NICE 2004), die sich auf Metaanalysen der bis dahin vorhandenen Studien stützen. Allerdings zeigte sich, dass die Einschlusskriterien für die bisherigen Metaanalysen etwas unterschiedlich waren. Für die Erstellung der deutschen Leitlinie wurde jetzt eine eigene Metaanalyse gerechnet, in die 61 Studien nach ausführlicher Analyse und Kodierung eingingen. In dem Symposium werden die Ergebnisse der Metaanalyse dargestellt und Schlussfolgerungen diskutiert. Diese müssen auch die Besonderheiten des deutschen Gesundheitssystems mit den Möglichkeiten von stationären Behandlungen in psychosomatischen Kliniken und längerfristigen ambulanten Therapien berücksichtigen. SOTA 4: Diagnostik und Therapie bei Geschlechtsidentitätsstörungen Moderation: D. Rösing (Stralsund), H.A.G. Bosinski (Kiel) Geschlechtsidentitätsstörungen (GIS): Grundlagen und Epidemiologie Bosinski H. A. Sektion für Sexualmedizin, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Arnold-Heller-Str. 3, Haus 28, 24105 Kiel Vor dem Hintergrund der nosologischen Entwicklung der aktuellen Nomenklatur (ICD-10; DSM-IV) wird die Epidemiologie, Symptomatologie, Diagnostik und Differenzialdiagnostik der Geschlechtsidentitätsstörungen dargelegt und auf die Besonderheiten der psychotherapeutischen Arbeit mit diesen Patienten eingegangen. Verschiedene ätiologische Konzepte werden vorgestellt. Geschlechtsidentitätsstörungen (GIS) im Kindes- und Jugendalter Rösing K. der chirurgische geschlechtsverändernde Behandlungsmaßnahmen vor Abschluss der Pubertät. Bei Vorliegen einer adäquat diagnostizierten GIS im Kindesalter ist vielmehr eine frühzeitige Psychotherapie gefragt, die optimalerweise durch eine sexualmedizinische Weiterbildung fundiert sein sollte. Dabei empfiehlt sich die Kombination von einzel-, gruppen- und familientherapeutischer Arbeit. Es geht nicht darum, rollenatypisches Verhalten oder den Wunsch nach Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht zu „verleiden“, sondern Genese und Funktionalität der Störung aufzudecken und zu bearbeiten mit dem Ziel, das Zugehörigkeitsgefühl zum Geburtsgeschlecht zu bestärken. Wesentlicher Fokus der Therapie müssen auch Angststörungen, Dysthymien und soziale Konflikte sein, die oft mit GIS im Kindesalter einhergehen. In der Adoleszenz kann sich die GIS als Transsexualismus in statu nascendi erweisen, welche dann explizit sexualmedizinische Interventionen erforderlich macht. Symptome einer GIS im Jugendalter können Ausdruck einer Pubertätskrise sein, die spezifischer Behandlung bedürfen. Leitlinien (Standards of Care) für die Behandlung von Patienten mit Geschlechtsidentitätsstörungen (GIS) Bosinski H. A. Sektion für Sexualmedizin, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Arnold-Heller-Str. 3, Haus 28, 24105 Kiel Im Interesse der Patienten und im Hinblick auf die aktuelle Rechtslage wird die zwingende Notwendigkeit einer differenzialdiagnostischen Absicherung der Diagnose einer transsexuellen GIS im Laufe eines mindestens einjährigen,psychotherapeutisch begleiteten Alltagstests vor Einleitung irreversibler körperverändernder Maßnahmen thematisiert. Vorliegende Standards of Care werden in ihren praktischen Anwendungen vorgestellt und auf die Besonderheiten des Transsexuellengesetzes eingegangen. SOTA 5: International guidelines for medically unexplained symptoms (EACLPP) (English Track) Chairs: T. Herzog (Göppingen), W. Söllner (Nürnberg) Privat Die Häufigkeit von GIS im Kindesalter ist unbekannt. Erwachsene Transsexuelle geben regelmäßig an, sich schon in der Kindheit eher wie Angehörige des Gegengeschlechts gefühlt und verhalten zu haben. Umgekehrt ist jedoch aus prospektiven Längsschnittuntersuchungen bekannt, dass nur etwa 5 bis 15% der Kinder mit GIS im Erwachsenenalter eine transsexuelle GIS entwickeln. Deshalb verbieten sich irreversible hormonelle o- The EACLPP Approach to developing guidelines for medically unexplained symptoms Creed F. Rawnsley Building, Manchester Royal Infirmary, Oxford Road, M13 9WL Manchester, Great Britain 16 This paper will describe briefly the approach being taken by the EACLPP to the topic: “Improving management of medically unexplained symptoms/somatisation”. The aim of this group is to raise awareness among clinicians and health service planners of the unmet needs of this group of patients with a view to improving clinical services across EU. In order to do this we need to have a clear and simple classification system with persuasive data concerning prevalence, disability and costs of patients with medically unexplained symptoms/ somatisation. We also need to present convincing evidence a) that these problems respond to appropriate treatment and b) such treatment is not being used widely at present. As a result these patients incur high costs in most healthcare systems without health gain. Finally, we must highlight examples of good practice and guidelines that have been developed in individual countries in the hopes that they will be generalised to other EU countries. Beyond somatoform disorders: classification of bodily distress Fink P. The Research Unit for Functional Disorders, Psychosomatics and CL psychiatry, Aarhus University Hospital, Barthsgade 5, 1., 8200 Aarhus N, Denmark The essential feature of somatization or functional disorders is that the patients present with morbid excessive illness worrying or with functional somatic symptoms, i.e. medically unexplained symptoms. At present we do not have any general agreement on how to define and classify these patients. Many different functional syndromes have been introduced and each medical specialty seems to have developed their own syndrome alias, e.g. Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia and Irritable Bowel Syndrome. In DSM-IV and ICD-10 these illnesses are mainly classified as somatoform disorders. The validity of the diagnostic categories and definitions has been questioned both from a clinical and from a nosological point of view. The individual diagnoses or syndromes are defined in a poor and arbitrary way overlapping each other, and some of the diagnoses are too restrictive for use in clinical practice. No substantial empirical evidence for their validity exists. Establishing more valid diagnostic categories for somatoform disorders is therefore highly needed and one of the most challenging tasks in present psychiatric nosology. This paper will highlight problems in the current classification system and suggestions for new empirically founded diagnostic categories will be indicated. Recently developed guidelines for medically unexplained symptoms Henningsen P. Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar der TU München, Langerstrasse 3, 81675 München Guidelines that are finished or currently underway in Europe on specific or general aspects of medically unexplained symptoms are presented. The special problems of cooperating across medical specialities in establishing the guidelines and of implementing them in medical practice are discussed. SOTA 6: Psychotherapy for borderline personality disorder (DGPPN) (English Track) Chairs: K. Lieb (Mainz), M. Bohus (Mannheim) Efficacy and Mechanism of Action of Dialectical Behaviour Therapy for Borderline Personality Disorder Bohus M. Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, Psychosomatische Klinik, J 5, 68159 Mannheim, Deutschland Dialectical Behavior therapy (DBT) is a comprehensive cognitive behavioral treatment developed originally for suicidal individuals meeting criteria for Borderline Personality Disorder (BPD), expanded to treat BPD patients generally or with substance dependence and since expanded to treat other personality disorders as well as other mental disorders whose criterion behaviors are functionally related to problems in emotion regulation. The data for the efficacy of DBT in treating disorders characterized by pervasive and difficult to manage emotion dysregulation is extensive, including eight randomized clinical trials conducted across five independent research teams (for overview see: Lieb et al., 2004) DBT is considered the front-line treatment for BPD and, thus, by extension can be considered a comprehensive treatment for emotion dysregulation. Training in skills to decrease emotional reactivity and to regulate emotional response is a primary focus of DBT. Each DBT skill set was derived either from more basic research on emotions and emotion regulation or from procedures used in clinical interventions already found efficacious in treating emotional disorders such as anxiety and fear, depression and grieving, and anger. Emotion regulation skills in DBT are taught in the context of mindfulness skills, which are viewed as central in DBT and are thus labeled the "core" skills. 17 Schema Therapy for Borderline Personality Disorder Arntz A. Department of Medical, Clinical, and Experimental Psychology, Maastricht University, Based on a schema mode model of Borderline Personality Disorder (BPD), Schema Therapy (ST) integrates experiential, cognitive and behavioral methods to bring about a profound change in and recovery from BPD. ST has been tested in two RCTs and one case series study and found to be more effective than Treatment as Usual (TAU) and Transference-Focused Psychotherapy (TFP). ST was also found to be more cost-effective than TFP. An ongoing implementation study demonstrates that implementation of ST in regular practice is feasible without loss of effectiveness. ST leads to reduction of all BPD manifestations, related personality- and psychopathology, and normalization of hypervigilance and emotional responses on the level of the amygdala and hippocampus. Compared to TAU and TFP, ST has less drop-outs from treatment. The major research findings will be presented, as well as possible new directions of further development of the treatment. Metaanalysis of psychotherapeutic treatments in Borderline Personality Disorder Lieb K. University of Mainz Medical Center, Mainz, Germany, Psychotherapy is of central importance in the treatment of Borderline Personality Disorder. There are several available psychotherapeutic treatment approaches including dialectical behaviour therapy, schematherapy, mentalization based therapy, cognitive behavioural therapy, transference focussed therapy and emotion regulation group therapy. We performed a systematic review and a metaanalysis of psychotherapeutic approaches for the treatment of Borderline Personality Disorder. From the searches up to June 2008, 12 randomized controlled trials were identified which investigated the effectiveness of psychotherapy as compared to treatment as usual. The detailed results of this systematic review and metaanalysis will be presented at the congress. It turns out that the best evidence of effectiveness is provided for dialectical behaviour therapy, but single studies also provide evidence for effectiveness of schematherapy and mentalization based therapy. Up to date, transference focus therapy currently lacks high level evidence of effectiveness. SOTA 7: Verhaltenssüchte Moderation: M. Huss (Mainz), S. Aufenanger (Mainz) Verhaltenssüchte: Nosologie, Ätiologie und Intervention Beutel M. Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz In die psychotherapeutische Praxis kommen zunehmend Patienten mit exzessivem Verhalten (z.B. Internetnutzung, Computerspielen, Einkaufen), die Kriterien einer Abhängigkeitserkrankung zeigen. Die verschiedenen Formen dieses pathologischen Verhaltens haben bisher keinen Eingang als eigenständige Störungsbildrt in die Internationalen Klassifikationssysteme Psychischer Störungen (ICD-10 und DSM IV-R) gefunden; daher fehlen einheitliche Kriterien. Bisher wurden diese klinischen Phänomene wie die Glücksspielsucht Impulskontrollstörungen oder dem Zwangsspektrum zugerechnet; klinisch bilden derartige Störungsbilder aber vor allem mit den Abhängigkeitserkrankungen eine große Schnittmenge. Es wird die These vertreten, dass sowohl das Verlangen von Verhaltenssüchtigen, ihrer Verhaltensroutine nachzugehen, das körperliche und psychische Missempfinden, wenn die Durchführung des Verhaltens verhindert wird und die Toleranzentwicklung der Symptomatik von Substanzabhängigen entsprechen. Wie aktuelle psychophysiologische Studien zeigen, ist auch die „Verhaltenssucht“ als erlerntes (belohnendes) Verhalten für das Gehirn ein motivationaler Faktor, analog zu psychotrop wirksamen Substanzen, die direkt auf Neurotransmitter einwirken. Aktuelle klinische, epidemiologische und psychophysiologische Befunde sollen auch in Bezug auf effektive Präventionsund Interventionsmaßnahmen diskutiert werden. Diagnostik, ätiologische Bedingungen und Therapie von Online- und Computerspielsucht erste Erfahrungen aus der Mainzer Spielsuchtambulanz Wölfling K. Medizinische Psychologie, Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Johannes Gutenbereg-Universität Mainz, Saarstr. 21, 55099 Mainz Aus gesundheitspolitischer Sicht hat die suchtartige Nutzung von Computerspielen und des Internets nunmehr an Gewicht gewonnen. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene scheinen ¬– unter Berücksichtigung von Fallzahlen aus dem Suchthilfesystem – häufiger ein sich verlierendes, entgleitendes und in Extremfällen psychopathologisch auffälliges Onlinenutzungsverhalten in den virtuellen Räumen des Internets sowie in OnlineSpielwelten zu zeigen. In der Diskussion um Noso- 18 logie, Pathogenese und Ätiologie dieses Phänomens wird häufig auf die Multimorbidität der Patienten verwiesen. Komorbid auftretende Störungen, wie juvenile Depression, sozialphobische Störungen und anamnestisch belegte ADHS- Symptomatik werden als ursächlich oder auch sekundär bedingt beschrieben. Die Kausalitätsbeziehungen zwischen den diagnostizierbaren Folgeerscheinungen auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene und der subklinischen bis pathogenen Hintergrundsymptomatik scheinen bisher ungeklärt. Der Vortrag soll einen Überblick über erste empirische Daten zur Evaluation der Intervention bei Computerspielsucht im Rahmen der Ambulanz für Spielsucht am Uniklinikum Mainz geben. Dabei sollen Daten einer mehrdimensionalen Analyse von interventionsbedingten Veränderungen unter Hinblick auf die Eingangs-, Ausgangs- und Katamnese-Untersuchungen der behandelten Patienten mit Computerspielsucht Aufschluss über Wechselbeziehungen zwischen dem onlinebedingten Syndrom und der psychischen Hintergrundsymptomatik geben. Evidenzbasierte Behandlung von Persönlichkeitsstörungen Doering S. SOTA 8: S2-Leitlinien Persönlichkeitsstörungen (DGPPN, DKPM, DGPM, DGP, DGKJP) SOTA 9: Versorgung Moderation: S. Doering (Münster), S.C. Herpertz (Rostock) Diskutant: M. Bohus (Mannheim) Die Entwicklung der neuen S2-Leitlinien Persönlichkeitsstörungen Herpertz S. C. Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universität Rostock Ziel der Leitlinien war die Beschreibung des aktuellen Stands in der Diagnostik und Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Persönlichkeitsstörungen. Um psychotherapeutisch arbeitenden Kollegen nicht unterschiedliche Behandlungsmodelle ohne didaktische Aufarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden für anstehende therapeutische Entscheidungen zur Verfügung stellen zu müssen, war es Zielsetzung unseres Expertengremiums, zunächst über die Therapieschulen hinweg, empirisch begründete oder – wo fehlend – im Konsensusprozess entwickelte therapeutische Interventionen darzustellen. Im Einzelnen wurden die wichtigsten Elemente der Therapieplanung, die therapeutische Beziehungsgestaltung, das Behandlungssetting, die Behandlungsziele sowie spezifische Behandlungsfoci diskutiert und miteinander verglichen. Daran schloss sich die Erläuterung schulenspezifischer Veränderungsstrategien an. Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde, Universitätsklinikum Münster Die Behandlung der Wahl bei Persönlichkeitsstörungen ist die Psychotherapie. Derzeit existieren störungsspezifische und manualisierte Therapieansätze, deren Wirksamkeit empirisch belegt ist, für die Behandlung von Borderline, ängstlicher (vermeidender), antisozialer und (mit Einschränkungen) zwanghafter Persönlichkeitsstörung. Die beste Evidenzlage besteht für verhaltenstherapeutische Verfahren, psychodynamische Ansätze wurden lediglich für die Borderline Persönlichkeitsstörung als „möglicherweise wirksam“ eingestuft. Die Psychopharmakotherapie wird in Krisensituationen und zur Behandlung komorbider Achse-IStörungen (z.B. Depression) empfohlen, wobei eine sorgfältige Aufklärung und eine Einbeziehung des Patienten in die Therapieplanung unerlässlich ist. Moderation: K. Tritt (Regensburg), T. Loew (Regensburg) Es muss nicht immer Richtlinie sein - Möglichkeiten einer psychosomatischen Facharztpraxis jenseits der Richtlinientherapie Schreiter A. Privatpraxis Ochsenfurt Am Beispiel einer Psychosomatischen Facharztpraxis, welche seit mehreren Jahren erfolgreich ihren Schwerpunkt in der fachärztlichpsychosomatischen Versorgung setzt, sollen die Möglichkeiten und Perspektiven einer kassenärztlichen, ambulanten Tätigkeit des Facharztes für psychosomatische Medizin jenseits der reinen Richtlinientherapie dargestellt werden. Es sollen die organisatorischen Besonderheiten dieses Praxismodells wie Zeitmanagement Personal- und Raumbedarf gezeigt werden. Auch die speziellen Schwierigkeiten im kassenärztlichen Bereich, bezüglich Arzneimittelregressen und Budgetierung, für die dieses Praxismodell besonders anfällig ist, sollen erläutert werden. Ich möchte hier auch die Vor- und Nachteile der Einbindung in ein Praxisnetz für den psychosomatischen Facharzt schildern. Auch die betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte dieses Praxismodells und seine zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten sollen dargelegt werden. Wichtig ist es mir hervorzuheben warum dieses Praxismodell weder für den klassischen Richtlinientherapeuten noch für den Psychiater eine Konkurrenz darstellt, sondern eine vorhandene Versorgungslücke schließt. 19 SOTA 10: Stationäre Psychotherapie - Rehaklinik oder Krankenhaus? Moderation: W. Senf (Essen), V. Köllner (Blieskastel / Homburg) Differentialindikation aus der Sicht des Krankenhauses emotionale Konflikte oder psychosoziale Belastungen als entscheidende ursächliche Faktoren gelten (anhaltende somatoforme Schmerzstörung). Diskussion: Die in der Leitlinie entwickelte Definition und Kodierungsvorschläge des chronischen Unterbauchschmerzes orientieren sich an dem biopsychosozialen Modell chronischer Schmerzen und überwinden somatische und psychogenen Reduktionismen. G. Hildenbrand (Lüdenscheid) Differentialindikationen aus der Sicht der Rehabilitationsklinik V. Köllner (Blieskastel / Homburg) Differentialindikation aus der Sicht der Sozialmedizin M. Nosper (MDK, Alzey), M. Bassler (Chemnitz) SOTA 11: Vorstellung der neu erstellten S2k-Leitlinie zum Chronischen Unterbauchschmerz der Frau (DGPFG) Moderation: F. Siedentopf (Berlin), Kentenich H (Berlin) Interdisziplinäre S2-Leitlinie „Chronischer Unterbauchschmerz der Frau“ – Definition und Klassifikation Häuser W. Funktionsbereich Psychosomatik der Klinik Innere Medizin I, Klinikum Saarbrücken, Winterberg 1, 66119 Saarbrücken Hintergrund: In der internationalen Literatur gibt es keine einheitliche Definition des chronischen Unterbauchschmerzes der Frau. Methodik: Systematische Literaturrecherche (Medline, Psychlit, nationale Leitlinien internationaler gynäkologischer Gesellschaften) und zwei Konsensuskonferenzen mit formalen Konsensusverfahrens unter Einbeziehung verschiedener medizinischen Fachgesellschaften. Ergebnisse: Folgende Definition und Klassifikation wurde im Konsens entwickelt: Der chronische Unterbauchschmerz ist ein andauernder, schwerer und quälender Schmerz der Frau mit einer Dauer von mindestens 6 Monaten. Er kann sich zyklisch, intermittierend-situativ oder nicht zyklisch chronisch ausprägen. Der Schmerz führt zu einer Einschränkung der Lebensqualität. Bei einem Teil der Patientinnen sind körperliche Veränderungen/Störungen überwiegend ursächlich (z. B. höhergradige Endometriose). Bei vielen Patientinnen kann der Schmerz durch eine körperliche Störung nicht vollständig erklärt werden (psychische Komorbidität bzw. psychische Faktoren und Verhaltenseinflüsse). Bei anderen Patientinnen können Diagnostik und Differentialdiagnosen des chronischen Unterbauchschmerzes der Frau Siedentopf F. M. Frauen- und Kinderklinik Westend, Spandauer Damm 130, 14050 Berlin Im folgenden Beitrag sollen die Kapitel 'Diagnostik und Differentialdiagnosen des chronischen Unterbauchschmerzes der Frau' der aktuellen S2kLeitlinie dargestellt werden. Die Anamneseerhebung stellt eine wesentliche Schnittstelle zwischen Diagnostik und Therapie dar. Die psychologische Diagnostik erfolgt dabei im Rahmen der Gesprächsführung gemäß der psychosomatischen Grundversorgung. Die pelvine Untersuchung und vaginale Sonographie sollen Bestandteil der Diagnostik sein. Erhobene Befunde sollen hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Schmerzgenese stets kritisch hinterfragt werden. CT, MRT und PET bleiben speziellen Fragestellungen vorbehalten und spielen in der Routinediagnostik keine Rolle. Schon bei der Diagnostik soll eine interdisziplinäre Zusammenarbeit stattfinden. Eine konsiliarische Vorstellung in der Abdominalchirurgie, Gastroenterologie, Neurologie, Orthopädie, Psychiatrie, Psychosomatik, Schmerztherapie und Urologie ist hierbei anzuraten. Insgesamt stellt die Laparoskopie eine sinnvolle diagnostische Methode dar. Sie ermöglicht aber lediglich eine intraperitoneale Diagnostik. Retroperitoneale Erkrankungen werden nicht gleichermaßen erfasst. Spezielle operativdiagnostische Maßnahmen bleiben bestimmten Fragestellungen vorbehalten. Zusammenfassend läßt sich sagen, dass es sich beim chronischen Unterbauchschmerz der Frau auch aus psychosomatischen Gründen anbietet, schon die diagnostische Situation therapeutisch nutzbar zu machen. Operative Therapie bei chronischem Unterbauchschmerz Ulrich U. Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Endometriosezentrum Stufe III, Martin-Luther-Krankenhaus, CasparTheyß-Str. 27-31, 14193 Berlin Im Rahmen der Abklärung chronischer Unterbauchschmerzen wird als invasiver Eingriff häufig eine diagnostische Laparoskopie durchgeführt, um 20 festzustellen, ob ein morphologisches Korrelat vorliegt, das geeignet erscheint, die Beschwerden zu verursachen. Prinzipiell können zwei Intentionen für chirurgische Eingriffe bei chronischen Unterbauchschmerzen festgehalten werden: Zum einen ist eine Operation angezeigt – und dann auch häufig erfolgreich – wenn ein relevanter pathologischer Befund als potentielle Ursache für die Beschwerden bereits klinisch vermutet wird. Das gilt z. B. insbesondere für das Krankheitsbild der Endometriose. Zum anderen werden bei chronischen Unterbauchschmerzen gelegentlich Eingriffe durchgeführt, deren rein symtomatischer Effekt auf der Unterbrechung oder Modulation der afferenten nervalen bzw. neuronalen Schmerzübertragung aus dem Becken beruht. Das Für und Wider operativer Maßnahmen bei chronischen Unterbauchschmerzen wird dargestellt. Chronischer Unterbauchschmerz der Frau: Psychotherapeutische und medikamentöse Ansätze Kentenich H. DRK-Kliniken Westend, Spandauer Damm 130, 14050 Berlin Die Psychotherapie basiert auf der Psychosomatischen Grundversorgung, die die Grundlage ist sowohl für die psychische als auch für die organische Behandlung des Krankheitsgeschehens. Derzeit liegen nur vereinzelt randomisierte kontrollierte Studien zur medikamentösen, operativen und psychotherapeutisch-psychosomatischen Therapieansätzen vor. In der aktuellen Studienlage ist nur ein niedriger Empfehlungsgrad vorhanden. In der medikamentösen Therapie sollten Analgetika nicht kontinuierlich angewendet werden. Eine Antidepressiva-Medikation insbesondere bei Vorliegen einer entsprechenden Komorbidität ist im Einzelfall sinnvoll. Weitere therapeutische Ansätze wie Akupunktur, Reflexzonentherapie, Biofeedback, Homöopathie erlauben aufgrund ihrer Studienlage keine Bewertung. Empfehlenswert ist ein multimodales Therapiekonzept bestehend aus Psychotherapie, Physiotherapie sowie psychosozialer Unterstützung. Dieses multimodale Konzept erscheint am ehesten evidenzbasiert und erfolgsversprechend. Bei Schmerzen im Zusammenhang mit Endometriose (Leitsymptom Dysmenorrhoe) ist der Einsatz von hormonellen Therapien sinnvoll. Dieses sind etwa Gestagene in der kontinuierlichen Applikation (oral oder als intrauterine Spirale) oder die „Pille“ im Langzyklus. In besonderen Fällen erscheint eine Downregulation mit einem GnRH-Analogon mit oder ohne hormonelle Add-Back-Therapie sinnvoll. SOTA 12: Psychosomatische Schmerzbegutachtung (IGPS) Moderation: U.T. Egle (Gengenbach), C. Derra (Bad Mergentheim) Wesentliche Standards der psychosomatischen Schmerzbegutachtung als Konsequenz fachübergreifender Leitlinien 1 2 Egle U. T. , Derra C. 1 Gengenbach 2 Bad Mergentheim In einem mehrjährigen Prozess gelang es, gemeinsame Leitlinien für die Begutachtung chronischer Schmerzzustände zwischen den Fachgesellschaften für Neurologie (DGN), Orthopädie (DGOOC), Psychiatrie und Psychotherapie (DGPPN), Schmerztherapie (DGSS) sowie Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (DGPM, DKPM) auszuhandeln (Widder et al 2005, 2007). Das Ergebnis dieses Leitlinien-Prozesses sieht u.a. vor, dass neben den jeweiligen fachspezifischen Kenntnissen und gutachterlichen Erfahrungen auch spezielle Kenntnisse im Bereich der speziellen Schmerztherapie (z.B. durch Absolvieren des 80-Stunden-Curriculums „Spezielle Schmerztherapie“) sowie für Orthopäden, Neurologen und Schmerztherapeuten eine psychosomatische Grundkompetenz (Absolvieren des entsprechenden Curriculums) erforderlich ist, um tatsächlich einer fachübergreifenden Sichtweise gerecht werden zu können. Darüber hinaus halten die Leitlinien fest, dass es neben durch Gewebsschädigung bedingten Schmerzen auch chronische Schmerzen als Leitsymptom verschiedener psychischer Erkrankungen sowie Mischbilder geben kann, bei denen körperliche und psychische Komorbiditäten für das vom Patienten erlebte Ausmaß der Schmerzen verantwortlich sind. Das Ergebnis dieses mehrjährigen Leitlinienprozesses führte u.a. auch zu der Erkenntnis, dass bei der Begutachtung chronischer Schmerzzustände im Bereich der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie dringend eine Qualitätssicherung erforderlich ist, um diesen fachübergreifenden Leitlinien künftig entsprechen zu können. Von einer Arbeitsgruppe der Interdisziplinären Gesellschaft für Psychosomatische Schmerztherapie (IGPS) wurde ein spezielles Curriculum zur psychosomatischen Schmerzbegutachtung entwickelt, der dritte Durchgang beginnt im Mai 2009 in Weimar (Genaueres findet sich unter www.schmerz-igps.de). Inhaltlich werden im Rahmen von drei Modulen die schmerzspezifischen Grundlagen einer psychosomatischen Begutachtung (Schmerz und Stress, kulturgebundene Faktoren, diagnostisches Vorgehen und Differentialdiagnose), die schmerzbezogene Anwendung des neuen ICF zu Bewertung von Aktivität, Partizipation und Kontextfaktoren im 21 Hinblick auf schmerzbedingte Leistungseinschränkungen sowie die wichtigsten psychosomatischen Schmerzerkrankungen mit gutachterlicher Relevanz (Fibromyalgie, somatoforme Schmerzstörung, Somatisierungsstörung mit Leitsymptom Schmerz, posttraumatische Belastungsstörung, chronischer Rückenschmerz) abgehandelt. Leistungsbeeinträchtigung nach ICF bei somatoformer Schmerzstörung im Vergleich zu anderen Schmerzerkrankungen Zentgraf B., Loeschmann C., Nosper M., Egle U. T. Privat Als Ergänzung der ICD-10-Klassifikation von Diagnosen hat die WHO in den letzten Jahren die International Classification for Functioning and Disability (ICF) entwickelt. Damit kann das Ausmaß der Einschränkungen in Aktivität und Partizipation systematisch erfasst werden. Zur Vereinfachung haben Arbeitsgruppen der WHO inzwischen Operationalisierungen für bestimmte Krankheitsbilder, u.a. für Chronic Widespread Pain entwickelt, mit denen eine systematische Fremdbeurteilung möglich ist. Parallel dazu wurde in den letzten Jahren ein Selbsteinschätungsverfahren (ICF AT50-Psych, Nosper 2006) entwickelt und validiert, welche aus Sicht des Patienten eine differenzierte Beurteilung des Ausmaßes der psychischen Einschränkung erlaubt. Neben ersten Ergebnissen bei pathogenetisch differenten Subgruppen (N=500) wird ein Überblick über die ICF-Klassifikation und ihre Bedeutung bei der Leistungsbeurteilung chronischer Schmerzpatienten gegeben. Neben dem Rehabilitationsbereich, wo ICF-Diagnostik seitens der Deutschen Rentenversicherung inzwischen eingeführt wurde, spielt die Nutzung dieser Systematik zur Beurteilung von Leistungseinschränkungen auch bei der Begutachtung chronischer Schmerzpatienten eine wesentliche Rolle, wie die fachübergreifenden Leitlinien zur Schmerzbegutachtung (Widder et al 2007) festlegen. Wissenschaftlich fundierte Differenzierung zwischen somatoformer Schmerzstörung, Aggravation und Simulation Gruner B. Privat Die Erfassung des Ausmaßes der Beeinträchtigung durch Schmerzen stellt bereits im klinischen Kontext eine Herausforderung dar; dies trifft ganz besonders für die somatoforme Schmerzstörung zu. Sie erhöht sich nochmals in der Begutachtungssituation, da Erwartungen von finanzieller Entschädigung von Klienten als Verstärker hinzukommen. Kernaufgabe des Gutachters ist die Er- kennung einer solchen „künstlichen“ Symptommodulation i.S. von Aggravation oder gar Simulation. Bei der somatoformen Schmerzstörung ist ein vorwiegend nicht bewusstes Motiv bei für die Symptombildung verantwortlich. Dabei spielen biographisch frühe schmerzbezogene Lernprozesse in Form von Konditionierung und Priming eine wesentliche Rolle.Simulation ist dagegen ein bewusstes Verhalten mit gezieltem Vortäuschen von Beschwerden. Das Auftreten von Simulation in der Gutachtensituation muss bedacht werden, ist im sozialmedizinischen Kontext aber sehr viel seltener als unterstellt. Bewusste Symptomverstärkungen sind im Begutachtungskontext jedoch hoch relevant. Es werden vorhandene Beschwerden zielorientiert betont, um z.B. das Ziel einer Berentung zu erreichen. Das Ausmaß dieser Aggravation zu erfassen, ist wesentlicher Bestandteil der Begutachtung. Untersuchungen zu dieser Thematik sind nicht häufig und erwartungsgemäß problematisch. Die Beschränkung auf einzelne, auffällige Verhaltensweisen oder gar auf Fragebögen zur Diagnostik der Beschwerdevalidität ist nicht hinreichend valide. Es wird ein Überblick über die heute wissenschaftlich gesicherten Parameter gegeben, ohne dass diese bisher jedoch eine ganz sichere Aussage herbeiführen können. Die Komplexität der Problematik erfordert insofern eine Mehrebenenbetrachtung mit Konsistenzprüfung. SOTA 13: Somatoformer Schwindel Moderation: A. Eckhardt-Henn (Stuttgard), R. Tschan (Mainz) Psychische Vulnerabilität versus psychische Protektion als Prädiktoren für die Chronifizierungstendenz organischer Schwindelerkrankungen 1 2 Tschan R. , Eckhardt-Henn A. 1 Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz 2 Psychosomatische Medizin und Psychotherapie/Med. Klinik 2 am Bürgerhospital, Klinikum Stuttgart, Tunzhofer Straße 14-16, 70191 Stuttgart In einer interdisziplinären prospektiven Studie wurde der Einfluss der psychischen Disposition auf die Krankheitsverarbeitung untersucht. Dabei wurde zwischen psychischen Protektivfaktoren und Vulnerabilitätsfaktoren differenziert. 59 Patienten mit unterschiedlichen organischen Schwindelerkrankungen (benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel, Morbus Menière, vestibuläre Migräne, Neuritis vestibularis) wurden zur Eingangsdiagnostik und nach einem Jahr untersucht (differenzierte neurologisch und vestibuläre, elektrophysiologische Diagnostik) und psychosomatische Diagnostik (SKID, Vertigo Symptom Scale, Sense of Coherence Scale, Resilience Scale, Satisfaction with Li- 22 fe Scale). Für die Konstrukte der psychischen Protektion konnte eine signifikante Vorhersagekraft für den Krankheitsverlauf nachgewiesen werden. Psychosomatische Komorbidität und deren Risikofaktoren bei Patienten mit vestibulären Schwindelsyndromen. Ergebnisse einer einjährigen Verlaufsstudie. 1 2 3 Best C. , Eckhardt-Henn A. , Tschan R. , Dieterich 4 M. 1 rametern bestand. Folgerung: Patienten mit VM sind psychisch signifikant höher belastet als Patienten mit vestibulären Erkrankungen anderer Genese. Patienten mit positiver Anamnese für psychiatrische Erkrankungen zeigen nach einer akuten vestibulären Erkrankung signifikant mehr psychosomatische und psychiatrische Störungen. Fluktuationen der vestibulären Funktion bedingen möglicherweise eine gesteigerte Wahrnehmung von Schwindelsymptomen. Klinik für Neurologie, Mainz 2 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Bürgerhospital 3 Klinik und Poliklinik für Psyudiwgmatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, 55131 Mainz 4 Klinik und Poliklinik für Neurologie, Ludiwg-MaximiliansUniversität Hintergrund: Patienten mit vestibulären Schwindelsyndromen entwickeln häufig psychosomatische Störungen und Patienten mit psychosomatischen Störungen beklagen vielfach das Symptom Schwindel. Aus dieser Beobachtung wurde eine kausale Verbindung zwischen dem vestibulären und den emotionen-prozessierenden Systemen postuliert. Ziel der Studie war die Identifikation sekundärer psychosomatischer Störungen und Risikofaktoren für das Auftreten solcher Störungen. Methodik: In die prospektiv angelegte interdisziplinäre Longitudinalstudie wurden 68 Patienten mit unterschiedlichen vestibulären Syndromen eingeschlossen (gutartiger paroxysmaler peripherer Lagerungsschwindel (BPPV, n=19), Neuritis vestibularis (NV, n=14), vestibuläre Migräne (VM, n=27) und M. Menière (MM, n=8)). Alle Patienten durchliefen eine detaillierte Diagnostik: Klinischneurologische und neuro-physiologische Diagnostik mit detaillierter Testung des vestibulären Systems, klinische und strukturierte Interviews (SCID I+II) sowie eine ausführliche psychosomatische Testbatterie (VSS, VHQ, GSI, SCL-90R). Insgesamt wurden alle Patienten fünfmal über einen Zeitraumes von einem Jahr untersucht (T0=Baseline, T1=6 Wochen, T2=3 Monate, T3=6 Monate, T4=12 Monate). Ergebnisse: Patienten mit VM zeigten signifikant höhere schwindelspezifische Symptomschwere (VSS-S), schwindelinduzierte Angst (VSS-A) und schwindelbedingtes Handicap (VHQ) (p<0.001 – p=0.006) und hatten signifikant mehr psychiatrische Störungen (Angst und Depression, p=0.044). Patienten mit positiver Anamnese für psychiatrische Erkrankungen wiesen signifikant erhöhte psychosomatische Belastungen (GSI, SCL-90R) auf. Fluktuationen der vestibulären Funktion korrelierten mit dem Ausmaß der subjektiven Schwindelsymptom-schwere, wohingegen keine Korrelation zwischen vestibulärer Funktion/Dysfunktion und psychometrischen Pa- STANDFEST: Eine manualisierte Kurzintervention für Patienten mit Somatoformen Schwindelerkrankungen 1 1 2 1 Tschan R. , Scheurich V. , Best C. , Beutel M.E. , 1 2,3, 4 Hammerle F. , Dieterich M. Eckhardt-Henn A. 1 Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz 2 Klinik und Poliklinik für Neurologie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz 3 Klinik für Neurologie, Ludwig-Maximilians-Universität München 4 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Bürgerhospital, Klinikum Stuttgart Einleitung: Bisher existieren in der deutschsprachigen Literatur keine störungsspezifischen Programme zur Behandlung des somatoformen Schwindels. Ziel des Projekts soll die Überprüfung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit eines kognitivverhaltenstherapeutischen Schulungsprogramms hinsichtlich Schweregrad der Schwindelsymptomatik, Krankheits-verarbeitung, Selbstmanagement, Inanspruchnahmeverhalten und Lebensqualität sein. Methodik: N = 14 Patienten mit einer primären somatoformen Schwindelerkrankung (Angststörung N = 8, Somatoforme Störung N = 5, Depression N = 1) nahmen an einer geschlossenen, ambulanten Gruppenbehandlung (10 Sitzungen à 90 min) teil. Die psychosomatische Untersuchung umfasste ein Strukturiertes Klinisches Interview nach DSM-IV (SKID), die Vertigo Symptom Scale (VSS), Vertigo Handicap Questionnaire (VHQ), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Patient Health Questionnaire (PHQ), Short-Form36 Health Survey (SF-36) und den Illness Perception Questionnaire (IPQ). Ergebnisse: Auszüge aus dem Schulungsprogramm sowie erste PräPost und 3-Monats-Follow-up Ergebnisse der Pilotstudie werden vorgestellt. Schlussfolgerungen: Eine Implementierung des Schulungsprogramms STANDFEST soll eine leichte Umsetzbarkeit in die Versorgungspraxis gewährleisten. Bei Persistenz der Beschwerden wird eine Überführung in eine ambulante Psychotherapie gebahnt. Langfristig sollen Krankheitskosten gesenkt und eine Chronifizierung verhindert werden. 23 Wissenschaftliche Symposien S1: Migration Bananen Studie: Auswirkung der bikulturellen Identität auf Persönlichkeitsstruktur, Emotion und Körperbewusstsein von jungen Übersee Chinesen Wu Y. S., Oddo S., Thiel A., Stirn A. Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Bereich Psychosomatik, Heinrich-Hoffmann-Straße 10, 60528 Frankfurt a.M. Der Begriff „Banane“ beschreibt Menschen asiatischen Ursprungs mit einem westlichen Intellekt und illustriert eine gelbe Hülle mit einem weißen Innerem. Unsere Studie behandelt die Fragestellung, in wie fern die chinesische Internalisierung gekoppelt mit der Integration an das europäische Umfeld eine Rolle in der Persönlichkeitsstruktur, im Erleben von Emotionen und im Körperbewusstsein spielt. 154 chinesische Studierende wurden für standardisierte psychometrische Testverfahren rekrutiert. Ein eigens konzipierter Fragebogen diente zur Messung der asiatischen und europäischen Identität. Die asiatische Gesamtstichprobe zeigte im FEE höhere Werte in der mütterlichen Kontrolle als bei der Normstichprobe. Je stärker die asiatische Identität ausgeprägt war, desto niedriger waren die Werte der mütterlichen Kontrolle und desto höher die Werte der väterlichen Wärme. Im NEO FFI korrelierte die asiatische Identität positiv mit dem Neurotizismus und negativ mit der Extraversion. Die SEE zeigten eine positive Korrelation zwischen der asiatischen Identität und der Gefühlsregulation sowie der Emotionsüberflutung. Je mehr die Lebensart zum Asiatischen tendierte, desto weniger äußerte sich die Akzentuierung des äußeren Erscheinungsbildes und desto höher erschien die Unsicherheit im Fbek. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die bikulturelle Identität Folgen für die psychologische Entwicklung mit sich bringt, was im psychotherapeutischen Prozess mit berücksichtigt werden muss. Traumaerlebnisse und posttraumatische Belastungsstörungen bei einheimischen im Vergleich zu türkischstämmigen Patienten einer psychosomatischen Ambulanz 1 1 1 1 Erim Y. , Morawa E. K. , Atay H. , Tagay S. , Ay2 1 gün S. , Senf W. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Essen, Virschowstr. 174, 45147 Essen 2 Private psychotherapeutische Praxis Häufigkeit erlebter Traumata und posttraumatischer Belastungsstörungen (PTSD) sind bei Migranten selten empirisch untersucht worden. In unserer psychosomatischen Ambulanz wurden 69 einheimisch-deutsche und 77 türkischstämmige Patienten (80,1% weiblich; Alter: 35,8 ± 11,1 Jahre) mit dem Essener Trauma-Inventar (ETI) untersucht. Die türkischen Patienten nannten schwere Krankheit, den Tod/ Verlust einer wichtigen Bezugsperson, einen schweren Unfall sowie maritale Probleme am häufigsten, während die Deutschen schwere Krankheit, den Tod/ Verlust einer wichtigen Bezugsperson, Vernachlässigung sowie Mobbing als häufigste traumatische Erlebnisse angaben. Als schlimmste Traumata wurden von deutschen Patienten der Tod/ Verlust einer wichtigen Bezugsperson, (schwere) Krankheit und der sexuelle Missbrauch in der Kindheit erlebt, von türkischen Patienten maritale Probleme, der Tod/ Verlust einer wichtigen Bezugsperson und schwere Krankheit. Bei 48,1% der türkischen Patienten und lediglich bei 9,0 % der einheimischen bestand testpsychometrisch der Verdacht einer posttraumatischen Belastungsstörung (p <.001). Die PTSD wurde bei türkischen Migranten am häufigsten durch maritale Probleme und schwere Krankheit ausgelöst, bei deutschen Patienten durch schwere Krankheit und sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Unsere Studie ergibt erste Hinweise auf eine hohe Prävalenz von PTSD sowie kultur- oder migrationsspezifische Bedeutung erlebter Traumata bei türkischen Patienten. Migration und Psychosomatische Belastungen: Vergleich von Frauen und Männern türkischer Herkunft in Deutschland und in der Türkei Milch W. E., Stingl M., Akinci S., Bilgin Y., Leweke F. Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Giessen, Paul-Meimberg-Str. 5, 35392 Giessen Hintergrund: Im Zuge der öffentlichen Diskussion über die Lebensqualität und Integration von Migranten in Deutschland gewinnt auch die Frage nach dem Verhältnis von Migration und psychosomatischen Erkrankungen bzw. deren Behandlung zunehmend an Bedeutung. Methode: Mittels einer umfassenden Fragebogenstudie (n=994) wurden türkische Migrantenkohorten in Deutschland mit im Heimatland lebenden Türken verglichen. Hierfür wurden die Teilnehmer der Studie zu psychosomatischen Beschwerden (SCL 90), Alexithymie (TAS 20) und Depressivität (BDI) befragt. Ergebnisse: Psychosomatische Symptome und Depressivität sind in der Immigrantenkohorte häufiger zu beobachten und stärker ausgeprägt als bei Türken im Heimatland (Haupteffekt „Migration“ im SCL 90-GSI: F(1)=12,15; p=.000; Haupteffekt „Migration“ im BDI: F (1)=51,79; p<.001). Als besonders von den Konsequenzen der Migration betroffene Gruppe müssen die türkischen Immigran- 24 tinnen gesehen werden. Besonders auffällig ist die hohe latente Suizidalität unter den Immigranten (BDI-Item: Suizidalität). Diskussion: Migration kann mit verschiedenen Arten von Belastung verbunden sein: diese können zum einen schon im Herkunftsgebiet bestanden haben und das Abwandern motiviert haben, zum anderen stellt jeder Wohnortwechsel für sich bereits eine „nicht-normative Lebenskrise“ oder ein „lebenskritisches Ereignis“ dar. S2: Trauma, posttraumatische Belastungsstörung und körperliche Gesundheit Trauma, PTSD und körperliche Erkrankungen in der Allgemeinbevölkerung 1 2 3 4 Spitzer C. , Grabe H. J. , Barnow S. , John U. , 2 5 Freyberger H. J. , Völzke H. 1 Intimisierung von Leidensformen durch Demokratisierung der Gesellschaft - Softwaregestützte, inhaltsanalytische Auswertung der Diagnosenbeschreibungen aus den Behandlungsberichten (Epikrisen) einer Psychotherapiestation in Ostdeutschland von 1979 bis 1999. 1 2 2 Wolfsberger J. M. , Kunze M. , Rösner D. , From1 mer J. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin, Universität Magdeburg Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE), Gebäude Ost 59 (O 59), Martinistr. 52, 20246 Hamburg 2 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Greifswald im Hanseklinikum Stralsund, Rostocker Chaussee 70, 18437 Stralsund 3 Psychologisches Institut, Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Heidelberg, Hauptstrasse 47-51, 69117 Heidelberg 4 Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin, ErnstMoritz-Arndt Universität Greifswald, Walther-RathenauStr. 48, 17487 Greifswald 5 2 Institut für Wissens- und Sprachverarbeitung, Universität Magdeburg, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg Institut für Community Medicine, Ernst-Moritz-Arndt Universität, Walther-Rathenau-Str. 48, 17487 Greifswald W. Hellpach stellte Anfang des 20. Jh. die These auf, dass die zunehmende Reflexion über sich selber und die Normen u. Werte der Gesellschaft, die Nervosität (Depression) fördere (Frommer & Frommer, 1997). In diesem Spannungsfeld müsse der Mensch zu einer personalen Identität finden. Auch W. v. Baeyer postulierte 1948 einen Wandel der Leidensformen vom Dramatischen zum Stillen. Es scheint, als ob die westliche Zivilisation eine Welt geschaffen hat, die die Integrationskapazität personaler Identität zunehmend überfordert (Frommer & Frommer, 1997). Mit der Deutschen Wiedervereinigung kommt es in Ostdeutschland zu einer Anpassung an die westliche Gesellschaft und Kultur. In dieser Studie wurden Diagnosenbeschreibungen aus Behandlungsberichten einer Psychotherapiestation in Ostdeutschland von 1979 bis 1999 inhaltsanalytisch ausgewertet, wobei 491 aus den Jahren der DDR und 470 aus den Jahren der BRD stammen. Methodisch kam die Sprachund inhaltsanalytische Auswertungssoftware UIMA zum Einsatz, die es ermöglicht, die Diagnosenbeschreibungen bzgl. Störungs-Labels, Symptomen und Persönlichkeitsbeschreibungen zu untersuchen. Durch einen Unterschiedstest und eine Zeitreihenanalyse wurden die Häufigkeiten der Beschreibungen auf signifikante Änderungen getestet. Die Ergebnisse weisen eine Zunahme depressiver und eine Abnahme hysterischer bzw. somatoformer Beschreibungen. Die Ergebnisse liefern Hinweise auf eine Zunahme stillen Leidens in Ostdeutschland. Jüngste Studien zeigen, dass traumatisierte Menschen bzw. solche, die eine posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) ausbilden, nicht nur vermehrt unter zusätzlichen anderen psychischen Störungen leiden, sondern auch ein erhöhtes Risiko für eine Vielzahl körperlicher Erkrankungen aufweisen. Vor diesem Hintergrund untersuchten wir 3171 Erwachsene (Durchschnittsalter 53,7 ± 15,1 Jahre; 52,1% Frauen) aus der Allgemeinbevölkerung hinsichtlich möglicher Zusammenhänge zwischen Trauma, PTSD und körperlichen Erkrankungen. Auf der Basis der Ergebnisse des PTSDModuls des SKID wurden die Probanden drei Gruppen zugeordnet: kein Trauma in der Vorgeschichte (N = 1440), Trauma, aber keine PTSD (N = 1669) und PTSD (N = 62). Alle Studienteilnehmer wurden mit Hilfe eines computergestützten Interviews zu einer Vielzahl körperlicher Beschwerden und Krankheiten befragt. Traumatisierte Probanden bzw. solche mit einer PTSD litten signifikant häufiger unter einem Hypertonus und hatten eine höhere Lebenszeitprävalenz für einen Myokardinfarkt, einen Schlaganfall, Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Carcinomen im Vergleich zu den Studienteilnehmern ohne Trauma. Unsere Ergebnisse ergänzen bisherige Befunde zu der hohen somatischen Komorbidität von Menschen mit traumatischen Erfahrungen und solchen, die in der Folge eine PTSD entwickeln. Potentielle Mechanismen der berichteten Assoziationen werden ebenso wie diagnostische und therapeutische Implikationen für die Praxis diskutiert. Der Zusammenhang zwischen lebensgeschichtlich frühem Stress, aktuellen Belastun- 25 gen und körperlichen Beschwerden bei Patienten mit chronischen Schmerzen 1 2 3 Wingenfeld K. , Schmidt I. , Hellhammer D. H. , 4 Heim C. 1 Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg 2 Privatpraxis, Aachen 3 Universität Trier, Abt. für Psychobiologie 4 Department of Psychiatry &amp; Behavioral Sciences, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA, USA, Früher traumatischer Stress, aber auch aktuelle Belastungen habe eine hohe Prävalenz bei einer Vielzahl von psychischen und somatischen Erkrankungen. Obwohl mittlerweile gute Messinstrumente zur Erfassung unterschiedlicher Stressoren zur Verfügung stehen, werden nur selten erlebte Stressoren im Erwachsenenalter und in der Kindheit gemeinsam erfasst. An einer Stichprobe von 33 Patienten mit chronischen Schmerzen (Fibromyalgiesyndrom bzw. chronische Unterbauchbeschwerden) und 25 Kontrollprobanden analysierten wir den Einfluss von frühkindlichen Stressoren, Traumatisierungen im Erwachsenenalter und chronischen Stressbelastungen auf die körperliche Symptomatik der Patienten. Interessanterweise erwiesen sich aktuelle Belastungen als stabiler Prädiktor für die Schwere der körperlichen Symptomatik, während die Traumatisierung in der Kindheit einen weitaus geringeren Effekt hatte. Möglicherweise spielen akute Belastungen insbesondere bei der Aufrechterhaltung der Symptomatik chronischer Schmerzen eine wichtige Rolle. Der Einfluss früher Belastungen hingegen, welche potenzielle Risikofaktoren für die Entwicklung einer entsprechenden Erkrankung darstellen, scheint eher abzunehmen. Der Herzinfarkt als traumatische Erfahrung: Prävalenz, Prädiktoren, prognostische Bedeutung und Therapie von Känel R. Abteilung für Psychosomatische Medizin der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern, Freiburgstrasse 4, 3010 Bern, Schweiz Ein akuter Herzinfarkt wird von den betroffenen Patienten oft als ein Ereignis erlebt, welches mit intensiver Todesangst einhergeht. In einer systematischen Literaturübersicht (13 Studien publiziert zwischen 1980-2005) fanden wir eine gewichtete Prävalenz von 14.7% (range 0-25%) für eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) mit Bezug auf den durchgemachten Infarkt. Unsere Untersuchungen an 394 Männern und Frauen nach einem akuten Infarkt ergab eine Prävalanz von 10.4% (n=40) für eine subsyndromale und syndromale PTBS nach DSM-IV erfasst mit einem psychiatri- schen Interview (Clinician-Administered PTSD Scale). Signifikante Prädiktoren für eine PTBS waren jüngeres Alter, Furcht zu sterben und Gefühle von Hilflosigkeit zum Zeitpunkt des Infarkts. Nach einem mittleren Follow-up von 26 Monaten erfüllten 67% (n=16) der 24 erneut interviewten Patienten nach wie vor die Kriterien für eine PTBS. Eine PTBS erhöht sowohl bei initial gesunden Individuen als auch bei Patienten nach einem Herzinfarkt das Risiko für ein erstmaliges bzw. erneutes kardiovaskuläres Ereignis. Eine mögliche Erklärung hierfür sind erhöhte Plasmaspiegel von Biomarkern für eine Arteriosklerose (Entzündung, Blutgerinnung und Endotheldysfunktion), wie wir diese bei 14 anderweitig gesunden Patienten mit PTBS nach einem Unfall im Vergleich zu 14 Unfallpatienten ohne PTBS fanden. Zur Therapie einer PTBS nach Herzinfarkt bietet sich die KVT nach den Prinzipien der Traumatherapie in Kombination mit einem SSRI an. Trauma, PTSD und Herzratenvariabilität: Bessert Psychotherapie kardiovaskuläre Risikofaktoren? Sack M. Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, KLinikum rechts der Isar der TU München, langerstrasse 3, 81675 München Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen leiden charakteristischerweise an überschießenden emotionalen Stressreaktionen, sowie korrespondierend dazu an einer verminderten Kapazität zur Aktivierung adaptiver biologischer Regulationsmechanismen. Die Herzratenvariabilität ist ein non-invasiv erhebbarer Parameter der parasympathischen Regulationslage der mit der Fähigkeit zur Regulation von Affekten und Impulsen korreliert und zugleich einen potenten kardiovaskulären Risikofaktor darstellt. Verschiedene Studien legen einen Zusammenhang zwischen einer verminderten Herzratenvariabilität und erhöhten Prävalenzraten kardiovaskulärer Erkrankungen bei traumatisierten Patienten nahe. Wir stellen eigne Ergebnisse aus zwei Behandlungsstudien mit Verlaufsuntersuchungen der Herzratenvariabilität bei Patienten mit PTSD vor. Es zeigen sich signifikante Zunahmen des Parasympathikotonus nach Therapieende in Ruhe und unter Stressbelastung und somit auch eine Besserung des kardiovaskulären Risikos. Die Zunahme des Parasympathikotonus im Sinne eines psychovegetativen Dearousal während der Therapiesitzungen korreliert mit dem Erfolg der Behandlung. Unsere Befunde sprechen für die psychosomatische Verschränkung von Traumafolgesymptomen mit biologischen Parametern der Regulationsfähigkeit. 26 S3: Entwicklung und Evaluation von DBT für PTBS – von der Neurobiologie zur Therapie Neuropsychologische Korrelate von Ekel bei Trauma-assoziierten Störungen Schulz D., Valerius G., Schmahl C. Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, Psychosomatische Klinik, Postfach 12 21 20, 68072 Mannheim Ekel stellt bei Trauma-assoziierten Störungen eine bislang nur wenig beachtete Emotion dar. Wir führten daher psychometrische, neuropsychologische und Bildgebungs-Untersuchungen zur Ekelverarbeitung bei gesunden Menschen sowie Patienten mit Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) durch. Es wurden 27 Patientinnen mit PTBS, 37 mit BPS und 38 gesunde Kontrollprobandinnen untersucht. Die Assoziation der eigenen Person mit Ekel bzw. Angst wurde mit Hilfe des Implicit Association Test (IAT) bestimmt. In einer fMRIUntersuchung wurde die Korrelation zwischen der Ekel-Einschätzung von Bildern und dem BOLDSignal bei Patientinnen mit BPS bestimmt. Sowohl BPS- als auch PTBS-Patientinnen zeigten gegenüber gesunden Kontrollprobandinnen eine erhöhte Ekelsensitivität. In der IAT- Untersuchung fand sich sowohl bei BPS als auch bei PTBS eine stärkere Assoziation der eigenen Person mit der Emotion Ekel als mit der Emotion Angst. In der fMRIUntersuchung fanden wir bei Gesunden eine Korrelation zwischen Ekel und dem BOLD-Signal sowohl in der Amygdala als auch der Insel. Im Vergleich zu Gesunden wiesen BorderlinePatientinnen zusätzlich eine gesteigerte Aktivität in präfrontalen Arealen auf. Die Ergebnisse dieser Studien sind insofern von Bedeutung, als die Posttraumatische Belastungsstörung bislang den Angststörungen zugerechnet wird, die Rolle von anderen Emotionen, wie z.B. Ekel, aber bislang nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Dissoziation als möglicher Einflussfaktor auf Lernprozesse und Therapieerfolg bei Traumaassoziierten Störungen 1 1 Mauchnik J. , Ebner-Priemer U. W. , Kleindienst 1 2 2 1 N. , Limberger M. , Schmahl C. , Bohus M. 1 Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, Psychosomatische Klinik, J 5, 68159 Mannheim, Deutschland 2 Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, Psychosomatische Klinik, Postfach 12 21 20, 68072 Mannheim Dissoziative Zustände sind ein häufiges Symptom bei der Borderline-Störung, der PTBS sowie der akuten Belastungsstörung, treten aber auch bei anderen psychischen Störungen, wie der Panikoder Zwangsstörung auf. Für diese Störungsbilder liegen etablierte verhaltenstherapeutische Ansätzen vor, dennoch gibt es eine hohe Rate an Patienten, die nicht von diesen Methoden profitieren. Die Psychotherapieforschung konzentriert sich daher zunehmend auf mögliche Moderatorvariablen, beispielsweise die Dissoziation. Drei der vier bisher durchgeführten Therapiestudien zum Einfluss von Dissoziation auf Therapieergebnisse finden, dass hohe Dissoziationswerte sich negativ auswirken. In einer Studie unserer Arbeitsgruppe zur Wirksamkeit der dialektisch-behavioralen Therapie konnte dieser Zusammenhang bestätigt werden. Klinisch und neurobiologisch liegen Hinweise dafür vor, dass Dissoziation Lernprozesse beeinträchtigt, die Grundlage therapeutischer Interventionen sind. Wir führten eine Konditionierungsstudie bei 35 unmedizierten Borderline-Patientinnen und 33 gesunden Kontrollen durch und fanden, dass diejenigen Patientinnen, die während der Untersuchung akut dissoziierten, den Zusammenhang zwischen unkonditioniertem und konditioniertem Stimulus nicht lernten, weder in peripher-physiologischen Reaktionen, noch in subjektiven Ratings. Hier finden sich erste Hinweise, dass akute Dissoziation bereits die Enkodierung beeinträchtigen könnte. Klinische Implikationen werden vorgestellt. Das Körperbild bei Patientinnen mit PTBS nach sexueller Gewalt 1 1 2 2 Dyer A. S. , Reinelt E. , Weiss R. , Borgmann E. , 1 1 Klofat B. , Bohus M. 1 Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, Psychosomatische Klinik, Postfach 12 21 20, 68072 Mannheim 2 Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, Psychosomatische Klinik, J 5, 68159 Mannheim, Deutschland Einführung: Gegenwärtig liegen keine empirischen Daten zur Körperbildstörung bei Patienten mit Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) vor. Wir überprüften das Vorliegen einer Körperbildstörung bei Patienten mit PTBS unter Berücksichtigung möglicher Kovariablen. Methode: Im Rahmen einer Case-Control-Untersuchung werden Daten von Patientinnen mit PTBS in Folge von sexuellem Missbrauch, PTBS in Folge von Typ I Traumatisierung und psychiatrischen Kontrollen erfasst. Die abhängige Variable wird über den Multidimensional Body Self Relations Questionnaire und den Dresdner Fragebogen zum Körperbild; die unabhängigen Variablen über das Strukturierte Klinische Interview, die Posttraumatic Diagnostic Scale und das Childhood Trauma Questionnaire erfasst. Als mögliche Kovariablen werden Essstörungen, der BMI, die Sexualität, der Selbstwert und Depressivität erhoben. Ergebnisse: Es ergeben sich signifikante Zusammenhänge zwischen dem Vor- 27 liegen einer PTBS und dem Vorliegen einer Körperbildstörung. Insbesondere bei Patientinnen mit sexueller Traumatisierung in der Kindheit zeigen sich deutliche Störungen des Körperbildes auf verschiedenen Ebenen. Diese Ergebnisse bleiben auch nach Kontrolle der Kovariablen erhalten. Diskussion: Es zeigen sich Hinweise auf das Vorliegen einer Körperbildstörung bei Patienten mit PTBS in Folge von sexuellem Missbrauch. Im folgenden Schritt wird ein Behandlungsmodul für die Körperbildstörung bei Patienten mit PTBS entwickelt und empirisch überprüft. Entwicklung und Evaluation des DBTKonzeptes für PTBS nach sexuellem Missbrauch Bohus M., Priebe K., Dyer A. S., Steil R. Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, Psychosomatische Klinik, J 5, 68159 Mannheim Dialektisch Behaviorale Therapie (DBT) gilt derzeit als das best-evaluierte Behandlungsprogramm für Patienten mit Borderline-Störungen (BPD). Allerdings bezieht sich sowohl Behandlungsmanual als auch die Studienlage primär auf die Verbesserung von schweren Störungen der Verhaltenskontrolle. Ca. 65% aller Borderline-Patienten leiden zudem unter komorbider PTBS in Folge schwerer sexueller Traumatisierung in der Kindheit. Auf der Basis der DBT entwickelten wir ein multimodales Behandlungsprogramm, welches unter stationären Bedingungen evaluiert wurde. Wir fanden sowohl in prä-post Messungen als auch unter kontrolliertrandomisierten Bedingungen signifikante Verbesserungen der trauma-relevanten Symptomatik, mit exzellenten Effektstärken und sehr hohen Remissionsraten. Der Vortrag gibt einen Überblick über Struktur der Behandlung und die wesentlichen Strategien, sowie die wichtigsten Forschungsergebnisse. S4: Betreuungsbedürfnisse von Patienten und Qualität klinischer Versorgung Qualität stationärer Versorgung am Beispiel der Zufriedenheit chirurgischer Patienten 1 2 2 Janßen C. , Ommen O. , Pfaff H. 1 Abt. Medizinische Soziologie, Uniklinik Köln, Eupener Str. 129, 50933 Köln 2 Zentrum für Versorgungsforschung Köln ZVFK, Eupener Str. 129, 50933 Köln Das Ziel der vorliegenden Analyse besteht darin, durch eine retrospektive Befragung schwerstverletzter Patienten Einflussfaktoren auf die Zufriedenheit der Patienten mit dem Krankenhausauf- enthalt zu identifizieren (Donabedian 2003). Befragt wurden 121 schwerstverletzte Patienten, die sich in Kölner Kliniken stationär auf den unfallchirugischen Abteilungen behandeln lassen mussten. In einem logistischen Regressionsmodell werden als unabhängige Variablen psychosoziale Versorgungsqualität durch die Ärzte (Janßen et al. 2007a), shared decision making (Scheibler et al. 2003), Patiententyp (Ommen et al. 2008) sowie subjektiver Behandlungserfolg (Janssen et al. 2008) und als abhängige Variable ein dichotomisierter Score aus Zufriedenheit plus Erwartung (Janssen et al. 2007b) eingeführt. Es konnten vier hochsignifikante Einflussfaktoren auf die Zufriedenheit schwerstverletzter Patienten mit dem Krankenhausaufenthalt identifiziert werden: 1) Psychosoziale Versorgungsqualität durch die Ärzte, 2) shared decision making, 3) Patiententyp sowie 4) subjektiver Behandlungserfolg. Die psychosoziale Versorgungsqualität der Patienten durch die Ärzte konnte in der vorliegenden Studie als wesentliche signifikante Einflussgröße auf die Unzufriedenheit der Patienten mit dem Krankenhausaufenthalt ermittelt werden. Darüber hinaus spielen Aspekte der Patienteneinbeziehung, des -typs sowie der subjektiven Beurteilung des Behandlungserfolges ebenfalls eine signifikante Rolle. Betreuungsbedürfnisse der Patienten in der primärärztlichen Versorgung 1 1 1 Laubach W. , Schmidt R. , Fischbeck S. , Jansky 2 M. 1 Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Mainz, Duisbergweg 6, 55099 Mainz 2 Abt. Allgemeinmedizin, Universitätsmedizin Mainz, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz Einleitung: Die Versorgung von Patienten in der Allgemeinmedizin hat in unserem Gesundheitssystem zentrale Bedeutung. Bei zunehmender sozialer Ungleichheit, modernen Informationsmöglichkeiten und wachsender Patientenautonomie stellt sich die Frage, welche Betreuungsbedürfnisse Patienten hinsichtlich emotionaler und praktischer Unterstützung sowie fachlicher Versorgung an den Allgemeinarzt haben. Methode: Anhand literaturgestützter Analysen und Expertenratings (73 Hausärzte) wurde ein Fragebogen zu psychosozialen Betreuungsbedürfnissen entwickelt und 279 Patienten im Rahmen ihres Praxisbesuchs zur Bewertung vorgelegt. Darüber hinaus wurden Daten zur sozialen Unterstützung (SozU K14) sowie soziodemographische Angaben erhoben. Ergebnisse: Mittels Faktorenanalyse ließen sich 4 Dimensionen differenzieren: 1. „Soziale Situation und emotionale Unterstützung“, 2. „Ärztliche Kompetenz, Aufklärung und Information“, 3. „Empathie und Einfühlung“ und 4. „Hausarzt-Funktion“. Die Betreuungsbedürfnisse werden anhand von soziodemographischen Merkmalen der Patienten, 28 Merkmalen der Erkrankung sowie hinsichtlich des Ausmaßes sozialer Unterstützung überprüft. Diskussion: In den Dimensionen der Betreuungsbedürfnisse wurden die klassischen Aufgaben des Hausarztes bestätigt: Kenntnis der Lebensbedingungen des Patienten, emotionaler Unterstützung, fachliche Versorgung und häusliche Betreuung. Die Erfüllung dieser Betreuungsbedürfnisse kann als Qualitätsmerkmal der Versorgung gelten. Patientenwunsch nach psychosozialer Unterstützung in der Onkologischen Nachsorge Werner A. 256), hämatologisch-onkologische Patienten (n = 117) sowie solche der Anästhesiologie (n = 193). Sie zeigen, dass Betreuungsbedürfnisse krankheits- und sektorenabhängig ausgestaltete sind . Darüber hinaus sind sie je verschieden dimensioniert und determiniert. Sie fordern insbesondere die kommunikative Kompetenz und die Empathiefähigkeit des Arztes. Die Befunde der Studien sowie das Konzept werden als Ansatz für eine Verbesserung der Versorgungsqualität diskutiert. S5: Störungsbezogene stationäre psychosomatische Psychotherapien Psychosoziale Versorgung von Tumorpatienten Tumorzentrum Rheinland-Pfalz e. V., In Rheinland-Pfalz wird bei der strukturierten Nachsorge von Patienten mit onkologischen Erkrankungen der psychosoziale Interventionsbedarf erhoben. Diese Nachsorge betrifft alle Patienten, die nach der Behandlung als Tumor frei gelten. Die Einschätzungen erfolgen durch den behandelnden Arzt. In einer Studie wurden parallel zu dieser Nachsorge die Patienten nach ihren Wünschen befragt. Es zeigt sich, dass ärztliche Einschätzung und Patientenwunsch deutlich auseinanderklaffen. Referiert werden Antworten zu Versorgungswünschen von 2642 Patienten sowie der ihrer Ärzte aus der Nachsorgedokumentation. Was sind Betreuungsbedürfnisse? Konzeptualisierung und empirische Befunde Fischbeck S. I. Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Mainz, Duisbergweg 6, 55099 Mainz Vertreter vieler wissenschaftlicher Disziplinen haben sich mit der Frage beschäftigt, welche Bedürfnisse Menschen haben und wie diese zu erfüllen seien. Allerdings besteht weder fachintern noch fachübergreifend Konsens darüber, wie sie theoretisch zu verorten oder zu klassifizieren sind. Definitionen des Gegenstandes „Bedürfnisse“ kennzeichnen sie als Bestimmungsstücke eines dynamischen Prozessgeschehens, welches das sie potentiell erfüllende Handeln leitet. Kategorienbildende Systematiken menschlicher Bedürfnisse sind nach unterschiedlichen Grundgedanken aufgebaut, es lassen sich Defizit-, Wachstums- und homöostatische Modelle unterschieden. Auf ihrer Basis wurde ein Konzept der arztbezogenen psychosozialen Betreuungsbedürfnisse entwickelt. Es bildet den Ausgangspunkt der empirischen Untersuchung dieses subjektiven Bedarfs und der entsprechenden Instrumentenentwicklung bei verschiedenen Patientengruppen: BrustkrebsPatientinnen im Kontext stationärer Betreuung (n = 70) und im Sektor der ambulanten Nachsorge (n = Behandlungsdauer und Ergebnisqualität von stationären Behandlungsverläufen bei Patientinnen mit Essstörungen - Ergebnisse langfristiger Prozessanalysen Zielke M. W. Wissenschaftsrat der AHG AG, Helmholtzstr. 17, 40215 Düsseldorf Einleitung: Seit 1986 wurde die stationäre Behandlungsdauer zur Behandlung und Rehabilitation von Essstörungen in einem durchgehenden Trend von 101 Tagen auf 47 Tage im Jahre 2007 mehr als halbiert. Die fehlende wissenschaftliche Bearbeitung verleitet zu der Annahme, dass diese Verkürzungen ohne Einbußen bei der Ergebnisqualität geblieben seien. Methoden und Ergebnisse: Auf der Basis von 6.649 stationären Behandlungsfällen von Patientinnen mit Essstörungen wurde mit Hilfe der Methode der Ankerjahrsgangsdifferenzen und der Alerting Korrelation untersucht, ob sich ein Zusammenhang zwischen den Verkürzungen der Behandlungsdauer und den Behandlungsergebnissen aufzeigen lässt. Es ergeben sich enge Zusammenhänge zwischen Behandlungsverkürzungen und den korrespondierenden Behandlungsergebnissen. Kontrastierend hierzu bleibt der Chronifizierungsgrad der klinischen Symptomatiken weitgehend konstant. Diskussion: Die Bewertung der Behandlungszeiten kann nicht länger durch die Verwaltungen der Sozialversicherungen erfolgen. Es wird empfohlen, diagnosebezogene Behandlungszeitfenster für die stationäre Behandlung von Essstörungen festzulegen mit der Möglichkeit zur Adaptation dieser Zeitfenster um weitere behandlungsrelevante Merkmale aus der klinischen Verlaufsforschung. Einfluss interpersonaler Probleme auf den Therapieerfolg bei Patientinnen mit depressiver Symptomatik 1 2 3 Haase M. , Franke G. H. , Hoffmann T. , Frommer 4 J. 29 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Magdeburg, Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg 2 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH), Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften, Studiengänge Rehabilitationspsychologie, Osterburger Straße 25, 39576 Stendal 3 AWO Fachkrankenhaus Jerichow, Abteilung für Psychosomatische Medizin, Johannes-Lange-Str. 20, 39319 Jerichow 4 Klinik für Psychosomatische Medizin, Universität Magdeburg Bisherige Studien zeigen, dass bei 20% bis 30% der langzeitbehandelten depressiven Patienten keine stabilen Verbesserungen oder sogar Verschlechterung ihrer Symptomatik zum Therapieende verzeichnen. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, den Einfluss interpersonaler Veränderungen während der frühen Therapiephase auf den Behandlungsverlauf stationärer psychodynamischer Psychotherapie zu untersuchen. In diese Untersuchung wurden 264 Patientinnen mit einer depressiven Symptomatik im Alter von 25 bis 55 einbezogen. Die Patientinnen wurden in drei psychosomatischen Abteilungen unterschiedlicher Kliniken behandelt. Zur Aufnahme (t0), Verlaufsmessung (t1) sowie Entlassung (t2) wurden die symptomatische Belastung (SCL-90-R) sowie die interpersonalen Probleme erhoben. Bereits im Zeitraum zwischen Aufnahme (t0) und vier Wochen später (t1) konnten mittlere Effektstärken (d=0,62) im symptomatischen Bereich ermittelt werden (GSI-Wert der SCL-90-R). Die symptomatischen Veränderungen steigerten sich zum Behandlungsende (t2) und erreichten hohe Effektstärken (d=1,33). Die Diskriminanzanalyse zeigte, Patientinnen, die hinsichtlich interpersoneller Probleme während der ersten 4 Wochen Therapie keine Verbesserung ihrer Problematik angaben, konnten mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht von der Therapie profitierten. Speziell im Bereich der Introversion gaben die Patientinnen, die nicht von der Therapie profitieren konnten, deutliche Probleme an. Hintergrund: Angststörungen stellen eine der häufigsten psychischen Diagnosen dar. Medikamentöse Behandlung ist oft durch Nebenwirkungen oder Abhängigkeiten belastet, Psychotherapie ist hier die Methode der Wahl. Methode: Insgesamt 17 Kliniken (Akut und Reha) in Bayern haben sich im Jahre 1998 auf ein gemeinsames Dokumentationssystem geeinigt, das unter anderem Diagnosen nach ICD-10 und den Globalen Schwere Index (GSI) der SCL-90-R enthält. Bisher wurden im Institut für Qualitätsentwicklung in der Psychotherapie und Psychosomatik (IQP) die Daten von über 100.000 Behandlungen dokumentiert. Aus den Jahrgängen 2001-2007 werden die Behandlungsdaten von 37052 Patienten aus dem Akut-Bereich untersucht, 5022 davon wiesen eine Angststörung als Erstdiagnose auf. Ergebnisse: Die häufigste einzelne Diagnose innerhalb der Angststörungen stellen Posttraumatische Belastungsreaktionen (26%) und Panikstörungen dar (24 %). Die häufigste psychische Komorbidität ist Depression (38 %). Varianzanalysen über den Verlauf des GSI zeigen von prä- zu post-Behandlung eine Effektstärke von d = .78 (p < .001). Es zeigen sich keine signifikanten Unterschiede der Effektstärken zwischen Subdiagnosegruppen der Angst oder für körperliche Komorbidität. Schlussfolgerung: Angststörungen zeigen eine zufriedenstellende Response in der multimodalen stationären Psychotherapie. Wesentliche Unterschiede für Subgruppen konnten nicht identifiziert werden. Wie wirksam ist stationäre Psychotherapie bei der Behandlung sozialer Ängste? Aktuelle Ergebnisse und zukünftige Herausforderungen 1 2 2 2 Pöhlmann K. , Eismann E. , Döbbel S. , Israel M. , 2 Joraschky P. 1 Universitätsklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 2 Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden Stationäre psychosomatische Therapie von Angststörungen: Ergebnisse aus der Versorgungsforschung 1 2 3 3 Hardt J. , Bleichner F. , von Heymann F. , Tritt K. , 4 Beutel M. E. 1 Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Mainz, Duisbergweg 6, 55099 Mainz 2 Psychosomatische Klinik, Bad Neustadt/Saale 3 Institut für Qualitätsentwicklung in der Psychotherapie und Psychosomatik, Werdenfelsstr. 81, 81377 München 4 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz Hintergrund: Sozialphobiker weisen höhere Symptombelastungen und stärkere Einschränkungen auf als Patienten anderer Störungsgruppen (Pöhlmann et al. 2008). Trotz der Prävalenz von 25% werden soziale Ängste selten erkannt und nicht ausreichend behandelt (Dally et al. 2005). Methodik: In einer naturalistischen Studie wurde die Wirksamkeit multimodaler stationärer Psychotherapie mit psychodynamischer Ausrichtung geprüft. 135 Patienten erfüllten die Einschlusskriterien (DIAX Diagnose soziale Phobie, LSAS≥30). Veränderungen in sozialen Ängsten sowie der Symptombelastung (SCL, BDI) wurden zu Therapieende und zum Katamnesezeitpunkt (1 Jahr) untersucht. Ergebnisse: Hinsichtlich der sozialen Ängste betrug der Responderanteil im Rahmen einer ITT Analyse zu Therapieende 17%, in der Katamnese 5.2%. Betrachtet man die Completer (N=95) wurden 30 23.2% der Patienten zu Therapieende als Responder klassifiziert, zum Katamnesezeitpunkt 13.6%. Klinisch unauffällige Depressionswerte wiesen vor der Therapie 8.4% der Sozialphobiker (N=95) auf, zum Therapieende 46.7% (N=92), wobei der Anteil in der Katamnese geringer war. Nach der Therapie berichteten 60.7% der Patienten (N=90) klinisch bedeutsame Reduzierungen der psychischen Belastung (SCL), in der Katamnese war der Anteil höher. Diskussion: Soziale Ängste scheinen sich im Rahmen der stationären Therapie wenig zu verändern. Die Ergebnisse werden im Vergleich zu a. Störungsgruppen diskutiert, Gründe und Verbesserungen der stationären Behandlung erörtert. S6: Psychoonkologie Screening körperlicher, psychosozialer und spiritueller Belastungen bei onkologischen Palliativpatienten: Entwicklung und erste Anwendung des Fragebogens zur Belastung von Palliativpatienten (FBPP) 1 2 3 Fischbeck S. I. , Weber M. , Maier B. O. , Siep2 2 4 3 mann U. , Schwab R. , Nehring C. , Gramm J. , 5 6 4 Delargardelle I. , Langenbach R. , Beutel M. E. 1 Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Mainz, Duisbergweg 6, 55099 Mainz 2 Interdisziplinäre Einrichtung für Palliativmedizin, Universitätsmedizin Mainz, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz Mainz 3 Abteilung Palliativmedizin der Dr. Horst-SchmidtKliniken Wiesbaden, HSK, Dr. Horst Schmidt Klinik, 55199 Wiesbaden 4 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz 5 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Trier, Feldstraße 16, 54290 Trier 6 Kliniken Mutterhaus der Borromäerinnen Trier, Feldstraße 16, 54290 Trier Die palliativmedizinische Betreuung onkologischer Patienten sollte somatischen, psychosozialen und existentiell-spirituellen Aspekten gerecht werden. Ziel der Studie ist, im Rahmen eines Pilotprojektes zu ermitteln, wodurch und wie stark die entsprechenden Patienten in dieser Hinsicht belastet sind. Für diesen Zweck wurde die Pilotform des Fragebogens zur Belastung onkologischer Palliativpatienten (FBPP) wie folgt entwickelt: (1) Durchsicht bestehender Belastungsfragebogen und palliativmedizinischer Literatur, (2) Itemmodifikationen durch eine Expertenrunde, (3) A-prioriDimensionierung der Pilotform mit 53 Items aus sechs Kategorien: (Psycho)somatische Beschwerden, Angst, Informationsdefizite, Alltagseinschrän- kungen, Soziale Belastungen und Existentielle/spirituelle/religiöse Belastungen. Zusätzliche wurden Validierungsinstrumente eingesetzt. Es werden Patienten von drei Palliativstationen einbezogen (Mainz, Wiesbaden, Trier). Ein Drittel von ihnen konnte bisher an der Studie teilnehmen (n = 86 Patienten, Alter 39-85, 59% weiblich). Am stärksten waren sie hinsichtlich der körperlichen Befindlichkeit (Schwäche, Erschöpfung) und von bestimmten Ängsten (z. B. vor einem qualvollen Sterben) belastet; weniger sahen sie sich von sozialen Belastungen (etwa Rückzug von Bekannten und Freunden) affiziert. Auf der Basis faktorenanalytischer Auswertung sollen letztlich reliable Skalen extrahiert werden. Ihr Einsatz soll helfen, Interventionen gezielt auf Palliativpatienten abzustimmen. Therapie dysfunktionaler Progredienzangst bei Krebspatienten 1 2 3 3 Herschbach P. , Berg P. , Waadt S. , Duran G. , 4 1 1 Engst-Hastreiter U. , Book K. , Dinkel A. , Henrich 1 G. 1 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, KLinikum rechts der Isar der TU München, Langerstrasse 3, 81675 München 2 Institut für Therapieforschung, Parzivalstr. 25, 80804 München 3 Privatpraxis München 4 Klinik Wendelstein Rheumazentrum, Kolbenmoorer Str. 56, 83043 Bad Aibling Hintergrund: Progredienzangst ist eine zentrale emotionale Belastung bei Krebskranken. In hohen Ausprägungen ist eine psychotherapeutische Behandlung indiziert. Vorgestellt wird das Ergebnis einer kontrollierten (teil-)randomisierten Psychotherapiestudie gegen dysfunktionale Progredienzangst. Methode: 174 Krebspatienten aus zwei Reha-Kliniken wurden zufällig einer direktiven spezifischen kognitiven Angsttherapie bzw. einer nondirektiven themenzentrierten Psychotherapie zugeordnet. Indikationskriterium war u.a. ein erhöhter Wert auf dem Progredienzangstfragebogen (PA-F, Herschbach et al. 2005). Die Therapiedosis (4 Doppelstunden + 2 Boosteranrufe) war in beiden Bedingungen gleich. 91 onkologische RehaPatienten (gleiche Einschlusskriterien) dienten als Kontrollgruppe. Primäres Therapieziel war die Reduktion der Progredienzangst, erfasst zu 4 Meßzeitpunkten (inkl. 1 Jahres Follow-up). Ergebnisse: In beiden Therapiegruppen konnte das Ausmaß der Progedienzangst signifikant reduziert werden (Effektgrößen 0.62 bzw. 0.58), was nicht für die Kontrollgruppe galt. Diskussion: Es ist möglich, auch mit kleinen Therapiedosen Krebspatienten mit ausgeprägten Ängsten nachhaltig zu helfen. Die potentiellen Wirkmechanismen sind zu diskutieren. 31 Wirksamkeit psychodynamischer Kurzzeitpsychotherapie depressiver Erkrankungen bei Brustkrebspatientinnen. Förderschwerpunktprogramm "Psychosoziale Onkologie" der Deutschen Krebshilfe e. V. - Erste Ergebnisse. 1 1 1 Imruck B. H. , Beutel M. , Zwerenz R. , Schwarz 2 2 2 R. , Barthel Y. , Kuhnt S. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz 2 Selbständig Abteilung für Sozialmedizin, Rosenthal-Straße 55, 04103 Leipzig Philipp- Depressive Störungen stellen die häufigste psychische Komorbidität von Krebserkrankungen dar. Bisher fehlen kontrollierte Studien zur psychotherapeutischen Behandlung depressiver Begleiterkrankungen bei Krebspatienten. Die Studie soll die Wirksamkeit der manualisierten „supportivexpressiven psychodynamischen Kurzzeittherapie“ bei Brustkrebspatientinnen mit komorbider Depression untersuchen. Die Untersuchung ist eine kontrollierte, randomisierte prospektive Interventionsstudie. Die „Psychotherapiegruppe“ erhält eine – für Krebspatienten adaptierte – manualisierte psychodynamische Kurzzeittherapie nach Luborsky (Luborsky 2000, Beutel & Schwarz, in preparation). Im Rahmen des Vortrages wird das Studienkonzept kurz umrissen und die bisherigen Ergebnisse bzgl. der folgenden Hypothesen werden dargestellt: (1) Bei depressiven Brustkrebspatientinnen besteht unter psychodynamischer Kurzzeittherapie eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Remission der Depression als bei Patientinnen unter der „treatment as usual“-Bedingung. (2) Auch 6 Monate nach Therapieende besteht in der Psychotherapiegruppe eine geringere Rate der Depression und eine bessere Lebensqualität. (3) Der Behandlungserfolg durch die Psychotherapie ist bei anaklitischer größer als bei perfektionistischer Persönlichkeit. Schmerzen als Prädiktor für Depressivität und Angst bei Krebspatienten im Langzeitverlauf unter besonderer Berücksichtigung des sozialen Status 1 2 3 4 Mehnert A. , Leibbrand B. , Barth J. , Friedrich G. , 4 5 1 Bootsveld W. , Gärtner U. , Koch U. 1 Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52 - S35, 20246 Hamburg 2 Salzetalklinik 3 Rehabilitationsklinik Nordfriesland 4 Klinik Tecklenburger Land, Tecklenburg 5 Paracelsus-Klinik Am See, Dehneweg 6, 37581 Bad Gandersheim Hintergrund: Schmerz ist ein belastendes Symptom, unter dem Patienten aller Tumordiagnose- gruppen leiden. Bisher liegen kaum Studien zum Einfluss von Schmerz auf die psychische Belastung unter Berücksichtigung des sozialen Status vor. Methode: 1193 Patienten (85% Frauen, 58% Brustkrebs) nicht älter als 60 Jahre wurden zu Beginn (T0), am Ende (T1) und ein Jahr nach Krebsreha (T2) (n=883, 78%) befragt. Erfasst wurden u.a. Depressivität, Angst, Schmerzausmaß und intensität. Die Zeit seit aktueller Diagnose beträgt M=11 Monate (SD=9, 1-46). 37% der Patienten haben einen niedrigen, 53% einen mittleren und 10% einen hohen sozialen Status. Ergebnisse: Zu T0 leiden n=948 Patienten (80%) überhaupt und 25% unter starken Schmerzen. Zu T1 leiden 19,5% und zu T2 23% unter starken Schmerzen. Es zeigt sich eine Verbesserung der Schmerzen zwischen T0 – T1 (P=0.001, eta² =0.05), dagegen eine Zunahme zwischen T0 – T2 (P=0.03, eta² =0.008). Patienten mit niedrigerem sozialen Status haben ein höheres Ausmaß an Schmerzen (P<0,05, eta² >0.01), aber kein höheres Ausmaß an Angst oder Depressivität. Starke Schmerzen zu T1, Hautkrebs und der Krankheitsstatus stellen Prädiktoren für Depressivität zu T2 dar (R²=0,15). Für Angst stellen starke Schmerzen den einzigen Prädiktor in dem Modell dar (R²=0,09). Diskussion: Die Ergebnisse zeigen die hohe Prävalenz und die Bedeutung von Schmerzen für die psychische Belastung im Langzeitverlauf und verdeutlichen die Notwendigkeit einer besseren Schmerzkontrolle. S7: Mentalisation-Based Treatment (MBT) in der Gruppe – Besonderheiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen MBT, Gruppenanalyse und Psychoanalytisch-interaktioneller Methode Der Kopf ist rund, damit die Gedanken ihre Richtungändern können – Mentalisierungskonzept und Gruppe Bolm T. Klinikum Christophsbad, Göppingen, Postfach 840, 73008 Göppingen Wie können Menschen ohne sichere Bindungsgrundlage und/oder mit schweren Traumatisierungen einen spielerischen Umgang mit der Realität lernen? Sie haben allen Grund, äußeres Verhalten von den dazu gehörigen Bedürfnissen, Wünschen und Motiven getrennt zu halten. Gruppenpsychotherapie ist ein idealer Ort, um die Pluralität des Erlebens und die intersubjektive Konstruktion von Realität zu erfahren und entsprechende Repräsentanzen aufzubauen. Damit dies bei Patienten mit deutlichen strukturellen Defiziten und häufig auch Traumatisierungshintergrund gelingt, muss sich der Interventionsstil in der Gruppe darauf einstel- 32 len. Die Basisprinzipien der Mentalisierungsbasierten Therapie in der Gruppe werden vorgestellt. Mentalisierungsfördernde und -hemmende Interventionen in analytischer Gruppentherapie Schultz-Venrath U. Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Ferrenbergstr. 24, 51465 Bergisch-Gladbach Mentalisierungsgestützte (Mentalization-based treatment – MBT) und analytische Gruppenpsychotherapie sind wirksame Behandlungsmethoden für Patienten mit Persönlichkeitsstörungen. Mittels therapeutischem Zyklusmodell (TCM) von Fantao u. Mergenthaler (2002) werden an 15 transkribierten Videoaufnahmen von 45 slow-openGruppensitzungen (3 x Woche 90 min) die theoretischen und behandlungstechnischen Neuerungen durch MBT, aber auch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der therapeutischen Haltung, aber auch bezüglich der affektorientierten Interventionsstile zwischen mentalisierungsbasierter und analytischer Gruppenpsychotherapie dargestellt. Schließlich werden mentalisierungsfördernde versus mentalisierungshemmende Interventionen prototypisch mittels TCM und Textanalyse miteinander verglichen. Psychoanalytisch-interaktionelle Methode und MBT. Bolm T. Klinikum Christophsbad, Göppingen, Postfach 840, 73008 Göppingen Im Rahmen des Göttinger Modells sind seit Jahrzehnten behandlungstechnische Modifikationen der Einzel- und Gruppentherapie im Einsatz und evaluiert. Diese ermöglichen es Patienten mit schweren Strukturbeeinträchtigungen, im Therapeuten ein präsentes, „antwortendes“ Gegenüber zu finden, das aktiv und neugierig ist und verschiedene Sichtweisen der Realität befördert, gerade auch in der Gruppentherapie. Von der bewussten bzw. bewusstseinsnahen Ebene der Interaktion im Hier und Jetzt ausgehend werden die normativen Hintergründe und die Motive für Handeln erschlossen. In all diesen Punkten zeigen sich viele Gemeinsamkeiten mit MBT, umso interessanter ist es, dass MBT gerade bei der therapeutischen Feinabstimmung und im Umgang mit Traumafolgephänomenen neue Akzente einbringt. Psychodynamische Gruppenpsychotherapie Was wirkt bei schweren Persönlichkeitsstörungen? Strauß B. Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena, Stoystr. 3, 07740 Jena Die Gruppenpsychotherapieforschung der letzten Jahrzehnte hat sich mehr und mehr auf spezifische Störungen konzentriert, zu denen auch diverse Persönlichkeitsstörungen gehören. In der Regel werden manualisierte Therapieansätze systematisch auf ihre Effektivität überprüft und mit alternativen Gruppenansätzen oder Einzelpsychotherapie verglichen. Unter den Studien aus jüngster Zeit sind nur sehr wenige, die sich auf psychodynamische Anätze beziehen. Demgegenüber tragen Studien aus der psychodynamischen Gruppenforschung deutlich mehr zum Verständnis von Wirkmechanismen in Gruppen bei. Der Vortrag soll aufbauend auf einer Systematik zur Zusammenfassung von Effekten der Gruppentherapie darstellen, welche Entwicklungen und Ergebnisse speziell die Forschung zur Gruppenbehandlung bei schweren Persönlichkeitsstörungen erzielt hat. Die Übersicht zeigt, dass einige vielversprechende Verfahren nicht im Gruppenformat angewandt werden. Insbesondere die MBT ist dagegen als Gruppenbehandlung konzipiert und zunehmend auch empirisch validiert. Der Beitrag formuliert abschließend einige Desiderate für die künftige Forschung auf dem Feld. S8: Somatoforme Störungen gastrointestinaler Genese Kindliche Bauchschmerzen: Ergebnisse aus der KiGGS-Studie 1 1 2 1 Schwille I. D. , Giel K. E. , Ellert U. , Zipfel S. , 3 Enck P. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Tübingen, Osianderstr. 5, 72076 Tübingen 2 Robert Koch Institut, Berlin 3 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen, Silcherstraße 5, 72076 Tübingen Der bevölkerungsrepräsentative Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) des RobertKoch-Instituts schließt die bestehende Wissenslücke bezüglich Prävalenz und Charakteristika von kindlichen Bauchschmerzen. Untersuchung von Prävalenz, Schmerzcharakteristika und Inanspruchnahme des Gesundheitssystems mittels Elternfragebögen (EFB bei 3- bis 10-Jährigen, n=7544) und Kinderfragebögen (KBF bei 11- bis 17-Jährigen, n= 7697). Nach Ermittlung der Bauchschmerzprävalenz in der Gesamtstichprobe konzentrierte sich die Auswertung mittels χ2-Tests und univariaten Varianzanalysen auf eine Untergruppe von 2150 Befragten (Alter 9,18 ± 4,04, 33 53,7% weiblich), die Bauchschmerz als ihren Hauptschmerz angegeben hatten. Die Bauchschmerzprävalenz betrug 69,3% im EFB, 59,6% im KFB und sank mit dem Alter (p ≤ 0,001). Mädchen waren häufiger betroffen als Jungen (p ≤ 0,002). Im KFB hatten Migranten häufiger Bauchschmerzen als Nichtmigranten (66,9% vs 58,0%; p ≤ 0,001). Erstes Auftreten, Schmerzfrequenz und stärke wurden von Alter, Geschlecht, sozioökonomischem Status und Migrationshintergrund in komplexen Interaktionen beeinflusst. Zum Arzt gingen 51,6% im EFB und 38,5% im KFB, 22,6% bzw. 39,2% nahmen Medikamente. Hohe Prävalenz und starke Inanspruchnahme des Gesundheitssystems belegen die Bedeutung kindlicher Bauchschmerzen. Weiterhin zeigen die Ergebnisse eine komplexe Beeinflussung kindlicher Bauchschmerzen durch bio-psycho-soziale Faktoren. Affective Disturbances Modulate the Neural Processing of Visceral Pain Stimuli in Irritable Bowel Syndrome: An fMRI Study 1 1 Elsenbruch S. , Rosenberger C. , Schedlowski 1 2 2 M. , Forsting M. , Gizewski E. R. 1 Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Essen, Hufelandstraße 55, 45122 Essen 2 Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie, Universitätsklinikum Essen, Hufelandstr. 55, 45122 Essen Aim and methods: In N=15 female irritable bowel syndrome (IBS) patients and N=11 healthy women, we assessed the correlation of trait anxiety and depression, respectively, with the neural response to painful rectal distensions in women with irritable bowel syndrome (IBS) and healthy women. Trait anxiety and depression were assessed with the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Results: I.) Multiple regression analyses within the IBS group revealed that anxiety scores were significantly associated with pain-induced activation of the insular cortex (IC) and the anterior cingulate cortex (ACC). Depression scores were significantly correlated with pain-induced activation of the prefrontal cortex (PFC), somatosensory cortex (S1), and ACC. II.) Direct group comparisons with 2sample t-tests revealed significant activation in the IBS versus controls contrast in the anterior IC, thalamus, S1, dorsal posterior cingulate cortex (dPCC), and PFC. Inclusion of anxiety scores in the 2-sample t-tests as a confounding variable led to a loss of significant group differences with the exception of anterior IC activation. Inclusion of depression scores revealed activation of the thalamus and dPCC, but a loss of activation in other previously detected areas, i.e., IC, S1, PFC. Conclusions: These findings support previous evidence of altered central processing of visceral stimuli in IBS, and suggest that these may at least in part be mediated by affective disturbances. Reizdarmsyndrom– doch eine infektiöse Erkrankung ? 1 2 Otto B. , Enck P. 1 Medizinische Klinik - Innenstadt, Klinikum der Universität München (LMU), Ziemssenstr. 1, 80336 München 2 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen, Osianderstr. 5, 72076 Tübingen Neben viszeraler Hypersensibilität, gestörter Motilität und psychosozialen Faktoren als Ursachen für die Entstehung eines Reizdarmsyndroms (RDS) finden sich Hinweise auf ein postinfektiöses Geschehen: Studien auf der Basis von PatientenBefragungen ergaben, dass 5 bis 30% der Patienten mit RDS ihre Beschwerden mit einer vorausgegangenen bakteriellen Darminfektion in Verbindung setzen. Das postinfektiöse RDS wird in den ROME III Kriterien erstmals gesondert diskutiert. Wegweisend ist eine prospektive Studie aus Kanada, die das postinfektiöse RDS nach einer Trinkwasserverseuchung mit E.coli und Campylobacter im Rahmen der „Walkerton Health Study“ untersuchte: das Risiko nach der abgelaufenen Darminfektion Symptome ein RDS zu entwickeln war dreifach erhöht im Vergleich zum Kontrollkollektiv. Als Risikofaktoren gelten weibliches Geschlecht, ängstliche Persönlichkeit, Dauer der initialen gastrointestinalen Infektion, Invasivität des bakteriellen Keimes bzw. Komplikationen bei der initialen Infektion. Die Pathogenese des postinfektiösen RDS ist nicht eindeutig geklärt. Diskutiert werden derzeit persistierende subklinische Entzündungen der Darmschleimhaut, genetische Disposition, Abnormalitäten der Muskelfunktion nach abgelaufener Darminfektion, erhöhte Freisetzung von Mediatoren und Neurotransmittern. Das postinfektiöse RDS hat im Vergleich zum idiopatischen RDS eine bessere Prognose, die Patienten erholen sich innerhalb von 5 bis 6 Jahren. A model for examining the role of stress in functional gastrointestinal disorders. 1 2 2 3 Muth E. , Fishel S. R. , Davis T. A. , Enck P. 1 Abteilung Innere Medizin VI, PSychosomatische Medizuin und Psychotherapie, Osianderstr. 5, 72076 Tübingen 2 Privat 3 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen, Silcherstraße 5, 72076 Tübingen Stress likely plays a role in functional gastrointestinal (GI) disorders. However, a standard model for studying the effects of stress on the GI system does not exist. This study measured the effects of stress on the GI system by examining gastric emp- 34 tying (Tlag and T1/2), oral-cecal transit time (OCTT), small bowel transit time (SBTT) and gastric myoelectrical activity (normal 3 cpm and tachygastria) in response to illusory motion. Twenty subjects (10 M and 10 F, ages 18-28) were grouped based on whether they were motion sickness susceptible to a visual stimulus. Tlag and T1/2 were significantly longer for the susceptible compared to the non-susceptible group (50 vs. 24 mins and 124 vs. 73 mins, respectively). No significant differences were found for OCTT (106 vs. 106 mins) or SBTT (57 vs. 82 mins). Three cpm gastric myoelectrical activity showed no significant change, but tachygastria increased significantly in both groups. While gastric emptying was delayed in the susceptible group, OCTT was not, perhaps due to a not statistically difference in SBTT. Coupled with a comprehensive battery of non-invasive GI measures, motion sickness represents a potential model to study the effects of stress on the GI system. multiplen logistischen Regressionsanalysen signifikante Zusammenhänge zwischen psychosozialen Arbeitsbelastungen und den Indikatoren für gesundheitliche Beeinträchtigungen sowie "Personal Burnout". Nachhaltige Effektivität eines Stressbewältigungstrainings bei mittleren Führungskräften in einem Industriebetrieb - 1-Jahres-Ergebnisse einer randomisierten Interventionsstudie bei Männern mit erhöhtem Risiko 1 2 3 Gündel H. , Limm H. , Heinmüller M. , Marten2 3 Mittag B. , Angerer P. 1 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Str. 1,, 30625 Hannover 2 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, KLinikum rechts der Isar der TU München, langerstrasse 3, 81675 München 3 S9: Arbeitswelt und Gesundheit Psychosoziale Arbeitsbelastungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen bei chirurgisch tätigen Krankenhausärzten 1 1 1 von dem Knesebeck O. , Grosse Frie K. , Klein J. , 2 1 Blum K. , Siegrist J. 1 Institut für Medizin-Soziologie, Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg 2 Deutsches Krankenhausinstitut, Hansaallee 201, 40549 Düsseldorf Obwohl psychosoziale Arbeitsbelastungen im Hinblick auf den Arztberuf häufig diskutiert werden, gibt es nur wenige Studien, die generalisierbare Aussagen über das Ausmaß und die Folgen bei Krankenhausärzten in Deutschland zulassen. Anhand einer bundesweiten Querschnittsstudie wurden die psychosozialen Arbeitsbelastungen bei Krankenhausärzten ermittelt und der Zusammenhang zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen analysiert. Insgesamt wurden 1311 chirurgisch tätige Ärzte aus 489 Krankenhäusern mit einem standardisierten Erhebungsinstrument postalisch befragt (Antwortrate 65%). Psychosoziale Arbeitsbelastungen wurden gemäß dem Modell der beruflichen Gratifikationskrisen und dem AnforderungsKontroll-Modell erfasst. Als Indikatoren für gesundheitliche Beeinträchtigungen wurden die subjektive Gesundheit, krankheitsbedingte Fehlzeiten, Häufigkeit des Arbeitens trotz Krankheit und Unfälle bei der Arbeit herangezogen. Zusätzlich wurde der "Personal Burnout" anhand des "Copenhagen Burnout Inventory" erhoben. Die Ergebnisse zeigen hohe Arbeitsbelastungen bei den befragten Krankenhausärzten. Zudem zeigen sich bei den Institut und Poliklinik für Arbeits- und Umweltmedizin, Klinikum der Universität München, Ziemssenstr. 1, 80336 München Hintergrund: Ziel dieser randomisierten Studie war es, bei produktionsnahen Führungskräften aus der Industrie die Stressreaktivität mittels eines Stressbewältigungstrainings zu verbessern. Methodik: Im Rahmen eines allgemeinen Gesundheitsförderprogramms bestand die evaluierte Kernintervention aus einer arbeitsmedizinischen (1 DoSt) und einer verhaltensmedizinischen (7 DoSt) Komponente. 4 und 8 Monate nach der initialen Intervention fanden jeweils 2 Doppelstunden umfassende „Boostersitzungen“ statt. Als Hauptzielparameter wurde die Erfassung der subjektiven Stressreaktivität (SRS) gewählt. Ergebnisse: 174 Mitarbeiter (171 Männer, 3 Frauen, Alter 40,9 ± 7,78 Jahren) wurden in die Studie eingeschlossen, 154 (88,5%) nahmen an der Kontrolluntersuchung nach 1 Jahr teil. Die Interventionsgruppe bestand aus 75 Teilnehmern, die Wartekontrollgruppe aus 79 Personen. Der Gesamtscore des SRS konnte in beiden Gruppen gesenkt werden. Eine zweifaktorielle Varianzanalyse zeigte jedoch einen signifikanten Gruppeneffekt zugunsten der Interventionsgruppe [F(5.932) = 0.624; p = 0.016]. Auch bei den sekundären Zielparametern Depression, Angst und Effort-Reward Imbalance zeigten die Teilnehmer am Stressbewältigungstraining stärkere Verbesserungen. Keine Unterschiede konnten für die Cortisolreaktionen festgestellt werden. Schlussfolgerungen: Die nachhaltige Wirksamkeit eines betrieblichen Stressbewältigungstrainings konnte durch Veränderungen der subjektiven Stressreaktivität nachgewiesen werden. 35 Auswirkungen von erlebter Arbeitslosigkeit auf Wohlbefinden und psychische Störungen im Alter 1 1 2 Brähler E. , Stöbel-Richter Y. , Decker O. 1 Selbständige Abteilung für Medizinische Psychologie und Soziologie, Universität Leipzig, Philipp-RosenthalStraße 55, 04103 Leipzig 2 Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universität Leipzig, Leipzig, PhilippRosenthal-Straße 55, 04103 Leipzig Viele Studien in den letzten Jahren haben gezeigt, dass Arbeitslosigkeit mit erhöhten psychischen Störungen und mit einer Beeinträchtigung der Lebensqualität einhergeht. In der vorliegenden repräsentativen Studie wird erstmals überprüft, ob die erlebte Arbeitslosigkeit auch spätere Auswirkungen auf die Lebensqualität, Angst und Depression im Rentenalter hat. Überprüft werden weiterhin Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und die Resilienz und das Selbstkonzept im Gießen-Test. Die Stichprobe umfasst 1380 Rentner und Pensionäre, die in einer repräsentativen Befragung von 5000 Bundesbürgern im Jahr 2006 erhoben wurde. Die Ergebnisse belegen erhebliche Beeinträchtigungen bei den Rentnern und Pensionären, die mehrfach in ihrem Leben arbeitslos waren. Nicht geklärt werden kann im Rahmen dieser Untersuchung, ob nicht Personen mit Beeinträchtigungen im Leben eher mehrfach arbeitslos geworden sind. Gesundheitsfolgen von Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzunsicherheit. Ergebnisse der Sächsischen Längsschnittstudie 1 2 3 1 Berth H. , Förster P. , Brähler E. , Balck F. , Stö3 bel-Richter Y. 1 Medizinische Psychologie Universitätsklinikum Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 2 Forschungsstelle Sozialanalysen, Schweizerbogen 11, 04289 Leipzig 3 Selbständige Abteilung für Medizinische Psychologie und Soziologie, Universität Leipzig, Philipp-RosenthalStraße 55, 04103 Leipzig Einleitung: Die negativen Gesundheitsfolgen von Arbeitslosigkeit konnten in zahlreichen Studien gezeigt werden, jedoch gibt es kaum Längsschnittuntersuchungen zum Thema. Methoden: In der seit 1987 laufenden Sächsischen Längsschnittstudie (http://www.wiedervereinigung.de/sls) werden die körperlichen und psychischen Folgen von Arbeitslosigkeit mit verschiedenen Methoden intensiv untersucht. Studienteilnehmer sind Ostdeutsche (N > 400, 54 % Frauen, Alter 1987: 14, 2008: 35 Jahre). Ergebnisse: 2008 hatten 72 % der Teilnehmer bereits persönliche Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit. Arbeitslose wiesen ein deutlich schlechteres psychisches und körperliches Befinden auf. Dies schlägt sich jedoch nicht in einem subjektiv höhe- ren Bedürfnis nach professioneller psychischer Unterstützung nieder. Auch Arbeitsplatzunsicherheit führte zu einer signifikant höheren Belastung. Es zeigte sich weiterhin, dass ein reduziertes psychisches Befinden in früheren Erhebungen (1991) in Zusammenhang mit der insgesamt erlebten Arbeitslosigkeitsdauer im Jahre 2008 stand. Diskussion: Die Daten unterstreichen die bekannten Befunde über Arbeitslosigkeitsfolgen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass weniger gesunde Personen eher arbeitslos werden und es länger bleiben, als Gesündere. Insgesamt ist daher von einer Wechselwirkung im Sinne einer Verstärkung bzw. eines Teufelkreises auszugehen: Arbeitslosigkeit führt zu einer Befindensreduktion, die dann zu einer schlechteren Position auf dem Arbeitsmarkt führt. S10: SOPHO-NET: Verbundstudie zur Wirksamkeit psychodynamischer (SET) und verhaltenstherapeutischer (CBT) Kurztherapie der sozialen Phobie Methodendifferenzierung und Integration am Beispiel der SOPHO-NET- Studie Leichsenring F., Leibing E. Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Giessen, Paul-Meimberg-Str. 5, 35392 Giessen Im Rahmen der vom BMBF geförderten Verbundstudie zur Psychotherapie der sozialen Phobie (SOPHO-NET) werden gegenwärtig psychodynamische Kurzzeitherapie (STPP) und kognitive Verhaltenstherapie (CBT) in einer randomisierten kontrollierten multizentrischen Studie, die an den Universitäten Göttingen, Bochum/Dortmund, Mainz, Dresden und Jena durchgeführt wird, im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und Wirkmechanismen untersucht. Beide Therapien werden nach Manualen durchgeführt. Das Manual der CBT basiert auf dem Modell von Clark und Wells, das sich in verschiedenen Studien als wirksam erwiesen hat. Das Manual der STPP basiert auf der supportivexpressiven (SE) Therapie nach Luborsky, die spezifisch auf die Behandlung der sozialen Phobie zugeschnitten worden ist. Beide Behandlungen umfassen bis zu 30 Therapiesitzungen. Zentral für das STPP Manual ist die Fokalisierung auf das ZBKT, das den sozialphobischen Symptomen zugrunde liegt. Darüber hinaus umfasst es verschiedene für die Behandlung der sozialen Phobie spezifische Elemente wie z.B. die - bereits von Freud empfohlene - Aufforderung zur Selbstexposition oder die Etablierung eines ermutigenden inneren Dialogs. Anders als in der CBT werden diese Elemente jedoch auf einem psychodynamischen Hintergrund angewendet und interpretiert. Ein Ziel der Therapiestudie ist es herauszufinden, welche Patienten von welcher Behandlung am besten profitieren. 36 1 Werner-Schwidder-Klinik, Krankenhaus für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, HerbertHellmann-Allee 38, 79189 Bad Krozingen S11: Psychotherapieforschung im stationären Rahmen Die Vorhersage ungünstiger Behandlungsverläufe bei stationärer psychotherapeutischer Behandlung mit Prädiktoren vom Beginn der Behandlung und aus der vierten Behandlungswoche 1 1 Donaubauer B. , Wilmers F. , Fernbach2 1 Fahrensbach A. , Herzog T. 1 Werner-Schwidder-Klinik, Krankenhaus für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, HerbertHellmann-Allee 38, 79189 Bad Krozingen 2 Universität Freiburg, Fakultät für Psychologie, Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie Freiburg Trotz intensiver Bemühungen scheinen einige (5% bis 15%) Patienten von stationärer Psychotherapie gar nicht oder wenig zu profitieren. Es ist wichtig, nicht erfolgreiche Behandlungsverläufe frühzeitig zu erkennen. Die bisherigen Forschungsbefunde zur Vorhersage basieren zumeist auf Ausgangsmerkmalen der Patienten. Die Ergebnisse sind inkonsistent und zeigen eine eher geringe prognostische Validität der erhobenen Merkmale. In der vorliegenden Untersuchung (n>1000) wurden zum Einen aggregierte Ausgangsmerkmale für die Regressionsgleichungen verwendet. Zum Anderen wurden Prozessdaten der routinemäßigen Zwischenuntersuchung in der vierten Woche der Therapie hinzugenommen. Mit Hilfe multipler und logistischer Regressionen wurden die Variablen auf ihren prädiktiven Wert für ungünstige Therapieergebnisse untersucht. Zu Beginn der Behandlung sind vor allem die Motivation der Patienten, ein Risikoindex (der z. B. Arbeits- und Partnerlosigkeit enthält) sowie die aggregierte Ausgangsbelastung (u. a. Symptomatik und Komorbidität) von Vorhersagewert. Die in der 4. Behandlungswoche erhobenen Daten (z. B. der HAQ) erhöhen erwartungsgemäß die Richtigkeit der Zuordnung der Patienten zur Gruppe der „NonResponder“. Mit den Daten von diesem Zeitpunkt ließ sich ein großer Anteil (75%) der etwa 4% ausmachenden „Non-Responder“ identifizieren. 81% der anderen Patienten wurden korrekt klassifiziert. Wegen der geringen Häufigkeit von „Misserfolg“ resultieren allerdings einige „falsch positive“. Die Beurteilung offener und geschlossener Gruppen: Eine quasi-experimentelle Untersuchung von Körperpsychotherapie-Gruppen im Rahmen von stationärer Psychotherapie 1 2 1 Wilmers F. , Pötter C. , Herzog T. 2 Universität Freiburg, Fakultät für Psychologie, Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie Freiburg Körperpsychotherapie in offenen Gruppen ist in fast allen Einrichtungen für stationäre Psychotherapie zu finden. Systematische Evaluation zeigt für unsere Klinik eine sehr positive Bewertung durch die Patienten. Diese Gruppen waren aber auch häufiges Ziel berechtigter Kritik. Bei knappen Ressourcen wurde vor allem die meist lange Wartezeit auf den Beginn bemängelt. Gleichzeitig sahen die Therapeutinnen in dem ständigen Wechsel der Patienten einen hemmenden Faktor für die Entwicklung einer konstruktiven Gruppendynamik. Sie entwickelten einen Vorschlag zur Konzeptverbesserung ohne zusätzlichen Aufwand von Personal: Ein geschlossenes zeitlich kontingentiertes Gruppenkonzept. Alle in einer Woche aufgenommen Patienten kamen rasch in eine geschlossene Gruppe und arbeiteten dort für 10 Sitzungen (5 Wo.) gemeinsam. Ein Vergleich der Evaluationsdaten zeigt Folgendes: Hinsichtlich der gefühlten Wartezeit, gemessen über die Anzahl der Beschwerden, zeigte sich eine sehr deutliche Verbesserung. Andererseits empfanden die Patienten die Beendigung der Gruppe, die meist vor dem Ende des stationären Aufenthalts kam, als ungünstig. Insgesamt äußerten die Patienten aber nur etwa halb so viel Kritik wie vor der Änderung. Durch das geschlossene Setting erhielten die Patienten im Mittel etwas weniger Therapiestunden. Die subjektive Effektivität zeigte sich nicht verändert. Es gab auch keine deutlichen Hinweise auf ein verändertes Erleben („Hilfe und Einsicht“ bzw. „Belastung“) in den Gruppen. 1-Jahreskatamnese stationärer Rehabilitation bei Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung 1 2 3 Mestel R. , Waschkowski S. , Wiedmaier N. , von 1 Wahlert J. 1 HELIOS Klinik Bad Grönenbach, Seb. Kneipp Allee 3a/5, 87730 Bad Grönenbach 2 Universität Osnabrück, 08/Gesundheitswissenschaften, Albrechtstraße 49069 Osnabrück FB 28, 3 Universität Koblenz-Landau, Psychologische Fakultät, Universitätsstr. 1, 56070 Koblenz Zur Ermittlung des mittelfristigen Therapieerfolgs wurde eine Jahreskohorte aller 197 Patienten mit Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS; 42% hatte die PTBS als Hauptdiagnose) ein Jahr nach stationärer psychosomatischer Rehabilitation mittels Breitbandtests (SCL-90-R, IIP, VEV-K etc.) und störungsspezifischer Fragebogen (IES-R, FDS-20 etc.) angeschrieben (Rücklaufquote: 45,2%). Die Antworter waren weitgehend reprä- 37 sentativ für die Gesamtgruppe. Traumaspezifische Behandlung: 29% nahmen an der TraumaFrauengruppe teil, 88% an Stabilisierungsübungen, 27% erhielten traumaspezifische Einzelsitzungen und 14% Traumabearbeitungsverfahren (EMDR oder VT). Es ergaben sich mittlere Effektstärken für die Breitbandskalen und kleine Effekte für Vermeidung, Übererregung und Dissoziationsneigung. Bei den Intrusionen wurden weniger Erfolge erreicht. Die Klinikangebote wurden post hoc wie folgt bewertet: Hilfreich fanden 54% die Frauengruppe, 52% die Stabilisierung, 67% die Trauma-Einzelgespräche mit aktiver Traumakonfrontation und 57% die Einzelgespräche ohne Konfrontation. Folgende Selbsthilfestrategien wurden etwas oder sehr hilfreich zur Überwindung der negativen Folgen de Traumas beurteilt: 92% bewusst mit Freunden/Partner über das Trauma sprechen; 91% Stabilisierungsübungen, 84% Entspannungsverfahren; 78% bewusste Ablenkung vom Trauma; 78% Selbsthilfebücher lesen; 70% gezielte Traumakonfrontation in vivo ohne therapeutische Begleitung; 45% Meditationstechniken. Ergebnisse der multizentrischen 1-Jahres Katamnese stationärer, psychosomatischer Akutversorgung im Rahmen des IQP-Projekts 1 1 1 Probst T. , Tritt K. , von Heymann F. , von Hey2 mann F. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin, Klinikum der Universität Regensburg, Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg 2 Institut für Qualitätsentwicklung in der Psychotherapie und Psychosomatik, Werdenfelsstr. 81, 81377 München In diesem Beitrag sollen Ergebnisse einer ersten diagnoseübergreifenden multizentrischen Katamnesestudie zu stationären psychosomatischen Krankenhausbehandlungen der Routineversorgung präsentiert werden. Diese Versorgungsstudie beruht auf einem Ein-Gruppen-Prä-Post Design mit den drei Messzeitpunkten Aufnahme, Entlassung und Katamnese. Die Katamnese wurde postalisch ein Jahr nach Entlassung realisiert. Es nahmen sechs Kliniken und N = 935 Patienten an der Studie teil. Als Basisdokumentationssystem kam in diesen sechs beteiligten Kliniken die Psy-BaDoPTM (Heymann, 2003) zum Einsatz. Als Ergebniskriterium wurde die Veränderung im Globalen Schwere Index (GSI) der SCL-90-R (Franke, 2002) zwischen den drei Messzeitpunkten varianzanalytisch geprüft. Dabei zeigte sich eine signifikante Veränderung (p<0.01) im GSI von Aufnahme (M=1.20; SD=0.68) zu Entlassung (M=0.67; SD=0.58) sowie zu 1-Jahreskatamnese (M=0.83; SD=0.68). Um zu prüfen, ob der GSI der Patienten von Aufnahme zu Entlassung sowie von Aufnahme zu 1-Jahreskatamnese statistisch bedeutsam abnimmt, wurden im Rahmen der Varianzanalyse mit Messwiederholung einfache Kontraste gerechnet. Diese Kontraste zeigen signifikante Verbesserun- gen im GSI von Aufnahme zu Entlassung (p<0.01; ES=0.78) sowie von Aufnahme zu 1Jahreskatamnese (p<0.01; ES=0.54). S12: Gehemmtes versus unterbrochenes Handeln – zur Weiterentwicklung der klassischen Psychosomatik in der Psychodynamik psychischer Traumatisierung Gehemmtes vs. unterbrochenes Handeln– zur Weiterentwicklung der klassischen Psychosomatik in der Psychodynamik psychischer Traumatisierung Fischer G. Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie der Universiät zu Köln, Höninger Weg 115, 50969 Köln In der psychodynamischen Theorie zur Psychosomatik wird das Symptom als "pathologische Endstrecke" eines Krankheitsprozesses betrachtet, welcher der Symptombildung voraus- und zugrunde liegt. Findet entsprechend dem modernen dialektisch-ökologischen Denken der ätiopathogenetische Kontext eines Krankheitsbildes Berücksichtigung, dann ergibt sich ein polyätiologisches Modell aus Übersozialisation (gehemmte Handlung), Untersozialisation (enthemmte Handlung), psychischer Traumatisierung (unterbrochene Handlung) und biologischen Faktoren angeborener oder in der Epigenetik erworbener Art. All diese Faktoren können nosologisch zum gleichen Symptombild führen, müssen aber für Zwecke der Forschung, Prävention und Therapie unterschieden werden (ätiologische Differenzierung bei symptomatischer Äquivalenz). So ergibt sich eine Erweiterung von Psychotherapiewissenschaft und psychosomatischer Medizin um die Dimension einer kausalen, ätiologieorientierten Diagnostik und Therapie. Die Darstellung von Opfern und Tätern von Gewaltverbrechen in öffentlichen Medien Eichenberg C. Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie der Universiät zu Köln, Höninger Weg 115, 50969 Köln Bei der indirekten Konfrontation mit traumatischen Ereignissen werden nach Fischer & Riedesser (2003) psychotraumatologische Abwehrstrategien angewendet, um die Bedrohung des sicheren Selbst- und Weltverständnisses abzuwenden. Es ist nahe liegend zu vermuten, dass diese Abwehrstrategien auch von Journalisten verwendet werden und sich in der Berichterstattung über Gewaltverbrechen nachweisen lassen. Über einen Zeitraum von 1 Monat wurden aus 5 deutschen Zeitungen alle publizierten Gewaltartikel (N = 209) in- 38 haltsanalytisch ausgewertet. Anschließend wurde experimentell mit N = 72 Personen untersucht, ob sich durch die Darstellungsweise eines Gewaltartikels unter Verwendung von Abwehrstrategien die Einstellung der Leser gegenüber Tätern und Opfern verändert. In der inhaltsanalytischen Untersuchung konnte die Anwendung von psychotraumatologischen Abwehrstrategien bestätigt werden. Ebenso konnten in der experimentellen Studie eindeutige sowie tendenzielle Veränderungen zu der zuvor erhobenen Einstellung gegenüber Tätern und Opfern von Gewaltverbrechen nachgewiesen werden. Somit wurde bestätigt, dass sich die Rezipienten in ihrem Urteil über andere aufgrund der Verwendung von Abwehrstrategien in Printmedien beeinflussen lassen. Aus den Befunden wird der Schluss gezogen, dass es aufgrund der negativen Konsequenzen durch die Verwendung von Abwehrstrategien wünschenswert wäre, dass Journalisten bestimmte Kriterien bei der Berichterstattung über Gewaltverbrechen berücksichtigen. Vom Opfer zum Täter? Mögliche Entsprechungen zwischen traumatischer Erfahrung und Tatprofil bei Gewaltstraftätern Orth A., Klein A., Eichenberg C., Fischer G. Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie der Universiät zu Köln, Höninger Weg 115, 50969 Köln Einleitung: Das „Warum?“ einer schweren Gewaltstraftat spielt neben dem öffentlichen Interesse auch eine Rolle bei der Erstellung eines Täterprofils zur Fahndung sowie im Zusammenhang mit der Strafzumessung. Unter psychotraumatologischen Gesichtspunkten kann eine Gewalttat als Ausdruck einer Reinszenierung im traumatischen Prozess angesehen werden. Methode: Mittels Vortests zu körperlichen u. traumatischen Belastungen u. der Erfassung dissoziativen Erlebens wurden je 10 männliche u. weibliche Inhaftierte selektiert u. durch ein halbstrukturiertes Interview zu ihrer (Trauma-)Biografie u. ihrer Straftat befragt. Die Stichprobenzusammensetzung beinhaltete Pbn mit PTBS, Pbn mit hoher Neigung zu dissoziativer Verarbeitung sowie unbelastete Pbn. Das Interviewmaterial wurde inhaltsanalytisch nach der Methode nach Miles & Huberman ausgewertet mit Hauptfokus auf den Vergleich zw. den erlebten traumatischen Situationen u. den Details der eigenen Tat. Ergebnisse:Es zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den (frühkindlich) traumatisierten u. den nicht-traumatisierten Tätern. Traumatisierte Straftäter wiederholen szenisch Details der eigenen traumatischen Erfahrungen, wobei sich Aspekte des peritraumatischen Erlebens abbilden. Diskussion:In der Prävention stetig wiederholter Reinszenierungen eigener traumatischer Erfahrungen (u. damit Schutz potenzieller Opfer) ist sowohl das psychotraumatologisch orientierte Profiling wie Behandlung schwerer Gewaltstraftäter ein fehlender Baustein. S13: Wiederkehr des Verdrängten: Die naturwissenschaftliche Psychosomatik Thure von Uexkülls 'Theorie der Humanmedizin' im Lichte der Interpretationsphilosophie H. Lenks und G. Abels Leiß O. Gastroenerologische platz 2, 55116 Mainz Gemeinschaftspraxis, Bahnhof- Von Uexkülls / Wesiaks ‚Theorie der Humanmedizin’ erschien 1988. Zeitgleich haben H. Lenk und G. Abel die Erstentwürfe ihrer Interpretationsphilosophie in der ‚Allgemeinen Zeitschrift für Philosophie’ publiziert. Es wird versucht, die bisher isoliert und ohne Kenntnis voneinander dastehenden Konzepte einer ärztlichen Semiotik und aktuelle Entwicklungen der Zeichen- und Interpretationsphilosophie miteinander in Kontakt, Austausch und Weiter-entwicklung zu bringen. An den Beispielen des Zeichen- und Interpretationsverständnisses, den Ebenen der Inter-pretation (von Biosemiotik bis Philosophie des Geistes) und einer Deutung klinischer Symptome als Interpretations-konstrukte werden Gemeinsamkeiten, Differenzen und Nuancierungen dargestellt. Abel betont, dass Zeichen keine Stellvertreterfunktion haben; er spricht von drehtürartiger Verschränkung von Wirklichkeit und Interpretation. Dies ist identisch mit von Uexkülls Vorstellungen zum Situationskreis, der bildlich-metaphorisch als Drehtür darstellbar ist. Die Interpretationsphilosophie verzichtet auf Wahrheitsaussagen und Dogmen, Wahrheit wird als ‚gültiges Passen’ interpretiert. Die ethischen Implikationen der Interpretationsphilosophie gehen mit der von von Uexküll / Wesiak eingeforderten Verantwortung des Arztes parallel. Die ärztliche Inter-pretation muss grundsätzlich offen und in der Lebenswelt des Patienten verankert sein. Sie verzichtet auf Wahrheit, intendiert Passung und beschränkt sich auf ‚Verbindlichkeit auf Zeit’. Die Folgen der von der gegenwärtigen Psychosomatik und Psychotherapie eingesetzten Erkenntnismittel und Forschungsmethoden 1 2 Schmitz-Weiss M. M. , Kettler R. 1 Praxis für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, In der Sürst 3, 53111 Bonn 2 Privatklinik Dr. Kettler, Kaiserdamm 26, 14057 BerlinCharlottenburg 1 Erkenntnismittel: Insofern Psychosomatik und Psychotherapie - wie alle Fachgebiete der Medizin - ihr Vorgehen ableiten aus der empirisch gewonnenen Sammlung von Daten, erschöpft sich ihr 39 Wissen und dessen Konsequenzen in der scheinbar bloßen Feststellung vorhandener einzelner Sachverhalte oder in der Feststellung abstrakter Allgemeinheit von Sachverhalten, also einer Allgemeinheit als bloßem Gedanken-„Ding“. Allgemeinheit als in der Tat bestehende Realität kann auf der Grundlage empirisch-induktiver Verfahren nicht zur Kenntnis genommen werden. 2 Folgen: Die Stellung der Individuen ist damit lediglich als eine der Konkurrenz und Rivalität zu denken. Objektive Gemeinsamkeit, damit auch deren innere Gewissheit, sind nicht denkbar. Damit entfällt die Möglichkeit der sich darauf berufenden Einsicht, somit auch Vertrauen, Bündnis und daraus resultierende Veränderung. Ebenso ist jede mögliche Zielsetzung, kraft dieser Mittel der Erkenntnis, aus der Behandlungspraxis ausgeschlossen. Denn durch die selbstgewählten Erkenntnismittel entsteht aktiv herbeigeführte Passivität. Die Identität des Arztes befindet sich in der Zerreißprobe, in der Behandlung herbeizuführen, was er in Gedanken ungeschehen gemacht hat. Die gegenwärtige Psychosomatik und Psychotherapie verabschiedet damit methodisch, was sie praktisch erstrebt. Das „bio-psycho-soziale Modell“ fügt sicht lückenlos in die naturwissenschaftliche Medizin ein, die von ihm bestimmte Psychosomatik befindet sich im Irrtum über sich selbst. S14: Adipositas Essverhalten und Eltern-Kind-Interaktionen bei Kindern mit Essanfällen: Eine laborexperimentelle Testmahlzeitenstudie Hilbert A., Czaja J. Fachbereich Psychologie, Philipps-Universität Marburg Ziel der vorliegenden Studie ist eine objektive laborexperimentelle Untersuchung des Essverhaltens im Kontext von Eltern-Kind-Interaktionen bei Kindern mit versus ohne Essanfälle. Insgesamt 120 8-13jährige Kinder mit und ohne Essanfälle wurden populationsbasiert für die Studie rekrutiert. Nach einer Induktion negativer versus neutraler Stimmung durch eine Eltern-KindInteraktionsaufgabe wurde mit den Eltern-KindDyaden eine Standard-Abendmahlzeit durchgeführt, gefolgt von einer Phase des freien Essens, bei der dem Kind allein Snack Food angeboten wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder mit Essanfällen, unabhängig von der Stimmungsinduktion, insgesamt eine energiereichere und kohlenhydratreichere Nahrung zu sich nahmen als Kinder ohne Essanfälle, und zwar besonders während des freien Essens. Nach negativer Interaktion war die Bissgröße der Kinder mit Essanfällen größer als nach neutraler Interaktion. Prädiktoren einer größeren Nahrungsaufnahme während des freien Essens waren ein stärkerer situativer Hunger, mehr Kontrollverlusterleben, eine negativere Stimmung, restriktivere Ernährungspraktiken und mehr kritische Kommentare über Figur und Gewicht seitens der Eltern. Die Ergebnisse demonstrieren objektiv Überessenstendenzen von Kindern mit Essanfällen, die durch individuelle biopsychologische Eigenschaften und Merkmale der ElternKind-Interaktion beeinflusst werden, und leisten damit einen Beitrag zur Konstruktvalidität dieser Symptomatik im Kindesalter. Depression und Lebensqualität im Zusammenhang mit dem Gewichtsverlauf 4 Jahre nach konservativer und chirurgischer Adipositasbehandlung Legenbauer T., Herpertz S. Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie; LWL Klinik Dortmund, Universitätsklinikum der Ruhr Universität Bochum, Marsbruchstr. 179, 44287 Dortmund Untersucht wurde der Gewichtsverlauf adipöser Menschen in drei verschiedenen Stichproben über vier Jahre im Zusammenhang mit der Ausprägung depressiver Symptome und der Lebensqualität. Initial wurden 532 Personen eingeschlossen (konservative Adipositasbehandlung (KONV): n=251, Adipositaschirurgie (CHIR): n=151, keine Gewichtsreduktionsmaßnahme (KG): n=129). Lebensqualität (SF-36) und depressive Symptome (HADS-D) wurden zu Behandlungsbeginn (T1), nach einem (T2), zwei (T3) und vier Jahren (T4) erfasst. Die Dropout-Rate betrug nach vier Jahren 33,8%. Bei CHIR-Patienten sank der BMI von 50,2 auf 38,8kg/m² (-22,7%); während KONV-Probanden nach einer signifikanten Gewichtsreduktion im ersten Jahr bis T4 wieder ihr Ausgangsgewicht erreichten. Das körperliche Wohlbefinden (SF-36) besserte sich nur bei CHIR signifikant. Ausschliesslich CHIR-Patienten mit klinisch relevanten Depressionswerten (HADS-D >10) zu T1 erreichten eine klinisch signifikante Verbesserung. Das Ausmaß der Gewichtsabnahme korrelierte zu allen drei Follow-up-Messungen mit der Verbesserung des körperlichen Wohlbefindens und der Reduktion der Depressionswerte. Eine substanzielle Gewichtsabnahme wie sie durch adipositaschirurgische Maßnahmen erreicht wird, verbessert das körperliche Wohlbefinden und klinisch relevante depressive Symptome, was bei der Mehrzahl adipöser Menschen mit Wunsch nach Gewichtsreduktion auf „state“- und weniger auf „trait“-Merkmale depressiver Symptome bei Adipositas verweist. Gewichtsreduktion bei Teilnehmern einer strukturierten Gruppenintervention - welche Faktoren beeinflussen den Interventionserfolg? 1 1 1 2 Giel K. , Binkele M. , Becker S. , Stübler P. , Zipfel 1 1 1 S. , Zipfel S. , Enck P. 40 1 Abt. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Klinik, Universitätsklinikum Tübingen, Osianderstr 5, 72076 Tübingen 2 Privatpraxis Mannheim Hintergrund: Der Behandlungsoutcome bei Teilnehmern eines strukturierten ambulanten Gruppenprogramms zur Gewichtsreduktion wurde untersucht sowie Faktoren identifiziert, die mit erfolgreicher Gewichtsreduktion einhergingen. Behandlung: Die Gruppenintervention umfasst Module zu Ernährung und Bewegung sowie verhaltenstherapeutische Elemente und wird im ambulanten Setting von einem multidisziplinären Team angeboten. Methoden: Demographische und somatische DAtenn sowie Gewichtsverläufe von 177 Kursteilnehmern (145 Frauen, 45,48 ± 12,21 Jahre, BMI: 36.67 ± 5.57 kg/m²) aus 24 abgeschlossenen Interventionsgruppen wurden analysiert. Ergebnisse: Ein signifikanter Gewichtsverlust von durchschnittlich 5,55 ± 7,88 kg wurde erreicht. Dabei stellte sich der spezifische Kurs, der besucht wurde, die prozentuale Anwesenheit des Patienten im Kurs sowie die Interaktion Kurs x Anwesenheit als besonders einflussreich für die erzielte Gewichtsabnahme heraus. Fazit: Adipositas-Patienten konnten nach einer multimodalen Gruppenintervention 5% ihres Ausgangsgewichtes reduzieren, wobei bestimmte Subgruppen von Patienten stärker im Hinblick auf das Zielkriterium der Gewichtsabnahme profitiert haben. Situative Variablen wie Aspekte des jeweiligen Gewichtsabnahmekurses selbst sowie die Häufigkeit der Anwesenheit spielen eine kritische Rolle für den Therapieerfolg und sollten bei Planung und Durchführung ähnlicher Trainingsprogramme stärker berücksichtigt werden. Erfolgreicher und anhaltender Gewichtsverlust in einer repräsentativen Stichprobe der Deutschen Allgemeinbevölkerung 1 2 3 4 de Zwaan M. , Herpertz S. , Hilbert A. , Zipfel S. , 5 6 1 Beutel M. , Gefeller O. , Mühlhans B. Gewichtserhalt ("weight loss maintenance") ist jedoch in klinischen Gruppen nur bei einer Minderheit der Patienten erfolgreich. In einer bevölkerungsbasierten repräsentativen Stichprobe (n=957) wurde die Häufigkeit einer erfolgreichen Gewichtsstabilisierung nach Gewichtsverlust erhoben. Als erfolgreiche Gewichtsstabilisierung wurde ein über zumindest ein Jahr gehaltener Gewichtsverlust von zumindest 10% des maximalen Gewichts definiert. Jene Teilnehmer, die zum Zeitpunkt ihres Maximalgewichtes übergewichtig oder adipös waren gaben zu 17,7% an, dass sie seit mindestens einem Jahr 10% weniger wiegen würden als zum Zeitpunkt ihres Maximalgewichtes. Die Zahl steigt auf 29,7% bei jenen Teilnehmern, deren Maximalgewicht im adipösen Bereich lag (BMI>30). Prädiktoren für eine erfolgreiche Gewichtsstabilisierung waren jüngeres Alter, weibliches Geschlecht und ein höherer maximaler Lebenszeit BMI. Die Resultate machen deutlich, dass eine erfolgreiche Gewichtsstabilisierung in der Allgemeinbevölkerung häufiger vorzukommen scheint als man nach den Langzeitergebnissen klinischer Gewichtsreduktions-Studien erwarten würde. Im Rahmen des Kompetenznetz Adipositas wird sich eine Registerstudie mit den Strategien beschäftigen, die Menschen in der Allgemeinbevölkerung eine erfolgreiche Gewichtsstabilisierung nach Gewichtsverlust ermöglichen. S15: Symposium II der Arbeitsgruppe Bindungsforschung: Einfluss der Bindungsrepräsentation auf psychotherapeutische Prozesse 1 Passung der Therapeuten-PatientenBindungsrepräsentation im Kontext der therapeutischen Allianz? 1 1 2 Petrowski K. , Herold U. , Buchheim A. , Jorasch3 ky P. 2 Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden Abt. für Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin, Universität Erlangen, Schwabachanlage 6, 91054 Erlangen Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie; LWL Klinik Dortmund, Universitätsklinikum der Ruhr Universität Bochum, Marsbruchstr. 179, 44287 Dortmund 3 Fachbereich Psychologie, Philipps-Universität Marburg 4 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen, Silcherstraße 5, 72076 Tübingen 5 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz 6 Institut für Medizinische Statistk und Epidemiologie, Kurzfristige Gewichtsreduktion kann mit verschiedenen Methoden erreicht werden, der langfristige 1 2 Institut für Psychologie, Universität Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Österreich 3 Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden Die therapeutische Beziehung stellt einen starken Prädiktor des Therapieerfolges dar. Basierend auf der klassischen Bindungstheorie wird die therapeutische Allianz als eine Form der Bindungsbeziehung diskutiert, die von beiden Seiten gleichermaßen beeinflusst werden kann. Daher wurde bei stationären Psychotherapiepatienten mit der Hauptdiagnose Angst zu Therapiebeginn und – ende die Symptomschwere und Therapiezielerrei- 41 chung erhoben. Ferner wurden für Therapeut und Patient die Bindungsrepräsentationen mittels Adult Attachment Interview erhoben. Die Bindungsrepräsentation des Therapeuten steht in engem Zusammenhang zur therapeutischen Allianz und zum Therapieerfolg. Allerdings besteht kein Zusammenhang zwischen der Bindungsrepräsentation des Therapeuten und der vom Patienten erlebten therapeutischen Allianz. Darüber hinaus wurde die Passung zwischen Patient und Therapeut in ihren Bindungsrepräsentationen berechnet. Diese Bindungspassung erklärte dann einen signifikanten Anteil der therapeutischen Allianz. Basierend auf diesen Ergebnissen ist zu diskutieren, ob eine Zuweisung von Patienten zu den Therapeuten je nach Ausprägung sinnvoll ist. Therapeut-Patient-Bindungsstil im Kontext von therapeutischer Allianz und Therapieerfolg 1 1 1 Herold U. , Petrowski K. , Petrowski K. , Buchheim 3 1 A. , Joraschky P. 1 Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden 2 Institut für Psychologie, Universität Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Österreich Im Rahmen der Psychotherapieforschung hat die Betrachtung des Therapieerfolgs unter Berücksichtigung von Bindungsstrukturen von Therapeut und Patient zunehmend an Interesse gewonnen. Die Bindungskategorien sicher und unsicher beim Patienten sowie die therapeutische Allianz wirken sich direkt auf den Therapieerfolg aus. Betrachtet man den Behandlungserfolg vor dem Hintergrund systemtheoretischer und interaktioneller Modelle ist es zwingend erforderlich, nicht nur Patientenbindungsstrukturen sondern auch die des Therapeuten sowie der Therapeut-PatientBeziehung/Bindung mit einzubeziehen. Dazu wurden bei stationären Psychotherapiepatienten mit einer Angststörung als Hauptdiagnose zu Therapiebeginn die Symptomschwere (SCL-90, KÖPS) und für Therapeut und Patient der Bindungsstil durch BBE und BFKE erhoben. Zu Therapieende wurden die Symptomschwere und der CATS- sowie der HAQ-Fragebogen erhoben. Erste Untersuchungsergebnisse weisen auf hohe Korrelationen zwischen Beziehungs- und Erfolgszufriedenheit bei Patienten und Therapeuten hin. Dagegen zeigten sich positive, aber eher niedrige Korrelationen zwischen Patienten- und Therapeuteneinschätzungen. Weiterhin lässt sich anhand der Daten zeigen, dass ein sicherer Bindungsstil zum Therapeuten zur Symptomreduktion und damit zum Therapieerfolg beiträgt. Basierend auf den Pilotdaten kann postuliert werden, dass ein Zusammenhang zwischen der Bindungspassung bei Therapeut und Patient und dem Therapieerfolg besteht. Zusammenhänge zwischen Bindungsstatus, kognitiv-emotionalem Entwicklungsstand und Therapieerfolg bei symptomzentrierten Kurzzeitinterventionen bei Panikstörungen Subic-Wrana C. Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz Im Rahmen eines RCTs werden 50 Patienten mit Panikstörungen einer psychodynamischen oder einer kognitiv-behavioralen Kurzzeitpsychotherapie zugewiesen; beide Therapien sind manualisiert und arbeiteten symptomzentriert; Zielkriterium ist die Verringerung der Paniksymptomatik. Um der Frage nachzugehen, ob Bindungsstatus und kognitiv-emotionaler Entwicklungsstand Einfluss auf das Behandlungsergebnis haben, werden diese Persönlichkeitseigenschaften bei Behandlungsbeginn und Behandlungsende erfasst. Der Bindungsstatus wurde mit dem Adult Attachment Picture System (AAP), der kognitiv-emotionale Entwicklungsstand mit der Levels of Emotional Awareness Scale (LEAS) untersucht. Der AAP erfasst im Gegensatz zur Selbstbeschreibung im Fragebogen auch nicht bewusst repräsentierte Bindungsmuster. Inzwischen liegen für 30 Patienten die Daten der Eingangsdiagnostik wie der Diagnostik bei Behandlungsende vor. An dieser Teilstichprobe soll untersucht werden, a) ob Bindungsstatus und kognitivemotionaler Entwicklungsstand jeweils unabhängig voneinander Einfluss auf das Behandlungsergebnis haben, b) ob sich dieser Einfluss in Abhängigkeit vom Behandlungsverfahren unterscheidet, c) ob sich eine Interaktion zwischen Bindungsstatus und Behandlungsergebnis findet und welche Auswirkung diese auf das Behandlungsergebnis hat. Die Ergebnisse der geplanten Zwischenauswertung sollen im Rahmen eines Symposiums zu Bindungsmuster – gemessen mit dem AAP – und Angststörungen vorgestellt werden. Attachment characteristics as differential predictors of treatment outcome in patients with social phobia de Liz T. M., Strauß B. Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie, Stoystr. 3, 07743 Jena This study is based on a partial sample of patients (n = 128) from the main A1 study on therapy comparison (short-term psychodynamic psychotherapy and cognitive behavioural therapy), and will focus on differential treatment indication based upon attachment variables. Emphasis will be placed on the predictive quality of these variables for treatment outcome. Interactions between patient characteristics and outcome in the two different treatment models of the clinical trial will be examined. We hypothesize that patients with secureorganized attachment representations shall reach 42 a better outcome than those with insecure features or disorganized states of mind. Furthermore, selfreported attachment shall significantly change after therapy indicating increased security. Mainstream instruments will be employed to measure attachment security (AAPR), attachment representation and organisation (AAP), as well as client attachment expectations to the therapist (BFKE). The ECR-R, taken from the entire main study sample (n=512), will aim to measure changes in attachment security. S16: „Wenn chronisch Depressive ihre Therapie wählen…“ Psychoanalytische und kognitiv-verhaltenstherapeutische Langzeittherapien bei chronischer Depression. Kurz- und Langzeitwirkungen bei präferierter und randomisierter Therapiezuweisung (LAC) (DGPT) Erkenntnisse über Therapieschwierigkeiten bei chronischer Depression aus psychoanalytischen Supervision innerhalb der LAC-Studie Deserno H. (Frankfurt a. M.), Bahrke U., Pfenning N. Verhaltenstherapeutische Bahandlungen chronisch Depressiver Hautzinger M. (Tübingen) Psychotherapieprozessforschung am Beispiel der LAC-Studie: Unterscheidung Verhaltenstherapie– psychoanalytische Therapie Haselbacher A., Edinger J., Beutel M. Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz Nach Schaetzungen der WHO werden Depressionen im Jahre 2020 die zweithäufigste Volkskrankheit sein. Da trotz verbesserten (v.a. medikamentoesen) Therapiemethoden bis zu 40% der depressiven Patienten chronifizieren, wird die Langzeitpsychotherapie bei dieser Erkrankung eine herausragende gesundheitspolitische Bedeutung erhalten. Demzufolge besteht Forschungsbedarf, um die Wirksamkeit psychoanalytischer und verhaltenstherapeutischer Langzeitverfahren bei chronisch depressiven Patienten zu belegen. Gehört dieser reine Effektivitätsnachweis seit je her zum Standard der Psychotherapieforschung, so wurde jedoch erst in den letzten Jahrzehnten ersichtlich, dass eine ausschließliche Betrachtung des Thera- pieerfolges nur wenig zum Verständnis des Therapieprozesses beiträgt. Wesentlich bedeutungsvoller ist hier die Untersuchung der konzeptuellen Unterschiede zwischen dem psychoanalytischen und dem verhaltenstherapeutischen Vorgehen hinsichtlich der jeweiligen Umsetzung in konkretes therapeutisches Handeln („Adherence“), da nur so Aussagen über spezifische Wirkfaktoren – und somit auch Aussagen z.B. darüber, welche Aspekte einer Psychotherapie zur Heilung des Patienten beitragen - möglich werden. Am Beispiel der LACStudie sollen das empirische Vorgehen bei einem solchen Forschungsvorhaben dargestellt werden. S17: Psychosomatische Aspekte bei erblichen Tumorerkrankungen Belastungerleben von Ratsuchenden nach interdisziplinärer genetischer Beratung bei familiärem Darmkrebs (HNPCC) – weibliches Geschlecht ein „Risikofaktor“? Brechtel A., Jost R., Schroeter C., Keller M. Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg Der interdisziplinären genetischen Beratung kommt angesichts der psychosozialen Komplexität familiärer Tumorerkrankungen ein wichtiger Stellenwert zu. Die Auswirkungen der genetischen Beratung auf das psychische Befinden der Ratsuchenden werden insgesamt positiv beurteilt, wobei in einzelnen Untersuchungen weibliches Geschlecht als psychosozialer Risikofaktor beschrieben wird. Die vorliegende Studie untersucht die Bedeutung des Geschlechts hinsichtlich des Belastungserlebens und krankheitsbezogener Kognitionen von Patienten/innen (PAT) und nicht erkrankten Familienangehörigen, sog. Risikopersonen (RP), die eine genetische Beratung für HNPCC aufsuchen. 71 Patientinnen und 68 Patienten sowie 155 weibliche und 78 männliche RP nahmen an der Studie teil. Die Datenerhebung erfolgte mittels standardisierter (HADS, IES) und studienspezifischer Fragebögen vor und 8 Wochen nach genetischer Beratung. Vor Beratung ist ein signifikanter Geschlechterunterschied festzustellen: Frauen sind im Vergleich zu Männern psychisch stärker belastet. Nach Beratung zeigen Frauen, besonders weibliche RP einen deutlichen Rückgang der Belastung. Neben dem Geschlecht spielen jedoch weitere soziodemographische Faktoren eine Rolle. Geschlechtsspezifische Aspekte haben zwar eine Bedeutung für die genetische Beratung bei HNPCC, mit dem ausschließlichen Fokus auf das unterschiedliche Ausmaß der Belastung bei weiblichen und männlichen Ratsuchenden bleiben jedoch viele weitere Aspekte unberücksichtigt. 43 Genetische Erstberatung für Patienten und Risikopersonen mit Verdacht auf HNPCC: Nutzen und Auswirkungen aus Sicht der Ratsuchenden 1 1 1 2 Schroeter C. , Jost R. , Brechtel A. , Kloor M. , 1 Keller M. 1 Klinik für Psychosomatik und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg 2 Abt.f. Molekulare Pathologie u. Tumorbiologie, Inst.f. Pathologie, Universitätsklinikum Heidelberg Fragestellung: Vor dem Hintergrund zunehmender Inanspruchnahme genetischer Testung gewinnt die Qualitätssicherung und Optimierung genetischer Beratung an Bedeutung. In dieser Studie wird ein interdisziplinäres Beratungsprotokoll für HNPCC aus Sicht der Ratsuchenden evaluiert. Ziel der Untersuchung war, Patienten (PAT)und Risikopersonen (RP) zu beschreiben, die 1. besonders von der psychosomatischen Beratung profitieren, 2. eine Zunahme von Sorgen nach Beratung berichten. Methoden: Bei 141 PAT und 289 RP wurden vor Beratung HNPCC-spezifische psychische Belastung und -Kognitionen erfasst. 8 Wochen nach Beratung beurteilten die Teilnehmer zentrale Beratungsdimensionen, persönlichen Nutzen und Auswirkungen der Beratung. Ergebnisse: Von der psychosomatischen Beratung profitieren insbesondere RP und PAT mit Kindern und hoher spezifischer Ausgangsbelastung. 28% der PAT und 16% der RP berichten über eine Zunahme von Sorgen über die erbliche Erkrankung. Diese Reaktion ist bei PAT abhängig von der HNPCCspezifischen Ausgangsbelastung, bei RP von der Mitteilung eines klinisch hohen Risikos für HNPCC und geringer Selbstwirksamkeit (bezpglich Testergebnis). Schlussfolgerungen: Die große Mehrheit der Ratsuchenden nimmt einen hohen persönlichen Nutzen und keine negativen Auswirkungen der Beratung wahr. Hohe Ausgangsbelastung und niedrige Selbstwirksamkeit könnten Indikatoren für eine Subgruppe mit besonderem psychosomatischen Betreuungsbedarf sein. Welche Auswirkungen hat die Mitteilung eines Mutationsbefundes auf die psychische Belastung von Patienten und Risikopersonen mit V.a. HNPCC? Jost R., Schroeter C., Kloor M., Brechtel A., Keller M. Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg Ziel: Die prospektive Studie fragt nach differentiellen Auswirkungen eines positiven oder negativen Mutationsergebnisses auf die psychische Belastung bei erkrankten Patienten (Pat) und Risikopersonen (RP) mit V.a. erblichen Darmkrebs (HNPCC). Methoden: Seit 1999 wurde 112 Personen - 52 Patienten, 60 gesunden Risikopersonen – im Heidelberger Zentrum ‚Familiärer Darmkrebs’ ein Mutationsbefund mitgeteilt. Die psychische Belastung wurde anhand HADS (globale Belastung) und IES/BEE (HNPCC-spezifische Belastung) jeweils 2 Wochen vor und nach Befundmitteilung erhoben. Die Auswertung erfolgte getrennt nach Mutationsergebnis (Mut +, Mut -, uninformativ) und Status (Pat /RP). Ergebnisse: 2 Wochen nach Befundmitteilung bleiben globale und spezifische Belastung insgesamt und unabhängig vom Mutationsergebnis unverändert: weder findet sich ein (sig.) Anstieg bei Anlageträgern, noch ein Rückgang bei Nichtanlageträgern. Pat unterscheiden sich hierin nicht von RP. Globale und spezifische Belastung nach Befundmitteilung werden vorrangig von den Ausgangswerten (baseline) determiniert. Schlussfolgerungen: Auf die Mitteilung eines positiven Mutationsergebnisses ist im KurzzeitVerlauf weder bei Pat noch bei RP mit einem relevanten Belastungsanstieg zu rechnen. Die initiale Belastungsausprägung gibt Hinweise für höhere Belastung nach Befundmitteilung und kann zur Identifizierung einer psychosozialen Risikogruppe genutzt werden. 9 Jahre Beratung und Betreuung von Familien mit familiärem Darmkrebs – was haben wir gelernt? 1 1 1 2 Keller M. , Brechtel A. , Schroeter C. , Kloor M. , 1 Jost R. 1 Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg 2 Abt.f. Molekulare Pathologie u. Tumorbiologie, Inst.f. Pathologie, Universitätsklinikum Heidelberg Fragestellung: Im Rahmen des Verbundprojekts ‚Familiärer Darmkrebs-HNPCC*’ der DKH nahmen seit 1999 alle Ratsuchenden (n = 474) in HD an einer psychosomatischen Beratung teil. Ziel der Begleitstudie war die Identifizierung von psychosozialen Risikofaktoren bzw. Bedarf an weiterer psychosomatischer Betreuung sowohl bei CaPatienten (Pat) als auch nicht erkrankten Familienangehörigen (RP). Methode: Prospektive Studie mit 2-8 Meßzeitpunkten vor und im Verlauf der genetischen Diagnostik. Erfassung von globaler und HNPCC*-spezifischer Belastung und Kognitionen. Erhebung von eigenen und familiären Krankheitserfahrungen (FE) im Interview. Ergebnisse: Die psychische Belastung von Pat wird vorrangig von eigenen und familiären FE, kaum vom Ergebnis der genetischen Testung determiniert. RP sind initial und im Verlauf (2 Jahre nach Gentest) unverändert gering belastet, auch bei Mutationsnachweis. Vereinzelte unerwartete psychische Belastungsreaktionen und familiäre Veränderungen bilden sich (statistisch) nicht ab. Fazit: Insgesamt hat genetische Diagnostik bei HNPCC keine messbar nachteiligen Auswirkungen. Mit gängigen psychometrischen Verfahren bleiben psychosoziale Risikokonstellationen, v. a. bei RP unentdeckt. Individuelle und familiäre biographische Faktoren sind in 44 der persönlichen (genetischen) Beratung zu eruieren, bzw. ergänzend qualitativ zu untersuchen. * erblicher nicht-polypöser Darmkrebs S18: Cardivascular risks in the general population and intervention strategies – cardiological and psychosomatic perspectives (English Track) Do genomics and clinical markers help to identify cardivascular risk in the community? The Gutenberg Heart Study. Blankenberg S. (Mainz) years. Tailoring interventions separately for men and women appears to be important. S19: Psychosomatische Schwangerschaft und (DGPFG) Aspekte von Wochenbett Psychische Erkrankungen in Schwangerschaft und Wochenbett - Behandlungsnotwendigkeit und –angebote 1 1 1 2 Weidner K. , Bittner A. , Richter J. , Sasse J. , Jo1 raschky P. 1 Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden Associations of psychological risk factors with cardiovascular diseases - first cross sectional results of the Gutenberg Heart Study 1 2 1 Michal M. , Blankenberg S. , Beutel M. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz 2 II Medizinische Klinik und Poliklinik, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität The Gutenberg Heart Study (GHS) is a prospective, population-based cohort study in cardiovascular epidemiology. As very common features of psychological distress symptoms of depression, anxiety (generalized anxiety, panic disorder, social phobia), depersonalization and type-d personality are assessed. In a first exploratory cross-sectional analysis of the first n=5000 participants of the (GHS) the association of type-d, depression and social phobia with cardiovascular disease will be examined. Furhtermore the associations between type-d with depression and social anxieties will be analysed Who Benefits from Psychotherapy after Myocardial Infarction? Schneiderman N. University of Miami, USA Psychosocial interventions for severe coronary heart disease (CHD) have previously yielded inconsistent results. Some trials (e.g., Recurrent Coronary Prevention Project) have shown positive results primarily for men, but interventions for women have not been successful. Recently, however, the Stockholm Women’s Intervention Trial for CHD (SWITCHD) led by Orth-Gomér has shown significantly improved survival after more than 7 2 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden Obwohl die Schwangerschaft für die meisten Frauen eine glückliche Lebensphase ist, kann diese Zeit auch durch psychische und psychosomatische Störungen und soziale Probleme belastet sein. Aktuelle Studien können zeigen, dass psychische Störungen in der Schwangerschaft genauso häufig auftreten wie in anderen Lebensphasen (ca. 15% der Schwangeren haben eine psychische Störung, die häufig nicht diagnostiziert und nur in 5,5% der Fälle adäquat behandelt wird). Die Belastung durch Stress, Angst und depressive Beschwerden ist nochmals höher (zwischen 30% und 40%). Die schlechte Versorgungssituation der Betroffenen ist insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Untersuchungen von schwerwiegender Bedeutung, die klare Zusammenhänge zwischen psychischen Belastungen in der Schwangerschaft mit nachfolgenden Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen, Frühgeburtlichkeit, geringem Geburtsgewicht des Neugeborenen, Stillproblemen, Verhaltensauffälligkeiten des heranwachsenden Kleinkindes, sowie Mutter-KindBindungsstörungen bis hin zu familiärer Gewalt gefunden haben. Der Vortrag zeigt einen Überblick über die psychischen Störungen in Schwangerschaft und Wochenbett und setzt sich mit den Auswirkungen auf den weiteren Schwangerschafts-, Geburtsverlauf, das Wochenbett und das Kind auseinander. Behandlungsangebote, die sich durch eine multiprofessionelle Vernetzung auszeichnen, werden an Hand von praktischen Beispielen vorgestellt. Geburtshilfliche Interventionen und maternale Wünsche Hellmers C., Schücking B. 45 Universität Osnabrück, FB 08/Gesundheitswissenschaften, Albrechtstraße 28, 49069 Osnabrück Einleitung und Fragestellung: Die Berücksichtigung maternaler Wünsche erhält in der Geburtshilfe zunehmende Bedeutung. Kriterien wie Selbstbestimmung und Kundenorientierung werden kontrovers diskutiert. Angloamerikanische TherapieEntscheidungskonzepte wie Informed Consent und SDM sind in Deutschland noch nicht etabliert. Welche Bedeutung die maternalen Wünsche für die Entscheidung zur Geburtseinleitung, Sectio caesarea, Episiotomie und CTG-Überwachung haben, wurde in vorliegender Studie untersucht. Methoden: Längsschnittliches qualitatives Design. Geführt wurden problemzentrierte Interviews nach Witzel mit Ärztinnen, Hebammen und Verwaltungsleitern in einer Klinik mit Hebammenkreißsaal sowie in einer Kontrollklinik. Ergebnisse: Der maternale Wunsch wird von den meisten Ärztinnen als ein entscheidendes Kriterium für und gegen die Durchführung von Interventionen genannt. Jedoch zeigen sich in der Berücksichtigung der mütterlichen Wünsche weit reichende Unterschiede zwischen den Interventionen. Für einige Eingriffe erhalten die Frauen ein hohes Mitbestimmungsrecht, für andere wird es eher vernachlässigt. Schlussfolgerung: Es gilt kritisch zu reflektieren, inwiefern die maternalen Wünsche im Sinne der Wertschätzung der Frauen Bedeutung erhalten oder diese genutzt werden, um eigene Vorstellungen zu legitimieren. Es bleibt zu hinterfragen, ob und warum die Frauen selbst ihre Anliegen hinsichtlich einzelner Interventionen unterschiedlich vehement durchzusetzen versuchen. Mothers in Stress - Inflammatoric breast diseases during lactation Wöckel A. Universitätsfrauenklinik Ulm, Prittwitzstraße 43, 89075 Ulm Background: Inflammatoric diseases of the breast (puerperal mastitis) are one of the most common reasons to cease breastfeeding. Mothers with puerperal mastitis often mention an emense amount of stress in their social surroundings. Higher levels of stress might lead to an imbalance of cytokines in breastmilk which cause an inflammatory reaction in the mammary tissue. Methods: 163 mothers were enrolled in this prospective cohort study during the first days postpartum. Social demographic data, psychometric data, a breastmilk and a blood sample were analyzed. 12 weeks postpartum psychometric data and the course of breastfeeding were taken by mailed questionnaires. By the course of breastfeeding mothers were divided into one group with breastfeeding associated diseases (case group) and one without breastfeeding associated diseases (control group). Results: Mothers of the case group were significant older, had higher lev- els of stress, a significant reduced health related quality of life then mothers of the control group at both points. They also had higher concentrations of proinflammatoric Th1 cytokines and lower concentrations of antiinflammatoric Th2 cytokines in their breastmilk after birth of the child. Leukocytes were also depressed in the case group. Conclusions: Higher levels of stress postpartum can lead to an imbalance of cytokines in breastmilk which might lead to inflammatory reaction in the mammary tissue in the following weeks. Frauen mit belasteter geburtshilflicher Anamnese in der stationären psychosomatischen Versorgung 1 2 3 1 Fertl K. I. , Beyer R. , Rauchfuß M. , Geissner E. 1 Medizinisch-Psychosomatische Klinik Roseneck, Am Roseneck 6, 83209 Prien am Chiemsee 2 Institut für Psychologie, Humboldt Universität zu Berlin, Rudower Chaussee 18, 12489 Berlin 3 Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Charité Universitätsmedizin Berlin, Charité-Campus Mitte, Luisenstr. 13a, 10117 Berlin 1.Fragestellung Ziel der Studie war die Erfassung von Häufigkeiten und psychischen Auswirkungen von geburtshilflichen Vorbelastungen bei Patientinnen in der stationären Psychosomatik sowie von subjektiven Einschätzungen des therapeutischen Personals. 2.Methodik Nach einem Screening von 117 Patientinnen zur geburtshilflichen Anamnese erfolgte ein standardisiertes Interview mit Frauen mit Schwangerschaftsverlusten bzw. -abbrüchen zu bisherigen Schwangerschaften sowie zu Attributionsmustern und Copingstrategien nach dem Verlust bzw. Abbruch (Rauchfuß et al., 1996) und eine Befragung des therapeutischen Personals mittels teilstandardisiertem Fragebogen. 3.Ergebnisse 17.9% der Teilnehmerinnen berichten von einer geburtshilflichen Vorbelastung, welche im Mittel bereits 16 Jahre zurückliegt. Die aktuelle Belastung durch den Verlust bzw. Abbruch wird durchschnittlich auf 3.6 (1= gar nicht, 7=extrem) eingeschätzt. 33.3% der betroffenen Frauen sehen einen Zusammenhang mit ihren aktuellen psychischen Beschwerden. Die Ergebnisse der Therapeutenbefragung werden Ende 2008 erwartet. 4.Schlussfolgerung Ein substantieller Teil der Patientinnen in der stationären Psychosomatik weist eine psychische Belastung durch eine geburtshilfliche Vorbelastung auf. Bei Vorlage der abschließenden Ergebnisse wird abgeleitet, ob geburtshilfliche Vorbelastungen und eventuelle psychische Folgebelastungen im der stationären Psychotherapie ausreichend berücksichtigt werden. 46 S20: Aktuelle Forschungen der Künstlerischen Therapien in der Psychosomatik Ergbnisse einer Studie zu den spezifischen Wirkfaktoren in den Künstlerischen Therapien Gruber H. Alanus Hochschule, Johannishof, 53347 Alfter / Bonn Spezifische Wirkfaktoren werden von allen Künstlerischen Therapien postuliert. Seit den Anfängen der KT finden sich in der Literatur Beschreibungen und Hinweise der spezifischen Wirksamkeit künstlerisch-therapeutischer Verfahren. Einzelne Studien versuchen diesen Zusammenhang nachvollziehbar zu machen. Welche spezifischkünstlerischen Wirkfaktoren dies allerdings genau sind und wann sie für wen wie eingesetzt werden sollten, bleibt meist eine Hypothese, die kaum einer strengen wissenschaftlichen Überprüfung standhalten würde. Vor dem jahrzehntelangen praktischen Erfahrungshintergrund der KT verwundert es, wie wenig konkrete wissenschaftliche Untersuchungen bislang unternommen worden sind. Die in dem Beitrag vorgestellte Studie geht der Frage der spezifischen Wirkfaktoren anhand einer umfassenden Literaturrecherche, mit mehreren Expertenbefragungen aus verschiedenen Therapiebereichen (Musik-, Kunst, und Tanztherapie) in unterschiedlichen Anwendungsfeldern, sowie einem Expertenworkshop nach. Der Schwerpunkt der Studie liegt im onkologischen Bereich. Die Ergebnisse bestätigen das Postulat der Experten, die von spezifischen Wirkfaktoren in den Künstlerischen Therapien ausgehen. Die aus der Analyse sich ergebenden Wirkdimensionen wurden für die Onkologie spezifiziert und werden als Teilaspekt in dem Beitrag vorgestellt. Einzelne aus der Untersuchung sich ergebende Wirkfaktoren werden diskutiert. Psychosomatik und veröffentlichte Kunsttherapie: Die Literaturdatenbank „www.arthedata.de“ als Forschungsinstrument Schulze C., Lauschke M. Institut für Kunsttherapie und Forschung der FH Ottersberg, Am Wiestebruch 68, 28870 Ottersberg Kunsttherapie ist eine vergleichsweise junge Disziplin, deren methodische Konzepte und Ansätze sich im Zusammenhang mit der Erschließung neuer Anwendungsbereiche in den letzten Jahrzehnten erweitert und ausdifferenziert haben. Die wissenschaftliche Situation der Kunsttherapie ist momentan dadurch gekennzeichnet, dass die vorliegende Wissens- und Forschungssubstanz kaum systematisch gesammelt und aufgearbeitet ist mit der Konsequenz einer lückenhaften Recherche. Die Generierung einer umfassenden internationa- len Literaturdatenbank für die Kunsttherapie (www.arthedata.de) soll eine wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung ihrer historischen Quellen, ihrer fachspezifischen Entwicklungslinien ebenso wie vorliegender Grundlagenstudien, Praxisdokumentationen und empirischer Forschungsergebnisse ermöglichen. Am Beispiel des klinischen Anwendungsfeldes der Psychosomatik, speziell dem Bereich der Essstörungen, werden Recherchemethoden und -strategien (wie z.B. Themenlandkarte und Verschlagwortung), Problemstellen in der Literaturauswertung und -sicherung, sowie der aktuelle Literaturbestand zum Thema: „Kunsttherapie und Essstörungen“ aufgezeigt. Mit der Literaturdatenbank „arthedata“ wird auf Basis innovativer technologischer Möglichkeiten ein Dokumentationsmedium geschaffen, dass vor allem auch eine wichtige Grundlage für zukünftige interdisziplinäre Forschungsvorhaben in der Psychosomatik ist. Dokumentation Kunsttherapeutischer Prozesse: Entwicklung einer Kurzform im kritischen methodischen Dialog 1 2 3 Elbing U. , Wietersheim J. v. , Hölzer M. 1 Institut für Kunsttherapie-Forschung der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen, Sigmaringer Strasse 15, 72622 Nürtingen 2 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Frauensteige 14a, 89075 Ulm 3 Sonnenberg Klinik Stuttgart, Christian-Belser-Str. 79, 70597 Stuttgart Die Notwendigkeit, den Beitrag der Kunsttherapie im Dokumentationswesen psychosomatischer und psychotherapeutischer Kliniken angemessen abzubilden, wird in einem Forschungsprojekt unter Federführung der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen, der Sonnenbergklinik Stuttgart und der psychosomatischen Tagesklinik der Universitätsklinik Ulm mit der Entwicklung eines Systems zur Dokumentation kunsttherapeutischer Prozesse beantwortet. Vorgestellt wird hier die Kurzversion von DoKuPro, eines Instruments zur Dokumentation kunsttherapeutischer Prozesse in psychosomatischen und psychotherapeutischen Kliniken. Im Fokus steht die Entwicklung der Kurzform im forschungsmethodischen Dialog zwischen Faktorenanalyse, qualitativer Inhaltsanalyse und Expertenwahl. Die Ergebnisse der jeweiligen methodischen Zugänge werden präsentiert und im kritischen Vergleich sowie mit ersten Evaluationsergebnissen diskutiert. Forschungsarbeiten in der Musiktherapie Übersicht zum Stand der Forschung unter besonderer Berücksichtigung der Psychosomatik Neugebauer L. 47 Institut für Musiktherapie, Universität Witten/Herdecke Wie in anderen kunsttherapeutischen Disziplinen existieren im Bereich der Musiktherapie zahlreiche Veröffentlichungen. Diese finden sich in musktherapeutisch Fachjournalen ebenso, wie in medizinischen Fachzeitschriften oder psychotherapeutischen Organen. Besonders bei Berücksichtigung englischsprachiger Publikationen lässt sich eine Fülle von Arbeiten finden, die unterschiedlichen Zwecken dienen, und dienen können. Angefangen von Fallbeschreibungen in Form von Kasuistiken, über systematisch angelegte Einzelfallstudien bis hin zu Gruppenstudien mit Kontrollgruppen finden sich verschiedene methodische und inhaltliche Ansätze. Im Beitrag soll eine Überscht zum Stand der Forschung durch eine systematisierte Übersicht zur zugänglichen Literatur gegeben werden. Aus diesem Kenntnisstand lässt sich eine Standortbestimmung hinsichtlich des Selbstverständnisses des Berufes ebenso herleiten wie eine mögliche Ausrichtung zukünftigen Forschungsarbeiten. S21: Stationäre und teilstationäre Psychotherapie: Indokationsstellung und Therapieverlauf Stationäre oder tagesklinische Behandlung? Eine Untersuchung zu Kriterien einer differentiellen Indikationsstellung. 1 2 1 Zeeck A. , Küchenhoff J. , Hartmann A. , Weiss 3 4 5 6 7 H. , Sammet I. , Gaus E. , Semm E. , Harms D. , 8 9 1 Eisenberg A. , Rahm R. , Einsele S. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg, Hauptstr. 8, 79104 Freiburg 2 Kantonale Psychiatrische Klinik Liestal 3 Abt. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart 4 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Tübingen, Osianderstr. 5, 72076 Tübingen 5 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Städtische Kliniken Esslingen 6 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Krankenhaus Bietigheim 7 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinik Erlangen 8 Klinik für Psychosomatik und und Psychotherapeutische Medizin am Klinikum Nürnberg 9 Schussentalklinik, Fachkrankenhaus und Rehabilitationsklinik für Internistische Psychosomatik und Psychotherapie Bislang liegen keine empirisch gesicherten Kriterien für eine Indikationsstellung stationäre vs. ta- gesklinische Behandlung vor. Ziel der DINSTAPStudie war es, solche Kriterien zu identifizieren, indem nach Prädiktoren gesucht wurde, welche mit einem guten bzw. schlechten Outcome in jedem Setting assoziiert sind. In einer naturalistischen, multizentrischen Studie wurden an 10 psychosom. Zentren 567 konsekutive Behandlungsepisoden (stationär, tagesklinisch) erfasst. Die Schwere der Beeinträchtigung (prä, post) wurde mit Hilfe von SCL-90-R, GAF und BSS eingeschätzt. Vor Aufnahme wurden 43 Aspekte beurteilt, welche für eine Indikationsstellung relevant sein könnten. Mit Hilfe einer Regressionsanalyse wurden Zusammenhänge zwischen Outcome und den Prädiktoren geprüft. Ein gutes Behandlungsergebnis in Tageskliniken ließ sich aus einer hohen Motivation der Patienten, einer guten Fähigkeit zur Selbststeuerung und einer hohen Belastung durch alltägliche Aufgaben vorhersagen. Bei stationärer Behandlung hatten die Patienten einen schlechteren Verlauf, welche ein hohes Regressionspotential aufwiesen, sozial isoliert waren und deren Symptome durch Auslöser zu Hause getriggert wurden. Zusammenfassend sollten Patienten deren Symptome einen engen Zusammenhang mit alltäglichen Abläufen zu Hause aufweisen vorzugsweise tagesklinisch behandelt werden. Die Indikation zu einer stationären Therapie sollte mit Vorsicht gestellt werden, wenn diese mit einem deutlichen sekundären Gewinn verbunden ist. Veränderungen bei Patienten in einer Psychosomatischen Tagesklinik - Modellierung von Therapieverläufen bei wöchentlicher Messung Munz D., von Wietersheim J., Pokorny D. Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Frauensteige 14a, 89075 Ulm Fragestellung: Therapeuten wissen, dass Veränderungen von Patienten nicht immer linear stattfinden, so daß herkömmliche Prä-Post-Vergleiche nur begrenzte Aussagen über Therapieverläufe zulassen. Demgegenüber eröffnet eine wöchentliche computergestützte Erfassung von Daten neue Möglichkeiten der Untersuchung und Charakterisierung von Therapieverläufen. Uns interessierte zunächst, wie sich hierbei Datensätze mit unterschiedlich langen Therapieverläufen möglichst einfach, dabei mathematisch und klinisch sinnvoll auswerten lassen. Methode: 107 Patienten (mittl.Therapiedauer 8 Wochen; Range 3 bis 19) wurde in wöchentlichen Abständen der Fragebogen KPD-38 (Klinisch Psychologisches Diagnossystem; Percevic et al. 2005) am PC vorgegeben. Neben einer Gesamtskala beinhaltet er symptomorientierte („Körperbezogene Beeinträchtigung“, „Psychische Beeinträchtigung“, „Soziale Probleme“, „Handlungskompetenz“) sowie ressourcenorientierte Subskalen („Allg. Lebenszufriedenheit“, „Soz. Unterstützung“). Für die Auswertung wurde eine nicht-parametrische Prozedur vorgeschlagen, 48 die eine Verallgemeinerung der herkömmlichen Prä-Post-Tests darstellt. Ergebnisse: Die Analyse der Daten zeigte, dass der Therapieverlauf als ein durchgehender – nicht immer linearer – Prozess dargestellt werden kann. Die Analysemethode erwies sich als geeignet für solche Datenstrukturen, ist dabei wesentlich einfacher als die Methodik der "hierarchischen Linearmodelle“ und lässt sich klinisch sinnvoll interpretieren. Subjektives Erleben von stationärer Psychotherapie - Qualitative Analyse katamnestischer Patienteninterviews 1 2 3 Langenbach M. , Krause C. , Subic-Wrana C. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, St. Marien-Hospital Bonn 2 Privat 3 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz Stationäre Psychotherapie wirkt auf vielschichtige Weise in vielfältigen Interaktionen. Das Modell der „therapierelevanten Erlebensaspekte“ zur Beschreibung von Wirkfaktoren in der stationären Psychotherapie (Schauenburg et al, 1999) legt den Schwerpunkt auf die für den Therapieerfolg wichtigen Beziehungen. Die Wirksamkeit des Beziehungserlebens aus Patientensicht ist bisher selten empirisch untersucht geworden. Unsere Stichprobe bestand aus 15 Patienten (mittleres Alter 40,5 Jahre, 11 Frauen, 33% alleinstehend, 54% in aktueller Partnerschaft, 13% geschieden, Diagnoseverteilung: 28% somatoforme Störung, 20% depressive Episode, je 12% Konversionsstörung, Belastungsreaktion und Angststörung). Die Patienten wurden ein bis zwei Jahre nach Entlassung aus stationärer Behandlung mit leitfadengestützten Interviews befragt, die auf Tonband aufgenommen und vollständig transkribiert wurden. Als besonders hilfreich wurden die Einzelgespräche bewertet, während die Gruppentherapie ambivalenter wahrgenommen wurde. Überwiegend positiv wurde auch das Pflegepersonal wahrgenommen. Der Kontakt zu den Mitpatienten wurde meist als unterstützend geschätzt, ließ aber auch erschrecken über das Leid der Anderen und bot Anlass, über sich und das eigene Erleben zu reflektieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Interaktionen mit dem Behandlerteam und den Mitpatienten aus Patientensicht als relevant für die Wirksamkeit der Behandlung eingeschätzt werden. Patientenfallgruppen in der medizinischen Rehabilitation am Beispiel der Behandlung von psychosomatischen Erkrankungen unter besonderer Berücksichtigung depressiver Störungsbilder Zielke M. W. Wissenschaftsrat der AHG AG, Helmholtzstr. 17, 40215 Düsseldorf Problemstellung: Obwohl begrifflich häufig verwendet gibt es kaum Ausarbeitungen zum Schweregrad bei psychischen Erkrankungen. Hierzu werden systematische Überlegungen angestellt, die berücksichtigen, dass Schweregradklassifikationen immer zweckgebunden erfolgen. Es wird unterschieden zwischen Indikatoren, die unabhängig von einem konkreten Behandler zu sehen sind und solchen, die erst in der Interaktion mit einem tatsächlichen Behandler zu beobachten sind. Methode: Bei einer Jahrgangsstichprobe 2003 von Patienten aus der stationären Verhaltenstherapie werden Einflussfaktoren ermittelt, die mit der Dauer der stationären Behandlung im Zusammenhang stehen und Behandlungszeitfenster vorgeschlagen, die die Behandlungsschweregrade und den Behandlungsaufwand berücksichtigen. Ergebnisse: Einflussfaktoren der stationären Behandlungsdauer sind die Behandlungsdiagnosen, die Komorbidität, das Lebensalter und die Krankheitsdauer. Die gewählten Cut-Off-Kriterien trennen deutlich zwischen kürzeren und längeren Behandlungsdauern. Unter Beachtung der erstrangigen Behandlungsdiagnosen und der Kriterienkombinationen erfolgt eine Zuordnung zu sechs Behandlungszeitkorridoren.Diskussion: Die Kriterien liegen als objektive Information vor und unterliegen keiner Ermessensentscheidung. Sie ermöglichen eine rationale Zuordnung zu differenziellen Behandlungszeitfenstern, die den Behandlungserfordernissen genügen. Dies wird am Beispiel der Behandlungserfordernisse bei Depressionen vorgestellt. S22: Von der Genetik bis zur Gesichtswahrnehmung – Aktuelle Perspektiven der Alexithymieforschung Familiäre Transmission und Genetik der Alexithymie 1 2 3 Grabe H. J. , Mahler J. , Spitzer C. , Freyberger H. 4 J. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Pschotherapie, Osianderstr., 72076 Tuebingen 2 Klinik für Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie der EMA Universität Greifswald, Rostocker Chaussee 70, 18439 Stralsund 49 3 Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE), Gebäude Ost 59 (O 59), Martinistr. 52, 20246 Hamburg 4 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Greifswald im Hanseklinikum Stralsund, Rostocker Chaussee 70, 18437 Stralsund Eine verminderte Fähigkeit eigene Emotionen zu erkennen, sprachlich zu kommunizieren und bewusst zu regulieren wird als Alexithymie bezeichnet. Mehr als 10% der Menschen in der Allgemeinbevölkerung und 25-30% der Patienten in psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung weisen hohe Störungswerte auf. Zahlreiche Befunde assoziieren die Alexithymie mit unterschiedlichen psychischen Störungen und Defiziten sozialer Interaktion. Neben psychologischen Krankheitsmodellen werden zunehmend auch neurobiologische Charakteristika identifiziert, die mit der Alexithymie assoziiert sind. Im Besonderen stellt sich die Frage, ob es eine genetische Veranlagung gibt, Emotionen und Gefühle im Sinne der Alexithymie kognitiv nicht zu verarbeiten. Hierzu werden Befunde aus zwei Familienstudien zur Familiarität alexithymer Persönlichkeitsmerkmale vorgestellt. Die Daten deuten auf eine relevante familiäre Transmission dieser Merkmale hin, die Merkmalsausprägung der Eltern auf der TorontoAlexithymie-Skala (TAS-20) prädiziert 40 % der TAS-20 Varianz der Kinder. Aktuelle Zwillingsstudien ermitteln den direkten genetischen Varianzanteil auf 30-33 %. Aus der Study of Health in Pomerania (SHIP) werden erste größere molekularbiologische Analysen zur Alexithymie vorgestellt, die eine Assoziation mit Genen des Immunsystems zeigen und somit auf eine gemeinsame biologische Veranlagung von Alexithymie und bestimmten körperlichen Erkrankungen hindeuten. Keine Assoziation zwischen dem Val158MetPolymorphismus im Catechol-OMethyltransferase-Gen und Alexithymie 1 1 2 1 Bausch S. , Stingl M. , Hennig J. , Leweke F. 1 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Giessen, Paul-Meimberg-Str. 5, 35392 Giessen 2 Abteilung Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung der Justus-Liebig-Universität Gießen, Fragestellung: Die Catechol-O-Methyltransferase (COMT) steuert den Abbau von Dopamin im orbitofrontalen Kortex. Die Aktivität der COMT unterliegt einem Genpolymorphismus, der bei Alexithymie eine ursächliche Rolle spielen könnte. Ziel der vorliegenden Studie ist es, zu untersuchen, ob ein Zusammenhang zwischen dem COMT Val158Met Gen-Polymorphismus und Alexithymie besteht. Methode: Bei 240 Versuchspersonen (120 Studenten und 120 stationäre Patienten einer psychosomatischen Universitätsklinik) wurde der Genotyp des COMT-Val158Met Polymorphismus bestimmt. Alle Probanden füllten die Toronto-AlexithymieSkala (TAS-20) und das Beck-DepressionsInventar (BDI) aus. Der Zusammenhang zwischen dem Gen-Polymorphismus und den Werten der TAS-20 wurde anhand von Kovarianzanalysen untersucht. Ergebnisse: Der COMT-Genotyp war in beiden Gruppen nicht mit dem TAS-20 Gesamtwert verknüpft. Bei den gesunden Probanden wiesen Träger des homozygoten Val-Allels geringfügig, aber nicht signifikant, niedrigere Werte in der Subskala 3 (external orientierter Denkstil) der TAS20 als solche mit einem Val/Met-Genotyp auf. Diskussion: Der COMT-Val158Met-Polymorphismus allein scheint in Stichproben von gesunden europäischen, kaukasischen Versuchspersonen nicht mit der Alexithymieausprägung verknüpft zu sein. Hieran ändert sich auch nichts, wenn durch Einbeziehung von Patienten einer psychosomatischen Klinik die Variationsbreite der Alexithymieausprägung (TAS) erhöht wird. Alexithymie und automatische Verarbeitung affektiver fazialer Informationen: Befunde zweier fMRT-Studien 1 1 2 Suslow T. , Ohrmann P. , Kugel H. 1 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster, Albert-Schweitzer Strasse 11, 48149 Münster 2 Institut für klinische Radiologie, Domagkstr. 3, 48149 Münster Die Forschung zu den neurobiologischen Grundlagen von Alexithymie hat sich auf Prozesse der kontrollierten Verarbeitung von affektiven Informationen konzentriert. Automatisch ablaufende Informationsverarbeitungsprozesse sind in diesem Zusammenhang aber nicht zu vernachlässigen, da sie für die Entwicklung von afektiven Reaktionen grundlegend sind und im durch ökonomische kognitive Routinen geprägten Alltagsleben auf Grund ihrer hohen Effizienz und geringen Kontrollierbarkeit leicht zum Tragen kommen. Es wurden zwei Untersuchungen anhand von funktioneller Magnetresonanztomographie durchgeführt, um zu prüfen, ob die zerebrale Responsivität auf maskierten affektiven Gesichtsausdruck eine Funktion des Persönlichkeitsmerkmals Alexithymie ist. In einer ersten Studie, in der die Amygdalae region-of-interest waren, zeigte sich in einer Stichprobe von gesunden Probanden (N=21) eine negative Korrelation zwischen dem Ausmaß der AmygdalaResponsivität auf traurigen Gesichtsausdruck und Alexithymie. Dieser Befund konnte durch die Ergebnisse einer zweiten Studie anhand einer Stichprobe von gesunden Frauen (N=33) bestätigt werden, wobei auch ein inverser Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Responsivität des Gyrus fusiformis auf traurige Gesichter und Alexithymie beobachtet wurde. Eine verminderte automatische Reaktivität basaler zerebraler Strukturen auf faziale Affekte könnte zu Schwierigkeiten beim Erken- 50 nen und Differenzieren von affektiven Reaktionen beitragen. Beeinträchtigte Gesichtswahrnehmung bei Alexithymen – zur Bedeutung der N170. 1 2 1 Franz M. , Seitz R. , Schäfer R. 1 Klinisches Institut für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5, 40225 Düsseldorf 2 Neurologische Klinik der Universitätsklinikum Düsseldorf, Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf Fragestellung: In Performancestudien wurde gezeigt, dass die Fähigkeit zur Wahrnehmung und Verarbeitung emotionaler Gesichtsmimik bei Alexithymen beeinträchtigt ist. Dieser klinische Befund sollte mittels einer EEG-Studie in einem sehr frühen Stadium der Informationsverarbeitung objektiviert werden. Methoden: 28 männlichen alexithymen Probanden (TAS-20) wurden separat wechselnd innerhalb beider visueller Halbfelder lateralisiert standardisierte Alltagsobjekte und Gesichter dargeboten. Der gesichtssensitive N170-Komplex des ereigniskorrelierten EEG wurde nach Kontrolle für Depressivität hinsichtlich Amplitude und Latenz im Bereich des temporalen Kortex analysiert und mit einer parallelisierten Kontrollgruppe nicht alexithymer Probanden verglichen. Ergebnisse: Alexithyme zeigten generell eine statistisch signifikant verringerte Amplitude der N170 insbesondere über dem rechten temporo-occipito-parietalen Kortex. Außerdem wiesen sie Unterschiede im interhemisphärischen Signaltransfer des N170-Potenzials auf. Diskussion: Die erhobenen Befunde unterstützen eine möglicherweise im Bereich des fusiformen Kortex veränderte Generierung des gesichtssensitiven N170-Potenzials, sowie das Bestehen einer veränderten interhemisphäriellen Signaltransduktion bei Alexithymen. Beide Phänomene könnten als Ausdruck einer interaktionsabhängig vermittelten Reifungsstörung spezialisierter neuronaler Netze diskutiert werden. S23: Elektrosensitivität als „larvierte“ psychosomatische Erkrankung Psychische Erkrankung bei subjektiv erhöhter Elektrosensibilität. Eine kontrollierte SKIDStudie. 1 1 1 1 Schmidt B. , Geber C. , Braas C. , Schulz J. , 1 3 2 Kimbel R. , Egle U. , Nix W. A. 1 Privat 2 Klinik für Neurologie, Universitätsmedizin Mainz 3 Gengenbach Im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz wurde eine Studie zum Beschwerdebild von Menschen mit subjektiv erhöhter Elek-trosensibilität durchgeführt. Hierzu wurde eine Stichprobe subjektiv elektrosensibler Personen (n=60) wurde mit einem nach Alter, Geschlecht und Wohnnähe gematch-tem Kontrollkollektiv (n=93) hinsichtlich psychischer Störungen und einer Vielzahl psychologischer Faktoren verglichen. Das Vorliegen von Achse-I- und Achse-IIStörungen wurde mit dem Strukturierten Klinischen Interview für DSM-IV (SKID-I und -II) erhoben und es wurden Gruppenvergleiche berechnet. Der Anteil der Personen mit affektiven Störungen, Angststörungen und zwanghafter Persönlichkeitsstörung war in der Gruppe elektrosensibler Personen signifikant höher als im Kontrollkollektiv. Eine Vielzahl der von den Betroffenen mit Elektrosmog in Verbindung gebrachten Beschwerden ließe sich auch im Zusammenhang mit psychischen Störungen erklären. Somatosensorische und autonome Funktionsparameter bei Personen mit subjektiver Elektrosensibiliät (SES) 1 1 1 1 Schmidt B. , Geber C. , Braas C. , Schulz J. , 1 3 2 Kimbel R. , Egle U. , Nix W. A. 1 Privat 2 Klinik für Neurologie, Universitätsmedizin Mainz 3 Gengenbach Einem Kollektiv von Personen mit SES (n=60), die eine Beeinflussung durch elektromagnetische Felder beklagten (n=93)wurde ein Kontrollkollektiv von gematchten Normalpersonen gegenübergestellt.In den Gruppen sind somatosensorische Parameter mit einem standardisierten quantitativsensorischen Testprotokolls [1] bestimmt worden, weiter wurde die thermische und mechanische Detektions- und Schmerzschwelle ermittelt. Autonome Funktionen ließen sich über Parameter der Herzratenvariabilität erfassen. Die beiden Kollektive unterschieden sich nicht hinsichtlich der somatosensorischen Parametern, hingegen wies im SES-Kollektiv die autonome Funktionsdiagnostik einen einheitlichen Trend (p=0.08) zur verstärkten Auslenkung dieser Parameter auf. Dies deutet auf eine erhöhte Beeinflussung des vegetativen Nervensystems durch Außen- bzw. Umweltreize hin, alternativ auf eine Sensitivierung des vegetativen Nervensystems als Folge der als belastend empfundenen elektromagnetischen Strahlung. Anhand korrelativer Analysen dieser Funktionsparameter mit psychometrischen Daten (SKID, GBB-24, PSQI) lassen sich mögliche individuelle persönlichkeitsbezogene Einflussfaktoren aufzeigen. 51 Elektrosensibilität im Kontext anderer Zivilisationserkrankungen Nix W. (Mainz) Klinik für Neurologie, Universitätsmedizin Mainz Zivilisatorische Gegebenheiten - das gesellschaftliche Klima, der „Zeitgeist“ - beeinflussen in nicht unwesentlichem Ausmaß die phänotypische Ausgestaltung von Beschwerdebildern und den Umgang mit ihnen. Dies ist insbesondere zu beobachten, wenn sich aus Vermutungen zur Ätiologie der Symptome Interessensgruppen bilden, aus denen politische Forderungen nach Konsequenzen zur medizinischen Behandlung und der versorgungsrechtlichen Bewertung der Betroffenen entstehen. Die Krankheitsattribution bei Beschwerdebildern wie der Elektrosensibilität ist überwiegend organisch. Hinsichtlich einer psychosomatischen Ursache besteht bei den Betroffenen der Verdacht, dass man sie nicht ernst nehme, eine psychosomatische Diagnostik wird daher meist abgelehnt. Dem steht eine große Aufgeschlossenheit hinsichtlich alternativer und unkonventioneller Heilangebote gegenüber, deren Kosten oft auch privat getragen werden. Nicht selten resultiert aus dieser Gemengelage eine Chronifizierung mit iatrogenen Anteilen. Typischerweise zeichnen sich die Erkrankungsbilder durch Symptomkombinationen aus, die so inkonstant sind, dass ihnen keine Anerkennung als Syndrom zugewiesen werden kann. Chronic Fatigue Syndrom (CFS), Elektrosensibilität, Sick-Building Syndrom und Chemikalienüberempfindlichkeit gehören wie die Fibromyalgie zu den derzeit in unserer Gesellschaft kontrovers diskutierten Erkrankungen. Eine systematischere Beachtung findet nur das CFS, zu dem mittlerweile in England standardisierte verhaltenstherapeutische Verfahren angeboten werden. deutlich werden. In einem den Patienten vermittelten Bild aus der Computerwelt handelt es sich nicht um ein Problem der „hardware“, sondern der „software“, die sich gewissermaßen „aufgehängt“ hat. So wird es ihnen erleichtert, ihre subjektive Krankheitstheorie vom "somatischen Pol" hin zum "psychogenen Pol" zu verändern. Dies kann die Aufnahme von Psychotherapie erleichtern. Bei allen 7 in einer Pilotstudie untersuchten Patienten mit psychogenem Tremor der Hände führte TMS zu einer signifikanten Reduktion des Tremors. 4 Patienten hatten eine andauernde Besserung der Symptomatik über einen Zeitraum von durchschnittlich 7 Monaten. Alle Patienten haben sich in Psychotherapie begeben. Weitere Ergebnisse u.a. zur kinematischen Bewegungsanalyse werden in der Zwischenzeit generiert und in Form eines Werkstattberichtes auf dem Kongress vorgestellt. Unklar bleibt derzeit die Wirkweise der transkraniellen Magnetstimulation (TMS) bei Patienten mit psychogenen Bewegungsstörungen, ebenso wieso einzelne Patienten auf die Methode ansprechen, andere wiederum nicht. Wir diskutieren die Frage, inwieweit TMS in der Diagnostik und Therapie des psychogenen Tremors helfen kann. Ethische Aspekte werden erörtert. PISO-IS: erste Ergebnisse zur Mentalisierung und Schmerzempathie während einer psychotherapeutischen Intervention bei multisomatoformer Störung 1 2 2 Noll-Hussong M. , Otti A. , Läer L. , Wohlschläger 2 2 3 3 A. , Zimmer C. , Henningsen P. , Gündel H. 1 Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Langerstrasse 3, 81675 München 2 S24: Neurobiologie der Somatisierung Diagnostischer und therapeutischer Einsatz der transkraniellen Magnetstimulation bei funktionellen Bewegungsstörungen: Beispiel psychogener Tremor 1 1 1 Nowak D. A. , Dafotakis M. , Ameli M. , Vitinius 2 2 2 1 F. , Weber R. , Albus C. , Fink G. R. 1 Klinik für Neurologie, Universität zu Köln, Institut für Neurowissenschaften und Biophysik (INB3-Medicine), Forschungszentrum Jülich, s.o., s.o. Köln bzw. Jülich 2 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Universität Köln, Josef-Stelzmann-Str. 9, 50931 Köln Ziel des Projektes ist die Untersuchung der Wertigkeit der transkraniellen Magnetstimulation (TMS) für die Diagnostik und Therapie von psychogenen Bewegungsstörungen. Auf TMS ansprechende Patienten kann die Reversibilität ihrer Symptome Abteilung für Neuroradiologie des Klinikums rechts der Isar der TU München, Ismaninger Str. 22, 81675 München 3 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Str. 1,, 30625 Hannover Patienten mit somatoformen Störungen haben nur begrenzte Fähigkeiten, ihre Gefühle von rein körperlichen Wahrnehmungen zu unterscheiden. Dieses eingeschränkte Vermögen wird traditionellerweise mit dem Begriff der Alexithymie als Risikofaktor dieses Störungsbildes diskutiert. Mentalisierung im Sinne der sog. „Theory of Mind (ToM)“ beschreibt die Fähigkeit des Menschen, eigene Gefühle selbstreflexiv wahrzunehmen. In einer laufenden fMRT-Studie gehen wir der Frage nach, inwiefern im Rahmen einer Psychosomatischen Intervention bei Patienten mit multisomatoformen Schmerzstörungen (PISO) die Schmerzwahrnehmung gestört bzw. durch therapeutische Prozeduren veränderbar ist. Hierzu werden Patienten zum einen Bilder menschlicher Gliedmaßen in unterschiedlich schmerzhaften Situationen gezeigt. Zum anderen kommt ein Mentalisierungs-Paradigma 52 zum Einsatz, in welchem Dreiecke auf unterschiedliche Art miteinander interagieren und emotionale wie intentionale Attributionen beim Beobachter auslösen können („ToM“ entspricht z.B. „miteinander flirten“, „goal-directed“ z.B. „nachmachen“, „random“ z.B. „schweben“). Über ein Interview nach dem Scan ermittelten wir die emotionale Antwort der einzelnen Probanden auf die gezeigten Stimuli. Darüber hinaus werden die Imagingbefunde mit den Ergebissen einer umfangreichen psychometrischen Testbatterie korreliert. Wir werden hier erste Ergebnisse der PISO-Imaging Studie präsentieren und die mögliche Bedeutung für weitergehende Untersuchungen diskutieren. Zusammenhang zwischen Differenzierung im Emotionserleben und Mentalsierungsfähigkeit bei Patienten mit somatoformen Störungen und gesunden Kontrollen 1 1 1 2 Subic-Wrana C. , Knebel A. , Beutel M. , Lane R. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz 2 University of Arizona, Tucson Tucson, USA Es gibt bei Gesunden Hinweise, dass Alexithymie und die Einschränkung der Fähigkeit, sich und anderen mentale Zustände zuschreiben zu können, (ToM = Theory of Mind), miteinander in Beziehung stehen. Die Frage, ob Patienten mit somatoformen Störungen, bei denen Alexithymie als Krankheitshintergrund vermutet wird, in ihrer Mentalsierungsfähigkeit eingeschränkt sind, ist bisher noch kaum untersucht. Wir haben geprüft, ob a) Patienten mit somatoformen Störungen im Vergleich zu Gesunden in ihrer Mentalisierungsfähigkeit eingeschränkt sind und b) ob dieses Defizit mit einer Einschränkung der emotional-kognitiven Entwicklung einhergeht. N = 30 Patienten mit der ICD 10 – Diagnose einer somatoformen Störung und N = 30 nach Alter, Geschlecht und Bildung parallelisierte gesunde Kontrollen wurden mit dem Animationstest (Filmsequenzen, bei denen durch Zuschreibung von Intentionen ein Handlungsfaden in der Bewegung geometrischer Figuren erkannt werden kann; Castelli at al., 2000) und der Levels of Emotional Awareness Scale (LEAS, Lane et al, 1987) untersucht. Die Mentalisierungsfähigkeit der Patienten ist signifikant geringer ausgeprägt als die der Kontrollen; Patienten hatten besonders bei der Zuschreibung von Gefühlen zu anderen signifikant niedrigere LEAS-Werte als die Kontrollen. Die Ergebnisse verweisen darauf, dass Alexithymie bei dieser Patientengruppe mit der Einschränkung der Fähigkeit, eigene und fremde mentale Zustände antizipieren zu können, in Verbindung steht. Psychological Stress Modulates Cerebral Processing Of Visceral Pain In Healthy Woman: an fMRI Study 1 2 Rosenberger C. , Gizewski E. R. , Schedlowski 1 2 1 M. , Forsting M. , Elsenbruch S. 1 Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Essen, Hufelandstraße 55, 45122 Essen 2 Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie, Universitätsklinikum Essen, Hufelandstr. 55, 45122 Essen Aim: To address the effects of psychological stress on the cortical processing of visceral stimuli in healthy women. Methods: In 14 women, the neural response to non-painful and painful rectal distensions were measured in a control condition and during acute stress. The association of brain activation and chronic stress, assessed with the Perceived Stress Questionnaire (PSQ), was analyzed in a multiple regression on data from the control condition. In addition, brain activation in the stress condition was compared to the control condition with paired t-tests. Results: Chronic stress was associated with activation of the bilateral amygdala (AMY), right IC, left periaqueductal grey (PAG), and right dorsal posterior cingulate gyrus (dPCC) during non-painful stimulation. During painful rectal distensions, activation was observed in the right posterior IC, right PAG, left thalamus (THA), and right dPCC. Compared to the control condition, acute stress revealed activation of the right dPCC, left THA, and right S1 during painful stimulation. Conclusions: These data suggest an influence of chronic and acute stress on cerebral activation patterns during visceral stimulation, which may explain inter-individual differences in pain sensitivity and the role of stress in chronic pain conditions. S25: Misserfolge, Non-Response, negative Effekte und Nebenwirkungen von Psychotherapie (SPR) Negative Effekte als Thema der Psychotherapieforschung Strauß B. Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena, Stoystr. 3, 07740 Jena Der Beitrag soll in ein Symposium zum Thema Misserfolge, Non-Response, Negative Effekte und Nebenwirkungen von Psychotherapie einführen. Die Thematik wird in der Psychotherapieforschung relativ wenig behandelt, wenngleich sie klinisch höchst bedeutsam ist. Es gibt eine ganze Reihe von Einzelfallbeschreibungen und Kasuistiken, die zum Teil auch öffentliches Interesse erhalten haben. Der Beitrag versucht in Anlehnung an eine kürzlich verfasste Übersicht eine Systematik nega- 53 tiver und unerwünschter Folgen von Psychotherapie zu geben. Desweiteren werden die vorliegenden Befunde aus der Psychotherapieforschung kurz zusammengefasst und Fragen für die Forschung formuliert. Misserfolg, Risiken und Nebenwirkungen in der Verhaltenstherapie Jacobi F., Uhmann S., Hoyer J. Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Chemnitzer Strasse 46, 01187 Dresden Der Forschungsstand zu Misserfolgen, Nebenwirkungen oder gar Therapieschäden bei verhaltenstherapeutischer Behandlung ist nach wie vor unbefriedigend, u.a. weil Verschlechterungen als relativ seltene Ereignisse meist nicht berichtet bzw. "herausgemittelt" werden. Im Rahmen der Misserfolgsforschung muss die Individualebene (im Gegensatz zur Gruppenstatistik) und damit die klinische Signifikanz betrachtet werden. In diesem Beitrag werden Daten aus einer verhaltenstherapeutischen Ambulanz zu folgenden Ebenen therapeutischen Misserfolgs vorgestellt: 1. Therapie-Ablehnung vor eigentlichem Therapiebeginn; 2. Therapieabbruch während laufender Therapie; 3. Non-Responder, die nicht oder nicht ausreichend auf die angebotenen Behandlungen ansprechen; 4. Verschlechterungen im Zuge der Therapie; 5. Rückfälle (6Monats-Katamnese). Neben Zusammenhängen zwischen diesen Misserfolgs-Kategorien und Patientenvariablen (z.B. Hauptdiagnosen, Schweregrad) werden auch Zusammenhänge mit Variablen auf Angebotsseite (störungsspezifische Spezialambulanz mit erhöhtem Grad an Manualisierung und Supervision vs. keine derartige Einbindung, Therapie-Erfahrung der Behandler), sowie mit Patientenangaben zur Therapiebeziehung präsentiert. Ferner erfolgt ein Überblick über Nebenwirkungen, die in verhaltenstherapeutischen Therapien von Patientenseite berichtet werden (die aber nicht notwendigerweise mit negativem Outcome assoziiert sind). "Misserfolg, non-responder, differentielle Indikation - Strategien zur Analyse wenig erfolgreicher Psychotherapien" Willutzki U. Fakultät für Psychologie der Ruhr-Universität Bochum, Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universtitätsstr. 150, 44780 Bochum In diesem Beitrag soll zunächst ein Überblick über Strategien zur Analyse von Misserfolgen bzw. Abbrüchen in der psychotherapeutischen Behandlung gegeben werden. Dabei werden einerseits eher patientenorientierte Perspektiven zur Prädiktion ungünstiger Entwicklungen fokussiert; andererseits wird auf Vorgehensweisen zur Identifikation ab- weichender Entwicklungsprozesse (z.B. auf der Ebene der therapeutischen Beziehung oder der Aufnahmebereitschaft von Patienten) eingegangen. Die jeweiligen Strategien werden anhand von Beispielen zur Psychotherapie sozialer Ängste illustriert und kritisch diskutiert. S26: Spätfolgen des II. Weltkrieges - Epidemiologische, salutogenetische und therapeutische Aspekte (DGMP) Spätfolgen von Ausbombung, Vertreibung und Kriegserfahrungen - Ergebnisse einer repräsentativen Befragung 1 1 2 Brähler E. , Glaesmer H. , Kuwert P. 1 Selbständige Abteilung für Medizinische Psychologie und Soziologie, Universität Leipzig, Philipp-RosenthalStraße 55, 04103 Leipzig 2 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Greifswald im Hanseklinikum Stralsund, Rostocker Chaussee 70, 18437 Stralsund Hintergrund: Die Kriegsgeneration berichtet häufiger traumatische Erfahrungen und ist auch 60 Jahre nach dem II. Weltkrieg stärker von posttraumatische Belastungssymptomen betroffen als die nachfolgenden Generationen in Deutschland (Maercker et al., 2008). Methodik: Eine repräsentative Stichprobe deutscher Senioren (größer/gleich 60 Jahre) wurde nach Ausbombung, Vertreibung und schreckliche Erfahrungen bei einem Kriegseinsatz sowie zu Lebensqualität (SF-12), Depressivität (PHQ-9), Somatisierung (PHQ-15) und dem Arztinanspruchnahmeverhalten befragt. Ergebnisse: Von den 1.429 vor 1946 Geborenen hatten 15,5% (221) schreckliche Erfahrungen bei einem Kriegseinsatz gemacht, 13,9% (199) waren heimatvertrieben und 12,9% (184) ausgebombt. Die untersuchten kriegsbedingten Traumata wirken sich signifikant negativ auf die Lebensqualität aus, gehen mit erhöhter Depressivität und Somatisierung und einem erhöhten Arztinanspruchnahmeverhalten einher. Diskussion: Die Langzeitfolgen von Kriegserlebnissen für die psychische Gesundheit, Lebensqualität und für das medizinische Versorgungssystem sollen detailliert dargestellt werden. Gesundheitliche Folgen früherer Traumatisierungen bei Kriegskindern im Langzeitverlauf 1 1 1 1 Lieberz K. , Hiltl M. , Koudela S. , Bielmeier P. , 2 1 Franz M. , Schepank H. 1 Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, Psychosomatische Klinik, J 5, 68159 Mannheim, Deutschland 54 2 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, Bergische Landstrasse 2, 40629 Düsseldorf Hintergrund: In der Mannheimer Kohortenstudie werden seit 1978 insgesamt 600 Probanden, jeweils 200 der Jahrgänge 1935,1945 und 1955, zur Hälfte Frauen und Männer, hinsichtlich ihrer seelischen Gesundheit im Langzeitverlauf untersucht. Methodik: Grundlage der Untersuchung ist ein ausführliches halbstrukturiertes tiefenpsychologisches Interview im häuslichen Umfeld der Probanden. Ergänzt wurden die dabei gewonnenen Informationen durch den Einsatz verschiedener psychometrischer Instrumente. Dabei kam jetzt auch der KBF zum Einsatz. 24 Frauen und 26 Männer der Jahrgänge 1935 und 1945 wurden in die jetzige Untersuchung aufgenommen. Ergebnisse: Es läßt sich kein rein quantitaiver Zusammenhang zwischen kriegstraumatischen Erfahrungen und der späteren Falleigenschaft herstellen. Es besteht auch kein Zusammenhang zwischen traumatischen Kriegserfahrungen und im späteren Leben erfahrenen Traumatisierungen. Es ist allerdings ein Zusammenahng zwischen Traumatisierungen im Krieg wie auch im späteren Leben und dem Gesamtscore im KBF zu belegen. Falleigenschaft und KBFScore gehen nicht zusammen. Diskussion: Die Ergebnisse lassen erkennen, daß Zurückhaltung bei der einfachen Kausalverknüpfung des aktuellen Gesund-heitszustandes und früheren, jahrzehntelang zurückliegenden Lebenserfahrungen angebracht ist. Methodische Einschränkungen sind zu beachten. Soziale Anerkennung als Überlebender und Kohärenzsinn als Prädiktoren von posttraumatischer Reifung bei ehemaligen Kindersoldaten des II. Weltkrieges 1 2 3 Forstmeier S. , Kuwert P. , Spitzer C. , Freyberger 2 1 H. J. , Maercker A. 1 Psychologisches Institut der Universtität Zürich, Abteilung Psychopathologie und Klinische Intervention, Binzmühlestraße 14/17, 8050 Zürich, Schweiz 2 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Greifswald im Hanseklinikum Stralsund, Rostocker Chaussee 70, 18437 Stralsund 3 Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg Hintergrund: Im 2. Weltkrieg wurden vom Naziregime 200 000 deutsche Kinder und Jugendliche als Soldaten eingesetzt. Die Beobachtung, dass nur 2% von untersuchten ehemaligen Kindersoldaten heute signifikante PTSD-Symptome aufweisen, könnte unter anderem auf Prozesse der posttraumatischen Reifung zurückgeführt werden. Methodik: In einer Stichprobe von 103 ehemaligen Kindersoldaten des 2. Weltkrieges wurden das Ausmass an posttraumatischer Reifung (PTGI) und als potentielle Prädiktoren soziale Anerkennung als Überlebender (SAQ), Kohärenzsinn (SOC), Traumaschwere und weitere Faktoren erhoben. Traumatische Erlebnisse und PTSD-Symptome wurden mit der Potsttraumatischen Diagnostik-Skala (PDS) erhoben; ausserdem Depression, Angst und Somatisierung mit dem Brief Symptom Inventory (BSI). Ergebnisse: Anzahl der Traumata, Anerkennung durch nahe Personen und generelles Unverständnis als Facetten der sozialen Anerkennung, sowie Sinnhaftigkeit als Dimension des Kohärenzsinns korrelierten signifikant mit posttraumatischer Reifung. In einer multiplen hierarchischen Regressionsanalyse erwiesen sich die Anerkennung als Überlebender (SAQ) und Sinnhaftigkeit (SOC) als einzige signifikante Prädiktoren von posttraumatischer Reifung. Diskussion: Die Behandlung der PTSD in Personen, die kürzlich oder lange Jahre zuvor Kriegstraumatisierungen erlebt haben, sollte das Überzeugungssystem sowie die Rolle der Familie und sozialer Unterstützung berücksichtigen. Integrative Testimonial Therapie: eine Zeugnisbasierte Schreibtherapie für ältere Kriegstraumatisierte 1 2 2 Kuwert P. , Böttche M. , Knaevelsrud C. 1 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Greifswald im Hanseklinikum Stralsund, Rostocker Chaussee 70, 18437 Stralsund 2 Behandlungszentrum für Folteropfer e.V., Hintergrund: Abgesehen von Einzelfallstudien existieren bisher keine empirisch überprüften Behandlungsangebote für die Kriegsüberlebenden des II. Weltkrieges, die unter den Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung im nun höheren Lebensalter leiden. Methodik: Im Rahmen einer kontrollierten, randomisierten Interventionsstudie (N = 100) soll die Wirksamkeit einer speziell für ältere Kriegstraumatisierte entwickelten Schreibtherapie (Integrative Testimonial Therapie, ITT) untersucht werden. ITT kombiniert Elemente der Biographiearbeit mit kognitiv-behavioralen Ansätzen der Traumaexposition und der kognitiven Restrukturierung. Über einen Zeitraum von sechs Wochen schreiben die Patienten insgesamt mithilfe psychotherapeutischer Anleitung elf Texte. Altersbedingte Besonderheiten (u.a. Verlusterfahrungen, kognitive Einschränkungen etc. ) finden dabei explizite Berücksichtigung. Um einen möglichst breiten und niedrigschwelligen Zugang zu gewähren, wird die Therapie sowohl internetbasiert als auch postalisch angeboten. Ergebnisse: Erste Ergebnisse zur Akzeptanz und Wirksamkeit werden vorgestellt. Diskussion: Potential, Herausforderungen und Grenzen der ITT werden vor dem Hintergrund der vorgestellten Daten diskutiert und ein Ausblick auf anstehende Weiterentwicklungen gegeben. 55 S27: Development of a New Generation of Patient-Reported Outcome (PRO) Measures (English Track) Introduction into Item Response Theory and Computer Adaptive Testing Bjorner J. National Research Centre for the Working Environment, University Copenhagen &amp; QualityMetric, Inc., Boston, Item banks and Computerized Adaptive Testing (CAT) have the potential to greatly improve the assessment of health outcomes. CATs promise to provide more precise and less burdensome instruments, and IRT item banks will help comparing established tools to move away from an instrument defined measurement towards greater standardization of Patient- Reported Outcome (PRO) measures. This presentation describes the features of item banks and CAT and discusses how to develop item banks. In CAT, a computer selects the items from an item bank that are most relevant for and informative about the particular respondent; thus optimizing test relevance and precision. Item response theory (IRT) provides the foundation for selecting the items that are most informative for the particular respondent and for scoring responses on a common metric. The development of an item bank is a multi-stage process that requires a clear definition of the construct to be measured, good items, a careful psychometric analysis, and a clear specification of the final CAT. The psychometric analysis needs to evaluate the assumptions of the IRT model such as unidimensionality and local independence; that the items function the same way in different subgroups of the population; and that there is an adequate fit between the data and the chosen item response models. Although medical research can draw upon expertise for educational testing the development in the medical field encounters unique opportunities and challenges. Development of the KIDSCREEN– An European Initiative to Improve Health Assessment for Children. Ravens-Siebener U., Erhart M. Department of Psychosomatics in Children and Adolescents, University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, The KIDSCREEN Project - founded by the EC and involving 13 European countries aims on a crosscultural simultaneously development, testing and implementation of a generic measure of HrQoL for children and adolescents. After item generation using delphi methods and focus groups a pilot test of the project resulted in a data set of 3019 children and adolescents (8 to 18 years). IRT techniques allowed identifying most informative items, showing no differential item functioning (DIF) cross- culturally. Finally, an instrument with 52 items was constructed which assess 10 HrQoL dimensions. The KIDSCREEN-52 was administered to a representative sample of 22,827 children and adolescents (8 to 18 years) in 13 European countries. Scaling success (MAP) was > 97.8% and item fit (INFITmsq) ranged from 0.80 to 1.27. No sizeable differential item functioning (DIF) was found by age, gender or health status. The specified SEM fitted the data well (RMSEA: 0.06). Statistically significant differences between children with and without physical and mental health problems were found in all dimensions. All dimensions showed a gradient according to socio-economic status. The development of the KIDSCREEN is one of a growing number of large international studies utilizing IRT techniques for an enhanced instrument development. IRT based instruments are promising way to build culturally sensitive measurements, and provide the basis to utilize the efficiency provided by CATs. The Patient-Reported Outcome Measurement Information System (PROMIS)– A NIH Keyroad Initiative to Utilize CATs for Health Outcome Measurement Rose M. Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg The U.S. National Institutes of Health (NIH) Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Roadmap initiative (www.nihpromis.org) is a 5-year cooperative group program of research designed to develop, validate, and standardize item banks to measure patientreported outcomes (PROs) relevant across common medical conditions. PROMIS aims to apply IRT and CAT to transform the way patient-reported outcome tools are selected and employed for accurate and efficient measurement of PROs in clinical research and practice. The network consists of 6 primary research sites (PRS), a statistical coordinating center (SCC), and NIH research scientists. The domain mapping process is built on the World Health Organization (WHO) framework of physical, mental, and social health. From this framework, pain, fatigue, emotional distress, physical functioning, social role participation, and global health perceptions were selected for the first wave of testing which was completed in 2007. 21,133 participants have answered different subsets of items. IRT-based analysis of 11 large datasets supplemented and informed item-level qualitative review of nearly 7000 items in the item library. First results indicate that the PROMIS scales will provide a higher measurement precision over a wider range than established legacy tools, with 56 minimal respondent burden. All PROMIS tools will be publically available for non-commercial use. S28: Ergebnisse imaginativer Psychotherapie in ambulanter und stationärer Versorgung Psychotherapie mit Imaginationen als Mentalisierungshilfe Sachsse U. Asklepios Fachklinikum Göttingen; FB Psychotherapie und Tagesklinik, Rosdorfer Weg 70, D-37081 Göttingen Psychotherapie, die strukturiert mit einem Übergangsraum arbeitet, galt bei erwachsenen PatientInnen lange als zweitklassig gegenüber rein verbalen Vorgehensweisen, ganz im Gegensatz zur etablierten Spieltherapie bei Kindern. Ihre Indikation galt als beschränkt auf Patienten, die in ihrer reifen Verbalisierungsfähigkeit als eingeschränkt, fast behindert galten. Das beeinträchtigte die Auseinandersetzung mit Verfahren wie Psychodrama, Gestalttherapie, Katathym Imaginativer Psychotherapie KIP. In der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie wächst in den letzten Jahren die Bereitschaft, aus theoretischen Fortschritten und Einsichten Konsequenzen für die Entwicklungen der Behandlungstechnik zu ziehen. Lange Zeit stand einer höchst differenzierten, sich kontinuierlich entwickelnden psychodynamischen Theorie eine fast steinern erstarrte Technik gegenüber. In der Auseinandersetzung mit der Therapie von komplexen Posttraumatischen Störungen und Borderline-Patienten hat sich ein breites technisches Experimentierfeld geöffnet (Psychodynamisch Imaginative TraumaTherapie PITT, Transference Focused Psychotherapy TFP, Dialektisch Behaviorale Therapie DBT, Mentalization Based Treatment MBT, Schematherapie). Imaginationen spielen in verschiedenen dieser Vorgehensweisen eine große Rolle. Dies wird verständlich, wenn man sich deutlich macht, dass Mentalisierung und Imagination untrennbar sind. Es liegt nahe, Imaginationen als Mentalisierungshilfe therapeutisch zu nutzen. „Evaluation ambulanter Behandlungen mit Katathym Imaginativer Psychotherapie“ 1 2 3 Imruck B. H. , Bahrke U. , Sachsse U. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz 2 Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt/Main, Myliusstr. 20, 60323 Frankfurt/Main 3 Asklepios Fachklinikum Göttingen; FB Psychotherapie und Tagesklinik, Rosdorfer Weg 70, D-37081 Göttingen Im Jahr 2001 begann unter der Leitung von Herrn Dr. med. Ulrich Bahrke die Evaluationsstudie zur Wirksamkeit ambulanter Behandlungen Katathym Imaginativer Psychotherapie (KIP). Es beteiligten sich bisher 15 TherapeutInnen, die insgesamt 23 Behandlungen nach den Angaben des Studiendesigns durchführten und zum Teil noch immer durchführen. Das Studiendesign gab vor, PatientInnen der Störungsbilder (1) Affektive Störungen, (2) Angststörungen sowie (3) Dissoziative und somatoforme Störungen im Alter von 18 – 60 Jahren einzuschließen. Zudem musste mindestens in jeder vierten Sitzung mit der Methode der KIP gearbeitet werden. Auf eine Wartekontrollgruppe wurde verzichtet. Stattdessen mussten alle PatientInnen nach der Probatorik drei Monate auf den Therapiebeginn warten, um eine Spontanremission ausschließen zu können. Ziel der Studie ist nicht nur, einen Beitrag zur Wirksamkeitsforschung psychodynamischer und besonders der Katathym Imaginativen Therapie zu leisten, sondern auch aufzuzeigen, dass die Arbeit mit der KIP den PatientInnen dabei hilft, einen besseren Zugang zu ihren Emotionen zu erlangen. Im Rahmen des Vortrages werden die Ergebnisse der 23 Behandlungen präsentiert und zur Diskussion gestellt. Imagination in der Traumatherapie: Ergebnisse einer Verlaufsbeobachtung mindestens 3 Jahre nach Abschluss der stationären Behandlung 1 2 1 Müller S. , Spang J. , Sachsse U. 1 Asklepios Fachklinikum Göttingen; FB Psychotherapie und Tagesklinik, Rosdorfer Weg 70, D-37081 Göttingen 2 Zentrum für Psychosoziale Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg Das integrative Konzept der Station 9 im Asklepios-Fachklinikum-Göttingen vereint die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie (PITT; Reddemann), EMDR (Shapiro) sowie Elemente der DBT (Linehan). Behandelt werden Frauen mit komplexen posttraumatischen Symptombildern – überwiegend nach Typ-II-Traumata. Bislang fehlen empirische Untersuchungen zu Chancen und Grenzen hinsichtlich der langfristigen allgemeinen und störungsspezifischen Therapieerfolge für diese Zielgruppe. Zielsetzung der vorliegenden Studie ist daher eine erste Datengewinnung zum langfristigen Verlauf der Patientinnen nach der stationären Behandlung bezüglich Symptomatik, Lebensqualität sowie Inanspruchnahme von Versorgungsmaßnahmen. Zum Zeitpunkt des Therapiebeginns wurde eine Standarddiagnostik in Form strukturierter Interviews durchgeführt und ergänzt um verschiedene psychometrische Verfahren. Alle ehemaligen Patientinnen, die spätestens im Jahr 2004 die stationäre Behandlung beendeten, bekamen die bekannten Fragebögen erneut zugesendet. Ein Teil dieser Frauen war bereit, an einem standardisierten diagnostischen Interview teilzunehmen. Die 57 retrospektive Untersuchung zeigt, dass die Erinnerung an die Traumata langfristig bestehen bleibt – es zeigen sich jedoch deutliche, statistisch hochsignifikante, Verbesserungen in störungsspezifischen und angrenzenden Symptombereichen, im Coping-Verhalten, in der Lebensqualität und allgemeinen psychischen Belastung. Eine prospektiv angelegte Studie ist in Vorbereitung. S29: Qualitative Psychotherapieforschung – ein Gewinn für die Praxis? Freud und die Abduktion von neuen Erkenntnissen Stuhr U. (Hamburg), Fittschen B. In jeder Wissenschaft ist relevant, wie neue Erkenntnisse überhaupt entstehen und ob diese ersten Erkenntnisprozesse logisch nachvollziehbar oder rein intuitiv ablaufen. Durch den Begriff der Abduktion von Peirce scheint auf diesem heuristischen Weg ein logischer Weg begehbar. Am Fallbeispiel Freuds „Anna O.“ soll diese Abduktion erläutert werden. Sind Ergebnisse aus qualitativen Psychotherapiestudien übertragbar? 1 2 Lindner R. , Briggs S. 1 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, TherapieZentrum für Suizidgefährdete, Martinistr. 52, 20246 Hamburg 2 Tavistock Clinic, Adolescent Department, 120 Belzise Lane, NW3 5BA London, Groß Britannien Ziel:Untersuchung des Begriffs der "Transferierbarkeit" in der qualitativer Psychotherapieforschung. Forschungsdesign: Unter Anwendung der Methode der "Verstehenden Typenbildung" wurde eine qualitative Taxonomie suizidaler Männer entwickelt. Die entwickelten Idealtypen: (!) "Unverbunden": Vorherrschen von Gefühlen der Unverbundenheit (2) "Gekränkt": Aggressionskonflikte und die Realisierung einer desillusionierenden Lebensrealität, (3) "Stürmisch": Verschweißtsymbiotisches Übertragungsangebot aktiviert unrealistische Helferwünsche, (4) "Objektabhängig": Konkretistisch muß im Fall der Trennung die Frau zurück gewonnen werden. In einem zweiten Schritt wurde das gesamte Fallmaterial von einer weiteren, unabhängigen Psychotherapeutengruppe nach den vorgegebenen Schritten erneut bearbeitet. Ergebnisse: Die zweite Gruppe entwickelte drei Idealtypen: (1) "zurückgezogene Looser": Männer mit einem dünnhäutigen Narzissmus, die jeden Beziehungskonflikt als einen Angriff erleben und Aggressivität projizieren, (2) "Sadomasochistisch- verschweißt": Die Paare ikönnen weder zusammen noch getrennt sein; diese Dynamik wiederholt sich in der therapeutischen Beziehung und (3) "Psychotisch-unrealistisch": Verlieben in der Therapie ist ein Versuch, Trennungs- und Auflösungsängste zu beherrschen. Folgerungen: In Bezug auf das klinische Veständnis der Fälle kamen beide Forschergruppen zu ähnlichen Beurteilungen, die dann unterschiedlich theoretisch-psychoanalytisch begründet wurden. Qualitative Forschung in der Psychoonkologie 1 2 Frommer J. , Heine V. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin, Universität Magdeburg 2 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Magdeburg, Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg Qualitative Forschung gewinnt nicht nur in der Psychotherapieforschung, sondern auch in der Psychosomatik zunehmend an Gewicht. Unser Übersichtsreferat beginnt mit einer kurzen Einführung in die qualitative Forschungs- und Publikationskultur in diesem Feld. Anschließend werden die besonders praxisrelevanten Ergebnisse aus zwei eigenen Foorschungsprojekten referiert. Im ersten Projekt wurden subjektive Krankheitstheorien, Ursachenzuschreibungen und Behandlungserfahrungen von Leukämiepatienten in einem Follow-upProjekt über 3 Zeitpunkte mit Interviews evaluiert. Die Ergebnisse geben einen lebendigen Eindruck über das Erleben der Patienten, einschließlich des response shifts über den Gesamtzeitraum. Das zweite Projekt ist autobiographisch-narrativen Interviews nach akuter Leukämie gewidmet. Fokussiert wird hier auf die Frage, durch welche subjektiven Überzeugungen es den Überlebenden gelingt, nach überstandener Todesangst, Verzweiflung und Mutlosigkeit, der negativen Verlaufskurvendynamik ihres Copingprozesses zu entrinnen und zu einer positiven Zukunftserwartung zurückzukehren. S30: Diabetes und Depression – eine Herausforderung für die Psychotherapie und Psychosomatik (DIAMANT) Depression und Diabetes– eine verhängnisvolle Interaktion Kulzer B. Forschungsinstitut der Diabetes Akademie Mergentheim (FIDAM), Postfach 1144, 97961 Bad Mergentheim Diabetespatienten haben gegenüber der Allgemeinbevölkerung ein deutlich erhöhtes Risiko, an 58 einer Depressivität (subklinische Form) zu leiden oder an einer Depression (entsprechen den ICD bzw. DSM Kriterien) zu erkranken. Gleichzeitig haben depressive Patienten auch ein höheres Manifestationsrisiko für Typ 2 Diabetes. Depressivität geht bei Menschen mit Diabetes mit einem ungünstigen Krankheits- und Therapieverhalten, eingeschränkter Lebensqualität, einer schlechteren glykämischen Kontrolle, einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von Folgeerkrankungen sowie einem erhöhten Mortalitätsrisiko einher. Als Ursache dafür werden sowohl neuroendokrinologische Veränderungen als auch ein ungünstiges Therapieund Krankheitsverhalten diskutiert. Ein zentrales Problem stellt die frühzeitige Identifikation von depressiven Diabetikern dar. In den aktuellen Leitlinien wird neuerdings ein Depressionscreening bei Diabetikern empfohlen. Die Ergebnisse von Therapiestudien deuten darauf hin, dass Psychotherapie, Antidepressiva und strukturierte Interventionskonzepte hilfreich sind, um bei depressiven Patienten mit Diabetes die Depressivität zu verringern und das Therapieverhalten zu verbessern. Neuroimmunologie als Bindeglied zwischen Diabetes, Depression und PTSD Rose B. Institut für Klinische Diabetologie, Deutsches DiabetesZentrum, Leibniz-Zentrum an der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, Auf'm Hennekamp 65, 40225 Düsseldorf Epidemiologische Studien zeigen, dass Personen mit Diabetes mellitus Typ 2 eine im Vergleich zur Normalbevölkerung höhere Prävalenz für eine klinisch manifeste Depression ebenso wie für eine subklinische Depression haben. Das Vorliegen beider Erkrankungen erhöht das Risiko für das Auftreten von diabetischen Komplikationen und das Mortalitätsrisiko. Auf der anderen Seite ist eine manifeste Depression auch ein Risikofaktor für die Entwicklung eines Typ 2 Diabetes, so dass sich die Frage nach den zugrunde liegenden Mechanismen stellt. Neben den klassischen Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht, BMI, sozioökonomischer Status, belastenden Lebensereignissen und chronischen Erkrankungen ist eine Depression mit neurobiologischen Veränderungen verbunden. Hier sind nicht nur Veränderungen von systemischen Spiegeln von Stresshormonen zu beobachten, sondern auch subklinische Inflammationsprozesse. Für diese konnte bereits mehrfach gezeigt werden, dass sie eine Rolle in der Entwicklung des Typ 2 Diabetes und der Adipositas spielen. Auch für die posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) werden ähnliche Mechanismen diskutiert. Es konnte gezeigt werden, dass akuter psychischer Stress zu Veränderungen von systemischen Immunmediatorspiegeln ebenso wie zu einer veränderten Genexpression in Immunzellen führen kann. Somit stellt die Verbindung zwischen Psyche und Im- munsystem ein mögliches Bindeglied zwischen Depression, PTSD und Typ 2 Diabetes dar. Von der Edukation zur Psychotherapie– Wege der Depressionsprophylaxe bei Menschen mit Diabetes Hermanns N. Forschungsinstitut der Diabetes Akademie Mergentheim (FIDAM), Postfach 1144, 97961 Bad Mergentheim Bei Diabetikern treten subklinische als auch klinische Depressionen signifikant häufiger auf als in der nichtdiabetischen Allgemeinbevölkerung. Klinische als auch subklinische depressive Störungen haben negative Auswirkungen auf das Selbstbehandlungsverhalten, die glykämische Kontrolle und damit langfristig auf die Prognose der Erkrankung. Es ist davon auszugehen, dass eine suboptimale Bewältigung diabetesspezifischer Belastungen und Stressoren zum Auftreten subklinischer Depressionen beiträgt (1). Die Verminderung von diabetesbezogenen Belastungen stellt einen viel versprechenden Ansatz dar, erhöhte Depressionssymptome zu reduzieren und hierdurch das Auftreten einer klinisch depressiven Störung zu vermeiden. Nach Teilnahme an einer Diabetikerschulung, in denen Kompetenzen und Fertigkeiten zu einer optimierten Diabetesbehandlung vermittelt werden, ist eine Verminderung der Depressivität nachweisbar. Es kann vermutet werden, dass durch eine Diabetikerschulung Kompetenzen zur Bewältigung diabetesbezogener Belastungen gestärkt wurden (2). Ebenso zeigt sich, dass ein Monitoring des psychischen Wohlbefindens und ein aktives Feedback zu einem signifikant verbesserten psychischen Befinden führt (3). In diesem Vortrag sollen daher Möglichkeiten einer Depressionsprävention durch aktives Ansprechen der psychischen Befindlichkeit und Reduktion diabetesbezogener Belastungen durch diabetesspezifische Edukationskonzepte bei Diabetikern mit subklinischer Depression aufgezeigt werden. Methoden und Effekte psychosomatischer/psychotherapeutischer Interventionen bei Patienten mit Diabetes und Depression 1 2 Kruse J. , Icks A. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, Bergische Landstrasse 2, 40629 Düsseldorf 2 Deutsches Diabetes Zentrum an der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, Auf´m Hennekamp 65, 40225 Düsseldorf Menschen mit Diabetes, die eine depressive Symptomatik entwickeln, weisen im Vergleich zu nicht depressiven Diabeteserkrankten eine geringere Lebensqualität, stärkere funktionelle Beeinträchti- 59 gungen, ein erhöhtes Risiko für Folgeerkrankungen sowie ein erhöhtes Mortalitätsrisiko auf. Dieses kann einerseits bedingt sein durch ein ungünstiges Krankheitsverhalten, das mit einer depressiven Symptomatik verbunden ist, aber auch durch die mit der depressiven Symptomatik assoziierten psychophysiologischen Veränderungen. Ziele der psychosomatisch-psychotherapeutischen Interventionen bei depressiven Patienten mit Diabetes sind daher nicht nur die Reduzierung der depressiven Symptomatik, sondern auch die Verbesserung der Krankheitsbewältigung und des Selbstbehandlungsverhaltens sowie die Beeinflussung des somatischen Krankheitsverlaufs. In einem Review werden im Vortrag die Therapiemethoden und aktuellen Ergebnisse der psychotherapeutischen/ psychosomatischen Interventionsstudien bei depressiven Patienten mit Diabetes dargestellt. Die Studien legen nahe, dass sich neben der Symptomreduktion im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung auch die Blutzuckereinstellung verbessert. Eine erste Studie weist auch auf die sinkende Mortalität im Rahmen der antidepressiven Behandlung hin. Methodische Grenzen der Studien werden diskutiert. Eine aktuell von der Bundesärztekammer geförderte Interventionsstudie zur psychosomatischen Intervention bei Menschen mit Diabetes wird vorgestellt. S31: Körper und Neurobiologie Der Körper als Objekt der Psyche Stirn A., Thiel A., Thiel J., Oddo S. Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Bereich Psychosomatik, Heinrich-Hoffmann-Straße 10, 60528 Frankfurt a.M. In den letzten Jahren konnte in eigener Forschungsarbeit festgestellt werden, dass Körpermodifikationen (Tattoo und Piercing) allgemein zunehmen: Im Alter von 15-25 Jahren haben 41% der weiblichen und 28% der männlichen Bevölkerung ein Tattoo oder Piercing. Ebenso haben schönheitschirurgische Eingriffe zugenommen. Die Motivation und psychologischen Hintergründe hängen häufig mit der Körperidentität zusammen. Der Körper fungiert als Objekt der Psyche und reagiert auf psychische Belastungen interindividuell unterschiedlich. Veränderungen am Körper können psychopathologische Formen annehmen, wie z.B. im Falle von Selbstverletzungen oder Essstörungen. Die eigene Körperwahrnehmung und – identität spielen für das Verständnis psychosomatischer Erkrankungen eine zentrale Rolle. Mittels verschiedener testpsychometrischer Verfahren, sowie funktioneller Bildgebung untersuchen wir psychopathologische Prozesse unterschiedlicher Formen von Körpermodifikationen, sowie neuronale Korrelate der Körperidentität. Unsere Ergebnis- se weisen darauf hin, dass bei ca. 50% aller Körpermodifikationen psychische Symptome vorliegen. Erste fMRT-Befunde zu dem bisher kaum erforschten Syndrom, der "Body Integrity Identity Disorder" (BIID), dass dabei auf neuronaler Ebene eine andere Körperidentität vorliegt als bei Kontrollpersonen ohne BIID. Die vorliegenden Ergebnisse erweitern das Verständnis über die Interaktion von Körper und Psyche und geben Raum für die Entwicklung neuer therapeutischer Möglichkeiten. Neuronale Erkenntnisse bei Patienten mit selbstverletzendem Verhalten Thiel J., Thiel A., Oddo S., Hödl K., Prieto Gill L., Stirn A. Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Bereich Psychosomatik, Heinrich-Hoffmann-Straße 10, 60528 Frankfurt a.M. Patienten mit selbstverletzendem Verhalten (SVV) haben den Drang, sich selbst in einer direkten und bewussten Art und Weise zu verletzen. Die Methoden sind äußerst verschieden und reichen von Schneiden über Verbrennen bis hin zu Verätzungen. Das Verhalten tritt meist zwischen dem 14. und 24. Lebensjahr erstmals auf und häufig sind Komorbiditäten mit PTSD, Essstörungen und Substanzmissbrauch vorhanden. Die höchste Konkordanz besteht jedoch zur BorderlinePersönlichkeitsstörung. In unserer Studie wird mittels funktioneller Magnetresonanztomographie untersucht, ob sich auf neuronaler Ebene Unterschiede zwischen Patienten mit SVV und gesunden Kontrollprobanden beim Betrachten von symptombezogenen und emotionalen Bildern zeigen. Es werden Bilder aus den Kategorien Freude, Liebe, Trauer, Trennung, Suizid und SVV präsentiert. Das Stimulus-Material wurde selbst zusammengestellt und an einer unabhängigen Kontrollgruppe validiert. Zusätzlich zum diagnostischen Erstgespräch erhalten die Patienten einige Tests zur genaueren Analyse des SVV, der Risikofaktoren und der Ätiologie. Erste Ergebnisse zeigen einen deutlichen Unterschied zwischen den Patienten mit SVV und den Kontrollprobanden bei Betrachten der krankheits-assoziierten Bilder. Entscheidend scheinen dabei der anteriore cinguläre sowie der orbitofrontale Kortex, Amygdala und Hippokampus zu sein. Ziel der Studie ist das genaue Verständnis der Störung zur Entwicklung einer gezielteren Therapie. Neue neuronale Substrate bei Subgruppen von Zwangserkrankungen 1 1 2 3 Thiel A. , Oddo S. , Markowitsch H. J. , Brand M. , 3 3 1 Langnickel R. , Heinicke A. , Stirn A. 60 1 Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Bereich Psychosomatik, Heinrich-Hoffmann-Straße 10, 60528 Frankfurt a.M. 2 Universität Bielefeld, Abteilung für Psychologie, Postfach 10 01 31, 33501 Bielefeld 3 PRIVAT, Patienten mit Waschzwang leiden unter ständiger Angst vor Kontamination und waschen sich mehrere Stunden täglich. Die Ätiologie dieses Störungsbildes ist wissenschaftlich bisher wenig erforscht. Untersuchungen auf neuronaler Ebene konnten Aktivitätsveränderungen im orbitofrontalen Kortex, im anterioren Gyrus Cinguli und im Striatum nachweisen. Ferner wurden auch Störungen des orbitofrontalen Regelkreises gefunden. Wir untersuchten erstmalig ausschließlich Waschzwangpatienten im Vergleich zu alters- und geschlechtsgepaarten Kontrollprobanden. Waschzwang wurde mittels diagnostischem Interview sowie mittels zweier Fragebögen (HZI-K, Y-BOCS) erfasst. Während der fMRT-Messung wurden den Teilnehmern verschiedene Bilderkategorien im Blockdesign präsentiert. Hierbei handelte es sich um autosexuelle -, aggressive -, ekel -, Wasser- sowie neutrale Bilder. Waschzwang-Patienten reagieren auf Ekelbilder mit einer höheren Aktivierung des Parahippocampalen Gyrus, also mit der Involvierung ihres Emotionsgedächtnisses. Besonders subkortikale Regionen weisen auf eine stärker emotionale, überwiegend negative Verarbeitung von Aggressionen, bei der Betrachtung der aggressiven Bilder, hin. Die Aktivierung des posterioren Cingulums sowie des Precuneus beim Betrachten von ambivalent besetzen Wasserbildern deutet auf den hohen Selbstbezug und die visuelle Imagination der Patientin im Umgang mit Wasser hin. Ableitbare Therapieindikationen beinhalten einen Fokus auf Emotionsreguliersstrategien. Body Integrity Identity Disorder: Gibt es ein neuroanatomisches Korrelat? Oddo S., Thiel A., Skoruppa S., Stirn A. Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Bereich Psychosomatik, Heinrich-Hoffmann-Straße 10, 60528 Frankfurt a.M. "Body Integrity Identity Disorder" (BIID) ist ein bisher wenig bekanntes Störungsbild, das durch einen überwältigenden Amputationswunsch eines oder mehrerer, gesunder Körperglieder, gekennzeichnet ist. Unsere umfangreichen Fragebogenuntersuchungen haben darlegen können, dass es sich bei BIID um sehr leistungsfähige, hochintelligente und hoch autonome Menschen, oftmals Männer, handelt, die an keiner bisher bekannten psychischen Erkrankung leiden. Weltweit erstmalig führen wir eine fMRT-Studie zu dem bisher kaum erforschten Syndrom durch. Den Betroffenen wurden mittels Bildbearbeitungsprogramm bearbeitete Amputationsfotos von sich selbst, Fotos mit Prothesen sowie mit dem aktuellen Körperbild im MRT dargeboten. Darüber hinaus wurden dieselben drei Kategorien von einer fremden Person gezeigt. Die Gruppe der BIIDler wurde außerdem mit einer Kontrollgruppe verglichen. Die bildgebenden Untersuchungen zeigten eine Aktivitätserhöhung im motorischen als auch somatosensorischen Kortex bei der Betrachtung ihres Körpers mit der Wunschamputation im Vergleich zu ihrem derzeitigen Erscheinungsbild. Die Beteiligung dieser Kortexareale weist auf eine sensomotorische Verarbeitung sowie auf eine unterschiedliche Körperrepräsentation hin. Die vorliegenden Ergebnisse erweitern das Verständnis über die Interaktion von Körper und Psyche und geben Raum für die Entwicklung neuer therapeutischer Möglichkeiten. S32: Möglichkeiten und Ergebnisse der Aktivierung persönlicher Ressourcen in der Psychosomatik Aktivierung persönlicher Ressourcen bei traumatisierten Patienten: Erfahrungen im Vorfeld einer bildgebenden Studie Schellong J., Joraschky P. Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, In der Placeboforschung wird die Imagination und die persönliche Bewertung als starker Einflussfaktor beschrieben. Zubieta vermutet, dass vor allem Gedanken und Gefühle physiologische Abläufe im Körper verändern könnten. In bestimmten Hirnregionen würden durch Hoffnung und Optimismus Mechanismen aktiviert, die gegen Krankheiten und Stress ankämpften. Grawe postuliert Ressourcenaktivierung als einen wichtigen Wirkfaktor der Psychotherapie. Nach AWMF Leitlinien zur Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) stehen insbesondere in der ersten Phase der Behandlung ressourcenorientierte Interventionen im Vordergrund. Standardisierte traumatherapeutische Verfahren, wie EMDR, bauen stabilisierende Elemente regelmäßig ein. Neurobiologische und psychophysiologische Untersuchungen in der PTSD- Forschung zeigen, dass durch Expositionsbehandlung bei PTBS eine veränderte hirnphysiologische Reaktionen auf Traumaaktivierung gemessen werden kann (Sack). Untersuchungen zu Veränderungen nach der Anwendung von ressourcenaktivierenden Methoden gibt es jedoch kaum. In dieser Studie wird untersucht, ob bei Ressourcenaktivierung ein Einfluss auf neurophysiologische Mechanismen messbar ist. Grundkonzept ist die Konfrontation von Probanden in der Versuchssituation mit traumatischen Erinnerungen „Traumaskript“ im Vergleich zur Konfrontation mit positiv Erinnerungen „Ressourcenskript“ als intraindivi- 61 dueller und als Gruppenvergleich zwischen gesunden Probanden und Patienten. Zur Bedeutung und Effektivität einer ressourcenorientierten Psychotherapie bei psychosomatischen Patienten 1 1 2 Jasper S. , Lempa W. , Gündel H. 1 Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover tagesklinisch-stationären Setting und die bisherigen Erfahrungen damit berichtet. Das Anknüpfen an den Ressourcen der Patienten in der Therapiezielarbeit, in der Dosierung und der Auswahl der therapeutischen Angebote hat sich sehr bewährt. Die Weiterentwicklung geht in eine Optimierung der eben genannten Aspekte und in einen Ausbau und Fundierung der Ressourcenaktivierung durch die Schaffung eines entsprechenden therapeutischen Klimas im therapeutischen Team und in einer Strukturierung des stationären und teilstationären Alltags. 2 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Str. 1,, 30625 Hannover Es soll die mögliche Relevanz der Ressourcenaktivierung für die zukünftige psychotherapeutische Arbeit aufgezeigt werden. Dazu wurden bei 20 psychosomatischen Patienten erstmals bei stationärer Aufnahme sowie wiederholt nach vier Wochen lösungs- und konfliktorientierter Behandlung Daten mit dem Fragebogen zur Ressourcenselbsteinschätzung (RES) (Trösken & Grawe, 2002; 2003) erhoben und mit den Werten von 20 gesunden Probanden verglichen. Vor Beginn der stationären Psychotherapie zeigten sich hypothesenkonform deutliche Mittelwertsunterschiede zwischen der Patientenstichprobe (TG) und der gesunden Kontrollgruppe (KG) hinsichtlich der aktuellen Ressourcenrealisierung (TG: Mt1= 20,96 vs. KG: Mt1=27,07). Die Patientenstichprobe zeigte über den Verlauf eine Verschiebung der Verteilung der Werte hin zu einem höheren Wert (von Mt1 = 20,62 auf Mt2 = 23,68). Varianzanalytisch zeigte sich ein statistisch bedeutsamer Interaktionseffekt zwischen der Gruppen- und der Zeitvariable (p < ,01). Die bedeutsamen Unterschiede zwischen den Ausgangswerten der klinischen und der nichtklinischen Stichprobe sowie die signifikante Verbesserung der aktuellen Ressourcenrealisierung in der Patientenstichprobe verdeutlichen die starke Bedeutsamkeit einer ressourcenorientierten Therapie und einer vorangehenden Ressourcendiagnostik. Eine integriert tagesklinisch-stationäres Setting zur Ressourcenaktivierung – psychodynamische Aspekte und klinische Erfahrungen Lempa W. Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, CarlNeuberg-Strasse 1, 39625 Hannover Eine erweiterte Psychodynamik für chronifizierte psychische Störungen (ergänzt um Funktion der Symptomatik, den Chronifizierungsprozess, bisherige Lösungsversuche) wird vorgestellt, die u.a. eine Ressourcenaktivierung als primäre therapeutische Strategie begründet. Danach wird die Umsetzung der Ressourcenaktivierung in einem integriert Entwicklung eines Gruppenangebots zur Aktivierung persönlicher Ressourcen in der psychosomatischen Tagesklinik Gerlach D., Kulinna U. Abteilung für Psychosomatische Medizin, Psychotherapie und medizinische Psychologie, tech. Univ. München, Klinikum rechts der Isar, Langerstr 3, 81675 München In der Aufbauphase unserer Tagesklinik für Stabilisierung und Ressourcenförderung entwickelten wir ein Gruppenangebot, das sich intensiv und explizit der Aktivierung persönlicher Ressourcen widmet. Dies trägt der Erkenntnis Rechnung, dass Ressourcenaktivierung mittlerweile als ein Hauptwirkfaktor von Psychotherapie angesehen werden muss. Mit therapeutischen Interventionen, welche die persönlichen Ressourcen fokussieren, konnten wir unsere Patienten deutlicher als sonst für das Erreichen neuer Ziele motivieren. Um den Effekt systematisch herzustellen konstruierten wir ein halbstandardisiertes 8-wöchiges Gruppenprogramm mit zwei Sitzungen pro Woche. Es enthält eine Mischung aus hypnotherapeutischimaginativen Interaktionsspielen, Bausteinen aus der DBT nach Linehan, ressourcenbezogenen psychoedukativen Sequenzen und ausgewählten Techniken sozialen Kompetenztrainings. Das Spektrum an ersten Erfahrungen und Rückmeldungen reicht von Überraschung und Begeisterung bis zur Irritation durch die Fokussierung auf Ressourcen. Die Atmosphäre in der eher hoch strukturierten und damit von Neugier und Entlastung geprägten Gruppe ist meist heiter, besonders die spielerischen Sequenzen machen Patienten und Therapeuten gleichermaßen Spaß. Derzeit findet eine Verfeinerung der Gruppe durch Erweiterung der spielerischen Sequenzen und Abtrennung der DBT-Sequenzen statt. Diese Umstrukturierung wird unter dem Aspekt der Patientenzufriedenheit evaluiert, erste Daten hierzu werden vorgestellt. S33: Fibromyalgie: Psychotherapie Neurobiologie 62 und Psychotherapie des Fibromyalgie-Syndroms– eine Meta-Analyse kontrollierter Studien 1 2 1 1 Bernardy K. , Füber N. , Köllner V. , Häuser W. 1 Fachklinik für Psychosomatische Medizin, Mediclin Bliestal Kliniken, Am Spitzenberg, D-66440 Blieskastel 2 Privat 3 Funktionsbereich Psychosomatik der Klinik Innere Medizin I, Klinikum Saarbrücken, Winterberg 1, 66119 Saarbrücken Einleitung: Psychotherapeutische Interventionen werden in der Behandlung des FibromyalgieSyndroms (FMS) häufig eingesetzt. Bisher existiert aber keine Meta-Analyse, welche die Effektivität psychotherapeutischer Behandlungen untersucht. Ziel der vorliegenden Meta-Analyse ist die Bewertung der Effekte von psychotherapeutischen Verfahren auf FMS-Symptome. Methodik: Die Datenbanken MEDLINE, PsycINFO, SCOPUS und The Cochrane library (Zeitraum 1990 bis 2007) wurden systematisch nach kontrollierten (CT) und randomisiert-kontrollierten Studien (RCT) zu psychotherapeutischen Intervention des FMS gescreent. Die Extrahierung der Daten, die Synthese und die Analyse wurden unabhängig von zwei Autoren durchgeführt. Als Effektmaß wurde Hedges` g verwandt. Ergebnisse: Insgesamt wurden 22 Studien in die Analyse einbezogen, davon 11 Studien zu verhaltentherapeutischen Interventionen, 4 Studien zu Entspannungsverfahren, 5 Studien zur Hypnotherapie/geleiteten Imagination und 2 Studien zu therapeutischen Schreiben. Präsentiert werden Gesamteffekte, vergleichende Subgruppensanalysen der verschiedenen Interventionen und Behandlungsintensitäten zu verschiedenen Zeitpunkten. Schlussfolgerung: Psychotherapeutische Verfahren zeigen differente Effekte in der Reduktion der FMS-Symptome. Neuronale Verarbeitung von miterlebtem Schmerz bei Fibromyalgie-Patientinnen: Eine fMRI-Untersuchung der„Schmerzneuromatrix“ 1 1 2 Müller-Becsangèle J. M. , Saum B. , Decety J. , 3 4 1 Ohlendorf S. , Glauche V. , Scheidt C. E. , Bauer 1 1 J. , Lacour M. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg, Hauptstr. 8, 79104 Freiburg 2 University of Chicago 3 Abteilung Medizin Physik, Hugstetterstr. 55, 79104 Freiburg 4 Neurologische 79104 Freiburg Universitätsklinik, Hugstetterstr. 55, Fragestellung: Aus Neuroimaging-Studien ist bekannt, dass periphere Schmerzreize bei Fibromyalgie (FM) eine Sensibilisierung der Schmerzneuromatrix fördern und zur Entstehung einer chronischen Schmerzverarbeitungsstörung beitragen. Ferner ist bekannt, dass die Ausprägung depressiver Symptome bzw. katastrophisierender Gedanken bei appliziertem Schmerz bei FM-Patientinnen zu einer verstärkten neuronalen Aktivierung der anterioren Insula und Amygdala bzw. des ACC, SII Cortex und des inferioren parietalen Lobulus führen. Ungeklärt ist bisher, ob auch visuell miterlebter Schmerz bei FM eine verstärkte Aktivierung der Schmerzneuromatrix bewirkt. Methode: In einer fMRI-Studie wurden 10 FM-Patientinnen und 10 gesunden Probandinnen standardisierte Bilder von schmerzhaften und nicht schmerzhaften Alltagssituationen im Blockdesign gezeigt. Ergebnisse: Im Gruppenvergleich zeigten die FM-Patientinnen im Kontrast “Schmerz > kein Schmerz“ gegenüber den gesunden Probandinnen verstärkte Aktivierungen in den affektverarbeitenden und für die somatosensorisch-diskriminativen Funktionen zuständigen Hirnarealen der Schmerzneuromatrix. Diskussion: Die Studienergebnisse sprechen dafür, dass emphatisch miterlebter Schmerz ähnlich wie periphere Schmerzreize zu einer Sensibilisierung der Schmerzneuromatrix führt und damit zu einer Chronifizierung der Fibromyalgie beiträgt. Störungsspezifische psychodynamische Kurzzeitpsychotherapie bei Fibromyalgie. Ergebnisse einer kontrollierten, randomisierten Interventionsstudie Lacour M., Müller-Becsangèle J. M., König R., Scheidt C. E. Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg, Hauptstr. 8, 79104 Freiburg Fragestellung: In der Pathogenese der Fibromyalgie (FM) sind katastrophisierende Gedanken, interpersonelle Probleme und unverarbeitete Traumatisierungen von Bedeutung. Hieraus ergeben sich Therapieverfahren auf kognitiv-behavioraler und auf psychodynamischer Basis. Die Effektivität kognitiv-behavioraler Behandlungsverfahren wurde in mehreren Studien überprüft. In der hier durchgeführten Studie wurde erstmals eine psychodynamische Einzeltherapie als störungsspezifische Kurzzeittherapie über 25 Sitzungen evaluiert. Methode: In einer prospektiven kontrollierten, randomisierten Therapiestudie wurden bisher 28 FM-Patientinnen auf zwei Behandlungsarme verteilt (störungsspezifische Psychotherapie vs. hausärztliche Betreuung). Beide Behandlungsmodule sind manualisiert. Da die Studie noch nicht abgeschlossen ist, können nur Ergebnisse einer Zwischenauswertung vorgestellt werden. Ergebnisse: In der 12-MonatsKatamnese zeigte sich in der Psychotherapiegruppe (n=9) gegenüber der Hausarztgruppe (n=11) eine signifikante Verbesserung der FM-bezogenen Schmerzsymptomatik (ANOVA mit Messwiederholung, F=5,2; p=0,04). In der Psychotherapiegruppe (n=12) zeigte sich ferner gegenüber der Hausarztgruppe (n=10) eine signifikante Verbesserung der 63 Arbeitsfähigkeit bereits in der 6-MonatsKatamnese (ANOVA mit Messwiederholung, F=15,8; p=0,001). Grenzen der Umsetzbarkeit von Evidenz in Leitlinien am Beispiel der interdisziplinären S3Leitlinie zum Fibromyalgie-Syndrom - Perspektive der am Konsensusprozess beteiligten Allgemeinmediziner Herrmann M. L., Klement A. Institut für Allgemeinmedizin der Universitäten Halle / Magdeburg, Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg Die InterdisziplinäreS3-Leitlinie zur „Definition, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie des Fibromyalgiesyndroms,(FMS)“ wurde von 10 medizinischen bzw. psychologischen Fachgesellschaften und zwei Patientenselbsthilfeorganisationen erstellt. Die Leitlinie Fibromyalgie hatte mehr als andere Leitlinien die zentralen Probleme: uneinheitlich definiertes Krankheitsbild, Fehlen objektiver Messgrößen zur Diagnosestellung, Fehlen bzw. unverbindbare Ätiologie-Konzepte sowie wenige Studien mit verlässlicher Methodik. Analysiert wird der Prozess der Leitlinienentwicklung zum Fibromyalgie-Syndrom durch a) die von der Steuerungsgruppe der Leitlinie vereinbarte Methodik im Vorgehen (Strukturqualität), b) den konsensuellen Gruppenprozess in der Bearbeitung und Gewichtung der vorhanden Literatur hinsichtlich der Erarbeitung der Empfehlungen (Prozessqualität), c) Darstellung und Analyse einiger Leitlinienempfehlungen (Ergebnisqualität). Zusammensetzung der interdisziplinären Leitliniengruppe und gesetzte Rahmenbedingungen haben einen sehr starken Einfluss auf das Ergebnis, das sich in den Empfehlungen niederschlägt, genommen. Die Tatsache, dass es nur wenig evidenzbasiertes Wissen auf Studienbasis zum Thema gibt, bedeutete einen enormen Einfluss auf das Konsensusverfahren. Strittige, aber möglicherweise für die Praxis nutzbare unterschiedliche Ätiologie-Konzepte wurden nicht dargelegt, wodurch die vordergründige Gemeinsamkeit einer phänomenologischen Diagnosebildung dominiert. S34: Evidence based psychosocial intervention that reduce somatic disease risk (ENPM / ISBM) (English Track) New Biological Risk Factors for Coronary Heart Disease.” Schneiderman N. University of Miami, USA Psychosocial interventions that decrease inflammation seem to decrease atherosclerosis and re- duce mortality. In the Stockholm Women’s Intervention Trial for Coronary Heart Disease (SWITCHD) led by Orth-Gomér, women receiving group based cognitive behavior therapy after severe coronary events showed decreased mortality; statins appeared to potentiate the improved rate of survival. New support fort he efficacy os stress reduction in the Stockholm Women Intervention Trial on Coronary Heart Disease, SWITCHD Orth-Gomér K. (Stockholm, Sweden) New evidence of cognitive interventions from Hungarian men und women Balog P. (Budapest, Hungary) Integrating psychosomatic principles in European preventive guidelines and recommendations Albus C. (Cologne, Germany) S35: Forschungsverbund zur Psychotherapie von Essstörungen (EDNET) Aufbau und Stand des Forschungsverbundes "Psychotherapie von Essstörungen (EDNET)" de Zwaan M. Abt. für Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin, Universität Erlangen, Schwabachanlage 6, 91054 Erlangen Der Forschungsverbund „Essstörungen: Diagnose und Behandlungs-Netzwerk (EDNET)“ wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderprogramms „Forschungsverbünde zur Psychotherapie“ finanziert. Der Bewilligungszeitraum der ersten Förderperiode ist auf die Zeit vom 1.10.2006 bis mindestens 31.12.2009 festgelegt. EDNET setzt sich aus 10 Projekten zusammen (einschließlich der Verbundkoordination, des Datenmanagements und der statistischen Unterstützung). Der Forschungsverbund beinhaltet 4 multizentrische, randomisiertkontrollierte Psychotherapiestudien. Vernetzt mit den Psychotherapiestudien werden Studien zur Neurobiologie, Genetik, Endokrinologie sowie Detailanalysen zu Mediatoren und Moderatoren im psychotherapeutischen Prozesses durchgeführt. Ein international zusammengesetztes Advisory Board überprüft den Fortgang des Verbundes und der einzelnen Studien. Die bestehenden Bezie- 64 hungen zu den 4 anderen vom BMBF geförderten Psychotherapie-Forschungsverbünden haben bereits zu einem gemeinsamen Projekt zur kritischen Evaluierung der GCP Kriterien bei Psychotherapieforschung geführt. ANTOP - Herausforderungen einer ambulanten randomisierten multizentrischen Psychotherapiestudie bei Anorexia nervosa 1 2 3 Zipfel S. , Groß G. , Herzog W. 1 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen, Silcherstraße 5, 72076 Tübingen 2 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen, Osianderstr. 5, 72076 Tübingen 3 Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg In der Praxis existieren viele verschiedene Ansätze für die Behandlung der Anorexia nervosa (AN), gleichzeitig fehlen jedoch bis heute größere randomisierte kontrollierte Studien, die eine angemessene Evaluation von Psychotherapieverfahren für diese Störung ermöglichen. Die sogenannte ANTOP-Studie (Anorexia Nervosa Treatment of OutPatients), die bisher größte randomisierte multizentrische Untersuchung weltweit zur ambulanten Psychotherapie bei erwachsenen AN-Patientinnen, soll diese Lücke schließen. Ziel der Studie ist es, die Wirksamkeit zweier spezifischer Psychotherapieverfahren, fokale psychodynamische Psychotherapie (FPT) und kognitive Verhaltenstherapie (KVT), im Vergleich zur bisher üblichen Standardbehandlung i.S. eines "Treatment as usual" zu untersuchen. Primärer Endpunkt ist die Veränderung des Gewichts im Behandlungsverlauf, erfasst werden außerdem Essstörungssymptomatik, psychische Begleitsymptomatik sowie Lebensqualität. Ein weiterer Fokus stellt die Untersuchung von Therapieprozessvariablen dar. Derzeit werden 237 Patientinnen an 10 deutschen universitären Zentren rekrutiert. FPT und KVT umfassen 40 ambulante Einzelsitzungen über 10 Monate. Für die Durchführung wurden gemeinsam mit internationalen Beratern spezifische Behandlungsmanuale entwickelt. Zum jetzigen Zeitpunkt werden Studiendesign sowie die zum Einsatz kommenden Methoden vorgestellt und die mit der Studie verbundenen Herausforderungen diskutiert. IN@ - Internet-gestützte Nachsorge bei Bulimia nervosa Beintner I., Fittig E., Jacobi C. Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden, Chemnitzer Str. 46, 01187 Dresden Fragestellung: Ziel der Studie ist die Überprüfung der kurz- und langfristigen Wirksamkeit eines Internet-gestützten Nachsorgeprogramms bei einer Stichprobe von Patientinnen mit Bulimia nervosa im Anschluss an stationäre Behandlung im Vergleich zu einer Warte-Kontrollgruppe ohne Intervention. Primärer Outcome ist die Häufigkeit der von Essanfällen und kompensatorischen Maßnahmen 9 Monate nach der Entlassung aus der stationären Behandlung. Sekundäre Outcomes sind Veränderungen in weiteren Symptomen der Essstörung, in weiteren psychischen Symptomen und Impulsivität. Methode: Das 9-monatige, Internet-gestützte Nachsorgeprogramm besteht aus 11 psychoedukativen Sitzungen, die sich mit den Themen Gewicht, Essverhalten, Körperakzeptanz und sowie bekannten auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren von Essstörungen beschäftigen, sowie einem moderierten Online-Forum, Selbstbeobachtungstagebüchern, Verhaltensexperimenten und persönlichen monatliche Zielsetzungen und monatlichen Chats mit einem Moderator. Das Nachsorgeprogramm soll im Rahmen einer randomisierten kontrollierten Studie mit insgesamt 258 Patientinnen aus 12 kooperierenden Psychosomatischen Kliniken überprüft werden. Die Datenerhebung erfolgt mittels eines diagnostischen Interviews (SIAB-EX), Online-Fragebögen (EDI, EDE-Q, BSI, BDI, BIS-11)sowie Selbstbeobachtungsprotokollen. Ergebnisse und Fazit: stehen noch aus. ANDI– Eine Studie zur Behandlung von Anorexia Nervosa im Kindes- und Jugendalter – Teilstationäre vs. stationäre Behandlung Schwarte R., Bühren K. I., Herpertz-Dahlmann B. Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen, Neuenhofer Weg 21, 52074 Aachen Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und – psychotherapie des Universitätsklinikums Aachen führt seit Februar 2007 in Zusammenarbeit mit sechs weiteren Kliniken in Düren, Köln-Holweide, Freiburg, Würzburg, Berlin-Charité und Mannheim eine Studie zur Behandlung der Anorexia Nervosa im Kindes- und Jugendalter durch. Die zentrale Fragestellung der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Therapiestudie ist, ob die adoleszente, nicht-chronische Anorexia Nervosa im tagesklinischen Setting vergleichbar gut behandelt werden kann wie im stationären Rahmen. Um dies zu ermöglichen, werden die teilnehmenden Patientinnen randomisiert den beiden Behandlungssettings zugeteilt und nach einem bewährten multimodalen Behandlungskonzept behandelt. In Pilot-Studien aus England (Gowers, 2000 und 2007) ergaben sich Hinweise darauf, dass ambulante oder tagesklinische Behandlungsformen bei der jugendlichen AN zu einer verringerten Rückfallrate führen könnte. Um dies zu über- 65 prüfen werden die Patientinnen im ambulanten Rahmen weiter behandelt und mehrere follow-upErhebungszeitpunkte durchgeführt. Vorgestellt werden das Design der multizentrischen, randomisierten, kontrollierten Nicht-Unterlegensheitsstudie, der Ablauf für die einzelnen Patientinnen einschließlich des bewährten angewendeten Behandlungskonzeptes, die erhobenen abhängigen Variablen und Messzeitpunkte sowie erste Erfahrungen bei der Umsetzung des teilstationären Settings. S36: Psychosomatik und Allgemeinmedizin Welche Patienten werden mit einer spezifischen ALLgemeinmedizinisch-psychosomatischen Kurzgruppenintervention zu somatoformen/ funktionellen Beschwerden in der Hausarztpraxis erreicht? (speziALL-Projekt) (ISRCTN55280791) 1 1 2 Schäfert R. , Kaufmann C. , Bölter R. , Faber R. 1 3 2 4 G. , König H. , Szecsenyi J. , Sauer N. , Herzog 1 W. 1 Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg 2 Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung, Universitätsklinikum Heidelberg 3 Stiftungsprofessur für Gesundheitsökonomie, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Universität Leipzig, Johannisallee 20, 04317 Leipzig 4 Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE), Gebäude Ost 59 (O 59), Martinistr. 52, 20246 Hamburg Hintergrund: Obwohl Patienten mit somatoformen/ funktionellen Syndromen am häufigsten in der Hausarztpraxis versorgt werden, fehlen hier evaluierte Behandlungskonzepte. In der Sekundärversorgung waren Gruppeninterventionen effektiv und ökonomisch (1,2). Im BMBF-geförderten speziALLProjekt wird eine manualisierte störungs- und ressourcenorientierte Kurzgruppenintervention über 10+2 x 90 min evaluiert, die kooperativ durch Hausarzt und Psychosomatiker in der Hausarztpraxis geleitet wird. Methodik: Cluster-randomisiertes, kontrolliertes Design; je 18 Hausärzte in Interventions- und Kontrollarm. Patientenauswahl durch den Hausarzt, Überprüfung durch ScreeningInstrumente (PHQ-15, WI-7, PHQ-9). Wir berichten vorläufige Ergebnisse aus dem Interventionsarm, welche Pat. ein solches Angebot erreicht. Ergebnisse: Im Mittel je 10 Pat. in 18 Gruppen; ca. 11% Drop-outs. 75% Frauen, fast 80% > 40 J., ca. 6% ausländische Patienten. Schwere der Somatisierung überwiegend im mittleren und hohen, Depressivität im niedrigen bis mäßigen Bereich. Ca. 45% hatten relevante Krankheitsängste. Schlussfolgerungen: Patienten mit somatoformen/ funktionellen Syndromen nehmen Kurzgruppeninterventionen in der Hausarztpraxis an. Die niedrige Dropout-Quote erklärt sich aus der starken Bindung an den Hausarzt. Der arztgesteuerte Patienteneinschluss liefert ein naturalistisches Bild der Erreichbarkeit. Schwierigkeiten zeigen sich bei der Erreichbarkeit von Männern, jüngeren und ausländischen Patienten. Beschwerdewahrnehmung und Beschwerdeumgang zu Beginn und nach einer spezifisch allgemeinmedizinisch-psychosomatischen Kurzgruppenintervention zu somatoformen/ funktionellen Beschwerden in der Hausarztpraxis - speziALL 1 2 1 Kaufmann C. U. , Bölter R. , Faber R. G. , Sauer 3 2 1 1 N. , Szecsenyi J. , Herzog W. , Schäfert R. 1 Klinik für Psychosomatik und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg 2 Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung, Universitätsklinikum Heidelberg 3 Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Martinistraße 52, 20246 Hamburg In der Versorgung von Patienten mit funktionellen und somatoformen Störungen kommt dem Hausarzt die wesentliche Bedeutung zu (1). Evaluierte Behandlungskonzepte wie in der Sekundär - und Tertiärversorgung fehlen in der Primärversorgung (1-3). Welche Effekte lassen sich mit einer spezifisch störungs- und ressourcenorientierten Kurgruppenintervention in der Hausarztpraxis erzielen? Im Rahmen eines BMBF-geförderten clusterrandomisierten Kontrollgruppendesigns wurden 18 Hausärzte zufällig dem Interventionsarm zugeordnet. In einer manualisierten Interventionsgruppe (10+2 Abende a 90 min), die gemeinsam von Hausarzt und einem Psychosomatiker in der Hausarztpraxis durchgeführt wird, wurden psychoedukative und interaktionelle Elemente mit aktiv angeleiteter Entspannung kombiniert. Auf den Dimensionen Symptomatik, Lebensqualität – und zufriedenheit, Krankheitswahrnehmung und Kontrollüberzeugungen sowie soziale Ressourcen werden Daten zu Gruppenbeginn und der ersten Verlaufsmessung nach sechs Monaten vorgestellt. Die Patienten berichten günstige Wirkungen bezüglich Beschwerdeumgang und Alltagsbewältigung und fühlen sich durch das Angebot entlastet. Das Krankheitsverständnis steigt. Arzt und Psychosomatiker unterscheiden sich wenig in der Einschätzung der Behandlung, die Hausärzte fühlen sich im Umgang mit den Patienten entlastet. Es liegen Veränderungen in Beschwerdewahrnehmung und -umgang vor. Die Patientengruppe nimmt die Intervention in der Hausarztpraxis an. 66 Welche Ärzte nehmen an Trainings zur Partizipativen Entscheidungsfindung teil? 1 1 1 1 Eich W. , Bieber C. , Loh A. , Nicolai J. , Ringel 1 1 2 N. , Hartmann M. , Härter M. 1 Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg 2 Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Freiburg Hintergrund: Zahlreiche Studien weisen auf den Nutzen der Partizipativen Entscheidungsfindung (PEF) in der Arzt-Patient-Interaktion hin. Eine wichtige Voraussetzung für PEF ist die Fähigkeit des Arztes die Perspektive des Patienten zu berücksichtigen. Obwohl viele Ärzte dem PEF-Ansatz zustimmen, fehlt es oftmals an der Fähigkeit den Patienten aktiv am Entscheidungsprozess zu beteiligen. Ziel dieser Untersuchung ist es herauszufinden, welche Ärzte durch ein freiwilliges PEFTrainingsangebot erreicht werden können. Methode: Es wurde ein 8-stündiges Ärztetraining mit dem Schwerpunkt auf der Vermittlung spezifischer PEFKompetenzen sowie Kompetenzen zum Aufbau einer guten Arzt-Patient-Beziehung angeboten. Neben der Evaluation des Trainings wurden soziodemographische Daten, interpersonale Orientierung, soziale Werte, Bindungsstil und Berufsmotivation untersucht. Ergebnisse: Insgesamt 150 Ärzte und Ärztinnen nahmen am Training teil. Allgemeinmediziner und Internisten waren in der Stichprobe überrepräsentiert (2/3). Das Training konnte die Gesprächskompetenzen und das Wissen der Teilnehmer erhöhen. Die Teilnehmer gaben zum Großteil soziale Motive als Berufsmotivation an und berichteten wenig Angst und Vermeidung in Beziehungen. Im Vergleich zu einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe wurden soziale Werte von den Teilnehmern höher bewertet. Diskussion: Die Studie liefert erste Hinweise auf besondere Merkmale von Ärzten, die sich durch ein PEFTraining angesprochen fühlen. ter of controlled trials und CINAHL. Eingeschlossen wurden alle randomisiert kontrollierten Studien, die Outcomeparameter für körperliche, psychische, soziale Gesundheit oder Partnergesundheit berichteten. Ergebnisse: 40 Studien konnten berücksichtigt werden. Die Interventionen erwiesen sich auf allen Zielvariablen als effektiv (Effektstärke für körperliche Gesundheit 0,32, für psychische Gesundheit 0,28, für soziale Gesundheit 0,37 und für Partnergesundheit 0,35). Auch über einen längeren Zeitraum blieb die Wirkung erhalten. Insgesamt war der Effekt signifikant, aber nicht sehr groß. Eindrücklich ist jedoch die Stabilität über ganz verschiedene Erkrankungen und Interventionsformen hinweg. Schlussfolgerung: Interventionen, die die Familie einbeziehen, sind wirksam. Sie haben auch einen präventiven Aspekt, indem sie die Gesundheit der Angehörigen stärken. Es besteht jedoch weiterer Forschungsbedarf. S37: Depression und Kognition bei Diabetes (DECODIA) - Forschungsansätze im DECODIA-Forschungsverbund des Krankheitsbezogenen Kompetenznetz Diabetes mellitus (BMBF) Einführung: Das Kompetenznetz Diabetes mellinus und der DECODIA-Verbund im Überblick Petrak F. (Bochum / Wiesbaden) Effekte von intranasalem Insulin auf Gedächtnisdefizite bei Typ 2-Diabetes und früher Alzheimer Demenz (INSULA) 1 2 1 Wiltfang J. , Kern W. , Esselmann H. , Müller B. 1 3 1 1 W. , Hallschmid M. , Bibl M. , Ennen J. 1 Soll die Familie chronisch körperlich kranker Erwachsener in die Behandlung einbezogen werden? Ergebnisse einer Metaanalyse Hartmann M., Bäzner E., Wild B., Herzog W. Klinik für Psychosomatik und Allgmeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg Hintergrund: Die Familie ist ein bedeutsamer Einflussfaktor für die Entstehung und den Verlauf von chronisch körperlichen Krankheiten. Daher wurden immer wieder Versuche unternommen durch Einbeziehung der Familie Krankheitsverläufe zu optimieren. Allerdings wurden die einzelnen Studien bislang noch nicht zusammengefasst bewertet. Ziel: Systematisches Review aller randomisiert kontrollierten Studien zu familienbezogenen Interventionen bei chronisch körperlichen Erkrankungen. Methodik: Systematische Recherche in Medline, PsycIndex, PsycInfo, Cochrane central regis- Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Rheinische Kliniken Essen, Universität Duisburg-Essen, Virchowstr. 174, 45147 Essen 2 Endokrinologikum Ulm, Hafenbad 33, 89073 Ulm 3 Institut für Neuroendokrinologie, Universität zu Lübeck, Haus 23a, Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck Die Alzheimer-Krankheit (AD) ist eine neurodegenerative Erkrankung des Gehirns im höheren Lebensalter und weltweit die Hauptursache von Demenzen. Eine CSF-basierte neurochemische Demenzdiagnostik kann eine beginnende AD bei MCI-Patienten bereits vier bis sechs Jahre vor dem Auftreten der klinischen Symptomatik vorhersagen. Neue Daten deuten darauf hin, dass eine Assoziation zwischen dem Typ-2 Diabetes Mellitus (T2D) und der sporadischen Form der Alzheimer Erkrankung besteht. Für beide Erkrankungen ist ein insulinabhängiger, molekularer Mechanismus bekannt, der das physiologische Gleichgeweicht des neuronalen Metabolismus und seiner Funktion 67 beeinträchtigen kann. Das Leitsymptom der frühen AD sind Defizite im deklarativen Gedächtnis und diese sind essentiell abhängig von der Funktion des Hippocampus, von dem bekannt ist, dass er eine hohe Dichte von Insulin-Rezeptoren aufweist. Ausgehend von diesen und weiteren Befunden soll hier ein Untersuchungsansatz im Rahmen des Kompetenznetz Diabetes (Verbund DECODIA) vorgestellt werden, in dem die potenzielle klinische Verwendung von intranasalem Insulin in der Behandlung von Gedächtnisstörungen bei AD und Gedächtnisstörungen bei älteren T2D Patienten mit amnestischer MCI geprüft werden soll. Auswirkungen verschiedener Insulinarten auf Kognition und neuronale Aktivierung im fMRT Kern W. Endokrinologikum Ulm, Hafenbad 33, 89073 Ulm Menschen mit Typ 2 Diabetes haben ein etwa doppelt so hohes Risiko, kognitive Defizite und eine Demenz vom Alzheimertyp zu entwickeln, als gesunde Kontrollen. Dabei könnte ein gestörter Insulintransport über die Blut/Hirn-Schranke eine wichtige Rolle spielen. Schon bei nichtdiabetischen Menschen fällt das Liquor-/Plasmainsulin Verhältnis mit zunehmender Körperfettmasse und Insulinresistenz. Bei Menschen mit M. Alzheimer ist ebenfalls die Konzentration von Insulin im Liquor reduziert und die Abnahme korreliert mit dem Grad der Demenz. Insulin ist aber wichtig für die Bildung des deklarativen Gedächtnisses. Eine intranasale Insulingabe führte wiederholt zu einer deutlichen Verbesserung des declarativen Gedächtnisses. Schnell wirksame Insulinanaloga bilden nicht wie Humaninsulin (HI) Hexamere, so dass sie schneller zum Gehirn gelangen könnten als HI. Tatsächlich war der Gedächtnis-verbessernde Effekt nach Insulinaspart Gabe signifikant stärker als nach HI Gabe. Grundsätzlich gelangen Substanzen umso leichter über die Blut/Hirnschranke, je lipophiler sie sind. Insulin Detemir ist als einziges Insulin an eine Fettsäure gebunden. Beim Vergleich der kortikalen Gleichspannungspotentiale gesunder Probanden während eines euglykämischen Clamps mit HI oder Detemir waren die Potentialveränderungen unter Detemirgabe signifikant stärker ausgeprägt als unter HI Gabe. Die Effekte von Insulinanaloga sollen nun weiter spezifiziert und auf ihre therapeutische Verwendbarkeit untersucht werden. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Ruhr-Universität Bochum 2 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Gießen, Licher Straße 106, 35394 Gießen 3 Abteilung für Klinische Psychologie und Entwicklungspsychologie, Universität Tübingen, Christophstr. 2, 72072 Tübingen Hintergrund: Symptome einer Minor Depression oder eine leichte Major Depression haben einen beachtlichen Einfluss auf die Lebensqualität und verschlechtern insbesondere die Prognose älterer Patienten mit Typ-2-Diabetes. Bislang existiert keine randomisierte, kontrollierte Studie, in der Psychotherapie für diese Risikogruppe evaluiert wurde. Zielsetzung: Evaluation einer diabetesspezifischen kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) für ältere Typ 2-Diabetiker. Stichprobe: 315 Typ 2Diabetiker im Alter zwischen 65 und 85 Jahren mit Minor Depression oder leichter Major Depression. Studiendesign: Randomisierte, kontrollierte Multicenterstudie, in der folgende Gruppen miteinander verglichen werden: Intensivierte medizinische Standardbehandlung vs. kognitive Gruppenverhaltenstherapie (KVT) vs. Diabetes-Selbsthilfegruppe (SH). Nach drei Monaten wöchentlicher Sitzungen werden beide Gruppeninterventionen auf monatliche Sitzungen umgestellt. Primäre Zielgröße: Gesundheitsbezogene Lebensqualität im 1-JahresFollow-Up. Sekundäre Zielgrößen: Reduktion depressiver Symptome, Prävention einer mittelgradigen/schweren Major Depression, Verminderung von Kosten im Gesundheitssystem und Mortalität. Hypothesen:(a) KVT ist hinsichtlich der Verbesserung von Lebensqualität und depressiver Symptome der Standardbehandlung im 1-Jahres-FollowUp signifikant überlegen. (b) KVT führt verglichen mit einer SH-Gruppe im 1-Jahres-Follow-Up zu einer signifikant größeren Steigerung der Lebensqualität. S38: Evidenzbasierte Körperpsychotherapie – Aktuelle Studien Funktionelle Entspannung und Audioanalgesie bei Zahnarztangst 1 2 1 Lahmann C. , Schoen R. , Henningsen P. , Ronel 1 1 3 4 J. , Noll-Hussong M. , Mühlbacher M. , Loew T. , 4 5 6 Tritt K. , Nickel M. , Doering S. 1 Kognitive Verhaltenstherapie bei älteren Patienten mit Typ-2-Diabetes und Minor Depression (MIND-DIA-Studie) - Studiendesign einer randomisierten kontrollierten Studie des DECODIA-Verbundes 1 2 3 Petrak F. , Müller M. J. , Hautzinger M. Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Langerstrasse 3, 81675 München 2 Privat 3 Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Ignaz Harrer Str. 79, 5020 Salzburg, Österreich 4 Abteilung für Psychosomatische Medizin, Universitätsklinikum Regensburg, Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg 68 5 Klinik Bad Aussee für Psychosomatik und Psychotherapie an der Medizinischen Universität Graz, Sommersbergseestr. 395, A-8990 Bad Aussee, Österreich 6 Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Universitätsklinikum Münster, Domagkstr.22, 48149 Münster Hintergrund: Zahnarztangst ist eine relevante Ursache schlechter Zahngesundheit und damit ein relevantes klinisches Problem. Die meisten betroffenen Patienten bevorzugen nichtpharmakologische Therapieansätze, weshalb in einer randomisierten Therapiestudie die Effektivität von Funktioneller Entspannung (FE) mit Audioanalgesie (AG) verglichen wurde. Methodik: 90 Patienten mit Zahnarztangst wurden in der dreiarmigen Studie entweder der FE, der AG oder einer Kontrollgruppe ohne zusätzliche Behandlung randomisiert. Die Intervention erfolgte begleitend zu einer routinemäßigen, in einer Sitzung durchführbaren ambulanten zahnärztlichen Behandlung. Das Outcome wurde mit der Subskala „Zustandsangst“ des State-Trait-Anxiety-Inventory beurteilt. Ergebnisse: Sowohl FE als auch AG führten im Vergleich zur Kontrollgruppe zu einer signifikant stärkeren Reduktion des Angstniveaus. Die FE war der AG dabei signifikant überlegen. Eine Stratifizierung gemäß der allgemeinen Zahnarztangst der Patienten, dass die FE im Gegensatz zur AG besonders bei hochängstlichen Patienten effektiv war. Schlussfolgerung: Mit der FE besteht eine sichere und effektive Behandlungsoption zur kurzfristigen, nicht-pharmakologischen Behandlung von Patienten mit Zahnarztangst. Effekte von Funktioneller Entspannung und Geleiteter Imagination auf das Gesamt-IgE bei Asthma bronchiale 1 2 3 4 Lahmann C. , Schulz C. , Schuster T. , Sauer N. , 1 1 5 5 Noll-Hussong M. , Ronel J. , Tritt K. , Loew T. 1 Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Langerstrasse 3, 81675 München 2 Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II, Klinikum der Universität Regensburg, Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg 3 Institut für Medizinische Statistik und Epidemiologie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Ismaninger Str. 22, 81675 München 4 Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE), Gebäude Ost 59 (O 59), Martinistr. 52, 20246 Hamburg 5 Abteilung für Psychosomatische Medizin, Universitätsklinikum Regensburg, Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg nungsverfahren in mehreren Studien als wirksame komplementäre Therapieoption bei Asthma bronchiale erwiesen haben, ist über die immunologischen Effekte wenig bekannt. Methodik: 64 Patienten mit allergischem Asthma bronchiale wurden im Rahmen einer randomisierten, kontrollierten Therapiestudie über einen Zeitraum von 4 Wochen mit FE, GI, einer Kombination aus FE und GI (FE/GI) oder einem Placebo-Entspannungsverfahren (PE) behandelt. Als immunologischer Marker wurde das Gesamt-IgE im Serum vor und nach Therapie erhoben. Ergebnisse: Die Behandlung mit FE, GI bzw. FE/GI führte zu einer Abnehme des GesamtIgE im Serum [IU/ml] von -35,9 ±49,7; -30,8 ±30,7; -44,5 ±100,3 verglichen mit einer Zunahme von 10,0 ±37,8 in der PE-Gruppe am Ende der Therapiephase. Nach 4 Monaten lagen die Veränderungen bei -54,7 ±67,1 in der FE-Gruppe; -49,5 ±93,4 in der GI-Gruppe; -28,4 ±93,9 in der FE/GIGruppe, verglichen mit einem Anstieg von 27,7 ±43,2 in der Kontrollgruppe PE.Schlussfolgerung: Die Studie konnte in Ergänzung zur bereits vorbeschriebenen klinischen Verbesserung der Lungenfunktion auch positive und klinisch relevante Veränderungen des Gesamt-IgE im Serum durch FE und GI nachweisen. Body attitude in psychosomatic rehabilitation Kalisvaart H., Bühring M. E. Eikenboom, Center for Psychosomatic Medicine, Oude Arnhemse Weg, NL 3705 BK Zeist, Niederlande This study is designed to identify aspects of body attitude that influence quality of life in clients with severe somatoform disorder, who are treated in Eikenboom, Center for Psychosomatic Medicine. This center is located in Zeist, and is a specialised tertiary referral clinic for clients with severe chronic psychosomatic diseases in the Netherlands. Clients usually have a long history of unsuccessful treatment, both medical and psychiatrical. They receive intensive and multidisciplinary treatment, taking into account that their body attitude is thought to be of great importance for their quality of life as well as for their treatment. Eleven therapists of various disciplines and ten clients were interviewed using semi-structured interviews. Moreover, a literature search on body attitude and somatoform disorder was performed. Both methods revealed that the ability to make contact with one’s bodily sensations is most crucial in reinforcing selfconfidence and health-promoting behaviour. Although this study concerns a very specific client group, the results can be of interest for all therapists who work with clients with chronic physical impairment. Hintergrund: Allergische Reaktionen auf Haustaubmilben-Allergene gelten als häufige Ursache exogen-allergischen Asthmas. Obwohl sich körperpsychotherapeutische Ansätze und Entspan- 69 Einsatz von Körperbildskulpturtest und Körperbildinterview als Verlaufsinstrumente bei stationär behandelten Traumapatientinnen 1 2 Schäfer S. , von Arnim A. 1 Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 2 Praxis für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Bozener Straße 18, 10825 Berlin Der Körperbildskulpturtests (KST) ist ein dreidimensionales Verfahren zur Erfassung des Körperbildes, ergänzt vom Körperbildinterview (KBI) (von Arnim, Joraschky & Lausberg, 2007). In der vorgestellten Untersuchung wird die Eignung von KST und KBI als veränderungssensitive Instrumente im therapeutischen Verlauf überprüft. Im Prä- PostVergleich werden über fünf Wochen stationär behandelte PTBS-Patientinnen der Altersgruppe 3050 untersucht. Das tiefenpsychologisch orientierte Behandlungskonzept umfasst u.a. eine Traumagruppe, Imagination und Konzentrative Bewegungstherapie. Die Messungen des Körperbildes erfolgen mittels einer Methodentriangulation durch den Dresdner Körperbildfragebogen (DKB-35, Pöhlmann, Thiel & Joraschky, 2007), das projektive Verfahren KST und das problemzentrierte KBI. Im Symposium wird die Anwendung von KST und KBI an Hand von 2 kontrastierenden Einzelfallvignetten vorgestellt. Die deskriptive Auswertung des KST zeigte eine Verbesserung auf den Dimensionen Vollständigkeit und Verbundenheit, sowie eine Abnahme von Oberflächendeformationen. Die Auswertung der KBIs mittels Qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2000) und Metaphernanalyse (Lakoff & Johnson, 1980) erbrachte für die PostBedingung eine verbesserte Fähigkeit zur Verbalisierung körperbezogener Affekte, eine deutlichere Benennung traumabezogener Zonen und einen vermehrten Assoziationsreichtum bezogen auf die eigene Körpergeschichte. Störungsorientierte psychodynamische Psychotherapie muss die Spezifika der jeweiligen Symptomatik und die in Verbindung hiermit stehenden relevanten Konflikte und strukturellen Störungsanteile behandeln. Das Manual zur Behandlung der Bulimia nervosa bei weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen beschreibt folgende Schritte der Therapie: 1. Störungsorientierte Diagnostik mit Erfassung der bulimischen Symptomatik, möglicher Auslöser, des Basis-Essverhaltens, des Körperbildes und Körperideals und deren Entwicklung sowie der Entwicklung relevanter Beziehungen. Hierbei ist die weibliche Adoleszenz besonders zu berücksichtigen. 2. Der Aufbau eines Arbeitsbündnisses mit der Formulierung eines auf die Symptomatik Behandlungsfokus (Konflikt oder Struktur orientiert). 3. Die Behandlungsphase mit Besonderheiten der Übertragung und der Abwehr, z. B. der Schamproblematik, der mangelnden Integration konflikthafter Selbstanteile sowie strukturelle Schwierigkeiten (Impulskontrolle). 4. Die Abschlussphase mit den Problemen der Integration des Erarbeiteten. 5. Probleme bei der Einbeziehung der Eltern in begleitende Gespräche. Diese Manual wird zur Zeit in einer RCT-Studie zur Therapie der Bulimia nervosa überprüft. Studienzentren sind Heidelberg/ Mannheim und Göttingen/ Kassel. Das Studiendesign und der Untersuchungsstand werden dargestellt. Refeeding Syndrome in Anorexia Nervosa 1 1 1 Craciun E. M. , Ballmaier M. , Riedl A. , Ehrlich 2 1 3 S. , Klapp B. F. , Klingebiel R. 1 Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Charité Universitätsmedizin Berlin, Charité-Campus Mitte, Luisenstr. 13a, 10117 Berlin 2 Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie, Charité Unversitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin 3 Department of Neuroradiology, Charité, Universitary Medicine, Campus Mitte, S39: Essstörungen: Anorexie und Bulimie Manual zur störungsorientierten psychodynamischen Psychotherapie bei weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Bulimia nervosa 1 2 3 3 Reich G. , Horn H. , Kronmüller K. , Stefini A. , 2 Winkelmann K. The possibility of encountering refeeding syndrome (RS) in the initial refeeding phase is still high for patients with severe anorexia nervosa (AN), whether the method of nutrition repletion is oral, enteral or parenteral. This study shall draw attention to this life-threatening, often neglected syndrome.Objective: Prospective assessment of RS related clinical and paraclinical disorders in patients suffering from AN. 1 Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie, Universität Göttingen, von-Siebold-Str. 5, 37075 Göttingen 2 Institut für analytische Kinder- und JugendlichenPsychotherapie, Heidelberg 3 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Heidelberg Von welchen Merkmalen hängt der stationäre Behandlungserfolg von Patientinnen mit Essstörungen ab? Ergebnisse einer Verlaufsstudie zur stationären psychosomatischen Psychotherapie der Anorexie und Bulimie 1 2 2 Bleichner F. , Zwerenz R. , Beutel M. 70 1 Psychosomatische Klinik Bad Neustadt, Salzburger Leite 1, 97616 Bad Neustadt/Saale rend die soziale Selbstbehauptung zugleich ansteigt. 2 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz Trotz intensiver Behandlungsangebote verlaufen Essstörungen noch häufig chronisch-rezidivierend. In der Psychosomatischen Klinik Bad Neustadt/Saale erhielten 234 Patienten (7,4 %) der Jahrgänge 2004 und 2005 die Erstdiagnose einer Essstörung (54,1 % Bulimie, 39,6 % Anorexie, 6,3 % sonstige). Ziele der Studie sind a) die Untersuchung der Wirksamkeit stationärer psychosomatischer Therapie bei Essstörungen, b) die Bestimmung von Prädiktoren für das Ansprechen auf die stationäre psychosomatische Therapie sowie c) die Analyse des mittelfristigen Krankheitsverlaufs. In die Studie wurden 115 konsekutive Patientinnen über die Dauer eines Jahres vorwiegend mit Anorexia nervosa eingeschlossen. Bei Aufnahme und Entlassung wurden Symptomatik sowie mögliche Einflussgrößen wie Kindheitsbelastungen und Bindungsmuster in Selbst- (EDI-2, FKB 20, SCL-90R, AAS, CTQ) und Fremdbeurteilung (SIAB) erhoben, im Verlauf wurden Gewichts- und Befindlichkeitsverläufe (SCL-9, EB 45) wöchentlich erhoben. Dargestellt werden Veränderungen der Symptomatik und Prädiktoren für den Behandlungserfolg. Dabei ist besonders das Ansprechen von schwerst untergewichtigen Patientinnen von Interesse, die im Rahmen einer geschlossenen Intermediate Care Station versorgt werden. Essstörungstherapie in den ANAD intensivtherapeutischen Wohngruppen: Ergebnisse einer Therapieevaluation Wunderer E., Pecho L., Schnebel A. ANAD e.V. Beratung und Therapie bei Essstörungen und Adipositas, Poccistraße 5, 80336 München Essstörungen werden oftmals in spezialisierten Kliniken behandelt – doch der Transfer der erreichten Erfolge in den „Alltag draußen“ fällt vielen Patienten schwer. Unterstützung bieten seit nunmehr 15 Jahren die ANAD intensivtherapeutischen Wohngruppen in München, die eine große Alltagsnähe garantieren. Dort bleiben die Betroffenen in Schule bzw. Beruf integriert, wohnen weitgehend selbständig und werden zugleich rund um die Uhr von einem interdisziplinären Team betreut, das aus einer fachärtzlichen Leitung, DiplomPsychologen, Diplom-Sozialpädagogen und Ernährungstherapeuten besteht. Bei der Evaluation des Therapiekonzeptes kamen standardisierte Messinstrumente (z.B. EDI-2, BDI, SCL90-R) zur Anwendung, neben Selbstratings wurden Fremdratings der Bezugspsychotherapeuten erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass im Laufe des Aufenthaltes Essstörungssymptomatik sowie allgemeine Psychopathologie signifikant zurückgehen, wäh- S40: Intervention bei somatoformen Störungen Bindung und somatoforme Störungen – Zur Bedeutung geringer Kohärenz und desorganisierter Verarbeitungszustände für chronischen Schmerz 1 2 1 Neumann E. , Nowacki K. , Kruse J. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, Bergische Landstrasse 2, 40629 Düsseldorf 2 Fachhochschule Dortmund, Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften, Emil-Figge-Straße 44, 44227 Dortmund Das Ziel dieser Studie war die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Bindungsrepräsentationen und somatoformen Schmerzstörungen. Patienten mit organisch nicht begründbarem Schmerz wurden mit klinisch unauffälligen Probanden verglichen. Die Bindungsrepräsentationen wurden mit dem Adult Attachment Interview (AAI) erfasst. Auf der Ebene der Skalen unterschieden sich die Schmerzpatienten von den Kontrollprobanden dadurch, dass sie von weniger Liebe und mehr Zurückweisung von beiden Elternteilen berichteten, mehr Ärger auf die Mutter zum Ausdruck brachten, häufiger Anzeichen von unverarbeiteten Verlusten und Traumata zeigten und eine geringere Kohärenz in der Darstellung hatten. Bei den Klassifizierungen entfielen alle Schmerzpatienten auf einen der unsicheren Bindungsstile, am häufigsten auf die desorganisierte Bindung, während die Mehrheit der Kontrollprobanden als sicher klassifiziert wurde. Die Ergebnisse verweisen insgesamt auf die Bedeutung geringer Kohärenz und desorganisierter Verarbeitungszustände für die somatoforme Schmerzstörung. PISO: Psychosomatische Intervention bei Patienten mit schmerzdominanter (multi-) somatoformer Störung - ein Studienbericht 1 2 3 1 Sattel H. C. , Gündel H. , Kruse J. , Lahmann C. , 1 4 5 Sack M. , Sauer N. , Schneider G. , Henningsen 5 P. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin, Psychotherapie und medizinische Psychologie, tech. Univ. München, Klinikum rechts der Isar, Langerstr 3, 81675 München 2 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover 71 3 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, Bergische Landstrasse 2, 40629 Düsseldorf 4 Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE), Gebäude Ost 59 (O 59), Martinistr. 52, 20246 Hamburg 5 Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Universitätsklinikum Münster, Domagkstr.22, 48149 Münster In diese große multizentrische, mehrdimensionale Studie konnten 219 Patienten eingeschlossen und einer 12-stündigen psychodynamischinterpersonellen Kurzzeitpsychotherapie oder einer verbesserten medizinischen Standardbehandlung per Zufall zugewiesen werden. Zielgruppe für die Studie waren Patienten mit einer langandauernden und gravierenden organisch nicht erklärbaren Schmerzsymptomatik und einem entsprechend organisch-somatischen Ursachenüberzeugung. Diese Patienten stehen einer Psychotherapie meist nicht aufgeschlossen gegenüber. PISO verfolgte das Ziel, diesen von Behandlern häufig als schwierig erlebten Patienten eine psychosomatische Behandlung angedeihen zu lassen. Die manualisierte Intervention folgte einem interpersonellen Ansatz, welcher die Schmerzsymptomatik unter dem Aspekt einer "Beziehungsstörung im Gesundheitswesen" aufgreift. Als primäres Erfolgskriterium der Intervention war eine - im Vergleich zur Kontrollgruppe - signifikante und klinisch relevante Verbesserung der körperlichen Lebensqualität (nach SF-36) vorgegeben. Die Kontrollgruppe erhielt eine anhand der "Leitlinien Somatoforme Störungen" verbesserte medizinische Standardbehandlung im Umfang von 3 Sitzungen. Nach Abschluss der 12Monats-Folgeuntersuchungen werden die Methoden der Studie und die untersuchte Stichprobe vorgestellt: Studiendurchführung, Rekrutierungserfolg, Untersuchungsdimensionen, klinische Merkmale der untersuchten Patienten. Dialectic Mentalization Based Therapy for severe Somatoform disorders (D-MBT-S)- Ein integratives psychosomatisches Modell Bühring M. E., Kalisvaart H. Eikenboom, Center for Psychosomatic Medicine, Oude Arnhemse Weg, NL 3705 BK Zeist, Niederlande Eikenboom, Center for Psychosomatic Medicine in Zeist, ist eine der wenigen Zentren in den Niederlanden, die somatoforme Störungen behandeln. Patienten haben eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich , bevor sie überwiesen werden. Sie sind im Laufe der Jahre sehr invalide geworden; ca 80% der Klinikpatienten sitzen im Rollstuhl. Eikenboom arbeitet mit einem transdiagnostischen, multifaktoriellen Modell. Auf Niederländisch heisst das Modell MAMS (Abkürzung von Mentalisierung, Akzeptieren, Modullieren, Systemisch Arbeiten). Die Therapiemethode, auf der das Modell basiert ist, nennt sich Dialectic Mentalization Based Therapy for severe Somatoform disorders (D-MBT-S), Diese Therapie geht davon aus, dass erst das KörperMentalisierungsvermögen und die Akzeptanz der Beschwerden gefördert werden müssen. Danach kann bei dieser sehr chronifizierten Gruppe Verhaltensmodifikation erfolgreich sein. Systemtherapeutische Ansätze unterstützen den gesammten Therapieprozess. Bei dieser Therapie geht es um die Dialektik zwischen verändern ( wollen) und akzeptieren (können), zwischen individueller und Gruppendynamik, zwischen deutlichen Strukturelementen und organischem Wachstum. Forschungsdaten geben an, dass dieses multimodale, integrative Modell die Lebensqualität der behandelten Patienten signifikant verbessert und sowohl die Psychopathologie als auch die medizinischen Kosten verringert. S41: Psychoneuroimmunologie und Psychodermatologie Die gezielte Beeinflussung des Immunsystems durch psychotherapeutische Interventionen Schubert C. Department of Medical Psychology and Psychotherapy, Mittlerweile gibt es ausreichend empirische Belege dafür, dass sich Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem wechselseitig beeinflussen können. Die Psychoneuroimmunologie konnte darüber hinaus verdeutlichen, dass nicht nur negative, emotional belastende Faktoren, sondern auch positive Faktoren (z.B. soziale Unterstützung, Optimismus, positive Stimmung) wesentliche Immunfunktionen verändern. Die gezielte Beeinflussung von Immunaktivitäten via psychologischer und psychotherapeutischer Intervention ist als ein logischer nächster Schritt anzusehen. Dieser Vortrag zeigt u.a. wie sich Immunfunktionen unter Hypnose verändern lassen, wie Immunaktivitäten klassisch konditioniert werden können und wie sich Immunologie durch Sich emotional öffnen modifizieren lässt. Meta-analytische Resultate zeigen darüber hinaus, dass die Forschung zur gezielten Beeinflussung des Immunsystems durch psychotherapeutische Interventionen zu einer Reihe von inkonsistenten Ergebnissen führte. Methodologisch alternative Herangehensweisen an diese komplexe Thematik sollen daher vorgestellt werden und zur Diskussion beitragen. Förderung integrativer Kompetenz bei Psoriasis durch eine persönlichkeitsadaptierte, sekundärpräventive Patientenschulung Bahmer J. A. 72 Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Universitätsklinikum Münster, Domagkstr.22, 48149 Münster Theoretischer Hintergrund: Verschiedene Pilotprojekte für Patienten mit Psoriasis vulgaris haben gezeigt, dass eine konsequente, interdisziplinär angelegte und wohnortnahe Rehabilitationsmaßnahme sowohl einen positiven Effekt auf die Schwere der Hauterkrankung, als auch auf die allgemeine Krankheitsbewältigung hat. Aufgrund verschiedener intrapsychischer Dynamiken und Mustern der Krankheitsbewältigung erscheint eine gemeinsame Schulung von Patienten mit Atopischer Dermatitis und Psoriasis nicht sinnvoll (Bahmer JA 2006, Bahmer JA et al. 2007). Patienten und Methoden: Insgesamt wurden 39 Patientinnen und Patienten mit Psoriasis vulgaris mittels des „Entwicklungsorientierten Scannings (EOS)“ (Kuhl & Henseler 2004) getestet und randomisiert in zwei Experimentalgruppen mit den Schulungsschwerpunkten Affektregulation und Zielverfolgung sowie eine Kontrollgruppe eingeteilt. Die Katamnese erfolgte nach 6 Monaten. Ergebnisse: Es zeigte sich eine förderliche Wirkung der individualisierten Intervention auf die subjektive Vorhersagbarkeit, Handhabbarkeit und Kontrollierbarkeit der Erkrankung sowie auf die Symptomschwere in den Interventionsgruppen. Diskussion: Eine persönlichkeitsadaptierte Patientenschulung kann einen positiven Einfluss auf die Krankheitswahrnehmungund schwere, sowie auf die Gelassenheit im Umgang mit der Psoriasis haben und helfen, einen inneren Umgang mit der Erkrankung zu finden und sich aus Fixierung auf das Krankheitsthema zu lösen. (KV) mit neutralen hautbezogenen Themen. Während der Videodarbietungen wurden die Probanden gefilmt. Anhand dieser Aufnahmen klassifizierten zwei unabhängige Rater die Selbstberührung der Probanden als Kratzbewegungen oder Berührungen. Kratzbewegungen und subjektiv empfundener Juckreiz waren die abhängigen, die beiden Videobedingungen und die Gruppenzugehörigkeit die unabhängigen Variablen. Daten aus psychologischen Testverfahren wurden als mögliche Kovariate betrachtet. Ergebnisse: Erste Ergebnisse weisen darauf hin, dass Neurodermitispatienten durch die Juckreizinduktion seltener zu (unbewussten) Kratzbewegungen während des EV neigen. Der subjektiv wahrgenommene Juckreiz scheint sich zwischen den Gruppen kaum zu unterscheiden. Wirkrichtungsanalyse der Wechselwirkungen zwischen Stimmung, Erschöpfung und Immunaktivität bei Brustkrebspatientinnen unter natürlichen Bedingungen 1 2 2 Schubert C. , Fritzsche K. , Burbaum C. , Schmid3 3 4 5 Ott G. , M. , Fuchs D. , Geser W. 1 Department of Medical Psychology and Psychotherapy 2 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Freiburg, Hauptstr. 8, 79104 Freiburg 3 Abt. Psychosomatik und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-Neuberg Str. 1, 30625 Hannover 4 Division of Biological Chemistry, Fritz-Preglstrasse 3, A6020 Innsb´ruck, Österreich 5 Ist die mentale Induktion von Juckreiz bei Patienten mit Neurodermitis und hautgesunden Probanden vergleichbar? 1 1 2 Kupfer J. , Bosbach S. , Gieler U. 1 Institut für Medizinische Psychologie, Justus-Liebig Universität Giessen, Friedrichstr. 36, 35392 Giessen 2 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Giessen, Paul-Meimberg-Str. 5, 35392 Giessen Fragestellung: Aus dem Alltag ist bekannt, dass Juckreiz stimulierende Themen zu vermehrtem Kratzen bzw. Juckreiz führen. In einer Studie zeigten wir, dass mit audiovisuellem Stimulusmaterial bei gesunden Probanden Juckreiz real induziert werden kann; die objektive und subjektive Juckreizmessung korrelierte dabei kaum. In der vorliegenden Studie wurde unter identischen Bedingungen eine Gruppe von Neurodermitikern untersucht, um Abweichungen und Übereinstimmungen mit gesunden Probanden darzustellen. Methoden: je 30 gesunde Probanden und nach Alter und Geschlecht parallelisierte Neurodermitiker sahen in einem Crossover-Design zwei Videos (getrennt durch wash-out Phase). Das Experimentalvideo (EV) mit Juckreiz induzierende, das Kontrollvideo Institut für Psychologie, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Österreich In der psychoneuroimmunologischen (PNI) Forschung herrscht Unklarheit darüber, inwieweit psychiatrische Komorbiditäten (Depressivität, chronische Erschöpfung) bei Brustkrebs durch erhöhte zelluläre Immunaktivität bedingt sind. Es wurden zwei integrative Einzelfallstudien an Patientinnen mit Brustkrebs in der Anamnese durchgeführt, um unter Alltagsbedingungen die Wechselwirkungen zwischen täglicher Stimmung, Erschöpfung und zellulärer Immunaktivität (Neopterin) zu analysieren. Beide Patientinnen (60a, 49a) sammelten 31 bzw. 28 Tage lang in 12-Stundenabständen ihren gesamten Harn zur Analyse von Neopterin (HPLC) und füllten Fragebögen u.a. zur Stimmung (EWL) und Erschöpfung (VAS, MFI) aus. Die Zeitreihen wurden anschließend modelliert (ARIMA, moving average smoothing) und die Wechselwirkungen zwischen den Variablen mittels Kreuzkorrelationen analysiert. Bei beiden Patientinnen ließ sich nachweisen, dass Stimmungsabfälle Neopterinanstiegen zeitlich signifikant vorausgingen, u.z. mit einer Verzögerung von 96 (lag4: -.697; p< 0.05) bzw. 132 Stunden (lag11: -.306; p< 0.05). Weiter zeigte sich, dass Neopterinanstiege Erschöpfungsanstie- 73 ge triggerten, u.z. mit einer zeitlichen Latenz von 24 (lag1: +.491; p < 0.05)bzw. 60 Stunden (lag5: +.324; p < 0.05). Diese ersten Ergebnisse dokumentieren, dass mit einer angemessenen Methodik komplexe PNI-Zusammenhänge unter Alltagsbedingungen analysiert werden können. Weitere Studien müssen nun folgen, um das hier Gezeigte abzusichern. S42: Elektronische Patienten-Tagebücher – Was bieten diese für die Psychosomatik? Elektronische Patienten-Tagebücher in der Psychosomatik - Über die FDA Guidelines zu Patient Reported Outcome Ebner-Priemer U. W., Bohus M. Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, Psychosomatische Klinik, J 5, 68159 Mannheim, Deutschland Da viele Symptome nur den Patienten selbst zugänglich sind, fordert die FDA eine stärkere Verwendung von „patient reported outcomes“ (PRO), d.h. von Symptomberichten die direkt vom Patienten stammen. Dabei werden rückblickende Erhebungsverfahren, wie z.B. Fragebogen, zunehmend kritisiert. Bei diesen bestimmt die aktuelle Symptomatik fälschlicherweise die Beurteilung vergangener Symptomatik: Geht es dem Patienten schlecht, so fällt die Erinnerung an Symptome leicht, wohingegen in symptomfreien Episoden die Erinnerung an Symptomatik erschwert ist. Eine viel versprechende Alternative sind Elektronische Tagebücher, auch als „Ambulantes Assessment“ oder „ecological momentary assessment“ bekannt, da sie wiederholt Symptomatik in „Echtzeit“ erfassen. Elektronische Tagebücher sind nicht nur genauer als bisherige Verfahren, sondern bieten zusätzlich neue Möglichkeiten: Symptome werden dort untersucht, wo sie natürlicherweise auftreten und den Patienten belasten, im Alltag. Zusätzlich können die Kontexte registriert werden, d.h. die situativen Bedingungen unter denen bspw. Panikattacken oder dissoziative Symptome auftreten. Weiterhin ist ein automatisiertes Feedback möglich, d.h. beim Auftreten von belastender Symptomatik werden den Patienten Handlungsalternativen angeboten. Der Nutzen Elektronischer Tagebücher wird beispielhaft an Studien zur BorderlinePersönlichkeitsstörung illustriert. Symptomwahrnehmung bei Diabetes mellitus– Elektronische Patienten-Tagebücher in der Klinischen Praxis Kubiak T. Institut für Psychologie, Universität Greifswald, FranzMehring-Str. 47, 17487 Greifswald Bei der Insulintherapie des Diabetes mellitus kommt der Blutglukoseselbstkontrolle eine zentrale Stellung im Rahmen des Selbstbehandlungsverhaltens zu. Paper-Pencil-„Blutzuckertagebücher“ sind nach wie vor der Standard in der Therapie. Neuere technische Entwicklungen (Messgeräte zur Blutglukoseselbstkontrolle mit „memory function“; kontinuierliche Glukosemessung) und der Einsatz von elektronischen Tagebüchern bieten hier Möglichkeiten zur weiteren Optimierung der Therapie. Insbesondere spezifische Subgruppen (z.B. Diabetespatienten mit Hypoglykämiewahrnehmungsproblemen) können von diesen neuen Ansätzen profitieren. Es werden eine Reihe klinischer Studien vorgestellt, in denen „memory meters“ und elektronische Tagebücher in Verbindung mit kontinuierlicher Glukosemessung genutzt werden, und der Zusatznutzen der Anwendung für die klinische Praxis demonstriert: (a) Ableitung von Indices für die Stabilität der Stoffwechselkontrolle, die über herkömmliche klinische Marker (z.B. HbA1C) hinausgehen; (b) Verbesserung der Symptomwahrnehmung bei Patienten mit Hypoglykämiewahrnehmungsproblemen; (c) Akzeptanz seitens der Patienten. Depressive Stimmung und autonome Dysregulation im Alltag: Der moderierende Einfluss der Situation Schwerdtfeger A. R., Friedrich-Mai P. Psychologisches Institut der Universität Mainz, Staudingerweg 9, 55099 Mainz Depressivität ist verschiedenen Befunden zufolge mit kardiovaskulären Erkrankungen assoziiert. Dieser Zusammenhang scheint u.a. durch eine autonome Dysregulation vermittelt zu werden. Wenig bekannt ist bisher jedoch darüber, ob psychosoziale Ressourcenvariablen (z.B. soziale Unterstützung) den gesundheitskompromittierenden Einfluss von Depressivität auf das HerzKreislaufsystem abfedern können. In einer ambulanten Monitoringstudie untersuchten wir negativen Affekt, Herzrate und Herzratenvariabilität von 63 gesunden Probanden mit variierenden Depressivitätswerten über 22 Stunden. Die Daten wurden mit Mehrebenenmodellen analysiert. Depressivität war mit erhöhten Werten und stärkeren Fluktuationen von negativem Affekt assoziiert. Darüber hinaus zeigten Individuen mit erhööhten Depressivitätswerten im Alltag signifikant höhere Herzraten und eine tendenziell verminderte Herzratenvariabilität. Die Befunde zur Herzratenvariabilität wurden jedoch vom sozialen Kontext, in dem sich die Probanden befanden, moderiert. Waren depressiv verstimmte Probanden allein, so war die Herzratenvariabilität deutlich erniedrigt. Interagierten diese Probanden jedoch mit nahen Angehörigen, dem 74 Partner oder Freunden, so erhöhte sich die Herzratenvariabilität signifikant. Die Befunde lassen vermuten, dass Sozialkontakte das kardiovaskuläre Risikoprofil depressiver Individuen positiv beeinflussen könnten. S43: Psychosomatische Urologie Das chronische Beckenschmerzsyndrom, Eine somatoforme urologische Störung Berberich H. J. (Frankfurt a. M.) Privat Es gibt Schätzungen, nach denen der Anteil an psychosomatischen Störungen in der niedergelassenen urologischen Praxis zwischen 15 und 50% liegt. Diese sind mehrheitlich nach der neuen ICD10-Nomenklatur den somatoformen Störungen zuzuordnen. Ein Paradebeispiel für eine solche Störung ist der chronische Beckenschmerz beim Mann (CPPS, ICD10 F45.8). Typisch für diesen Beschwerdekomplex sind folgende Symptome: Druckgefühl im Damm Ziehende Beschwerden in den Leisten, die zum Teil in die Hoden ausstrahlen Vermehrter Harndrang, mitunter erschwerte, verlangsamte Blasenentleerung (funktionelle Stenose) Brennen in der distalen Harnröhre Nachträufeln Druckgefühl oder Brennen hinter dem Schambein Spannungsgefühl in der Dorsolumbal- sowie der SakralregionSehr häufig gehen diese Beschwerden mit sexuellen Funktionsstörungen (Erektionsstörungen, früher Orgasmus) einher und können der konversionsneurotische Ausdruck eines ungelösten Sexualkonflikts sein. In der Regel lassen sich bei den Patienten mit den genannten Beschwerden mit den herkömmlichen Methoden(4Gläseprobe, Ejakulatkultur) keine entzündlichen Vorgänge. In der Prostata nachweisen. Deshalb sind Begriffe wie Prostatodynie, chronische Prostatitis etc. irreführend und als obsolet zu bezeichnen. Der unvorsichtige Umgang mit solchen Diagnosebezeichnungen kann eine iatrogene Organfixierung der Patienten bewirken, insbesondere wenn diese zu hypochondrischen oder zwangsneurotischen Störungen neigen. Allerdings finden sich nicht selten in der Vorgeschichte des Patienten eine abgelaufenen Erkrankungen im Beckenbereich, auf die dieser mit einer erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber allen Vorgängen in dieser Körperregion reagiert hat. Es entwickelt sich ein so genannter Angst-Spannungs-Zyklus, der eine chronischen Anspannung der Beckenmuskulatur, die die Bildung von schmerzhaften Myogelosen zur Folge haben kann. Bei einer rektalen Austastung des Beckenbodens findet sich neben einem erhöhten Analsphinktertonus nicht selten schmerzhafte Levatoren. Nicht selten löst die Tatsache, dass die Ärzte trotz zahlreicher Untersuchungen nichts finde können, Ängste aus, dass es sich um eine be- sonders schwere, möglicherweise sogar um eine Karzinomerkrankung handeln könnte. Dem Patient sollte nach Abschluss der Diagnostik mitgeteilt werden, dass zwar keine ernsthafte Erkrankung vorliegt dass man seine Beschwerden aber durchaus ernst nimmt und diese auch behandelt werden müssen. Besteht kein Hinweis auf ein entzündliches Geschehen im Urogenitalbereich, sollte eine antibiotische Behandlung vermieden werden. In leichten Fällen reicht oft die Aufnahme von körperlichen Aktivitäten, wie leichtes Joggen oder Nordic Walking. Gute Erfahrung konnten vor allem mit Biofeedback-Training und der Progressiven Muskelentspannung (PME) gemacht hat werden. Sind jedoch schwerere psychische Störungen, wie zum Beispiel eine lavierte Depression, eine zwangsneurotische oder eine Angststörung Auslöser der Beschwerden, ist eine psychotherapeutische Behandlung anzustreben. Prostatitisbeschwerden und ihre Komorbidität mit Depression und psychischen Störungen Ergebnisse einer Repräsentativuntersuchung Brähler E. Selbständige Abteilung für Medizinische Psychologie und Soziologie, Universität Leipzig, Philipp-RosenthalStraße 55, 04103 Leipzig In einer Repräsentativuntersuchung zeigten sich bei 3,2 % der Männer Prostatitisbeschwerden, die nach dem NIH-ZPSI-Index eine chronische Prostatitis nahelegen. Diese Personen waren älter als die Personen ohne auffälligen Befund. Sie waren jedoch auch älter als bisher in der Literatur für chronische Prostatitis beschrieben wurde. Die Personen mit Prostatititssymptomen zeigen ein gesteigertes Ausmaß an Depressionen und psychischen Störungen, auch unter Kontrolle des Alters. „Wenn die Blase weint“ Neubauer H. Privat Mit einer Fallvignette typischer urologischer Erkrankungen und urologische Problempatienten aus psychosomatischer und psychotherapeutischer Sichtweise möchte ich Sie in die Problematik der psychosomatischen Urologie einführen. Für die klinisch tätigen wie für die niedergelassen Urologinnen und Urologen kann dieser Perspektivenwechsel vielleicht gleichermaßen hilfreich sein, insbesondere in den Fällen in denen „man nichts findet. Haben Psychosomatiker andere Patienten? Oder liegt es am Blickwinkel? Der Blickwinkel, mit dem der psychosomatisch ausgebildete Arzt Patienten betrachten sicherlich ein anderer als die Sichtweise eines vorwiegend operativ tätigen Urologen. Um Missverständnissen vorzubeugen: In diesem Beitrag dreht es sich nicht darum, eine Ur- 75 sachendiskussion um Krankheitskausalität zwischen „Somatikern“ und „Psychosomatikern“ erneut anzufachen. Das Anliegen des Arbeitskreis Psychosomatische Urologie und Sexualmedizin ist es anhand von typischen Krankheitsbildern und Therapieverläufen auf die Möglichkeiten hinzuweisen, neben der organisch urologischen Betreuung auch psychosomatische Aspekte mit einzubeziehen. Insbesondere in Fällen therapieresistenter oder aus anderen Gründen unbefriedigender Heilungsverläufe wollen wir weitere Möglichkeiten aufzeigen, die sich aus der bio-psycho-sozialen Vorgeschichte des Patienten ergeben. Fazit für die Praxis: „Idiopathische Störungen“ können oft eine Umschreibung für psychosomatisch oder gar psychogene Krankheitsbilder sein. Die gleichzeitige Erfassung des bio – psycho – sozialen Umfeldes im Sinne der psychosomatischen Grundversorgung kann sehr hilfreich in der Erfassung und Behandlung von allen Krankheitsbildern sein. Der psychosomatische Ansatz sollte nicht am Ende einer langen Reihe von Untersuchungen und Behandlungsansätzen als ultima ratio stehen, sondern möglichst früh einbezogen werden um Frustrationen auf ärztlicher sowie auf Patientenseite zu vermeiden. S44: Psychoneuroallergology – main branch of psychosomatics (English Track) Bronchial asthma with psychogenic triggers Iamandescu I. B. University of Medicine and Pharmacy, Dionisie Lupu, 37 Bucharest, Romania Psychogenic-triggered bronchial asthma (BAPT) includes cases of bronchial asthma which are clearly triggered by psychological stimuli (usually stress) in the context of multiple triggers, on the background of bronchial hyperreactivity induced by allergic inflammation or by non-immunological factors. It is not only the stress stimuli that play a triggering role, but also a series of conditioned excitants (e.g. asthma attacks provoked by seeing a cat exhibition at TV).In large groups of asthma with allergic or other etiology, we pointed out that forms of asthma triggered by an additional psychogenic factor are noticed in 62.5% of inpatients, most cases with a prolonged and more severe evolution of the disease, but in only 30% of mild and moderately severe cases that are followed up in outpatient setting. The percent of psychological trigger is maximum (86%) in corticodepedent asthmatics.BAPT has a series of particularities that we have pointed out: the female gender, high level of anxiety and/or depression, the increased duration of illness, corticodependence and the tendency to multi-intricate forms of asthma, the severity of the attacks, sensitivity to aspirin and certain endocrine dysfunctions (high estrogen and thyroid hormones secretion). BAPT is frequent also in patients with multi-factorial triggering of the attacks (especially non-specific respiratory irritants, including physicalchemical factors and meteorological changes). Psychological factors involved in therapeutic adherence at asthmatic patients Popa-Velea O. University of Medicine and Pharmacy, Dionisie Lupu, 37 Bucharest, Romania 84 patients with chronic bronchial asthma (mean age = 48.02; SD = 15,53), were administered the Illness Perception Questionnaire (IPQ) in order to evaluate their attitudes regarding the disease and treatment and were later randomly assigned to 2 different methods of approach: technical and personalized, with the aim to evaluate their impact on adherence. The initial findings revealed that an important number of patients tended to overestimate their adherence (70,23%), to attribute the disease to stress (33,33%) and to underestimate their own responsibility in influencing the prognosis of the disease. In some cases there was an important discrepancy between the treatment that patients had received and the treatment they would have preferred. A significant proportion of patients (57,14%) reported significant changes brought by the disease in self-perceived quality of life. The personalized therapeutic proved to be capable to diminish most of these negative phenomena. Hierarchical regression analysis of adherence scores (at MARS test) revealed that the highest contribution to adherence variance was attributable to illness perceptions (11%) and to the participation to a personalized therapeutic plan (15%). These results suggest at least two concrete possibilities of intervention for increasing adherence in chronic asthma, one focused on perceptions and the second focused on personalization of therapeutic strategies. Psychosomatische Aspekte bei Patienten mit Asthma bronchiale in der hausärztlichen Praxis Herrmann M. L. Institut für Allgemeinmedizin der Universitäten Halle / Magdeburg, Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg Bei Patienten mit Asthma bronchiale ist wissenschaftlich erwiesen, dass neben allergischen, entzündlichen und genetischen auch psychologische Aspekte eine bedeutende Rolle spielen. Asthma bronchiale wird zu den sogenannten Organkrankheiten mit psychosozialer Komponente gezählt. Selbstständigkeits- /Abhängigkeitskonflikte sowie Ambivalenzkonflikte aber auch aggressive Hemmungen spielen psychodynamisch gesehen bei Betroffenen eine große Rolle. Im Rahmen einer 76 derzeit laufenden Fragebogenstudie wird bei einer repräsentativen Stichprobe von 150 niedergelassenen Hausärzten in Sachsen-Anhalt der Frage nachgegangen, welche Erfahrungen sie in den Jahren ihrer Niederlassung mit dieser Patientengruppe gesammelt haben und wie sie mit ihr als Hauärzte umgehen. Insbesondere wird der Frage nachgegangen, inwieweit psychosomatische Aspekte in der Behandlung eine Rolle spielen. In dem selbst entwickelten Instrument werden Fragen gestellt nach Häufigkeit, Vorgehen, weiterführender Diagnostik, Medikation und dem Gewahrwerden psychosozialer Konfliktsituationen. Ferner werden nach notwendigen Fähigkeiten und persönlichem Entwicklungsbedarf im Umgang mit diesem Patiententypus gefragt. Ebenfalls wird mittels vorgegebener Items die Dynamik der Arzt-PatientenBeziehung erfasst. Die noch ausstehenden Ergebnisse sollen präsentiert und in Hinblick auf Entwicklungs- und Fortbildungsbedarfe der Hausärzte diskutiert werden. Quality of life in allergic patients Mihailescu A. I. University of Medicine and Pharmacy, Dionisie Lupu, 37 Bucharest, Romania The assessment of Quality of Life (QoL) in allergic disorders is a way to objectively evaluate how a patient or a population of patients subjectively feels the impact of the allergic disease on his/her daily life. The burden of disease, as the patient perceives it, forms the basic motivation to seek medical aid or to undergo therapy. We have studied QOL, using Juniper questionnaire, on groups of asthmatics and have found the following. Overall QOL score on the AQLQ less than 4 (diminished quality of life) was significantly correlated with the increased stress vulnerability regarding overload. Also, we have noticed in these patients aggressive behavior traits, and feelings of being under pressure of time. Low values of scores in all subscales of AQLQ (Activity limitation, Emotional functions, Environmental stimuli and Symptoms) have positively correlated with vulnerability to overload. Those patients with low QOL scores on Emotional functions and Environmental stimuli had also excessive aggressivity. Patients’ age and a longer duration of the disease were factors that increased the Overall QOL score. Practical importance of this research is that, for a correct evaluation of the quality of life in the patient with asthma, we must consider also the patient’s subjectivity in this selfassessment. An adequate psychological approach could be the source of some “adjustments” to the interpretation of AQLQ results. Psychosomatic and somatic aspects of allergic rhinitis. Some experimental contributions Cioca I., Iamandescu I. B. University of Medicine and Pharmacy, Dionisie Lupu, 37 Bucharest, Romania Psychosomatic problems of allergic rhinitis (AR) are characterized , at the first global evaluation, by certain imbalance somewhat discreet (or poorly perceived) effect of psychic stress on the evolution of AR symptoms (the trigger effect of psychical stress) and the evidence effect of the illness, including also antiallergic medication, on the quality of life (QOL) of patients (somato-psychical action). Some clinical observations, only rarely confirm perception by patients with AR of the occurrence of nasal function changes such as sneezing or blocking of the nasal pathways in the course of the psychical stress. Experimental proofs are furnished by “pollen chambers” in which pollinose patients presented rhino-conjunctivitis symptoms induced by a stressing interview. Ionescu and Iamandescu have demonstrated in AR patients, using rhinoscopy during a stress test, two kinds of responses: nasal vasoconstriction or dilatation. AR alter the quality of life. “The sleep disorder breathing” is more frequent in patients with nasal obstruction then in normal subjects and it could generate diurnal symptoms as deficit of verbal function or memory, of visual-spatial organization and coordination, effective attention and verbal performances. This appearing on the background of marked somnolence with diminished attention, induce the above mentioned cognitive failure. Using HRQOL Juniper questionnaire, we noticed a persistent thirst, frequent headache, irritability and worn-out. S45: Neurokognitive Essstörungen Befunde bei Selective attention for unattractive body parts causes body dissatisfaction Smeets E., Jansen A., Lindelauf T., Roefs A. Department of Clinical Psychological Science, Faculty of Psychology, Maastricht University, PO Box 616, 6200 Maastricht, Niederlande Body dissatisfaction plays a key role in the maintenance of eating disorders and selective attention might be crucial for the origin of body dissatisfaction. Jansen et al., (2005) showed that eating disorder patients attend relatively more to their own unattractive body parts, whereas healthy controls attend relatively more to their own attractive body parts. In the current study, it was investigated whether this bias in selective attention is causal to body dissatisfaction. To test this hypothesis, we trained attention to either one’s self-defined unat- 77 tractive body parts (i.e., negative bias training) or one’s self-defined attractive body parts (i.e., positive bias training) in 47 healthy female participants while registering eye-movements. The results show that inducing a temporary attentional bias for self-defined unattractive body parts led to a significant decrease in body satisfaction. The positive bias training did lead to a significant increase in body satisfaction but only when it followed the negative bias training. Registration of eyemovements showed that the bias inductions did not lead to long-lasting changes in visual attention. In conclusion, the current study supports the causal role of selective attention for unattractive body parts in the development of body dissatisfaction. Selektive Aufmerksamkeitspräferenzen essgestörter und gesunder Frauen bei der Betrachtung des eigenen Körpers sowie anderer Frauenkörper 1 1 2 Kunzl F. K. , Hoffmann H. , Traue H. C. , Glaub 3 1 J. , von Wietersheim J. 1 Universitätsklinik Ulm, Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Am Hochsträß 8, 89081 Ulm 2 Universitätsklinik Ulm, Abteilung Medizinische Psychologie und Soziologie, Am Hochsträß 8, 89081 U 3 Privat, Ulm Empirische Studien belegen die Existenz selektiver Aufmerksamkeit essgestörter Frauen für eigene unattraktive Körperpartien (Freeman et al., 1991; Jansen et al., 2005). Im Rahmen der Studie wurden selektive Aufmerksamkeitstendenzen essgestörter Patientinnen und gesunder Kontrollprobandinnen während der Betrachtung des eigenen Körpers sowie von Fotos anderer Frauen (BMISpektrum von 11,2 bis 43,8) mit Hilfe einer Blickbewegungskamera untersucht. Es wurden 50 Probandinnen getestet, von denen 18 eine Essstörung aufwiesen. Zusätzlich wurden verschiedene psychische Variablen (ASTS, EDI-2, SCL90-R, Körperzufriedenheit) sowie die Attraktivität einzelner Körperpartien der präsentierten Frauenbilder erfasst. Bei der Betrachtung des eigenen Körpers unterscheiden sich essgestörte und gesunde Probandinnen nicht signifikant hinsichtlich absoluter Betrachtungszeiten einzelner Körperpartien. Wird die Betrachtungsdauer einer Körperzone in Bezug gesetzt zu deren Attraktivitätsbewertung, zeigen essgestörte Patientinnen gerade für diejenigen Partien eine selektive Aufmerksamkeitstendenz, welche sie als überaus unattraktiv empfinden (Bauch und Oberschenkel). Bei der Betrachtung anderer Frauenkörper mustern Patientinnen mit einer Essstörung ebenfalls diejenigen Körperpartien am längsten, welche sie am eigenen Körper als besonders unattraktiv bewerten. Die Ergebnisse verweisen auf die Relevanz selektiver Aufmerk- samkeitspräferenzen essgestörter Patientinnen im Kontext sozialer Vergleichsprozesse. Verarbeitung selbstwertrelevanter und körperbezogener Informationen: Experimentelle Studien zum impliziten Selbstwert von Frauen mit gezügeltem Essstil und Frauen mit der Diagnose einer Essstörung 1 2 Hoffmeister K. , Teige-Mocigemba S. , Blechert 1 2 1 J. , Klauer C. , Tuschen-Caffier B. 1 Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie, Psychologisches Institut Freiburg, Engelbergerstrasse 41 Freiburg im Breisgau 2 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Psychologie, Abteilung Sozialpsychologie und Methodenlehre, Engelbergerstr. 41, 79106 Freiburg Empirische Befunde zeigen, dass Patientinnen mit der Diagnose einer Essstörung häufig einen niedrigen expliziten Selbstwert aufweisen. Bisher gibt es jedoch kaum Forschung über implizite Prozesse der Selbstbewertung bei Essstörungen. In Studie 1 wurde der implizite Selbstwert sowie dessen Zusammenhang mit Figur und Gewicht bei Frauen mit gezügeltem Essstil (n=32) im Vergleich zu Frauen ohne gezügelten Essstil (n=39) anhand eines Impliziten Assoziationstests (IAT; Greenwald & Farnham, 2000) untersucht. Hierfür wurde der implizite Selbstwert wiederholt erhoben, wobei die Probandinnen vor der zweiten Erhebung mit ihrer Figur und ihrem Gewicht konfrontiert wurden. Wie erwartet, war ein Hauptergebnis, dass sich beide Gruppen darin unterschieden, wie sich der implizite Selbstwert nach der Konfrontation mit Figur und Gewicht veränderte: Während der implizite Selbstwert der Frauen mit gezügeltem Essstil sank, stieg er bei der Kontrollgruppe. In Studie 2 untersuchen wir aktuell den impliziten Selbstwert von Patientinnen mit der Diagnose einer Essstörung (bisher Anorexia Nervosa n=15, Bulimia Nervosa n=15) im Vergleich zu Frauen ohne die Diagnose einer Essstörung (bisher n=20). Die Ergebnisse beider Studien werden im Hinblick auf Implikationen für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Essstörungen in Zusammenhang mit Selbstwertproblemen diskutiert. Verarbeitung visuell-bildhafter Essensreize bei Patientinnen mit Anorexia nervosa 1 2 2 Giel K. , Zipfel S. , Enck P. 1 Abt. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Klinik, Universitätsklinikum Tübingen, Osianderstr 5, 72076 Tübingen 2 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen, Silcherstraße 5, 72076 Tübingen 78 Patientinnen mit Essstörungen zeigen eine gestörte Nahrungsaufnahme, die sich bei der Anorexia nervosa typischerweise in stark gezügeltem Essverhalten und eingeschränkter Nahrungszufuhr zeigt. Dieses Verhalten ist meist begleitet von dysfunktionalen Einstellungen und Gedanken hinsichtlich Essen, Figur und Gewicht. Die vorliegende Studie untersucht experimentell, wie AnorexiePatientinnen visuell-bildhafte Essensreize wahrnehmen und kognitiv verarbeiten. Dazu werden Bildpaare aus neutralen und essenbezogenen Fotografien zur freien visuellen Exploration dargeboten und währendessen die Blickbewegungen mithilfe eines Eye Trackers aufgezeichnet. Verglichen werden die Daten mit denen normalgewichtiger gesunder Frauen und Frauen mit gezügeltem Essverhalten. Erkenntnisse darüber, wie essgestörte Patientinnen Essen und Nahrungsmittel als hoch störungsrelevanten Reizen verarbeiten, tragen zu einem besseren Verständnis der Störungsentstehung und -aufrechterhaltung bei und geben wichtige Hinweise für ihre Behandlung. S46: Placeboforschung: Vom Labor zur Klinik PLACEBO ANALGESIA RECORDED AS MODULATION OF EVENT-RELATED POTENTIALS TO PAINFUL STIMULATION 1 1 2 Flaten M. A. , Aslaksen P. M. , Enck P. 1 Institute of Psychology 2 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen, Silcherstraße 5, 72076 Tübingen Placebo analgesia refers to reduction in pain after administration of an inactive substance or procedure with the information that it is a powerful painkiller. Telling a patient or research participant that a substance will reduce pain may induce a response bias, that may affect the pain report without affecting the experience and physiological response to painful stimuli. To avoid the problem of response bias, electroencephalography was recorded under painful stimulation in healthy volunteers (N=30) before and after administration of a capsule with information that it reduced the pain (the Placebo condition). This was contrasted with a Natural History condition where pain was applied as in the placebo condition, but no capsule was administrated. Pain was induced by a thermode, rapidly heated (70o C / sec) to 51o C, placed on the lower arm. This stimulus generated a pain unpleasantness rating between 3 and 4 on a 10 point scale. Reported pain unpleasantness was significantly reduced in the Placebo compared to the Natural History condition. Importantly, pain-elicited changes in the electroencephalogram (i.e., eventrelated potentials) were reduced in the Placebo compared to the Natural History condition. This is interpreted as evidence that placebo analgesia involves a reduction in the pain signal to the brain. Klassische Konditionierung von Immunfunktionen: Mechanismen und klinische Relevanz 1 2 Schedlowski M. , Enck P. 1 Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Essen, Hufelandstr Essen 2 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen, Silcherstraße 5, 72076 Tübingen Neueste experimentelle Forschungsergebnisse dokumentieren, daß der Placebo-Effekt durch hochaktive Prozesse im ZNS gesteuert wird, bei denen sowohl kognitive Faktoren wie die Erwartungshaltung von Patienten als auch assoziative Lernprozesse eine Hauptrolle bei der Vermittlung dieser Effekte spielen. Die Bedeutung der Erwartungshaltung bzw. der Lern- oder Konditionierungsprozesse für die Wirkung der Placeboeffekte auf unterschiedliche physiologische Systeme bzw. auf pathophysiologische Prozesse bei unterschiedlichen Erkrankungen ist im Detail jedoch noch unklar. An experimentellen Beispielen zur Klassischen Konditionierung von Immunfunktionen sollen die Wirkungsweise, die neuroanatomischen und biochemischen Mechanismen sowie die klinische Relevanz der konditionierten Immunsuppression exemplarisch aufgezeigt werden. Das Ziel dieser Untersuchungsansätze ist die Schaffung einer Basis für den systematischen Einsatz solcher Konditionierungsprotokolle als supportive Therapie in klinischen Behandlungsansätzen. Innovative Studiendesigns zur Identifizierung und Minimierung der Placeboresponse 1 2 Enck P. , Klosterhalfen S. 1 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen, Silcherstraße 5, 72076 Tübingen 2 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Tübingen, Osianderstr. 5, 72076 Tübingen Die klassische Methode der Kontrolle von Placeboeffekten ist – in Medikamentenstudien – die Gabe von Placebos in doppel-blinder Verfahrensweise; dies gibt jedoch nur Auskunft über die den Placeboeffekt überschreitenden Medikamenteneffekt (gain above placebo) und meist nicht über die Placebowirkung selbst. Die Re-analyse der Rohdaten von solchen Medikamentenversuchen sind demgegenüber wegen der begrenzten Daten, die zur Verfügung stehen ebenfalls nicht sehr informativ. Unspezifische Effekte in Psychotherapiestudien sind demgegenüber mit „Wartelistenkontrollen“ 79 oder „treatment as usual“ (TAU) nicht zu erfassen. Es gibt jedoch eine Reihe von experimentellen, innovativen Studiendesigns, die für die Erforschung der Placeboeffekte ebenso in Frage kommen wie – zumindest theoretisch – auch für die Minimierung von Placeboeffekte in der klinischen Forschung. Dazu gehören das sog. „balanced placebo design“ (BPD), die verdeckte Applikation von Medikamenten (hidden treatment), randomisierte Run-in- und Auslassversuche, und das Paradigma der freien Wahl (free choice). Diese werden mit Beispielen aus der Forschung illustriert werden. S47: Instrumente Psychische Störungen und Multimorbidität im Alter: psychosoziale Instrumente in der epidemiologischen ESTHER-Studie 1 1 1 2 Wild B. , Lechner S. , Maatouk I. , Söllner W. , 3 3 3 4 Brenner H. , Raum E. , Müller H. , Löwe B. , Her1 zog W. 1 Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg 2 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin, Klinikum Nürnberg 3 Abteilung Klinische Epidemiologie und Alternsforschung, DKFZ, Heidelberg, Bergheimer Str. 20, 69115 Heidelberg 4 Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE), Gebäude Ost 59 (O 59), Martinistr. 52, 20246 Hamburg Der Verbund „Multimorbidität und Gebrechlichkeit im hohen Alter: Epidemiologie, psychische Komorbidität, medizinische Versorgung und Kosten“ wird geleitet von Prof. Brenner aus der Abteilung Klinische Epidemiologie und Alternsforschung (HD) mit Projektpartnern aus der Psychosomatik, Allgemeinmedizin, Pharmakoepidemiologie und Gesundheitsökonomie. Der Verbund zentriert sich um die Kohorte der ESTHER-Studie (Epidemiologische Studie zu Chancen der Verhütung, Früherkennung und optimierten Therapie chronischer Erkrankungen in der älteren Bevölkerung).In einem dritten follow-up bearbeiten ca. 9 000 Teilnehmer im Alter von 58 – 82 Jahren einen standardisierten Fragebogen. Alle Teilnehmer älter als 73 Jahre (und zufällig ausgewählte jüngere) werden zu Hause besucht (n ≈ 4000).Dabei wird ein geriatrisches Assessment durchgeführt und u.a. werden Medikamentenstatus,Versorgungsbedarf und psychische Komorbidität erhoben.Das Teilprojekt aus der Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin untersucht die Prävalenz psychischer Störungen im Alter in Beziehung zur Multimorbidität.Zur Einschätzung des Versorgungsbedarfs der Teilnehmer wird das adaptierte INTER- MED für ältere Menschen durchgeführt. Der vorliegende Beitrag präsentiert das Design der ESTHER-Studie.Besonderheiten des Einsatzes psychosozialer Messinstrumente im Rahmen einer epidemiologischen Studie werden diskutiert.Die Entwicklung des INTERMEDs für ältere Menschen in dem epidemiologischen Rahmen wird vorgestellt. Kennwerte des Fragebogens ICD-10-SymptomRatings (ISR) 1 2 3 1 Tritt K. , Zaudig M. , Klapp B. F. , Loew T. , Söll4 5 ner W. , von Heymann F. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin, Klinikum der Universität Regensburg, Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg 2 Psychosomatische Klinik Windach 3 Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Charité Universitätsmedizin Berlin, Charité-Campus Mitte, Luisenstr. 13a, 10117 Berlin 4 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin, Klinikum Nürnberg 5 Institut für Qualitätsentwicklung in der Psychotherapie und Psychosomatik, Werdenfelsstr. 81, 81377 München Der Fragebogen „ICD-10 Symptom-Rating“ (ISR) fußt auf den im ICD-10 erzielten, weltweit etablierten Konsens der Symptome zur Erfassung psychischer Störungen. Das ISR hat 29 Items, die auf sechs Syndrom-Skalen verteilt sind (Depression, Angst, Zwang, Somatoform, Essstörung sowie die Zusatzskala, die Screening-Items für weitere Syndrome enthält). Die Gesamtskala gibt das Ausmaß der Gesamtbeeinträchtigung an. Die Patienten schätzen die ISR-Symptome nach Schweregrad ein (trifft nicht zu = 0 bis trifft extrem zu = 4). In diesem Beitrag werden der Normierungsprozess und die statistischen Kennwerte des ISR vorgestellt. Um das Ausmaß der psychischen Beeinträchtigung, die Testnormierung sowie Cut-off Werte zwischen den zwei Stichproben darzustellen, werden die Daten einer klinisch unauffälligen, repräsentativen Stichprobe von N = 2.512 Personen sowie einer Stichprobe von N = 2.800 psychosomatischen Patienten herangezogen. Die klinische Stichprobe erzielten z.B. bei der Gesamtskala einen Mittelwert (MW) von 1,13 (SD = 0,63), während der MW der repräsentativen Stichprobe lediglich 0,40 (SD = 0,45) betrug. Die diagnosespezifischen MW für die jeweils dazu gehörigen Syndromskalen (z.B. MW der Depressionsskala bei Patienten mit einer Depressionsdiagnose) rangierten bei der klinischen Stichprobe von 2,43 (SD = 1,04) bis 1,09 (SD = 1,09) und bei der klinisch unauffälligen Stichprobe von 0,54 (SD = 0,69) bis 0,30 (SD = 0,42). 80 Faktorstruktur und testtheoretische Kennwerte des ICD-10-Symptom-Rating (ISR) an einer konsekutiven Stichprobe psychosomatischer Patienten 1 2 1 1 Fischer F. , Tritt K. , Fliege H. , Klapp B. F. 1 Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Charité Universitätsmedizin Berlin, Charité-Campus Mitte, Luisenstr. 13a, 10117 Berlin 2 Abteilung für Psychosomatische Medizin, Klinikum der Universität Regensburg, Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg Das ICD-10-Symptomrating, kurz ISR, ist ein Fragebogen, der sich an die syndromale Struktur des ICD-10 anlehnt und so psychische Belastung symptombezogen erfassbar machen soll. Der Fragebogen besteht aus insgesamt 6 Skalen (Depressions-, Angst-, Zwangs-, Essstörungs-, Somatisierungssyndrom sowie einer Zusatzskala mit besonders relevanten Items), der Gesamtscore soll als Maß globaler psychischer Belastung genutzt werden. An einer konsekutiven Stichprobe von 1057 psychosomatischen Patienten der Charité Berlin wurde die Faktorenstruktur des Fragebogens jeweils an Teilstichproben explorativ und konfirmatorisch geprüft. Desweiteren wurden Multi-SampleAnalysen zur Prüfung der Stabilität der Dimensionalität in verschiedenen Teilstichproben (Geschlecht, Altersgruppen, Zuweisungsmodus) berechnet. Die obengenannten, syndromalen Einheiten der ICD-10 zeigten sich in den Dimensionsanalysen als einzelne Faktoren mit hoher und gleichmäßiger Varianzaufklärung und verhielten sich zufriedenstellend stabil. Darüberhinaus zeigten die einzelnen Skalen des Instruments hohe interne Konsistenz und zeigten nur geringe Einflüsse von Alter und Geschlecht. Das ICD-10-Symptomrating ist aus testtheoretischer Sicht insgesamt gut geeignet, die psychische Symptomatik psychosomatischer Patienten im Sinne des syndromalen Ansatzes des ICD-10 zu erfassen und zu quantifizieren. Entwicklung und Validierung des OPDStrukturfragebogens (OPD-SF) Grande T., Dinger U., Ehrenthal J. C., Wölfelschneider M., Schauenburg H., Opd A. Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) ist ein vor allem in Kliniken, aber auch in ambulanten Praxen und in der Forschung breit etabliertes Instrument zur Beschreibung psychischer und psychosomatischer Störungen sowie zur Unterstützung der Therapieplanung. Das Instrument verlangt von dem Anwender eine komplexe klinische Beurteilung, die in Schulungskursen erlernt werden muss und einen gewissen Aufwand beinhaltet. Es liegt deshalb nahe, die Möglichkeiten einer Selbsteinschätzung für einzelne Aspekte der OPD zu prüfen, um leichter zu einem zumindest orientierenden Befund gelangen und in der Forschungsanwendung größere Fallzahlen untersuchen zu können. Eine Untersuchung der Übereinstimmungen zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung kann zudem zeigen, welche Bereiche des OPD-Befundes selbstreflexiv zugänglich sind und sich damit als Ausgangspunkt für die psychotherapeutische Arbeit anbieten. Es werden die Entwicklung und erste Validierungen eines Fragebogens zur Selbstbeurteilung der strukturellen Fähigkeiten vorgestellt. In einer ersten Version wurden die 24 Einzelmerkmale der OPDStrukturachse mit Hilfe von insgesamt 160 Items operationalisiert und einer Stichprobe von 200 Probanden/Patienten vorgelegt. Auf dieser Datenbasis wurden Item- und Faktorenanalysen durchgeführt und eine zweite Version mit einer reduzierten Itemzahl entwickelt. Der Beitrag zeichnet diesen Prozess nach und berichtet über erste Untersuchungen zur Validität des OPDStrukturfragebogens. S48: Psychosomatische Transplantationsmedizin Aspekte der Der Effekt des Verwandtschaftsgrades auf die psychische Befindlichkeit des Spenders im Rahmen der Leberlebendspende (LDLT) 1 1 2 Erim Y. , Beckmann M. B. , Kroencke S. , Senf 1 2 W. , Schulz K. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Essen, Virschowstr. 174, 45147 Essen 2 Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52 - S35, 20246 Hamburg Die Bedeutung der Spender-EmpfängerBeziehung in der Leberlebendspende wurde beschrieben (Walter et al. 2003, Greif-Higer et al. 2005), der Einfluss der Verwandtschaftsbeziehung auf die psychische Belastung und Lebensqualität der Spender jedoch bislang nicht untersucht. Insgesamt 168 Spendekandidaten wurden vor einer LDLT hinsichtlich Angst und Depressivität (HADSD) sowie psychischer und körperlicher Lebensqualität (SF-36) untersucht. Folgende Kategorien wurden gebildet: Eltern für Kinder (Gruppe 1), Kind für Eltern (Gruppe 2), Geschwister (Gruppe 3), Ehepartner (Gruppe 4), andere Verwandte (Gruppe 5) und nicht verwandte Spender (Gruppe 6). Eine Reihe univariater Varianzanalysen (ANOVA) ergab signifikante Gruppenunterschiede hinsichtlich Angst (F=2,8; p=.02), Depressivität (F=2,6; p=.03) sowie psychischer Lebensqualität (F=3,1; p=.01). Erwachsene Kinder, die für ihre Eltern spendeten (G2) wiesen eine hohe und im Gruppenvergleich die höchste psychische Belastung auf. Eltern, die für ihre Kinder spendeten (G 1) zeigten sogar im 81 Vergleich zur gesunden Stichprobe niedrigere Angst und Depressivität. Bei den weiteren Verwandten (G5) und Nichtverwandten (G6) ließ sich keine psychische Belastung feststellen. Ein Grund für die hohen psychischen Belastungen der Gruppe 2 könnte die ambivalente Entscheidungsfindung aufgrund divergierender sozialer Erwartungen sein. Die geringe Belastung der Gruppe 1 könnte der spontanen und ambivalenzfreien Entscheidungsfindung zu verdanken sein. Psychische Langzeitfolgen nach High urgency - Lebertransplantation wegen akutem Leberversagen 1 2 1 Greif-Higer G. , Otto G. , Beutel M. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz 2 Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) nach Stammzelltransplantation – Häufigkeit und auslösende Faktoren 1 2 3 4 Köllner V. , Berger M. , Einsle F. , Ehninger G. , 2 Joraschky P. 1 Fachklinik für Psychosomatische Medizin, Mediclin Bliestal Kliniken und Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes, Am Spitzenberg, 66440 Blieskastel 2 Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 3 Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden, Chemnitzer Str. 46, 01187 Dresden 4 Medizinische Klinik und Poliklinik I, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus der TU Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden Fragestellung: Zur Häufigkeit einer PTBS nach Stammzelltransplantation (SCT) gibt es in der Literatur unterschiedliche Angaben. Ziel dieser Studie war es, die Ausprägung von stressbezogenen Symptomen und die Häufigkeit einer voll ausgebildeten PTBS nach DSM-IV-Kriterien zu erfassen. Methoden: Befragt wurden 110 Patienten (63m/47w, 48,9 Jahre, Zeit nach SCT 32,4 Monate), >6 Monaten nach SCT. Verglichen wurden die Impact of Event Scale (IES- R) und die PTSS-10 mit dem SKID- Interview. Angst und Depressivität wurden mit der HADS-D erfasst. Ergebnisse: Im IES-R lagen 7,3% der Patienten (n=8), im PTSS10 30,9% (n=34) über dem Cut off für eine auf die SCT bezogenen PTBS. Im SKID wurde nur bei 2,7% (n=3) der Patienten eine PTBS diagnostiziert, 15.5% (n=7) litten an einer Anpassungsstörung. Eine voll ausgebildete PTBS-Symptomatik fand sich nur bei Patientinnen, die traumatische Ereignisse im Sinne der A-Kriterien des DSM- IV erlebt hatten. Diskussion: Hohe PTBS-Raten nach Stammzell-Transplantation, die in reinen Fragebogen-Erhebungen gefunden wurden, müssen zurückhaltend bewertet werden. Problematisch ist v. a. eine valide Erfassung des A2-Kriteriums nach DSM-IV. Die PTSS-10 erfasst mit höherer Sensitivität als die HADS die eher unspezifische Symptomatik einer Anpassungsstörung. Zu diskutieren ist, welche klinische Bedeutung die in Fragebögen erfasste Belastung bei Patienten hat, die nicht vollständig die Kriterien einer PTBS erfüllen. Abteilung für Transplantationschirurgie Universitätsmedizin Mainz, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz Bei akutem Leberversagen kann durch eine Lebertransplantation (LTX) den Schwerstkranken das Leben gerettet werden. Für die Patienten (PAT) bedeutet das meist, dass sie nach der LTX erstmals realisieren, dass ihnen inzwischen eine Spenderleber übertragen wurde und sich damit ihr Leben vollständig verändert hat. Trotz dieser enormen Belastung wirken die meisten dieser PAT im Verlauf psychisch unauffällig und zeigen eine gute Compliance. In unserer Transplantationsabteilung konnten wir 14 PAT nach High urgencyLTX im Verlauf psychodiagnostisch nachuntersuchen. Es handelte sich um 9 Frauen (mittleres Alter: 42 Jahre) und 5 Männer (mittleres Alter 50 Jahre) 2 – 9 Jahre nach LTX. 6 PAT hatten eine toxische Genese ihres Leberversagen, 3 einen akuten Schub eines M. Wilson, je 2 akute Schübe einer Hepatitis B bzw. einer Autoimmunhepatitis. Bei 1 PAT war die Ursache unklar. Mittels teilstrukturiertem klinischem Interview, HADS und der SCL 90 ließ sich zeigen, dass bei 9 PAT z.T. ausgeprägte und bereits chronifizierte depressive und Angstsymptome vorlagen. Bei 2 PAT lagen zusätzlich Symptome einer PTSD vor. Bei 2 PAT, die bei der LTX jünger als 18 Jahre alt waren, lag eine verzögerte psychosoziale Reifung mit der Folge von Compliancestörungen vor. Bis auf 2 PAT hatten alle versucht allein mit ihren Symptomen zu Recht zu kommen. Die Ergebnisse werden dargestellt und mögliche Risikofaktoren für die Entwicklung längerfristiger psychischer Symptome nach High urgency-LTX diskutiert. Erfassung von Medikamenten-Compliance bei erfolgreich Nierentransplantierten mit einer erweiterten Version des Morisky-Scores– dem Essener Compliance Score (ECS) 1 1 2 Franke G. H. , Jagla M. , Reimer J. , Haferkamp 3 3 3 L. , Türk T. , Witzke O. 1 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH), Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften, Studiengänge Rehabilitationspsychologie, Osterburger Straße 25, 39576 Stendal 2 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, UKE HH 3 Universitätsklinikum Essen, Klinik für Nephrologie, Hufelandstr. 55, 45122 Essen 82 Nierentransplantierte müssen zur Verhinderung der Abstoßungsreaktion zeitgenau über den Tag verteilt immunsuppressive Medikamente einnehmen, dazu ist die unbedingte Mitarbeit des Patienten erforderlich. Bislang mangelt es an einem praktikablen psychologisch-diagnostischen Verfahren zur Erfassung der Medikamenten-Compliance. Daher wird in der vorliegenden Studie der bekannte Morisky-Score (Morisky et al., 1986) zur Evaluation der Medikamenten-Compliance modifiziert und zum Essener Compliance Score (ECS) erweitert. Von Dezember 2007 bis Juli 2008 wurden 418 Nierentransplantierte in Bezug auf Soziodemographie und Klinik untersucht. Neben dem ECS kamen ESRD-SCL-TM, EFK, SF-8 und F-Sozu-K14 zum Einsatz. Es fanden sich 43,3% Frauen und 56,7% Männer im durchschnittlichen Alter von 52 Jahren (SD=13, 20-81 J.), von denen 19,3% eine Lebendspende erhielten. Aus den in einer Expertengruppe entwickelten 24 Fragen zur MedikamentenCompliance eigneten sich 18 zur Bildung des ECS, der die Compliance wesentlich differenzierter erfasst als der Morisky-Score. Inhaltlich stimmige korrelative Zusammenhänge mit klinischen Parametern wie Hb-Wert und Serum-Kreatinin sowie zu psychologischen Konstrukten bildet der ECS deutlich besser ab. Der ECS ermöglicht die differenzierte Erfassung der Medikamenten-Compliance. Er sollte in zukünftigen Studien zur Prüfung rehabilitationspsychologischer Interventionen zur Steigerung der Compliance eingesetzt werden. S49: DISCOS – „Disorders and Coherence of the Embodied Self“ Embodiment as crucial interface of the biological and psychosocial approaches to the human self and its disorders (English Track) DISCOS“Disorders and Coherence of the Embodied Self”: Eine Einführung in das Projekt Fuchs T. Klinik für Allgemeine Psychiatrie, Zentrum für Psychosoziale Medizin, Voßstr. 4, 69115 Heidelberg Die Debatten um das Selbst, die sich in den letzten Jahren zwischen Neurowissenschaften, Psychologie und Philosophie entwickelt haben, sind keineswegs nur von theoretischer Bedeutung. Sie haben auch Konsequenzen für den klinischen Umgang mit Störungen des Selbst von den somatoformen Störungen über die Borderline-Störung bis zur Schizophrenie. Die Tatsache, dass das Selbst immer auch ein körperliches ist, stellt ein wichtiges Bindeglied dieser verschiedenen Ansätze dar und inspirierte das europäische Marie-Curie Graduiertenkolleg “Disorders and Coherence of the Embodied Self” (DISCOS), ein interdisziplinäres Konsortium von 10 europäischen Forschungseinrichtungen. Das Projekt verfolgt die verschiedenen Facet- ten des verkörperten Selbst in theoretischer und klinischer Perspektive. Beteiligt sind philosophische, neurobiologische, entwicklungspsychologische, psychiatrische und psychosomatische Institutionen. Ein erstes Ziel des Projekts liegt darin, sich über Unterschiede im Verständnis des Selbst und zu verständigen: Ist z.B. das Selbst nur die Illusion eines Gehirns oder unhintergehbarer Ausdruck unserer Subjektivität? Weiter kommt der Erforschung des Zusammenspiels von biologischen und psychosozialen Faktoren für die Bildung eines kohärenten Selbst besondere Bedeutung zu. Schließlich besteht ein übergeordnetes Ziel darin, einen integrativen Rahmen für die häufig zersplitterten einzelwissenschaftlichen Zugänge zu entwerfen, die unsere Forschungslandschaft heute prägen. Individual and interactional autonomy in therapeutic change. De Jaegher H. Psychiatrische Universitätsklinik Heidelberg, Voßstraße 2, 69117 Heidelberg In current debates about ‘common factors’ in therapy, the cause of therapeutic change is overwhelmingly attributed to the client. Supposedly, neither therapist nor specifics of a chosen approach play a big role. The therapeutic relationship is also often given no more than a merely passive or instrumental role. The present paper, in contrast, views the therapeutic relationship as an autonomous process in which client and therapist participate. It hypothesises that client and therapist not only build their relationship, but that the relationship also creates client and therapist. This is reflected in e.g. ongoing coordination patterns between therapist and client’s movements, language use, etc. The paper examines the role of the therapeutic relationship in the process of change by conceptualising how client and therapist participate in the therapeutic relationship. E.g., client and therapist can get stuck in a form of participation despite their attempts to stop or change it. But forms of participation can also be agents of change in the therapeutic relationship. To understand this, we need to grasp the complex interplay between the autonomies of the interactors (client and therapist) and the autonomy of the interaction process. Notions of individual and interactional autonomy, sense-making and participatory sense-making inform the discussion, which aims to give responsibility back to both client and therapist, although not in well-delineated packages. The Medical Self: Therapy and Ethics Lees L. 83 Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Langerstrasse 3, 81675 München A compelling case has been made for categorising disorders such as schizophrenia or somatoform disorders as “self-disorders”, a fragmentation of subject from cohesive self-model. This fragmentation can be viewed in various ways, but in therapeutic terms causal mechanisms attain practical importance in the sense that the cause should be understood so as to provide a cure or alleviation of symptoms. In schizophrenia, the drive for a cure raises significant ethical concerns. Early intervention has reached the stage where it almost outpaces the disease: treatment can be given before the prodromal phase has ended. This raises a problem: the prodromal phase is essentially retrospectively determined. Not everyone who receives early intervention goes on to develop schizophrenia, and only those who do have experienced a prodromal phase. Thus it can be claimed that those who only have the potential to develop schizophrenia are being unnecessarily treated and that this over-medication is intrusive and unethical. There is an inherent dichotomy in the ethics of treatment: ought we to take a biomedical model and offer pharmacological intervention or suggest instead an interpersonal model? The aim of treatment is to restore autonomy. This perceived loss of autonomy is what enables involuntary treatment. This problem is further confused by normative beliefs about mental illness. The clarity generally required in law and in how self-disorder is discussed in the public domain is absent. DISCOS und die psychosomatische Konzeptbildung heute Henningsen P. Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, KLinikum rechts der Isar der TU München, langerstrasse 3, 81675 München In diesem Kurzvortrag soll zumindest umrissen werden, inwiefern die beiden wesentlichen historischen Stränge der psychosomatischen Theoriebildung, die anthropologisch-integrierte und die psychogenetisch-psychotherapeutische, mit Hilfe der im Rahmen von DISCOS zu entwickelnden Mehrebenenperspektive auf das verkörperte Selbst und seine Störungen auf heutigem Stand der Wissenschaft sinnvoll und in klinisch relevanter Weise zusammengeführt werden können. S50: Qualitätsmanagement in Praxis und Klinik (DÄVT) Qualitätssicherung in der psychotherapeutischen Praxis Sulz S. K. Centrum für Integrative Psychotherapie CIP, Nymphenburger Str. 185, 80634 München Die Frist für die Etablierung eines praxisinternen Qualitätsmanagements in jeder Kassenpraxis läuft ab. Hier werden Möglichkeiten eines psychotherapiespezifischen, schlanken und zugleich effektiven QM vorgestellt und diskutiert. Es wird gezeigt, dass das schon immer vorhandene Qualitätsbewusstsein der Psychotherapeuten auf eine befriedigende Weise in eine Form gebracht werden kann, die dem Gesetz genügt und die eigene Fachkompetenz pflegt. Qualitätssicherung im Krankenhaus - Qualitätsmanagement in einer psychosomatischen Klinik – Bericht über 5 Jahre effizientes QM Ehrig C. Medizinisch Psychosomatische Klinik Roseneck, Am Roseneck 6, 83209 Prien am Chiemsee Seit 1999 ist die Medizinisch-Psychosomatische Klinik Roseneck nach DIN EN ISO 9001 und den Grundsätzen der DEGEMED zertifiziert. Von den inzwischen 380 Betten der Klinik sind 200 Betten im Krankenhaus-plan Bayerns und damit für die Akutversorgung zugelassen. Neben der Zertifizierung nach DIN EN ISO 2001 werden auch andere Systemen zur Sicherung der Qualität entwickelt und eingesetzt. So nehmen alle psychosomatischen Kliniken der Unternehmensgruppe Schön Kliniken an einem klinikübergreifenden Benchmark-Projekt zur Qualitätssicherung in der Psychosomatik teil. Zur Philosophie gehört es, dass ein einmal erreichtes Qualitätsniveau auf einer bestimmten Ebene nicht „eingefroren“ wird, sondern vielmehr versucht wird, das Qualitäts-management laufend zu verbessern und an den steigenden Anforderungen und Bedürfnissen der Patienten aber auch der Kostenträger und Zuweiser auszurichten. Über die einzelnen Elemente des QM-Prozesses wie die Qualitätsziele, den Aufbau des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements, verwendete Instrumente des Qualitätsmanagements und die Bewertung des Qualitätsmanagements wird ausführlich berichtet. S51: Symposium I der Arbeitsgruppe Bindungsforschung: Neurobiologische und psychophysiologische Grundlagen 84 Neurobiologische Korrelate von Bindung (AAP) bei depressiven Patienten 1 2 3 Buchheim A. , Taubner S. , Kächele H. , Münte 4 3 5 3 T. , Kessler H. , Roth G. , Wiswede D. 1 Institut für Psychologie, Universität Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Österreich 2 Universität Kassel, Arnold-Bode-Str. 10, 34109 Kassel 3 Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Am Hochsträss 8, 89081 Ulm 4 Universität Magdeburg, Lehrstuhl für Neuropsychologie, Universitätsplatz, Gebäude 24, 39106 Magdeburg 5 Universität Bremen, Leobener Strasse, 28 Bremen Im Rahmen der Hanse-Neuro-PsychoanalyseStudie ist es Ziel dieses Teil-Projektes mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) Einblick in die neuronalen Mechanismen von Bindungsmustern chronisch depressiver Patienten zu Beginn einer psychoanalytischen Therapie zu gewinnen. Hypothese ist, dass 1) depressive Patienten im Vergleich zu Gesunden vermehrt eine desorganisierte Bindung aufweisen und 2) dass sich neuronal vermehrte Aktivierungen in limbischen Regionen zeigen, wenn diese mit individuellen bindungsrelevanten Themen konfrontiert sind. Es wurden in dieser Studie 19 depressive Patienten mit 20 nach soziodemographischen Variablen vergleichbaren gesunden Kontrollprobanden verglichen. Alle Probanden wurden mit dem Adult Attachment Projective Interview untersucht (AAP). Die Narrative zu 7 Bindungsbildern wurden transkribiert und ausgewertet. Darauf basierend wurden für jeden Probanden individuelle Schlüssel- Sätze gebildet, die bindungsrelevante linguistische Marker enthalten und das entsprechende Bindungsmuster (organisiert versus desorganisiert) repräsentieren. Diese individuellen Schlüsselsätze wurden kontrastiert mit neutralen, nur die Umgebung der AAP Bilder beschreibenden Sätze. Die neutralen sowie individuellen Sätze sowie die AAP Bilder wurden den Probanden im fMRT Scanner präsentiert. Die Daten wurden nach einem event-related Design analysiert. In diesem Vortrag werden erste Ergebnisse der laufenden Studie präsentiert. Bindung und Stressregulation– psychophysiologische Effekte von emotionaler Valenz und Bewertung Ehrenthal J. C., Frank S., Irgang M., Zöckler M., Schauenburg H. Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg In der psychosomatischen wie auch sozialpsychologischen Bindungsforschung werden zunehmend Paradigmata zur Untersuchung physiologischer Prozesse im Kontext von interpersoneller Stressregulation entwickelt. Allerdings leidet die Aussagekraft der bisherigen Studien oft darunter, dass unklar bleibt, wodurch genau die beobachteten Einflüsse von Bindung auf die Stressreaktion zustande kommen. Speziell für die klinische Bindungsforschung relevant sind die Auswirkungen emotional besonders bedeutsamer Bindungserfahrungen und Effekte von lang anhaltenden Grübelprozessen über bindungsrelevante Themen auf die Stressphysiologie. In zwei Studien mit gesunden Probanden werden die emotionale Valenz eines bindungsspezifischen Kurzzeitstressors („separation recall“) und anschließende Bewertungs- und Grübelprozesse experimentell manipuliert. Physiologische Daten werden nicht-invasiv per EKG und Impedanzkardiographie erhoben. In einer dritten Stichprobe wird der Einfluss von Bindung auf die Stressphysiologie von Patienten in stationärer Psychotherapie erhoben. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund eines Mehrebenenmodells der bindungsbezogenen Stressregulation diskutiert. Einfluss von Oxytocin auf erhöhte Wahrnehmung von Bindungssicherheit 1 2 3 4 Gündel H. , Heinrichs M. , Pokorny D. , Koops E. , 4 5 Henningsen P. , Buchheim A. 1 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Str. 1,, 30625 Hannover 2 Psychologisches Institut Klinische Psychologie und Psychobiologie, Universität Zuerich, Binzmuehlestrasse 14 / Box 8, 8050 Zuerich, Schweiz 3 Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Am Hochsträß 8, 89081 Ulm 4 Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Langerstrasse 3, 81675 München 5 Institut für Psychologie, Universität Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Österreich Oxytocin ist ein bei verschiedenen Säugetieren bindungsfördernd wirkendes Neuropeptid und scheint nach einer ersten Studie auch in zwischenmenschlichen Beziehungen zu einer Erhöhung des Vertrauens im Gegenüber zu führen [1]. In der Pilotstudie sollte getestet werden, ob Oxytocinvergabe bei der Einschätzung der Qualität von zwischenmenschlichen Beziehungen zu einer verstärkten subjektiven Bindungsbereitschaft führt. Es wurden 26 Humanmedizin-Studierende einer doppelblinden, randomisierten Pilotstudie in einem ABBA-Design mit zwei Messzeitpunkten unterzogen: 50 Minuten vor Beginn des Verhaltensexperimentes erhielten sie entweder eine einzige intranasale Dosis (24 IU Oxytocin; Syntocinon-Spray; Novartis; 3 Hübe per Nasenöffnung, jeder à 4 IU Oxytocin) oder eine intranasale Dosis eines Placebo Präparates per Nasenspray. Die subjektive Bindungsbereitschaft wurde mittels einer für das experimentelle Design angepassten Methode (Fragebogen) in Anlehnung an ein valides etabliertes Bindungsin- 85 strument (Adult Attachment Projective, AAP) [2] gemessen. Erwartungsgemäss nahm unter Oxytocin die Bereitschaft signifikant zu, Aussagen zu präferieren, die Bindungssicherheit repräsentierten. Dagegen nahm die Bereitschaft ab, sich mit unsicher-verstrickten Aussagen zu identifizieren. Oxytocin scheint also gesunde Personen mit unsicherem Bindungsmuster vorübergehend in einen Zustand zu versetzen, der die Bereitschaft für Bindungssicherheit deutlich erhöht. Zusammenhänge zwischen Bindungsmerkmalen, Depressivität und der Kognitiven Triade nach A. T. Beck bei Patienten in stationärer Gruppenpsychotherapie Kirchmann H., Strauß B. Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena, Stoystr. 3, 07740 Jena Bereits Bowlby postulierte konzeptuelle Überschneidungen zwischen Bindungsmustern und kognitionspsychologischen Konstrukten zur Erklärung depressiver Störungen wie etwa Seligmans Ansatz der erlernten Hilflosigkeit/Hoffnungslosigkeit oder Becks Entwurf der Kognitiven Triade. Im Gegensatz zu diesen Konstrukten liegt der Fokus der Bindungstheorie allerdings auf nahen Beziehungen. Die vorliegende Studie bezieht Daten von 267 stationär gruppenpsychotherapeutisch behandelten Patienten ein. Einerseits wurden korrelative Zusammenhänge zwischen Bindungsmerkmalen und einer fragebogenbasierten Operationalisierung der Kognitiven Triade analysiert; weiterhin wurde untersucht, inwieweit die bekanntermaßen hohen Korrelationen zwischen Merkmalen der Bindungsunsicherheit und depressiven Beschwerden durch die Konstrukte der Kognitiven Triade (als Mediatoren) aufgeklärt werden können. Die Mediatormodelle belegen, dass beide Dimensionen der Bindungsunsicherheit (Ambivalenz und Vermeidung) unabhängig voneinander mit den Konstrukten der Kognitiven Triade assoziiert sind und darüber hinaus keine Zusammenhänge zwischen Bindungsmerkmalen und depressiven Beschwerden bestehen. Diese Ergebnislage ist mit einem ätiologischen Modell vereinbar, wonach ein unsicheres Bindungsmuster ausschließlich vermittelt über die Kognitiven Triade und somit lediglich indirekt ein Risikofaktor für die Entwicklung depressiver Störungen darstellt. Begutachtung / Rehabilitation Sozialmedizinische Begutachtung psychosomatischer Störungen: Qualitätssicherung durch interdisziplinäre psychodynamische, testpsychologische und ergotherapeutische Diagnostik Purucker M., Keller P., Rätzel-Kürzdörfer W., Wolfersdorf M. Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Bezirkskrankenhaus Bayreuth, Nordring 2, 95445 Bayreuth Die sozialmedizinische Begutachtung hat bei psychosomatischen Störungen zu berücksichtigen, daß 1.) die Klassifikation nach ICD-10 allein wenig reliabel ist, da das Symptomerleben von intrapsychischen bzw. interpersonellen Faktoren und die Diagnostik von ÜbertragungsGegenübertragungsinteraktionen beeinflusst wird, und 2.) die individuelle Krankheitsbewältigung im Kontext psychodynamischer Prozesse steht. Zur Umsetzung der Begutachtungsleitlinien haben wir ein Modell mit 1.) hermeneutischpsychopathologischer Symptomanalyse im Querund Längsschnitt mittels halbstrukturierter Interviews, 2.) Diagnostik des Störungsbildes unter Berücksichtigung von Komorbidität und Schichtenregel, 3.) psychodynamischer Diagnostik durch biographische Anamnese und Erfassung von Struktur- und Konfliktpsychologie, 4.) testpsychologischer Diagnostik von Persönlichkeitsmerkmalen und mnestisch-kognitiven bzw. exekutiven Funktionen und 5.) ergotherapeutischer Leistungsdiagnostik entwickelt. Anhand komplexer Fälle wird gezeigt, daß die integrierende Analyse von Interaktionen und Verhalten in unterschiedlichen Belastungssituationen die Validität der psychodynamischen Befunderhebung und sozialmedizinischen Beurteilung verbessert. Die mehrdimensionale Diagnostik von psychopathologischen, psychodynamischen und motivationalen Faktoren ermöglicht eine leitliniengerechte Diskussion von Krankheitsbewältigung (Aggravation, Verdeutlichungstendenz bzw. Regression) sowie von Behandlungsoptionen und Leistungsbild. Bindung und stationäre psychosomatische Rehabilitation 1 1 2 Damke B. J. , Koechel R. , Krause W. H. , Loh2 mann K. 1 Posterpräsentationen Fachklinik für Psychosomatische Medizin Eifelklinik der Deutschen Rentenversicherung Rheinland, Mosenbergstr. 19, 54531 Manderscheid 2 Privat In der vorliegenden Studie wurden 302 psychosomatische Patienten der Eifelklinik Manderscheid zu 86 drei Messzeitpunkten (Rehabilitationsbeginn, Rehabilitationsende, Einjahreskatamnese) nach ihren psychischen (BSI, Franke 1999) und körperlichen Symptomen und Beschwerden (B-L, v. Zerssen 1978) befragt. Der Bindungsstil wurde mittels BFKE (Höger 2000) ermittelt. Bei 29 Patienten wurde ein Adult Attachment Interview (FremmerBombik, 1992) durchgeführt. In der Katamnese wurde nach den Arbeitsunfähigkeitszeiten, der Anzahl der Arztbesuche in den vergangenen 12 Monaten und nach der subjektiven Leistungsfähigkeit auf einer Skala (0 bis 10) gefragt. Der hohe Anteil an vermeidend verschlossener Patienten (48%) weist auf die Vulnerabilität psychisch zu erkranken hin. Vermeidend Verschlossene nutzen psychosoziale Ressourcen in Krisenzeiten kaum. Ambivalente Patienten geben stärkere subjektive Beschwerden an als andere Bindungsstilgruppen. Zudem befinden sich in der Gruppe sozialmedizinisch hochproblematischer Patienten überzufällig mehr ambivalente Patienten. In der Katamnese gab die Gruppe der ambivalent verschlossenen Patienten geringere Leistungsfähigkeit an als die Gruppe der bedingt Sicheren. Die ambivalent Verschlossenen hatten signifikant längere Arbeitsunfähigkeitszeiten als die vermeidend verschlossenen Patienten. Ein ambivalenter Bindungsstil scheint ein Vulnerabilitätsfaktor für die Chronifizierung von Krankheiten darzustellen. Wirksamkeit des Rehaaufenhaltes auf das somatische und psychische Befinden der Patienten, eine Studie mittels SCL- 90-R Majd Z. Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin,Hohenfeld-Kliniken,Bad Camberg, Hohenfeldstraße 12-14, 65520 Bad Camberg Die Auswirkung von verschiedenen somatischen und psychotherapeutischen Maßnahmen während eines Rehaaufenthaltes auf die subjektiv empfundene körperliche und psychische Symptome werden in der Literatur Unterschiedlich diskutiert. In dieser Studie sollte den Patienten die mögliche Wirksamkeit eines Rehaaufenthaltes in einer Psychosomatischen Abteilung innerhalb eines Zeitraumes von vier bis acht Wochen durch SCL-90-R befragt werden. Zu zwei verschiedenen Messzeitpunkten (Therapiebeginn und Therapieende) werden mittels gut eingeführter SCL-90-R Fragebögen Symptome und Befindlichkeit der Patienten erhoben. Diese studie beinhält die Datei über 356 Patienten ,die in der Psychosomatischen Abteilung des Klinikzentrums Lindenallee in Bad Schwalbach Stationär aufgenommen waren. Eine Differenzierung der Patienten nach ihrem Geschlecht , Alter sowie nach ihrer Hauptentlassungsdiagnose betrachtet die theoretisch mögliche Faktoren, die auf Befindlichkeit der Patienten einwirken könnten. Insgesamt zeigt diese Studie, dass zum Behandlungsende werden fast in allen Skalen der SCL-90- R eine Positive Wirksamkeit der Rehamaßnahme erzielt. Diese Studie und die entsprechende Ergebnisse werden bewertet als eine Unterstützung für den Anspruch von an verschiedenen psychosomatischen Symptome leidenden Patienten auf Rehamaßnahmen . Qualitätsanalyse forensisch-psychiatrischer Zurechnungsfähigkeits- und Prognosegutachten über Sexualstraftäter 1 2 3 3 Kunzl F. K. , Eher R. , Lamott F. , Mörtl K. , Modi3 3 3 ca C. , Rosenow T. , Pfäfflin F. 1 Universitätsklinik Ulm, Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Am Hochsträß 8, 89081 Ulm 2 Begutachtungs- und Evaluationsstelle für Gewalt- und Sexualstraftäter im Österreichischen Strafvollzug, Gerichtsgasse 6, 1210 Wien, Austria 3 Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Sektion Forensische Psychotherapie, Am Hochsträß 8, 89081 Ulm Forensisch-psychiatrische Gutachten dienen der Feststellung der Zurechnungsfähigkeit eines Straftäters zum Tatzeitpunkt sowie der in Zukunft von ihm zu befürchtenden Gefährlichkeit im Hinblick auf erneute Delinquenz. Sie stellen für das Gericht eine wichtige Entscheidungshilfe bezüglich der Verhängung von Freiheitsstrafen und/oder der Anordnung von Maßnahmen bzw. Maßregeln dar. Empirische Befunde, welche gravierende Mängel strafrechtlicher Gutachten belegen konnten (z.B. Pfäfflin, 1978; Möller et al., 1999), sowie die Formulierung von „Mindestanforderungen für Schuldfähigkeitsgutachten“ (Boetticher et al., 2007) unterstreichen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Qualitätssicherung. Im Rahmen dieser Untersuchung wird die Qualität österreichischer Zurechnungsfähigkeits- und Prognosegutachten anhand eines entwickelten Kriterienkatalogs evaluiert. Dieser umfasst zum einen deskriptive Kriterien (z.B. Länge), zum anderen qualitative Ratingskalen, welche sich auf die Wissenschaftlichkeit der Argumentation, die sprachliche Ausdrucksweise, die Neutralität sowie die strafrechtlich wertende Haltung des Gutachters beziehen. Zusätzlich erhält jedes Gutachten eine Gesamtnote. Insgesamt wurden bisher 93 Gutachten aus dem Zeitraum zwischen 1981 und 2007 beurteilt. 46.5 % der Gutachten erhielten die Noten 5 oder 6, während lediglich 20.5 % mit 1 oder 2 bewertet wurden. Insgesamt bestätigen die Ergebnisse die Unentbehrlichkeit einer Verbesserung der Qualität forensischer Gutachten. Neue Medien 87 Die Nutzung von Medien in der stationären Psychotherapie und Psychiatrie: Ergebnisse einer Befragungsstudie an Therapeuten und Patienten Eichenberg C. Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie der Universiät zu Köln, Höninger Weg 115, 50969 Köln Eine Reihe von Medien hat sich in verschiedensten Bereichen der klinisch-psychologischen Intervention als nützlich erwiesen. Das Spektrum reicht vom Einsatz traditionellerer Medien wie Bücher oder Videos zur Psychoedukation bis hin zu moderneren Medientypen wie dem Internet oder Virtual-Realities innerhalb von Psychotherapien. Bislang wurde noch nicht systematisch geprüft, welche mediengestützten Anwendungen speziell innerhalb der stationären Psychotherapie u. Psychiatrie fruchtbar eingesetzt werden können. Daher wird zum einen ein Review über die Anwendungsmöglichkeiten und Effektivität verschiedener Medientypen im Rahmen der stationären therapeutischen Arbeit gegeben. Zum anderen werden die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung an allen psychosomatischen u. psychiatrischen Kliniken in NRW vorgestellt. Die Studie dokumentiert u. analysiert die aktuelle Verbreitung von Medien sowie die Bewertung medienunterstützter Interventionen auf Therapeuten- (N= 40) wie Patientenseite (N= 289). Die Studie identifizierte große Ausstattungs- und Nutzungsunterschiede zwischen den verschiedenen Medien, Anwendungsfeldern u. Kliniken. Die Bewertung des Medieneinsatzes durch die Therapeuten erwies sich als sehr heterogen, während die Pat. den Einsatz vorwiegend positiv beurteilten. Als wichtiger Einflussfaktor für die Bewertung erwies sich die Medienerfahrung der Befragten. Abschließend wird ein Ausblick auf den Forschungsbereich der klinischen Telepsychiatrie gegeben. Hilfe aus dem Netz bei Essstörungen. Ein Beitrag der Sprachwissenschaft zur Klärung der Wirksamkeit virtueller Selbsthilfeangebote Reimann S. E. Institut für Germanistik, Lehrstuhl Deutsche Sprachwissenschaft, Universitätsstr. 31, 93053 Regensburg Psychotherapeutische Hilfsangebote in den sog. neuen Medien nehmen eine wachsende Bedeutung ein.Die Frage nach der Wirksamkeit ist jedoch nicht ausreichend geklärt. Punktuelle medizinischpsychologische Untersuchungen sind vorhanden, können jedoch nicht beantworten, welche Rolle das Sprachverhalten einnimmt. Im Mittelpunkt des sprachwissenschaftlichen Vortrags steht die exemplarische Analyse des Sprachgebrauchs von Menschen mit Essstörungen im Internetforum „www.hungrig-online.de“. Von Interesse ist v.a., ob sich die Verwendung von Sprache der beispielhaft analysierten Beiträge einzelner Userinnen im Hin- blick auf bestimmte Themen im Laufe der Zeit, also der geschriebensprachlichen Präsenz bei diesem virtuellen Selbsthilfeangebot, verändert. Es stellt sich aus medizinisch-psychosomatischer Sicht die Frage, ob ein Wandel in den Äußerungen der von der Krankheit Betroffenen Hinweise auf eine Entwicklung im Umgang mit der Essstörung geben könnte und ein Zusammenhang mit der Kommunikation bei hungrig-online besteht. Der Diskurs in virtuellen Selbsthilfeangeboten ist gänzlich unerforscht. Für die Psychosomatik verspricht die Untersuchung, die schließlich allgemein in den Rahmen der Therapie von Essstörungen zu stellen ist, Aufschlüsse über die Wirksamkeit von Behandlungsmethoden im Internet zu geben. Der interdisziplinäre Kontakt der Sprachwissenschaft und der Psychosomatik könnte Chance für die Erforschung solcher nicht nur auf ein Fach bezogener Fragestellungen sein. Die Akzeptanz einer internetgestützten Nachsorge nach stationärer psychosomatischer Rehabilitation 1 2 1 Golkaramnay V. , Cicholas B. , Vogler J. 1 Klinik Alpenblick, Fachklinik für Psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik, Kurweg 9, 88316 IsnyNeutrauchburg 2 Reha-Zentrum Bad Frankenhausen, Udersleber Weg 35, 06567 Bad Frankenhausen Hintergrund: Nachsorge, als ein wichtiges Versorgungselement, spielt in der stationären psychosomatischen Rehabilitation eine bedeutende Rolle. Seit einigen Jahren werden die Möglichkeiten neuer Medien genutzt, die psychosoziale Versorgung in diesem Bereich zu optimieren. Die Integration neuer Angebote in der Versorgungslandschaft hängt jedoch zum größten Teil auch von ihrer Akzeptanz ab. Im Rahmen des von dem DRV-Bund geförderten Forschungsprojektes „ Wirksamkeit einer internetgestützten Nachsorge nach stationärer psychosomatischer Rehabilitation“ wird ebenso die Akzeptanz dieses Angebotes untersucht. Methode: An der randomisierten Längsschnittstudie nehmen 450 Rehabilitanden aus 2 psychosomatischen Kliniken teil. Die Hälfte der Stichprobe erhält die internetgestützte Nachsorge. Die therapeutisch begleiteten Chatgruppen finden einmal pro Woche und insgesamt für die Dauer von 15 Wochen statt. Die Daten zur psychischen und körperlichen Verfassung der Probanden, sowie ihre berufsbezogenen und rehabilitationsrelevanten Daten werden u.a. durch Messinstrumente wie BSI, BDI, GBB-24 und AVEM erfasst. Gemessen wird an 5 Messzeitpunkten: bei Aufnahme und Entlassung aus der Klinik, sowie 4, 8 und 12 Monate nach der Entlassung aus der Klinik. Ergebnisse: Die vorläufigen Ergebnisse zeigen die hohe Akzeptanz des Angebotes. Die Endergebnisse der Studie werden Ende 2009 erwartet. Diskutiert werden die Chancen und 88 Grenzen der Online-Gruppen u.a. für die Psychotherapieforschung. Neurobiologie Eine open-source-Softwareplattform unter LabVIEW für die physiologische Forschung in der Psychosomatik Noll-Hussong M., Sack M., Lahmann C., Henningsen P. Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Langerstrasse 3, 81675 München Neurobiologische Korrelate von mentalen Repräsentationen dysfunktionaler Beziehungen (OPD) bei depressiven Patienten 1 2 3 Kessler H. , Stasch M. , Cierpka M. , Buchheim 4 5 1 6 7 A. , Taubner S. , Kächele H. , Roth G. , Münte T. , 8 Wiswede D. 1 Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Am Hochsträss 8, 89081 Ulm 2 Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie, Bergheimer Str. 54, 69115 Heidelberg 3 Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie, Psychosoziales Zentrum, Universitätsklinikum Heidelberg 4 Institut für Psychologie, Universität Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Österreich 5 Universität Kassel, Arnold-Bode-Str. 10, 34109 Kassel 6 Universität Bremen, Leobener Strasse, 28 Bremen 7 Universität Magdeburg, Lehrstuhl für Neuropsychologie, Universitätsplatz, Gebäude 24, 39106 Magdeburg 8 Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Am Hochsträß 8, 89081 Ulm Im Rahmen der Hanse-Neuro-PsychoanalyseStudie ist es Ziel dieses Projektes mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) Einblick in die neuronalen Mechanismen dysfunktionaler Beziehungsmuster chronisch depressiver Patienten zu Beginn einer psychoanalytischen Therapie zu gewinnen. Es wird vermutet, dass depressive Patienten im Vergleich zu einer Kontrollgruppe bei der mentalen Beschäftigung mit ihren dysfunktionalen Beziehungsmustern eine erhöhte Aktivität in limbischen Regionen, als Ausdruck größerer emotionaler Verwicklung, haben. Weiterhin sollten präfrontale Regionen, die zur Emotionsregulation wichtig sind, relativ weniger aktiv sein. Insgesamt wurden in dieser Studie 17 depressive Patienten mit 17 nach soziodemographischen Variablen vergleichbaren gesunden Kontrollprobanden verglichen. Alle Probanden wurden mittels eines OPD Interviews untersucht (Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik). Darauf basierend wurden für jeden Probanden individuelle Sätze gebildet, die das zentrale dysfunktionale Beziehungsmuster umschreiben. Zusammen mit neutralen und unspezifisch emotionalen Sätzen wurden diese OPD-Sätze im fMRT Scanner präsentiert (Blockdesign). In diesem Vortrag werden erste Ergebnisse der laufenden Studie präsentiert In der „scientific community“ sind die Vorteile des open-source Software-Konzepts hinsichtlich jederzeitiger Validier- und flexiblen Skalierbarkeit des Programmcodes anerkannt und geschätzt. Die grafische Programmierplattform LabVIEW von National Instruments (http://www.ni.com/labview) bietet Anwendern, weitgehend unabhängig von deren Erfahrung, eine zügige und gerade für Forschungseinrichtungen kosteneffiziente Möglichkeit, um Mess-, Steuer- und Regelhardware anzubinden, Daten zu analysieren, gewonnene Ergebnisse gemeinsam zu nutzen sowie verteilte Anwendungen zu realisieren. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung physiologischer Daten in der psychosomatischen (Grundlagen)Forschung schlagen wir eine quellcodeoffene Softwareapplikation vor, welche als Plattform für verschiedene PlugIns dient, die unentgeltlich und gegenseitig kontrollierbar über das Internet zur Verfügung gestellt werden und im Laufe der Zeit einen wachsenden Bestand an verschiedenen, direkt einsetzbaren wie an die jeweiligen Bedarf adaptierbare Werkzeuge darstellen. Das Grundprogramm wird hier ebenso vorgestellt wie ein hierunter laufendes Modul zur Auswertung verschiedenster üblicher Parameter der Herzratenvariabilität (HRV) als Beispiel der potentiellen Mächtigkeit wie Ausbaufähigkeit eines solchen als kostenlose freeware angelegten Programmkonzepts. Die gesamte Software kann unter Beachtung der GNULizenzbedingungen über das Internet heruntergeladen werden unter http://www.psychosomatik.me. Ereigniskorrelierte Potentiale bei Dysthymie Georgiewa P., Filipowa A., Pommer M., Rothemund Y., Klapp B. F., Danzer G. Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Charité Universitätsmedizin Berlin, Charité-Campus Mitte, Luisenstr. 13a, 10117 Berlin Ziel dieser Studie war die Untersuchung von EEGKorrelaten veränderter affektiver Verarbeitung bei Patienten mit dysthymer depressiver Verstimmung, Patienten mit somatoformer Schmerzstörung und gesunden Kontrollpersonen. Methoden: 14 Patientinnen mit einer Dysthymie (ICD 10, definiert über zwei unabhängige klinische Diagnostiker und Fragebögen), 15 Patienten mit somatoformer Störung und 11 Kontrollpersonen wurden untersucht. Als Auslöser für die Ereigniskorrelierten EEGPotentiale wurden 5 auditorische Stimuli unterschiedlichen emotionalen Gehalts genutzt (unan- 89 genehm erlebter Ton, neutraler Ton, melodisches Glockenspiel, neutrale Wörter und Wörter mit affektiver Bedeutsamkeit). Resultate: Sowohl die Ausprägung der P300 als besonders die späte PWS Komponente unterscheiden sich in Abhängigkeit von der affektiven Bedeutsamkeit der akustischen Stimuli. Die drei Untersuchungsgruppen unterscheiden sich hinsichtlich der Ausprägung der P300 und der PSW-Komponente nur tendenziell. Wohl aber ergeben sich Unterschiede im Hinblick auf die eingeschätzte Affektivität der Stimuli. Zusammenfassung: Die Resultate sprechen für veränderte Verarbeitung affekthaltiger Stimuli auch bei milderen Formen der Depression bzw. eher somatisierten Anteilen. Dabei scheinen die Amplituden der evozierten Potentiale aber deutlich mehr mit der Reizbewertung zu korrelieren als mit testdiagnostisch gesicherter erhöhter Depressivität. Neuronale Korrelate einer veränderten Empathiefähigkeit bei Patienten mit multisomatoformen Schmerzstörungen 1 2 2 Noll-Hussong M. , Otti A. , Läer L. , Wohlschläger 2 2 3 1 A. , Zimmer C. , Decety J. , Lahmann C. , Hen1 4 ningsen P. , Gündel H. 1 Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Langerstrasse 3, 81675 München 2 Abteilung für Neuroradiologie des Klinikums rechts der Isar der TU München, Ismaninger Str. 22, 81675 München 3 The University of Chicago - Department of Psychology, 5848 South University Ave Chicago, IL 60637, USA 4 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Str. 1,, 30625 Hannover Chronische Schmerzzustände ohne adäquates organisches Korrelat können gemäß den Kriterien des ICD-10 als anhaltende somatoforme Schmerzstörung charakterisiert werden. Wiewohl hier Untersuchungen auf eine Pertubation der emotionalen Regulation im Sinne einer verminderten "reflective emotional awareness" hinweisen, sind die zugrunde liegenden neuronalen Vorgänge noch weitgehend unklar. In dieser laufenden fMRT-Studie wurden somatoformen Schmerzpatienten wie gesunden Kontrollen (jeweils n=17) Bilder menschlicher Extremitäten in unterschiedlich schmerzhaften Situationen gezeigt, wobei per Instruktion die Selbstperspektive einzunehmen war. Die funktionellen Bilder wurden mit einem 3-T-MRT akquiriert und mittels SPM5 analysiert (treshold: p[uncorr.]<0.001). Nach dem Scan legten die Probanden auf einer Skala ihre Einschätzung der Schmerzstärke fest. In der Kontrollgruppe konnten wir die Ergebnisse früherer Studien hinsichtlich der Aktivierungen der Pain-Matrix (Insel, somatosensorischer Kortex, mittlerer ACC) reproduzieren. Im Vergleich mit Patienten schreiben die Kontrollen im Post-Scan-Interview den Schmerzbildern eine hö- here Schmerzintensität zu. Als neuronales Korrelat zeigt sich in der Kontrollgruppe bei Exposition gegenüber Schmerzbildern eine signifikant höhere (p[corr.]<0.05, Cluster-Level) Aktivierung im vorderen ACC. Diese Ergebnisse deuten auf eine vergleichsweise geringere empathische Schmerzwahrnehmung bei unseren Patienten hin, welche weiterer Untersuchungen bedarf. Kurzfristige autonome Effekte von Espressokonsum Zimmermann-Viehoff F., Herrmann C., Weber C., Deter H. Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie, Charité Unversitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin Einleitung: Ziel der Studie war die Untersuchung kurzfristiger Effekte von Espressokonsum auf die Herzfrequenzvariabilität (HRV). Methoden: 36 gesunde Gewohnheitskonsumenten (GWK) und 39 Gelegenheitskonsumenten (GLK) wurden in die Studie eingeschlossen. Alle Probanden nahmen an 3 Untersuchungen teil. Hierbei wurde in randomisierter Reihenfolge koffeinhaltiger Espresso, entkoffeinierter Espresso oder Wasser verabreicht. HRV wurde anhand des Polar©-Systems über je 20 min vor und 20 min nach dem Konsum aufgezeichnet. Ergebnisse: Es fanden sich keine Unterschiede hinsichtlich Baseline-HRV (Highfrequency-Komponente) zwischen GWK und GLK. Bei den GWK nahm die High-frequencyKomponente der HRV nach Espressokonsum im Vergleich zu Wasser und entkoffeiniertem Espresso signifikant stärker zu (p = 0,02 und p = 0,003). Bei den GLK unterschieden sich Änderungen der HRV nicht zwischen den einzelnen Bedingungen. Diskussion: Die beobachtete Zunahme kurzfristiger vagaler Einflüsse auf das Herz bei den GWK könnte einen primär physiologischen (baroreflexvermittelten) Effekt, eine Wirkung durch Aufhebung von Entzugssymptomen oder einen durch Konditionierung bzw. Erwartungshaltung vermittelten unspezifischen Effekt darstellen. Als Erklärung für die fehlende Zunahme der HRV bei den GLK könnten fehlende Habituation oder eine unterschiedliche Erwartungshaltung herangezogen werden. Diese Fragen sind derzeit Gegenstand weiterer Analysen. Funktionale neuronale Veränderungen bei Patienten mit einer somatoformen Störung nach stationärer psychodynamisch-orientierter Psychotherapie 1 2 1 de Greck M. , Bölter A. F. , Scheidt L. , Frommer 2 1 J. , Northoff G. 1 Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, Universitätsklinikum Magdeburg, Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg 90 2 Abt. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Magdeburg, Leipziger Straße 44, 39120 Magdeburg Die neuronalen Veränderungen bei Psychotherapie können seit kurzem mit der funktionellen Bildgebung untersucht werden. Dabei standen bisher vor allem verhaltenstherapeutische und interpersonelle Verfahren im Vordergrund. Das Ziel unserer Studie war daher die Untersuchung von neuronalen Effekten einer stationären, psychodynamisch-orientierten und standarsierten Psychotherapie im fMRT während einer Aufgabe zur Empathie. Neben einer gesunden Kontrollgruppe wurden N = 20 Patienten aus einer psychosomatischen Klinik mit psychodynamisch-orienterter Psychotherapie untersucht, die nach dem SKID mit einer somatoformen Störung diagnostiziert wurden. Mit unterschiedlichen Selbst- und Fremdbeurteilungsinstrumenten wurden Effektivitätsmessungen zu t 0 (Aufnahme), t1 (4 Wochen nach Aufnahme) und t2 (12 Wochen nach Aufnahme, Entlassungszeitpunkt) vorgenommen. Zu den Zeitpunkten t0 und t2 wurden fMRT Messungen mit einem bereits etablierten Paradigma zur Empathie durchgeführt. Die Empathie wurde durch Wahrnehmung von Bildern der Ekman Face Serie gemessen. Die Analyse bezieht sich vor allem auf den Vergleich zwischen t0 versus t2. Die Korrelationen mit den entsprechenden Parametern der Therapieeffekte werden berechnet und vorgestellt. Persönlichkeitsstörungen Wie hilfreich erleben Patienten mit einer Borderline-Störung einzelne Therapiemodule einer tagesklinischen Behandlung? 1 2 2 2 Mrose J. , Jenjahn E. , Keller A. , Joraschky P. 1 Universitätsklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 2 Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Am Hochsträß 8, 89081 Ulm Fragestellung: Eine teilstationäre Behandlung umfasst eine Reihe von Maßnahmen (z.B. Einzel-, Spezial-, Gruppentherapien), die gemeinsam darauf abzielen, dass der Patient einen optimalen Behandlungserfolg erreicht. Uns interessiert, welche Module speziell von unseren PatientInnen mit einer Borderlinestörung als hilfreich erlebt werden und welche nicht, um das Therapieangebot zu verbessern und ggf. den Therapieerfolg zu erhöhen. Methodik: Bisher liegen Daten von 28 PatientInnen vor, die deskriptiv ausgewertet werden. Die Evaluierung erfolgt mit Hilfe eines klinikinternen Fragebogens, in dem über subjektive Patientenangaben die Therapiebausteine mit Hilfe einer 4stufigen Skala (sehr, etwas, wenig und überhaupt nicht hilfreich) bewertet werden. Ergebnisse: Erste Ergebnisse zeigen, dass Therapiemodule wie das Einzelgespräch (96,4%), das Fertigkeitentraining nach Linehan (85,2%) sowie das therapeutische Behandlungsprogramm insgesamt (84,7%) von einem Großteil der PatientInnen als sehr bzw. etwas hilfreich eingeschätzt werden. Schlussfolgerungen: Das therapeutische Gesamtprogramm scheint gut akzeptiert. Ein struktureller und zeitlicher Ausbau von Therapiemodulen, die als hilfreich erlebt werden (z.B. Fertigkeitentraining) wird angestrebt. Prävention / Arbeitswelt Psychische Gesundheit bei 2900 Lehrkräften im Studium, im Referendariat und in der Unterrichtstätigkeit Unterbrink T., Zimmermann L., Pfeifer R., Wirsching M., Bauer J. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg, Hauptstr. 8, 79104 Freiburg Verschiedene Studien der letzten Jahre sowie Untersuchungen unserer eigenen Arbeitsgruppe zeigen eine hohe Gesundheitsbelastung bei Lehrern/innen. Um typische Belastungsspitzen im Verlauf des Studiums und der Arbeitstätigkeit von Lehrkräften identifizieren zu können, haben wir als Instrument zur Messung der psychischen Gesundheit den GHQ 12 bei ca. 670 Studenten/innen, ca. 1060 Referendaren/innen und ca. 1150 Lehrern/innen eingesetzt. Wesentliche Ergebnisse sind: Die Studenten, die z.T. in Prüfungszeiten befragt wurden, zeigten im Vergleich zu einer Normstichprobe (n=13814) zwar erhöhte, aber nicht bedenklich erscheinende Symptome psychischer Belastung. Von Referendaren wurden hingegen bei unterschiedlichen Erhebungen jeweils in sehr hohem Ausmaß psychische Beschwerden angegeben. Regelmäßig lagen über 40 % der befragten Referendare/innen mit ihren Werten über dem CutOff von 4. Bei Überschreiten dieses Grenzwertes ist von einer ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigung auszugehen. Lehrkräfte liegen in allen 4 Dekaden ihrer Arbeitstätigkeit mit ca. 30% über dem Grenzwert und zeigen damit deutlich häufiger als der Durchschnitt der Allgemeinbevölkerung erhebliche gesundheitliche Belastungen. Unsere Daten zeigen, daß schulische Lehrkräfte spätestens im Referendariat einer hohen beruflichen Belastung ausgesetzt sind und daß dies einhergeht mit belasteter Gesundheit. Deshalb ist eine Gesundheitsprävention spätestens im Referendariat dringend angezeigt. Modellprojekt „Hinsehen – Erkennen – Handeln (aktive Hilfen) im Gesundheitssystem“ der Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psy- 91 chosomatik und Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden, gefördert durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales. Isaak A., Schellong J. Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Ca. 25 Prozent der Frauen in der BRD haben mindestens einmal im Leben körperliche und/oder sexuelle Gewalt durch (Ex-) Beziehungspartner erlebt (BMFSFJ, 2004). Fachkräfte im Gesundheitswesen sind oft erste Kontaktpersonen für Opfer häuslicher Gewalt (Hellbernd, 2004). Die Präsenz des Themas wird jedoch z.B. von ÄrztInnen meist unterschätzt und ausgeblendet (Blättner & Müller, 2007). Gewaltbedingte Gesundheitsprobleme bleiben ohne aktives Ansprechen von ärztlicher oder pflegerischer Seite häufig unerkannt (Ramsey et al., 2002). Das bedeutet für Betroffene, dass physische und psychische Gesundheitsstörungen nicht als gewaltbedingt eingeordnet werden. Fehl-, Unter-, aber auch Überversorgung sind die Folge. Fachkräfte im Gesundheitswesen sind durch gezielte, auf sie abgestimmte Maßnahmen für die Auseinandersetzung mit diesem Thema erreichbar (Hellbernd, 2004). Das Dresdner Modellprojekt „Hinsehen – Erkennen – Handeln“ möchte Fachkräfte im Gesundheitswesen (Ärzte, Therapeuten, Pflegekräfte usw.) für das Thema „häusliche Gewalt“ qualifizieren und sensibilisieren. Analysen im Vorfeld geben Aufschluss über Fortbildungsbedarfe und spezielle Zugangsweisen zu den Zielgruppen, um eine hohe Compliance sicher zu stellen. Die Fachkräfte sollen die Angst verlieren, im Verdachtsmoment nachzufragen. Sie sollen lernen, sensibel und situationsgemäß zu handeln und in eine leitliniengerechte Beratung und Behandlung zu vermitteln. Sie sollen erkennen, dass Hinsehen keine Arbeit macht. Psychische Gesundheit von Medizinstudierenden in Homburg / Saar 1 2 3 Hamdan W. , Becker N. , Becker K. W. , Köllner 4 V. Bekannt ist, dass Medizinstudenten überdurchschnittlich stark durch körperliche Symptome, Depressivität und Burnout belastet sind. Ziel dieser Studie war es, die Prävalenz von PTB-Symptomen sowie Angst und Depressivität vor und nach dem Kurs zu messen und die Daten mit Werten von Studierenden im fortgeschrittenen Studium und mit Werten der Normalbevölkerung zu vergleichen. Es wurde eine Längsschnittstudie mit Studierenden des 3. Semesters durchgeführt, direkt vor und nach dem Präparierkurs befragt wurden. Es konnten 100 Fragebögen gepaart ausgewertet werden (78,13%). Bei T1 war das Alter 22,52 J, w/m 60,2%/39,8%; Symptome der PTB wurden mit der IESR (Impact of Event Scale), Angst und Depressivität mit der HADS (Anxiety and Depression Scale) erfasst. Mittelwerte lagen bei Intrusion(I) 14,6 SD ± 8,2, Vermeidung(V) 15,5 SD ± 8,6, Hyperarousal(H) 15,5 SD ± 7,6. Mittelwerte waren nach dem Kurs (I) 12,9 SD ± 7,6, (V) 13,6 SD ± 8,4, (H) 11,4 SD ± 7,4. Mittelwerte lagen bei Angst 9,8 SD ± 4,2 und Depressivität 6,1 SD ± 3,7, nach dem Kurs 8,5 SD ± 3,5 bzw. 4 SD ± 2,8. Studenten aus dem 6. klinischen Semester liegen bei (I) 13,2 SD ± 9,1, (V) 14,5 SD ± 9 und (H) 10,6 SD ± 9,3, bei Angst 6,4 SD ± 3,7 und Depressivität 3,6 SD ± 2,9. Im Vergleich zur Bevölkerung sind die Werte erhöht. Auffällig ist, dass die Symptombelastung durch Angst und PTB-Symptome nach dem Kurs zurückging. Die psychische Belastung ist vor dem Kurs groß, was eher für Erwartungsangst als für Traumatisierung spricht. Psychokardiologie Weißkittelhypertonie vs. Essentielle Hypertonie – bestehen die gleichen „Risikofaktoren“? 1 2 2 2 Einsle F. , Langer D. , Haas L. , Groß C. , Mu2 2 2 ckermann P. , Schlichthaar F. , Joraschky P. , Be1 esdo K. 1 Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden, Chemnitzer Str. 46, 01187 Dresden 2 1 Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden 2 Die vorliegende Studie geht der Frage nach, ob das Auftreten einer Weißkittelhypertonie (WKH) mit den gleichen psychischen Faktoren assoziiert ist, wie das Auftreten einer essentiellen Hypertonie (HYP). Dies wurde bei 65 WKHkern (58% Frauen; 42,3±15,7 Jahre) sowie 130 HYPkern (53% Frauen; 54,3±13,2 Jahre) im Vergleich zu 104 Normotonikern (NO; 76% Frauen; 35,3±15,3 Jahre) analysiert. Als psychische Konstrukte wurden untersucht. Ärger (STAXI), Typ D (DS 14), Angst und Depressivität (HADS), Hypochondrie (IAS); Soziale Ängste (SIAS, SPS); Unsicherheitsintoleranz (I- Institut für Psychoanalyse, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, Homburg Saar, 66421 Homburg Saar, Universitätsklinik, Haus 2, 66421 Homburg Saar Differentielle Psychologie und psychologische Diagnostik, Universität des Saarlandes, Campus, 66123 Saarbrücken 3 Anatomisches Institut, Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes, Homburg/Saar, Universität des Saarlandes - Medizinische Fakultät, 66421 Homburg/Saar 4 Fachklinik für Psychosomatische Medizin, Mediclin Bliestal Kliniken und Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes, Am Spitzenberg, 66440 Blieskastel 92 US); Behavioral Inhibition (RSRI) und das Vorliegen psychischer Störungen (DIA-X). In multinomial logistischen Regressionen (univariat) unter Kontrolle von Alter und Geschlecht ist eine WKH im Vergleich zu NO signifikant assoziiert mit: Sozialer Phobie (Exp(B) = 4,39; p = ,025), SIAS (Exp(B) = 1,04; p = ,008) und Trait-Anger (Exp(B) = 1,09; p = ,040). Eine HYP ist im Vergleich zu NO ebenfalls assoziiert mit Trait-Anger (Exp(B) = 1,14; p = ,002) aber auch mit allgemeiner Ängstlichkeit (Exp(B) = 1,10; p = ,038). WKH und HYP lassen sich mittels der untersuchten Konstrukte nicht differenzieren. Das Auftreten einer WKH ist demnach mit dem Vorliegen sozialer Ängste assoziiert, die beim Arztkontakt aktiviert werden und über die sympatische Aktivierung zu einer Blutdruckerhöhung führen. Hierbei wäre zu untersuchen, ob der temperamentsbedingte Ärger das Bindeglied zur Entwicklung einer HYP bei einer Subgruppe von WKH darstellt. SDANNI wurde durch Bildung/Verstehen vorhergesagt (34,5% erklärte Streuung). Die Ergebnisse bestätigen die notwendige Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedürfnisse. Beeinflussung des Koronardiameters durch suggestive Komponenten therapeutischer Interventionen. Methodenreport einer randomisiert-kontrollierten Pilotuntersuchung 1 2 1 Ronel J. , Mehilli J. , Oversohl N. C. , Blättler H. 1 2 2 2 X. , Byrne R. A. , Schneider S. , Bauer A. , Meiß3 ner K. 1 Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Langerstrasse 3, 81675 München 2 Deutsches Herzzentrum München, Lazarettstr. 36, 80636 München 3 Welche eingeschränkten Bedürfnisse führen bei Koronarpatienten zu Depression und eingeschränkter Herzratenvariabilität? Gibt es Geschlechtsspezifika? 1 2 3 1 Seifert S. R. , Einsle F. , Seifert D. , Joraschky P. 1 Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden 2 Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden, Chemnitzer Str. 46, 01187 Dresden 3 Praxis für Innere Medizin/Kardiologie Chronisch Erkrankte sind in ihrer Bedürfniserfüllung oft eingeschränkt. Nach der Konsistenztheorie von Grawe (2000) führt Motivinkongruenz zu psychischen Störungen. Die Studie untersucht, welche Bedürfnisbereiche für die Entstehung einer depressiven Störung und reduzierten Herzratenvariabilität (HRV) wichtig sind und ob geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen. Es wurden 117 KHK-Patienten untersucht (Alter=60,SD=7,5, Männer 74%). Die Datenerhebung erfolgte mittels Inkongruenzfragebogen (INK) zu T1 sowie 2 Jahre später (T2) mittels Hospital-Anxiety-DepressionScale (HADS-D) und Langzeit-EKG zur HRVMessung (SDANNI). Die statistische Prüfung erfolgte getrennt für Männer und Frauen mit schrittweiser multipler linearer Regression. 86% Beteiligung zu T2. Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern in soziodemographischen und krankheitsspezifischen Variablen. Prädiktoren für Depression waren bei den Männern die mangelhafte Erfüllung der Bedürfnisse Autonomie und Leben auskosten und die Kontrollvariable Lebensalter (27,5% erklärte Streuung). Kein Inkongruenzbereich konnte die HRV vorhersagen. Bei den Frauen waren Intimität/Bindung und Geselligkeit auf die depressive Verstimmung zu T2 einflussreich (61,2% erklärte Streuung). Die Institut für Medizinische Psychologie der LudwigMaximilians-Universität München, Goethestr. 31, 80336 München Hintergrund: Placeboeffekte bei Angina pectoris könnten auf eine veränderte Schmerzverarbeitung, aber auch auf eine verbesserte Koronardurchblutung zurückzuführen sein. In dieser Pilotstudie wurde untersucht, ob Placebointerventionen die Herzkranzgefäße erweitern können. Hierzu wurde das sog. "open vs. hidden"-Paradigma (Benedetti et al., 2003) angewandt, d.h. Medikamente und Placebos wurden entweder mit oder ohne Wissen des Patienten verabreicht. Methoden: Im Deutschen Herzzentrum München wurden 78 Patienten mit klinisch-kardiologischer Indikation zur Koronarangiographie rekrutiert und in eine von 4 Gruppen randomisiert. Patienten mit akuten myokardialen Ereignissen und interventionspflichtigen Stenosen wurden ausgeschlossen. Die Hälfte der Patienten erhielt 5 ml NaCl 0,9%, die andere Hälfte 5 ml einer geringfügig effektiven Nitroglycerin-Lösung intracoronar appliziert. Wiederum die Hälfte der Patienten in jeder Gruppe erhielt das Mittel offen und mit verbalen Suggestionen zum erwarteten Medikamenteneffekt, die andere Hälfte verdeckt verabreicht. Als primärer Zielparameter wurde der Durchmesser eines standardisierten Zielgefäßes mittels Koronarangiographie vor und nach Intervention gemessen (QCA). Als sekundäre Zielparameter wurden Herzfrequenz, Blutdruck, aktuelle Belastung und Schmerzen im Brustbereich erfasst. Erste Ergebnisse werden auf der Tagung vorgestellt. Die Studie ist Teil des Marie-Curie- Research-Training EU-Projektes "DISCOS". Angst und Angstbehandlung bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung 1 1 2 Merswolken M. , Siebenhüner S. , Orth-Gomér K. , 3 1 1 Albert W. , Weber C. , Deter H. 93 1 Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie, Charité Unversitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin 2 Department of Public Health Sciences, Karolinska Institute, Box 220, SE-171 77 Stockholm, Schweden 3 Deutsches Herzzentrum Berlin, Einführung: Angstsymptome und Angsterkrankungen haben eine hohe Prävalenz bei Patienten mit koronaren Herzerkrankungen (KHK). Symptome von Angst wie auch andere psychische Faktoren verursachen ein hohes Maß an Beeinträchtigung und subjektivem Leid. Darüber hinaus zeigt sich ein Einfluss psychischer Faktoren auf die Entstehung und den Verlauf der kardialen Erkrankung. Neben der Frage nach einer effektiven Behandlung der psychischen Symptomatik ist bislang die Frage ungeklärt, über welche physiologischen oder behavioralen Mechanismen der Zusammenhang von psychischem Befinden und kardialem Verlauf vermittelt wird. Ziele: Im Rahmen der Studie soll auf die Bedeutung der Angst im Zusammenhang mit der koronaren Herzerkrankung fokussiert werden. Fragestellungen: 1. Führt die von uns entwickelte Intervention zu einer signifikanten Reduktion der Angstsymptome der Patienten im Vergleich zur Kontrollbedingung (KG) (Verringerung der Angstscores im HADS)? 2. Führt die Behandlung im Vergleich zur KG zu positiven Veränderungen weiterer psychosozialer und biologischer Faktoren, für die eine Relevanz im Zusammenhang mit der koronaren Erkrankung erwiesen ist? Methoden: Randomisierte Zuweisung von N=62 Patienten zu den Untersuchungsbedingungen. Intervention: manualisierte Gruppentherapie (15 Sitzungen), Kontrolle: Behandlung durch ambulante Kardiologen (treatment as usual (TAU)). Ergebnisse: Aus der angelaufenen Studie werden das Studien-Design und die Baseline-Daten referiert. Welche psychosozialen Behandlungsangebote wünschen sich (depressive) Koronarpatienten einer ambulanten Praxis für Kardiologie? 1 2 3 1 Seifert S. R. , Einsle F. , Seifert D. , Joraschky P. 1 Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden 2 Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden, Chemnitzer Str. 46, 01187 Dresden 3 Praxis für Innere Medizin/Kardiologie Mögliche psychosoziale und psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten bei KHK-Patienten, die die medizinische Therapie im ambulanten Bereich ergänzen könnten, sind noch nicht erfragt worden. In dieser Studie wurden 101 Koronarpatienten (Alter 62+7 Jahre,74% Männer) einer Praxis für Kardiologie des MVZ Bitterfeld/Wolfen zu ihrem Interesse, ihrer Teilnahmebereitschaft an einem Behandlungsangebot und an einer kontrollierten In- terventionsstudie befragt. Sie beantworteten auch die Hospital Anxiety and Depression Scale (HADSD) und wünschenswerte Behandlungsformen. 71,7% zeigten sich interessiert. Die Teilnahmebereitschaft betrug 43,3%. An einer Interventionsstudie würden 28,6% teilnehmen. Die Rangfolge wünschenswerter Behandlungsangebote: Hilfen bei der Änderung ungesunder Lebensgewohnheiten (ja 57,3%), Angebote für die körperliche Fitness (ja 50,5%), Gespräche mit einem Arzt/Psychologen (ja 48,0%), Stressbewältigungsprogramme (ja 46,9%), Psychoedukation/Vorträge (ja 39,8%), Herz-Gruppengespräche (ja 23,7%). Depressive Herzpatienten (HADS-D-Rohwert ab 11,n=13) zeigten nur bezüglich der Behandlungsform Stressbewältigungsprogramm ein signifikant abweichendes Ergebnis (χ2=13,0(4), p=0,011). 76,5% depressiver Koronarpatienten möchten Stressbewältigungsprogramme angeboten bekommen. Die Ergebnisse zeigen das Bedürfnis nach Zusatzprogrammen in der Sekundärprävention der KHK im ambulanten Bereich. Körperliche und psychische Beschwerden sowie Schockangst bei Patienten mit einem Defibrillator - eine randomisierte Studie hinsichtlich Narkose während der Testentladung (PHD) 1 1 2 Dannemann S. , Petrowski K. , Günther M. , Eins3 1 2 le F. , Joraschky P. , Strasser R. H. 1 Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinik, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 2 Herzzentrum Dresden, Klinik für Kardiologie, Universitätsklinik, Fetscherstraße 76, 01307 Dresden 3 Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, TU Dresden, Chemnitzer Str. 46, 01062 Dresden Defibrillatoren (ICD) werden Patienten implantiert, um tachykarde, maligne Arrhythmien durch einen elektrischen Schock zu beenden. In der Regel erfolgt die ICD-Testung (pre-hospital discharge, PHD) vor Entlassung in Narkose. Dem Patienten bleibt die Angst vor dem unbekannten Schock sowie das Unwissen einer einlaufenden Arrhythmie und mangelnde Vorbereitung auf einen potenziellen Schock. Schocks sind bei vielen Patienten mit psychischen Beschwerden assoziiert. Bisher ist unbekannt, ob ein PHD mit bzw. ohne Narkose die psychische Anpassung an den ICD und die Verarbeitung therapeutischer Schocks beeinflusst. In einer Pilotstudie wurden 29 Patienten (60.9±12.46 Jahre, 90% Männer) mit Primärindikation für einen ICD hinsichtlich der Narkose im PHD randomisiert. Exemplarisch werden die Ergebnisse des Brief Symptom Inventory (BSI) und der Florida Shock Anxiety Scale (FSAS) vorgestellt. Die Zwischenauswertung zeigt, dass Patienten mit Narkose tendenziell mehr körperliche und psychische Beschwerden präoperativ in den Einzelskalen und der Gesamtskala des BSI angeben. Zudem berichten sie postoperativ tendenziell mehr Angst vor und mehr Sorgen bezüglich der Konsequenzen ei- 94 nes Schocks in der FSAS. Die bisherigen Daten zeigen tendenziell eine bessere psychische Verarbeitung von Schocks im PHD ohne Narkose. Die Studie ist als Längsschnitt angelegt. In der prospektiven Datenanalyse der 3- und 6Monatskatamnesen werden die Hypothesen zur psychischen Anpassung und Verarbeitung überprüft. Effektivität psychologischer und seelsorgerlicher Interventionen auf die postoperative Genesung nach Bypass-Operation 1 1 1 Strauß B. , Rosendahl J. , Rothaug J. , Tigges1 2 2 3 Limmer K. , Dziewas R. , Albes J. , Gummert J. 1 Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena, Stoystr. 3, 07740 Jena 2 Evangelisch-Freikirchliches Krankenhaus und Herzzentrum Brandenburg in Bernau, Ladeburger Str. 17, 16321 Bernau 3 Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Jena, Erlanger Allee 101, 07747 Jena Die Effektivität psychologischer und seelsorgerlicher Interventionen auf die Genesung nach Herzoperationen wurde vielfach untersucht, entsprechende Studien liegen jedoch vornehmlich für präoperative Interventionen vor [1-3]. Eine systematische Analyse der Effekte psychologischer und seelsorgerlicher Interventionen sowie eine Berücksichtigung der Interventionspräferenz der Patienten ist bislang noch nicht vorgenommen worden. In einer DFG-geförderten bizentrischen Studie wurden ca. 300 herzchirurgische Patienten entsprechend ihrer Interventionspräferenz einer von fünf Interventionssubgruppen zugewiesen: entweder gewünschte psychologische Interventionen, gewünschte seelsorgerliche Interventionen oder keine gewünschte Interventionen. Patienten, die eine Intervention ohne therapeutische Präferenz wünschten, wurden randomisiert psychologischen oder seelsorgerlichen Interventionen zugewiesen. Drei Monate vor Beginn der Interventionsphase wurden als Kontrollgruppe 425 Patienten zu ihrer Interventionspräferenz befragt, erhielten aber keine Interventionen. Es wurden psychosoziale und medizinische Daten zu 4 Messzeitpunkten erhoben. Erste Ergebnisse zeigen, dass Patienten, die perioperativ psychologische oder seelsorgerliche Interventionen erhielten, einen positiveren psychischen und somatischen Genesungsverlauf aufweisen als Patienten der Kontrollgruppe. Der Einfluss der Interventionspräferenz und sich daraus ergebende psychologische und ökonomische Konsequenzen werden diskutiert. Prävalenz und Prädiktoren einer Posttraumatischen Belastungsstörung bei kardiologischen Rehabilitanden 1 2 3 Kittel J. , Karoff M. , Hinz A. 1 Institut für Rehabilitationsforschung, Norderney, Holthauser Talstr. 2, 58256 Ennepetal 2 Klinik Königsfeld der DRV Westfalen, Holthauser Talstraße 2, 58256 Ennepetal 3 Selbständige Abteilung für Medizinische Psychologie und Soziologie, Universität Leipzig, Philipp-RosenthalStraße 55, 04103 Leipzig Ziel der Studie war die Erfassung der Prävalenz einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) während und 6 Monate nach einer kardiologischen Rehabilitation. Methode: Analysiert wurden die Daten von konsekutiv aufgenommenen Patienten mit akutem Myokardinfarkt, Bypass- oder Herzklappenoperation. Eine Posttraumatische Belastungsstörung wurde definiert über das Vorhandensein eines im Zusammenhang mit dem kardialen Ereignis stehenden extrem belastenden Erlebnisses, sowie auffälligen Werten in den Screeninginstrumenten "Impact of Event-Scale" (IES-R) und "Posttraumatic Stress Syndrom Questions Inventory" (PTSS-10). Untersucht wurde ferner mit Hilfe von logistischen Regressionsanalysen die Assoziation von auffälligen Fragebogenwerten mit soziodemografischen, medizinischen und belastungsspezifischen Variablen. Es liegen die Datensätze von 292 Patienten vor. Zu Beginn der Rehabilitation erfüllten 44 Patienten die aufgestellten Kriterien einer PTBS. Das entspricht einer Prävalenz von 15,1%. Sechs Monate später zeigten 31 der 44 Patienten noch immer auffällige Werte. Bei beiden Fragebögen erwiesen sich weibliches Geschlecht, das Erleben von Todesängsten und Hilflosigkeit während des kardialen Ereignisses als bedeutsame Prädiktoren für das Auftreten einer PTBS. Die beiden letzteren Variablen sind auch mit einer PTBS ein halbes Jahr nach der Rehabilitation assoziiert. Fazit: Die Identifikation und Behandlung von traumatisierten kardiologischen Patienten ist dringend erforderlich. Psychodynamische Gruppentherapie bei Patienten mit Koronarspasmen - Ergebnisse einer Interventionsstudie 1 2 3 Knieling J. , Körmendy C. , Athanasiadis A. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Riedstr. 12, 74321 Bietigheim-Bissingen 2 Privat 3 Abteilung für Kardiologie und Pulmologie, Auerbachstr. 110, 70376 Stuttgart Koronarspasmen sind rezidivierende krampfartige Verengungen an den Koronargefäßen, die ähnlich wie eine bestehende KHK zu Angina-pectorisBeschwerden führen. Sie sind erst seit einigen Jahren durch einen ACh-Provokationstest während der Herzkatheteruntersuchung gut zu diagnostizieren. Vorher galten diese Patienten häufig als "organisch gesund" und von psychosomatischer Seite wurden Diagnosen wie "Herzneurose" oder "atypi- 95 scher psychogener Brustschmerz" gestellt. Auch wenn mittlerweile der physiologische Mechanismus der Koronarspasmen gut beschrieben werden kann, bleibt die Frage nach psychogener Mitbeeinflussung weiter bestehen. Viele der Patienten selbst sehen einen Zusammenhang zwischen psychischer Belastung/Stress und ihren Beschwerden.Es werden die Ergebnisse einer Interventionsstudie vorgestellt, die die Wirksamkeit psychodynamischer Gruppenpsychotherapie bei dieser Patientengruppe untersucht. Hierfür wurden 46 Patienten mit Koronarspasmen rekrutiert, die trotz med. Behandlung weiter symptomatisch waren. Insgesamt 21 Patienten wurden mit Gruppentherapie behandelt, 20 Patienten bildeten zunächst eine Wartegruppe (randomisierte Zuteilung), 18 Patienten konnten aus Entfernungsgründen nicht teilnehmen (weitere Kontrollgruppe). Das Behandlungsprogramm umfasste 20+2 Gruppensitzungen á 90 Minuten, gemessen wurden vor und nach der Intervention die Spasmus-Symptomatik (Tagebuch über jeweils 4 Wochen) sowie verschiedene körperliche und psychische Parameter (SCL-90, IIP, GBB). Psychosoziale und somatische Korrelate des NYHA Stadiums herzinsuffizienter Patienten 1 1 1 Holzapfel N. , Wild B. , Müller-Tasch T. , Jünger 1 1 1 1 J. , Zugck C. , Remppis A. , Frankenstein L. , 2 3 1 4 Haass M. , Rauch B. , Herzog W. , Löwe B. 1 Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg 2 Abteilung für Kardiologie, Theresienkrankenhaus Mannheim, Bassermannstr. 1, 68165 Mannheim 3 Herzzentrum Ludwigshafen, Kardiologie und Pneumologie, Bremserstr. 79, 67063 Ludwigshafen 4 Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE), Gebäude Ost 59 (O 59), Martinistr. 52, 20246 Hamburg Einleitung: Chronische Herzinsuffizienz geht häufig mit komorbiden depressiven Störungen einher. Beide Erkrankungen sind über pathophysiologische und psychosoziale Aspekte miteinander verbunden. Die in der Literatur berichteten Zusammenhänge zwischen NYHA Stadium und Depression sind jedoch stärker ausgeprägt, als die zwischen anderen klinischen Parametern (z.B. LVEF) und Depression. Untersucht wurden daher psychosoziale und somatische Korrelate des NYHA Stadiums herzinsuffizienter Patienten. Methodik: n= 318 chronisch herzinsuffiziente Patienten, NYHA Stadium II-III, LVEF ≤ 50. Neben einer breiten Erfassung soziodemographischer und somatischer Variablen wurde die Depressivität der Patienten mit dem PHQ-9, die Multimorbidität mit dem CIRSG erfasst. Ergebnisse: Das finale Regressionsmodell ergab signifikante Assoziationen des NYHA Stadiums mit dem Alter (p =.02, OR = 1,03, 95% CI 1,00-1,06) und der Depressivität der Patienten (p ≤ .001, OR = 1,13, CI 1,07-1,19). Univariate Assoziationen ergaben sich mit der Multimorbidität (p=.004). Keine signifikanten Zusammenhänge ergaben sich mit der LVEF, der Ätiologie der Herzinsuffizienz, der Dauer der Erkrankung, der Anzahl kardialer Risikofaktoren, dem BMI, dem Geschlecht, Familien- und Bildungsstand der Patienten, sowie deren Alkohol- und Tabakkonsum. Schlussfolgerung: Die Depressivität und das Alter der Patienten hängen mit der Einschätzung des NYHA Stadiums zusammen und sollten in der klinischen Routine berücksichtigt werden. Psychotherapieforschung Aus Fehlern wird man klug: Flüchtigkeitsfehler eines revolutionären Projekts (Psychoanalyse) zwischen Trauma- und Triebperspektive – in rückblickender Text- und Falldiskussion. Schlagmann K. Privat, psychotherapeutische Praxis, Scheidter Str. 62, 66123 Saarbrücken Saarbrücken, „Psychoanalyse“ meint für den Namensgeber, Josef Breuer, die Aussprache („talking cure“) eines real erlebten Traumas. Von der Wirksamkeit dieses Modells (z.B. bei „Katharina“) überzeugt sich Sigmund Freud selbst. Auch beim Aufarbeiten seines eigenen Konflikts ist er davon fasziniert.Er gerät jedoch unter den suggestiven Einfluss des Kollegen Wilhelm Fließ, der seinen Freund auf die Betonung der Triebe einschwört. Der Perspektivenwechsel entlastet: Der Kern des eigenen Familiendramas – zum Greifen nahe – kann unberührt bleiben. Im Therapie-Verfahren, für das Freud den Namen „Psychoanalyse“ beibehält, fordert er weiterhin offene Aussprache – nun jedoch die der triebhaften Verfehlungen, anstatt der erlebten Gewalt. Seinem revolutionären Projekt einer „sprechenden Medizin“ unterläuft hier gewissermaßen ein Flüchtigkeitsfehler. „Ödipuskomplex“ und „Narzissmus“ spiegeln Freuds Zwiespalt: Als Paradebeispiele eines Trieb-Geschehens dienen ihm zwei Mythen, die eindeutig von Traumatisierungen erzählen (Schlagmann, 2001, 2005). Otto Kernberg (1999) bringt – so prägnant, wie vermutlich niemand sonst – die Spannung „auf den Punkt“, die sich – bis heute – aus der Diskrepanz von traumatischer Wirklichkeit und triebtheoretischer Deutung ergibt. Dabei kann man wohl sagen: Freud hält unbewusst an dem sich in der modernen TraumaForschung immer mehr bestätigenden TraumaModell Breuers fest. Neuere Erfahrungen mit diesem ursprünglichen Herangehen (Diehlmann, 2006) zeigen ermutigende Ergebnisse. 96 Psychotherapieausbildung in Europa Kaufmann S., Tritt K., Löw T. Abteilung für Psychosomatische Medizin, Klinikum der Universität Regensburg, Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg In Deutschland existiert eine gesetzliche Regelung zu Ausbildung und Ausübung der ärztlichen bzw. nichtärztlichen Psychotherapie. Allerdings liegt bis jetzt noch keine Übersichtsarbeit zur Situation in den anderen Ländern Europas vor. Die vorliegende Arbeit hat die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Ausbildung von Psychotherapeuten in den Ländern Europas zum Thema. Die Auswahl der 16 beschriebenen Länder erfolgte aufgrund einer internen Aufteilung der Arbeitsgruppe zufällig. Methode der Datenerfassung waren Internetrecherche geeigneter Interviewpartner, anschließende telefonische Kontaktaufnahme und ein zuvor ausgearbeiteter standardisierter Fragebogen zu den wichtigsten Parametern (verlangte Vorbildung, Dauer der Ausbildung, verlangte Selbsterfahrung, Kosten der Ausbildung, Institute, Modalitäten) psychotherapeutischer Ausbildung. Die Ergebnisse werden im Kontext des jeweiligen Gesundheitssystems präsentiert. Dabei ergeben sich grob drei Gruppen von Ländern. Die erste besteht aus Ländern mit einem hohen Grad an gesetzlicher Regelung sowie einer hochwertigen (gemessen an der Dauer) Ausbildung (Dänemark, Österreich, Deutschland, Finnland). In der zweiten Gruppe finden sich Länder mit zwar gesetzlicher Regelung, die jedoch bezüglich der Ausbildung viel Spielraum lässt (Norwegen). In der dritten Gruppe ist eine nationale Regelung zur Psychotherapie nicht vorhanden bzw. noch in der Entstehung begriffen (Griechenland, Zypern). Auswirkungen eines 6-wöchigen Entspannungstrainings mit Progressiver Muskelrelaxation auf psychologische Stressparameter bei gesunden Probanden von Seckendorff R., Rudat M., ZimmermannViehoff F., Deter H., Weber C. Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie, Charité Unversitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin Einleitung: Zahlreiche Studien zeigen positive Effekte auf die psychologische Befindlichkeit von Progressiver Muskelrelaxation (PMR) bei verschiedenen Patientenpopulationen. Wir testeten den Effekt einer 6-wöchigen Gruppenintervention auf psychometrische Stressparameter bei gesunden männlichen Probanden. Methoden: Die PMRIntervention erfolgte über 6 Wochen 1 Mal pro Woche unter Anleitung einer Diplompsychologin (Je 90 Minuten). Vor und nach 6 Wochen wurden per Fragebogen erfasst: depressive Verstimmung, (BDI, Beck 1994), Ärger (STAXI, Spielberger 1988), Angst (STAI, Spielberger 1970) und Stress- erleben (PSQ, Levenstein et al. 1993, Fliege et al. 2005). Die Ergebnisse der PMR-Gruppe wurden mit Daten einer Kontrollgruppe verglichen, die keine Intervention erhielt (Mann-Whitney-U Test). Ergebnisse: Es wurden 37 Probanden eingeschlossen (n=18 PMR-Teilnehmer, Alter: 29,4 ± 6,5 Jahre). Die PMR-Gruppe zeigte im Vergleich zur Kontrollgruppe nach der Intervention signifikant niedrigere Scores für depressive Verstimmung (p=0,046), Stressempfinden (p=0,04) und Angstdisposition (p=0,002), sowie einen statistischen Trend für niedrigere Ärgerdisposition (p=0,075). Diskussion: Analog zu Studien an verschiedenen Patientenpopulationen können wir auch bei gesunden männlichen Probanden signifikante positive Effekte im Anschluss an eine 6-wöchige PMRGruppenintervention hinsichtlich verschiedener psychometrischer Parameter zeigen. Die Bedeutung der beobachteten Veränderungen wird diskutiert. Wie wirkt sich Hoffnungslosigkeit auf die Behandlung und den Behandlungserfolg aus? Lüdemann A., Keller A., Petrowski K., Pöhlmann K., Joraschky P. Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden Hoffnungslosigkeit (H) wird in der kognitiven Therapie als wichtiger Aspekt bei depressiven Störungen und Therapieerfolg angesehen. Allerdings gibt es kaum prospektive Untersuchungen zur Rolle von H im Therapieverlauf oder bei anderen Patientengruppen. An 85 Fällen einer psychosomatischen Tagesklinik wurde untersucht, wie sich Patienten ohne (N=44), mit sinkendem (N=25) und steigendem (N=16) linearen Trend in der H unterscheiden. Erfasst wurden wöchentlich die H (HRB) sowie bei Aufnahme und Entlassung BDI, SWE, GSAB und FKK. Die Ergebnisse zeigen eine höhere Depressivität bei Patienten mit steigender H (p<.05). Selbstwerterleben und Selbstwirksamkeitserwartung sind höher bei Patienten mit sinkender H (p<.01; p<.05). Bei Entlassung haben Patienten mit sinkender H eine geringere Depressivität (p<.001), höheres Selbstwerterleben (p<.01) und Selbstwirksamkeitserwartung (p<.01). An 72 Fällen wurde untersucht, wie sich das Ausmaß der H zu Therapiebeginn auswirkt. Dabei wurden Patienten mit hoher und niedriger H unterschieden. In Depressivität und Selbstwerterleben verbessern sich beide Gruppen zur Entlassung (p<.001), die hoffnungsloseren Patienten jedoch auf schlechterem Niveau (p<.001; p<.05). Patienten mit höherer H bei Aufnahme sind weniger von eigenen Fähigkeiten (p<.05) und stärker von Schicksal/ Zufall (p<.05) überzeugt. Es soll weiter untersucht werden, inwieweit durch neue Therapiebausteine die ungünstigen Effekte im Therapieprozess aufgefangen werden können. 97 2 Fachklinik für Psychosomatische Medizin, Am Spitzenberg, 66440 Blieskastel, Deutschland Ambulante psychosomatische Patienten mit Anpassungsstörungen, deren Beschwerden, Veränderungsbereitschaft und Psychotherapiemotivation 1 2 1 1 Dannemann S. , Einsle F. , Kämpf F. , Kerbach I. , 3 1 Maercker A. , Joraschky P. 1 Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinik, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 2 Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, TU Dresden, Chemnitzer Str. 46, 01062 Dresden 3 Psychologisches Institut der Universtität Zürich, Abteilung Psychopathologie und Klinische Intervention, Binzmühlestraße 14/17, 8050 Zürich, Schweiz Patienten einer psychosomatischen Poliklinik wurden mit einem neuen Fragebogen (ADNM) zu ihren Belastungen befragt. Anpassungsstörungen werden in praxi häufig diagnostiziert, jedoch ohne ausreichend reliable und valide Diagnosekriterien. Dies führte auch zur Vernachlässigung der Forschung auf diesem Gebiet. Neben dem ADNM wurden Fragebögen zu Interaktionsangst (SIAS), Beschwerden (SCL-90), Veränderungsbereitschaft (FEVER) und Psychotherapiemotivation (FPTM23) eingesetzt. 337 Patienten (Rücklauf 73%) nahmen an der Studie teil. Die Stichprobe war 44.6±15.09 Jahre alt (Frauen 66%). 7% gaben keine, 18% eine, 67% bis zu fünf und 8% mehr als fünf Belastungen an. 60% der Patienten waren im ADNM auffällig, im Sinne von Anpassungsproblemen an die Belastungen. Auffällige Patienten berichteten eine höhere Interaktionsangst (p = .000) und mehr Beschwerden in allen Skalen der SCL90 (p = .000) als Unauffällige. Im ADNM auffällige Patienten zeigten höhere Werte in den Skalen Handlung (p = .003) und Handlungsbereitschaft (p = .000) des FEVER und berichteten einen höheren psychischen Leidensdruck (p = .000), mehr Initiative (p = .001) und Wissen (p = .034) bezüglich Psychotherapie im FPTM-23. Patienten mit Belastungen sind deutlich beeinträchtigter, dies lässt sich mit dem ADNM abbilden. In zukünftigen Studien muss untersucht werden, ob im ADNM auffällige Patienten eher Psychotherapie in Anspruch nehmen, so wie dies anhand der vorgestellten Daten als Hypothese besteht. Wirksamkeit psychotherapeutischer Interventionen bei der Behandlung des FibromyalgieSyndroms - Eine Meta-Analyse kontrollierter und nicht-kontrollierter Studien 1 2 2 Füber N. A. , Bernardy K. , Köllner V. , Häuser 3 1 W. , Spinath F. M. 1 Differentielle Psychologie und psychologische Diagnostik, Universität des Saarlandes, Campus, 66123 Saarbrücken 3 Zentrum für Interdisziplinäre Schmerztherapie, Klinikum Saarbrücken, Einleitung: Die Symptomatik des FibromyalgieSyndroms ist vielgestaltig. Neben Schmerzen in mehreren Körperregionen klagen die Patienten über andere Symptome, die mit einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität einher gehen. Bislang gibt es keine Therapie, die zu einer anhaltenden Remission der Beschwerden führt. Leitlinien und eine Meta-Analyse kontrollierter Studien, empfehlen die Anwendung kognitivverhaltenstherapeutischer Maßnahmen. Bislang hat keine quantitative Befundintegration stattgefunden, die diese Empfehlung bei Berücksichtigung unkontrollierter Studien bestätigt. Ziel der vorliegenden Meta-Analyse war die Quantifizierung der Effektivität psychotherapeutischer Interventionen anhand der Variablen Schmerz, Depression und Lebensqualität, unter Einschluss der Resultate kontrollierter und unkontrollierter Studien. Methode: Es wurde eine systematische Recherche diverser Datenbanken für den Zeitraum 1990 bis 2007 durchgeführt. Für die Befundintegration wurde die Methode nach Hunter und Schmidt herangezogen, die eine Korrektur statistischer Artefakte ermöglicht. Ergebnisse: Die mittleren Effekte bestätigen die Überlegenheit kognitivverhaltenstherapeutischer Interventionen in der Behandlung des FMS. Aufgrund eines Mangels an Studien muss die Evaluation psychodynamischer Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt ausbleiben. Strukturbezogene Verhaltenstherapie Berberich G. Psychosomatische Klinik Windach, Die multimodale Verhaltenstherapie im stationären Setting bietet eine Vielzahl von differenzierten Interventionsmöglichkeiten zur Therapie struktureller Defizite. Die dimensionale Diagnostik spielte in der Verhaltenstherapie schon immer eine entscheidende Rolle, setzt sich aber auch in der Beurteilung von Persönlichkeitsstörungen zunehmend durch. Allerdings fehlt im verhaltenstherapeutischen Schrifttum ein schlüssiges System der Strukturdefizite bzw. der defizitären „Skills“, welches auch deren Quantifizierung erlaubt. Die Strukturachse der OPD-2 lässt sich jedoch als Ergänzung gut in die verhaltenstherapeutische Diagnostik integrieren, um Art und Ausmaß der strukturellen Defizite zu erfassen. In einer „strukturbezogene Verhaltenstherapie“ - analog der strukturbezogenen Psychotherapie nach Rudolf – können dann bereits bestehende und sich weiterentwickelnde kognitiv-behaviorale Therapiemethoden für Persönlichkeitsstörungen gezielt und individualisiert entsprechend dem Muster der vorliegenden Struktur- bzw. Skilldefizite eingesetzt werden. Aus 98 den vorliegenden Erfahrungen ist auch der Einsatz kognitiv-behavioraler Methoden im Rahmen einer tiefenpsychologisch orientierten strukturbezogenen Psychotherapie zu diskutieren. Anhand von Fallbeispielen werden dieses integrative Vorgehen geschildert und erste Erfahrungen des Therapieoutcomes vorgestellt. Modellprojekt zur Interprofessionellen Kooperation in der Pränataldiagnostik: zwei Jahre danach Sieler V., Bruder A., Pauli-Magnus C., Riehl-Emde A. Untersuchung der Coping-Strategien von Patientinnen der stationären Gynäkologie mit dem Essener Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (EFK) 1 2 2 Jagla M. , Parchmann O. , Kumbier E. , Franke G. 1 H. Die psychosoziale Beratung zu allen Zeitpunkten einer Schwangerschaft, also auch im Kontext von Pränataldiagnostik (PND), ist als rechtlicher Anspruch jeder Schwangeren in den Mutterschaftsrichtlinien verankert. In der Realität wird ein solches Hilfsangebot selten genutzt. Daher wurde in den Jahren 2002 bis 2007 ein Modellprojekt mit interprofessionellen Qualitätszirkeln (IQZ) durchgeführt, das zum Ziel hatte, die psychosoziale Beratung mehr in die Versorgung Schwangerer zu integrieren und die fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Beraterinnen auszubauen. Die mittelfristigen Veränderungen wurden mindestens zwei Jahre nach Abschluss der IQZ mittels Fragebogen, Interview und teilnehmender Beobachtung der Zirkeltreffen erfasst. Das Modellprojekt und die Nachbefragung wurden von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefördert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kooperationsstrukturen an einigen Orten intensiviert und ausgebaut wurden. Die Inanspruchnahme psychosozialer Beratung stagniert allerdings auf dem bisherigen Niveau. Obwohl die verschiedenen Professionen von berufsgruppenübergreifender Kooperation im Bereich PND profitieren, nimmt nur ein Bruchteil der Schwangeren das psychosoziale Beratungsangebot wahr. Mögliche Faktoren dafür sind vielschichtig und standortspezifisch, weshalb Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgungssituation zu PND an regionale Gegebenheiten anknüpfen sollten, um längerfristige Strukturverbesserungen bewirken zu können. 1 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH), Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften, Studiengänge Rehabilitationspsychologie, Osterburger Straße 25, 39576 Stendal 2 Krankenhaus &quot;Am Rosarium&quot; Sangerhausen, Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Am Beinschuh 2, 06526 Sangerhausen Die Psychogynäkologie untersucht vorrangig die Lebensqualität der Patientinnen, unberücksichtigt bleibt oft deren Krankheitsverarbeitung. Ziel der Studie ist der Einsatz des Essener Fragebogens zur Krankheitsverarbeitung (EFK) zur Untersuchung von Coping-Strategien bei gynäkologischen Patientinnen sowie die psychometrische Prüfung des EFK in dieser Stichprobe. Der EFK besteht aus 45 Items, die 9 Skalen zugeordnet werden. Analysiert werden die Daten von 123 Patientinnen im durchschnittlichen Alter von 48 Jahren (SD 12 J), die präoperativ mit EFK, SF-36 und SCL-90-R untersucht wurden. Die Patientinnen beschrieben geringe Bewältigungsanstrengungen, außer beim Vertrauen in die ärztliche Kunst und handelndem, problemorientierten Coping. Verglichen mit anderen Patientengruppen zeigten sich signifikante Unterschiede bei allen Skalen, außer bei der depressiven Verarbeitung. Die interne Konsistenz (r=0,41 bis r=0,75) und die faktorielle Validität waren akzeptabel, die Item-Skalen-Zuordnung war gegeben. Die konvergente und divergente Validität wurde durch Korrelationen mit BSI und SF-36 geprüft; depressive Verarbeitung korrelierte mit allen BSI-Skalen und den Subskalen sowie der Psychischen Summenskala des SF-36. Zur Verbesserung ihrer gesundheitsbezogenen Lebensqualität aktivieren die Patientinnen wenig CopingStrategien; rehabilitationspsychologische Interventionen sollten hier ansetzen. Der EFK eignet sich zur Diagnostik von Krankheitsverarbeitung bei gynäkologischen Patientinnen. Abteilung für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie Universitätsklinikum, Bergheimer Straße 54, 69115 Heidelberg Synchrone Instabilitäten im Erleben der therapeutischen Beziehung durch Patienten und Therapeuten im Verlauf psychodynamischer Prozesse Gumz A., Kästner D., Villmann T. Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatische Medizin der Universität Leipzig, K.-TauchnitzStr. 25, 04107 Leipzig Um detaillierte Erkenntnisse der Einfluss- und Wirkfaktoren in psychotherapeutischen Prozessen zu erlangen, ist es wichtig, die Mechanismen von Veränderung zu untersuchen. Zunehmend widerlegen Befunde die Vorstellung einer sukzessiven, kontinuierlichen Verbesserung in Psychotherapien. Veränderung scheint nicht graduell und linear, sondern innerhalb kritischer Phasen mit abrupten Umbrüchen zu erfolgen. In diesem Sinne haben wir die Patient-Therapeut-Beziehung im Prozess 99 psychodynamischer Psychotherapie unter Berücksichtung selbstorganisatorischer Prinzipien als dynamisches System mit stabilen und instabilen Abschnitten und abrupten Übergängen modelliert. Bei mehreren Einzelfällen, zehn kürzeren stationären Therapien und drei ambulanten Langzeittherapien, wurde das Erleben der therapeutischen Interaktion jeweils durch Patienten und Therapeuten Prozess begleitend mit dem Intrex-Fragebogen (SASB) eingeschätzt. Über die erhaltenen Zeitreihen wurde ein Maß der Instabilität der Dynamik einer Zeitreihe berechnet. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass in erfolgreichen Therapien bei Patienten und Therapeuten instabile Phasen synchron verlaufen und nur geringe Unterschiede in der Höhe ihrer Instabilität aufweisen. In zeitlichem Zusammenhang mit hoher Instabilität treten diskontinuierliche Veränderungen auf. Die Befunde sprechen für die Zulässigkeit des zugrunde gelegten Prozessmodells, speziell auch dafür, dass Therapeut und Patient als Teile eines Gesamtsystems zu betrachten sind. "Trefferquoten“ therapeutischer Prognosen vom Beginn der stationären psychosomatischen Rehabilitation 1 2 Oster J. , von Wietersheim J. 1 Abt. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Am Hochstraess 8, 89081 Ulm 2 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Frauensteige 14a, 89075 Ulm Die Therapeuteneinschätzungen zu Beginn einer Behandlung sind relevant für die Behandlungsplanung. In dieser Studie sollte untersucht werden, wie zutreffend diese Einschätzungen zur Vorhersage von Therapiemisserfolgen in der stationären psychosomatischen Rehabilitation sind. Es lagen Daten der Basisdokumentation einschließlich SCL90R zur Aufnahme, Entlassung und 3Monatskatamnese von 463 Patienten einer psychosomatischen Rehaklinik vor. Therapeuten schätzten nach dem Erstgespräch Prognose, Motivation und Rentenbegehren ein. Zusammenhänge mit Ergebnismaßen (Verbesserung von GSI, Hauptdiagnose, Arbeitsfähigkeit) wurden untersucht. Die Korrelationen belegen signifikante, aber lediglich geringe Zusammenhänge in der erwarteten Richtung. Die Trefferquote der Therapeutenprognosen für Patienten, die in allen Kriterien bei Entlassung nicht erfolgreich waren (14%), lag bei lediglich 12%. Mit allen genannten Therapeuteneinschätzungen gelingt bei diesem Kriterium im multivariaten Modell eine Varianzaufklärung von 18%. Von den 60% der Patienten, die bei der Katamnese keine GSI-Verbesserung aufwiesen, wurden 32% vom Therapeuten zutreffend prognostiziert. Die Varianzaufklärung mit allen Therapeuteneinschätzungen beträgt hier nur 7%. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, in die Therapieplanung weitere Informationsquellen ein- zubeziehen. Die Trefferquoten der Therapeuteneinschätzungen zu Beginn sind zu gering, auf ihrer Grundlage weitreichende Behandlungsfestlegungen vorzunehmen. Psychotraumatologie Der Einfluss verschiedener Unfalltypen auf den Prozess der Traumaverarbeitung und die psychosoziale Anpassung 1 1 2 1 Wrenger M. , Lange C. , Langer M. , Heuft G. , 1 Burgmer M. 1 Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Universitätsklinikum Münster, Domagkstr.22, 48149 Münster 2 Klinik und Poliklinik für Hand- und Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Münster Einleitung: Unfälle können psychische Erkrankungen nach sich ziehen. Hierbei spielt die Traumaverarbeitung und die psychosoziale Anpassung eine besondere Rolle. Hier wird untersucht, inwiefern der Unfalltyp einen Einfluss auf die Traumaverarbeitung hat. Methode: In einer prospektiven Studie einer konsekutiven Stichprobe von 192 Unfallopfern wurde der Prozess der Traumaverarbeitung und die psychosoziale Anpassung nach verschiedenen Unfalltypen (Verkehrs-, Arbeits-, Freizeitunfall) direkt sowie 6 und 12 Monate nach dem Unfall untersucht. Ergebnisse: Die drei Gruppen unterschieden sich in den demographischen Daten, in der Verletzungsschwere, im subjektiven Erleben sowie in den direkten psychischen Reaktionen. Dennoch war die Prävalenz traumaassoziierter Störungen nach 6 Monaten in den drei Gruppen nicht signifikant verschieden. Nach 12 Monaten war jedoch bei den Opfern von Freizeitunfällen die niedrigste Belastung feststellbar. Verkehrs- und Arbeitsunfallopfer zeigten ähnlich häufig PTBSSymptome. Als Folge dieser Unfälle entstanden eher Traumafolgestörungen, nach Freizeitunfällen eher andere Störungen. Diskussion: Die individuelle Traumaverarbeitung und der Unfalltyp nehmen Einfluss auf die psychische Gesundheit. Der Einfluss weiterer Variablen (beruflicher Wiedereinstieg, finanzielle Kompensationen) ist zu berücksichtigen. Die Ergebnisse stützen die Notwendigkeit einer frühzeitigen psychischen Diagnostik und ggf. rascher differenter Interventionen nach Unfällen. Evaluation einer gruppenbasierten Anwendung von imaginativen Stabilisierungsübungen im Kontext der stationären Psychotherapie von Traumafolgestörungen Wölfelschneider M., Grau A., Schauenburg H. 100 Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg In der Psychotherapie von (komplexen) posttraumatischen Störungsbildern ist die Anwendung imaginativer Techniken in der Stabilisierungsphase der Behandlung verbreitet. Die Patienten sollen sich dabei Möglichkeiten aneignen, sich zu beruhigen und starke Affektzustände zu bewältigen. Die klinische Erfahrung zeigt jedoch, daß die Entwicklung hilfreicher innerer Bilder nicht allen Patienten gleichermaßen gelingt. Wenngleich ein Großteil im Laufe der Behandlung grundsätzlich von der Methode zu profitieren scheint, finden sich sowohl im Hinblick auf die initiale Bereitschaft der Patienten, sich auf imaginative Arbeit einzulassen, als auch bezüglich der Fähigkeit, diese im Verlauf gewinnbringend für sich nutzen zu können, nicht unerhebliche Differenzen. Weiterhin fällt auf, dass bestimmte Elemente etablierter Übungen scheinbar regelhaft besonders gut angenommen werden können, andere von bestimmten Pat. aber sogar als ängstigend und destabilisierend-überwältigend erlebt werden. In dem Beitrag werden erste Daten einer Evaluation zur empirischen Überprüfung dieses klinischen Eindrucks präsentiert. Ziel der Untersuchung ist es, die beschriebenen Patientengruppen zu differenzieren und Prädiktoren für die Wirksamkeit des Verfahrens zu finden. Untersucht wurde ein stationäres Gruppenangebot, das stabilisierende und distanzierende imaginative Elemente in Anlehnung an die Arbeiten von Reddemann und Sachsse verwendet. Typ D Persönlichkeit - ein Risikofaktor für die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung nach herzchirurgischen Eingriffen? 1 2 3 Dannemann S. , Matschke K. , Einsle F. , Zim1 1 1 mermann K. , Weidner K. , Joraschky P. , Köllner 4 V. 1 Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinik, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 2 Herzzentrum Dresden, Klinik für Kardiochirurgie, Universitätsklinikum Dresden, Fetscherstraße 76, 01307 Dresden 3 Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, TU Dresden, Chemnitzer Str. 46, 01062 Dresden 4 Fachklinik für Psychosomatische Medizin, MediClin Blieskastel, Am Spitzenberg, 66440 Blieskastel Typ D (Negative Affektivität | Soziale Inhibition) ist mit einer höheren Ängstlichkeit nach herzchirurgischen Eingriffen verbunden. Zu überprüfen ist, ob Typ D auch ein Risiko für eine posttraumatische Belastungsstörung (PTB) darstellt. 126 Patienten (67,0 ± 8,5 | 75% Männer) wurden vor und sechs Monate nach einem herzchirurgischen Eingriff befragt. 71% erhielten eine Bypass-, 21% eine Herzklappen- und 7% eine kombinierte Operation. PTB und auf die Operation bezogene stressbezogene Symptome wurden mit der Impact of Event Scale (IES-R) erfasst. Typ D- und PTB-Diagnose nach IES–R sind stochastisch unabhängig. Patienten mit Typ D waren aber prä und post stärker durch Hyperarousal belastet (PRÄ Typ D 14.6±8.51, Nicht Typ D=9.78±7.70, p=.002 | POST Typ D 11.1±6.85, Nicht Typ D=7.34±6.59, p=.005). Die Skalen der IES-R korrelierten postoperativ mit Negativer Affektivität rI=.294** | rV=.170 | rH=.485** und Sozialer Inhibition rI=.139 | rV=.114 | rH=.211*. Im Gegensatz zu einer nicht traumatisierten Vergleichsstichprobe sind alle Skalen der IES-R präoperativ signifikant erhöht, postoperativ für Vermeidung und Hyperarousal. In unserer Studie erwies sich Typ D nicht als Risikofaktor für das Vollbild einer PTB nach herzchirurgischen Eingriffen. Allerdings ist Typ-D mit einer stärkeren Belastung durch Symptome von Hyperarousal assoziiert. Es sollte überprüft werden, ob Typ-D für andere Formen einer dysfunktionalen Krankheitsverarbeitung, wie z. B. eine Anpassungsstörung prädisponiert. Gruppentherapie in der psychosomatische Rehabilitation für Frauen mit komplexen Traumafolgestörungen nach sexueller Gewalterfahrung Webendörfer S., Diehl S., Benoit D., Goenner S., Bauder H., Limbacher K. Psychosomatische Fachklinik Bad Dürkheim, Kurbrunnenstraße 11, 67098 Bad Dürkheim Das Behandlungskonzept basiert auf einem kognitiv-verhaltenstherapeutischen Konzept in das psychoedukative Module, Skilltraining aus der DBT sowie körpertherapeutische Elemente integriert wurden. Um die Gruppenakzeptanz und Wirkung zu überprüfen, setzten wir einen von uns entwickelten Fragebogen ein, in dem Gruppenelemente und die durch die Gruppe erzielten Veränderungen durch die Teilnehmerinnen bewertet werden sollten. Im Rahmen einer Therapiestudie wurden „Frauengruppenpatientinnen“ mit Patientinnen, die im Untersuchungszeitraum an einer unspezifischen Gruppentherapie teilnahmen und mit denen im Rahmen der Einzeltherapie ebenfalls Traumatherapie erfolgte (Tau) mittels standardisierter Selbstauskunftsfragbögen verglichen. Überprüft wurde, ob die Patientinnen von der multimodalen Traumatherapie in der Gruppe profitieren. Es wurden Veränderungen im Ausmaß posttraumatischer Symptome, comorbider Störungen und der generellen Befindlichkeit erfasst. In der Prä- Post Messung zeigte sich bei den Patientinnen der Experimentalgruppe eine signifikant stärkere Abnahme posttraumatischer Symptome, traumabezogener negativer Gedanken, dysfunktionaler Bewältigungsstrategien und depressiver Begleitsymptome als in der Kontrollgruppe. Voraussichtlich werden bis zum Vortragszeitpunkt Katamnesedaten vorliegen. Eine Überforderung oder 101 Symptomverstärkung durch die Auseinandersetzung mit den erlebten Traumatisierungen in der Gruppe trat nicht auf. Indikation zur Betrachtung des Schlafes im Posttraumatischen Therapieverlauf 1 2 3 Kleen C. , von Giesen H. J. , Wagner D. , Bering 3 R. 1 Zentrum für Psychotraumatologie, Alexianer Krankenhaus - Maria Hilf GmbH, 47809 Krefeld 2 Zentrum für Psychotraumatologie des AlexianerKrankenhauses Krefeld, Oberdießemerstr. 136, 47805 Krefeld 3 Zentrum für Psychotraumatologie des AlexianerKrankenhauses Krefeld, Oberdießemerstr. 136, 47 805 Krefeld, Deutschland Der gestörte Schlaf ist laut DSM-IV Bestandteil der Diagnose einer PTBS.Uns interessiert die Einflussnahme des Schlafes auf das Therapieoutcome. So wurden 58 Patienten, die stationär mit einer Variante der Mehrdimensionalen Traumatherapie behandelt wurden, mittels strukturierter Anamnese, Fragebogendiagnostik und Polysomnografie somnologisch betrachtet sowie psychometrisch untersucht. Retrospektiv bestanden bei 57% der Probanden bereits vor der Psychotraumatisierung Schlafstörungen; mit der Entwicklung einer PTBS stieg dieser Anteil auf 87% (Kleen et al. 2008). Im Schlaflabor ließen sich in 40% der Fälle organische Schlafstörungen identifizieren. Analog zu früheren Studien (Bering et al., 2003) konnten wir in den allgemeinpsychopathologischen und psychotraumatologischen Symptomskalen Therapieeffekte nachweisen. Im Gegensatz hierzu blieb dieser Effekt im Kontext von Tagesschläfrigkeit (ESS) und Schlafqualität (PSQI) im prä-post Vergleich aus. Wir schlussfolgern: 1. Eine Schlafdiagnostik einschließlich Polysomnografie sollte zur Standarddiagnostik bei schweren Verläufen einer PTBS gehören. 2. Schlafstörungen sind bei der PTBS ätiologisch heterogen und einer zeitlich begrenzten stationären Traumatherapie häufig nicht zugänglich 3. Bestehende organische Schlafstörungen könnten ein Vulnerabilitätsfaktor für die Entstehung einer PTBS sein. Olfaktorische Wahrnehmung bei Frauen mit Kindheitsmisshandlungen 1 1 1 2 Croy I. , Schellong J. , Joraschky P. , Hummel T. 1 Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 2 Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Universitätsklinikum Dresden, Universitätsklinikum Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden Childhood maltreatment (CM) has often been hypothesized to result in functional changes of the limbic system. Because this system has outstanding importance for olfactory processing, we hypothesized an effect on olfactory function in adults with a history of CM. We compared the olfactory processing (psychophysiological techniques, chemosensory event related potentials) of depressive women with a history of CM (N=31) with depressive women without CM (N=28) and healthy women (N=27). Furthermore 13 depressive women with CM and 10 depressive controls participated in an olfactory based fMRI-Study. We found no influence of CM on psychophysiological results and event related potentials. However, there was a significant correlation between current symptoms of PTSD and olfactory function. Following statistical adjustment for depressive symptoms a significant correlation remained between PTSD symptoms and odor identification, N1 latencies and amplitudes in response to the unpleasant trigeminal (CO2) and olfactory (H2S) stimuli. In the fMRIStudy, the CM-group showed more activation in response to olfactory stimuli. This effect was stronger for unpleasant-rated odors. Furthermore the CM-group showed more activation in the posterior cingulate cortex and in the precentral cortex. The results indicate a preferred processing of unpleasant stimuli in patients with PTSD and childhood maltreatment and appear to fit the information dissociation theory in PTSD. Zur differentiellen Ätiologie schizophrener Störungen unter psychotraumatologischen Gesichtspunkten 1 2 Bering R. , Zilinskaite A. 1 Zentrum für Psychotraumatologie des AlexianerKrankenhauses Krefeld, Oberdießemerstr. 136, 47805 Krefeld 2 Zentrum für Psychotraumatologie, Alexianer Krankenhaus - Maria Hilf GmbH, 47809 Krefeld Die folgende Studie wurde durchgeführt, um der Frage nachzugehen, ob Patienten mit einer schizophrenen Störung ein auffälliges psychotraumatologisches Profil in ihrer Vorgeschichte aufweisen. Zu diesem Zweck wurden 36 stationäre Patienten mit einer gesicherten schizophrenen Störung und eine Kontrollgruppe (N=36) auf der Grundlage des Kölner Traumainventar, des Kölner RisikoindexSuizidalität und eines Genogramms verglichen. Über die halbstandardisierten Interviews hinaus wurden ein Fragebogen zum elterlichen Erziehungsverhalten (FEE), die Symptom Checkliste nach Derogatis (SCL-90-R), die Posttraumatic Symptom Scale (PTSS-10) und das Beck Depressions Inventar (BDI) erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass das biographische psychotraumatologische Belastungsprofil bei schizophrenen Störungen (z.B. sexueller Missbrauch, Gewalterfahrung und Zeugenschaft innerfamiliäre Gewalt) signifi- 102 kant überwiegt und mit einer klinischen Stichprobe von Patienten mit einer Borderline Persönlichkeitsstörung vergleichbar ist (Schilles & Bering, 2008). Ebenso besteht eine klinisch relevante psychotraumatologische Symptombelastung. Im Einklang zu bisherigen Ergebnissen aus der Schizophrenieforschung sind das suizidale Risiko, die Häufigkeit von psychischen Erkrankungen in der Familie und die allgemeinpsychopathologische Symptombelastung erhöht. Wir schlussfolgern, dass das Vulnerabilitäts-Stress Konzept schizophrener Störungen um Erkenntnisse aus der Psychotraumatologie ergänzt werden muss. Stationäre und teilstätionäre Psychosomatik Benchmarking in der stationären Verhaltenstherapie psychischer Erkrankungen auf der Basis von Qualitätsbeurteilungen durch Patienten Zielke M. W. Wissenschaftsrat der AHG AG, Helmholtzstr. 17, 40215 Düsseldorf Problemstellung: Vor allen methodischen Erörterungen bei Klinikvergleichen rangiert die Auswahl der Kriterien und der Messinstrumente an erster Stelle. Die Qualitätsbeurteilungen durch Patienten müssen den Gütekriterien psychologischer Messverfahren genügen sowie qualitätsrelevante und handlungsrelevante Merkmale der Therapie erfassen. Es muss empirisch geprüft werden, ob direkte (naive) Vergleiche oder risikoadjustierte Vergleiche zu unterschiedlichen Ergebnissen führen und welche Risikomerkmale dabei zu berücksichtigen sind. Methodik: Auf der Basis des Behandlungsjahrgangs 2007 wurden die Patientenbefragungen von 6.154 stationären Rehabilitationsverläufen aus 7 verhaltensmedizinischen Kliniken verwendet. Das Instrument erfasst die Konzeptqualität, die Servicequalität und die Ergebnisqualität. Es wurden direkte „naive" und risikoadjustierte Vergleiche durchgeführt. Ergebnisse: Das Benchmarking führt zu einer ausreichenden Differenzierung zwischen den Kliniken. Die einzelnen Qualitätsbereiche verteilen sich über die Kliniken nicht uniform. Die Risikoadjustierung wird von den Kliniken als „gerechter" betrachtet. Die Differenzierungen zwischen den Kliniken werden eindeutiger. Diskussion: Qualitätsrelevante Befragungen eignen sich als Grundlage für ein klinisches Benchmarking. Die Positionierungen der Kliniken sind ein fundiertes Arbeitsmaterial, von den Besten zu lernen, wenn die Kriterien und die Auswertungsmethodik von allen Beteiligten akzeptiert werden. Optimierung von Entlassbriefen aus der Psychosomatischen Tagesklinik 1 2 1 Wenzel K. , von Wietersheim J. , Munz D. 1 Abt. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Am Hochstraess 8, 89081 Ulm 2 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Frauensteige 14a, 89075 Ulm Entlassbriefe aus der Klinik sind eines der wichtigsten Kommunikationsmittel zwischen niedergelassenem Arzt und Klinikarzt. Sie dokumentieren die Qualität der Klinikbehandlung nach Außen und müssen eine sachgerechte und kontinuierliche Weiterbehandlung ermöglichen. Kaum untersucht ist bisher, inwieweit diese zeitintensive Dokumentation von den Empfängern genutzt wird und ob die Patienten mit der Weitergabe der persönlichen Daten in dieser Form einverstanden sind.In dieser Studie wurden kooperierende niedergelassene Ärzte und Patienten hinsichtlich ihrer Bewertung von Qualitätsmerkmalen und den inhaltlichen Aspekten der Briefe mit einem Fragebogen befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass mehr als 75% der Ärzte (n=57) die Entlassungsbriefe lesen, die sie für verständlich halten und damit zufrieden sind. Allerdings wünschen sich die meisten einen deutlich kürzeren Brief. Fast alle halten die einzelnen Inhalte für notwendig oder wünschenswert, sind dabei jedoch an der Schilderung des körperlichen Untersuchungsbefundes oder der Arzt-PatientBeziehung weniger interessiert. Nahezu alle Patienten (n=90) gaben an, dass sie ihr Recht auf Einsicht kennen und auch großes Interesse haben, den Brief zu lesen, wobei bisher nur 29% den Brief tatsächlich zu lesen bekamen. Sie bewerten die Verständlichkeit als ausreichend und sind mit den Inhalten weitgehend zufrieden, nicht Wenige aber möchten auf eine Darstellung der Biografie und auf die Darstellung der Lebenssituation verzichten. Veränderungen von emotionalem Erleben und psychopathologischer Belastung im Verlauf stationärer psychodynamischer Psychotherapie 1 1 2 Faber R. G. , Grande T. , Leising D. 1 Klinik für Psychosomatik und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg 2 Institut für Psychologie, Universität Halle-Wittenberg, Brandbergweg 23c, 06120 Halle (Saale) Hintergrund: Emotionen werden als Bewertungsschemata aufgefasst, die die Person über die Relevanz von Ereignissen für ihr eigenes Wohlbefinden informieren, und zugleich der Vorbereitung adaptiver Verhaltensweisen dienen. Klinische Theorien postulieren daher einen Zusammenhang zwischen eingeschränkter Emotionswahrnehmung und dem Auftreten psychopathologischer Beschwerden. Entsprechend wirken viele Psychotherapieformen (u.a. psychodynamische) auf eine 103 Verbesserung der emotionalen Wahrnehmungsund Ausdrucksfähigkeit ihrer Patienten hin. Methode: Vor diesem Hintergrund untersuchten wir 34 Patienten in stationärer Psychotherapie (Hauptdiagnose: überwiegend Depression), und 29 nach Alter und Geschlecht gematchte, psychisch unauffällige Kontrollpersonen. Veränderungen des Emotionserlebens und der emotionalen Expressivität wurden von unabhängigen Ratern anhand von Beziehungsepisodeninterviews eingeschätzt. Gängige Outcome-Maße zur psychischen Belastung (SCL 90-R, IIP-64) wurden ebenfalls im Verlauf erhoben. Ergebnisse: Die Therapie bewirkte deutliche Verbesserungen in beiden Outcome-Maßen. Demgegenüber zeigte sich jedoch sowohl zum Therapiebeginn als auch am Ende ein signifikant intensiveres und variableres Emotionserleben der Patienten im Vergleich zu den Kontrollprobanden. Es fanden sich keine Unterschiede in der emotionalen Expressivität zwischen den Gruppen. Die theoretischen und therapiepraktischen Implikationen dieser unerwarteten Ergebnisse werden diskutiert. Vergleich von stationärem und tagesklinischem psychosomatischen Behandlungssetting 2 1 2 2 Freye T. , Lindenberg T. , Haase M. , Frommer J. 1 toren bennenen zu können, die für die in der Studie vergliechenen Behandlungsformen (Tagesklinik vs. Station) und deren Therapieerfolg prognostisch günstig sind. Pflege psychosomatischer Patienten auf interdisziplinärer Station – Be- oder Entlastung für das Pflegepersonal? Göhler H., Zimmermann-Viehoff F., Deter H., Weber C. Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie, Charité Unversitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin Die Pflege stellt einen zentralen Baustein in der Gesamtbehandlung psychosomatischer Patienten dar. In der Abteilung für Psychosomatik Charité CBF Berlin befinden sich die Patientenbetten auf gemischten interdisziplinären Stationen – eine Herausforderung für die Pflegeteams. Prognostische Relevanz rascher Änderungen der Prozeßdynamik während stationärer Psychotherapie für die Ergebnisqualität in der 1Jahres-Katamnese 1 2 3 Simmich T. , Robitzsch A. , Alisch L. Hochschule Magdeburg-Stendal (FH), Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften, Studiengänge Rehabilitationspsychologie, Osterburger Straße 25, 39576 Stendal Psychosomatische Abteilung der MEDIAN-Klinik Berggießhübel, Gersdorfer Str. 5, 01819 Berggießhübel 2 2 1 Klinik für Psychosomatische Medizin, Universität Magdeburg HU Berlin, Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, Unter den Linden 6, 10099 Berlin Hintergrund:Diese Studie vergleicht das stationäre vs. tagesklinische Setting. Des Weiteren werden Prädiktoren, wie beispielsweise frühe interpersonelle Veränderungen, Komorbidität mit Persönlichkeitsstörungen sowie Variablen, die auf den Therapeuten zurückzuführen sind, untersucht. Methode:Die hierfür verwendete Stichprobe umfasst 300 konsekutiv behandelte Patienten (150 stationär, 150 tagesklinisch). Die Symptomatischen Beschwerden wurden mit der SCL-90-R und die interpersonellen Probleme mittels IIP-C über den Behandlungsverlauf erhoben (Aufnahme, 4Wochen später, Behandlungsende). Ergebnisse:Vorraussichtlich wird die Datenerhebung erst Ende des Jahres abgeschlossen sein. Auf der Grundlage durchgeführter Untersuchungen ähnlicher Studien, werden bis zur Entlassung der Patienten hohe Effektstärken sowie klinisch relevante Verbesserungen im symptomatischen Bereich erwartet. Auch wird angenommen, dass die Quantität der Psychotherapievorerfahrung sowie die Therapeutenvariablen Einfluss auf den Therpieoutcome haben. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse sollen Aufschluss über Variablen geben, die das Outcome von Psychotherapie sowie die Bedeutung interpersonaler Veränderungen während der Therapie beeinflussen. Erhofft wird weiter Patientenfak- 3 TU Dresden Fakultät Erziehungswissenschaften, Weberplatz 5, 01062 Dresden Die Nachhaltigkeit des Behandlungserfolges einer stationären Psychotherapie im psychodynamischen Grundverfahren wird als Konsequenz eines dynamischen psychischen Veränderungsprozesses verstanden. Dabei sind rasche Änderungen der Prozeßdynamik vor allem während krisenhafter Behandlungsepisoden zu erwarten, die hier als besonderes Konfigurationsphänomen mehrerer krisenrelevanter Merkmalsdimensionen operationalisiert wurden. Die vorliegende Pilotstudie schloss 54 stationäre Behandlungsverläufe ein. Die Prozeßdynamik wurde mittels Hauptkomponentenanalyse im Rahmen einer funktionalen Datenanalyse der funktionalen Kovarianzstruktur FDA [1] erkennbar. In einer vorausgegangenen Studie war die prognostische Relevanz klinisch erfasster krisenhafter Behandlungsepisoden für den Behandlungserfolg, operationalisiert als Symptomrückgang bei Behandlungsende gegenüber Behandlungsbeginn, berechnet worden. Die Annahme aus einzelfallorientierten Studien, wonach strukturell stabile Patienten besser respondieren, wenn sie während einer stationären Psychotherapie eine krisenhafte Behandlungsepisode durchlaufen haben, die für sie zur Chance einer Neube- 104 arbeitung von Konfliktmustern wurde, konnte empirisch teilweise bestätigt werden [2]. Ungeklärt blieb die Stabilität der Behandlungsergebnisse der besser respondierenden Teilstichprobe und die Bedeutung meßbarer Änderungen der Prozeßdynamik mittels FDA für den Behandlungserfolg im Katamneseintervall. Die 1-Jahres-Katamnese gibt hierauf erste Antworten. Die Bedeutung der Visite in der Psychosomatischen Medizin Probst S., Mörtl K., von Wietersheim J. Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Frauensteige 14a, 89075 Ulm Als Stichprobe wurden im Jahr 2004 alle 157 psychosomatischen Akut- und Rehabilitationskliniken in Bayern und Baden-Württemberg ausgewählt. Ein Fragebogen mit 25 Items zu Merkmalen der Visite wurde erarbeitet, der von den Visiteführenden auszufüllen war. Von 157 versandten erhielten wir 60 ausgefüllte Fragebögen zurück, davon 38 aus Akut- und 22 aus Rehabilitationskliniken. Die Ergebnisse zeigen, dass das psychosomatische Visitengespräch in den Kliniken durchschnittlich 11 Minuten dauert (im Vergleich zu durchschnittlich 3 Minuten bei somatischen Visiten). 51% der Visiten finden im Zimmer des Patienten statt, zu 73% ist kein Mitpatient anwesend. Der Patient wird durchschnittlich von 4 Personen visitiert. Funktionell geht es in der Visite darum, sich einen Überblick über den Zustand des Patienten zu verschaffen, Therapiefortschritt und -wirksamkeit zu überprüfen. Die teambezogene Funktion der Visite (z.B. Informationsaustausch, Supervision) ist für die befragten Ärzte wenig bedeutsam. Vielmehr geht es um patientenbezogene Faktoren, wie z.B. den Patienten zu ermutigen, zu loben und emotionalen Beistand zu leisten. Inhaltlich werden vor allem soziale und biographische Aspekte angesprochen und psychosomatische Zusammenhänge erläutert. Zwischen den Visiten in Akut- und Rehakliniken finden sich nur geringe Unterschiede: Den Visiteführenden beider Institutionen ist es bedeutsam, den Patienten emotionalen Beistand zu geben, in der Rehabilitation ist dies tendenziell wichtiger. Alexithymie / Emotionsregulation Alexithymie als prognostisches Kriterium für den Behandlungserfolg einer stationären multimodalen psychotherapeutischen Behandlung Leweke F., Stingl M., Bausch S., Leichsenring F. Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Giessen, Paul-Meimberg-Str. 5, 35392 Giessen Fragestellung: Ziel dieser Studie ist zu untersuchen, ob die Alexithymieausprägung zu Beginn einer stationären psychodynamisch orientierten multimodalen Therapie einen Einfluss auf den Behandlungserfolg hat und damit als prognostisches Kriterium herangezogen werden kann. Methode: Bei 480 stationären Patienten mit verschiedenen psychischen Störungen (nach ICD 10) wurde bei Aufnahme und Entlassung die AlexithymieAusprägung (TAS), die globale psychische Belastung (SCL90-GSI) und die Depressivität erfasst. Mittels multipler Regression wurde der prädiktive Wert der Alexithymieausprägung zu Behandlungsbeginn für den Behandlungserfolg bestimmt. Ergebnisse: GSI und Depressivität verringerten sich im Beobachtungszeitraum signifikant. Hohe Alexithymiewerte zu Behandlungsbeginn gingen mit einem signifikant geringeren Behandlungserfolg einher. Insbesondere die Subskala 1 der TAS (Schwierigkeiten bei der Identifikation von Gefühlen) hatte die größte prädiktive Power; hohe Werte in dieser Subskala waren mit geringerer Symptomverbesserung assoziiert. Schlussfolgerungen: Eine hohe initiale Alexithymieausprägung wirkt sich ungünstig auf den stationären Behandlungserfolg einer stationären Psychotherapie aus wofür insbesondere die eingeschränkten Fähigkeiten zur Identifikation von Gefühlen verantwortlich sind. Hieraus ergeben sich wichtige therapeutische Implikationen. Psychophysiologische und subjektive Reaktionsmuster hoch- und niedrigalexithymer Probandinnen während emotionaler Imagination 1 1 2 2 Stingl M. , Bausch S. , Hartmann L. , Stark R. , 1 Leweke F. 1 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Giessen, Paul-Meimberg-Str. 5, 35392 Giessen 2 Abteilung für Klinische und Physiologische Psychologie der Justus-Liebig-Universität Gießen Einleitung: Alexithymie soll mit einer eingeschränkten Vorstellungskraft und Phantasietätigkeit einhergehen. Es wurde untersucht, ob HA und NA emotionale Imaginationen unterschiedlich bewerten und dabei verschiedene peripherphysiologische Reaktionsmuster zeigen. Methode: Bei 20 hoch- und 20 niedrigalexithymen Probandinnen (HA/NA; TAS-20) wurden Hautleitfähigkeit (SCR) und subjektive Bewertungen auf emotionale Imagination (Angst, Freude, Neutral) verglichen. Die Stimuli umfassten standardisierte und individuell erstellten Szenen. Ergebnisse: In beiden Gruppen (HA / NA) unterschied sich die SCR signifikant in Abhängigkeit von der Emotionsqualität (Angst>Freude>Neutral). NA reagierten bei allen individuellen Imaginationen stärker als bei standardisierten Skripten. Während individuelle Angstskripte bei HA ebenfalls stärkere Reaktionsmuster hervorriefen, unterschieden sich dagegen die SCR auf Freude bei individueller und standardisierter 105 Imagination nicht. Subjektiv war die Valenz der einzelnen Emotionsqualitäten für HA und NA gleich, HA (NA: Freude > Neutral) empfanden die freudigen Imaginationen genauso wenig erregend wie die neutralen. Diskussion: Die Untersuchung liefert Hinweise dafür, dass HA zu differenzierter emotionaler Imagination fähig sind. Die verminderten physiologischen Reaktionsmuster zusammen mit den geringeren Erregungseinschätzungen bei den individuellen freudigen Imaginationen bei HA werden im Zusammenhang mit dem Konzept der Anhedonie diskutiert. Angst- und Zwangsstörungen Der Einfluss der Komorbidität auf die Versorgungswege von Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie - Eine qualitative Untersuchung zu Gründen unterschiedlichen Inanspruchnahmeverhaltens 1 2 2 2 Nobis S. , Einsle F. , Dekoy M. , Kotlarski B. , Jo1 2 raschky P. , Wittchen H. 1 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinik Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 2 Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden, Chemnitzer Str. 46, 01187 Dresden Theoretischer Hintergrund: Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie (P&A) gehören zu den „high-utilizern“ des Gesundheitssystems. Wenig bekannt ist, inwieweit eine bestehende psychische Komorbidität den medizinischen und psychotherapeutischen Versorgungsweg beeinflusst. Fragestellung: Geprüft wird, inwieweit sich Patienten mit einer „puren“ P&A von denen mit einer komorbiden Störung unterscheiden. Sowohl Anzahl als auch Art der komorbiden Störung werden berücksichtigt. Methode: 37 Personen mit P&A (ermittelt durch DIA-X inkl. komorbider Diagnosen) wurden mittels halbstandardisierten Interview befragt. Ergebnisse: Die Anzahl der Diagnostika, der Spezialisten und der Behandlungsempfehlungen stieg mit der Anzahl der komorbiden Störungsbilder, jedoch zeigten nicht alle Störungsbilder gleiche Effekte. Eine komorbide somatoforme oder depressive Störung führte zur Erhöhung dieser Variablen, eine komorbide soziale Phobie dagegen nur zur Erhöhung der Behandlungsempfehlungen. Patienten mit komorbider Störung benötigten länger bis zur Aufnahme einer Psychotherapie. Schlussfolgerung: Komorbidität verlängert den medizinischen und psychotherapeutischen Versorgungsweg von Patienten mit P&A. Speziell in der Primärversorgung sollte deren Diagnostik verbessert und berücksichtigt werden. Herzangst bei Allgemeinarztpatienten– Ausprägung und Zusammenhänge mit der Fremdeinschätzung durch Allgemeinmediziner 1 1 1 1 Kühne F. , Bergmann A. , Voigt K. , Bergmann A. , 1 2 Voigt K. , Einsle F. 1 Lehrbereich Allgemeinmedizin/Medizinische Klinik III, Universitätsklinikum der Technischen Universität Dresden, Fetscherstraße 74, 01307 Dresden 2 Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden, Chemnitzer Str. 46, 01187 Dresden Hintergrund: Herzangst kann bei kardiologischen Erkrankungen oder psychischen Störungen, aber auch ohne zugrunde liegende Erkrankungen auftreten. Bisher liegen keine Befunde zur Ausprägung der Herzangst bei Allgemeinarztpatienten vor. Weiterhin ist unklar, mit welchen Konstrukten Herzangst aus Arztsicht assoziiert ist. Methodik: 266 Patienten (56±17 Jahre, 60% F) wurden mittels Herzangstfragebogen untersucht [1]. Als Vergleich dienten Patienten einer anderen Erhebung [2]. Aus Arztsicht wurden Ängstlichkeit, Depressivität, Somatisierung und Psychische Gesamtbelastung mittels VAS erfasst. Ergebnisse: Die Herzangst bei Allgemeinarztpatienten (MW 1,05±0,54) ist signifikant geringer als bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen (MW 1,69±0,59; p < .01) und mit Panikstörung (MW 1,60 ± 0,64; p < .01) sowie tendenziell geringer als bei chronisch Kranken ohne Herzerkrankung (MW 1,11 ± 0,50; p < .10). Der höchste, nur moderate, Zusammenhang liegt zwischen Herzangst (Gesamtwert) und Ängstlichkeit (Arzteinschätzung) (r = .34, p < .01) vor. Schlussfolgerungen: Herzangst liegt bei Allgemeinarztpatienten vor, ist aber geringer ausgeprägt als bei anderen Patientengruppen. Eine Analyse von Subgruppen – z.B. Allgemeinarztpatienten mit kardiologischen Erkrankungen - steht aus. Herzangst ist aus Sicht der Ärzte am Ehesten mit Ängstlichkeit und weniger mit der psychischen Gesamtbelastung assoziiert. Ob sich dieser Befund ebenso bei kardiologischen Patienten findet, ist zu überprüfen. Risikofaktoren komorbider Depression bei Agoraphobie mit oder ohne Panikstörung 1 1 1 Zimmermann K. , Weidner K. , Walther M. , Einsle 2 1 F. , Joraschky P. 1 Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinik Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 2 Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden, Chemnitzer Str. 46, 01187 Dresden Hintergrund: Die psychische Komorbidität von Agoraphobie mit/ ohne Panikstörung gilt nach heutigem Kenntnisstand als gut belegt. Die Risikofaktoren, welche die Entwicklung einer komorbiden Depression begünstigen, fanden bislang jedoch nur unzureichend Berücksichtigung. Ziel der Studie 106 war es daher, Prädiktoren für das Auftreten einer komorbid depressiven Störung bei Agoraphobikern mit/ ohne Panikstörung zu eruieren. Methoden: Im Rahmen dieser explorativen Querschnittsstudie konnten 94 Agoraphobiker (89% mit Panikstörung) hinsichtlich des Auftretens lebenszeitbezogener psychischer Störungen (CIDI) sowie Paniksymptomatik (AKV, PAS), Behavioral inhibition (RSRI) und Trennungsangst (ASA-27) untersucht werden. Ergebnisse: Die Komorbiditätsrate der Depression betrug in dieser Stichprobe 59,6%. Prädiktoren für das Auftreten einer komorbiden Depression waren: weibliches Geschlecht (OR 5,1), geschiedener/verwitweter Familienstand (OR 4,9), Behavioral inhibition (OR 1,1) sowie eine komorbid aufgetretene Soziale Phobie (OR 8,5) oder Generalisierte Angststörung (OR 3,9). Diskussion: Mit Hilfe dieser Untersuchung konnten Risikopatienten für das Auftreten einer komorbid depressiven Störung eruiert werden. Für zukünftige Forschungsvorhaben ist es wichtig die gefundenen Prädiktoren v.a. auch anhand longitudinal angelegter Studien zu replizieren und weitere Risikofaktoren in die Analysen mit einzubeziehen, um diese auf ihren Prädiktorwert für eine komorbide Depression zu untersuchen. Ist der Räusperzwang ein Zwang? Marek A. M. HNO-Psychosomatik Leverkusen, Breidenbachstr. 46, 51373 Leverkusen Einleitung: Globus pharyngeus ist weit verbreitetes Symptom, welches eine unangenehme Missempfindung darstellt. Räuspern ist ein häufig beobachtbares Begleitsymptom. Schätzungen zufolge haben etwa 50% der Allgemeinbevölkerung schon einmal im Leben Globus verspürt. Globus und Räuspern sind viel beklagte Symptome in der Sprechstunde des Allgemeinarztes und des HNOArztes. In der Vergangenheit hat sich der Begriff "Räusperzwang" in die medizinische Literatur eingebürgert, obwohl es sich hierbei um eine terminologische Unschärfe bzw. Fehlbezeichnung handelt. Bindungsforschung Zur Bedeutung des Körpers als Bindungsobjekt, bei traumatisierten Patienten Lohmann K., Damke B., Koechel R., Krause W. Fachklinik für Psychosomatische Medizin Eifelklinik der Deutschen Rentenversicherung Rheinland, Mosenbergstr. 19, 54531 Manderscheid Zur Bedeutung des Körper`s als Bindungsobjekt, bei traumatisierten Patienten. Der Körper in seiner Funktion als Übergangsobjekt und Symbol ist be- kannt. In empirischen Untersuchungen (Lohmann 2007, Damke 2006) zu Bindungsrepräsentanzen von 28 Patienten mit psychosomatischen Störungen, zeigt sich ein sig. hoher Anteil von unsichervermeidenen Bindungsrepräsentanzen und gleichzeitig unverarbeiteten traumatischen Erfahrungen. Fragestellung: Aus dieser Gruppe wird exemplarisch am Beispiel einer Patientin die Frage untersucht, ob Patienten mit unsicher-vermeidenen Bindungsrepräsentanzen und unverarbeiteten traumatischen Erfahrungen von Trennung und körperl. Gewalterfahrung den Körper als Bindungsobjekt besetzen? Methode: Mittels der Inhaltsanalyse des Adult-Attachment-Interview einer Patientin mit der Bindungsklassifikation U/Ds wird die Funktion des Körpers untersucht. Ergebnis: Der Körper hat die Funktion eines Bindungsobjektes, im Sinne eines Vorläufers "precurser". Voraussetzung dafür ist, dass das Bindungsobjekt gleichzeitig als traumatisierendes und abweisendes Objekt repräsentiert ist. Der Körper steht der Patientin als Übergangsobjekt oder Symbol nicht zur Verfügung. Wiederholt traumatisierenden Bindungserfahrungen ermöglichen keine übergangsobjektartigen und protosymbolische Erlebnisformen. Der Körper bildet somit einen Schutz vor den abwesend/traumatisierenden elterlichen Bindungsrepräsentanzen. Keywords: Bindungsobjekt, Bindungtheorie, Psychosomatik Zusammenhänge von Beziehungsgestaltungen der Eltern und der Triadischen Familienallianz in Familien mit Säugling im interkulturellen Vergleich zwischen Deutschland und Chile Schwinn L. Abteilung für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie Universitätsklinikum, Bergheimer Straße 54, 69115 Heidelberg In Familien mit Säugling sind Interaktionsmuster zu finden, die als „Familienallianz“ meist über Jahre hinweg erhalten bleiben. In einer Studie am Institut für psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie der Uniklinik Heidelberg wird die Interaktion im Dreieck Vater, Mutter und Säugling mit dem Lausanne Triadic Play analysiert und darauf einwirkende Einflüsse untersucht. Der Fokus richtet sich dabei auf die Beziehung der Mutter zu ihrer Mutter, ihren Bindungsstil und intrapsychische Mechanismen der Beziehungsgestaltung nach OPD. Diese werden mit den Zweierbeziehungsbögen (aus den Familienbögen), dem ECRR und RQ-2 und OPD-Interviews erhoben. Zusätzlich werden mögliche Zusammenhänge zwischen Regulationsstörungen des Säuglings und der Familienallianz hergestellt. Ziel ist es, die Erkenntnisse über familiäre Interaktion in die ElternSäuglings-Beratung einzubeziehen. Im interkulturellen Vergleich mit Chile werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der triadischen Interakti- 107 on und Zusammenhänge zu den Regulationsstörungen des Säuglings hergestellt. Dargestellt werden Annahmen zu Familienallianzen in Familien mit Säugling, deren Zusammenhänge mit der Beziehungsgestaltung der Mutter und erste Ergebnisse der Studie. Krippenkinder– Seelenkrüppel? Krippenbesuch und Psyche im Erwachsenenalter 1 1 2 3 Berth H. , Balck F. , Förster P. , Brähler E. , Stö3 bel-Richter Y. 1 Medizinische Psychologie Universitätsklinikum Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 2 Forschungsstelle Sozialanalysen, Schweizerbogen 11, 04289 Leipzig Postnatale maternale Deprivationseffekte in adulten Ratten: Interaktion reduzierter Kleinhirnneuronenzahlen und Motorfunktionsleistung mit genetischem Hintergrund 3 3 1 2 Stephan M. , Mugrauer K. , Korr H. , Schmitz C. , 3 4 Gündel H. , von Hörsten S. 1 Abteilung für Anatomie und Zellbiologie, RWTH Universität Aachen 2 School Mental Health and Neuroscience 3 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Str. 1,, 30625 Hannover 4 Franz-Penzoldt-Center, Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg, Palmsanlage 5, 91054 Erlangen Der Phänotyp eines Individuums wird durch eine ständige Interaktion der Erbanlagen mit Umwelteinflüssen determiniert (naturenurtureinteraction). Für die Ausreifung des sich entwickelnden Individuums stellt mütterliche Zuwendung einen der wichtigsten Umgebungseinflüsse dar. Eine Störung der Mutter-Kind-Dyade, tierexperimentell instrumentalisiert als maternale Deprivation, kann zu lange andauernden Effekten auf das ausreifende Individuum führen. So wurden auch sowohl mentale als auch motorische Ausreifungsstörungen bei Kindern in rumänischen Kinderheimen nach Deprivationserfahrungen beschrieben (1). In der vorliegenden Studie wurden die Effekte maternaler Deprivation (MD; im Sinne einer täglichen, zweistündigen Trennung) auf die KleinhirnZell-Dichte sowie die Motorfunktionsleistung (Accelerod-Test) im Erwachsenenalter vor dem genetischen Hintergrund verschiedener Rattenstämmen (Lewis und F344 Ratten) untersucht. Interessanterweise fanden sich signifikante, Deprivationsinduzierte Verschlechterungen der auf dem Accelerod verbrachten Zeit nur in Lewis-Ratten (p<.05), die mit einer signifikanten Verminderung der cerebellaren Granulosazellzahl (Kontrolle:51.8x106 vs. MD: 43.0 x106, p<.05) einhergingen. Die Ergebnisse belegen eine genetische (Prae)Disposition für die Ausprägung frühkindlicher Erfahrungseffekte und zeigen, dass Deprivationserleben tatsächlich zu einer veränderten Plastizität des Gehirns führt, die mit Verhaltensauffälligkeiten einhergehen kann. 3 Selbständige Abteilung für Medizinische Psychologie und Soziologie, Universität Leipzig, Philipp-RosenthalStraße 55, 04103 Leipzig Hintergrund: Einflüsse eines frühkindlichen Kinderkrippenbesuchs auf die Entwicklung werden kontrovers diskutiert. Krippengegner argumentieren, dass die zu frühe Trennung von der Mutter zu negativen psychischen Folgen im späteren Leben führen würde. Methodik: In einer Stichprobe junger ostdeutscher Erwachsenen (N = 383, 54 % weiblich, Alter M 34 Jahre) im Jahr 2007 wurde der Einfluss eines Kinderkrippenbesuchs auf verschiedene, durch Fragebogen erfasste, Indikatoren (u. a. Angst, Depressivität, Körperbeschwerden, Bindung, Zukunftszuversicht, politische und rechtsextreme Einstellungen) geprüft. Ergebnisse: Es finden sich vor allem Geschlechtsunterschiede: Frauen sind meist stärker belastet. Der Krippenbesuch als solcher wirkte sich signifikant nur auf einen der Indikatoren aus: Studienteilnehmer, die nicht in der Krippe waren, fühlen sich durch belastende Lebensereignisse, wie z. B. Armut, bedrohter. Varianzanalysen erbrachten weiterhin einige Interaktionen von Geschlecht und Krippenbesuch. Diskussion: Die Ergebnisse belegen nicht, dass ein Kinderkrippenbesuch einen schädlichen Einfluss auf die Psyche im mittleren Erwachsenenalter hat. Sie zeigen jedoch auch nicht, dass ein Krippenbesuch sich auf die untersuchten Eigenschaften förderlich auswirkt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um den Ausbau der frühkindlichen außerfamiliären Betreuung bedarf es daher differenzierter Untersuchungen, die etwa die Qualität der Kinderbetreuung stärker berücksichtigen. Childhood adversities and suicide attempts Hardt J. Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Mainz, Duisbergweg 6, 55099 Mainz Background: There is some evidence that a variety of childhood adversities are associated with suicide attempts. But many studies used adversity scores or single adversities. The aim of this study was to explore the common effect of 10 risk factors. Method: A total of 575 patients of a psychosomatic clinic and general practitioners were examined by use of questionnaires and a structured interview. Results: Seventeen percent of the sample reported a suicide attempt in the past. In par- 108 ticular, two forms of early violence, i.e., sexual abuse and harsh physical punishment, were associated with an increased risk for suicide attempts (multivariate RR’s = 2.8 and 2.5, respectively). In addition, financial hardship was associated with an increased risk for suicide attempts (RR = 1.8). Parental separation or divorce and physical arguments between parents increased the risk only in a bivariate analysis; after controlling for other adversities, no association with suicide attempts remained. Conclusions: Suicide attempts can be considered as an act of violence against oneself; they are associated with early experiences of sexual and physical violence. Bindungsrelevante Situationen in der Psychotherapie– die Sicht der Patienten Dinger U., Tomanek J., Schauenburg H., Ehrenthal J. C. Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg Die Beziehung zwischen Patient und Therapeut trägt Züge einer Bindungsbeziehung im Sinne der Bindungstheorie, weist aber auch bindungsunabhängige Merkmale auf. Bisherige Untersuchungen zu diesem Zusammenhang berücksichtigen jedoch nicht explizit, dass das Bindungssystem wahrscheinlich vor allem in spezifischen Situationen während einer Behandlung wirksam wird. Ziel der vorliegenden Studie ist daher zu überprüfen, welche Situationen in der Psychotherapie von Patienten als bindungsrelevant wahrgenommen werden. In einem ersten Teil wurden zunächst halbstandardisierte Interviews mit Patienten in stationärer Psychotherapie geführt, um bindungsrelevante Situationen mit ihrem Therapeuten zu identifizieren. Daraus wurden standardisierte Beschreibungen von therapeutischen Situationen in Vignettenform entwickelt und unabhängigen Experten vorgelegt. In der folgenden Evaluation einer Auswahl der Vignetten in einer zweiten Patientenstichprobe wurde die Bindungsrelevanz der ausgewählten therapeutischen Situationen bestätigt. Weiter wurde überprüft, inwiefern die emotionalen Reaktionen der Patienten auf die geschilderten therapeutischen Situationen mit ihrem eigenen Bindungsstil assoziiert waren. Die Studie liefert Hinweise darauf, dass der Therapeut als Bindungsfigur tatsächlich ein wichtiges Merkmal der therapeutischen Beziehung ist. In guten wie in schlechten Zeiten? Eine qualitative Analyse bindungsrelevanter Situationen in der Psychotherapie Tomanek J., Dinger U., Schauenburg H., Ehrenthal J. C. Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg Obwohl im Kontext der klinischen Bindungsforschung viele einleuchtende Hypothesen dazu entwickelt wurden, warum und wie innere Arbeitsmodelle von Bindung Auswirkungen auf Prozess und Erfolg einer psychotherapeutischen Behandlung haben könnten, ist die empirische Befundlage uneindeutig. Insbesondere gibt es kaum Studien dazu, wann das Bindungssystem im therapeutischen Kontext aktiviert wird, und was für spezifische Affekte, Kognitionen und Wünsche dadurch entstehen. Die Frage nach der situativen Aktivierung scheint jedoch sowohl aus bindungstheoretischen Überlegungen heraus als auch vor dem Hintergrund z.B. der Rupture-repair-Forschung bedeutsam. Im Rahmen einer weiterführenden Untersuchung wurden zu diesem Thema halbstandardisierte Interviews mit 40 PatientInnen in stationärer psychotherapeutischer Behandlung geführt und qualitativ ausgewertet. Auslöser für als bindungsrelevant erlebte Situationen bezogen sich einerseits auf äußere Ereignisse (z.B. Trennung, Todesfall, Arbeitsplatzkonflikt), aber auch therapiebezogene Erlebnisse (z.B. Therapiebeginn/-ende, Verfahrenswechsel, Interventionstechnik, Öffnungsbereitschaft) und gingen mit spezifischen Affekten und Wünschen an den Therapeuten einher. Die Ergebnisse werden mit im Fragebogen (RQ-2) erhobenen bindungsbezogenen Selbsteinschätzungen diskutiert und in ein übergreifendes Modell zur Bindungsaktivation in psychotherapeutischen Beziehungen eingeordnet. Eltern-Kind-Beziehungen und Suizidversuche: Eine retrospektive Studie Hardt J., Fischbeck S., Laubach W. Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Mainz, Duisbergweg 6, 55099 Mainz Hohe Prävalenzraten von Suiziden weisen auf die Notwendigkeit von Präventionsmassnahmen hin. Neben unmittelbaren Risikofaktoren (z.B. Vorliegen aktueller psychischer Erkrankungen, Verfügbarkeit von Waffen, Gewalt in Medien) erscheinen für die Prävention insbesondere frühe Erfahrungen rele-vant. In diesem Zusammenhang wurden bisher vorwiegend manifeste Kindheitserlebnisse untersucht. Die vorliegende Arbeit fokussiert auf einem wenig beachteten Aspekt, den Eltern-KindBeziehungen in der Ursprungsfamilie. In einer Stichprobe von 500 Patienten wurden hierzu retrospektiv die Eltern-Kind-Beziehungen und die Lebenszeitprävalenzen von Suizidversuchen erfasst. 109 Die Auswertung der Daten erfolgte mittels logistischer Regressionen, in denen neben Haupteffekten auch Interaktionsterme getestet wurden. Als Ergebnis zeigen sich zwei hochsignifikante Interaktionseffekte. Hohe mütterliche Kontrolle und wenig Liebe sind mit einem deutlich erhöhten Risiko für Suizidversuche assoziiert, ebenfalls hohe mütterliche Kontrolle und Rollenumkehr. Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass frühe Beziehungserfahrungen einen wesentlichen Risikofaktor für Suizidversuche darstellen. Konsil- und Liaisondienst Literaturüberblick zu familiären Konsequenzen erblicher Erkrankungen 1 2 2 Dinkel A. , Berth H. , Balck F. 1 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, KLinikum rechts der Isar der TU München, langerstrasse 3, 81675 München 2 Medizinische Psychologie Universitätsklinikum Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden Dissoziative Störungen Gruppentherapie bei Patientinnen und Patienten mit dissoziativen Störungen - Was ist möglich und wirksam? Wirtz G., Helfricht S., Esser U., Frommberger U. MediClin Klinik an der Lindenhöhe, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Bertha-von-Suttner Str. 1, 77654 Offenburg Gruppentherapien bei Patientinnen mit dissoziativen Störungen sind umstritten. Das Hauptgegenargument wird im Wesen der Grundproblematik gesehen. Von uns wurde ein offenes Konzept zur ambulanten Gruppenbehandlung entworfen. Es wurden Patientinnen mit PTSD, DDNOS oder DID in zwei Gruppen eingeteilt. Initial wurden CTQ, PDS, FDS und BSI gemessen, das Erleben von Veränderung wurde mit dem VEV erfasst, nach Abschluss der 10 Gruppensitzungen erfolgte eine Postmessung mit den Eingangsinstrumenten. Die Sitzungen folgten einer thematischen Strukturierung mit Stabilisierungs- und psychoedukativen Elementen sowie der Erarbeitung von positiven Aktivitäten im Alltag und Ressourcenaktivierung. Vor und nach den einzelnen Sitzungen wurden Stimmung, Gedanken, Körpersymptome, dissoziative Symptome und das allgemeine Empfinden erfragt. Außerdem wurde ein Wochenprotokoll ausgegeben. Zwischenzeitlich wurde das Konzept an Folgegruppen überprüft. Die Gruppen wurden als „Minigruppen“ mit maximal vier Teilnehmern geführt, um eine möglichst geringe Belastung und eine konstante Gruppenteilnahme zu erreichen. Aufgrund der resultierenden Teilnehmerzahl von 16 erfolgen Einzelfallbeschreibungen. Dabei zeigen sich unterschiedliche Veränderungen in den PräPost-Messungen, aber bei der Mehrheit der Teilnehmer eine deutliche Besserung der subjektiven Befindlichkeit nach den Gruppensitzungen und im Verlauf aller Sitzungen. Als Hauptwirkfaktor scheint das „Getragensein“ in der Gruppe grosse Bedeutung zu haben. Hintergrund: Erbliche Erkrankungen bedingen notwendigerweise eine familiäre Sichtweise. Im Rahmen des Beitrags soll der Frage nach den Auswirkungen erblicher Erkrankungen auf Partnerschaft und Familie nachgegangen werden. Methode: Wir führten eine Literaturrecherche in den gängigen Datenbanken durch. Ferner wurden Referenzlisten relevanter Artikel geprüft. Ergebnisse: Es zeigte sich, dass empirische Ergebnisse vor allem für Chorea Huntington vorliegen, gefolgt von erblichem Brust- und Darmkrebs. Für andere erbliche Erkrankungen, z.B. Hämophilie oder Cystische Fibrose, liegen weit weniger Studien zu familiären Konsequenzen vor. Als dominierende Themen lassen sich in erster Linie folgende Bereiche identifizieren: familiäre Kommunikation über die Erkrankung oder über die Ergebnisse genetischer Untersuchungen; psychische Befindlichkeit und Lebensqualität der Partner und Familienmitglieder nach Ausbruch der Erkrankung oder nach der Durchführung einer genetischen Beratung/Testung; Veränderungen im Familiensystem; Aufwachsen in einer Familie mit einer erblichen Erkrankung; Auswirkungen auf Reproduktionsentscheidungen. Es fällt auf, dass ein Großteil der Studien einen qualitativen Ansatz verfolgt. Diskussion: Erbliche Erkrankungen haben weitreichende familiäre Konsequenzen. Die empirische Datenlage ist für einige Erkrankungen jedoch recht dünn, und viele Studien haben eher explorativen Charakter. Psychoedukatives Bewältigungstraining für Patienten mit Multipler Sklerose (MS): Entwicklung und Evaluation 1 2 3 4 Klauer T. , Apel-Neu A. , Faiss J. , Hoffmann F. , 5 3 4 5 Köhler W. , Kunkel A. , Lippert J. , Martin E. , 5 2 6 2 Schilling H. , Tiffert C. , Voigt K. , Zettl U. K. 1 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin der Universität Rostock, Gehlsheimer Str. 20, 18147 Rostock 2 Klinik und Poliklinik für Neurologie der Universität Rostock, Gehslheimer Str. 20, 18147 Rostock 3 Klinik für Neurologie und Neurophysiologie, AsklepiosFachklinikum Teupitz, Buchholzer Str. 21, 15755 Teupitz 4 Klinik für Neurologie, Krankenhaus Martha-Maria HalleDölau, Röntgenstr. 1, 06120 Halle (Saale) 110 5 Klinik für Neurologie und neurologische Intensivmedizin, Fachkrankenhaus Hubertusburg 6 Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin, Zentrum für Nervenheilkunde, Universität Rostock, Gehlsheimer Strasse 20, 18147 Rostock Entwicklung und erste Schritte der Evaluation des Psychoedukativen Trainings für Patienten mit Multipler Sklerose (PTMS) werden vorgestellt. Im Anschluss an eine Beschreibung des PTMSProgramms, welches zwölf wöchentliche Gruppensitzungen umfasst und auf die Vermittlung krankheitsbezogenen Wissens und die Förderung von Bewältigungsfertigkeiten abzielt, werden Befunde aus einer ersten multizentrischen, randomisierten Evaluationsstudie dargestellt. Je 27 MS-Patienten aus einer PTMS-Trainingsgruppe sowie einer Kontrollgruppe, die während des Trainingszeitraums psychoedukative Literatur rezipierte, wurden in dieser Studie im Hinblick auf depressive Symptome, Lebensqualität, Bewältigungsverhalten, Fatigue, krankheitsspezifische Selbstwirksamkeit und soziale Unterstützung verglichen. Die Befunde zeigen positive Interventionseffekte in den meisten Ergebnisvariablen, verweisen aber auch auf differentielle Effekte des Programms auf Depression und Bewältigungsverhalten: Die PTMS-Gruppe verbesserte sich im Hinblick auf diese Kriterien stärker als die Kontrollgruppe. Im Anschluss an eine knappe Skizze erster katamnestischer Befunde werden methodische Beschränkungen der Studie, Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung des Programms sowie Implikationen für die medizinische und psychologische Versorgung von MS-Patienten diskutiert. einer retrospektiven Fragebogen basierten Untersuchung wurden sämtliche Patienten die sich in den letzten 24 Monaten mit Zustand nach Reaktion auf LA in der Universitäts-Hautklinik vorgestellt haben untersucht. Der Rücklauf der Fragebögen betrug 50 %. Die Kontrollgruppe wurde aus Patienten rekrutiert, die bei einer zahnmedizinischen Maßnahme keine Reaktion auf das LA zeigten. 35 Patienten konnten mit 35 Kontrollen verglichen werden. Erfasst wurden Somatisierung (SOMS-2), Angst (STAI), Depressivität und Stress (PHQ). Patienten und Kontrollen unterscheiden sich nicht bezüglich Stress, Somatisierung und Depressivität. Hinsichtlich der Angst gab es einen statistisch signifikanten Unterschied in der Trait-Variable: Patienten, die im Rahmen einer LA-Gabe eine körperliche Reaktion gezeigt hatten, beschreiben mehr „Angst als Eigenschaft“. Angst kann als ein wichtiger Faktor im Rahmen von körperlichen Reaktionen auf LA-Gabe gesehen werden. Dies wurde in dieser Untersuchung erstmals standardisiert erfasst. Weitere prospektive Untersuchungen müssen folgen, damit Strategien für die Praxis erarbeitet werden können. Curriculum Konsiliar- und Liaisondienst 1 2 3 3 Larisch A. , Fritzsche K. , Stein B. , Söllner W. 1 Klinik für Neurologie, Rudolf.Bultmann-Str. 8, 35039 Marburg 2 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Freiburg, Hauptstr. 8, 79104 Freiburg 3 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin, Klinikumk Nürnberg Die Angst vor der Spritze - psychosomatische Charakterisierung von Patienten mit unklaren Reaktionen auf Lokalanästhetika-Gabe 1 2 2 Teufel M. , Fischer J. , Biedermann T. , Glatzel 3 3 1 1 4 C. , Giel K. , Enck P. , Zipfel S. , Fischer J. 1 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen, Silcherstraße 5, 72076 Tübingen 2 Universitäts-Hautklinik Tübingen 3 Abt. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Klinik, Universitätsklinikum Tübingen, Osianderstr 5, 72076 Tübingen 4 Universitäts-Hautklinik, Liebermeisterstr. 25, 72076 Tübingen Lediglich 0,5-1% der Zwischenfälle im Zusammenhang mit einer Lokalanästhesie (LA) können einer allergischen Reaktion zugeschrieben werden. Eine Testung erbringt aus allergologischer Sicht zumeist keine auffälligen Befunde. Als Auslöser der Reaktion werden psychogene Faktoren in Kombination mit vasovagaler Reaktion angenommen, sind jedoch noch nicht systematisch untersucht. In Einleitung: Erstmalig wurde im Mai 2008 in Freiburg ein Curriculum Konsiliar- und Liaisondienst von der AG Konsiliar-Liaison-Psychosomatik des DKPM, der DGPM und der AG Konsiliarpsychiatrie der DGPPN gemeinsam angeboten. Das Curriculum richtet sich an Ärzte in Weiterbildung zum Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie bzw. zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie an Ärzte mit der Zusatzweiterbildung Psychotherapie und an Psychologen mit klinischer Tätigkeit. Methodik: Zu den Lernzielen gehört die Befähigung zur Arbeit im psychologischen, psychiatrischen, psychosomatischen, psychosozialen oder psychotherapeutischen Konsiliarund Liaisondienst (Diagnostik, therapeutische Interventionen, Kooperation) und Aspekte der Qualitätssicherung. Die Kompetenzen wurden in einer Mischung aus Kurzvorträgen, Rollenspielen, Hospitationen und Fallsupervisionen vermittelt. Auf Praxiserfahrungen der Teilnehmer wurde explizit eingegangen. Ergebnisse: Überraschend setze sich der erste Kurs aus 20 zum Teil sehr erfahrenen Kollegen mit abgeschlossener Facharztausbildung bzw. Approbation zusammen, die überwiegend bereits im Konsiliar- und Liaisondienst arbei- 111 teten. Das Curriculum wurde von den Teilnehmern sehr positiv evaluiert: Sie schätzten besonders den praxisorientierten Ansatz sowie die konsilspezifischen Beiträge der verschiedenen Dozenten. Der positive Start ermutigt zur Weiterführung. Das nächste Curriculum findet im Juni 2009 in Dresden statt. Erforschung musiktherapeutischer Praxis in der Psychosomatik– Genealogie eines qualitativen Ansatzes zur Musiktherapieforschung 1 2 Sembdner M. , Frommer J. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Magdeburg, Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg 2 Klinik für Psychosomatische Medizin, Universität Magdeburg, Aktive und depressive Krankheitsverarbeitung als Prädiktoren der Überlebenszeit nach operativer Entfernung der Harnblase 1 1 2 Hardt J. , Schneider S. , Gillitzer R. 1 Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Mainz, Duisbergweg 6, 55099 Mainz 2 Urologische Klinik, Langenbeckstr.1, 55101 Mainz Die Diagnose eines Harnblasenkarzinoms mit der Notwendigkeit der operativen Entfernung der Harnblase stellt eine außerordentliche psychische Belastung dar. Aus den vielen möglichen Alternativen zur Bewältigung einer solchen Situation wurden insbesondere zwei Gruppen untersucht, dass ist die aktive Krankheitsverarbeitung und die depressive Krankheitsverarbeitung. Ein Patient mit überwie-gend aktiver Krankheitsverarbeitung reagiert in einer solchen Situation derart, dass er zunächst Infor-mationen über die Erkrankung und die Behandlung sucht – beispielsweise den Arzt fragt, sich ein Buch kauft, ins Internet schaut, sich einer Selbsthilfegruppen anschließt etc. Weiterhin ist eine aktive Bewältigung durch geplantes und strukturiertes Verhalten gekennzeichnet. Im Vordergrund steht hier eine Einstellung es mit der Erkrankung aufzunehmen, gegen die Probleme anzukämpfen. Depressive Verarbeitung stellt in gewisser Weise das Gegenteil dar. Ein Patient mit überwiegend depressiver Krankheitserarbeitung reagiert mit Selbstmitleid, Rückzug von anderen Menschen, Grübeln, Suche nach dem Sinn in der Erkrankung. Psychologisch kann man dieses Verhalten dadurch erklären, dass nicht die unmittelbare Problembewältigung im Vordergrund steht, sondern die Bewältigung der negativen Gefühle. Es werden Ergebnisse vorgestellt, in der die Entwicklung der Lebensqualität bei 81 Tumorpatienten nach der Operation mit der Krankheitsverarbeitung vor OP in Beziehung gesetzt wird. Kreativverfahren in der Psychotherapie In musiktherapeutischen Behandlungswerken werden verdrängte Emotionen, Gedanken und Verhaltensmuster für Patient und Therapeut sichtbar und unangenehme Emotionen und Erlebnisprozesse verwandeln sich im Zusammenspiel von musiktherapeutischer Improvisation und Gespräch in dieser Therapieform in angenehmere Emotionen und Erlebnisprozesse. Dieser therapeutische Prozess kann in der 1992 durch Langenberg, Frommer und Tress erstmalig beschriebenen Methode der Qualitativen Methodik zur Beschreibung und Interpretation musiktherapeutischer Behandlungswerke erfasst werden. Ziel des Vortrages wird es sein, einen Überblick über die in den vergangenen 16 Jahren vorgenommenen Entwicklungen, Verfeinerungen und Ergänzungen zu geben sowie einen Ausblick auf geplante Modifikationen vorzustellen. Im Ergebnis lässt sich zeigen, dass durch das Medium Musik un- oder vorbewusst erlebte Emotionen früher erreicht werden können, als dies auf verbaler Ebene möglich ist. Dafür bietet der therapeutische Spielraum einen Übergangsraum, um schöpferisch handelnd Dialog zu erleben und Konflikte zu bewerkstelligen. Mentalisierung Dialectic Mentalization Based Therapy for severe Somatoform disorders (D-MBT-S) Bühring M. E. Eikenboom, Center for Psychosomatic Medicine, Oude Arnhemse Weg, NL 3705 BK Zeist, Niederlande Eikenboom, Center for Psychosomatic Medicine in Zeist, The Netherlands, is a tertiary referral clinic for severe and chronic somatoform disorders. Patients have been treated extensively but usually unsuccessful before being referred to our Center. Cognitive Behaviour Therapy, which is often used for patients with Somatically Unexplained Physical Symptoms (SUPS) is not always sufficiently effective for very complex patients. It can be important to broaden the therapeutic perspectives for these patients. This poster presents a transdiagnostic explanation model in which impaired mentalization of primary representations of the body (bodymentalization) plays a central role next to the following factors: 1) problematic attention and per- 112 ception; 2) low acceptation of symptoms and the restrictions they imply; and 3) negative systemic influences. A body-mentalization based treatment for severe variants of SUPS is described. In Dutch we call this model MAMS (Mentalization, Acceptation, Modulation, Systemic Work). In this multimodal therapy the dialectics between change and acceptation, individual and group, fixed structures and organic development is a starting point. This is why the therapy is called: Dialectic Mentalization Based Therapy for severe Somatoform disorders (D-MBTS). This integrative multi-modal approach improves quality of live significantly. It has shown to decrease psychopathology and medical costs. Psychische Realität, reflexive Kompetemz und Problemverhalten im Vorschulalter Juen F. Institut für Psychologie, Universität Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Österreich Die MacArthur Story Stem Battery (MSSB) hat sich in den letzten Jahren zunehmend als Methode bewährt, mit der es gelingt Zugang zur Innenwelt von Kindern zu bekommen. Dabei werden den Kindern konflikthafte Geschichtsanfänge erzählt und präsentiert, die sie weitererzählen und mit Hilfe von Spielfiguren weiterspielen sollen. Dadurch sollte es möglich sein das Verständnis über die Zusammenhänge von psychischen Problemen, kindlichem Problemverhalten sowie Repräsentanz und psychischer Struktur zu vertiefen. In der vorgestellten Untersuchung soll der Frage nachgegangen werden, wie man die Auswertung der erzählten Geschichten modifizieren kann, um Informationen über die zugrunde liegende psychische Struktur von Kindern im Vorschulalter zu bekommen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Erfassung des reflexiven Emotionsverständnisses von Vorschulkindern. Dazu haben wir bei einzelnen Geschichten so genannte „Demand Fragen“ gestellt, die einerseits auf das Erkennen emotionaler Zustände von Figuren im Spiel fokussierten andererseits auf das Erkennen von Handlungsintentionen. Der Zugang zum mentalen System zeigt sich in den Ergebnissen besonders protektiv für kindliches Problemverhalten, das wir per Fragebögen erfasst haben, was darauf hindeutet, dass ein Verständnis mentaler Zustände (Gefühle, Intentionen,…) eine zentrale Fähigkeit darstellt, mit der es dem Kind gelingt Handlungen zu steuern, mit Belastungen umzugehen und gemachte Erfahrungen in seine psychische Welt zu integrieren. Wie können Mentalisierungsstörungen und pathogene Überzeugungen wirksam behandelt werden? Die geplante Einzelfallstudie der Single Case Psychotherapy Research Group Frankfurt (SCPRGF) 1 2 3 Sammet I. , Kirsch H. , Brockmann J. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Tübingen, Osianderstr. 5, 72076 Tübingen 2 Evangelische Fachhochschule Darmstadt, Zweifalltorweg 12, 64293 Darmstadt 3 Private Psychotherapiepraxis, Frankfurt, Egenolffstr. 29, 60316 Frankfurt Hintergrund: Das Konzept der Mentalisierung (Fonagy 1998, 2004, Busch 2008) stellt einen elaborierten entwicklungs- und bindungstheoretischen Ansatz der Pathogenese psychischer Störungen dar. Die Control-Mastery Theorie (Weiss 1986, 1993; Silberschatz 2005) liefert hingegen ein empirisch abgesichertes Modell zur psychoanalytischpsychodynamischen Behandlungstechnik. Zielsetzung: Die Wirksamkeit therapeutischer Interventionen soll unter dem Blickwinkel beider Theorien untersucht werden. Hypothesen: Interventionen, die unbewusste pathogene Überzeugungen entkräften und/oder Mentalisierungsfähigkeit fördern, führen zu positiven Immediateffekten und zu einer Verbesserung der therapeutischen Beziehung. Zwischen pathogenen Überzeugungen und Mentalisierungsdefiziten besteht ein bedeutsamer Zusammenhang. Methodik: Je 40 Therapiestunden zweier psychoanalytischer Langzeittherapien von Patienten mit unterschiedlichen Anteilen struktureller Störung gemäß OPD-2 werden mikroprozessanalytisch untersucht. Zur Anwendung kommen einzelfallanalytische Methoden der San Francisco Psychotherapy Research Group. Im Ratingverfahren werden Mentalisierungsdefizite und pathogene Überzeugungen sowie therapeutische Interventionen eingeschätzt. Als Beurteiler fungieren Mitglieder der Single Case Psychotherapy Research Group Frankfurt (SCPRGF), die dazu seit 2006 7 Workshops durchgeführt hat. Dargestellt wird das einzelfallanalytische Vorgehen zur Erfassung von Mentalisierung und pathogenen Überzeugungen. Psychometrie / Diagnostik NGCS/ELAN– Coding movement behaviour in psychotherapy 1 2 Lausberg H. , Sloetjes H. 1 Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena, Stoystr. 3, 07740 Jena 2 Max Planck Institute for Psycholinguistics, Wundtlaan 1, 6525 XD Nijmegen, Niederlande 113 Individual and interactive movement behaviour (non-verbal behaviour / communication) specifically reflects implicit processes in psychotherapy . However, thus far, the registration of movement behaviour has been a methodological challenge. We will present a coding system combined with an annotation tool for the analysis of movement behaviour during psychotherapy interviews. The NGCS coding system enables to classify body movements based on their kinetic features alone. The theoretical assumption behind the NGCS is that its main kinetic and functional movement categories are differentially associated with specific psychological functions and thus, have different neurobiological correlates. ELAN is a multimodal annotation tool for digital video media. The NGCS / ELAN template enables to link any movie to the same coding system and to have different raters independently work on the same file. The potential of movement behaviour analysis as an objective tool for psychotherapy research and for supervision in the psychosomatic practice is discussed by giving examples of the NGCS/ELAN analyses of psychotherapy sessions. While the quality of kinetic turn-taking and the therapist’s (implicit) adoption of the patient’s movements may predict therapy outcome, changes in the patient’s movement behaviour pattern may indicate changes in cognitive concepts and emotional states and thus, may help to identify therapeutically relevant processes. Wie können Veränderungen von Angst und Depressivität reliabel erfasst werden? 1 1 2 Hinz A. , Zenger M. , Kittel J. 1 Universität Leipzig, Abteilung für Medizinische Psychologie und Soziologie, Philipp-Rosenthal-Str. 55, 04301 Leipzig 2 Institut für Rehabilitationsforschung, Norderney, Holthauser Talstr. 2, 58256 Ennepetal Um die Wirkung medizinischer oder psychotherapeutischer Maßnahmen auf Erleben und Verhalten von Patienten zu analysieren, sind änderungssensitive Fragebögen erforderlich. Die Kriterien der Änderungssensitivität, welche man in der Literatur findet, drücken vorrangig Änderungen auf der Ebene der Stichprobenmittelwerte aus. Offen bleibt damit, wie präzise individuelle Änderungen erfasst werden können. Änderungsmessungen von Angst und Depressivität mit der Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) werden anhand zweier Stichproben vorgestellt: kardiologische Rehabilitanden (n=2695) und Krebspatienten (n=901). Die Standardized Effect Size vermag Änderungen im Stichprobenmittel gut auszudrücken. Um jedoch die Reliabilität individueller Änderungen zu bestimmen, ist ein anderer Ansatz nötig, der hier vorgestellt wird. Dieser überträgt das Prinzip der inneren Konsistenz von der Zustandsmessung auf die Messung von Veränderungen. Dieses Prinzip wird anschaulich erläutert und beispielhaft durchgerechnet. Beziehungen dieser neuen Form der Änderungsreliabilität zu den klassischen ÄnderungsKennwerten, zur Trennschärfe und zur TestRetest-Reliabilität werden aufgezeigt. Mit Koeffizienten um 0.70 kann der HADS eine akzeptable Änderungsreliabilität bescheinigt werden. Analyse der Skalenstruktur des IIP-C an einer psychiatrischen Stichprobe: Das IIP mit vier Skalen? 1 1 2 2 Jäger S. , Franke G. H. , Tögel C. , Schütt A. 1 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH), Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften, Studiengänge Rehabilitationspsychologie, Osterburger Straße 25, 39576 Stendal 2 Salus Institut für Trendforschung und Therapieevaluation in Mental Health, Seepark 5, 39116 Magdeburg Einleitung: Das IIP-C (Horowitz et al., 2002) wird häufig zur Status- und Prozessdiagnostik im Rahmen von Psychotherapie eingesetzt. Eine Optimierung des Verfahrens erscheint daher zweckmäßig. Methode: Skalenstruktur und Itemkennwerte des IIP-C werden analysiert. Ergebnisse: Untersucht werden insgesamt N=1016 psychiatrische Patienten der Sucht- (n=428) und der Psychosomatikstationen (n=587) der SALUS Kliniken Bernburg und Uchtspringe, die von Mitte 2004 bis Mitte 2008 stationär aufgenommen waren. Das durchschnittliche Alter der Patienten beträgt 37 Jahre. Männer und Frauen sind in der Gesamtstichprobe gleichermaßen vertreten. Die Patienten verblieben durchschnittlich 66.5 Tage in der Einrichtung und die häufigsten psychischen Diagnosen waren eine depressive Episode sowie kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen. Eine Überprüfung der internen Konsistenz der Originalskalen ergibt befriedigende (NO r=0.70) bis gute (HI r=0.88) Kennwerte. Faktorenanalytisch kann die Skalenstruktur des Verfahrens nicht bestätigt werden. Eine vier-Faktoren Lösung mit 44% Varianzaufklärung ist auf Grund des Eigenwerteverlaufes zu präferieren. Vier neue Skalen mit einer guten internen Konsistenz von 0.80 (Skala 4) bis 0.91 (Skala 1) werden konstruiert. Diskussion: Die Verkürzung des IIP-C auf 48 Items wird inhaltlich diskutiert; Probleme im Bereich zu introvertiert/ vermeidend stehen im Mittelpunkt. Der Schwerpunkt liegt auf der Reduktion der acht Originalfaktoren auf vier neue Faktoren. Die deutsche Version des Measure of Attachment Qualities (MAQ-D): Erste Befunde zu den psychometrischen Gütekriterien Hackelöer A., Löwe B., Spitzer C. 114 Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE), Gebäude Ost 59 (O 59), Martinistr. 52, 20246 Hamburg Für die Erfassung von Bindungsqualitäten bei Erwachsenen wurden bisher vergleichsweise lange Verfahren konstruiert. Anwendungsökonomische und kurze Erhebungsinstrumente, wie das aus 14 Items bestehende Measure of Attachment Qualities (MAQ-D) gewinnen in der psychosomatischen und psychologischen Diagnostik und Forschung zunehmend an Bedeutung. Mit Hilfe des MAQ-D erfolgt die Erfassung des präferierten Bindungsstil eines Erwachsenen auf den Dimensionen Sicherheit, Vermeidung, Ambivalenz-Besorgnis und Ambivalenz-Fusion, denen jeweils drei bzw. fünf Items zugeordnet sind, die auf einer vierstufigen LikertSkala zu beantworten sind. Die deutsche Version des MAQ-D wurde an einer Gesamtstichprobe (N = 769) psychometrisch evaluiert, die Studenten (N = 369), nicht-klinische Probanden (N = 261) und ambulanten bzw. teilstationären psychiatrischpsychotherapeutische Patienten (N = 139) umfasste. Zudem wurde das Inventar zur Erfassung interpersonaler Probleme (IIP-C), die deutsche Version des Experiences in Close Relationship - revised (ECR-R), das Brief Symptom Inventory 18 (BSI-18) und das Relationship Questionnaire (RQ-2) vorgegeben. Neben einer ausreichenden Trennschärfe der einzelnen Items sowie mäßigen internen Konsistenz, ergab unsere Studie gute Werte zur konvergenten Validität und Retestreliabilität. Des Weiteren ließen sich die vier Subskalen mit Hilfe einer explorativen Faktorenanalyse replizieren. Wir diskutieren unsere Befunde hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten des MAQ-D. Entwicklung eines kurzen Fragebogens zur Spiritualität Hardt J. Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Mainz, Duisbergweg 6, 55099 Mainz Fragestellung: Moderne Medizin wird zwar unwidersprochen immer besser, jedoch nicht unbedingt beliebter bei den Patienten. Die Kritik lautet, dass wir Krankheiten behandeln und nicht Menschen, wir entwickeln uns zum Gesundheitstechniker. Patienten müssen sich mit der gesamten Lebenswirklichkeit um ihre Erkrankung auseinander setzten, Spiritualität ist dabei für viele nicht nur bei lebensbedrohenden Erkrankungen ein wichtiger Bereich. Methode: Es wurde eine Befragung an 375 Studenten und 500 Probanden per Internet durchgeführt. Ergebnisse: Faktorenanalytisch konnten vier Dimensionen der Spiritualität entwickelt werden: (1) Glaube an Gott, (2) Sinnsuche, (3) Altruismus und (4) Geborgenheit in der Welt. Diese wurden in der zweiten Stichprobe kreuzvalidiert. Jede der Dimensionen wird mittels 5 Items erhoben. Schlussfolgerung: Der Fragebogen zu Spiritualität stellt ein kurzes Instrument dar, mit dem reliabel verschiedene Dimensionen der Spiritualität abgebildet werden. Der Kindheitsfragebogen im Vergleich zwischen deutschen und polnischen Probanden 1 2 3 Hardt J. , Dragan M. , Engfer A. 1 Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Mainz, Duisbergweg 6, 55099 Mainz 2 Institute for Psychology, Stakan 5-7, 46829 Warschau, Polen 3 FB 2 Psychologie, Universität GH Paderborn, 33089 Paderborn Fragestellung: Der Kindheitsfragebogen erfasst in seiner Kurzform vier Dimensionen in der Beziehung zu Mutter und Vater: Wahrgenommene Liebe, Kontrolle, Ehrgeiz und Rollenumkehr. Weiterhin werden Angaben zu sozioökonomischem Status und Trennung der Eltern erhoben. Ziel der Untersuchung war die Erprobung einer Polnischen Version und der vergleich der Angaben zwischen Deutschen und Polen. Methode: Es wurde eine Befragung per Internet an 500 deutschen und 508 polnischen Probanden mittels eines professionellen Befragungsinstituts durchgeführt. Ergebnisse: Im wesentliche lassen sich die Skalen im Polnischen gut replizieren (Cronbach’s alpha zwischen .95 und .79), lediglich die Skala Rollenumkehr Mutter zeigt ein alpha von .69. In den Skalen zeigen sich deutliche Unterschiede, Polnische befragte beschreiben ihre Mütter als stärker kontrollierend und ehrgeizig. Über polnische Väter wird mehr Rollenumkehr berichtet als über deutsche. Schlussfolgerung: Der Unterschied zwischen polnischen und deutschen im Kindheitsfragebogen ist von der Struktur eher gering. Auf der Skalenebene hingegen zeigen sich charakteristische Unterschiede zwischen beiden Ländern. Entwicklung und Validierung eines Instruments zur Diagnostik der Posttraumatischen Belastungsstörung nach dem Trauma „Krebs“ 1 1 2 2 Bölter A. F. , Lange J. , Anger B. , Olbricht S. , 1 Frommer J. 1 Abt. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Magdeburg, Leipziger Straße 44, 39120 Magdeburg 2 Rehabilitationsklinik Bad Salzelmen, Badepark 5, 39218 Schönebeck Einleitung: Nach dem DSM-IV ist eine lebensbedrohliche Erkrankung wie Krebs ein Trauma, das eine PTSD auslösen kann. Die Erfassung psychotraumatischer Symptome mit den üblichen PTSD- 115 Diagnoseinstrumenten kann bei diesem spezifischen Trauma jedoch nicht als valide bezeichnet werden. Methodik: N = 400 Rehabilitationspatienten mit heterogenen Tumordiagnosen, deren Diagnosestellung (=Trauma) max. 1 Jahr zurückliegt, wurden neu formulierte, traumaspezifische PTSDItems und die IES-R vorgelegt. Theoriegeleitet faktorenanalytisch (CFA) wurde daraus ein neuer Fragebogen entwickelt. Das SKID-PTSD, zwei psychoonkologische Belastungsmaße (PA-F-KF, HF) sowie das Angst- und das Depressionsmodul des PHQ dienten der Konstruktvalidierung. Ergebnis: Der Fragebogen umfasst auf 4 Faktoren/Skalen 5 Intrusions- und 4 Vermeidungsitems (IES-R), 6 spezifische (zukunftsorientierte Intrusionen und spezifische Vermeidungsstrategien) sowie 5 Symptome der Fehlanpassung. Das zugrundeliegende neue, theoretisch fundierte, diagnostische Modell entspricht den Daten (CFA: CFI = .961; RMSEA = .056). Die konvergente Validität, gemessen am SKID, ist mit .616 hoch signifikant. Die Reliabilität (interne Konsistenz anhand Cronbach) liegt bei α= .911. Diskussion: Das veränderte diagnostische Modell ist ein Schritt zur Erforschung von PTSD-Symptomen bei Krebspatienten; es ist reliabel und konvergent valide. Die Abgrenzung zu anderen Störungsbildern (diskriminante Validität) wird diskutiert. Entwicklung eines an der ICF orientierten Instrumentes für die Erfassung von Aktivitäten und Partizipation bei Patienten mit psychischen Erkrankungen 1 1 1 2 Brütt A. L. , Schulz H. , Koch U. , Braukhaus C. , 3 1 Schmeling-Kludas C. , Andreas S. 1 Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, S 35, 20246 Hamburg 2 Medizinisch-Psychosomatische Klinik Bad Bramstedt, Schön-Kliniken 3 Psychosomatische Klinik, Krankenhaus Ginsterhof In der psychotherapeutischen Behandlung gewinnt die Diskussion um eine Verbesserung von Aktivitäten und Teilhabe immer mehr an Bedeutung. Seit 2001 steht mit der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) ein System zur Verfügung, das diese Lebensbereiche kategorisiert. Bisher jedoch ist das Ausmaß an Aktivitäten und Teilhabe kaum praktikabel, reliabel und valide erfassbar. Vor diesem Hintergrund soll ein Selbsteinschätzungsinstrument entwickelt, psychometrisch getestet und schließlich implementiert werden. Das Vorgehen bei der Entwicklung bestand aus verschiedenen Arbeitsschritten (Literaturanalyse, Fokusgruppen und Expertenworkshops). In der Literaturanalyse, bei welcher Outcome-Instrumente identifiziert und Items untersucht wurden, konnten insgesamt 1562 bedeutungsvolle Konzepte (z.B. Hausarbeiten erledigen) den ICF-Kategorien „Aktivitäten und Partizipation“ zugeordnet werden. Es zeigte sich hierbei, dass für bestimmte Diagnosen auch spezifische Kategorien von Bedeutung sind. Darüber hinaus ließen sich auch Kategorien aufzeigen, die diagnoseübergreifend von Relevanz waren (z.B. soziale Beziehungen). Die Ergebnisse der Literaturanalyse wurden anschließend in Fokusgruppen mit Patienten und im Expertenworkshop erörtert. Die so identifizierten relevanten Kategorien zu Aktivitäten und Partizipation sollen im Hinblick auf diagnosespezifische bzw. generische Anteile kritisch diskutiert werden. Der Beziehungsmuster-Q-Sort (BQS)– Konzeptionelle Einführung und erste empirische Ergebnisse 1 1 2 2 Zimmermann J. , Stasch M. , Hunger C. , Rost R. , 2 2 1 Grande T. , Schauenburg H. , Cierpka M. 1 Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie, Psychosoziales Zentrum, Universitätsklinikum Heidelberg 2 Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg Mit dem Beziehungsmuster-Q-Sort (BQS) wird ein neues Instrument zur Diagnostik von dysfunktionalen Beziehungsmustern vorgestellt. Der BQS kann sowohl von kompetenten Fremdbeurteilern als auch vom Patienten selbst bearbeitet werden. Die Leitfrage ist jeweils, welche Schwierigkeiten für die Beziehungsgestaltung des Patienten besonders typisch bzw. untypisch sind. Als mögliche Antworten stehen die 32 Items der OPDBeziehungsachse (Arbeitskreis OPD 2006) zur Auswahl, die ein breites Spektrum an klinisch relevanten Beziehungsschwierigkeiten abdecken. Die Aufgabe des Beurteilers besteht darin, die Items in eine Rangfolge von „sehr typisch“ bis „sehr untypisch“ zu bringen – wobei im ersten Durchgang die problematischen Verhaltensweisen der Mitmenschen, im zweiten Durchgang die des Patienten fokussiert werden. Das zugrundeliegende Q-SortVerfahren (Block 2008) hat den Vorteil, dass die Einschätzungen verschiedener Beurteiler psychometrisch vergleichbar sind. Daher ist der BQS besonders für Fragestellungen geeignet, bei denen die Diskrepanz zwischen verschiedenen Erlebensperspektiven im Zentrum steht. Nach einer konzeptionellen Einführung des BQS werden erste empirische Ergebnisse präsentiert, die auf einer Stichprobe von n = 25 stationär behandelten, depressiven Patienten basieren. Dabei ist geplant, die BQS-Selbsteinschätzungen der Patienten anhand etablierter Fragebogeninstrumente zu validieren und mit den BQS-Fremdeinschätzungen unabhängiger Beurteiler in Beziehung zu setzen. 116 Diagnostik des Stresserlebens: Validität und Vorhersageleistung des Perceived Stress Questionnaire (PSQ) 1 1 1 1 Fliege H. , Peters E. M. , Joachim R. , Arck P. , 2 1 Levenstein S. , Klapp B. F. 1 Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Charité Universitätsmedizin Berlin, Charité-Campus Mitte, Luisenstr. 13a, 10117 Berlin 2 Aventino Medical Group, Der Perceived Stress Questionnaire von Levenstein et al. erfasst subjektives Stresserleben unabhängig von äußeren Bedingungen. Berichtet werden Ergebnisse zu den psychometrischen Eigenschaften in verschiedenen Stichproben. Stichproben umfassen Patienten mit Asthma, Neurodermitis, Tinnitus, CED, somatoformen, affektiven und Essstörungen, Schwangere, Frauen nach Fehlgeburt, Frauen nach Entbindung und gesunde Erwachsene. Für Vergleiche zwischen Lang- und Kurzversion (30/20 Items) wurde an Originaldaten reanalysiert, wie gut die Exazerbation einer Colitis prognostiziert werden kann. Ein hierarchisches Modell mit 4 Faktoren (Sorgen, Anspannung und Freude (invers) als Stressreaktion, Anforderungen als Stressor) verhielt sich invariant über verschiedene Stichproben. Zusammenhänge zwischen Stress, Symptomen, physiologischer Funktion (Lungenfunktion bei Asthma) und Immunparametern werden berichtet. Die Vorhersageleistung für die Exacerbation einer Colitis über 68 Monate war für die Lang- wie die Kurzversion des Fragebogens gut. Das Instrument misst valide. Die 20-ItemVersion hält Vergleichen mit der Originalversion stand. Ist eine Schulung von Ratern zur differenzierten Beurteilung des Schweregrades bei Patienten mit psychischen Störungen in der Routineversorgung notwendig? 1 1 1 Andreas S. , Rabung S. , Horstmann D. , Schau2 3 4 enburg H. , Harris-Hedder K. , Schwenk W. , 1 1 Koch-Gromus U. , Schulz H. 1 Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, S 35, 20246 Hamburg 2 Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg 3 Therapiehilfe e.V. 4 Fachkrankenhaus Nordfriesland Die „Health of the Nation Outcome Scales HoNOSD“ ist ein Fremdeinschätzungsinstrument zur differenzierten Erfassung des Schweregrades von Patienten mit psychischen Störungen und stellt inzwischen ein international etabliertes Instrument in der Routineversorgung dar. Zielsetzung der vorliegenden Studie war es zu überprüfen, ob eine Schulung von Beurteilern im HoNOS-D notwendig ist. Im Rahmen eines quasi-experimentellen De- signs wurden jeweils zwei Behandler aus vier verschiedenen Einrichtungen des stationären Versorgungsbereiches psychisch Kranker gebeten den HoNOS-D zu Beginn der Therapie auszufüllen. Nach ca. 60 Ratings pro Einrichtung erfolgte eine Schulung der Beurteiler (N = 22). Nach der Schulung erhoben ebenfalls zwei Beurteiler Ratings im HoNOS-D. Neben deskriptiven Itemanalysen und Bestimmung von Interraterreliabilitäten vor und nach der Schulung (ICC) wurde die Überprüfung zur Effektivität einer Schulung mittels des statistischen Verfahrens Mixed-Models vorgenommen (3Level-Model; abhängige Variable = quadrierte Abweichung der Beurteilungen, unabhängige Variablen = u.a. Ratinganzahl, Beurteiler, Einrichtung). Erste vorläufige Auswertungen zeigen, dass drei der zwölf Items der HoNOS-D Schulungseffekte (z.B. Item 4 „Kognitive Probleme)“ und fünf der zwölf Items Übungseffekte aufweisen (z.B. Item 3 „Alkohol- und Drogenabusus“). Die Ergebnisse sollen kritisch hinsichtlich der Notwendigkeit von Schulungen bei der Fremdbeurteilung des Schweregrades diskutiert werden. Konstruktion eines Fragebogens zu negativen und positiven Kindheitserfahrungen Eickhoff A., Wagner F., Schauenburg H. Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg Aktuelle Untersuchungen zeigen Zusammenhänge zwischen aversiven Kindheitserfahrungen und körperlichen bzw. psychischen Symptomen im Erwachsenenalter, wie z.B. Essstörungen, Substanzmissbrauch, Depression und kardiovaskulären Erkrankungen. Resilienzfaktoren können derartigen Erfahrungen entgegenwirken und zum Erhalt von psychischer Gesundheit trotz vorhandener Belastung beitragen. Zur Erhebung solcher aversiver und positiver Kindheitserfahrungen, zu denen Vernachlässigung, emotionaler/körperlicher/sexueller Missbrauch, dysfunktionale Familienverhältnisse, allgemeine traumatische Erlebnisse und Schutzfaktoren gehören, wird ein Screeningfragebogen entwickelt. Nach umfassender Literatursuche, sowie Laienund Expertenbefragung wurde ein Itempool erstellt. Ein qualitativer Vortest mit stationären Patienten der Psychosomatischen Klinik zeigte gute Verständlichkeit der Fragen und eine geringe bis mittlere subjektive Belastung. Es folgte die Überprüfung an 100 klinischen und nicht-klinischen Probanden. In einer anschließenden Itemanalyse wurden die einzelnen Fragen mittels statistischer Verfahren auf Eignung überprüft und der endgültige Fragebogenentwurf fertig gestellt, der in diesem Beitrag vorgestellt und diskutiert wird. 117 Vergleich von Instrumenten zur Erfassung berufsbezogener Motivation Epple N., Wietersheim von J. Abteilung Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin, Hochsträß 8, 89077 Ulm Hintergrund: Die berufsbezogene Motivation spielt eine wichtige Rolle für den Erfolg rehabilitativer und klinisch psychosomatischer Maßnahmen. Erfasst wird diese u.a. mit dem Arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster AVEM, dem Fragebogen zur berufsbezogenen Therapiemotivation FBTM und dem Diagnostikinstrument für Arbeitsmotivation DIAMO. Ziel der vorgestellten Studie war der Vergleich dieser Instrumente sowie ihrer prognostischen Bedeutung für den Behandlungserfolg. Methode: Erfasst wurden 50 Datensätze zu Beginn und Ende sowie 3 Monate nach einer stationären psychosomatischen Rehabilitationsmaßnahme. Die Daten zur Berufsbezogenen Motivation wurden mit Korrelations- und Regressionsanalysen untereinander, sowie mit Erfolgseinschätzungen aus Patienten- und Therapeutensicht in Beziehung gebracht. Ergebnisse: Die Korrelationsanalysen ergaben differenzielle Muster höchstsignifikanter Korrelationen mittlerer Höhe und damit Hinweise auf inhaltliche Unterschiede un Überschneidungen. Regressionsanalysen zeigten die unterschiedliche Prognosekraft bezüglich ausgewählter Ergebniskriterien, z.B. korreliert die FBTMSkala Rentenwunsch mit r=0,40 mit Perfektionsstreben (AVEM) und ist mir R²=0,3 bester Prädiktor für Patientenzufriedenheit. Diskussion: Die vorliegende Studie ergab Hinweise für einen differenzierten und effizienteren Einsatz der diskutierten Instrumente. Der Stark QoL- -ein etwas anderer Fragebogens zur Lebensqualität 1 2 Hardt J. , Stark H. 1 Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Mainz, Duisbergweg 6, 55099 Mainz 2 deutschen Probanden per Internet mit den Skalen der SF-36 verglichen. Ergebnisse: Es lässt sich mittels 16 Zeichnungen eine mentale und körperliche Dimension der Lebensqualität messen. Erstere besteht aus drei Aspekten, Affektlage, Energie und Kontakt zu anderen. Letztere besteht aus sechs körperlichen Aktivitäten (z.B. Schuhe binden, Tisch rücken, Kiste heben). Schlussfolgerung: Der Stark Qol stellt einen zweiseitigen Fragebogen dar, mit dem wesentliche Aspekte der Lebensqualität überwiegend nonverbal abgebildet werden. Evaluation der deutschen Form der "Comprehensive Psychotherapeutic Interventions Rating Scale" (CPIRS-D)– erste Ergebnisse Dinger U., Friedrich A., Ehrlich A., Schauenburg H. Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg Die Comprehensive Psychotherapeutic Intervention Rating Scale (CPIRS) von Trijsburg et al. (2002; 2004) ist ein Instrument zur Erfassung des Auftretens und der Verteilung von therapeutischen Interventionen. Die CPIRS beruht auf einer Vielzahl bereits publizierter Instrumente und fasst diese in 81 Items auf insgesamt zwölf Faktoren zusammen. Dabei entstammen fünf Fakten den sog. common factors, also den allen Therapieformen gemeinsamen Faktoren; sieben Faktoren erfassen typische Merkmale verbreiteter Therapieformen. Die CPIRS eignet sich also sowohl dazu, zwischen verschiedenen Therapieformen zu unterscheiden, als auch allgemeine, schulenübergreifende Interventionen zu erfassen. In der vorliegenden Studie werden eine deutsche Übersetzung des Instruments (CPIRS-D) vorgestellt und erste Ergebnisse hinsichtlich ihrer psychometrischen Qualität berichtet, u.a. Befunde zu Interraterübereinstimmung und Faktorenstruktur. Mit der CPIRS-D liegt ein umfassendes Instrument zur Erfassung von therapeutischen Interventionen in deutscher Sprache vor, dass für die Psychotherapieprozessforschung eingesetzt werden kann. Privat Fragestellung: Die Dartmouth COOP functional assessment charts heben sich von den vielen anderen Fragebogen zur Lebensqualität dadurch ab, dass die Items nicht rein verbal formuliert sind sondern durch Zeichnungen unterstützt werden. Das lockert ein Fragebogenheft angenehm auf. In der Verwendung solcher Zeichnungen liegt aber ein weiteres Potential, nämlich dass Inhalte weniger per Text und stärker per Zeichnung transportiert werden. Diese Möglichkeit wird in den Dartmouth Charts leider nicht konsequent verfolgt. Methode: Es wurden in mehreren Pilotstudien Items entwickelt, die mit einem Minimum an Wörtern auskommen und ein Maximum an Information über die Zeichnung vermitteln. Diese wurden an 500 Die 2-Itemversion der Cambridge Depersonalization Scale Michal M., Tschan R., Beutel M., Zwerenz R. Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz Depersonalisation (DP) und Derealisation (DR) sind häufige klinische Phänomene, welche aber nur selten diagnostisch erfasst werden. Fragebögen zur Erfassung von DP-DR habens sich bewehrt, um die gerade bei diesem Syndrom besonders große diagnostische Lücke zu schließen. Aus der Cambridge Depersonalization Scale (CDS, [1]) 118 wurden mittels Diskriminanzfunktion 2 Items mit der höchsten Trennschärfe extrahiert und zu einer 2-Item-Version der Cambridge Depersonalization Scale mit einem vereinfachten Antwortformat zusammengefasst. In einer Stichprobe von n = 84 psychosomatischen Ambulanz- und Konsilpatienten wurde die 2-Itemskala der Cambridge Depersonalization Scale (CDS-2) validiert. Als Goldstandard diente die klinische Diagnose gemäß eines strukturierten klinischen Interviews. Für die Erfassung pathologischer DP-DR ergab sich bei einem Cut-off von CDS-2 ≥ 3 eine Sensitivität von 77,7% und eine Spezifität von 85,7%. Die Fläche unter der Kurve betrug 0,94 (p<0,001). Für die 9-Item Kurzversion der CDS (CDS-9) ergaben sich bei einem Cut-Off CDS-9 ≥ 17 eine Sensitivität von 91,4% und eine Spezifität von 93,9% mit einer Fläche unter der Kurve von 0,97 (p<0,001). Die CDS2 korrelierte mit dem klinischen Schweregrad mit rho = 0,76 p<0,001 und mit der CDS-9 mit rho = 0,82 (p<0,001). Die CDS-2 ist ein einfach handbares Screeninginstrument für die Erfassung pathologischer DP-DR, welches leicht mit einem Instrument wie z.B. dem Patient Health Questionnaire kombiniert werden kann. Fragebogen zur Erfassung der Gegenübertragung: Die deutsche Version des Countertransference Questionnaire (Zittel Conclin & Westen, 2005) 1 2 3 Kernhof K. M. , Grabhorn R. H. , Kaufhold J. 1 Psychosomatische Klinik am Hospital zum heiligen Geist, Frankfurt am Main, Lange Strasse 4-6, 60311 Frankfurt 2 Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Universität Frankfurt am Main 3 Privat Die Bedeutung der Gegenübertragung hat seit ihrer Entdeckung durch Freud (1910) eine erhebliche Veränderung erfahren. Galt sie zunächst als Störfaktor und Haupthindernis der Behandlung, weil sie Freuds Bild des Analytikers als Spiegelplatte nicht entsprach und als Folge der eigenen neurotischen Erlebnisweisen zu überwinden war, so vollzog sich mit Heimann (1950) ein Wendepunkt hin zur ganzheitlichen Auffassung und zum Verständnis der Gegenübertragung als wichtigem Hilfsmittel der Behandlung. Trotz einer seitdem erfolgenden regen theoretischen Auseinandersetzung über das Konzept der Gegenübertragung (Thomä & Kächele, 1985), sind empirische Untersuchungen in diesem Bereich selten (Betan et al., 2005). Vorgestellt werden soll die deutsche Übersetzung eines Fragebogens zur Erfassung der Gegenübertragung (Countertransference Questionnaire (CTQ), Zittel Conclin & Westen, 2005), der dazu geeignet ist, die diagnostische und therapeutische Relevanz des Konzeptes zu unterstreichen und die Bedeutung der Gegenübertragung zu diffe- renzieren. Neben der Darstellung der ersten an deutschen Stichproben erhobenen Daten zur Faktorenstruktur wird versucht, den Zusammenhang von Gegenübertragungsphänomenen und Persönlichkeitsstörungen genauer zu erfassen. DSM-IV Cannabisabhängigkeit - Die Bedeutung des Konsumkontextes neben der Konsumfrequenz 1 2 3 3 Noack R. , Höfler M. , Gründler R. , Becker A. , 3 3 Schulz R. , Paul K. 1 Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 2 Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Chemnitzer Strasse 46, 01187 Dresden 3 Privat Hintergrund: Die Gebrauchsfrequenz steht in engem Zusammenhang mit dem Vorliegen einer Abhängigkeit von Cannabis (Chen et al., 1997; Nocon et al., 2006) der am häufigsten gebrauchten illegalen Droge (EMCDDA, 2007). Wenig bekannt ist die Rolle des sozialen Kontextes beim Gebrauch. Ziel: Es sollten die Zusammenhänge zwischen Gebrauchsmustern und Cannabisabhängigkeit nach DSM-IV untersucht und leicht abfrag- und objektivierbare Items, z.B. für die Entwicklung von Screenings identifiziert werden. Methode: Die Rekrutierung der studentischen Stichprobe (N=3904) erfolgte mittels querschnittlicher Interneterhebung. Die Gebrauchsmuster wurden analog der Versorgungsstudie CareD (Simon et al., 2004), die Abhängigkeitskriterien analog M-CIDI (Wittchen et al., 1997) erhoben. Die Regressionsanalysen fanden bei den N=843 Personen mit regelmäßigem Konsum (mindestens monatlich) statt. Als Maß der Aufklärung wurden die Flächen unter den ROCKurven (AUC) berechnet. Ergebnisse: Je höher die Konsumfrequenz und je häufiger Konsum abseits sozialer Kontexte stattfindet, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit des Vorliegen einer Abhängigkeit. Die Konsumfrequenz klärt moderat auf (AUC .71), ebenso wie ein Konsum meist abseits sozialer Kontexte (AUC .70). Der Aufklärungswert eines multiplen Modells steigt auf AUC .75. Schlussfolgerungen: Angaben zur Loslösung des Konsums aus sozialen Kontexten leisten einen zusätzlichen Aufklärungswert und legen eine veränderte Funktionalität des Konsums nahe. Psychoonkologie Gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Patienten während Hochdosis-Chemotherapie mit 119 autologer peripherer Blutstammzelltransplantation (PBSCT) 1 1 1 2 Koehler M. , von Toll T. , Fischer T. , Frommer J. 1 Klinik für Hämatologie/ Onkologie, Universitätsklinikum Magdeburg, Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg 2 Klinik für Psychosomatische Medizin, Universität Magdeburg Einleitung: Verlaufsuntersuchungen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität (HRQOL) als onkologische Outcome-Variable sind bei hämatologisch-onkologischen Patienten während der Hochdosis-Chemotherapie mit autologer PBSCT immer noch unzureichend belegt; insbesondere die Erhebung zu behandlungsrelevanten Zeitpunkten aus Perspektive von Onkologen und Patienten. Methode: 52 Patienten wurden zu den Zeitpunkten T1) Stammzellmobilisierung und anschließende Stammzellseparation, T2) Gabe der HochdosisChemotherapie und T3) Entlassung bei ihrer ersten Behandlung mit autologer PBSCT zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität mittels SF-36 befragt. Die Psychoonkologische Basisdokumentation wurde ergänzend zu T1 eingesetzt. Als Referenzsysteme wurden der Vergleich zu T1 (Baseline) und der deutschen Normstichprobe des SF-36 genutzt. Ergebnisse: Für die Verlaufsuntersuchung zeigt sich die signifikante Abnahme (p < 0,01) körperlicher Gesundheit, körperlicher Funktionsfähigkeit, körperlicher Rollenfunktion und Schmerzen. Demgegenüber bleiben psychische Gesundheit, allgemeine Gesundheitswahrnehmung und emotionale Rollenfunktion unverändert. Der Vergleich zur deutschen Normstichprobe zeigt, daß während der akuten Behandlungsphase (T2-T3) eine erhebliche signifikante Minderung der HRQOL zu beobachten ist; jedoch zu keinem Zeitpunkt eine vergleichsweise Minderung des psychischen Wohlbefindens. Diskussion: Die Ergebnisse werden unter Berücksichtigung von möglichen Determinanten der HRQOL diskutiert. Für viele Krebspatienten ist eine aktive Auseinandersetzung mit der Erkrankung und die Suche nach krankheitsbezogener Information eine wichtige Verarbeitungsstrategie. Dem hohen Aufklärungs- und Informationsbedarf der Patienten steht jedoch der Zeit- und Kostendruck der akutmedizinischen Versorgung gegenüber. Vor diesem Hintergrund entstand das Projekt „Krebskrank – der direkte Weg zur guten Information“ mit dem Ziel, Patienten an zwei Münchner Krankenhäusern der Maximalversorgung leicht zugängliche psychoedukative Gruppen anzubieten. In einer 6stündigen interdisziplinären Schulung werden Informationen zu verschiedenen Behandlungsverfahren, Ernährung, Sozialrecht, Krankheitsbewältigung u.a vermittelt. Um dem spezifischen Bedarf der einzelnen Patienten Rechnung zu tragen, können diese zwischen zwei Gruppensettings wählen. Im offenen Seminarangebot nehmen die Patienten selektiv an einzelnen Vorträgen teil, im geschlossene Gruppensetting können alle Kurseinheiten in einer festen Kleingruppe besucht werden. Im Rahmen einer Begleitstudie wurden die einzelnen Kurseinheiten evaluiert sowie Angst und Depressivität (HADS-D), krankheitsbezogene Belastungen (FBK-R23) und die psychosoziale Belastung (Distress-Thermometer) erhoben. Die Datenauswertung zeigt eine signifikante Reduktion von Angst und depressiver Symptomatik in beiden Gruppen, sowie eine signifikante Abnahme der krankheitsbezogenen Belastung bei Patienten des geschlossenen Gruppensettings. Welcher Krebspatient ist posttraumatisch belastet?– Vorhersage der Posttraumatischen Belastungsstörung nach einer Krebsdiagnose 1 1 2 2 Lange J. , Bölter A. , Anger B. , Olbricht S. , 1 Frommer J. 1 Abt. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Magdeburg, Leipziger Straße 44, 39120 Magdeburg 2 Effektivität von zwei unterschiedlichen psychoedukativen Gruppensettings bei Krebspatienten 1 2 3 4 Heeper A. , Schulz F. , Besseler M. , Tari S. , 2 1 Heussner P. , Herschbach P. 1 Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Langerstrasse 3, 81675 München 2 Psycho-Onkologie an der Medizinische Klinik und Poliklinik III - Klinikum Großhadern der LMU München, Marchioninistraße 15, 81377 München 3 Bayerische Krebsgesellschaft e.V., Nymphenburger Str. 21a, 80335 München 4 lebensmut e.V., Klinikum der Universität MünchenGroßhadern, Marchioninistraße 15, 81377 München Rehabilitationsklinik Bad Salzelmen, Badepark 5, 39218 Schönebeck Fragestellung: Bei 11,8% der Krebspatienten wird eine PTSD-Symptomatik diagnostiziert (N=93; SKID, inkl. subsyndromalem Symptombild und Berücksichtigung zukunftsgerichteter Intrusionen), doch Daten zur reliablen Identifizierung von Risikopatienten fehlen. Ziel dieser Studie ist die Überprüfung eines theoriebasierten Vorhersagemodells zur PTSD nach dem Trauma „Krebsdiagnose“. Methodik: Es wurden 124 Tumorpatienten einer Rehabilitationsklinik mit heterogenen Diagnosen befragt. Mit einem von Bölter et al. für das Trauma „Krebs“ modifizierten Modul der IES-R wurde der Schweregrad der PTSD-Symptomatik erhoben. Als Prädiktoren dienten Kohärenzgefühl (SOC-L9), Soziale Unterstützung (F-SozU K-22), Peritraumatische Dissoziation (PDEQ) und Rezidivangst (Fünf-Item-Skala, Übers. nach Kornblith). Ergeb- 120 nis: In der simultanen multiplen Regression leisteten lediglich Peritraumatische Dissoziation (β=.470) und Kohärenzgefühl (β=-.371) signifikante Vorhersagebeiträge (p=.000). Das Modell erklärte 54% der Gesamtvarianz des PTSDSchweregrades (p=.000). Diskussion: Krebspatienten mit hohem peritraumatischen Dissoziationserleben und einem als niedrig wahrgenommenen Kohärenzgefühl entwickeln ein höheres Ausmaß an PTSD-Symptomen. Nach der Diagnosestellung ist ein zeitnahes Screening der Patienten hinsichtlich dieser beiden Faktoren indiziert, um zu einem frühen Zeitpunkt eine PTSD-Symptomatik vorherzusagen. Die Ergebnisse zur Sozialen Unterstützung und Rezidivangst werden diskutiert. Kommunikation psychoonkologischer Befunde und interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem Brustzentrum 1 1 1 2 Grimm A. , Voigt B. , Georgiewa P. , Winzer K. , 2 1 1 Schneider A. , Klapp B. F. , Rauchfuß M. 1 Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Charité Universitätsmedizin Berlin, Charité-Campus Mitte, Luisenstr. 13a, 10117 Berlin 2 Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Gynäkologie, Charité-Universitätsmedizin, Hintergrund: Allen Brustkrebspatientinnen sollte im gesamten Behandlungsverlauf fachkompetente psychoonkologische Versorgung zur Verfügung stehen. Dafür ist die adäquate Weitergabe von Informationen im Behandlungsteam aus Kollegen verschiedener Fachdisziplinen einschließlich externer Behandler, erforderlich. Fragestellung: Wie kann die Organisation einer solchen interdisziplinären Kommunikation aussehen? Methodik: Vorgestellt wird die Organisation der Kommunikation psychoonkologischer Befunde im Brustzentrum der Charité. Ergebnisse: Auf der Grundlage psychometrischer Testdiagnostik und Gesprächen mit der Patientin erfolgt eine psychoonkologische Einschätzung hinsichtlich Stimmungslage, Krankheitsverarbeitung, psychosozialer Belastungsfaktoren, ggf. psychischer Diagnose sowie Betreuungsbedarf im Dokumentationssystem ODSeasy. Dieser Befund wird anhand der direkt nach dem Kontakt ausgefüllten Patientinnen-Einschätzung und des POBADO, die auch zur schriftlichen Kommunikation im Psychoonkologie-Team dienen, erstellt. Ein interdisziplinärer Austausch findet über ODSeasy, im Arbeitsalltag/Stationsvisite und in der Tumorkonferenz statt. In den Entlassungsbericht ist eine psychoonkologische Weiterbehandlungsempfehlung integriert. Schlussfolgerungen: Zur Optimierung der Brustkebsbehandlung unter Einbeziehung psychoonkologischer Aspekte im gesamten Behandlungsverlauf ist eine gezielte Kommunikation psychosozialer Befunde notwendig. „Wenn’s mir schmeckt, dann geht’s mir auch gut.“ – Der Einfluss von Nahrungsmitteln bei Leukämiepatienten beim Entrinnen aus der Verlaufskurve 1 2 3 Heine V. , Koehler M. , Frommer J. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Magdeburg, Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg 2 Klinik für Hämatologie/ Onkologie, Universitätsklinikum Magdeburg, Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg 3 Klinik für Psychosomatische Medizin, Universität Magdeburg In der aktuellen Studie zur biographischen Krankheitsverarbeitung von Überlebenden einer akuten Leukämie, wurden 17 autobiographisch-narrative Interviews erhoben (N=17, mind. 1 Jahr behandlungsfrei; Interviewlänge: 60-180 min). In unserem Referat soll die akute Leukämie als Auslöser für eine Verlaufskurve des Erleidens dargestellt werden. Zudem soll ein Beitrag zu einer zentralen Fragestellung der Psychoonkologie geleistet werden: wie gelingt es Menschen mit dieser lebensbedrohenden Krankheit den Schock und die Traumatisierung durch die tödliche Bedrohung zu verarbeiten. Von zentraler Bedeutung erscheint dabei, herauszufinden, welche Strategien von den Befragten als hilfreich für das Entrinnen aus der Verlaufskurve erlebt werden. Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass Nahrungsmittel bei den Patienten hierbei eine besondere Rolle einnahmen. Wir werden Beispiele zur subjektiven Bedeutung der Nahrungsmittel präsentieren und welche Rolle diese Bedeutungszuschreibung der Patienten für den weiteren Krankheitsverlauf hat. Als Erkrankte sind sie dem Handeln der Ärzte quasi hilflos ausgeliefert und müssen auf deren Kompetenz vertrauen. Die Lebensmittel bieten den Patienten nicht nur das Gefühl sich selber etwas Gutes zu tun, sondern auch ihren eigenen Beitrag zur Therapie leisten zu können. Damit haben sie neben den Ärzten einen subjektiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf, da sie sich aktiv an der Stärkung ihres kranken und geschwächten Körpers beteiligen können. Psychoonkologische Versorgung von Patienten mit kolorektalen Tumorerkrankungen im Einzugsgebiet des Münchner Krebsregisters 1 2 2 1 Beraldi A. , Kukk E. , Fejtkova S. , Fejtkova S. , 2 1 Herschbach P. , Heussner P. 1 Medinzinische Klinik und Poliklinik III - PsychoOnkologie, Klinikum Großhadern der LMU München, Marchionini Straße 15, 81377 München 2 Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Langerstr. 3, 81675 München Fragestellung: Ein Manko bisherigen Studien zur Erfassung von Bedarf und Angebot an psychoso- 121 zialer Unterstützung für Krebspatienten ist der Mangel an Repräsentativität. Die Zusammenarbeit mit dem Tumorregister München (TRM), die in dieser Form einmalig ist, ermöglicht erstmals repräsentative Aussagen über den Bedarf und Inanspruchnahme der Patienten mit einem kolorektalen Karzinom sowie über die reale psychoonkologische wohnortnahe Versorgung zu machen. Sekundäres Ziel ist die Untersuchung der Frage, von welchen Faktoren der Betreuungsbedarf und die Akzeptanz von Angeboten abhängen. Stichprobe: Personen (Alter > 18 Jahre, Lebenserwartung > 6 Monate) mit der Diagnose eines kolorektalen Karzinoms aus dem Einzugsgebiet des TRM. Messinstrumente: Fragebogen zur Person und Erkrankung sowie zu Wunsch, Akzeptanz und Inanspruchnahme von psychosozialen Betreuungsangeboten, NCCN-Distress-Thermometer, Fragebogen zur Belastung von Krebskranken FBK-R10, Gesundheitsfragebogen für Patienten PHQ-D4. Datenauswertung: Selbstauskunft der Patienten über die Fragebögen, objektive Daten aus dem TRM sowie Internet- und Telefonrecherchen über die regionalen psycho-sozialen Angebote. Die Repräsentativität der Kohorte wird durch den Abgleich mit den populationsbezogenen Daten des TRM gewährleistet. Aktueller Stand der Studie: 89% der angeschriebenen Kliniken wurden eingeschlossen. Vorläufige Ergebnisse liegen bis März 2009 vor. Psychosomatik in der inneren Medizin Prädiktion von Schüben bei Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung durch psychosoziales Screening Benninghoven D., Matthes K., Jantschek G. Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Ratzeburger Allee 160, 235238 Lübeck Psychosoziale Faktoren scheinen für die Aufrechterhaltung und den Verlauf Chronisch Entzündlicher Darmerkrankungen (CED) bedeutsam zu sein. In der vorliegenden prospektiven Studie wurde überprüft, inwiefern es gelingt, Krankheitsschübe durch psychosoziales Screening vorherzusagen. Es wurden sowohl Selbst- als auch Fremdbeurteilungsverfahren zum Screening psychosozialer Belastung eingesetzt (LIPS-CED, SIBDQ). Die Genauigkeit und die Gültigkeit der Fremdbeurteilung durch das Lübecker Interview zum psychosozialen Screeening bei Patienten mit Chronisch Entzündlicher Darmerkrankung (LIPS-CED) war in einer Vorstudie überprüft worden (Kunzendorf et al., 2007). 92 Patienten wurden zum Zeitpunkt T0 einem umfassenden körperlichen und psychosozialen Screening unterzogen. Bei 60 Patienten (37 Patienten mit Morbus Crohn; 23 Patienten mit colitis ulcerosa) konnte eine Follow-up-Untersuchung nach durchschnittlich 37 Monaten durchgeführt werden. Die beste Vorhersage für das Auftreten von Schüben während des Beobachtungszeitraumes gelang für die Colitis-Patienten mit dem SIBDQ. Für Morbus Crohn Patienten hatte die mit Hilfe des LIPS-CED fremdeingeschätzte Beeinträchtigung durch die Erkrankung den höchsten prädiktiven Gehalt für das Auftreten von Schüben im Beobachtungszeitraum. Die Bedeutung dieser Ergebnisse für die Versorgung von Patienten mit Chronisch Entzündlicher Darmerkrankung wird diskutiert. Psychische Belastung bei Patienten mit chronischer Lungenerkrankung Limbacher E. K., Michal M. Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen (Asthma/COPD) weisen eine hohe psychische Komorbidität auf. In Querschnittstudien werden Komorbiditäten von 16-51% für psychische Störungen gefunden (Angststörungen vor depressiven Störungen und einer Geschlechterratio von 1:2 (m vs. f); Depersonalisationssyndrom; Panikstörung). Die vorliegende Studie untersucht die Prävalenz psychischer Beschwerden bei erwachsenen Patienten mit Asthma und COPD sowie den Zusammenhang psychischer Beschwerden mit Aspekten der Krankheitsverarbeitung und Lebensqualität. Bisher liegen die Ergebnisse von 65 Patienten vor, von diesen zeigen 18,5% ein Typ-D Muster, 16,9% klinisch relevante Depressivität, 6,3% klinisch relevante Angst, 6,3% klinisch signifikante Depersonalisation und 13,8% starke Somatisierung. Trotz der hohen Beschwerdebelastung befanden sich nur 2 Patienten in fachspezifischer Behandlung (jeweils 1 Patient in psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung). Neben Aspekten der Versorgung werden außerdem Zusammenhänge mit dem Gesundheitsverhalten (Teilnahme an Patientenschulungen, Rauchen etc.) sowie der krankheitsbezogenen Lebensqualität dargestellt. Aufgrund der bisherigen Auswertung zeichnet sich bereits ab, dass Patienten mit COPD/Asthma eine erhebliche psychische Komorbidität aufweisen, insbesondere überrascht dabei das hohe Ausmaß an Depersonalisation, sowie dass die psychische Belastung die Lebensqualität stark beeinträchtigt und nur selten fachspezifisch behandelt wird. Sexualstörungen / Sexualforschung 122 Sexuelle Orientierung, Partnerwahl und sexuelle Phantasien von Patienten mit Störungen der Geschlechtsidentität (Transsexualität) Cerwenka S., Nieder T. O., Richter-Appelt H. Institut für Sexualforschung, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg Einleitung: Eine Störung der Geschlechtsidentität ist gekennzeichnet durch das starke und andauernde Zugehörigkeitsgefühl zum anderen Geschlecht und das konstante Unbehagen über die Zugehörigkeit zum eigenen biologischen Geschlecht. Bisherige Studien weisen darauf hin, dass die sexuelle Orientierung bei Frau-zu-Mann Transsexuellen (FM-TS) in Bezug auf die gefühlte Geschlechtszugehörigkeit überwiegend heterosexuell (gynäphil) geprägt ist, während Mann-zu-Frau Transsexuelle (MF-TS) häufiger homosexuell betreffend das eigene Geschlechtsidentitätsempfinden (gynäphil) orientiert sind. Zielsetzung: Diese Studie zielt als Teil einer internationalen MultiCenter-Studie darauf ab, sexuelle Orientierung, Partnerwahl sowie sexuelle Phantasien in Bezug auf das eigene Geschlechtserleben und das Geschlecht des Partners bei Patienten mit Geschlechtsidentitätsstörung zu untersuchen. Dabei interessiert besonders ein Vergleich zwischen FMTS und MF-TS. Methode: Die Stichprobe besteht aus 40 Patienten, bei denen eine Störung der Geschlechtsidentität diagnostiziert werden konnte. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre, Ausschlusskriterium war eine psychotische Störung. Die relevanten Variablen wurden mittels eines im Rahmen der Studie konstruierten, jeweils geschlechtsspezifischen Fragebogens direkt nach dem Erstgespräch erhoben. Ergebnisse: Daten zur sexuellen Orientierung, Partnerwahl und zu sexuellen Phantasien bei FM-TS und MF-TS werden vorgestellt und kritisch diskutiert. Geschlechtszuweisung, Behandlungserfahrungen und psychische Belastung bei erwachsenen Personen mit 46, XY Karyotyp und vollständiger und partieller Androgeninsensitivität (AIS) Brunner F., Huber K., Schweizer K., Gedrose B., Richter-Appelt H. Institut für Sexualforschung, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg Bei Androgeninsensitivität, einer Form der Intersexualität, kommt es aufgrund eines Androgenrezeptordefekts bei männlichem Chromosomensatz (46, XY) zu einer partiell (PAIS) oder komplett (CAIS) eingeschränkten Virilisierung. Bei CAIS erfolgt trotz männlicher Gonaden bei weiblich erscheinendem äußeren Genitale eine Geschlechtszuweisung zur Frau, bei PAIS richtet sich diese meist nach dem Grad der Vermännlichung und der zu erwartenden Funktionalität des Genitales im Erwachsenenalter. Die wenigen bisherigen Studien zeigen bei der Gruppe mit CAIS kaum psychische Belastungen. 13 Personen mit CAIS werden mit 12 mit PAIS verglichen, von denen 5 in der männlichen Rolle leben und sieben als Frau. Das Alter liegt zwischen 17 und 56 Jahren. Behandlungserfahrungen wurden per Fragebogen erfasst und durch Arztunterlagen ergänzt. Psychische Belastung wurde mit dem “Brief Symptom Inventory” (BSI) erhoben. Die Ergebnisse zeigen große Unterschiede in der Behandlung von CAIS und PAIS bzgl. Art und Anzahl der Operationen, wofür Maßnahmen im Rahmen der Geschlechtszuweisung bestimmend sind. Die psychische Belastung der Betroffenen ist weitaus größer als bisher angenommen wurde und zwar vor allem bei weiblichen PAIS (57%) und CAIS (62%). Es findet sich kein Zusammenhang zwischen Behandlungsmaßnahmen und klinischer Auffälligkeit im BSI. Es wird aber deutlich, dass für diese Personengruppe ein besseres Betreuungsangebot von medizinischpsychologischer Seite geschaffen werden muss. Affektive Störungen Können depressive Patienten Sinn in ihrem Leben konstruieren? 3 1 2 3 Gruß B. , Dimpfl D. , Bleich S. , de Zwaan M. 1 Privat Psychiatrische und Psychotherapeutische Klinik, Universitätsklinikum Erlangen, Schwabachanlage 6, 91054 Erlangen 3 Abt. für Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin, Universität Erlangen, Schwabachanlage 6, 91054 Erlangen 2 Hintergrund: Obwohl depressive Patienten häufig Sinnlosigkeitsgefühle beklagen, wurde bisher nicht untersucht, ob sie Sinn in ihrem Leben konstruieren können. Die Bedeutung der Erfahrung von Sinn für unsere Gesundheit wurde bereits aufgezeigt (Debats, 1996; Gruß & Pöhlmann, 2004). In der vorliegenden Studie wird die Sinnkonstruktion depressiver Patienten gegenüber Gesunden untersucht und Veränderungen im stationären Verlauf erfasst. Methode: Gemeindemitglieder (n=39) und depressive Patienten (F32, n=28 & F33, n=55) wurden gefragt, welche Dinge ihr Leben sinnvoll machen, bis zu welchem Grad diese aktuell erfüllt sind und inwieweit Zusammenhänge zwischen ihnen bestehen. Die Inhalte wurden kategorisiert und Sinnkonstruktion anhand verschiedener Kriterien abgebildet. Zusätzlich erfasst wurden Depressivität, Symptomschwere, Lebenszufriedenheit und Kohärenzgefühl. 35 Patienten beantworteten die Fragen nach vier Wochen erneut. Ergebnisse & Diskussion: Signifikante Gruppenunterschiede wurden erzielt: Depressive Patienten können zwar Inhalte nennen, die das Leben für sie sinnvoll ma- 123 chen, verfügen aber über ein weniger differenziertes und integriertes Sinnsystem. Letzteres trifft für Patienten mit rezidivierender Depression stärker zu und verändert sich im Therapieverlauf nicht, so dass über eine spezifische sinnorientierte Intervention nachgedacht werden sollte. Im Therapieverlauf verbessert sich bei den Patienten nur der Grad der Erfülltheit ihrer Sinninhalte (T=-2,04, p < ,045). Subtypen depressiver Persönlichkeitsentwicklung in der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD-2) 1 1 2 Rost R. , Hunger C. , Zimmermann J. , Cierpka 1 1 1 M. , Grande T. , Schauenburg H. 1 Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg 2 Abteilung für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie Universitätsklinikum, Bergheimer Straße 54, 69115 Heidelberg Depressive Entwicklungen stehen oft mit belastenden Situationen, inneren Konflikten und vor allem bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen in Zusammenhang. Im Rahmen eines Projekts an der Heidelberger Klinik für Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin erfolgt eine genaue Analyse von Therapieverläufen und -erfolgen im stationären Setting vor dem Hintergrund der Typisierung depressiver Patienten nach zugrunde liegenden intrapsychischen Konflikten (Arbeitsgruppe OPD 2006). Es wird untersucht, welche differentiellen Effekte sich für verschiedene Konfliktmuster zeigen. Als Variablen werden per Operationalisierter Psychodynamischer Diagnostik (OPD-2) erhobene Merkmale, sowie die deutschsprachige Version des Depressive Experience Questionnaire (DEQ; Beutel et al. 2004) eingesetzt. Hypothese ist, dass sich bereits bei der Eingangsdiagnostik bestimmte Konfliktmuster abbilden, welche eine prognostisch und behandlungstechnisch relevante Typisierung der Depression ermöglichen. Ziel ist es, Therapiefoki spezifischer auf den Patienten abzustimmen und eine effektivere Therapieplanung der psychodynamischen Depressionsbehandlung zu gewährleisten. Dargestellt werden die Annahmen zu intrapsychischen Konflikten bei depressiven Patienten nach OPD-2, sowie erste Ergebnisse der laufenden Studie mit voraussichtlich N = 40 Patienten. 2 Psychiatrische Universitätsklinik derstrasse, 72076 Tübingen Tübingen, Osian- 3 Department für Augenheilkunde, Universitätsaugenklinik, Tübingen, Schleichstr. 12-16, 72076 Tübingen Hintergrund und Ziel: Die Evaluierung von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren von Patienten mit altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) als auch der Vergleich von dafür geeigneten Diagnostikinstrumenten sind Ziele dieser klinischen Studie.Methode: In einer prospektiven Kohortenstudie wurden 55 Patienten mit AMD untersucht. Folgende Instrumente wurden für die Datenerhebung verwendet: Visus mit ETDRS und Radner, SKID I + II, BDI, BAI, SCL-90-R, NEI VFQ-25, SF-36, WHOQOL. Ergebnisse: Depressive und Angstsymptome waren mit insgesamt 20% die häufigsten psychischen Symptome in der Studienpopulation. Eine signifikante Abnahme der Quality of Life (QOL) war mit der AMD assoziiert. Es bestanden signifikante Korrelationen zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren. Als Risikofaktoren konnten visuelle Funktionseinschränkungen, veränderte Rollendefinitionen sowie komorbide somatische Störungen beschrieben werden. Nur wenige Patienten hatten Zugang zum Low-Vision Service oder zum psychischen Hilfesystem. Schlussfolgerungen: Psychologische und soziale Faktoren spielen in der Rehabilitation von Patienten mit AMD eine wichtige Rolle. Psychische Symptome können effektiv mit Standardfragebogen gescreent werden. Multimodale Therapiemethoden einschließlich psychopharmakologischer und psychotherapeutischer Interventionen sind für die Betroffenen indiziert. Dabei ist die Implementierung eines multidisziplinären Netzwerkes notwendig. Arzt-Patient-Kommunikation Effekte von ärztlichen Trainingsmaßnahmen und Entscheidungshilfen zur Partizipativen Entscheidungsfindung (Shared Decision Making) bei Brust- und Darmkrebs-Patienten 1 1 2 2 Nicolai J. , Bieber C. , Buchholz A. , Reuter K. , 1 2 Eich W. , Härter M. 1 Klinik für Psychosomatik und Allgemeine Klinische Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg 2 Altersabhängige Makuladegeneration (AMD) Angststörungen und Major Depression: Relevanz psychischer Störungen bei der AMD - eine prospektive Kohortenstudie 1 2 3 Smolka R. , Batra A. , Aisenbrey S. 1 Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen, Silcherstraße 5, 72076 Tübingen Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Freiburg Hintergrund: Bisherige Forschungsergebnisse belegen, dass mit spezifischen Trainingsmaßnahmen zur Partizipativen Entscheidungsfindung (PEF) und unterstützenden Materialien (Decision Aids) die Patienteninformation und –beteiligung bei medizinischen Entscheidungen verbessert werden kann. Trotz des vielfach nachgewiesenen Nutzens der PEF bekommen die meisten Patienten nicht das 124 gewünschte Maß an Beteiligung am Entscheidungsprozess. Methode: In einer randomisierten kontrollierten Studie soll der Beitrag spezifischer PEF-Trainingsmaßnahmen für Ärzte und der Einsatz von Entscheidungshilfen zur Verbesserung der Arzt-Patient-Kommunikation untersucht werden. In die Studie werden 50 onkologisch tätige Ärzte (je 25 in der Interventions- bzw. Kontrollgruppe) und 400 Brust- oder Darmkrebs-Patienten einbezogen. Die Arzt-Patienten-Gespräche werden aufgezeichnet und mit einem validierten Fremdbeobachtungsverfahren evaluiert. Direkt nach der Konsultation sowie 3 Monate später wird der Einfluss des Trainings auf Entscheidungskonflikte und –zufriedenheit, psychische Belastungen sowie die Arzt-Patient-Beziehung überprüft. Erwartete Ergebnisse: Das PEF-Training führt zu einer Erhöhung der ärztlichen Gesprächskompetenz und zu einer stärkeren Einbeziehung von Patienten bei medizinischen Entscheidungen. Das verbesserte Kommunikationsverhalten und die stärkere Einbeziehung lassen eine Reduzierung der Entscheidungskonflikte und eine erhöhte Zufriedenheit der Patienten mit der Entscheidung erwarten. Essstörungen Alters-, Geschlechts- und Diagnosegruppenspezifische Unterschiede in den Körperkonzepten bei Patienten einer psychosomatischen Ambulanz Stumpf A., Braunheim M., Heuft G., Schneider G. Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Universitätsklinikum Münster, Domagkstr.22, 48149 Münster Fragestellung: Ziel der Studie war eine Untersuchung des Körpererlebens in Bezug auf psychische ICD-10-Diagnosen, Alter und Geschlecht bei Patienten einer psychosomatischen Ambulanz auf der Basis vorab formulierter Zusammenhangshypothesen. Methodik/Stichprobe: Von 1114 Patienten, die im Verlauf von 10 Monaten in der psychosomatischen Ambulanz untersucht wurden, waren 865 zur Studienteilnahme bereit. Die Untersuchung wurde mittels Frankfurter Körperkonzeptskalen (FKKS, Deusinger 1998) durchgeführt. Ergebnisse: Patienten, die die Kriterien für mindestens eine psychische ICD-10-Diagnose erfüllten, wiesen signifikant negativere Körperkonzepte auf als die von Deusinger untersuchten Normstichproben. Patienten mit der ICD-10-Diagnose einer Essstörung zeigten gegenüber den anderen Diagnosegruppen die am stärksten negativ ausgeprägten Körperkonzepte. Männer gaben positivere Körperkonzepte an als Frauen. Unter 30jährige zeigten für die meisten Unterskalen der FKKS positivere Körperkonzepte als über 50jährige. Diskussion: Die hypothesenkonformen Unterschiede in der Körperwahrnehmung in Bezug auf das Geschlecht und das Alter könnten durch gesellschaftliche Einflüsse (z.B. Schönheitsideale, die Frauen stärker betreffen) erklärbar sein. Diskutiert werden weiter die komplexen Zusammenhänge zwischen Störung des Körpererlebens und psychischer Störung und die therapeutischen Implikationen. Stationäre Psychotherapie bei schwer anorektischen Patienten Voigt B., Craciun E. M., Ballmaier M., Klapp B. F. Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Charité Universitätsmedizin Berlin, Charité-Campus Mitte, Luisenstr. 13a, 10117 Berlin Frühzeitige therapeutische Intervention mit der Integration von Verhaltenstherapie und psychodynamischer Psychotherapie umfasst eine komplexe Behandlung, die Einzelgespräche, Gruppen- und Sporttherapie sowie körperpsychotherapeutische und edukative Maßnahmen einschließt. Darüber hinaus wird die Familie in die Behandlung einbezogen. Ein wichtiger Eckpfeiler der Behandlung stellt eine längerfristige Planung ambulanter therapeutischer Maßnahmen dar. Am Beispiel eines klinischen Verlaufs einer Patientin unter Einbeziehung der Selbsteinschätzung mittels psychometrischer Testverfahren (Einschätzung persönlicher Ressourcen, Selbstregulation, wahrgenommener Beschwerden) wird das Konzept stationärer Psychotherapie im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplans vorgestellt, welches sich auch bei schwer anorektischen Patienten mit einem BMI < 13 kg/ m2 bewährt hat. Interdisciplinary Treatment of Severe Anorexia Nervosa Craciun E. M., Voigt B., Nischan A., Pirlich M., Klapp B. F., Ballmaier M. Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Charité Universitätsmedizin Berlin, Charité-Campus Mitte, Luisenstr. 13a, 10117 Berlin We would like to introduce a concept for an interdisciplinary inpatient treatment of Anorexia Nervosa (predominant patients with a BMI less than 13 kg/m²). The participating disciplines are internal medicine, psychiatry and psychosomatics. All the patients agree to the therapy voluntarily. The duration of the treatment is adapted to every patient’s individual necessity. Usually it lasts between 3 and 8 months. We start with a week of systematic diagnostics to verify the somatic and psychic state of the individual patient. Then the therapy starts on three different levels: 1. stabilisation of the somatic state and weight gain (treatment of the different somatic problems; strict, individually adjusted dietprogram including high caloric beverages and/ or nasogastric-tube feeding, exercises to relearn eat- 125 ing and information about food and normal eating behaviour; medication) 2. amelioration of the own body perception and acceptance (including individual physiotherapy and sports program, massage, mirror therapy, music- and art- therapy) 3. work on conflicts and problem areas as well as perspectives (psychotherapy including single, group and family sessions; work on and organisation of perspectives after the inpatient treatment) The aim of our concept is to long-term stabilize our patients and prevent relapses on the bases of a strong relationship between patients and the therapeutic team during the months of treatment and afterwards (ambulant group sessions). We will present first promising results. Emotionsverarbeitung bei Anorexia Nervosa: eine Untersuchung zu Besonderheiten in der Emotionserkennung und–regulation 1 2 1 1 Wächter B. , Hartmann A. , Joos A. , Zeeck A. 1 Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg, Hauptstr. 8, 79104 Freiburg 2 Abt. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Hauptstrasse 8, 79104 Freiburg Frühere Studien weisen auf Störungen in der Emotionsverarbeitung bei Patientinnen mit Anorexia Nervosa (AN) hin. Die Ergebnisse sind jedoch widersprüchlich. Ein besseres Verständnis der betroffenen Bereiche der Emotionsverarbeitung ist v.a. für die psychotherapeutische Arbeit bedeutsam. In der vorliegenden Untersuchung wurden 23 Frauen mit AN und nach Alter und Bildung gematchte Kontrollprobandinnen verglichen. Es wurde angenommen, dass sich beide Gruppen nicht hinsichtlich der Emotionserkennung unterscheiden, sehr wohl aber in Bezug auf Verarbeitungsmechanismen in emotional aufgeladenen, sozialen Situationen. Zur Prüfung der Emotionserkennung wurden visuelle Stimuli (Palermo & Coltheart, 2004) eingesetzt, welche Gesichter zeigen (Ärger, Ekel, Angst, Freude, Trauer, neutrale Bilder). „Coping“Mechanismen in emotional aufgeladenen sozialen Situationen wurden über den FKBS (Fragebogen zu Konfliktbewältigungsstrategien) erfasst. Es wurde für Depressivität und Alexithymie kontrolliert und auch das grundsätzliche emotionale Erleben erhoben (BDI, TAS-20, PANAS). Eine vorläufige Auswertung ergab keine Unterschiede in der Emotionserkennung. Anorexiepatientinnen zeigten insgesamt höhere Werte für Alexithymie und ein ins negative verschobenes emotionales Erleben. Sie bewältigen emotional aufgeladene soziale Situationen signifikant häufiger über eine „Wendung gegen das eigene Selbst“ (FKBS) und empfinden in aggressiv-angespannten Situationen signifikant mehr Angst, Trauer und Erregung. Der Einfluss von Selbstwirksamkeit und Narzissmus auf den Therapieverlauf bei Patientinnen mit Anorexia nervosa Craciun E. M., Peetz C., Voigt B., Becker J., Buchwald C., Klapp B. F., Fliege H. Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Charité Universitätsmedizin Berlin, Charité-Campus Mitte, Luisenstr. 13a, 10117 Berlin Ziel der vorliegenden Studie ist es, den Einfluss von Selbstwirksamkeit und Narzissmus auf den Therapieverlauf bei Patientinnen mit Anorexia nervosa (AN) zu untersuchen. Das Narzissmusinventar und der Selbstwirksamkeits- Optimismus- Pessimismus- Fragebogen wurden 69 Patientinnen mit AN zu Beginn eines stationären Aufenthaltes vorgelegt. Ein positiver Therapieverlauf wurde anhand einer Zunahme der „gehobenen Stimmung“ (Subskala des Berliner Stimmungsfragebogens), einer Abnahme des „Beschwerdedrucks“ (Skala des Gießener Beschwerdebogens) und einer Zunahme des Body- Mass- Indexes im Verlauf des stationären Aufenthaltes gemessen. Es konnte gezeigt werden, dass Patientinnen mit AN, die niedrige Werte in sieben der acht Subskalen der ersten Dimension „Bedrohtes Selbst“ des Narzissmusinventars aufwiesen, ein positiveres Therapieergebnis erzielten. Zusätzlich sagten hohe Werte in Selbstwirksamkeit ein positiveres Therapieergebnis vorher. Es wurden Interkorrelationen zwischen Selbstwirksamkeit und sieben Subskalen der Dimension „Bedrohtes Selbst“ gefunden. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass eine geringere Destabilisierung im Selbst- System anorektischer Patientinnen zu einem positiveren Therapieverlauf führen kann. Auch begünstigen hohe Werte in Selbstwirksamkeit den Therapieverlauf. Implikationen für die Forschung und die therapeutische Praxis werden diskutiert. Veränderung von essstörungsrelevanten Symptomen bei anorektischen Patientinnen im Verlauf einer stationären Psychotherapie Schlegl S., Tagay S., Düllmann S., Senf W. Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Essen, Virschowstr. 174, 45147 Essen Fragestellung: Ziel der Studie war es, Therapieeffekte zu überprüfen und zu spezifizieren, zu welchem Zeitpunkt sich essstörungsrelevante Symptome im Verlauf einer stationären Behandlung verändern. Methode: 38 Anorexie-Patientinnen wurden zu mehreren definierten Messzeitpunkten mit dem EDI-2 getestet. Prä-post-Werte lagen zusätzlich bzgl. des BSI, des IIP-D und des SF-12 vor. Ergebnisse: Insgesamt zeigte sich eine hochsignifikante Verbesserung der allgemeinpsychopathologischen Symptomatik, der interpersonalen Probleme und der Lebensqualität. Zu Messzeitpunkt 2 zeigten sich signifikante Veränderungen im BMI 126 und in der EDI-2-Skala Bulimie. Zu Messzeitpunkt 4 wurden die Skalen Schlankheitsstreben, Ineffektivität und Soziale Unsicherheit signifikant. Verbesserungen in den Bereichen Interozeptive Wahrnehmung, Askese und Impulsregulation waren zu Messzeitpunkt 5 feststellbar. Für die Bereiche Unzufriedenheit mit dem Körper, Perfektionismus, Misstrauen und Angst vor dem Erwachsenwerden zeigten sich über den gesamten stationären Behandlungsverlauf hinweg keine signifikanten Verbesserungen. Diskussion: Veränderungen im BMI und in der bulimischen Symptomatik konnten relativ zeitnah festgestellt werden. Auch Bereiche wie Schlankheitsstreben, Interozeptive Wahrnehmung und Askese scheinen einer Behandlung unmittelbarer zugänglich, wohingegen sich Bereiche wie Perfektionismus, Misstrauen und Angst vor dem Erwachsenenwerden als veränderungsresistenter erwiesen. Sagen spezifische Selbstwirksamkeitserwartungen eine erfolgreiche Gewichtsreduktion vorher? Erste Ergebnisse aus dem multimodalen Therapieprogramm zur Verbesserung der Versorgung von Patienten mit Adipositas und Metabolischem Syndrom an der Charité – Universitätsmedizin Berlin Hempel C., Ahnis A., Riedl A., Klapp B. F. Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Charité Universitätsmedizin Berlin, Charité-Campus Mitte, Luisenstr. 13a, 10117 Berlin Hintergrund: Fehlernährung und Bewegungsmangel leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung von Adipositas. Eine dauerhafte Änderung dieser verhaltensbezogenen Faktoren zur Gewichtsreduktion und Steigerung der Lebensqualität erfordert zum einen ein umfassendes Behandlungskonzept, zum anderen subjektive Kompetenzerwartungen seitens der Patienten. Methode: Erwachsene adipöse Patienten der DAK nehmen an der Charité – Universitätsmedizin Berlin an einem einjährigen multimodalen Gewichtsreduktionsprogramm teil. Elemente sind Ernährungs-, Bewegungs-, Verhaltens- und Entspannungstherapie. Es finden psychometrische Verlaufsmessungen statt, welche den Zusammenhang von ernährungs- und bewegungsbezogener Selbstwirksamkeitserwartung, Gewichtsabnahme und Lebensqualität untersuchen. Erwartete Resultate: Hohe ernährungs- und bewegungsbezogene Selbstwirksamkeitserwartungen zu Therapiebeginn prädizieren eine erfolgreiche Gewichtsabnahme nach drei Monaten. Patienten mit einer erfolgreichen Gewichtsabnahme zeigen einen signifikant positiven Zuwachs an Lebensqualität. Ausblick: Die Ergebnisse der Untersuchung sollen bestehende Auswahlkriterien zur Therapieaufnahme optimieren, um den Erfolg des Gewichtsreduktionsprogramms zu gewährleisten. Innerhalb des Programms ist eine individuelle An- passung der spezifischen Selbstwirksamkeitserwartungen durch verhaltenstherapeutische Interventionen möglich. Bedingungen für einen positiven Verlauf von Anorexia nervosa- erste Ergebnisse einer 15Jahres-Katamnese Apel L., Kallenbach-Dermutz B., ZimmermannViehoff F., Köpp W., Weber C., Deter H. Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie, Charité Unversitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin Einleitung: Die Anorexia nervosa (AN) hat eine Prävalenz von etwa 1% und weist eine hohe Chronifizierungsrate mit bedeutender Mortalität auf. Kenntnisse zum Krankheitsverlauf haben Implikationen für die Primär- und Sekundärprävention, für die Ausbildung im medizinischen Bereich sowie für die Struktur von Versorgungseinrichtungen. Fragestellung und Ziele: Im Rahmen einer KatamneseStudie soll der Krankheitsverlauf von ehemals stationär behandelten Patienten beschrieben werden. Es sollen Faktoren ermittelt werden, die den Verlauf beeinflussen. Zentral ist hierbei die Ermittlung von Faktoren, die zu einem guten körperlichen und seelischen Gesundheitsstatus beitragen. Methode: In der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie, Campus Benjamin Franklin, Charité Berlin, wurden zwischen 1979 und 1997 n=101 Patienten mit AN stationär behandelt. In einer Nachuntersuchung werden körperliche (Laborparameter, körperlicher Gesundheitsstatus), psychische (EDI2, BSI, SIAB-EX, SKID-II,) und soziale Variablen bei dieser Kohorte untersucht. Weiter wird anhand der Morgan-Russel-Kriterien sowie des ANSS der Krankheitsverlauf beurteilt. Ergebnisse: Unter den 101 Patienten waren 99 Frauen und 2 Männer, das Durchschnittsalter zum Behandlungszeitpunkt betrug m=24.4, s=6.6. Ausblick: Die Nachuntersuchung hat im September 2008 begonnen, bis März 2009 können erste Daten von 20 Patienten präsentiert werden. Bedingungen für einen positiven Verlauf sollen spezifiziert werden. Evaluation des Schulprojekts PriMa zur Primärprävention von Essstörungen bei Mädchen ab der 6. Klasse (Pilot- und Replikationsstudie) Brix C., Bormann B., Sowa M., Beinersdorf J., Lüdecke M., Berger U. Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena, Stoystr. 3, 07740 Jena Ueber ein Viertel der 12-jährigen Maedchen in Thueringen zeigen nach Befragung mit dem Eating-Attitudes-Test (EAT26-D) ein auffaelliges Essverhalten und damit ein erhoehtes Risiko für die Entwicklung einer Ess-Stoerung. Mit dem Programm „PriMa“ zur Primaerpraevention von Ma- 127 gersucht bei Maedchen ab der 6. Klasse liegt eine wirksame schulbasierte Intervention vor (Berger et al., 2007). Der erfolgreiche Wirkungsnachweis muendete in einem vom BMBF gefoerderten Projekt, welches die Ueberpruefung der Wirksamkeit des Programms an einer groeßeren Stichprobe sowie die Neukonzeption und Evaluation des darauf aufbauenden Projekts „Torera“ für Jungen und Maedchen ab der 7. Klasse zur Praevention von Bulimie, Fress-Attacken und Adipositas ermoeglichte. Die Replikation der Prae-PostKontrollgruppenstudie erfolgte mit 99 Thueringer Schulen (51 PriMa-Schulen) von September 2006 bis Juli 2008. Erhoben wurde an vier Messzeitpunkten (unmittelbar vor, direkt nach und 3 Monate nach „PriMa“) die spezifische Wirkung des Programms auf den koerperbezogenen Selbstwert (FBeK), die Zufriedenheit mit der eigenen Figur (Body Image Silhouettes), Einstellungen zum Dickund Dünnsein sowie das Essverhalten (EAT-26D). Wiederum zeigten sich auf allen Variablen in der Untergruppe mit hoeherem Risiko (EAT-26D >= 10 Punkte) signifikante Verbesserungen vom 1. zum 3. Messzeitpunkt. Diagnostischer und therapeutischer Wert der bildtheoretisch fundierten Bilddeutung in der Behandlung von Anorexia Nervosa Schäfer C., Voigt B., Klapp B. F. Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Charité Universitätsmedizin Berlin, Charité-Campus Mitte, Luisenstr. 13a, 10117 Berlin In das therapeutische Spektrum der Behandlung von Anorexie-Patienten gehören die Kunsttherapien verschiedener Provenienz. Die von uns angewandte selbstpsychologisch orientierte interaktiv-psychoanalytische Kunsttherapie, welche diagnostisch und therapeutisch die Patient-WerkInteraktion und somit die Bildlichkeit des Bildes mit der Auslegung des Bildsinns in Verbindung setzt, ist ein neuer Ansatz innerhalb der künstlerischen Therapien. Ausgehend von einer laienhaften Ausdrucksvorstellung neigen Patienten mit Entgleisung der Affektregulation und Störungen des Selbstgefüges dazu, in bildnerischen Arbeiten rhetorisch und szenisch angereicherte Werke zu erzeugen. Dadurch konzentriert sich ihre Bildproduktion auf das narrativ Ausgedrückte und auf die darstellende Performation. Der Vortrag zeigt - mit Einbeziehung der neuesten für die Ausdruckspsychopathologie relevanten bildhermeneutischen Verfahren - wieweit die Zeigekraft des Bildes in der Affektregulation des Ausdrucksgeschehens erzählerisch-demonstrativ verstanden wird, wobei unbewusste Komponenten der Persönlichkeit mit der Analyse der Materialbehandlung, der Ausdruckshaltung und dadurch mit den nicht unmittelbar sichtbaren Bildkonstituenten erschlossen werden. Wie häufig ist die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei adipösen Patientinnen und Patienten? Gruß B. Psychosomatische und Psychotherapeutische Abteilung, Universitätsklinikum Erlangen-Nürnberg, Hintergrund: Verlaufsstudien (Mannuzza et al., 1993; Rasmussen et al., 2000) zeigen, dass ADHS bei 30-60% der Betroffenen im Erwachsenenalter persistiert und einen Vulnerabilitätsfaktor für spezifische Störungen des Erwachsenenalters darstellt. Studien (Davis et al., 2006; Holtkamp et al., 2004) zufolge ist auch bei adipösen Patienten ADHSspezifische Diagnostik von großer Wichtigkeit. Altfas (2002) berichtet eine Prävalenz von 27,4% unter Anlegung eines BMI von < 40 bzw. 42,6% (≥ 40). Methode: Diese Studie erfasst, wie häufig adipöse Patienten unter Symptomen einer ADHS leiden. Neben Auffälligkeiten im Kindesalter (WURSK) und aktuellem ADHS-Status (ADHS-SB) wurden mögliche Symptomüberschneidungen (u.a. Depressivität) berücksichtigt. Ergebnisse & Diskussion: Von den aktuell eingeschlossenen Patienten (16 Frauen, 8 Männer) litten 75% an Adipositas III (BMI ≥ 40) und bei 58,3% wurde mindestens eine weitere psychiatrische Diagnose gestellt (vorwiegend Binge-Eating-Störung oder Depression). 26,1% erzielten auffällige Werte in der WURS-K und 39,1% in der aktuellen ADHSSelbstbeurteilung. 13% hatten konsistent auffällige Werte auf beiden Skalen, allerdings wiesen 2/3 von ihnen auch klinisch relevante Depressivitätswerte auf. Daher muss genauer hinterfragt werden, wodurch die Symptomatik am besten zu erklären ist bzw. inwieweit mehrere Komorbiditäten bestehen. Dennoch sprechen die Zahlen für die Relevanz der Symptomerhebung und ihrer Berücksichtigung in der weiteren Therapie. Selbstregulationsstrategien von essgestörten Patientinnen Ost S., Pöhlmann K., Joraschky P. Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden Hintergrund: Essgestörte Patienten weisen beim Umgang mit Problemen und beim Streben nach Zielen weniger effektives Verhalten auf als Gesunde (Ball & Lee 2000). Bei psychotherapeutischen Interventionen fördern Therapieziele die Therapiemotivation der Patienten und haben positive Effekte auf den Therapieverlauf (Driessen et al. 2001). Methodik: Die Stichprobe besteht aus 49 Patientinnen, die aufgrund einer Essstörung (F50.0, F50.1, F50.2, F50.3) in einer stationären oder teilstationären Psychotherapie behandelt wurden. Die Selbstregulationsstrategien wurden mittels GSAB (Karoly & Ruehlmann 1995) erfasst. In diesem Fragebogen sollen die Patientinnen mit- 128 telfristige Ziele formulieren. Es wurde eine Gruppe von Patientinnen ohne störungsspezifischen Ziele und eine mit störungsspezifischen Zielen gebildet. Fragestellung: Wie verändern sich die Selbstregulationsstrategien der Patientinnen im Therapieverlauf in Abhängigkeit vom Vorhandensein von essstörungsspezifischen Zielen? Ergebnisse: Bei Patientinnen ohne essstörungsspezifische Ziele zeigten sich kaum Veränderungen der Selbstregulationsstrategien im Therapieverlauf. Patientinnen mit störungsspezfischen Zielen wiesen deutliche Verbesserungen ihrer Selbstregulationsdefizite auf. Schlussfolgerung: Diese Gruppe von Patientinnen, deren Symptomatik in ihr Zielsystem integriert ist, kann gezielter am Fokus ihrer Essstörung arbeiten und einen besseren Behandlungserfolg abgebildet durch die Selbstregulationsstrategien erreichen. 129 Psychosomatik in der Gynäkologie Klimakterische Beschwerden aus psychosomatischer Sicht: Epidemiologie und Korrelate 1 1 1 2 Richter J. , Weidner K. , Bittner A. , Glaesmer H. , 2 2 1 Stöbel-Richter Y. , Brähler E. , Joraschky P. 1 Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 2 Selbständige Abteilung für Medizinische Psychologie und Soziologie, Universität Leipzig, Philipp-RosenthalStraße 55, 04103 Leipzig In der Lebensphase des Klimakteriums müssen sich Frauen mit dem Ende der eigenen Fruchtbarkeit u. einem Rollenwandel in Partnerschaft u. Gesellschaft auseinander setzen. Unser Ziel ist es, die epidemiologische Bedeutung als auch Korrelate für klimakterische Beschwerden aufzuzeigen.Es werden Ergebnisse einer repräsentativen Untersuchung an N=1350 Frauen in Deutschland dargestellt. Folgende Fragebögen kamen zum Einsatz: FAQ (Müdigkeit), SOZU14 (Soziale Unterstützung), FLZ (Lebenszufriedenheit) und MRS II (Klimakterische Beschwerden). Erste Analysen zeigen, dass 87% der deutschen Frauen im Alter zwischen 45 und 70 Jahren mindestens ein klimakterisches Symptom in leichter Ausprägung aufwiesen (z.B. Hitzewallungen od. depressive Verstimmung). Acht Prozent der Frauen litten unter starken bis sehr starken Schlafstörungen und 9% unter starken bis sehr starken Gelenk- und Muskelbeschwerden. Signifikante Korrelate für stark ausgeprägte Klimakteriumsbeschwerden waren Müdigkeit und geringe Zufriedenheit in den Bereichen: allgemeine Beschwerden/Schmerzen, Freunde/Bekannte und Energie/Lebensfreude. Das epidemiologische Ausmaß u. die Korrelate von Klimakteriumsbeschwerden unterstreichen die Relevanz des Forschungsbereiches u. die Notwendigkeit psychotherapeutisch/psychosomatischer Interventionen. Die genannten Korrelate können im therapeutischen Setting bearbeitet werden; zukünftige Studien müssen zeigen, ob eine Beeinflussung des Ausmaßes klimakterischer Beschwerden möglich ist. Qualitative Untersuchung zur Versorgung körperlich behinderter Frauen in der Gynäkologie Neises M. Funktionsbereich Psychosomatische Frauenheilkunde, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-NeubergStrasse 1, 30625 Hannover In der Zeit von 12/07 bis 04/08 wurden 5 Rollstuhlfahrerinnen, im Alter von 40 - 52 Jahren, in eine qualitative Untersuchung einbezogen. Es wurden offene, Leitfaden-orientierte Interviews geführt, mit folgendem Themenfokus: Erfahrungen in der gynäkologisch-geburtshilflichen Behandlung in Praxis und Klinik. Beklagt wurde von allen Frauen die unzureichende Information über die gynäkologische Praxis bei der Terminplanung, weder von den Ärzten noch von den Arzthelferinnen wurden ausreichende oder zutreffende Angaben zur Erreichbarkeit der Praxisräume für Rollstuhlfahrerinnen gemacht. Neben diesen Barrieren im Zugang beschrieben die Frauen Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme, so z.B. der fehlende Sichtkontakt in Augenhöhe im Anmeldebereich. Von allen Frauen wurde vehement die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit der Lagerung auf dem gynäkologischen Stuhl betont. Gleichzeitig hoben alle Frauen das gutwillige Engagement von Ärzten und Arzthelferinnen hervor allerdings bei oft fehlender Sachkompetenz. Die Folge ist, dass körperbehinderte Rollstuhlfahrerinnen präventive Angebote in der Gynäkologie nicht nutzen, was für diese Personengruppe wichtig wäre, insbesondere wegen ihrer eingeschränkten Wahrnehmungsmöglichkeiten von urogenitalen Beschwerden. Ich danke Herrn Dr. Pacharzina, MHH, für die Unterstützung bei der Leitfadenentwicklung und Herrn Dr. Kruse, Universität Freiburg, für die Hilfe bei der Auswertung. Wirksamkeit eines kognitiv-behavioralen Gruppenprogramms bei Schwangeren mit erhöhten Stress-, Angst- und depressiven Symptomen Bittner A., Weidner K., Richter J., Müller C., Eisenhardt U., Lehmann C., Junge-Hoffmeister J., Joraschky P. Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden Wenige Studien haben den Einfluss psychologischer Interventionen auf das Stresserleben bzw. ängstliche und depressive Symptomatik in der Schwangerschaft untersucht. Ziel der Studie ist deshalb die Untersuchung der Wirksamkeit eines Gruppenprogramms hinsichtlich einer Reduktion von Stress, Angst und Depressivität der werdenden Mutter und der Prävention von Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen. In einer längsschnittlich angelegten Studie wurden bisher 365 schwangere Frauen im ersten Trimenon hinsichtlich Stress (PDQ), Angst (STAI) und Depressivität (BDI) in Dresdner Frauenarztpraxen gescreent (Ausschöpfungsquote 77%). Frauen mit erhöhten Werten werden zur Teilnahme an der Interventionsstudie eingeladen, es erfolgt eine randomisierte Zuordnung zu einer Interventions- und einer Kontrollgruppe. Prä-Post-Daten liegen aktuell von insgesamt 49 Probandinnen vor. Vorläufige Analysen zeigen, dass klinisch relevante depressive Symptomatik bei ca. jeder zehnten Schwangeren im ersten Trimenon vorliegt, was die hohe Bedeutsamkeit von psychotherapeutischen Frühinterventionsmaßnahmen in diesem Bereich unter- 130 streicht. Auf der Tagung werden die Effekte der Intervention hinsichtlich des Wissenszuwachses der Teilnehmerinnen, der Reduktion von Angst- und depressiven Beschwerden sowie der Reduktion von Risikofaktoren für die Entwicklung von Angststörungen und Depression vorgestellt. 1 Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden, Chemnitzer Str. 46, 01187 Dresden 2 Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden 3 Ein interdisziplinärer und multimodaler Forschungs- und Behandlungsansatz zur postpartalen Depression 1 1 1 1 Würzburg J. , Oddo S. , Thiel A. , Klinger D. , 1 1 1 Grabmair C. , Steetskamp J. , Thiel J. , Louwen 2 1 F. , Stirn A. 1 Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Bereich Psychosomatik, Heinrich-Hoffmann-Straße 10, 60528 Frankfurt a.M. 2 Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universitätsklinik Frankfurt a.M., Theodor-Stern-Kai, 60590 Frankfurt a.M. Die postpartale Depression (PPD) tritt zwischen der 2. und 6. Woche nach der Geburt bei ca. 10 % aller Entbundenen auf. Die Symptomatik umfasst sowohl depressive Symptome, als auch zwiespältige Gefühle gegenüber dem Kind, Überforderung, Versagensängste bis hin zum Suizid und Infantizid. Da die PPD verheerende Auswirkungen für Mutter und Kind haben kann, ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen gynäkologischen und psychosomatischen Fachdisziplinen dringend notwendig. In unserer Studie mit telefonischer Beratung rund um die Uhr (01577-4742654), Internetpräsenz (www.wochenbettdepression-hotline.de), klinischen, testpsychometrischen und bildgebenden Untersuchungen werden zahlreiche Komponenten als mögliche Einflussfaktoren untersucht. Mittels fMRT werden die neuronalen Korrelate der emotionalen Involviertheit zum eigenen versus fremden Kind bei Müttern mit PPD erfasst und mit einer gesunden Kontrollgruppe verglichen. Die ersten Ergebnisse zeigen eine Prävalenz der PPD von 8%. Klinisch manifestiert sich eine Persönlichkeitsstruktur mit hohem Selbstanspruch und perfektionistischem Streben. Die neuronalen Ergebnisse zeigen eine unterschiedliche emotionale Reaktion der postpartal depressiven Frauen im Vergleich zu den gesunden Frauen in limbischen Arealen beim Betrachten des eigenen Babys. Insgesamt handelt es sich um eine multikausal bedingte Erkrankung mit interindividuellen Unterschieden, die eine umfassende Diagnostik und Behandlung erforderlich macht. Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden Epidemiologische Studien zeigen, dass Stress, Ängste und Depressionen - entgegen dem Mythos der „glücklichen Schwangeren“ - in der Pränatalzeit ebenso häufig auftreten wie in anderen Lebensphasen. Obwohl longitudinale Studien rar sind, gilt als bestätigt, dass pränatale/r Angst/Stress negative Auswirkungen auf den Fetus, den Schwangerschaftsverlauf, die Geburt sowie die Entwicklung des Kindes haben sowie ein Risikofaktor für postpartale psychische Störungen der Mutter sowie die Mutter-Kind-Interaktion darstellen. Somit kommt der frühzeitigen Identifikation pränatal auffälliger Frauen und ihrer adäquaten Behandlung große Bedeutung zu. Systematische Behandlungsangebote sind international äußerst rar - nicht zuletzt, weil die Größenordnung des Problems nicht ausreichend bekannt und als spezifisches Handlungsfeld anerkannt ist. Wir möchten hier einen Beitrag leisten. Im Rahmen einer Interventionsstudie werden derzeit schwangere Frauen (bisher N=365, ausgegebene Fragebögen N=475, Ausschöpfung 77%, ø Alter: 29;3 Jahre) in Dresdner Frauenarztpraxen bzgl. ihrer psychopathologischen Belastung im ersten Trimenon gescreent. Gemessen werden u.a. schwangerschaftsbezogener Stress (PDQ), Angst (STAI) und Depressivität (BDI-V). Erste Daten belegen, dass ca. jede zehnte Frau im ersten Trimenon eine klinisch relevante, d.h. behandlungsbedürftige psychische Problematik aufweist. Detaillierte Analysen und Implikationen für notwendige Behandlungsangebote werden präsentiert und diskutiert. Schmerz und Somatoforme Störungen Einfluss psychologischer Faktoren auf Ergebnisse orthopädischer Gelenkoperationen 1 2 1 Schiltenwolf M. , Henningsen P. , Koch L. 1 Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg, Schlierbacher Landstr. 200 a, 69118 Heidelberg 2 Schwangerschaft:„Frohe Hoffnung“ oder „andere Umstände“? - Psychische Beschwerden junger Frauen während der Pränatalzeit 1 2 2 Junge-Hoffmeister J. , Richter J. , Bittner A. , Ei3 3 3 senhardt U. , Lehmann C. , Joraschky P. , Weid2 ner K. Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, KLinikum rechts der Isar der TU München, langerstrasse 3, 81675 München Psychologische Einflussfaktoren auf Ergebnisse elektiver Gelenkchirurgie sind bislang nicht untersucht.In einer Längsschnittstudie konnten 234 Patienten für Hüftendoprothese (HE, N=86), Knieen- 131 doprothese(KE, N=71), Meniskusoperation(AM, N=58), Hallux-valgus-Korrektur(HK, N=45) nach 6, 12 und 24 Monaten untersucht werden. Prä- und postoperativ wurden Schmerzstärke und psychologische Störungskriterien (PHQ: Somatisierung, depressive Störung, Panik- und Angststörung) erfasst, postoperativ auch Unzufriedenheit. Chi2Test und multivariate logistische Regression für postoperativen Schmerz und Unzufriedenheit. Positive Skalenwerte der Somatisierung erreichten präop. in Gruppe HE/KE/AM/HK 22%/10%/12%/9%, der Major-Depression 15%/ 18%/2%/4%, sonstiger depressiver Störung 31%/30%/22%/22%, der Panikstörung 6%/3%/5%/2% sowie der Angststörung 11%/11%/2%/2%. Die postoperativen Ergebnisse waren stabil. Knapp 40% beklagten weiter Schmerzen. Nach Regressionsanalyse erreichte Somatisierung die stärkste Odds Ratio (OR) für postoperativen Schmerz (26 nach 6, 24 nach 12 und 8 nach 24 Monaten), gefolgt von Major Depression (7/5/5). Unter diesen Einflussgrößen waren präoperativer Schmerzstärke, Alter, Geschlecht, Panik und Angst keine unabhängige Faktoren. Die abhängige Variable „Unzufriedenheit“ verhielt sich kongruent. Der Einfluss von Somatisierung und Depression auf postoperative Schmerzen und Unzufriedenheit nach elektiver Gelenkchirurgie konnte belegt werden. Die Veränderung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei chronischen Schmerzpatienten im Rahmen eines multimodalen Therapieprogramms 1 1 2 Schubert C. S. , Venkat S. , Söllner W. 1 Schmerztagesklinik Nürnberg, Klinikum Nürnberg Nord, Prof-Ernst-Nathan-Str.1, 90419 Nürnberg 2 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin, Klinikum Nürnberg, Die Schmerztagesklinik Nürnberg bietet chronischen Schmerzpatienten die Möglichkeit an einem vierwöchigen, multimodalen Therapieprogramm teilzunehmen. Als besondere therapeutische Herausforderung gelten Patienten mit der Diagnose Anhaltende somatoforme Schmerzstörung (F45.5). Profitieren diese Patienten in derselben Weise wie andere chronische Schmerzpatienten von einer solchen Behandlung? Bindungsverhalten und Schmerz Giulini M., Schiltenwolf M. Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg, Schlierbacher Landstr. 200 a, 69118 Heidelberg Schmerz als multidimensionales Phänomen, wird durch psychosoziale und biologische Variablen beeinflusst. Die bindungstheoretische Forschung geht davon aus, dass Bindungsstile und damit ver- bundene mentale Modelle des Selbst, anderer und der sozialen Umgebung, durch frühe interpersonelle Erfahrungen geprägt sind. Sie können einen wichtigen Hinweis auf das Krankheitsverhalten, die Inanspruchnahme von Hilfe und den Behandlungserfolg von Schmerz über den gesamten Lebenslauf geben. Die vier Bindungsstile können die Einstellung des Patienten zum Schmerz, die Inanspruchnahme und die Effektivität von Schmerztherapieangeboten und der Umgang mit negativen Emotionen vorher sagen. Unter Berücksichtigung der theoretischen Bindungsperspektive wird untersucht wie die Beziehungen zwischen Bindungsorientierung des Patienten und die Unterstützung durch Ärzte und Therapeuten eine Schmerztherapie beeinflusst. Eine Hypothese ist, dass Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, und die überwiegend sicher gebunden sind, mehr Unterstützungsangebote annehmen, effektiver davon profitieren und über optimistischere Einstellungen verfügen, als unsicher Gebundene. Es wird untersucht wie sich der alltägliche Umgang und die Wahrnehmung des Schmerzes, die durch das jeweilige Bindungsmuster beeinflusst werden, durch ein sicheres therapeutisches Beziehungsangebot positiv verändern lassen? Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es um die speziellen Bedürfnisse des Patienten mit einzubeziehen und therapeutisch günstigen Einfluss auf die bereits erfolgte Chronifizierung zu nehmen? Es werden die Wahrnehmung und Bewertung des Schmerzes und die Veränderung dessen im Verlauf der Behandlung erhoben, zudem die Komorbidität psychischer Erkrankungen. Leitsymptom Schmerz: Erfahrungen mit dem Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ) Kappis B., Schwab R., Laufenberg R. Klinik für Anästhesiologie, Bereich Schmerztherapie, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Bei über 100 konsekutiv untersuchten Patienten einer universitären Schmerzambulanz wurden neben den üblichen klinischen Untersuchungsverfahren auch psychometrische Daten erhoben. Hierzu wurde der Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D), der Deutsche Schmerzfragebogen (neue Version) und der Pain Disability Index (PDI) eingesetzt. Dieses Poster charakterisiert die Patienten einer Schmerzambulanz und zeigt Zusammenhänge von Schmerzvariablen, psychischer Belastung und klinischen Diagnosen. Die Screening-Fähigkeit des PHQ wird untersucht, Zusammenhänge von soziodemographischen Variablen und psychischer Beeinträchtigung werden aufgezeigt und klinisch bedeutsame Implikationen werden abgeleitet. 132 Transplantation Adhärenz in der Transplantationsmedizin – spezielle Aspekte nach Lungen- und Herztransplantation 1 1 2 Erim Y. , Beckmann M. B. , Marggraf G. , Azhari 2 1 P. , Senf W. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Essen, Virschowstr. 174, 45147 Essen 2 Klinik für Thorax- und Kardiovaskuläre Chirurgie, Universitätsklinikum Essen, Hufelandstrasse 55, 45122 Essen Psychische Symptome tauchen bei etwa 25% von körperlich erkrankten Patienten auf (Härter 2005) und werden mit schlechter Therapieadhärenz und schlechtem Outcome in Verbindung gebracht (Raynour et al. 2007). In der Transplantationsmedizin ist der Zusammenhang zwischen einer eingeschränkten Adhärenz und psychischen Belastungen noch nicht untersucht. Insgesamt 64 Patienten nach einer Lungen- und/oder Herztransplantation wurden bezüglich ihrer Einstellungen mit der Medikamentenerfahrungsskala für Immunsuppressiva (MESI, Götzmann et al. 2006) untersucht; Patientengruppen mit „guter“ oder „eingeschränkter“ Compliance gebildet und diese hinsichtlich Depressivität, Angst (HADS-D) sowie posttraumatischer Stresssymptomatik (PTSS-10) verglichen. Für die Gesamtstichprobe waren Angst und Depressivität mit einer gesunden Stichprobe bzw. der Norm vergleichbar. Die Subgruppen unterschieden sich in Bezug auf Depressivität (p=.04), Angst (p<.01) und posttraumatische Belastungssymptomatik (p<.01) signifikant voneinander. Patienten mit eingeschränkter Medikamentencompliance wiesen höhere psychische Belastungen auf. Unsere Ergebnisse deuten auf einen Zusammenhang zwischen psychischen Belastungen und eingeschränkter Medikamentencompliance hin. Psychische Belastungen von Transplantationspatienten sollten auch postoperativ regelmäßig evaluiert werden, um bei Bedarf frühzeitig intervenieren und ein gutes Outcome sichern zu können. Abstinenz nach Lebertransplantation: Beurteilungsmethoden und psychische Einflüsse 1 1 1 Erim Y. , Beckmann M. B. , Gräf J. , Beckebaum 2 2 3 4 1 S. , Cicinnati V. , Böttcher M. , Paul A. , Senf W. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Essen, Virschowstr. 174, 45147 Essen 2 Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinikum Essen, Hufelandstrasse 55, 45147 Essen 3 Laborarztpraxis Dessau, Dessau, Bauhüttenstrasse 6, 06847 Dessau 4 Klinik für Allgemeinchirurgie Viszeral- und Transplantationschirurgie, Universitätsklinikum Essen, Hufelandstrasse 55, 45147 Essen Messungen des Äthylglukuronid, eines Ethanolmetabolits, im Urin, erwiesen sich in eigenen Studien (Erim et al 2007) als zuverlässiger Indikator des Trinkverhaltens vor der Transplantation. Wir untersuchten in der folgenden Studie, in welchem Masse Patienten nach einer Lebertransplantation ihren Alkoholkonsum wiederaufnehmen und welche psychischen Faktoren mit dem Rezidiv zusammenhängen. 67(63%) von 106 konsekutiv in der hepatologischen Transplantationsambulanz angesprochenen Patienten waren bereit, an der Studie teilzunehmen. Abstinenz wurde auf drei verschiedenen Ebenen beurteilt: Selbstaussagen, Fremdeinschätzung und die Messung von Äthylglukuronid im Urin (LC/MS-MS Methode chromotographisch). Schließlich wurde die psychische Symptombelastung (BSI) erhoben. Nach der Arzteinschätzung konsumierten 3% der Patienten Alkohol, 18% der Patienten gaben selbst Alkoholkonsum an und 15% wiesen einen positiven ETGWert auf. Patienten mit Alkoholkonsum gaben gegenüber Patienten ohne Konsum eine signifikant höhere Symptombelastung (p=.05), stärkere Somatisierung, höhere Unsicherheit im Sozialkontakt sowie stärkere Ängstlichkeit an. Nach einer Lebertransplantation konsumiert eine nicht zu vernachlässigende Gruppe von Patienten erneut Alkohol. Dabei ist der Alkoholkonsum mit erhöhten psychischen Belastungen korreliert. Post transplantationem sollten auch psychische Belastungen berücksichtigt werden, um beim Auftreten von schädigendem Alkoholkonsum frühzeitig intervenieren zu können. Posttraumatische Belastungsstörung nach Lebertransplantation 1 1 1 Erim Y. , Beckmann M. B. , Gräf J. , Beckebaum 2 1 S. , Senf W. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Essen, Virschowstr. 174, 45147 Essen 2 Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinikum Essen, Hufelandstrasse 55, 45147 Essen Nach einer Organtransplantation ist eine erhöhte Prävalenz psychischer Störungen zu erwarten (Paris 1994, Dew 1997, Fukunishi 1997), wobei Dew et al. (1997) als häufigste Störung bei Herztransplantierten die Major Depression mit 17% und die PTBS mit 14% beschrieben. Die Vorkommenshäufigkeit von PTSD nach Lebertransplantation ist noch nicht untersucht.Insgesamt 106 Leber transplantierte Patienten wurden mittels des Essener Traumainventars (Tagay et al. 2004; ETI) untersucht. Der ETI-Totalwert lag bei M=9.8 (s=10.4). Als häufigstes traumatisches Erlebnis wurde die Diagnosemitteilung (27%) angegeben. Bei 7 Patienten (7%) waren die Traumakriterien nach DSMIV und der Cut-off-Wert erfüllt. Von diesen Patien- 133 ten wurden folgende traumatische Erlebnisse angegeben: Atemnot nach der Transplantation, Retransplantation und Koma, Diagnosemitteilung, die Krankheit (n= 2) Patienten sowie die Transplantation (n=2). Verglichen mit einer gesunden Stichprobe wiesen die Patienten nach einer Lebertransplantation höhere posttraumatische Symptomausprägung auf. Im Vergleich mit Patienten nach einer Herztransplantation fiel diese niedriger aus. Psychische Belastungen durch posttraumatische Symptome sollten in der psychosomatischen Betreuung von Lebertransplantationspatienten berücksichtigt werden. Psychosomatisch-psychotherapeutische Aspekte in der Herztransplantationsmedizin (HTx) - Eine systematische Literaturübersicht 1 1 2 Vitinius F. , Worms A. , Albus C. 1 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Universität Köln, Josef-Stelzmann-Str. 9, 50931 Köln 2 Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Kerpener Str. 62, 50924 Köln Ziel: Das Ziel dieser Darstellung war es, einen aktuellen Überblick über psychosomatischpsychotherapeutische Aspekte in der Herztransplantationsmedizin zu geben und die Qualität der Studien nach den Cochrane Kriterien zu beurteilen. Ergebnisse: Depressive Patienten haben eine niedrigere Lebenserwartung nach der HTx als nicht depressive Patienten. Patienten mit einer transplantationsbezogenen posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) haben eine signifikant niedrigere Lebenserwartung als Patienten ohne PTBS. Ein erhöhter Body Mass Index nach der HTx erhöht das Risiko, eine chronische Transplantatdysfunktion zu entwickeln. Eine Noncompliance bezüglich der Medikamente vor der HTx sagt ein schlechteres Überleben nach der HTx voraus. Eine Noncompliance bezüglich der Medikation nach der HTx erhöht das Risiko für spätakute Abstoßungsreaktionen und für eine chronische Transplantatdysfunktion. Ein Messintrument zur Abschätzung der Medikamentencompliance ist die Medikamenten-Erfahrungs-Skala für Immunsuppressiva (MESI). Eine internetbasierte psychosoziale Unterstützung kann wahrscheinlich das Outcome der HTx verbessern. Empfehlungen: Die genannten Faktoren müssen berücksichtigt werden. Bei Problemen in einem der Bereiche ist eine konsequente Behandlung zu erfolgen. Ausblick: Es besteht ein Mangel an kontrollierten und randomisierten Studien auf diesem Gebiet. Multizentrische Studiendesigns können helfen, genügend große Fallzahlen zu akquirieren. Organintegration und die Identifikation mit dem Spender– empirische Ergebnisse zur psychischen Verarbeitung einer Lungentransplantation 1 2 1 Götzmann L. , Irani S. , Schwegler K. , Boehler 2 1 A. , Klaghofer R. 1 Abteilung für psychosoziale Medizin, Haldenbachstrasse 18, CH-8091 Zürich, s 2 Department Innere Medizin, ÙniversitätsSpital Zürich, Rämistrasse 100, 8091 Zürich, Schweiz Hintergrund: Patienten nach einer Lungentransplantation werden in einen komplexen mentalen Prozess involviert, der die Integration des Organs wie auch die Verarbeitung der Beziehung zum Spender umfasst. Methodik An der Querschnittsstudie nahmen 76 Patienten nach einer Lungentransplantation teil. Der Fragebogen enthielt Items, die auf Grund der Ergebnisse einer qualitativen Studie entwickelt wurden. Sie beschrieben Aspekte der Organintegration und der Beziehung zum Spender. Ergänzend wurde der chronische Stress (TICS), Distress (SCL-K-9) und die emotionale Verarbeitung der Transplantation bzw. der immunsupressiven Medikation erfasst (TxEQ-D, MESI). Ergebnisse: Die meisten Patienten nehmen das Transplantat als Teil ihres Selbst (97.4%) und nicht als fremdes Objekt wahr (90%). Ein Drittel beschäftigt sich weiterhin mit dem Spender. Die Mehrheit (80.3%) glaubt nicht, Eigenschaften des Spenders übernommen zu haben. Die Faktorenanalyse zeigt eine zweidimensionale Struktur des 5-Item-Fragebogens mit den Faktoren „Organintegration“ und „Spenderidentifikation“. Probleme mit der Organintegration sagen Non-Adherence sowie Scham- und Schuldgefühle voraus. Die Identifikation mit dem Spender ist ein Prädiktor für Stress und Distress. Schlussfolgerung: Treten bei der Organintegration oder in der Beziehung zum Spender Probleme auf, sollten diese vor allem auch hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Adherence bzw. auf das psychische Wohlbefinden therapeutisch bearbeitet werden. 134 Autorenverzeichnis Ahnis, A. Aisenbrey, S. Akinci, S. Albert, W. Albes, J. Albus, C. Alisch, L. Ameli, M. Andreas, S. Anger, B. Angerer, P. Apel, L. Apel-Neu, A. Arck, P. Arnim, A. Arntz, A. Aslaksen, P. M. Atay, H. Athanasiadis, A. Aygün, S. Azhari, P. Bahmer, J. A. Bahrke, U. Balck, F. Ballmaier, M. Balog, P. Barnow, S. Barth, J. Barthel, Y. Bassler, M. Batra, A. Bauder, H. Bauer, A. Bauer, J. Bausch, S. Bäzner, E. Beckebaum, S. Becker, A. Becker, J. Becker, K. W. Becker, N. Becker, S. Beckmann, M. B. Beesdo, K. Beinersdorf, J. Beintner, I. Benninghoven, D. Benoit, D. Beraldi, A. Berberich, G. Berberich, H. J. S. 131 S. 128 S. 25 S. 97 S. 98 S. 11, 54, 66, 138 S. 108 S. 54 S. 120, 121 S. 119, 125 S. 36 S. 132 S. 114 S. 121 S. 72 S. 18 S. 81 S. 24 S. 99 S. 24 S. 137 S. 75 S. 44, 59 S. 37, 112, 114 S. 73, 130 S. 66 S. 26 S. 33 S. 32 S. 20 S. 128 S. 105 S. 96 S. 65, 94 S. 51, 109 S. 69 S. 137 S. 123 S. 131 S. 95 S. 95 S. 42 S. 84, 137 S. 96 S. 132 S. 67 S. 126 S. 105 S. 126 S. 102 S. 77 Berg, P. Berger, M. Berger, U. Bergmann, A. Bering, R. Bernardy, K. Berth, H. Besseler, M. Best, C. Beutel, M. E. Beyer, R. Bibl, M. Bieber, C. Biedermann, T. Bielmeier, P. Bilgin, Y. Binkele, M. Bittner, A. Bjorner, J. Blankenberg, S. Blättler, H. X. Blechert, J. Bleich, S. Bleichner, F. Blum, K. Boehler, A. Bohus, M. Bolm, T. Bölter, A. F. Bölter, R. Book, K. Bootsveld, W. Borgmann, E. Bormann, B. Bosbach, S. Bosinski, H. A. Böttche, M. Böttcher, M. Braas, C. Brähler, E. Braukhaus, C. Braunheim, M. Brechtel, A. Brenner, H. Briggs, S. Brix, C. Brockmann, J. S. 32 S. 84 S. 32 S. 110 S. 105, 106 S. 65, 101 S. 37, 112, 114 S. 124 S. 23, 24 S. 31, 32, 42, 44, 46, 54, 73, 85, 123 S. 48 S. 70 S. 69, 129 S. 115 S. 56 S. 25 S. 42 S. 47, 133, 134, 135 S. 57 S. 46 S. 96 S. 81 S. 128 S. 31, 73 S. 36 S. 138 S. 17, 19, 28, 76 S. 10, 33, 34 S. 94, 119, 125 S. 68 S. 32 S. 33 S. 28 S. 132 S. 75 S. 16 S. 57 S. 137 S. 53 S. 12, 37, 56, 78, 112, 133 S. 120 S. 129 S. 45, 46 S. 82 S. 60 S. 132 S. 117 135 Bruder, A. Brunner, F. Brütt, A. L. Buchheim, A. Buchholz, A. Bühren, K. I. Bühring, M. E. Burbaum, C. Burgmer, M. Byrne, R. A. Cerwenka, S. Cicholas, B. Cicinnati, V. Cierpka, M. Cioca, I. Craciun, E. M. Creed, F. Croy, I. Cuntz, U. Czaja, J. Dafotakis, M. Dahme, B. Damke, B. J. Dannemann, S. Danzer, G. Davis, T. A. de Greck, M. de Jaegher, H. de Liz, T. M. de Zwaan, M. Decety, J. Decker, O. Degener, A. Dekoy, M. Delargardelle, I. Derra, C. Deserno, H. Deter, H. Diehl, S. Dieterich, M. Dimpfl, D. Dinger, U. Dinkel, A. Döbbel, S. Doering, S. Donaubauer, B. Dragan, M. Düllmann, S. Duran, G. Dyer, A. S. Dziewas, R. Ebner-Priemer, U. W. Eckhardt-Henn, A. Edinger, J. Egle, U. Eher, R. S. 103 S. 127 S. 120 S. 10, 43, 87, 88, 92 S. 129 S. 68 S. 72, 74, 116 S. 76 S. 104 S. 96 S. 127 S. 91 S. 137 S. 92, 120, 128 S. 80 S. 73, 130, 131 S. 17 S. 106 S. 12, 15 S. 41 S. 54 S. 11, 16 S. 89 S. 98, 101, 104 S. 92 S. 35 S. 94 S. 86 S. 44 S. 66, 128 S. 65, 93 S. 37 S. 10 S. 109 S. 32 S. 21 S. 44 S. 11, 93, 97, 100, 108, 132 S. 105 S. 23, 24 S. 128 S. 84, 113, 122 S. 32, 114 S. 31 S. 10, 19, 71 S. 38 S. 119 S. 131 S. 32 S. 28 S. 98 S. 27, 74 S. 22, 23 S. 43 S. 21, 22, 51 S. 87 Ehninger, G. Ehrenthal, J. C. Ehrig, C. Ehrlich, A. Ehrlich, S. Eich, W. Eichenberg, C. Eickhoff, A. Einsele, S. Einsle, F. Eisenberg, A. Eisenhardt, U. Eismann, E. Elbing, U. Ellert, U. Elsenbruch, S. Enck, P. Engfer, A. Engst-Hastreiter, U. Ennen, J. Epple, N. Erhart, M. Erim, Y. Esselmann, H. Esser, U. Faber, R. Faiss, J. Fejtkova, S. Fernbach-Fahrensbach, A. Fertl, K. I. Filipowa, A. Fink, G. R. Fink, P. Fischbeck, S. Fischer, F. Fischer, G. Fischer, J. Fischer, T. Fishel, S. R. Fittig, E. Fittschen, B. Flaten, M. A. Fliege, H. Förster, P. Forsting, M. Frank, S. Franke, G. H. Frankenstein, L. Franz, M. Freyberger, H. Freye, T. Friederich, H. Friedrich, A. Friedrich, G. S. 82 S. 81, 85, 109 S. 84 S. 118 S. 70 S. 67 S. 38, 39, 88 S. 117 S. 48 S. 82, 92, 93, 94, 98, 101, 106 S. 48 S. 129, 130 S. 30 S. 11, 47 S. 33 S. 34, 53 S. 33, 34, 41, 78, 79, 111 S. 115 S. 31 S. 68 S. 118 S. 56 S. 24, 81, 132 S. 67 S. 110 S. 66, 104 S. 111 S. 121 S. 37 S. 46 S. 90 S. 52 S. 17 S. 28, 29, 31, 109 S. 81 S. 38, 39 S. 111 S. 120 S. 34 S. 65 S. 58 S. 79 S. 81, 117, 126 S. 36, 108 S. 34, 53 S. 85 S. 30, 83, 99, 114 S. 96 S. 11, 51, 55 S. 25, 50, 55 S. 104 S. 15 S. 118 S. 32 136 Friedrich-Mai, P. Fritzsche, K. Frommberger, U. Frommer, J. Füber, N. Fuchs, D. Fuchs, T. Gärtner, U. Gaus, E. Geber, C. Gedrose, B. Gefeller, O. Geissner, E. Georgiewa, P. Gerlach, D. Geser, W. Giel, K. Gieler, U. Gillitzer, R. Giulini, M. Gizewski, E. R. Glaesmer, H. Glatzel, C. Glaub, J. Glauche, V. Glawe, S Goenner, S. Göhler, H. Golkaramnay, V. Götzmann L. Grabe, H. Grabhorn, R. Grabmair, C. Gräf, J. Gramm, J. Grande, T. Grau, A. Greif-Higer, G. Grimm, A. Groß, C. Groß, G. Grosse Frie, K. Gruber, H. Gründler, R. Gruner, B. Gruß, B. Gummert, J. Gumz, A. Gündel, H. Günther, M. Haas, L. Haase, M. S. 74 S. 10, 73, 111 S. 110 S. 25, 30, 58, 91, 104, 112, 115, 120, 121 S. 63, 98 S. 73 S. 11, 83 S. 32 S. 48 s. 51 S. 123 S. 41 S. 46 S. 90, 121 S. 62 S. 73 S. 33, 41, 79, 111 S. 73 S. 112 S. 131 S. 34, 53 S. 54, 129 S. 111 S. 78 S. 63 S. 11 S.102 S. 105 S. 89 S. 134 S. 25, 49 S. 119 S 130 S. 132 S. 31 S. 81, 103, 116, 124 S. 101 S. 12, 82 S. 121 S. 92 S. 15, 65 S. 35 S. 47 S. 119 S. 22 S. 123, 128 S. 95 S. 99 S. 13, 35, 52, 62, 71, 85, 90, 108 S. 94 S. 92 S. 30, 104 Haass, M. Hackelöer, A. Haferkamp, L. Hagenah, U. Hallschmid, M. Hamdan, W. Hammerle, F. Hardt, J. Harms, D. Harris-Hedder, K. Härter, M. Hartmann, A. Hartmann, L. Hartmann, M. Haselbacher, A. Häuser, W. Hautzinger, M. Heeper, A. Heim, C. Heine, V. Heinmüller, M. Heinrichs, M. Helfricht S. Hellhammer, D. H. Hellmers, C. Hempel, C. Henningsen, P. Henrich, G. Herke, M. Hermann, C. Hermanns, N. Herold, U. Herpertz, S. Herpertz, S. C. Herpertz-Dahlmann, B. Herrmann, M. L. Herrmann-Lingen, C. Herschbach, P. Herzog, T. Herzog, W. Heuft, G. Heussner, P. Hilbert, A. Hildenbrand, G. Hinz, A. Hödl, K. Hoffmann, F. Hoffmann, H. Hoffmann, T. Hoffmeister, K. Höfler, R. Holtkamp, K. S. 96 S. 114 S. 82 S. 15 S. 67 S. 92 S. 23 S. 14, 30, 109, 110, 112, 115, 118 S. 48 S. 117 S. 67, 125 S. 15, 48, 126 S. 106 S. 67 s. 43 S. 20, 63, 98 S. 43, 68 S. 120 S. 26 S. 58, 121 S. 35 S. 85 S. 110 S. 26 S. 46 S. 127 S. 17, 52, 68, 72, 84, 85, 89, 90, 131 S. 31 S. 14 S. 90 S. 59 S. 41, 42 S. 15, 40, 41 S. 19 S. 65 S. 64, 76 S. 11 S. 31, 120, 121 S. 11, 16, 37 S. 12, 15, 65, 66, 67, 80, 96 S. 11, 12, 100, 125 S. 120, 121 S. 40, 41 S. 11, 12, 20 S. 95, 114 S. 60 S. 111 S. 78 S. 30 S. 78 S. 119 S. 15 137 Holzapfel, N. Hölzer, M. Horn, H. Horstmann, D. Hoyer, J. Huber, K. Hummel, T. Hunger, C. Iamandescu, I. B. Icks, A. Imruck, B. H. Irani, S. Irgang, M. Isaak, A. Israel, M. Jacobi, C. Jacobi, F. Jäger, B. Jagla, M. Jansen, A. Jansky, M. Janßen, C. Jantschek, G. Jasper, S. Jenjahn, E. Joachim, R. John, U. J. Joos, A. Joraschky, P. Jost, R. Juen, F. Junge-Hoffmeister, J. Jünger, J. Kächele, H. Kalisvaart, H. Kallenbach-Dermutz, B. Kämpf, F. Kappis, B. Karoff, M. Kästner, D. Kaufhold, J. Kaufmann, C. Kaufmann, S. Keller, A. Keller, M. Keller, P. Kentenich, H. Kerbach, I. Kern, W. Kernhof, K. Kersting, A. Kessler, H. Kettler, R. Kimbel, R. S. 96 S. 48 S. 70 S. 117 S. 54 S. 123 S. 102 116, 124 S. 76, 77 S. 60 S. 32, 57 S. 133 S. 85 S. 92 S. 31 S. 15, 65 S. 54 S. 15, 114 S. 83, 99 S. 78 S. 29 S. 28 S. 11, 122 S. 62 S. 91 S. 117 S. 25 S. 126 S. 31, 42, 45, 61, 82, 91, 93, 94, 95, 98, 101, 102, 106, 107, 129, 130, 131 S. 44, 45 S. 113 S. 130, 131 S. 12, 96 S. 85, 89, 119 S. 70, 72 S. 128 S. 98 S. 132 S. 95 S. 100 S. 119 S. 66 S. 97 S. 91, 98 S. 44, 45 S.86 S. 20, 21 S. 98 S. 67, 68 S. 119 S. 15 S. 85, 90 S. 40 S. 51, 52 Kircher, T. Kirchmann, H. Kirsch, H. Kittel, J. Klaghofer, R. Klapp, B. F. Klauer, C. Klauer, T. Kleen, C. Klein, A. Klein, J. Kleindienst, N. Klement, A. Klingebiel, R. Klinger, D. Klofat, B. Kloor, M. Klosterhalfen, S. Knaevelsrud, C. Knebel, A. Knieling, J. Koch, L. Koch, S. C. Koch, U. Koch-Gromus, U. Koechel, R. Koehler, M. Köhler, W. Köllner, V. König, H. König, R. Koops, E. Köpp, W. Körmendy, C. Korr, H. Kotlarski, B. Koudela, S. Krause, C. Krause, W. Krause, W. H. Kroencke, S. Kronmüller, K. Kruse, J. Kubiak, T. Küchenhoff, J. Kugel, H. Kühne, F. Kuhnt, S Kukk, E. Kulinna, U. Kulzer, B. Kumbier, E. Kunkel, A. Kunzl, F. K. Kupfer, J. S. 13 S. 86 S. 113 S. 95, 114 S. 134 S. 71, 80, 81, 90, 117, 121, 126, 127, 128 S. 78 S. 111 S. 102 S. 39 S. 35 S. 27 S. 64 S. 71 S. 130 S. 28 S. 44, 45 S. 80 S. 56 S. 14 S. 96 S. 131 S. 11 S. 32, 116 S. 117 S. 87, 107 S. 120, 121 S. 111 S. 20, 63, 82, 92, 98, 101 S. 66 S. 63 S. 85 S. 127 S. 95 S. 108 S. 106 S. 54 S. 49 S. 107 S. 87 S. 81 S. 70 S. 60, 71, 72 S. 74 S. 48 S. 50 S. 106 S. 32 S. 121 S. 62 S. 58 S. 99 S. 110 S. 78, 87 S. 73 138 Kuwert, P. Lacour, M. Läer, L. Lahmann, C. Lamott, F. Lane, R. Lange, C. Lange, J. Langenbach, R. Langer, D. Langer, M. Larisch, A. Laubach, W. Laufenberg, R. Lausberg, H. Lauschke, M. Lechner, S. Lees, L. Legenbauer, T. Lehmann, C. Leibbrand, B. Leibing, E. Leichsenring, F. Leising, D. Leiß, O. Lempa, W. Levenstein, S. Leweke, F. Lieb, K. Lieberz, K. Limbacher, E. K. Limbacher, K. Limberger, M. Limm, H. Lindelauf, T. Lindenberg, T. Lindner, R. Lippert, J. Loeschmann, C. Loew, T. Loh, A. Lohmann, K. Louwen, F. Löw, T. Löwe, B. Lüdecke, M. Lüdemann, A. Maatouk, I. Maercker, A. Mahler, J. Maier, B. O. Majd, Z. Marek, A. M. Marggraf, G. Marten-Mittag, B. S. 54, 55 S. 63, 64 S. 53, 90 S. 10, 69, 72, 90 S. 88 S. 53 S. 101 S. 116, 121 S. 31, 49 S. 93 S. 101 S. 112 S. 29, 110 S. 132 S. 10, 114 S. 47 S. 80 S. 84 S. 40 S. 130, 131 S. 32 S. 37 S. 37, 105 S. 104 S. 39 S. 62, 76 S. 117 S. 25, 50, 105, 106 S. 18 S. 55 S. 123 S. 102 S. 27 S. 35 S. 78 S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. 58 111 22 10, 69, 81 67 87, 107 130 97 80, 96, 115 128 98 80 55, 98 50 31 87 107 132 36 Martin, E. Mathiak, K. Matschke, K. Matthes, K. Mauchnik, J. Mehilli, J. Mehnert, A. Meißner, K. Merswolken, M. Mestel, R. Michal, M. Mihailescu, A. I. Milch, W. E. Modica, C. Morawa, E. Morlinghaus, K. Mörtl, K. Mrose, J. Muckermann, P. Mugrauer, K. Mühlbacher, M. Mühlhans, B. Müller, B. Müller, C. Müller, H. Müller, M. J. Müller, S. Müller-Becsangèle, J. M. Müller-Tasch, T. Münte, T. Munz, D. Muth, E. Nehring, C. Neises, M. Neubauer, H. Neugebauer, L. Neumann, E. Nickel, M. Nicolai, J. Nieder, T. O. Nischan, A. Nix, W. A. Noack, R. Nobis, S. Noll-Hussong, M. Northoff, G. Nosper, M. Nowacki, K. Nowak, D. Nowak, D. A. Oddo, S. Ohlendorf, S. Ohrmann, P. Olbricht, S. Ommen, O. Opd, A. S. 111 S. 14 S. 101 S. 122 S. 27 S. 94 S. 32 S. 94 S. 94 S. 38 S. 45, 119, 123 S. 77 S. 25 S. 88 S. 24 S. 11 S. 88, 105 S. 91 S. 93 S. 108 S. 69 S. 41 S. 68 S. 130 S. 80 S. 69 S. 58 S. 63, 64 S. 96 S. 85, 89 S,. 49, 104 S. 35 S. 31 S. 74, 130 S. 76 S. 11, 48 S. 72 S. 10, 69 S. 67, 126 S. 124 S. 127 S. 52 S. 121 S. 107 S. 10, 53, 69, 70, 90, 91 S. 92 S.20, 22 S. 72 S. 10 S. 53 S. 24, 61, 62, 132 S. 64 S. 51 S. 117, 122 S. 28 S. 82 139 Orth, A. Orth-Gomér, K. Ost, S. Oster, J. Otti, A. Otto, B. Otto, G. Oversohl, N. C. Parchmann, O. Paul, A. Paul, K. Pauli-Magnus, C. Payne, H. Pecho, L. Peetz, C. Peters, E. M. Petrak, F. Petrowski, K. Pfaff, H. Pfäfflin, F. Pfeifer, R. Pfenning, N. Pietrowsky, R. Pirlich, M. Pöhlmann, K. Pokorny, D. Pommer, M. Popa-Velea, O. Priebe, K. Prieto Gill, L. Probst, S. Probst, T. Purucker, M. Rabung, S. Rahm, R. Rätzel-Kürzdörfer, W. Rauch, B. Rauchfuß, M. Raum, E. Ravens-Siebener, U. Reich, G. Reimann, S. E. Reimer, J. Reinelt, E. Remppis, A. Reuter K. Richter, J. Richter-Appelt, H. Riedl, A. Riehl-Emde, A. Robitzsch, A. Roefs, A. Röhricht, F. Ronel, J. Rose, B. Rose, M. Rosenberger, C. Rosendahl, J. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. 39 65, 95 130 101 53, 91 34 93 94 100 134 121 101 11 72 128 118 68, 69 42, 96, 99 28 88 92 43 15 127 31, 99, 130 49, 87 91 77 28 61 106 38 87 119 49 87 97 47, 123 81 57 71 89 84 28 97 5, 126 46, 131, 132 124, 125 71, 129 101 106 79 10 10, 70, 94 60 57 34, 54 96 Rosenow, T. Rösing, D. Rösing, K. Rost, R. Roth, G. Rothaug, J. Rothemund, Y. Rudat, M. Rustenbach, S. J. Sachsse, U. Sack, M. Salbach-Andrae, H. Samaritter, R. Sammet, I. Sasse, J. Sattel, H. C. Sauer, N. Saum, B. Schäfer, C. Schäfer, R. Schäfer, S. Schäfert, R. Schauenburg, H. Schedlowski, M. Scheidt, C. E. Scheidt, L. Schellong, J. Schepank, H. Schilling, H. Schiltenwolf, M. Schlagmann, K. Schlegl, S. Schlichthaar, F. Schmahl, C. Schmeling-Kludas, C. Schmid-Ott, G. Schmidt, B. Schmidt, I. Schmidt, R. Schmitz, C. Schmitz-Weiss, M. M. Schnebel, A. Schneider, A. Schneider, G. Schneider, S. Schneiderman, N. Schoen, R. Schreiter, A. Schroeter, C. Schubert, C. Schubert, C. S. Schücking, B. Schulz, D. Schulz, F. S. 89 S. 16 S. 16 S. 118, 125 S. 86, 90 S. 96 S. 91 S. 98 S. 15 S. 58, 102 S. 27, 73, 90 S. 15 S. 11 S. 49, 115 S. 46 S. 73 S. 10, 67, 70, 73 S. 64 S.130 S. 51 S. 71 S.67 S. 10, 82, 86, 102, 110, 111, 118, 119, 120, 126 S. 34, 54, 80 S. 64 S. 92 S. 62, 93, 104 S. 55 S. 112 S. 133 S. 98 S. 128 S. 94 S. 27 S. 118 S. 11, 47 S. 52 S. 26 S. 29 S. 109 S. 40 S. 72 S. 122 S. 73, 127 S. 94, 113 S. 46, 65 S. 70 S. 19 S. 44, 45 S. 11, 73, 74 S. 133 S. 46 S. 27 S.122 140 Schulz, H. Schulz, J. Schulz, K. Schulz, R. Schulze, C. Schuster, T. Schwab, R. Schwarte, R. Schwarz, R. Schwegler, K. Schweizer, K. Schwenk, W. Schwerdtfeger, A. R. Schwille, I. D. Schwinn, L. Seifert, D. Seifert, S. R. Seitz, R. Sembdner, M. Semm, E. Senf, W. Siebenhüner, S. Siedentopf, F. M. Siegrist, J. Sieler, V. Siepmann, U. Simmich, T. Skoruppa, S. Sloetjes, H. Smeets, E. Smolka, R. Söllner, W. Sowa, M. Spang, J. Spinath, F. M. Spitzer, C. Stark, H. Stark, R. Stasch, M. Steetskamp, J. Stefini, A. Steil, R. Stein, B. Stephan, M. Stingl, M. Stirn, A. Stöbel-Richter, Y. Strasser, R. H. Strauß, B. Stübler, P. Stuhr, U. Stumpf, A. S. 118, 119 S. 52 S. 83 S. 121 S. 11, 48 S. 10, 70 S. 31, 134 S. 66 S. 32 S. 135 S. 125 S. 119 S. 75 S. 34 S. 109 S. 94, 95 S. 94, 95 S. 51 S. 114 S. 49 S. 20, 24, 83, 128, 134, 135 S. 95 S. 20 S. 35 S. 101 S. 31 S. 106 S. 62 S. 115 S. 79 S. 126 S. 5, 11, 17, 81, 113, 133 S. 129 S. 58 S. 99 S. 25, 50, 56, 71 S. 120 S. 107 S. 90, 118 S. 132 S. 71 S. 28 S. 113 S. 109 S. 25, 51, 106, 107 S. 24, 61, 62, 132 S. 36, 110, 131 S. 96 S. 12, 33, 43, 54, 87, 96 S. 41 S. 58 S. 127 Subic-Wrana, C. Sulz, S. K. Suslow, T. Szecsenyi, J. Tagay, S. Tari, S. Taubner, S. Teige-Mocigemba, S. Teufel, M. Thiel, A. Thiel, J. Tiffert, C. Tigges-Limmer, K. Tomanek, J. Traue, H. C. Tritt, K. Tschan, R. Türk, T. Tuschen-Caffier, B. Uhmann, S. Ulrich, U. Unterbrink, T. Valerius, G. Venkat ,S. Villmann, T. Vitinius, F. Vocks, S. Vogler, J. Voigt, B. Voigt, K. Völzke, H. von dem Knesebeck, O. von Giesen, H. J. von Heymann, F. von Hörsten, S. von Känel, R. von Seckendorff, R. von Toll, T. von Wahlert, J. von Wietersheim, J. Waadt, S. Wächter, B. Wagner, D. Wagner, F. Walther, M. Waschkowski, S. Webendörfer, S. Weber, C. Weber, M. Weber, R. S. 5, 43, 49, 53 S. 85 S. 51 S. 67 S. 24, 128 S. 122 S. 86, 90 S. 79 S. 113 S. 24, 61, 62, 132 S. 61, 132 S. 112 S. 96 S. 110, 111 S. 79 S. 10, 19, 30, 38, 69, 70, 81, 82, 98 S. 23, 120 S. 84 S. 15, 79 S. 54 S. 21 S. 92 S. 27 S. 133 S. 101 S. 53, 135 S. 15 S. 89 S. 122, 127, 128, 130 S. 107, 112 S. 25 S. 35 S. 103 S. 30, 38, 81 S. 109 S. 26 S. 98 S. 121 S. 38 S. 12, 15, 49, 79, 101, 105, 106 S. 32 S. 127 S. 103 S. 119 S. 108 S. 38 S. 103 S. 91, 95, 98, 106, 129 S. 31 S. 53 141 Weidner, K. Weiss, H. Weiss, R. Wenzel, K. Werner, A. Wiedmaier, N. Wild, B. Willutzki, U. Wilmers, F. Wiltfang, J. Wingenfeld, K. Winkelmann, K. Winzer, K. Wirsching, M. Wirtz, G. Wiswede, D. Wittchen, H. Witzke, O. Wöckel, A. Wohlschläger, A. Wölfelschneider, M. Wolfersdorf, M. Wölfling, K. Worms, A. Wrenger, M. Wu, Y. S. Wunderer, E. Würzburg, J. Zaudig, M. Zeeck, A. Zenger, M. Zentgraf, B. Zettl, U. K. Zielke, M. W. Zilinskaite, A. Zimmer, C. Zimmermann, J. Zimmermann, K. Zimmermann, L. Zimmermann-Viehoff, F. Zipfel, S. Zöckler, M. Zugck, C. Zwerenz, R. S. 45, 101, 106, 129, 130 S. 48 S. 27 S. 103 S. 29 S. 37 S. 67, 80, 96 S. 54 S. 37 S. 67 S. 26 S. 70 S. 121 S. 91 S. 110 S. 85, 89 S. 106 S. 82 S. 46 S. 52, 90 S. 81, 100 S. 86 S. 18 S. 133 S. 100 S. 24 S. 72 S. 131 S. 81 S. 15, 48, 127 S. 115 S. 22 S. 102 S. 29, 50, 104 S. 104 S. 53, 91 S. 118, 125 S. 102, 108 S. 92 S. 91, 98, 105, 129 S. 12, 15, 33, 41, 65, 78, 111 S. 85 S. 96 S. 32, 70, 118 142 Sponsoren Wir danken den folgenden Sponsoren: AHG Klinik für Psychosomatik Bad Dürkheim Campus Döner Campus Restaurant cibait CIP, Centrum für Integrative Psychotherapie Diwan Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Hildburghausen GmbH Klinik Wittgenstein Evangelisches Johanneswerk MediClin Bliestal Kliniken Fachklinik für Psychosomatische Medizin MK - EDV & Beratung Pfizer Pharma GmbH Psychosomatische Klinik Bad Neustadt, Rhön-Klinikum AG Schattauer Verlag Schön Kliniken, Medizinisch-Psychosomatische Klinik Bad Arolsen schwa-medico Medizintechnik Taberna Academica VAS Verlag für Akademische Schriften ZPID, Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation Dank an die Gutachter 2009 Die Tagungsleitung bedankt sich bei den nachfolgend genannten Kolleginnen und Kollegen für die Mitarbeit bei der Beurteilung eingereichter Beiträge. Albus Christian, Köln Deter Hans-Christian, Berlin Doering Stephan, Münster Kächele Horst, Ulm Kersting Anette, Münster Köllner Volker, Bliestal Pöhlmann Karin, Dresden Schneider Gudrun, Münster Stein Barbara, Nürnberg Tritt Karin, Regensburg Von Wietersheim Jörn, Ulm Zipfel Stephan, Tübingen 143