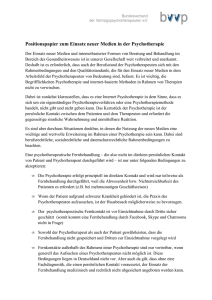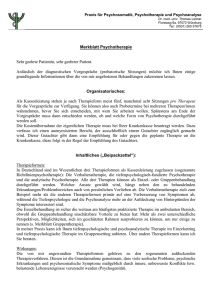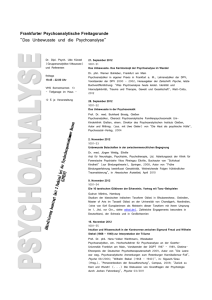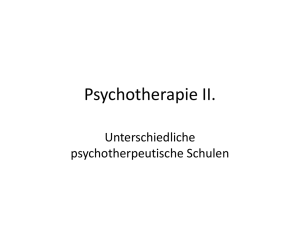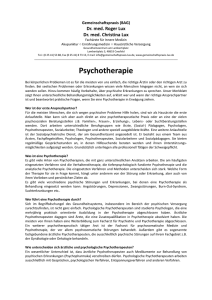1 Zur Frage getrennter Versorgungs- bzw
Werbung
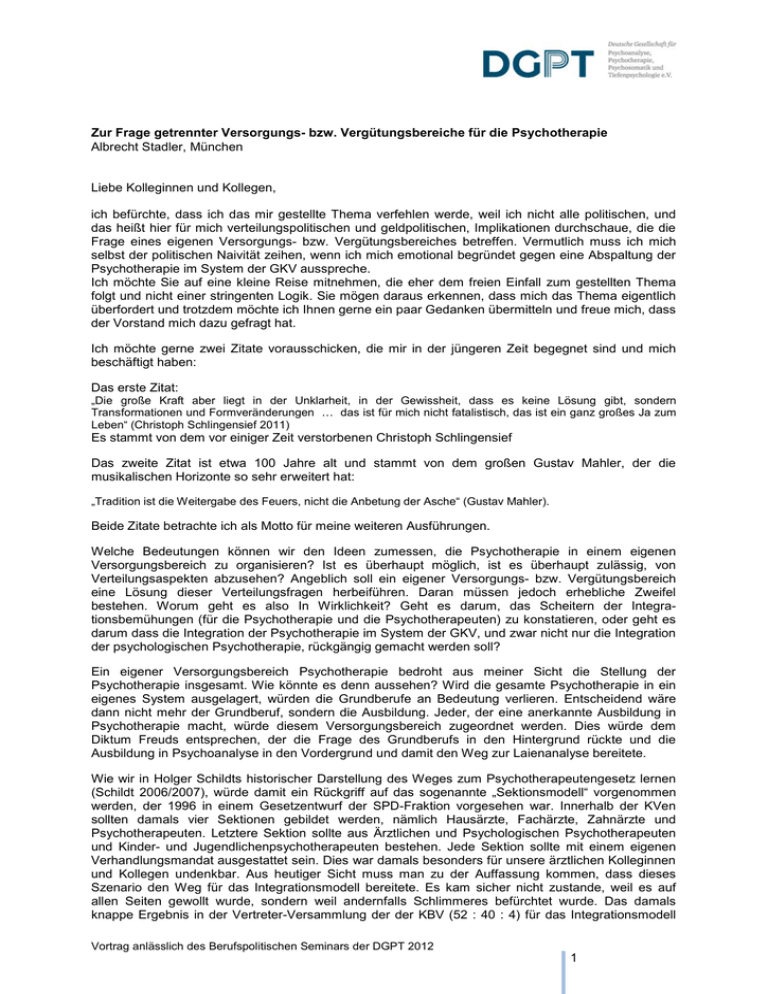
Zur Frage getrennter Versorgungs- bzw. Vergütungsbereiche für die Psychotherapie Albrecht Stadler, München Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich befürchte, dass ich das mir gestellte Thema verfehlen werde, weil ich nicht alle politischen, und das heißt hier für mich verteilungspolitischen und geldpolitischen, Implikationen durchschaue, die die Frage eines eigenen Versorgungs- bzw. Vergütungsbereiches betreffen. Vermutlich muss ich mich selbst der politischen Naivität zeihen, wenn ich mich emotional begründet gegen eine Abspaltung der Psychotherapie im System der GKV ausspreche. Ich möchte Sie auf eine kleine Reise mitnehmen, die eher dem freien Einfall zum gestellten Thema folgt und nicht einer stringenten Logik. Sie mögen daraus erkennen, dass mich das Thema eigentlich überfordert und trotzdem möchte ich Ihnen gerne ein paar Gedanken übermitteln und freue mich, dass der Vorstand mich dazu gefragt hat. Ich möchte gerne zwei Zitate vorausschicken, die mir in der jüngeren Zeit begegnet sind und mich beschäftigt haben: Das erste Zitat: „Die große Kraft aber liegt in der Unklarheit, in der Gewissheit, dass es keine Lösung gibt, sondern Transformationen und Formveränderungen … das ist für mich nicht fatalistisch, das ist ein ganz großes Ja zum Leben“ (Christoph Schlingensief 2011) Es stammt von dem vor einiger Zeit verstorbenen Christoph Schlingensief Das zweite Zitat ist etwa 100 Jahre alt und stammt von dem großen Gustav Mahler, der die musikalischen Horizonte so sehr erweitert hat: „Tradition ist die Weitergabe des Feuers, nicht die Anbetung der Asche“ (Gustav Mahler). Beide Zitate betrachte ich als Motto für meine weiteren Ausführungen. Welche Bedeutungen können wir den Ideen zumessen, die Psychotherapie in einem eigenen Versorgungsbereich zu organisieren? Ist es überhaupt möglich, ist es überhaupt zulässig, von Verteilungsaspekten abzusehen? Angeblich soll ein eigener Versorgungs- bzw. Vergütungsbereich eine Lösung dieser Verteilungsfragen herbeiführen. Daran müssen jedoch erhebliche Zweifel bestehen. Worum geht es also In Wirklichkeit? Geht es darum, das Scheitern der Integrationsbemühungen (für die Psychotherapie und die Psychotherapeuten) zu konstatieren, oder geht es darum dass die Integration der Psychotherapie im System der GKV, und zwar nicht nur die Integration der psychologischen Psychotherapie, rückgängig gemacht werden soll? Ein eigener Versorgungsbereich Psychotherapie bedroht aus meiner Sicht die Stellung der Psychotherapie insgesamt. Wie könnte es denn aussehen? Wird die gesamte Psychotherapie in ein eigenes System ausgelagert, würden die Grundberufe an Bedeutung verlieren. Entscheidend wäre dann nicht mehr der Grundberuf, sondern die Ausbildung. Jeder, der eine anerkannte Ausbildung in Psychotherapie macht, würde diesem Versorgungsbereich zugeordnet werden. Dies würde dem Diktum Freuds entsprechen, der die Frage des Grundberufs in den Hintergrund rückte und die Ausbildung in Psychoanalyse in den Vordergrund und damit den Weg zur Laienanalyse bereitete. Wie wir in Holger Schildts historischer Darstellung des Weges zum Psychotherapeutengesetz lernen (Schildt 2006/2007), würde damit ein Rückgriff auf das sogenannte „Sektionsmodell“ vorgenommen werden, der 1996 in einem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion vorgesehen war. Innerhalb der KVen sollten damals vier Sektionen gebildet werden, nämlich Hausärzte, Fachärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten. Letztere Sektion sollte aus Ärztlichen und Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bestehen. Jede Sektion sollte mit einem eigenen Verhandlungsmandat ausgestattet sein. Dies war damals besonders für unsere ärztlichen Kolleginnen und Kollegen undenkbar. Aus heutiger Sicht muss man zu der Auffassung kommen, dass dieses Szenario den Weg für das Integrationsmodell bereitete. Es kam sicher nicht zustande, weil es auf allen Seiten gewollt wurde, sondern weil andernfalls Schlimmeres befürchtet wurde. Das damals knappe Ergebnis in der Vertreter-Versammlung der der KBV (52 : 40 : 4) für das Integrationsmodell Vortrag anlässlich des Berufspolitischen Seminars der DGPT 2012 1 spiegelt die Situation wider. Ich glaube nicht, dass dies heute anders wäre. Für die DGPT und ihre Fachgesellschaften bedeutete dies, dass die, verschiedene Berufsgruppen übergreifende fachliche Gemeinschaft der Psychoanalytiker erhalten werden konnte. Heute sehe ich diese Gemeinschaft in mehrerer Hinsicht bedroht, eine Gemeinschaft, die ihre Stärken bisher auch aus den Reibungen unterschiedlicher beruflicher Identifikationen bezieht, wobei mögliche Schwächen dieser Konstellation sicher auch zu akzeptieren sind. Wenn es also einen eigenen Versorgungsbereich Psychotherapie geben sollte, sind aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten gegeben: 1. Die Ärzte werden vor die Entscheidung gestellt, ob sie sich diesem Bereich der Psychotherapie zugesellen wollen und damit aus dem Bereich der Fachärzte ausgegliedert werden. Zu vermuten ist, dass die Ärzte, wie damals beim Sektionsmodell, dies nicht mitmachen wollen und werden. Konsequenz: Sie bleiben bei den Fachärzten, wo sie, wie ich es oft mitbekommen habe, eher ein marginales Schatten-Dasein fristen. Ob sich dies verändern wird, sei in Zeiten zunehmender Einengungen dahingestellt. Die Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bekommen den ihnen zugewiesenen Bereich, haben keine Wahl, und kommen mit der Psychotherapie in eine abgespaltene Außenseiterposition, in der sie sich der übermächtig erscheinenden Gruppe der Ärzte gegenübersehen. Ich gebe zu, dass es unter den Psychologischen Psychotherapeuten durchaus viele gibt, die dies begrüßen würden, weil sie, wie ich meine, sich illusionistisch erhoffen, endlich frei für ihre Interessen eintreten zu können. Man stelle sich vor, welche Formen von Verwirrung auf Seiten der Patienten entstehen würden, die auf psychotherapeutische Versorgung angewiesen sind. 2. Die ärztlichen Psychotherapeuten, die psychologischen Psychotherapeuten und die Kinder- und Jugendliche Psychotherapeuten werden per Verfügung in einen dritten Versorgungsbereich verlegt, alle anderen P-Fachärzte bleiben jedoch bei den Fachärzten. Das wäre die völlige Abspaltung der Psychotherapie innerhalb der GKV. Hier würde m.E. ein „Sperrbezirk Psychotherapie“ entstehen. Aus einer organisatorischen Abgrenzung würde sich auf längere Sicht eine inhaltliche Entfernung zur medizinischen Versorgung kranker Menschen ergeben, die weder für die Patienten noch für die Psychotherapeuten ein Gewinn sein kann. Wie die Erfahrung zeigt, haben solche organisatorischen Veränderungen in der Regel auch inhaltliche Implikationen. In meiner Zeit als Vorsitzender der Sektion der Psychologischen Psychoanalytiker in der DGPT habe ich großen Wert gelegt auf die gute Kooperation zwischen den Ärzten und den Psychologen. Dies ist, wie ich meine, trotz vieler strittiger Fragen, die auch streitbar diskutiert wurden, immer wieder gelungen. Der gemeinsame nachhaltig vorhandene psychoanalytische „common ground“ hat uns darin bestärkt. Die nicht vergleichbaren beruflichen Herkünfte traten hinter einer gemeinsamen analytischen Identität und Solidarität zurück. Ich habe diese gemeinsame Arbeit als ausgesprochen befriedigend erlebt. Unser gemeinsames Interesse in der DGPT und den Fachgesellschaften kann m.E. nur sein, der Psychoanalyse in ihren verschiedenen Ausformungen Raum in uns, in unseren Institutionen und in übergeordneten systemischen Zusammenhängen zu verschaffen. Dies kann nur gelingen, wenn wir offen und neugierig bleiben. Grenzziehungen und Partikularisierungen haben meist destruktive Auswirkungen. Dies betrifft in gleicher Weise interne Grenzziehungen durch sektiererische Schulen-Interessen, wie auch Grenzziehungen im äußeren Raum, sowie künstliche Grenzziehungen zwischen Ärzten und Psychologen. Sie werden uns von außen diktiert und werden zu Spaltungen führen, deren Auswirkungen wir nicht kennen. Die Psychoanalyse steht überall auf dem Prüfstand und muss sich zunehmend nach außen artikulieren. Hier befinden wir Psychoanalytiker uns im Vergleich zu anderen Psychotherapeuten in einer schwierigen und ungewöhnlichen Lage, weil unsere Arbeit mit Patienten in einer relativ starken Abgeschiedenheit stattfindet, die sich den verborgenen unbewussten Prozessen zuwendet und uns einsam machen kann. Auf dem IPV-Kongress in Chicago 2009 wählte Warren Poland (Poland 2009) folgenden Vergleich: „Wie es unseren Augen schwerfällt, sich nach längerer Dunkelheit wieder ans Licht zu gewöhnen, so ist es auch für unser Selbstgefühl nicht einfach, den Wechsel vom In-derPraxis-Sein zum In-der-Außenwelt-Sein zu vollziehen.“ Poland ging in seinem Referat auf die Probleme der Psychoanalytiker ein, sich über die unterschiedlichen Schulen untereinander zu Vortrag anlässlich des Berufspolitischen Seminars der DGPT 2012 2 verständigen. M.E. können seine Überlegungen nicht nur für die Verhältnisse innerhalb der Psychoanalyse geltend gemacht werden, sondern auch darüber hinaus im gesellschaftlichen Raum. Polands Gedanken erscheinen mir vertraut, weil sie, wie ich meine, individualpsychologisches Gedankengut aufgreifen. Wir fühlen uns als Psychoanalytiker in Frage gestellt und in der Folge scheinen wir zu vergessen, die asymmetrische Partnerschaft der analytischen Situation in unseren Behandlungszimmern zurückzulassen. Außerhalb der klinischen Situation kehrt diese Asymmetrie in Form eines Überlegenheitsgefühls wieder, das uns dazu verführt, eine überlegene Deutungsposition einnehmen zu wollen. Wenn wir uns unsicher fühlen, erniedrigen wir offen oder subtil das Gegenüber, das wir für unsere Unsicherheit verantwortlich machen. Mir fällt an dieser Stelle einer meiner Lieblingssätze der kürzlich verstorbenen Christa Wolf ein, der aus ihren Frankfurter Poetikvorlesungen stammt, die sie nach der Veröffentlichung von Kassandra hielt: „Aus Unsicherheit Freude gewinnen, wer hätte uns das beigebracht.“ (Wolf 1982) Das Überlegenheitsstreben schlägt immer dann zu, wenn wir unsere eigenen Schwächen verschleiern wollen. Wenn wir, so Poland, unsere Schwächen anerkennen können, können wir untersuchen, wie sie sich im interpersonalen Raum ausbreiten. Wir wollen uns über andere erheben und haben zugleich den Wunsch, von anderen akzeptiert zu werden. Wir wollen uns einerseits als getrennte Individuen erleben können und andererseits haben wir die Sehnsucht nach Verbundenheit mit einer Gemeinschaft. Dieser uns oft unbewusste Konflikt ist nicht wirklich lösbar und muss mit einer erheblichen Ambivalenztoleranz ausgehalten werden. Wenn nicht, entbrennen Machtkämpfe auf allen interpersonalen Ebenen, die von Vorurteilen, Ressentiments und narzisstischen Kränkungen bestimmt sind, deren lange Halbwertszeiten Poland betont. Der bayerische Sprachkünstler Herbert Achternbusch kommt in einem seiner Theaterstücke zu der Aussage: Das Vorurteil ist die Mutter des Urteils (Achternbusch 1990). Es bleibt uns nicht erspart, uns mit dem Fremden und der damit verbundenen Ungleichheit auseinander zu setzen und trotzdem zu Gemeinsamkeiten zu finden, die das Unterschiedliche nicht auslöschen. Das Ungleiche ist der Ausgangspunkt unserer Existenz, es ist der Ausgangspunkt unseres Fremdheitserlebens. Das Ungleiche gleich zu machen, gelingt nur in totalitären Beziehungsverhältnissen oder es gelingt scheinbar und mit Bitterkeiten verbunden durch immer weitergetriebene Abspaltungen. Vermutlich ist das Ungleiche auch der Ausgangspunkt, sich in Gemeinschaften zu organisieren, um nicht alleine zu bleiben. Hier ist die Frage nach einer psychoanalytischen Identität zu stellen. Offenbar stellt sich diese Frage nach der Identität besonders dann, wenn sie bedroht erscheint, wenn also auch das Nicht-Identische angesprochen ist. Ist die Frage nach der Identität schon ein Symptom der Krise? In seinem erhellenden Artikel in der „Psyche“ vom Juli 2011 geht der Münchener Psychoanalytiker Andreas Hermann dieser Frage nach (Herrmann 2011). Das Identitätsgefühl strebt die Erhaltung von Kohärenz, Konstanz und Integrität an. Das Unbewusste wird als ein Agent des Nicht-Identischen erlebt. Also kommt die Gefährdung des Identitätsgefühls nicht einzig, aber eben auch aus dem Unbewussten, das ein Gegenstand unserer beruflichen Tätigkeit ist. Thomä vertritt nach Herrmann die Auffassung, dass man den Begriff der psychoanalytischen Identität ganz abschaffen solle. Er sei ein Hemmnis für die Entwicklung der Psychoanalyse zu einer scientific community. Thomä befürchte, so Herrmann, dass hoch entwickelte psychoanalytische Gruppenidentitäten zu sehr darüber bestimmen, wie unbewusste Prozesse zu verstehen seien. Damit werden, so könnte man sagen, in einem Bereich Normen gesetzt, der sich der Normierung entzieht, nämlich im Bereich des Unbewussten. Herrmann nennt verschiedene berufspolitische Entwicklungen, die aus seiner Sicht die psychoanalytische Identität betreffen und sie womöglich gefährden. Zum einen die Überprüfung der Wissenschaftlichkeit unseres Verfahrens beim Wissenschaftlichen Beirat und im Gemeinsamen Bundesausschuss. Diese Überprüfung stellt unsere Berufstätigkeit als Psychoanalytiker in Frage, weil die zukünftige Finanzierung unserer Tätigkeit in Frage gestellt ist. Die DGPT und die analytischen Fachgesellschaften unternehmen große und schon Erfolg versprechende Aufwände, um über teure Untersuchungen unser Verfahren und damit auch einen Teil unserer Identität zu retten. Weiterhin wird, laut Herrmann, als Gefährdung psychoanalytischer Identität die zunehmende Diskussion störungsspezifischer Behandlungsansätze betrachtet, die z.B. in den groß angelegten Leitlinienprozessen sichtbar werden und denen wir uns nicht verschließen können. Wir sehen unsere Vortrag anlässlich des Berufspolitischen Seminars der DGPT 2012 3 Identität bedroht, weil wir noch nicht wissen, wie diese uns zunächst fremden Behandlungs-Ansätze mit unserem menschenspezifischen individualisierten Behandlungsverständnis zu vereinbaren sind. Ein weiterer Punkt, der unsere analytische Identität zunehmend zu gefährden scheint ist, und damit ist schon das morgige Thema unseres berufspolitischen Seminars angesprochen: die Entwicklung der Ausbildung, wie sie sich seit dem Psychotherapeutengesetz gestaltet hat. Die ärztliche Weiterbildung und die Ausbildung nach dem Psychotherapeutengesetz driften auseinander. Wie wird es mit unserer analytischen Identitätsbildung weitergehen, wenn sich die Ausbildung nicht mehr an unseren Instituten abspielt, wo sich ein erheblicher Teil unserer Identitätsbildung vollzieht, wenn auch zum Teil mit Schmerzen verbunden. Die jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich um Ausbildung an unseren Instituten bemühen, sind an diesen Identitätsfragen weniger interessiert, im Gegenteil, sie finden die implizite Aufforderung zur Ausbildung einer psychoanalytischen Identität eher einschränkend und behindernd. Ist dies ein Ergebnis der „flüchtigen Moderne“, wie sie uns Zygmunt Bauman auch schon im Rahmen der DGPT-Tagung in Bonn an die Wand gemalt hat? Die flüchtige Moderne braucht und konstituiert den flexiblen Menschen, der mit seinen Identitäten spielen kann. Die Bedrohung kommt für die jüngeren Menschen eher aus der Verfestigung von Identitäten. Die Welt erwartet von uns, so sagen sie, dass wir Identitäten auch über Bord werfen können, ohne mit dem Schiff unterzugehen. (Bauman 2008) Wir können nicht mehr sicher sein, ob derjenige, der die psychoanalytische Ausbildung macht, sich mit dem Ziel identifiziert, Psychoanalytiker zu werden. Auf allen Seiten unserer grundberuflichen Voraussetzungen, sei es bei den Ärzten, bei den Psychologen oder den Pädagogen wird unserem Angebot zur Identitätsbildung mit Skepsis begegnet. Dieses scheinbar Sicherheiten vermittelnde Angebot wird in der Tendenz eher als Einschränkung der Freiheit erlebt. Die Lösung unserer Krise kann, so meine ich, nicht darin bestehen, den psychoanalytischen Raum durch organisatorische, schon gar nicht durch Verteilungskämpfe motivierte, Abtrennungen und inhaltliche Abspaltungen zu verengen, sondern wir können die Krise nutzen, um den Raum zu öffnen und im Bewusstsein eines sicheren Fundaments, das ich zum Beispiel in einem schöpferischen Unbewussten sehe, den Raum weiterhin offen zu halten. Was also tun? Wolfgang Mertens schlug auf einer Sitzung der Münchener DGPT-Institute im vergangenen Jahr vor, ein psychoanalytisches Zentrum zu gründen. Dieses Zentrum soll ein offener Raum sein, der jenseits der analytischen Ausbildung, die Möglichkeit schafft, in einen offenen Dialog mit anderen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Gruppen zu treten, damit wir, so habe ich das für mich verstanden, aus der Enge der psychoanalytischen Identität herauskommen, oder wie Herrmann das in seinem Artikel in der Psyche benennt, damit wir in einen Dialog mit dem Nichtidentischen eintreten können. Es hat sich das Psychoanalytische Forum München gegründet, das vorsichtige Versuche im Sinne dieses Vorschlags von Wolfgang Mertens unternimmt. Das Forum ist der Marktplatz, auf dem sich alle treffen können, die den Zugang finden wollen. Im Zusammenhang mit dieser Forumsidee, die den sokratischen Dialog ermöglichen könnte, fällt mir ein Theatererlebnis ein: 1992 wurde am Wiener Burgtheater ein Stück von Peter Handke (Handke 1992) uraufgeführt mit dem Titel: „Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten“. Es ist ein Stück ohne Sprache. Auf einem offenen Platz treten von verschiedenen Seiten Figuren auf, gehen über den Platz und verschwinden wieder. Insgesamt sollen es ca. 260 Figuren sein, die uns in Handkes Stück das Leben auf einem städtischen Platz vorführen. Die Figuren sind aus dem Leben gegriffen, Alte und Junge, Verliebte und Einsame, Berufstätige und Arbeitslose, Funktionäre und Schauspieler, Artisten und Behinderte und alle anderen treten auch auf. Sie gehen aneinander vorbei, sie begegnen sich, sie stoßen zusammen, sie kommen in Gruppen, sie kommen alleine, sie bleiben kurz stehen oder stoßen aneinander, sie sind gesund und krank und kaum sind sie da, gehen sie auch schon wieder. So geht das über 90 Minuten. Ich war damals fasziniert von dieser Aufführung. Heute erkenne ich darin eine Dramatisierung des flüchtigen Lebens im Sinne Zygmunt Bauman‘s, das von etwa 10 Schauspielern dargestellt wird. Sie mussten sich andauernd und zügig umziehen, um in andere Identitäten zu schlüpfen. Manchmal und besonders in solchen Zusammenhängen, wie oben beschrieben, denke ich an dieses Stück und ich möchte den Titel Handkes verändern: „Die Stunde da wir nichts voneinander wussten“ und möchte es nennen: „Die Zeit, da wir mehr voneinander wissen werden.“ In diesem Stück darf auch gesprochen werden.Ich möchte Sie noch einmal an Christoph Schlingensief erinnern und an seine Rede: „Die große Kraft aber liegt in der Unklarheit, in der Gewissheit, dass es keine Lösung gibt, sondern Vortrag anlässlich des Berufspolitischen Seminars der DGPT 2012 4 Transformationen und Formveränderungen … das ist für mich nicht fatalistisch, das ist ein ganz großes Ja zum Leben“ (Christoph Schlingensief 2011) Vor ziemlich genau 100 Jahren lässt Arthur Schnitzler (Schnitzler 1911) den Hoteldirektor Aigner in seinem Stück „Das weite Land“ den Satz sprechen: „Die Seele ist ein weites Land.“ Schnitzler beschreibt die Menschen mit ihren Seelenqualen von Liebe und Hass, von Liebes-Enttäuschung und Rachsucht, von Begehren und Macht, von Ohnmacht und Verzweiflung. Er nennt sein Stück eine Tragikomödie, in der das Komische in die Tragik der verwirrten Beziehungsverhältnisse, der Täter und der Opfer des Strebens nach Liebe eingebettet ist. Ein Ja zum Leben scheinen Schnitzlers Figuren nicht zu finden. Die Geschichte endet tödlich. Ich möchte mir hier wünschen, dass wir das weite Land der Seele nicht einengen und es uns nicht einengen lassen. Ich weiß, dass dies ein frommer Wunsch ist. Trotzdem möchte ich daran mitwirken. Literaturangaben: Christoph Schlingensief: Deutscher Pavillon 2011; 54.Internationale Kunstaustellung; La Biennale die Venezia; Hrg: Susanne Gaensheimer Holger Schildt: Vom „nichtärztlichen“ zum Psychologischen Psychotherapeuten/KJP; Vortrag 2006 und 2007 Warren S. Poland: Probleme des kollegialen Lernens in der Psychoanalyse: Narzißmus und Neugier; in Psyche Supplement 2009: Konvergenzen und Divergenzen Christa Wolf: Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra; Frankfurter Poetik Vorlesungen, Frankfurt 1982 Herbert Achternbusch: Auf verlorenem Posten; Drama; Uraufführung Kammerspiele München 1990 Andreas P. Herrmann: Psychoanalytische Identität in Psyche 7. Juli 2011 Zygmunt Bauman: Vortrag gehalten bei der DGPT Tagung in Bonn 2008 Peter Handke: Die Stunde da wir nichts voneinander wussten; Drama; Uraufführung Burgtheater Wien 1992 Arthur Schnitzler: Das weite Land; Drama; Wien 1911 Vortrag anlässlich des Berufspolitischen Seminars der DGPT 2012 5