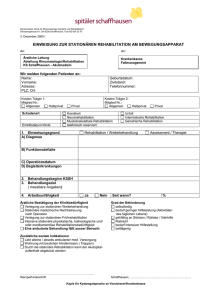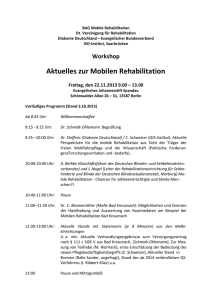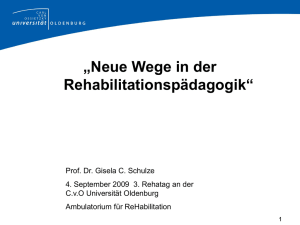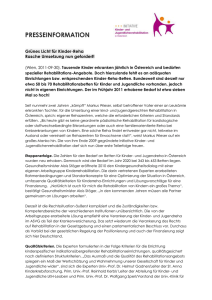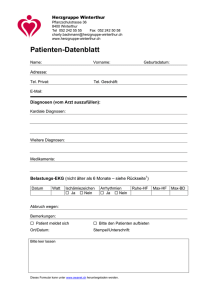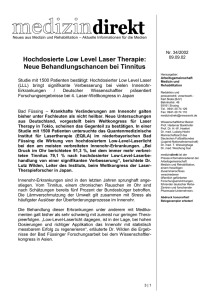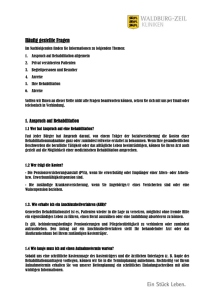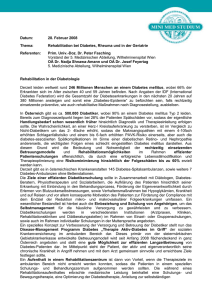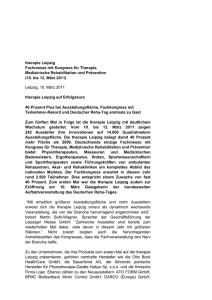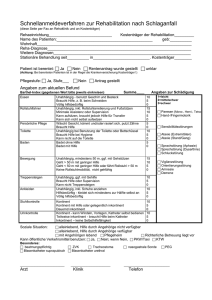Abstrakt-Band - Bentheimer Mineral Therme
Werbung

Wissenschaftliche Tagung in Zusammenarbeit mit dem Reha-Forschungsverbund Berlin-Brandenburg-Sachsen aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des Rehabilitationszentrums Seehof, Teltow/Berlin Krankheitsbezogene Forschung in der medizinischen Rehabilitation 22./23.6.2007 Rehabilitationszentrum Seehof Abstrakt-Band Freitag, 22.06.2007 Psychosomatik I. Freitag, 22.06.2007 Psychosomatik I. Kohärenzveränderungen des EEG bei Patienten mit Psychosomatischen Störungen Ergebnisse von drei Studien Höll R., Hempel W. Median Klinik Berggießhübel Hintergrund und Methode: In einer Vorstudie und in zwei Hauptstudien wurden bei psychosomatischen Patienten nach dem internationalen 10-20 System vor und nach einer 6-wöchigen Behandlung EEG Ableitungen vorgenommen. (Digitales EEG Fa. Viaysis). Die Kohärenzen wurden am Lehrstuhl Biopsychologie der TU Dresden in Kooperation mit Herrn PD Dr. Jürgen Volke gerechnet und ausgewertet. Folgende weitere Parameter wurden zur Beurteilung herangezogen: Patientenselbsteinschätzung zur Therapie, Therapeuteneinschätzung (Arzt und Psychologie) und Prä-Post-Messung. Insgesamt wurden die Daten von 68 Patienten unter Einhaltung von allen datenschutzrechtlichen Bestimmungen in die Untersuchung mit einbezogen. Autoren: Die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit der TU Dresden (Lehrstuhl Biopsychologie vertreten durch Herrn Priv. Doz. Dr. Jürgen Volke) und der Median Klinik Berggießhübel (vertreten durch Dr.med. Rüdiger Höll und Dr.phil. habil. Johannes Roth) durchgeführt. Ergebnisse: Es zeigte sich bei den gebesserten Patienten eine hochsignifikante Kohärenzveränderung im Prä-Post-Vergleich, also ein Kriterium, welches „Gesundwerden“ mit neuro- physiologischen Entsprechungen erfasst. Bei Patienten ohne gesundheitliche Besserung fand sich dieser Marker nicht. (Signifikant fehlende Ankopplungen zwischen bestimmten Hirnarealen). Bei Patienten die keine Besserung durch die Gesamtbehandlung erfuhren zeigte sich bereits in der Erstuntersuchung ein signifikanter Prädiktor für den Misserfolg der geplanten Behandlung. Wir fanden einen Ausgangspunkt für eine trainierbare Neurobiofeedbackvariable. Die Untersuchung ist technisch einfach und wenig belastend für die Patienten. Weitere Untersuchungen sind notwendig an psychosomatischen und internistischen/ orthopädischen Patienten zur Verbreiterung der Anwendbarkeit. Hier zu sind Fördermittel erforderlich für Software, Rechenleistung, MTA oder Dokumentationsassistenten bzw. Promotionsstellen. Literatur: 1) Volke, H.-J., Höll, R., Roth, J. (2001). Kohärenzveränderungen des EEG bei erfolgreich behandelten Patienten mit psychosomatischen Störungen. Unveröffentlichte Kurzdokumentation, Technische Universität Dresden.; 2) Volke, H.-J., Dettmar, P., Richter, P., Rudolf, M., Buhss, U. (1999). Evozierte EEG-Kohärenzen bei mentaler Beanspruchung: Eine Untersuchung an Schachspielern. Zeitschrift für Psychologie, 207, 258 – 262.; 3) Höll, R., Volke, H.-J., Roth, J.: Therapieinduzierte Veränderungen von EEG-Kohärenzen, Biofeedback-Kongress 2004. Elektrophysiologische Korrelate einer psychogenen Parese Liepert J.1,3, Hassa T.2, Tüscher O.3, Schmidt R.4 1 Kliniken Schmieder Allensbach, 2Kliniken Schmieder Gailingen, 3Neurologische Universitätsklinik Freiburg, 4Bereich Psychotherapeutische Neurologie, Kliniken Schmieder Konstanz und Gailingen; Korrespondenz: [email protected] Hintergrund: Bei Patienten mit einer psychogenen Lähmung liegt die Ursache nicht in einer Schädigung von Nervenstrukturen, sondern im psychologischen Bereich. Daher sind alle Zusatzuntersuchungen wie Kernspintomographien und Messungen motorischer Leitungsbahnen typischer- und notwendigerweise unauffällig. Die Fragestellung in dieser Studie war, ob bei diesen Patienten eine Funktionsstörung des motorischen Kortex im Sinne einer Exzitabilitätsveränderung vorliegt. Mit der Transkraniellen Magnetstimulation ist es möglich, die Exzitabilität intrakortikaler und kortikospinaler Bahnen genauer zu untersuchen. Methodik: Bislang wurden 4 Patienten mit einer unilateralen psychogenen Parese des Armes mittels transkranieller Magnetstimulation im Seitenvergleich (gesund versus „gelähmt“) untersucht und mit einer 2 Freitag, 22.06.2007 Psychosomatik I. Gruppe gesunder Kontrollpersonen (n=6) verglichen. Es wurden die motorische Schwelle sowie die Intrakortikale Inhibition und Fazilitierung in Ruhe evaluiert und die kortikospinale Erregbarkeit bei Vorstellung einer Bewegung mit der Ruhebedingung verglichen. Ergebnisse: Die motorischen Schwellen, die Latenzzeiten und Amplituden motorisch evozierter Potentiale (MEP) sowie die Intrakortikale Inhibition und Fazilitierung wiesen in Ruhe keine Seitenunterschiede auf. Im Kontrast hierzu kam es bei Vorstellung einer Bewegung mit der paretischen Extremität zu einer MEP-Amplitudenminderung auf 66 % im Vergleich mit einer Ruhebedingung im Sinne einer Exzitabilitätsabnahme. Die Bewegungsvorstellung der gesunden Extremität führte hingegen bei 3 der 4 Patienten zu der zu erwartenden, physiologischen Exzitabilitätszunahme in Form einer MEPAmplitudenzunahme auf 165 % , wie sie in der Kontrollgruppe nachweisbar war. Schlußfolgerung: Die hier demonstrierte Exzitabilitätsabnahme für die „gelähmte“ Extremität ähnelt den Daten, die bei „No Go“- Aufgaben festgestellt wurden (Sohn et al., 2003) und kann als elektrophysiologisches Korrelat einer (unbewußten) Bewegungshemmung interpretiert werden. Möglicherweise liegt dem Phänomen eine vom prämotorischen Kortex ausgehende Hemmung zugrunde. Unsere elektrophysiologischen Ergebnisse komplementieren Fallberichte zum erfolgreichen therapeutischen Einsatz der repetitiven transkraniellen Magnetstimulation (Schonfeldt-Lecuona et al., 2006). Literatur: 1) Schonfeldt-Lecuona C, Connemann BJ, Viviani R, Spitzer M, Herwig U. Transcranial magnetic stimulation in motor conversion disorder: a short case series. J Clin Neurophysiol. 2006 Oct;23(5):473-6., 2) Sohn YH, Dang N, Hallett M. Suppression of corticospinal excitability during negative motor imagery. J Neurophysiol. 2003 Oct;90(4):2303-9 Neuronale Netzwerke emotional-motorischer Interaktion bei Konversionsstörungen Schmidt R.4, Hassa T.1, Tüscher O.3, Liepert J.2,3 1 Kliniken Schmieder Gailingen, 2Kliniken Schmieder Allensbach, 3Neurologische Universitätsklinik Freiburg, 4Bereich Psychotherapeutische Neurologie, Kliniken Schmieder Konstanz und Gailingen Hintergrund: Die Interaktionen motorischer und emotionaler Prozesse sind für die normale motorische Funktionalität wesentlich; ihre Störung ist, gerade in der neurologischen Rehabilitation, zugleich von unmittelbarer rehabilitations- wie sozialmedizinischer Bedeutung. Als Grundlage neurobiologischer Modellvorstellungen zu motorischen Konversionsstörungen (verstanden als primär psychische Störung mit somatischen Symptomen, die sich durch einen physiologischen Prozess oder eine körperliche Störung nicht vollständig erklären lassen und in Verbindung mit emotionalen Konflikten oder psychosozialen Belastungen auftreten sowie hohe Komorbiditäten mit affektiven Störungen wie Depression und Angststörungen aufweisen) nimmt die emotional-motorische Interaktion eine Schlüsselstellung ein. Vor diesem Hintergrund war das Ziel dieser Studie die Entwicklung eines fMRT-Paradigmas zur Darstellung neuronaler Netzwerke, in denen motorische und emotionale Prozesse interagieren. Anatomische Zielregionen bei diesem Paradigma sind motorische und prämotorische Areale, limbische (emotionale) Areale (z.B. Amygdala) und Assoziationsareale, die bei beiden Prozessen aktiv sind. Die Untersuchung ist zugleich Pilotprojekt für und selbst Teil eines breiter angelegten Forschungsansatzes, der sich – aufbauend auf einem speziellen Versorgungsangebot - mit der Komorbidität neurologischer, psychiatrischer und psychosomatischer Störungen und deren rehabilitationsmedizinischen Folgen bzw. Erfordernissen beschäftigt (Schmidt et al. 2007). Methodik: Unter dieser Vorgabe wurde eine einfach zu bewältigende, fMRT-adaptierte Testaufgabe (“emotionale Modulation passiver Handbewegung”; 3x3 faktorielles Blockdesign) entwickelt: Die Probanden sind aufgefordert, entweder ein Fixationskreuz oder Gesichter (traurig oder neutral) zu betrachten (Zielstimuli) und dabei scheinbar zufällig erscheinende rote Punkte zu zählen (Aufgabe zur Aufmerksamkeitskontrolle). Dies wird mit der passiven Bewegung der rechten oder linken Hand kombiniert. Die fMRT-Untersuchung erfolgt an einem Philipps Gyroscan Intera 1,5 Tesla. Ergebnisse: Anhand der Pilotdaten konnte gezeigt werden, dass der ventromediale präfrontale Kortex (insbesondere vorderes Cingulum) im emotional-motorischen Zielinteraktionskontrast (trauriges Gesicht kombiniert mit passiver Handbewegung versus neutrales Gesicht kombiniert mit passiver Handbewegung) zur Darstellung kommt. Schlußfolgerung: Mittels (emotionaler) Modulation passiver Handbewegungen können neuronale Netzwerke emotional-motorischer Interaktion dargestellt werden. Hypothetisch von besonderem Interesse 3 Freitag, 22.06.2007 Psychosomatik I. hinsichtlich der Pathogenese der motorischen Konversionsstörungen ist dabei das vordere Cingulum mit seiner funktionellen Unterteilung in einen oberen kognitiven sowie motorischen Anteil und einen unteren emotionalen Anteil (Ballmaier und Schmidt 2005). Die postulierte Fehlfunktion in der Kommunikation zwischen diesen beiden Anteilen des Cingulums bei der Konversionsstörungen soll mit Hilfe diese Paradigmas getestet werden. Literatur: 1) Ballmaier M, Schmidt R (2005) Conversion disorder revisited. Funct Neurol 20:105-113; 2) Schmidt, R, Lütgehetmann, R, Krauß, B und Schörner, K (2007) Vom »entweder – oder« zum »sowohl als auch«: Die integrierte Versorgung komorbider neurologischer und funktionell psychischer Störungen im neurologischen Fach- und Rehabilitationskrankenhaus. Neurol Rehabil 13: 51-60 Neurobiologische Korrelate der Posttraumatischen Verbitterungsstörung (PTED) Stephan J.-A.1, Kienast T.2 1 Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation am Rehabilitationszentrum Seehof der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Charité Berlin; 2Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité, Campus Mitte, Berlin Hintergrund: Es gibt erste Hinweise, dass Krankung und Verbitterung auch zu neurobiologischen Änderungen führen, die die Funktion des anterioren Gyrus Cinguli, der wesentlich an der Steuerung handlungsrelevanter Konflikte beteiligt ist, betreffen. Es wurde untersucht, ob bei Patienten mit einer protrahierten Verbitterung i.S. einer PTED während emotionaler Erregung im fMRT eine Aktivitätsänderung im anterioren Gyrus Cingulus nachweisbar ist und ob sich evtl. Auffälligkeiten bei Besserung des Krankheitszustandes zurückbilden? Methode: Untersucht wurden bisher 16 Patienten mit einer PTED vor Therapie und 12 Patienten vor und nach Therapie. 6 Patienten durchliefen eine Weisheitstherapie und 6 Patienten eine Euthyme Therapie. Im MRT wurden 63 validierte affektive Worte dargeboten, darunter jeweils 21 Bilder mit positiver, neutraler bzw. negativer Valenz, und 21 traumaspezifische Worte vorgegeben. Alle Worte wurden in einem halbstandardisierten Interview erfragt. In der fMRT-Untersuchung werden die 84 Worte in einem pseudorandomisierten Blockdesign über einen Bildschirm präsentiert. Ein Block besteht aus einem cue und drei Worten einer Kategorie. Ein Fixationskreuz wird zwischen den Blöcken präsentiert. Es wird ein 1,5 Tesla Kernspintomograph (Siemens Vision®) benutzt. Für die funktionelle Kernspintomographie wird eine EPI (echo-planar imaging)-Sequenz (TR = 3,2 ms; Blockdauer 16 sec.) mit einer in-plane resolution von 64x64 pixels. Die Blutoxygenase (blood-oxygenation-level-dependent BOLD) - Response wird Outcome-Kriterium sein. Ergebnisse: Erste Auswertung ergaben, dass es vor Therapie eine Veränderung des BOLD-Signals im anterioren Gyrus cinguli bei Patienten mit PTED während Konfrontation mit dem Trauma gibt im Vergleich zur Konfrontation mit einem neutralen Ereignis. Zudem zeigt sich bei den vier Patienten, dass sich die Veränderungen nach Weisheitstherapie und nach Euthymer Therapie zurückbilden. Diskussion: Falls sich diese ersten Ergebnisse bestätigen, dann wäre das ein erster Hinweis auf neurobiologisches Korrelate persistierender Verbitterung, die sich unter Therapie zurückbilden.. Chronischer Stress und Indikatoren somatischer Morbidität Bruenahl C. Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation am Rehabilitationszentrum Seehof der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Charité Berlin Hintergrund: Bereits vom Vater des Stressforschers Selye stammt der Satz: „Stress macht krank!“. Es wird diskutiert, dass psychischer Stress assoziiert ist mit einer erhöhten Rate an Infektionen der oberen Atemwege, zur Verschlechterung von allergischen Reaktionen, wie allergisches Asthma bronchiale oder allergische Rhinitis führt oder auch kardiale, endokrinolgische und Autoimmunparameter negativ beeinflusst. Dennoch ist die Datenlage zur somatoklinischen Relevanz einer chronischen psychischen Stressbelastung weiterhin uneinheitlich. Wenn es eine pathogenetische Wirkung von Stress geben sollte, dann müsste sich dies in vermehrten somatischen Erkrankungen von Menschen zeigen, die unter chronischem Stress stehen. 4 Freitag, 22.06.2007 Psychosomatik I. Methode: Die Screeningparameter für somatische Morbidität aus der Routinelaboruntersuchung wurden bei 50 vollstationären Patienten mit einer Posttraumatischen Verbitterungsstörung (PTED) und bei einer Kontrollgruppe von 50 Patienten mit unterschiedlichen psychischen Erkrankungen, aber ohne unmittelbare Stress- oder Angstsymtomatik, auf Unterschiede getestet. Die Geschlechtsverteilung und das Alter war in beiden Gruppen ausgeglichen (60% Frauen; Altersdurchschnitt: 49 Jahre). Bei den Patienten mit einer PTED wurde im SCL-90 ein durchschnittlicher GSI-score von 1.13 (SD: 0.55) und in der Kontrollgruppe von 0.75 (SD: 0.50) ermittelt. Ergebnisse: Die Auswertung der untersuchten Parameter erbrachte keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Diskussion: Die Daten sprechen gegen die Annahme, dass längerdauernder psychischer Stress zu einer relevanten Erhöhung somatischer Morbidität führt. Dies kann anders sein bei akutem Stress (Herzinfarkt nach Streit). Hypo- und Dyssomnien in der psychosomatischen Rehabilitation Hanisch M., Kühn Chr., Linden M. Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation am Rehabilitationszentrum Seehof der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Charite Universitätsmedizin Berlin Hintergrund: Primäre Schlafstörungen können zu sekundären psychischen Folgeerkrankungen führen. Primäre psychische Störungen wie Depressionen oder Anpassungsstörungen können zu sekundären Schlafstörungen führen. In jedem Fall können Schlafstörungen unabhängig von ihrer Ätiologie zu Tagesmüdigkeit, neurasthenischen Zuständen und Leistungsinsuffizienz führen. Sie haben jedoch bislang in der medizinischen Forschung zur psychosomatischen Rehabilitation wenig Beachtung gefunden. Die Fragestellung dieser Untersuchung war daher, Art und Umfang von Schlafstörungen in der medizinischen Rehabilitation zu untersuchen. Methode: Es wurden 1690 unausgelesene Patienten einer psychosomatischen Rehabilitationsklinik gebeten anzugeben, in welchem Ausmaß sie unter Ein- und Durchschlafstörungen bzw. Früherwachen litten. Es wurde untersucht, in welchem Zusammenhang die Schlafstörungen mit dem Krankheitsstatus standen. Ergebnisse: 78,4% der Patienten klagten über Einschlafstörungen, darunter 31,8% über eine starke oder sehr starke Ausprägung, 87,1% über Durchschlafstörungen, darunter 40,1% stark oder sehr stark und 68,2% über Früherwachen, darunter 28,4% stark und sehr stark. Am Ende des stationären Aufenthalts war die Rate für Einschlafstörungen noch 68,5%, für Durchschlafstörun-gen 80,5% und für Früherwachen 64,4%. Es bestehen signifikante Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit und Schlafstörungen. Erstaunlicherweise war die Verteilung der genannten Schlafstörungen von den Diagnosen weitgehend unabhängig. Diskussion: Schlafstörungen stellen über alle Erkrankungsgruppen hinweg ein extrem häufiges Problem bei Patienten in psychosomatischer Rehabilitation dar. Es gibt Hinweise auf enge Zusammenhänge zwischen beruflicher Leistungsfähigkeit und der Schlafqualität. In jedem Fall stellen sie ein Problem dar, das wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität und die Leistungsfähigkeit hat und dem in der psychosomatischen Rehabilitation vermehrt Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Predicting remission in antidepressive treatment. Results from the German Algorithm Project (GAP) M. Adli1, K. Wiethoff1, T.C. Baghai2, D. Hollinde1, T. Stamm1, H.J. Möller2, M. Bauer3 1 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Charité-Universitätsmedizin Berlin, Charité Campus Mitte; Department of Psychiatry and Psychotherapy, Ludwig-Maximilians-Universität Munich; 3Department of Psychiatry and Psychotherapy, Karl Gustav Carus Universität Dresden 2 Background: Implementing treatment algorithms in the clinical care of patients suffering from major depressive disorder (MDD) is considered as an important instrument in increasing treatment efficacy, independent from the clinical subtype of depression. The German Algorithm Project GAP has evaluated algorithm-guided treatment of inpatients with MDD. Phases I (open observational trial) and II (randomized controlled trial) demonstrated the feasibility and efficacy of a standardized stepwise drug treatment regimen (SSTR) compared to treatment as usual (TAU). We present the results of the recently 5 Freitag, 22.06.2007 Kardiologie I. finished third phase (GAP III) with regard to differential efficacy of algorithm-guided treatment in anxious vs. non-anxious depression. Methods: GAP III compared an SSTR and a computerized documentation and expert system (CDES) with TAU in 429 inpatients treated for MDD in a five-arm multicenter randomized controlled trial. We performed multivariate cox regression analysis as well as an analysis of interaction to identify differential response patterns in clinical and sociodemographical subgroups of patients. In addition, we searched for associations of the 50-T/C SNP of the glycogen-synthase-kinase 3beta (GSK3B) as well as the promoter linked region of the serotonin transporter gene (5HTTLPR) with response to lithium augmentation in nonresponders to an initial antidepressant monotherapy. Results: Patients with anxious MDD (prevalence 48.6%) were significantly more likely to be older and prematurely retired and to endorse higher subjective symptom severity. Anxious MDD was associated with longer duration of the current episode and lower probability of achieving remission independent of treatment modality. Compared to TAU, SSTR treatment was associated with a significantly higher probability of achieving remission (HR: 1.5; p=.01) but not CDES (HR: 1.06; p=.81). We did not identify any significant confounding factor or statistical interaction which would be suggestive of differences in responsevity to algorithm-guided treatment for any clinical subgroup. We found a significant association of the response to lithium augmentation in treatment-resistant patients with the GSK3B 50T/C SNP as well as with the 5HTTLPR. Conclusion: Algorithm-guided treatment of depression following an SSTR increases efficacy of antidepressive pharmacotherapy independent from the clinical subtype. However, patients with anxious depression show an inferior response pattern to treatment in general than non-anxious patients. A genotype-based modulation of treatment pathways may represent an option to tailor algorithm-guided treatments to individual needs. Kardiologie I. Anhaltend unzureichende Sekundärprävention koronarkranker Diabetiker: Eine Analyse von 41.300 Patienten im 3-Jahresverlauf Völler H.1, Bestehorn K.2, Jannowitz C.3, Reibis R.1, Wegscheider K.3 1 Abteilung Kardiologie, Klinik am See, Fachklinik für Innere Medizin, Rüdersdorf; 2MSD Sharp and Dohme GmbH, Haar, 3Institut für Statistik und Ökonometrie, Universität Hamburg, Hamburg Hintergrund: Diabetiker weisen nach akutem koronarem Syndrom (ACS) eine vergleichsweise schlechtere Prognose auf. Diese kann unter Beachtung von in Leitlinien verankerten Zielwerten für Blutdruck (<130/ 80mmHg) oder LDL-Cholesterin (optional <70mg/dl) verbessert werden. Inwieweit Diabetiker eine an den strengen Zielwerten orientierte Sekundärprävention erhalten, ist bislang unzureichend bekannt. Methodik: Von 2003 bis 2005 wurden in 116 Rehabilitationskliniken 41.300 konsekutive Patienten (30,6 % Frauen, im Jahre 2005 67,9 Jahre; 69,4% Männer, 63,3 Jahre) nach akutem koronarem Ereignis eingeschlossen. Zu Beginn und bei Entlassung wurden BMI, Blutdruck, Blutzucker und das Lipidprofil bestimmt und die Pharmakotherapie protokolliert. Unter Adjustierung für Alter, Geschlecht und Ausgangswerte erfolgte die Analyse von Niveauunterschieden zwischen Diabetikern (n=11.973, 29,7%) und Nicht-Diabetikern (n=28.370, 70,3%) unter Berücksichtigung zeitlicher Veränderungen (Trends). Ergebnisse: Im Beobachtungszeitraum von 3 Jahren wiesen Diabetiker in gleichem Ausmaß höherer RRWerte bei Entlassung (123,7 mmHg systolisch vs. 122,1 mmHg, p<0.001) sowie einen niedrigeren Anteil derjenigen mit RR-Werten <140/90mmHg auf (78,2% vs. 82,4%, p<0,001). ACE-Hemmer und AT1Blocker wurden mit Konstanz signifikant häufiger Diabetikern verordnet (im Jahre 2005 70,9% vs. 68,4%, p<0,001, und 15,9% vs. 14,3%, p<0,001); Betablocker hingegen mehr Nicht-Diabetikern. Der Gesamtanteil von Patienten mit Antihypertensiva war bei Diabetikern signifikant erhöht (im Jahre 2005 94,9% vs. 94,0%, p<0,001). LDL-Cholesterin war bei Entlassung im Verlauf signifikant niedriger; das galt insbesondere für Diabetiker. Triglyceride waren auf konstantem Niveau, wenn auch für Diabetiker höhere Werte registriert werden. Zielwerte für LDL-Cholesterin <100mg/dl und Triglyceride <180mg/dl wurden für beide Gruppen in höherem Ausmaß erreicht (51,3% 2000 versus 57,3% 2005; Trend p< 0,001). 6 Freitag, 22.06.2007 Kardiologie I. Schlussfolgerung: Während in den letzten Jahren eine Verbesserung des Lipidprofils – wenn auch noch nicht im ausreichendem Maße – bei allen Koronarkranken erzielt wurde, ist insbesondere bei Diabetikern keine verbesserte Blutdruckeinstellung gelungen. Risikoprofil und Beziehungen von kardialer autonomer Blutdruckrhythmik und Urinalbuminexkretion bei Typ 2-Diabetes Neuropathie, zirkadianer Weck M.1, T. Fiedler T.1, Schulze J.2 1 Klinik Bavaria Kreischa, Abt. Diabetes, Stoffwechsel und Endokrinologie, 2Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden, III. Medizinische Klinik und Poliklinik (Diabetes, Stoffwechsel und Endokrinologie) Ziel der Arbeit war, an einem ausgewählten Krankengut von Typ 2-Diabetikern Auftreten, Verknüpfungen und Risikoprofil von kardialer autonomer Neuropathie (KAN), gestörter zirkadianer Blutdruckrhythmik und Urinalbuminexkretion (UAE) zu erfassen. Wir untersuchten alle 423 Typ 2-Diabetiker, die 2002 in eine spezialisierte Diabetes-Abteilung einer Rehabilitationsklinik aufgenommen wurden hinsichtlich der o. g. Parameter und des mikro- und makrovaskulären Risikos. 70,4 % der Patienten waren Männer, 29,6 % Frauen. Das Durchschnittsalter lag bei 55,7 Jahren (Bereich 18 - 86 Jahre). Die mittlere Diabetesdauer war 10,0 ± 8,7 Jahre. Die KAN wurde über die Bestimmung der Herzfrequenzvariabilität (HFV) mittels des ProSciCard-Verfahrens diagnostiziert, der 24h-Blutdruck wurde mit dem SpaceLab-System erfaßt und die UAE nephelometrisch bestimmt. Der Variationskoeffizient der HFV unter tiefer Atmung (VKTA) gilt als sensitivster Einzelparameter zur Erfassung einer KAN. Zirkadiane Blutdruckrhythmik, UAE, Nephropathie, Retinopathie und koronare Herzerkrankung (KHK) wurden deshalb Quartilen des VKTA zugeordnet. Typ 2-Diabetiker mit niedrigem VKTA als Marker einer ausgeprägten KAN weisen signifikant höhere systolische Blutdruckwerte während der Tag- und auch der Nachtphase, einen signifikant geringeren systolischen und diastolischen Blutdruckabfall im Vergleich der Tag- zur Nachtphase, einen signifikant höheren Anteil an Non-Dippern (90 %!), signifikant höhere UAE, Serumkreatininwerte, Retinopathie- und KHK-Häufigkeit auf als Typ 2-Diabetiker mit hohen (normalen) VKTA. Wir schlußfolgern, daß für das untersuchte Patientengut die Analyse des VKTA, der 24h-Blutdruckmessung und der UAE eine profunde Einschätzung des mikro- und makrovaskulären Risikos erlaubt. Für die tägliche Praxis könnte man unter Kostengesichtspunkten noch weiter abstrahieren: Eine Aufhebung der respiratorischen Sinusarrhythmie im EKG mit tiefer In- und Exspiration könnte als Hinweis auf KAN, Non-Dipping, diabetische Nephround Retinopathie sowie KHK gewertet werden. Erste Ergebnisse einer multimodalen strukturierten Intervention bei Patienten mit Herzinsuffizienz im Rahmen einer kardiologischen Rehabilitation Glatz J1, Kiwus U1, Karger G.2 1 Rehabilitations-Zentrum Seehof der Deutschen Rentenversicherung-Bund, Teltow, 2Rehabilitationsklinik Heidelberg-Königstuhl der Deutschen Rentenversicherung-BW, Hintergrund: Herzinsuffizienz ist ein häufiges klinisches Syndrom mit wachsender Bedeutung und schlechter Prognose, das hohe Gesundheitskosten vor allem durch häufige Krankenhausaufenthalte im Rahmen von Dekompensationen verursacht. Diese wiederum sind überwiegend Folge von NonCompliance der Patienten mit den medikamentösen und nicht-medikamentösen Behandlungsmaßnahmen. Es konnte gezeigt werden, dass ein gutes Wissen über die Erkrankung und ein Verständnis für die Behandlungsmaßnahmen wichtige Voraussetzungen für eine gute Patienten-Compliance sind. In Ländern wie Schweden und den Niederlanden, aber auch in den USA sind Patientenschulungen bei Herzinsuffizienz bereits weit verbreitet und tragen zu einer deutlichen Reduktion stationärer Aufenthalte und einer verbesserten Lebensqualität der Patienten in diesen Ländern bei. In Deutschland könnten die flächendeckend vorhandenen kardiologischen Rehabilitationskliniken eine wichtige Rolle im Management von Herzinsuffizienz-Patienten übernehmen mit den 3 wichtigen Säulen: Strukturiertes Kompetenztraining, körperliches Training und leitliniengerechte Medikamenten-Optimierung. In 2 Rehabilitationszentren (Heidelberg und Rüdersdorf) wurde seit 3/2004 eine Schulung entsprechend den Empfehlungen zu Schulungsinhalten bei Herzinsuffizienz der European Society of Cardiology aufgebaut und seither bei über 500 Patienten eingesetzt. 7 Freitag, 22.06.2007 Kardiologie I. Im Rehabilitationszentrum Seehof wird seit 5/2005 diese Schulung und seit 12/2005 ein strukturiertes Herzinsuffizienz-Programm durchgeführt. Dieses beinhaltet eine 6-stündige nach einem Curriculum strukturierte, von Ärzten, Bewegungstherapeuten, Psychologen und Diätassistentinnen durchgeführt Schulung in Kleingruppen mit den wesentlichen Bestandteilen: Kompetenz- und Compliance-Förderung (medikamentös und nicht-medikamentös), Ernährungsumstellung (Salzreduktion), ein spiroergometrischund laktat-kontrolliertes aerobes Ausdauer- und Kraftausdauer-Training, eine psychosoziale Gruppen- und Einzelbetreuung und eine erweiterte serologische (Biomarker, GFR) und echokardiographische Diagnostik. Zur Erfassung einer psychosomatischen Komorbidität wird ein Screening auf Angst und Depression (Fragebogen: HADS) durchgeführt. Die allgemeine und krankheitsspezifische Lebensqualität wird mit den Fragebögen SF36 und KCCQ erfasst. Vor und nach der Schulung absolvieren die Patienten einen Wissenstest. Zur Dokumentation der Reha-Effekte werden spiroergometrische und echokardiographische Parameter, Biomarker, 6-Minuten-Gehtest, sowie die Medikation (ACE-/AT1Hemmer, Betablocker) am Beginn und Ende der Maßnahme erfasst. Methodik: Alle Patienten mit einer Auswurffraktion (LV-EF) von maximal 40% werden kontinuierlich seit Dezember 2005 in dieses Interventionsprogramm eingeschlossen. Die genannten Parameter vor und nach der 3-4-wöchigen Rehabilitation werden für das Jahres 2006 verglichen und ausgewertet. Ergebnisse: Die 97 Patienten waren zu 83% männlich und im Durchschnitt 57,6 Jahre alt. Die durchschnittliche LV-EF zum Zeitpunkt der Schulung betrug 31,5 %, das durchschnittliche aktuelle NYHA-Stadium 2,4. Die meisten Patienten hatten eine KHK (54%) oder eine dilatative Kardiomyopathie (26%). Durch die Schulung konnte das Wissen signifikant erhöht werden (von 66,5 auf 83,5 % richtig beantwortete Fragen). Die Akzeptanz des Programms bei den Patienten war, gemessen an einem Zustimmungs-Score, sehr hoch. Bei den prognostisch wichtigen Parametern Dauerleistung, MaximalLeistung, Muskelkraft, BNP, NYHA-Klasse und 6-Minuten-Gehtest konnten signifikante Verbesserungen erreicht werden. Bei der herzentlastenden Medikation mit Betablockern und ACE-Hemmern bzw. Angiotensin-Rezeptor-Blockern konnte sowohl eine Steigerung der Anwendungshäufigkeit als auch des Erreichens der Zieldosis dokumentiert werden. Bei den spiroergometrischen (Sauerstoffaufnahme im Peak und an der anaeroben Schwelle, Atemeffizienz) und echokardiographischen Parametern (LV-EF, LVDiameter, diastolische Funktionsklasse) waren teilweise eine signifikante Verbesserung, zumindest aber ein positiver Trend zu erkennen. Schlussfolgerung: Eine multimodales strukturiertes Programm mit strukturiertem Kompetenztraining, körperlichem Training und leitliniengerechter Medikamenten-Optimierung im Rahmen einer kardiologischen Rehabilitation führt zu einer Verbesserung sowohl des Wissens über die Erkrankung als auch etablierter prognostisch relevanter Parameter in einem Zeitrahmen von 3-4 Wochen. Ob diese Verbesserung auch langfristig anhält und über eine bessere Compliance Auswirkungen auf Krankheitsverlauf und Kosten hat, wird Gegenstand künftiger Untersuchungen sein. Patienten mit maschinellen Herzunterstützungssystemen (Assist Device) in der kardiologischen Rehabilitation U. Kiwus, J. Glatz Abteilung Kardiologie, Rehabilitationszentrum Seehof der Deutschen Rentenversicherung Bund, Teltow/Berlin Hintergrund: Patienten im praekardiogenen Schock unterschiedlicher Genese und optimierter konventioneller Intensivtherapie haben dennoch eine extrem hohe Mortalität. Als ultima Ratio entwickelte die experimentelle Kardiochirurgie seit den 70iger Jahren Herzunterstützungssysteme (Assist device), die zunächst im Tierversuch erprobt und seit Ende der 90iger Jahre in die Routine herzchirurgischer Spitzenzentren gelangt sind. Vor dem Hintergrund immer knapper werdender Herztransplantate (HTX) mit jährlich nur noch knapp 400 transplantierten Herzen in Deutschland und einem Bedarf von über 1000 HTX/Jahr kann mit Hilfe der Assist-Device (AD) Technik eine Überbrückungstechnologie genutzt werden, die den entsprechend operierten Patienten eine ungefähr gleiche 1 Jahresüberlebensrate einräumt wie nach der TX selbst. Diese schwerstkranken Patienten zeigen nach einer oft wochen- bzw. monatelangen Intensivtherapie eine fragile psychophysische Stabilität, die bei anderen kardiochirurgischen Operationen mit weit weniger kompliziertem Verläufen regelmäßig zur Indikation einer Anschlussheilbehandlungsmaßnahme führen würde um die Leistungfähigkeit, Lebensqualität und – Prognose der Patienten zu bessern und eine Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. 8 Freitag, 22.06.2007 Kardiologie I. Methode: Im Zeitraum von 2001 bis 2006 haben wir insgesamt 146 Patienten nach Implantation eines linksventrikulären oder auch biventrikulären Assist-Device als Direktverlegung nahezu ausschließlich aus dem DHZB übernommen und im Rahmen einer Anschlussheilbehandlung (AHB)im Reha-Zentrum stationär rehabilitiert. Dabei wurden Daten zunächst diskontinuierlich und seit 2006 kontinuierlich zum Rehaverlauf bezüglich körperlicher Entwicklung, Selbstversorgungfähigkeit, Therapiecomplience, Komplikationen und Kosten in einer Datenbank erfasst und ausgewertet. Ergebnisse: Die Zunahme der körperlichen Belastbarkeit konnte in einer Steigerung des 6 min-Gehtests von 37% und in der Zunahme des ventilatorisch bestimmten aerob-anaeroben Übergangs (vAT) um 16% während eines 3-4wöchigen AHB belegt werden. Die Sicherheit der Messungen und Interpretation der täglich durchgeführten Antikoagulationsselbstbestimmungen waren Grundbedingungen für eine Entlassung nach Hause und konnte bei allen Patienten erreicht werden oder in ein so sicheres häusliches Setting geführt werden, dass eine Entlassung möglich war. Komplikationen mit Apoplexien, HRST, Pumpenversagen und Kabelaustrittsinfektonen konnten aufgrund der besonderen Bedingungen unserer AHB-Klinik beherrscht und durch die enge Kooperation mit der Akutklinik zeitnah gelöst werden. Der personelle, medikamentöse und physiotherapeutische Aufwand für die Rehabilitation dieser Patientengruppe führte zu erheblich höheren Kosten, als sie im AHB-Verfahren kardiochirugischer Patienten kalkuliert werden. Diskussion: Die 2001 mit Unterstützung der Deutschen Rentenversicherung als Machbarkeitsprüfung gestartete AHB von AD- Patienten hat sich für unsere entsprechend spezialisierte und ausgestattete RehaEinrichtungen als machbar erwiesen. Die entwickelten Reha-Abläufe und Therapien haben sich als wichtiger Schritt für die Fähigkeit der Patienten gezeigt ein überwiegend selbstbestimmtes Leben in ausreichender Lebensqualität zu erreichen. Die AHB von AD-Patienten schließt eine Lücke im Rahmen dieser Überbrückungsmaßnahme zur HTX, führt zu einer stabileren Lebenssituation und macht das Erleben der Herztransplantation wahrscheinlicher. Medizinische Behandlung nach Herztransplantation im Rahmen der Rehabilitation Lehmkuhl H. Deutsches Herzzentrum Berlin Die medizinische Rehabilitation von Herztransplantierten schließt unmittelbar an den frühen postoperativen Verlauf an. Diese Behandlung hat als Schwerpunkte die Rejektionskontrolle und Steuerung der Immunsuppression, die Behandlung von Komorbidität und die physikalische Therapie der häufig vorliegenden eingeschränkten Mobilität. Spezielle Schulungen zur immunsuppressiven Medikation (I. Cyclosporin A oder Tacrolimus, II.) Azathioprin, Mycophenolat, Everolimus oder Rapamycin, III.) Steroide) sowie ihrer Talblutspiegelkontrollen: Cyclosporin A 150–200ug/ml, Tacrolimus 8–10ng/ml, MMF >1,5ng/ml, Sirolimus 6–10ng/ml, Everolimus 3–8ng/ml und spezielle Hygienemaßnahmen sowie Beratungen zur Ernährung und zu sozialmedizinischen Fragen bilden weitere Schwerpunkte. Häufigkeit und Schweregrad einer Abstoßungsreaktion sind für das Ausmaß einer irreversiblen Transplantatschädigung und damit für den Langzeitverlauf von Bedeutung. Solche Abstoßungen sollten frühzeitig und sicher erkannt und adäquat behandelt werden. Eine klinisch-symptomatologisch orientierte Verfahrensweise ist unspezifisch. Das konventionelle Oberflächen-EKG hat seit der klinischen Einführung von Cyclosporin A für die Abstoßungsdiagnostik mit einer Sensitivität von unter 40% an klinischer Bedeutung verloren. Allein das Neuauftreten von Herzrhythmusstörungen, insbesondere von Vorhofarrhythmien kann als mögliches Indiz einer Abstoßung hilfreich sein. Zur Abstoßungsdiagnostik müssen deshalb Verfahren eingesetzt werden, welche mit hoher Genaugkeit Abstoßungen offen legen und in Reha-Einrichtungen implementierbar sind. Neben der Kontrolle der Basisimmunsuppression zählen die Interpretation von intramyokardialen Elektrokardiographieaufzeichnungen und GewebedopplerEchokardiographie hierzu. Die Herzkatheteruntersuchung mit Endomyokardbiospie, MRT- oder CTVerfahren sowie das multipara-metrische serologische Immunmonitoring sind dem Transplantationszentrum vorbehalten. Bestandteil einer jeden Reha-Nachsorge sind regelmäßige Anamnese und körperliche Untersuchung, Ruhe-EKG, Herzschrittmacherkontrollen, RöntgenThoraxaufnahmen, Echokardiographie und allgemeine und spezielle Laboruntersuchungen sowie LZ-EKG und Langzeitblutdruckmessungen. Die Behandlung von häufigen Begleiterkrankungen wie Niereninsuffizienz, arterielle Hypertonie, Hyperlipidämie und Diabetes mellitus sowie verzögerte 9 Freitag, 22.06.2007 Orthopädie I. Wundheilung unter Immunsuppression und Infektionen nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Physikalische Reha-Programme berücksichtigen den Knochenstoffwechsel ehemals Herzinsuffizienter (<40% Osteopenie, <20% Osteoporose) und jetzt Herztransplantierter unter Steroidmedikation. Zusammenfassend müssen Reha-Einrichtungen nach Herztransplantation als wichtiger und integrativer Baustein in der Nachsorge gewertet werden. Dabei nimmt die Kommunikation einer Reha-Einrichtung mit dem Tx-Zentrum einen besonderen Raum ein. Die Reha-Einrichtung ermöglicht einen fließenden und schonenden Übergang aus der Akutklinik in das patientenindividuelle Sozialumfeld. Orthopädie I. Die EFL nach Isernhagen – Diagnostikum und Intervention in der stationären orthopädischen Rehabilitation Büschel C.1, Schaidhammer-Placke M.2, Greitemann B.2 1 Institut für Rehabilitationsforschung e.V., Norderney, Abt. Bad Rothenfelde; 2Klinik Münsterland, Bad Rothenfelde Hintergrund: In dem Maße, in dem die berufliche Orientierung stationärer Reha-Maßnahmen an Bedeutung gewinnt, rücken auch fähigkeitsbezogene Assessments wie die Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit nach Isernhagen (EFL) in den Blickpunkt des Interesses. Dabei steht dem relativ breiten Einsatz eine noch unzureichende wissenschaftliche Absicherung vor allem in den Bereichen Validität und Praxisrelevanz gegenüber. Die vorliegende Studie sollte einen Beitrag zur Schließung dieser Lücke leisten und folgende Fragen beantworten: 1. Bringt die EFL Ärzten in der stationären orthopädischen Reha relevante Informationen für ihre sozialmedizinische Einschätzung der Patienten? 2. Korrigieren die Patienten aufgrund der EFL ihre eigene Einschätzung ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit? Hat das Einfluss auf ihre beruflichen Perspektiven? 3. Führt die EFL zu einer erheblichen Zunahme von Beschwerden? Methode: In die Studie wurden 73 Probanden eingeschlossen, die im Rahmen ihrer stationären orthopädischen Reha in der Klinik Münsterland, Bad Rothenfelde, oder dem Reha-Zentrum Bad Pyrmont einen EFL-Test absolviert haben. Die EFL-Berichte standen dem Projekt zur Verfügung. Weiterhin schätzten die Ärzte davon unabhängig die Leistungsfähigkeit des Patienten analog zur EFL-Tabelle in „Arztbögen“ ein. Die Patienten gaben in vor und nach der EFL unter anderem schriftlich Auskunft über ihre eigene Einschätzung ihrer Leistungsfähigkeit sowie ihre beruflichen Perspektiven. Ergebnisse: 1. Die ärztlichen Einschätzungen der Leistungsfähigkeit unterscheiden sich sowohl in Bezug auf die allgemeine Leistungsfähigkeit nach REFA als auch in fast allen Subtests signifikant von den EFLErgebnissen. Diese Unterschiede stehen im Zusammenhang mit ärztlichem Wissen um belastende Arbeitsbedingungen des Patienten und Berufserfahrung der Ärzte. 2. Viele Patienten korrigieren nach der EFL ihre Einschätzung ihrer abstrakten Leistungsfähigkeit, verändern ihre konkreten beruflichen Perspektiven aber kaum. 3. Die mittleren Schmerzen nach NAS steigen im Laufe der EFL signifikant an, vor allem bei Patienten, die aus einer unbefriedigenden Arbeitssituation in die Reha kommen, vor der EFL bereits ein höheres Schmerzniveau berichten und ein appellatives Schmerzverhalten zeigen. Diskussion: Die EFL bringt sowohl den Ärzten als auch den Patienten in der Regel einen Informationsgewinn, wobei eine kritische Interpretation des Ergebnisses unter Berücksichtigung der medizinischen und arbeitsplatztechnischen Rahmenbedingungen durch einen erfahrenen Arzt unerlässlich scheint. Unklar bleibt, wessen Einschätzung die beste prädiktive Validität im Hinblick auf eine erfolgreiche Wiederaufnahme der Berufstätigkeit aufweist. Literatur: 1) Erbstößer, S., Nellesen, G. & Schuntermann, M. (2003). Abschlussbericht der FCE-Studie: FCE-Systeme zur Beurteilung der arbeitsbezogenen Leistungsfähigkeit – Bestandsaufnahme und Experteneinschätzung; 2) Innes, E. & Straker, L. (1999b). Validity of work-related assessments. Work, 13, S. 125- 152. Psychosoziale Arbeitsbelastungen bei Rehabilitanden der orthopädischen Rehabilitation Bethge M.1, Herbold D.2, Jacobi C.3, Trowitzsch L.4, Streibelt M.1, Müller-Fahrnow W.1 10 Freitag, 22.06.2007 Orthopädie I. 1 Lehrstuhl für Versorgungssystemforschung und Grundlagen der Qualitätssicherung in der Rehabilitation, Charité Universitätsmedizin Berlin, 2Paracelsus-Klinik an der Gande, Bad Gandersheim, 3ParacelsusRoswitha-Klinik, Bad Gandersheim, 4Institut für Arbeits- und Sozialmedizin in der Paracelsus-Klinik an der Gande Hintergrund:Vielfältige Befunde der sozialepidemiologischen Forschung zeigen, dass psychosoziale Arbeitsbelastungen, die negative Emotionen und Stressreaktionen begünstigen, das Erkrankungsrisiko auch für muskuloskeletale Erkrankungen erhöhen (Linton 2001; Joksimovic et al. 2002; von dem Knesebeck et al. 2005; Bongers et al. 2006). Mit dem Modell beruflicher Gratifikationskrisen wurde ein theoretischer Ansatz zur Abbildung psychosozialer Arbeitsbelastungen entwickelt, der auch für die Ausgestaltung der orthopädischen Rehabilitation von Bedeutung sein könnte. Das Modell der beruflichen Gratifikationskrise geht davon aus, dass Beschäftigte, die in ihrer beruflichen Tätigkeit wiederholt vor Anforderungen gestellt werden, die sie zu hoher Verausgabung veranlassen, ohne dass dieser Verausgabung angemessene Belohnungen in Form von Geld, Anerkennung sowie Aufstiegschancen und/oder Arbeitsplatzsicherheit entsprechen, fortgesetzte Distressreaktionen zeigen. Das am Arbeitsplatz erfahrbare Ausmaß von Verausgabung und Belohnungserwartung wird jedoch nicht allein von situativen, sondern ebenso durch intrapsychische Faktoren beeinflusst. So sind Personen, die eine übersteigerte berufliche Verausgabungsbereitschaft und damit einhergehende hohe Belohnungserwartungen aufweisen, gefährdet, die Wirkung bereits gegebener beruflicher Gratifikationskrisen zu verschärfen, indem Distressreaktionen in ihrer Intensität und Dauer gesteigert werden (Siegrist 1996). Diese Stresserfahrungen können zunächst zur Veränderung körperlicher Funktionen führen und schließlich zur Schädigung von Organsystemen beitragen. Die vorliegende Studie untersucht, ob das Modell der beruflichen Gratifikationskrisen bei Rehabilitanden der orthopädischen Rehabilitation Erklärungsgehalt für die Stärke der berichteten Beeinträchtigung der beruflichen Leistungsfähigkeit und die Dauer der vorangegangenen Arbeitsunfähigkeitszeiten besitzt. Methode: Im Rahmen eines Forschungsvorhabens an der Paracelsus-Klinik an der Gande in Bad Gandersheim wurden 176 Rehabilitanden befragt (74,6% weiblich; Alter 48,9 Jahre [SD=8,2]). Die Komponenten des Modells beruflicher Gratifikationskrisen wurden mit einem standardisierten Fragebogen erhoben. Multivariate Analysen berücksichtigten den Einfluss von Alter, Geschlecht und körperlichem Gesundheitszustand. Ergebnisse: Eine Imbalance zugunsten hoher Verausgabung bei geringer Belohnung (t=-2,255; p=0,026) und eine höhere Verausgabungsbereitschaft (t=-2,098; p=0,038) gehen mit stärkeren Einschränkungen der beruflichen Leistungsfähigkeit einher. Mit steigender Verausgabungsbereitschaft erhöht sich darüber hinaus die Wahrscheinlichkeit für längere Arbeitsunfähigkeitszeiten (bis unter 3 Monate: OR=1,162; p=0,034; 3 bis unter 6 Monate: OR=1,198; p=0,047). Diese Zusammenhänge bestehen unabhängig von Alter, Geschlecht und körperlichem Gesundheitszustand. Es lassen sich zudem Patienten identifizieren, für die sich eine Diskrepanz zwischen eingeschätzter beruflicher Leistungsfähigkeit und der Dauer der Arbeitsunfähigkeitszeiten ergibt. Patienten mit hoher Beeinträchtigung der beruflichen Leistungsfähigkeit bei zugleich geringeren Arbeitsunfähigkeitszeiten sind am stärksten durch ein Ungleichgewicht zugunsten hoher Verausgabung betroffen. Diskussion: Das Ergebnis zeigt, dass die im Modell der beruflichen Gratifikationskrise beschriebenen situativen und intrapsychischen Faktoren einen Zusammenhang zu Schwere und Dauer der Erkrankung bei Rehabilitationsaufnahme zeigen. Innerhalb der orthopädischen Rehabilitation könnten Interventionen, die auf eine Stärkung der Bewältigungskompetenz bei Stressorexposition zielen, einen Beitrag für einen nachhaltigen Rehabilitationserfolg leisten. Literatur: 1)Bongers, P. M., Ijmker, S., van den Heuvel, S. und Blatter, B. M. (2006). Epidemiology of work related neck and upper limb problems: Psychosocial and personal risk factors (Part I) and effective interventions from a bio behavioural perspective (Part II). Journal of Occupational Rehabilitation V16 (3): 272-295.; 2) von dem Knesebeck, O., David, K. und Siegrist, J. (2005). Psychosoziale Arbeitsbelastungen und muskuloskeletale Beschwerden bei Spezialeinheiten der Polizei. Gesundheitswesen 67 (08/09): 674679.; 3) Joksimovic, L., Starke, D. und von dem Knesebeck, O. (2002). Perceived work stress, overcommitment, and self-reported musculoskeletal pain: a cross-sectional investigation. International Journal of Behavioural Medicine 9 (11): 122-138.; 4) Linton, S. J. (2001). Occupational psychological factors increase the risk for back pain: a systematic review. J Occup Rehabil 11 (1): 53-66. Siegrist, J. (1996). Soziale Krisen und Gesundheit. Göttingen, Hogrefe. 11 Freitag, 22.06.2007 Orthopädie I. Einfache standardisierte Testverfahren zur Beurteilung von Aktivität und Teilhabe innerhalb einer aktiven, multimodalen Behandlung des chronischen, unspezifischen Rückenschmerzes Dienemann O., Lohmann J., Kuipers C. Rehabilitationsfachklinik Bad Bentheim, Klinik für Innere Medizin und Rheumatologie Hintergrund: Die Beurteilung von Aktivität und Teilhabe in der medizinischen Rehabilitationspraxis beruht im wesentlichen auf den Stützpfeilern Anamnese und klinischer Testungen. Der fehlende Praxisbezug der klinischen Testungen sorgt häufig zu Frustrationserleben bei Patienten und Behandlern, wenn es sich um realistische Einschätzungen des Leistungsvermögens handelt. Innerhalb von Workhardening-Programmen können insbesondere Patienten mit unspezifischen Rückenschmerzen von einfach durchzuführenden, evaluierten Test- und Trainingsverfahren profitieren. Mittels Selbsterfahrung können Betroffene ihr Leistungspotential einschätzen lernen. Die ungenügende individuelle Belastbarkeit gegenüber unterschiedlichen äußeren Belastungsreizen wird in der Literatur als wesentliche Quelle von Verletzungen und Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule angesehen. Schmerzerfahrung und –erwartung lösen vielfach ein Angst- und Vermeidungsverhalten aus, dass dekonditionierend wirkt. Neben der Muskelkrafteinschränkung gibt es zuverlässige Hinweise auf eine Reduktion der kardiovaskulären Kapazität, die ungünstige Voraussetzungen für Regenerationsprozesse darstellt [Hildebrandt et al. 2005]. Evaluierte Messverfahren liegen für die Ausdauerleistungsfähigkeit, die Maximalkraft und Kraftausdauer der globalen Muskelgruppen sowie der Beweglichkeit vor. Studiendesign: Innerhalb eines multimodalen Behandlungssettings, welches sich an den Erfahrungen des in der Literatur beschriebenen GRIP (Göttinger Rücken-Intensiv-Programm) [Hildebrandt et al. 1996] anlehnte, untersuchten wir die körperlich messbaren Effekte von 78 Patienten mit chronischen, unspezifischen Rückenschmerzen über einen Zeitraum von 1 Jahr. Die Einflussnahme des physio- und sporttherapeutischen Programms war auf die Leistungsvoraussetzungen Grundlagenausdauer, Maximalkraft sowie Koordination ausgerichtet. Die Statusmessung der Ausdauerleistungsfähigkeit erfolgte mittels des UKK-Walking-Tests und des Astrand- Ergometertests. Zur Bestimmung der Maximalkraftfähigkeit wurde das Verfahren der biomechanischen Funktionsanalyse der Wirbelsäule [Denner 1997] (David-Test) eingesetzt. Als ergotherapeutische Intervention wurde Workhardening durchgeführt, eine Kombination aus Rückenschule, Ergonomie, Training und Koordinationsschulung zur realistischen Reintegration in Alltag und Arbeit für Arbeitnehmer mit chronischen Rückenschmerzen. Zur Erfassung der individuellen Hebelast wurde der Pile-Test, zur Ermittlung der allgemeinen Leistungsfähigkeiten bei Alltagsaktivitäten der Parcours-Test [Seeger 1999] eingesetzt. Retrospektiv erfolgte die Betrachtung des Outcomeparameters Arbeitsunfähigkeit 2 Jahre vor und nach Reha mittels der beteiligten Krankenkassen. Ergebnisse: Die Veränderung der Arbeitsunfähigkeit 2 Jahre Post-Reha ist nach Auskünften durch die Krankenkassen um 47 % vermindert. Tab. 1 Veränderungen der Werte zwischen Eingangs- und Retest Test Ausmaß der Veränderung Statistische Signifikanz Astrand-Test 35,5% der PatientInnen verbesserten sich, 59,4% blieben konstant und 3,1% verschlechterten sich (N=64). hoch signifikant (Wilkoxon-Test, Z=-4,235, p<0,001) Walking-Test Durchschnittliche Verbesserung um 9,7 Punkte (N=72) hoch signifikant (t-Test f. gepaarte Stichproben, t=-5,8, df=71, p<0,001) Parcours-Test Durchschnittliche Verbesserung hoch signifikant um 57,5% der Startwerte (N=76) (t-Test f. gepaarte Stichproben, t=-25,3, df=75, p<0,001) Pile-Test Durchschnittliche Verbesserung um 32,2% (LWS) bzw. 21,3% (HWS) der Startwerte 12 (N=73) hoch signifikant (t-Test f. gepaarte Stichproben, t=-7,9, df=72, p<0,001) David-Test Durchschnittliche Verbesserung um 10,3% der Referenzwerte (N=74) hoch signifikant (t-Test f. gepaarte Stichproben, t=-8,2, df=73, p<0,0001) Freitag, 22.06.2007 Orthopädie I. Diskussion und Ausblick: Die gewählten Assessments haben sich in der Rehapraxis bewährt. Die eingesetzten Verfahren verbessern die Aussagefähigkeit und die Akzeptanz von Beurteilungen zur Aktivität und Teilhabe. Die in dem zur Verfügung stehenden Zeitraum von 4 Wochen gemessenen Veränderungen bei der Maximalkraftbestimmung (David-Test) sind zu circa 10 % Leistungszuwachs durch koordinative Lerneffekte erklärbar. Besonders beim Parcours- und Pile-Test konnten wir im Schnitt wesentlich größere Zuwächse feststellen. Unsere Vermutungen gehen dahin, das insbesondere in dem Arbeitsprozess nahestehenden Bewegungsabläufen Vermeidungsverhalten durch Angst und Verunsicherung ausgeprägt war. Der Schluss liegt nahe, dass die Patienten diese Verhaltensmuster während der Reha positiv verändert haben. Die Veränderungen des Outcomeparameters Arbeits-unfähigkeit sollte in weiterführenden Untersuchungen durch geeignete Assessments zur Arbeitszufriedenheit und subjektiven Belastungserleben ergänzt werden, um qualifiziertere Aussagen zu diesem wichtigen Themenkomplex erhalten zu können [Hildebrandt et al. 2005]. Literatur: 1) Hildebrandt J, Müller G, Pfingsten M. (Hrsg). Lendenwirbelsäule – Ursachen, Diagnostik und Therapie von Rückenschmerzen. München: Elsevier Urban & Fischer, 2005; 2) Hildebrandt J, Pfingsten M, Franz C, Saur P, Seeger D. Das Göttinger Rücken Intensiv Programm (GRIP) – ein multimodales Behandlungsprogramm für Patienten mit chronischen Rückenschmerzen, Teil 1 Ergebnisse im Überblick. Schmerz 1996; 10: 190- 203; 3) Denner A. Muskuläre Profile der Wirbelsäule. Berlin; Heidelberg; New York; Barcelona; Budapest; Hongkong; London; Mailand; Paris; Santa Clara; Singapur; Tokio: Springer, 1997; 4) Seeger D. „Workhardening“ Eine Kombination aus Rückenschule, Ergonomie, Training und Koordinationsschulung zur realistischen Reintegration in Alltag und Arbeit für Arbeitnehmer mit chronischen Rückenschmerzen. Orthopädische Praxis 1999; 35: 297- 307; 5) Cieza A, Stucki G, Weigl M, Kullmann L, Stoll T, Kamen L, Kostanjsek N, Walsh N. ICF Core Sets for chronic widespread pain. J Rehabil Med. 2004 Jul;(44 Suppl):63-8 Funktionelle Langzeitergebnisse mittels EMG-Mapping, Isokinetik und Sonographie – 10 Jahre nach primärer Knieendoprothesenimplantation Erler K. 1,3, Neumann U. 1, Babisch J. 2, Brückner L. 1 1 Moritz-Klinik GmbH & Co., 2Waldkrankenhaus „Rudolf Elle“ gGmbH Eisenberg, 3FSU Jena, Klinik für Unfall-, Hand, und Wiederherstellungschirurgie, FB Motorik, Pathophysiologie und Biomechanik Hintergrund: Die Knieendoprothetik hat sich als Standardverfahren etabliert. Sowohl die OP als auch die stationäre Rehabilitation leisten einen wichtigen Beitrag, um eine gute Lebensqualität zu erreichen. Von großem Interesse sind daher die funktionellen Langzeitergebnisse nach Implantation einer Knieendoprothese. Methode: Knie-TEP-Patienten, die einseitig mit einer LCS-Knieendoprothese (Alter: 66,3 ± 5,8 Jahre) versorgt wurden, konnten sowohl präoperativ (n=41) als auch postoperativ nach 5 Jahren (n=21) und 10 Jahren (n=15) mittels EMG-Mapping, Isokinetik und Sonographie untersucht werden. Weitere klinische und subjektive Daten (z.B. Funktionskapazität mittels FfbH) wurden erhoben. Ergebnisse: Von den untersuchten Patienten waren nach 10 Jahren 93 % subjektiv zufrieden. Im Vergleich zu den postoperativen Ergebnissen nach 5 Jahren kommt es zu weiteren Verbesserungen der Flexionsfähigkeit sowie der muskulären Kraft und Koordination, welche das problemlose Ausführen aller Alltagstätigkeiten erlauben. Besonders überraschend war der in der Isokinetik gemessene Kraftzuwachs trotz des höheren Alters der Patienten. Die Koordinationsmuster des M. quadriceps femoris unterscheiden sich z.T. deutlich von denen der Kontrollgruppe; zeigen jedoch gegenüber den 5-Jahres-Ergebnissen keine signifikanten Veränderungen. Die subjektiv empfundene Lebensqualität zeigt sich gegenüber dem präoperativen Zustand deutlich verbessert. Sie ist jedoch explizit vom Auftreten weiterer Begleiterkrankungen und dem alltäglichen Aktivitätsgrad der Patienten abhängig. Diskussion: Langfristige Resultate nach Implantation einer Knieendoprothese zeigten eine gute muskuläre Koordination, Kraft und Beweglichkeit. Ein aktives Alltagsverhalten der Patienten führte zu besseren funktionellen Ergebnissen und einer höheren Patientenzufriedenheit. Literatur: 1) Erler K, Neumann U, Brückner L, Babisch J, Venbrocks R, Anders C, Scholle HC. EMGMapping – Anwendung und Ergebnisse zur Erfassung muskulärer Koordinationsstörungen bei Patienten mit Knieendoprothese. Z. Orthop. 2000; 138: 197-203.; 2) Erler K, Anders C, Fehlberg G, Neumann U, Brückner L, Scholle HC. Objektivierung der Ergebnisse einer speziellen Wassertherapie in der stationären 13 Samstag, 23.6.2007 Kardiologie II. Rehabilitation nach Knieendoprothesenimplantation. Z. Orthop. 2001; 139: 352-358.; 3) Erler K, Neumann U, Anders C, Venbrocks RA, Babisch J, Pieper KS, Scholle HC, Brückner L. Nachuntersuchungsergebnisse mittels EMG-Mapping – 5 Jahre nach Knieendoprothesen-implantation. Z Orthop 2003; 141: 48-53 Änderungssensitivität verschiedener Assessments für die Verlaufskontrolle der Rehabilitation nach Kniegelenkersatz – ein Methodenvergleich Wilhelm B. MEDIAN Klinikum für Rehabilitation, Bad Salzuflen Hintergrund: Die 14 orthopädischen Kliniken der Median-Gruppe haben Studien zur Rehabilitation nach Knie- und Hüft-Endoprothesen-Implantation durchgeführt, um die Ergebnisqualität der Rehabilitation nachzuweisen und ein Bangemarking der orthopädischen Kliniken zu evaluieren. Nach Auswertung der Ergebnisse wurden Leitlinien für die rehabilitative Behandlung dieser Patientengruppen herausgegeben. Es wurden elektronische Messblätter entwickelt, die als Anlage den Entlassungsbriefen beigefügt werden. Methode: Im Bereich der Knieendoprothetik ist es nun möglich, drei verschiedene Scores (HSS, Staffelstein, Median) miteinander zu vergleichen, weil wir wissen wollten, welcher Score die Rehabilitation am besten abbildet, auch im Hinblick daraufhin, dass im Rahmen der integrierten Versorgung diese Erhebungsbögen nicht nur von der Rehabilitationsklinik, sondern auch im Vorfeld von der Akutklinik durchgeführt werden. Ergebnisse: Die Stichprobe wurde an 289 Patienten durchgeführt, 72 davon waren weibliches Geschlecht. Das Durchschnittsalter lag bei 69,4 Jahren. Die durchschnittliche Verweildauer im Akuthaus betrug 16,1 Tage. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Veränderungen der Scores zwischen Aufnahme und Entlassung signifikant sind. Erstaunlicherweise ist die Effektstärke des HSS sogar etwas größer als die der beiden anderen Scores. Beurteilt wurden die Veränderungen bezüglich Gehstrecke, Schmerzen, Hinken, Bewegungsausmaße, Muskelkraft, Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Tätigkeiten des täglichen Lebens. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass der HSS durchaus in der Lage, ist, das Rehabilitationsergebnis unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Kriterien darzustellen. Diskussion: Um im Rahmen der integrierten Versorgung eine möglichst einheitliche Dokumentation des Therapieverlaufs vor und nach einer Implantation einer Knie-Endoprothese festzustellen, ist auch der HSS-Score geeignet, um routinemäßig von den operierenden Kliniken erstellt zu werden. Im Rahmen der Rehabilitation können diese Werte weiterverfolgt und evtl. sogar im Nachsorgebereich von den niedergelassenen Kollegen übernommen werden. Samstag, 23.6.2007 Kardiologie II. Kardiovaskuläre Risikostratifizierung in der Primärprävention Piper J. Rehabilitationskliniken Bad Bertrich Teil 1: Möglichkeiten und Grenzen etablierter Scores Eine möglichst erfolgreiche Primärprävention der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere eine Verhinderung der koronaren Herzkrankheit und ihrer Komplikationen, ist von herausragender präventivmedizinischer Bedeutung. Daher wurden in der Vergangenheit verschiedene Risiko-Scores entwickelt, um individuelle Infarkt-Risiken unter Berücksichtungung vorhander Risikofaktoren quantitativ abzuschätzen und gefährdete Individuen zu erfassen. Diese Scores werden im vorliegenden Beitrag beschrieben, einander gegenübergestellt und hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen kritisch gewürdigt. 14 Samstag, 23.6.2007 Kardiologie II. Framingham- und PROCAM-Score sollen als Morbiditäts-Scores das Risiko abschätzen, eine KHK bzw. einen Herzinfarkt zu erleiden. ESC-Score, Heart-Score und Score-Deutschland sind als Mortalitäts-Scores auf eine Abschätzung des Infarkt-Todesrisikos ausgerichtet. Sämtliche Scores berücksichtigen jeweils nur eine begrenzte Anzahl kardiovaskulärer Risiken. Einige Risiken werden nur pauschal gewichtet, ohne dass der jeweilige individuelle Schweregrad in eine Risikoberechnung eingeht. Hieraus lassen sich gegebene Limitierungen dieser Scores und die Forderung nach valideren und sensitiveren Berechnungsalgorithmen ableiten. Vor diesem Hintergrund wurde ein neuer Algorithmus entwickelt, der das Potenzial bietet, wensentlich sensitivere individuelle Risikoabschätzungen vorzunehmen. Dieser neu erarbeitete Score soll in einem Folgebeitrag (Teil 2) vorgestellt werden. Teil 2: Neue Aspekte einer erweiterten individuellen Risikoerfassung Eine Primärprävention der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere des Herzinfarktes, kann nur erfolgreich sein, wenn Risikoträger mit hoher Sensitivität erfasst und vorhandene Risiken möglichst valide abgeschätzt werden. Die bisher zur Verfügung stehenden Risiko-Scores weisen mehrere methodisch bedingte Limitierungen auf, die in einem vorausgehenden Beitrag diskutiert wurden. Der Großteil aller Infarktpatienten kann daher bei Anwendung dieser Scores nicht einer Hochrisikogruppe zugeordnet werden. Vor diesem Hintergrund soll nun ein neuer Algorithmus vorgestellt werden, der das Potenzial bietet, mit wesentlich höherer Sensitivität individuell vorhandene Infarkt-Risiken quantitativ abzuschätzen. Dieser neu entwickelte Score ist auf universelle Anwendbarkeit ausgerichtet; er berücksichtigt insgesamt 23 riskoerhöhende Determinanten und drei risikoverringernde Faktoren. Die Mehrzahl der Einzelfaktoren geht nicht mit pauschal veranschlagten, sondern mit Meßwert-adaptierten Multiplikatoren in die Risikoberechnung ein. Da das gesamte Datenmaterial tabellarisch aufbereitet wurde, können die Risikoberechnungen auf einfache Weise manuell vorgenommen werden. Seitens der epidemiologischen Forschung könnte der hier vorgestellte Algorithmus aufgegriffen und bei Anwendung auf umfangreiche Probandenkollektive ggf. hinsichtlich seiner Einzelparameter spezifisch adjustiert werden. Teil 3: Mathematische Modelle zur Relativität von Risikofaktoren und Risiko-Scores Im vorliegenden Beitrag wird ein mathematisches Berechnungsmodell vorgestellt, aus bekannten kardiovaskulären Einzelrisiken ein plausibles resultierendes Gesamtrisiko zu kalkulieren. Wenn mehrere Risikofaktoren vorhanden sind und deren jeweilige Einzelrisiken miteinander multipliziert werden, lässt sich aus dem Multiplikationsprodukt x das ungefähre prozentuale Herzinfarkt-Gesamtrisiko f(x) bei Adjustierung an den PROCAM-Score nach folgender Formel berechnen: F(x) = 100 ⋅ tanh (0,008x) [%]. Diese Formel sollte in jedem Fall bei Multiplikationsprodukten x > 30 % angewendet werden, da ansonsten Überschätzungen entstehen. Bei identischen Risikokonstellationen ergibt der Framingham-Score im Vergleich zum PROCAM-Score deutlich höhere Gesamtrisiken. Bei bekanntem PROCAM-Risiko P kann mittels eines Umrechnungsfaktors F auf die korrespondierenden Framingham-Risiken FR wie folgt rückgeschlossen werden: P . 6. 1 p n 1 FR = P ⋅ F F= Der Exponent n = 0,8 ergibt den Mindestfaktor, n = 0,5 den Maximalfaktor, mit dem das jeweilige PROCAM-Risiko multipliziert werden kann, um den korrespondierenden Framingham-Risikobereich zu ermitteln. Indem bei gegebenen Risikokonstellationen vergleichend Risiken nach PROCAM und Framingham abgeschätzt werden, kann auf die Relation der Manifestationswahrscheinlich-keiten von koronarer Herzkrankheit und akutem Herzinfarkt rückgeschlossen werden. Die entwickelten mathematischen Berechnungsmodelle haben das Potenzial, bei jeglichen bekannten kardiovaskulären Risikofaktoren plausible resultierende Gesamtrisiken abzuschätzen. Hierin unterscheiden sich diese Algorithmen von den bisher etablierten Risiko-Scores, welche nur relativ wenige kardiovaskuläre Risiken berücksichtigen. 15 Samstag, 23.6.2007 Kardiologie II. Blutdruck senkende Effekte eines Herzratenvariabilitäts-Biofeedback in der Behandlung essentieller Hypertonie Mussgay L.1, Reineke A.2, Domann S.1, Gevirtz R.2, Rüddel H.1 (Bad Kreuznach, Trier, San Diego) 1 Psychosomatische Fachklinik St.-Franziska-Stift, Bad Kreuznach, Abteilung für Verhaltensmedizin und Rehabilitation des Forschungszentrums für Psychobiologie und Psychosomatik (FPP), Universität Trier; 2 Alliant International University, San Diego, USA Hintergrund: Neuerdings haben bei Patienten mit essentieller Hypertonie Behandlungsversuche mit langsamer Atmung viel versprechende Ergebnisse gezeigt (Franck et al., 1994; Elliot et al., 2004; Grossman et al., 2000). Die vorliegende Studie untersucht die Effekte einer Biofeedback-Behandlung mit Hilfe einer Steigerung der Herzratenvariabilität (HRV; Del Pozo et al., 2004) durch langsame Atmung (ca. 6 Zyklen/min) (EG) im Vergleich zu einer Aufmerksamkeits-Placebo Kontrollgruppe (KG). Zusätzlich wird ermittelt, welchen Beitrag die Baroreflex-Sensitivität (BRS) als Kennwert der autonomen, kardiovaskulären Regulation leistet. Methodik: Die Teilnehmer wurden in der Psychosomatischen Fachklinik St.-Franziska-Stift rekrutiert. Alle Versuchspersonen (Alter 18-60 Jahre) erfüllten die Kriterien für Stufe 1 Hypertonie (90-99/140–159 mmHg). Die Patienten wurden den Gruppen zufällig zugewiesen. Beide Gruppen erhielten zudem die Standardbehandlung der Klinik. Während der 1., 5. und 10. Sitzung sowie zum Follow-up-Zeitpunkt (+3 Monate) wurden die abhängigen Variablen ermittelt. Ergebnisse: Die Auswertung von 31 Patienten der EG (46,9 Jahre, 15 Frauen) und 26 Patienten der KG (49,1 Jahre, 15 Frauen), von denen jeweils 18 auch die 3-Monatskatamnese absolvierten, zeigen vor allem in der EG starke anfängliche Blutdruckreduktionen relativ zum ermittelten 24-Std-Wert. Diese verlieren sich jedoch im Verlauf der Erhebung wieder, so dass keine Gruppenunterschiede bestehen bleiben. Patienten der EG reduzierten jedoch signifikant ihren antihypertensiven Medikamentengebrauch. Sie zeigten auch während der initialen Trainingsphase einen starken Anstieg der BRS, die KG verändert sich kaum. Dieser anfängliche Gewinn verliert sich aber zum Ende hin wieder. Die Bedeutung der BRS als vermittelnder Mechanismus wird durch eine signifikante Korrelation zwischen anfänglicher Abnahme des Blutdrucks und Zunahme der BRS bestätigt (r=-.40; p=.01). Entsprechende starke initiale Anstiege mit späterer Abnahme finden sich in der HRV für die EG im gesamten, niederen und mittleren Frequenzband. Diskussion: Bei einer hohen Variabilität der Blutdruckmessungen zeigten sich insgesamt wenig andauernde Effekte auf den Blutdruck. Die EG konnte die antihypertensive Medikation reduzieren. Der anfängliche Anstieg bei BRS und HRV mit anschließender Abnahme weist auf ungeklärte autonome Anpassungsmechanismen hin. Weitere Studien sollen diesen Aspekt aufklären helfen. Literatur: 1) Del Pozo, J. M., Gevirtz, R. N.; Scher, B. & Guarneri, E. (2004). Biofeedback treatment increases heart rate variability in patients with known coronary artery disease. American Heart Journal, 147(3): E11.; 2) Elliot, W. J., Izzo, J. L., Jr., White, W. B., Rosing, D. R., Snyder, C. S., Alter, A., Gavish, B. & Black, H. R. (2004). Graded blood pressure reduction in hypertensive outpatients associated with use of a device to assist with slow breathing. Journal of Clinical Hypertension (Greenwich), 6(10), 553-559.; 3) Franck, M.; Schäfer, H.; Stiels, W.; Wassermann, R. & Herrmann, J.M. (1994) Entspannungstherapie mit dem respiratorischen Feedback bei Patienten mit essentieller Hypertonie. Psychotherapie, Psychosomatik und medizinische Psychologie, 44, 316-322.; 4) Grossman, E. ; Grossman, A.; Schein, M.H.; Zimlichman, R. & Garvish, B. (2000). Breathing-control lowers blood pressure. Journal of Human Hypertension, 15, 263-269. Bedeutung herzbezogener Ängste für die Rehabilitation kardiologischer Erkrankungen Köllner V.1, Einsle F.2, Sapia K.2, Berg G.3, Altmann, C.4 1 Fachklinik für Psychosomatische Medizin, Bliestal Kliniken Blieskastel, 2Klinik für Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, 3Fachklinik für Innere Medizin, Bliestal Kliniken Blieskastel, 4Herz-Kreislauf-Klinik, Gesundheitspark Bad Gottleuba Untersucht werden sollen der Effekt stationärer kardiologischer Rehabilitation auf herzbezogene Ängste und deren Effekt auf die Lebensqualität. Herzangst wurde mit dem Herzangstfragebogen (HAF) auf den Skalen Furcht, Vermeidung und Selbstaufmerksamkeit erfasst. Ängstlichkeit und Depressivität wurden mit der HADS-D, gesunheitsbezogene Lebensqualität mit der SF-12 gemessen. Eingeschlossen wurden 186 Patienten 16 Samstag, 23.6.2007 Kardiologie II. (66,7% m; 65,7 Jahre, SD 10,18) der Herz-Kreislauf-Klinik Bad Gottleuba. 87,6% füllten den Fragebogen zu Beginn (t1), 57,5% auch nach der Rehabilitation (t2) aus. Körperliche (p = 0,003) und der psychosoziale (p = 0,001) Lebensqualität verbesserten sich, Angst und Depressivität nahmen ab (p < 0,001), wobei sich die Patientinnen zu t2 im HADS nicht mehr von der Norm unterscheiden, während Angst bei Männern erhöht blieb. Herzangst lag bei den Rehabilitanden zu t1 und zu t2 signifikant höher als bei Herzgesunden. Nur auf der Skala Furcht zeigt sich eine Reduktion (p = 0,051) in der Gesamtgruppe. Bei einer Subgruppenanalyse hinsichtlich unterschiedlicher Ausprägung der Herzangst zeigt sich eine Reduktion der Furcht bei der hohen und der mittleren Gruppe, während die niedrige Gruppe konstant blieb. Vermeidungsverhalten stieg in der niedrigen und der mittleren Gruppe an, während es bei Patienten mit hoher Ausprägung zurückging. Selbstaufmerksamkeit stieg in der niedrigen Gruppe an, während sie in den beiden anderen Gruppen konstant blieb. Bei der Herzangst zeigte sich somit ein differentieller Effekt: Herzängstliche Rehabilitanden konnten eine Reduktion von Furcht und Vermeidung erreichen, während es bei Patienten mit niedrigen Werten zu einer Zunahme von Vermeidung und Selbstaufmerksamkeit kam. Mit dem HAF steht für die Rehabilitation ein veränderungssensitives Instrument zur Verfügung, das Rehabilitanden mit auffällig hoher bzw. niedriger Herzangst erfasst, um Interventionen individuell gestalten zu können. Weitere Studien sind erforderlich, um zu klären, ob mit unterschiedlichen Ausprägungen von Herzangst auch ein unterschiedliches Gesundheitsverhalten verbunden ist. Zu beantworten ist weiterhin die Frage, welches Ausmaß an herzbezogenen Ängsten bei welcher Herzerkrankung als Bestandteil eines adaptiven Copings zu betrachten ist. Literatur: 1) Einsle F, Hoyer J, Zimmermann K, Knaut M, Matschke K, Köllner V. Cardiac anxiety before and after cardiac surgery: Its not only panic patients who suffer from anxiety focused on the heart. International Journal of Behavioral Medicine 2004; 11: Supplement, 180 Hoyer J. Herzangstfragebogen (HAF). In Hoyer J, Margraf J (Hrsg.) Angstdiagnostik. Berlin, Springer, 2004; S. 485-488; 2) Eifert GH, Thompson RN, Zvolensky MJ, Edwards K, Frazer NL, Haddad JW, Davig J. The Cardiac Anxiety Questionnaire – development and preliminary validity. Behav Res Ther 2000; 38: 1039-1050 Verbessert eine berufliche Orientierung in der kardiologischen Rehabilitation die berufliche Reintegration? Ergebnisse von 12-Monatskatamnesen einer randomisierten Kontrollgruppenstudie Karoff, M. Klinik Königsfeld der DRV Westfalen Hintergrund: Trotz einer deutlichen Verbesserung in der Akutversorgung kardiologischer Patienten hat sich die berufliche Prognose in den letzten Jahrzehnten nicht verbessert. Mehrere Studien konnten nur moderate Korrelationen zwischen der Schwere des kardialen Ereignisses und „return to work“ zeigen. Ziel der Studie ist die Evaluation eines berufsorientierten Rehabilitationsprogramms, das bei Patienten mit schlechter Prognose hinsichtlich der beruflichen Reintegration während einer stationären Rehabilitation durchgeführt wurde. Neben psychologischen Einzelinterventionen wurden zur Entwicklung einer realistischen Selbsteinschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit und zum Aufbau von Selbstvertrauen die Übungen der Evaluation der funktionalen Leistungsfähigkeit (EFL) in das Therapieprogramm integriert. Methode: Mit Hilfe einer prospektiven, randomisierten Kontrollgruppenstudie sollen die Effekte des berufsorientierten Programms auf die berufliche Reintegration evaluiert werden. Das Hauptzielkriterium ist die Erwerbstätigkeit ein Jahr nach der Rehabilitation. Dieses für die Rentenversicherung (RV) sehr bedeutsame Outcome-Kriterium wird über die Auswertung der Versichertenkonten bei der RV erfasst. Ergebnisse: Insgesamt nahmen 300 Patienten an der Studie teil. Zur 12-Monatskatamnese liegen die Versichertenkonten von 279 Patienten (93 %) vor. Ein Jahr nach der Rehabilitation sind 69,0% der Patienten aus der IG wieder berufstätig. In der Kontrollgruppe (KG) sind es nur 54,0% (chi2; p<0,05). Berücksichtigt man nur jene Patienten, die zu Reha-Beginn ein Arbeitsverhältnis hatten, konnten in der IG 75,4% wieder zur Arbeit zurückkehren. In der KG lag die „Return to Work“-Rate bei 62,4%. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zur 12-Monatskatamnese bestätigen die positiven Effekte einer berufsorientierten Rehabilitation hinsichtlich der beruflichen Prognose. 17 Samstag, 23.6.2007 Kardiologie II. Reha-Fokus Lebensstiländerung: 1 Jahr Psychokardiologische Rehabilitation in der Klinik Höhenried Martius P., Werner A., Klein G. Klinik Höhenried gGmbH der DRV Bayern Süd, 82347 Bernried/Obb. Bei kardiologischen Patienten beträgt die psychiatrisch-psychosomatische Komorbidität rund 25 %, wobei depressive Störungen und Angst- bzw. Belastungsstörungen vorherrschen. Gleichzeitig sind die Ergebnisse der psychiatrisch-psychotherapeutischen Mitbehandlung kardial erkrankter PatientInnen, bezogen auf Morbidität und Mortalität, noch unbefriedigend. Ein Grund dafür könnte darin liegen, dass weder die kardiologische noch die psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung ausreichend auf den Bereich der Lebensstiländerung fokussiert. Für Interventionen in diesem Bereich wurden aber hohe Effektstärken nachgewiesen. In der Klinik Höhenried wurde deshalb an der Schnittstelle zwischen Kardiologie und Psychosomatik eine Psychokardiologische Abteilung eingerichtet, die folgende Behandlungsschwerpunkte bietet: Leitliniengestützte kardiologische Rehabilitation, gruppentherapeutisch ausgerichtete psychosomatische Rehabilitation sowie verhaltenstherapeutisches und psychoedukatives Übungsprogramm zur Lebensstiländerung (Ernährungsschulung, Bewegungstherapie , Stressbewältigungsund Entspannungsverfahren, Nichtraucher-Motivation, Erarbeiten einer medikamentösen Compliance). 2006 wurden 160 PatientInnen in diesem Setting behandelt (33 % w, 67 % m, 27 bis 64 Jahre alt, Altersmedian 53 J.). Sie befanden sich 31 Tage (Minimum 14, Maximum 77 Tage) in der Rehabilitation, zumeist (96 %) mit kardiologischer Zuweisung. 79 % der Patienten kamen arbeitsfähig zur Rehabilitation. Aufnahme-Diagnosen waren das gesamte Spektrum der koronaren Herzerkrankungen, sowie depressive und/oder Angststörungen als vorwiegende psychische Komorbidität. Der Rehabilitationserfolg einer Stichprobe von 30 konsekutiv aufgenommenen PatientInnen wird anhand folgender bei Aufnahme und Entlassung erhobener Parameter beschrieben und diskutiert: HADS, Körpergewicht, 24 h-RR, Trainingswerte Ergometer, Laborwerte (Blutfette), Nikotin- und Alkoholabstinenz, Arbeitsfähigkeit. Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass sich die Risikofaktoren rasch bessern lassen, dass die psychische Symptomatik deutlich zurücktritt und dass auch im Hinblick auf die Arbeitsfähigkeit eine günstige Prognose gestellt werden kann. In der Diskussion wird darauf eingegangen, ob die Fokussierung auf die Lebensstiländerung ein Schlüssel zum Erfolg psychokardiologischer Behandlungsprogramme darstellen kann. Übergewicht bei KHK-Rehabilitanden: Verlauf und Wirkfaktoren nach kardiologischer Rehabilitation Nowossadeck E. Lehrstuhl für Versorgungssystemforschung und Grundlagen der Qualitätssicherung in der Rehabilitation, Charité Universitätsmedizin Berlin Hintergrund: Übergewicht und insbesondere Adipositas ist mit einem erhöhtem Risiko für ein (weiteres) kardiales Ereignis bei KHK-Patienten verbunden (De Bacquer et al. 2004). Nach Entlassung aus der kardiologischen Rehabilitation steigt das mittels Body Mass Index gemessene Übergewicht im Langzeitverlauf wieder an (Küpper-Nybelen et al. 2003). Hier wird die Frage untersucht, ob es Unterschiede in der Entwicklung zwischen verschiedenen Patientengruppen gibt. Daten und Methodik: Die Analysen basieren auf den Daten der von der DGPR geförderten multizentrischen Beobachtungsstudie CARO II (N=1.680 Patienten in 9 Kliniken) von 2003/04 (MüllerFahrnow et al. 2006). Einschlusskriterium war eine gesicherte koronare Herzkrankheit mit und ohne Bypass-OP. Für alle Patienten wurden rehaklinische Daten erhoben. Schriftliche Katamnesebefragungen erfolgten 6 (n=1.043, Response=74% ) und 12 Monate (n=978, Response: 76%) nach Rehabilitation. Zur Ermittlung von Wirkfaktoren für den BMI-Verlauf nach Rehabilitation wurde eine multivariate Varianzanalyse mit Messwiederholung gerechnet. Ergebnisse: Eine differenzierte Analyse des Verlaufs zeigt, dass die Patienten, die zum Beginn der Reha einen BMI > 30 kg/qm hatten, nach Entlassung aus der Reha die günstigste Entwicklung des Körpergewichts aufweisen: 6 bzw. 12 Monate nach Reha ist das mittlere Körpergewicht dieser Patientengruppe niedriger als am Ende der Reha (-0,6 kg bzw. -0,1 kg). In den Patientengruppen mit Normalgewicht (unter 18 Samstag, 23.6.2007 Kardiologie II. 25 kg/qm) bzw. Übergewicht (25 bis 30 kg/qm) gab es signifikante Wiederanstiege (6 Monate: +1,7 kg bzw. 0,8 kg, 12 Monate: +2,4 kg bzw. +1,4 kg) gegenüber dem Reha-Ende. In der multivariaten Varianzanalyse mit Messwiederholung erwiesen sich die Normgruppenzugehörigkeit des BMI am Beginn der Reha, die körperliche Aktivität sowie die Wahrnehmung des eigenen Risikos Übergewicht als signifikante Prädiktoren für die Veränderung des Körpergewichts. Die Wahrnehmung des eigenen Risikos Übergewicht findet sich bei 95% der adipösen Patienten, hingegen bei 41% der übergewichtigen Patienten. Diskussion: Während der kardiologischen Reha erreicht die überwiegende Zahl der Rehabilitanden eine Gewichtsreduktion. Ein bedeutsames Zwischenziel, das bei Patienten mit Übergewicht und insbesondere Adipositas von Bedeutung ist, besteht darin, erreichte Erfolge in der Gewichtsreduktion nicht wieder zu verlieren. Adipöse Patienten haben zumindest dieses Zwischenziel erreicht, Patienten mit Übergewicht hingegen nicht. Gleichwohl bleibt das mit der Adipositas verbundene Risiko bestehen. Literatur : 1) De Bacquer D, De Backer G, Cokkinos D, et al. (2004). Overweight and obesity in patients with established coronary heart disease: Are we meeting the challenge? European Heart Journal 25: 121128; 2) Küpper-Nybelen J, Rothenbacher D, Hahmann H, et al. (2003): Veränderungen von Risikofaktoren nach stationärer Rehabilitation bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit. Deutsche Medizinische Wochenschrift 128: 1525-1530, 3) Müller-Fahrnow W, Nowossadeck E, Dohnke B, et al. (2006). Leitlinienbasiertes Bewegungstraining und Lipidmanagement im Langzeitergebnis nach kardiologischer Rehabilitation - CARO I/II-Studien im Vergleich. Herzmedizin 23: 58-68 Sozioökonomische Bedeutung einer konzeptintegrierten kardialen Nachbetreuung: Erste sozioökonomische Ergebnisse aus der SeKoNa – Studie –Sekundärprävention bei Patienten mit Koronarer Herzkrankheit durch Anschlussheilbehandlung und anschließender konzeptintegrierter Nachsorge. Kohlmeyer M.1, Redaèlli M.2, Seiwerth B.1, Stock S.2, Simic D.2, Lauterbach K.W.2, Mayer-Berger W. 1 1 Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen Roderbirken, Leichlingen, Deutsche Rentenversicherung Rheinland; 2Institut für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie der Universität zu Köln Hintergrund: In der Nachbetreuung von KHK-Patienten nach Anschlußheilbehandlung gibt es bisher kein standardisiertes Vorgehen. Die SeKoNa-Studie ist mit der Zielsetzung konzipiert, eine Verbesserung in der Sekundärprävention der KHK nach Anschlussheilbehandlung mittels konzeptintegrierter Nachsorge zu erzielen. Die Auswirkungen dieses Vorgehens sollen neben der Verbesserung des Risikoprofils insbesondere auch die durch KHK bedingten Fälle von vorzeitigem Tod sowie vorübergehender oder andauernder Morbidität senken. Die vorgenannten Ereignisse belasten besonders die Rentenkassen [Deutsche Rentenversicherung, 2006]. Mit dem Hintergrund der derzeitigen politischen Diskussionen um die Erhöhung des Renteneinstiegsalters auf 67 Jahren erfährt die SeKoNa-Studie eine zusätzliche Bedeutung. Methodik: Das Design der SeKoNa-Studie ist als unizentrische, prospektive, randomisierte und kontrollierte 18-monatige Studie konzipiert [Kohlmeyer et al., 2006]. Insgesamt wurden entsprechend Einbzw. Ausschlusskriterien 600 Patienten eingeschlossen. Die Intervention besteht nach der 3-wöchigen stationären AHB in strukturierten telefonischen Remindern (monatlich in den ersten drei Monaten, danach 3-monatlich bis Studienende nach 18 Monaten) und einer 1-tägigen, ambulanten Nachschulung im Studienzentrum 6 Monate nach AHB-Ende. Zur Outcomemessung werden zu Studienbeginn (Interventions- und Kontrollgruppe) zum Zeitpunkt 6 Monate nach AHB-Ende (Interventionsgruppe) und zum Studienende (beide Gruppen) herangezogen: Blutdruck, BMI, Triglyzeride, Gesamtcholesterin, LDLCholesterin, HDL-Cholesterin, HbA1c sowie Raucherstatus. Ebenso erfolgt eine Messung der IntimaMedia-Dicke der Carotiden 1 cm präbifurkal zu Studienbeginn und Studienende. Die Lebensqualität wird mittels EUROQOL und HADS erhoben. An gesundheitsökonomischen Daten werden am Ende der Studie für die Gesamtstudiendauer erhoben: direkte Kosten (Medikamentenverbrauch, ambulante und stationäre Kosten) und indirekte Kosten (AUTage, Krankentagegeld, Rentenstatus). Ergebnisse: Bei den 600 Studienteilnehmern ergibt sich ein Durchschnittsalter von 49 Jahren. Knapp 89% der Teilnehmer sind männlich. Bezüglich der Schulbildung dominiert der Hauptschulabschluss mit 71%. Interventionsgruppe und Kontrollgruppe unterscheiden sich in allen somatischen und sozioökonomischen gemessenen Parametern zu Studienbeginn nicht signifikant. 19 Samstag, 23.6.2007 Orthopädie II. Bei der 18-monatigen Nachbeobachtung von derzeit n=417 Patienten weisen die Parameter vorzeitiger Tod und Berentung folgenden Trend auf. In der Kontrollgruppe (n=232) sind bereits 5 Patienten verstorben. Die Recherche zeigt, dass alle Todesfälle kardial bedingt sind. In der Interventionsgruppe (n=185) ist noch kein Patient verstorben. Bezüglich Berentung zeigt sich, dass die Kontrollgruppe bereits mehr bewilligte Berentungen(Erwerbsminderung) bzw. laufende Verfahren dazu aufweist als die Interventionsgruppe. Ebenfalls ist die Höhe der Morbidität der Kontrollgruppe deutlich ausgeprägter, die sich durch die Anzahl der 100%igen Erwerbsminderungsrenten (EM-Rente) darstellt (Tabelle 1). Tabelle 1: Absoluter und prozentualer Anteil Rentenstatus EM-Berentung (Gesamt): - Renten Status: 50% - Renten Status: 100% EM-Verfahren EM = Erwerbsminderung Interventionsgruppe 4 (2,2%) 2 2 3 (1,6%) Kontrollgruppe 12 (5,2%) 3 9 9 (3,9%) Schlussfolgerungen: Die Baseline-Daten zeigen, dass es sich um junge, in der Regel männliche Patienten mit niedrigem sozialen Status im Sinne einer Hochrisikogruppe handelt. Interventions-und Kontrollgruppe weisen zu Studienbeginn keine signifikanten Unterschiede auf. Bei der 18-monatigen Nachbeobachtung somatischer und sozioökonomischer Daten ergeben sich erste Hinweise darauf, dass Rentenstatus und Sterblichkeit durch die Intervention günstig beeinflusst werden können. Eine Verlängerung der Nachbeobachtung über 3 Jahre ist beabsichtigt. Literatur: 1) Kohlmeyer, M., Redaèlli, M., Seiwerth, B., Stock, S., Lauterbach, K. W. & Mayer-Berger, W. (2006). Hintergrund, Design und Baseline-Daten aus der SeKoNa-Studie [Abstract]. In 15. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium vom 13. bis 15. März 2006 in Bayreuth. Rehabilitation und Arbeitswelt – Herausforderung und Strategien. Deutsche Rentenversicherung Bund (Hrsg.). Tagungsband: DRV-Schriften, Band 64, (S. 393-394). Frankfurt am Main.; 2) Deutsche Rentenversicherung Bund (2004). www.deutsche-rentenversicherung.de (Abruf: 22.10.06). Orthopädie II. Nutzung rehawissenschaftlicher Forschung zum aktiven Qualitätsmanagement in rehabilitativen Kliniken Sudek A., Blau J. R. MEDIAN Kliniken Berlin Hintergrund: Kontinuierliche interne Qualitätsmaßnahmen sichern im Gegensatz zu exemplarischen, punktuellen Qualitätsmessungen über einen längeren Zeitraum hinaus die Evaluation der Praxis und verstärken durch die andauernde Selbstbetrachtung/-kontrolle das Eigenverständnis in der Prozesshandhabung der medizinischen Rehabilitation. Ziel war es für MEDIAN, unter Nutzung rehawissenschaftlicher, empirischer Studien praxistaugliche Assessments und Indikatoren für Rehaergebnisse zu entwickeln. Methode: Die MEDIAN Kliniken haben in der Indikation Orthopädie diesen Entwicklungsprozess durch bislang drei Studien in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Versorgungssystemforschung und Grundlagen der Qualitätssicherung in der Rehabilitation unter der Leitung von Prof. Dr. Werner Müller-Fahrnow durchgeführt. Diese multizentrischen Studien umfassten 14 Zentren und jeweils 1.200 Patienten. Die praktische Durchführung konnte auf prozess- und ergebnisbezogen erhobene Daten zurückgreifen, die edv-technisch etabliert im Rahmen einer Basisdokumentation regelmäßig erhoben werden. Dieser Datenpool umfasst jährlich ca. 60.000 Fälle. Ergebnisse: Im Ergebnis des Forschungsprozesses wurden Assessments, Bewertungsmaßstäbe und Behandlungsstandards entwickelt. Die Assessements und Bewertungsmaßstäbe wurden formalisiert und als Teil der elektronischen Patientenakte dem klinischen Rehaprozess zur Verfügung gestellt. Damit werden Ergebnisse der Rehawissenschaften in die praktische Rehabilitation umgesetzt. 20 Samstag, 23.6.2007 Orthopädie II. Diskussion: Das oben beschriebene Vorgehen hat gezeigt, dass es möglich ist auf Basis rehawissenschaftlicher Forschungen kontinuierlich wirkende Prozessveränderungen im rehapraktischen Alltag zu etablieren. Dies kann allerdings nicht in Monatsfrist erreicht werden. Dafür benötigt man neben einem langfristig wirkenden Forschungs- und Qualitätskonzept die Strukturvoraussetzungen zur edvgestützten Erfassung und Auswertung kontinuierlicher Massendaten des Rehabilitationsprozesses. Literatur: 1) MEDIAN Kliniken GmbH & Co. KG; Statistische Erfassung und Auswertung von Basisdaten zur stationären Rehabilitation der Patientenklientel der MEDIAN Kliniken – Dokumentation 2000 bis 2005; 2) MEDIAN Kliniken GmbH & Co. KG; QualitätsmanagementSystem für die medizinische Rehabilitation Muskulo-Skelettaler-Krankheiten, speziell: „Zustand nach Hüftgelenkersatz“, Berlin, Dezember 2003; 3) MEDIAN Kliniken GmbH & Co. KG; QualitätsmanagementSystem für die medizinische Rehabilitation Muskulo-Skelettaler-Krankheiten, speziell: „Zustand nach Kniegelenkersatz“, Berlin, August 2002; 4) MEDIAN Kliniken GmbH & Co. KG; QualitätsmanagementSystem für die medizinische Rehabilitation Muskulo-Skelettaler-Krankheiten, speziell: „Chronischer Rückenschmerz“, Berlin Reha-Ergebnisse bei Rehabilitanden mit degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen – eine Analyse der Ergebnisse und Entwicklung von Patientenkategorien Peters A.1, Müller-Fahrnow W.2, Schimpf S.2 1 Schwarzwaldklinik Orthopädie, Bad Krozingen; 2Charite’ Universitätsmedizin Berlin, Lehrstuhl für Versorgungssystemforschung und Qualitätssicherung in der Rehabilitation Hintergrund: Bei der Erarbeitung von Leitlinien in der stationären Rehabilitation ist die Ergebnisevaluation abhängig von unterschiedlichen Schweregradgruppen unverzichtbar. Am Beispiel der Reha-Indikation „degenerative Wirbelsäulenerkrankungen“ wird gezeigt, inwieweit eine differenzielle Behandlung möglich ist, so dass funktionelle Einschränkungen, Schmerzintensität und psychischbedingte Beeinträchtigungen ausgeglichen werden. Angenommen wird, dass Patienten mit sehr hohem Schweregrad und psychischer Komorbidität mehr von der stationären Rehabilitation profitieren als Patienten mit geringerem Schweregrad ohne psychische Komorbidität. Ein weiteres Anliegen der Studie ist, Patientenkategorien für eine zukünftige fallbezogene Vergütung in der stationären orthopädischen Rehabilitation zu entwickeln. Methode: Die Stichprobe entstammt einer multizentrischen prospektiven Kohortenstudie zur Evaluation der Rehabilitation von 1228 Patienten. Der Schweregrad der Erkrankung wurde anhand einer 2-StepClusteranalyse auf Basis von Variablen, die den körperlichen und psychischen Gesundheitszustand bei Reha-Beginn, ermittelt. Hierbei ergaben sich vier Cluster, die sich bezüglich der körperlichen Verfassung deutlich voneinander unterscheiden. Die am stärksten körperlich beeinträchtigten Patienten sowie die Patienten mit dem zweit höchsten Schweregrad weisen zudem eine psychische Komorbidität auf. Bei den Patienten, die zu den beiden anderen Clustergruppen zu zählen sind, ergeben sich keine Hinweise auf eine psychische Belastung. Die Ergebnismessung erfolgte mittels Fragebogeninstrumente (Funktionsfragebogen Hannover-Rücken = FFbH-R, Pain Disability Index = PDI, Fragebogen zum Gesundheitszustand = SF-12, Fragebogen zum Chronifizierungsgrad = MPPS, Erfassung der Schmerzintensität mittels numerischer Rating Skala = NRS). Mittelfristige Effekte wurden durch eine Katamneseerhebung 3 Monate nach Reha-Ende erhoben. Ergebnisse: Zu Reha-Beginn wird bei 23% und 20% der Patienten ein sehr hoher bzw. erhöhter Schweregrad mit psychischer Komorbidität sowie bei 36 % und 21 % ein hoher bzw mittelgradiger Schweregrad ohne psychische Faktoren festgestellt. Unterschiede zwischen den Gruppen zu Reha-Beginn bestanden darin, dass Patienten mit sehr hohem Schweregrad und psychischen Faktoren hohe Angst- und Schmerzwerte, hohe Funktionsbeeinträchtigungen und eine Schmerzchronifizierung, einen geringsten Ausbildungsgrad mit ungünstigster Erwerbssituation zeigten und wirbelsäulenoperiert waren. Unterschiede bezüglich Alter, Geschlecht und Kostenträgerschaft bestanden nicht. Patienten der Schweregradgruppen ohne psychische Komorbidität erhielten mehr aktive, solche mit psychischer Komorbidität mehr psychotherapeutische Maßnahmen. Die Veränderungsmessungen ergaben bei Patienten mit sehr hohem Schweregrad und psychischen Merkmalen den größten Zugewinn körperlicher Funktion, die deutlichste Reduzierung der Schmerzintensität und führte bei diesen Rehabilitanden mit bestehendem Beschäftigungsverhältnis am ehesten zur Wiederaufnahme der Berufstätigkeit. 21 Samstag, 23.6.2007 Orthopädie II. Diskussion: Die Untersuchung der Reha-Verläufe von Rehabilitanden mit unterschiedlichem Erkrankungsschweregrad weist differentielle Effekte aus. Die Vermutung, dass Patienten mit hohem Schweregrad und psychischer Komorbidität stärker von der stationären Rehabilitation profitieren als Patienten mit geringerem Schweregrad mit und ohne psychische Merkmale, kann mit Hinblick auf die kurz- und mittelfristigen Ergebnisse bestätigt werden. Trotz schlechterer Ausgangslage als die anderen Gruppen verbessert sich der Gesundheitszustand speziell der Gruppe mit sehr hohem Schweregrad und psychischer Komorbidität, bleibt jedoch auf höherem ungünstigen Niveau, so dass eine Angleichung an die Gruppen mit geringerem Schweregrad nur gering ausfällt. Durch die Analyse von somatischen, psychischen und sozialen Einflussfaktoren lassen sich unterschiedliche Schweregradgruppen ermitteln, auf deren Basis ein Zuordnungsalgorithmus für die Bildung von Patientenkategorien und damit für eine fallbezogene Vergütung in der stationären orthopädischen Rehabilitation entwickelt werden kann. Literatur: 1) Müller-Fahrnow, W. (2006): Fallgruppenbildung in der Suchtrehabilitation – Ergebnisse aus der RMK-Studie. In: Tagungsband des 15. Rehabilitationswissenschaftlichen Kolloquiums in Bayreuth (DRV-Schriften, Bd. 64, 500-502). Frankfurt/Main: VDR; 2) Neubauer, G., Ranneberg J. (2005): Entwicklung von Rehabilitationsbehandlungsgruppen (RBG) für die Kardiologie und Orthopädie – Ergebnisse eines Forschungsprojektes. In: Rehabilitation 44: 34-43; 3) Rapp, B. (2006): Eine Frage der Zeit – die Reha-DRG’s kommen. In: Das Krankenhaus 8: 663-668.; 4) Spyra, K., Müller-Fahrnow, W. (1998): Rehabilitanden-Management-Kategorien (RMK’s) – Ein neuer Ansatz zur Fallgruppenbildung in der medizinischen Rehabilitation. In: Die Rehabilitation. 37. Jhg., Suppl. 1, Juni 1998, Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag, 47-56.; 5) Spyra, K., Kolleck, B., Möllmann, C., Müller-Fahrnow, W. (2006): Rehabilitanden-Management-Kategorien (RMK) – neue Ergebnisse aus einem Projekt zur Bildung von Patientenfallgruppen in der Suchtrehabilitation. In: Tagungsband des 15. Rehabilitationswissenschaftlichen Kolloquiums in Bayreuth (DRV-Schriften, Bd. 64, 302-304). Frankfurt / Main: VDR. Extremitätenerhalt in einem Disease Management Programm für den diabetischen Fuß Weck M. 1,2, Bendel G. 2, Ott P. 1, Laage C. 2, Dietrich U. 1, Hempel M. 1, Koehler C. 3 1 Klinik Bavaria Kreischa, Abteilung Diabetes, Stoffwechsel und Endokrinologie; 2Weißeritztal- Kliniken Freital-Dippoldiswalde, Abteilung Diabetischer Fuß; 3Zentrum für klinische Studien (GWT) der Technischen Universität Dresden Zielstellung: Amputationen der unteren Extremitäten sind eine häufige Komplikation bei Patienten mit Diabetes mellitus. Diese Studie untersucht, ob die Anwendung eines strukturierten Disease Management Programms (DMP) für den diabetischen Fuß (DF) in einer Region des Bundeslandes Sachsen die Anzahl an Majoramputationen reduzieren kann. Design und Methoden: In einem prospektiven Studienansatz untersuchen wir Patienten mit diabetischem Fuß in einer Behandlungskette von ambulanter, akutmedizinischer und rehabilitativer Therapie. Die Studie wurde geplant und ausgeführt durch die AOK Sachsen, ein Akutkrankenhaus mit Spezialisierung für die Behandlung des diabetischen Fußes und eine spezialisierte Rehabilitationsklinik. Die Rekrutierungsphase reichte vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2004. Alle Studienteilnehmer werden darüber hinaus einer follow-up Kontrolle über 5 Jahre unterzogen. Das University of Texas Wound Classification System (UT) für Fußulzera diente als Basis der Dokumentation und Analyse. Wir evaluierten die Anzahl von Amputation der unteren Extremitäten, die Abheilungsraten der Ulzera und die zugrunde liegenden Formen der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Ergebnisse: Wir berichten hier die Ergebnisse der ersten Patientengruppe, die die 2-Jahres follow-up Untersuchungen abgeschlossen hatten. Im Jahr 2000 wurden 102 Patienten mit neuem DF konsekutiv in die Studie eingeschlossen. 68,6 % waren Männer, das mittlere Alter der Studienpopulation war 68,1 ± 11,4 Jahre und die mittlere Diabetesdauer 19,4 ± 10,3 Jahre. Nach 2 Jahren konnten noch 68 Patienten nachuntersucht werden. Insgesamt verstarben 22 Patienten (21,6 %) und 12 (11,8 %) haben die Studie aus verschiedenen Gründen beendet (drop out). Bei Entlassung aus der Rehabilitations-Klinik waren 35,3 % aller Ulzerationen komplett abgeheilt und weitere 44,1 % befanden sich im UT-Grad 1. Die follow-up Kontrolle nach 6 Monaten zeigt eine Abheilungsrate von 65,7 % und weitere 16,7 % waren dem UT-Grad 1 zuzuordnen. Nach 2 Jahren konnte eine komplette Abheilung bei 51 Patienten (50 % der Kohorte der originären 102 Patienten oder 75 % der 22 Samstag, 23.6.2007 Orthopädie II. Probanden, die die 2-Jahres follow-up Untersuchung erreichten) konstatiert werden. 10 Patienten fanden sich im UT-Grad 1. 8 Diabetiker mußten einer Majoramputation während der 2 Jahresperiode unterzogen werden (Amputationsrate 7,8 %). Schlussfolgerungen: Die primäre Zielstellung der Studie, eine signifikante Reduktion der Majoramputationen bei Patienten mit DF konnte erreicht werden. Die Heilungsraten der Ulzera sind vergleichbar denen führender Zentren. Das DMP für den DF scheint die Effekte einer strukturierten und integrierten ambulanten, akutstationären und rehabilitativen Behandlung bei Patienten mit diabetischem Fuß auf die Qualität der Ergebnisse zu demonstrieren. Indikationen für die verhaltensmedizinisch-orthopädische Rehabilitation – Prädiktoren des Therapieerfolgs Schwarz S.1, Mangels M.1, Holme M.2, Rief W.1 1 2 Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Psychologie, AG Klinische Psychologie und Psychotherapie; Rehazentrum Bad Pyrmont–Klinik Weser Hintergrund: Bei der Behandlung chronischer orthopädischer Beschwerden war es bisher kaum möglich, Prädiktoren für den Erfolg eines multidisziplinären Treatments zu finden [1]. Da jedoch bei der Entwicklung von Chronizität die Wichtigkeit biopsychosozialer Einflüsse zunehmend betont wird [2], wurde in den letzten Jahren in der stationären orthopädischen Rehabilitation neben der klassischorthopädischen Behandlung der verhaltensmedizinisch-orthopädische Behandlungsansatz eingeführt, der im Sinne der Prävention einer weiteren Verschlechterung besonderen Schwerpunkt auf Strategien der Schmerzbewältigung legt. Hier stellt sich die Frage nach der differenziellen Indikation für entweder eine klassisch-orthopädische oder eine mit verhaltensmedizinischen Elementen angereicherte Behandlung. Im Rahmen einer randomisierten, kontrollierten Studie wurde untersucht, ob sich jeweils Prädiktoren für den Rehabilitationserfolg der beiden Behandlungsansätze finden lassen. Methode: Es handelt sich um eine Studie mit zwei Messzeitpunkten (Aufnahme & Entlassung aus der Rehabilitation). Insgesamt wurden 363 Patienten befragt. Zur Überprüfung des Behandlungserfolgs wurden schmerzspezifische Maße (FESV, SES, PDI), subjektiver Gesundheitszustand (SF12), Depressivität (BDI) und Lebenszufriedenheit (FLZ) erhoben sowie eine Diagnostik psychischer Störungen (IDCL) durchgeführt. Zudem wurden Angaben der behandelnden Ärzte berücksichtigt. Als Prädiktoren des Therapieerfolgs wurde eine Vielzahl von Variablen geprüft. Ergebnisse: Beide Behandlungen waren im Kurzzeitvergleich effektiv. Signifikante Effekte für beide Behandlungsansätze fanden sich regressionsanalytisch bei folgenden Prädiktoren: Depressivität, medizinische und psychologische Behandlungserwartung sowie hoher Schmerzmittelgebrauch und das Vorliegen einer psychischen Störung. Insgesamt konnte jedoch nur eine niedrige Varianzaufklärung gefunden werden (1,4% bis 5,5%). Diskussion: Im Rahmen dieser Untersuchung war es nicht möglich, eindeutige Prädiktoren für den differenziellen Rehabilitationserfolg der beiden Behandlungsansätze zu finden. Sollte sich im Langzeitverlauf der Untersuchung herausstellen, dass sich eine der beiden Behandlungen überlegen zeigt, ohne dass sich spezifische Prädiktoren finden lassen, müsste die Frage einer differenziellen Indikation grundsätzlich kritisch hinterfragt werden. Literatur: 1) Hulst, M. van der, Vollenbroek-Hutten, M.M.R., IJzerman, M.J. (2005). A systematic review of sociodemographic, physical, and psychological predictors of multidisciplinary rehabilitation – or, back school treatment outcome in patients with chronic low back pain. Spine 30 (7), 813-825.; 2) Vlayen, J.W.S. & Morley, S. (2005). Cognitive-behavioral treatments for chronic pain – What works for whom? Clinical Journal of Pain 21(1), 1-8. 23 Samstag, 23.6.2007 Orthopädie II. Die „Integrierte Medizinisch-Berufsorientierte Orthopädische Rehabilitation“ in der ParacelsusKlinik an der Gande – Ergebnisse der formativen Evaluation Bethge M.1, Herbold D.2, Jacobi C.3, Trowitzsch L.4, Müller-Fahrnow W.1 1 Lehrstuhl für Versorgungssystemforschung und Grundlagen der Qualitätssicherung in der Rehabilitation, Charité Universitätsmedizin Berlin, 2Paracelsus-Klinik an der Gande, Bad Gandersheim, 3ParacelsusRoswitha-Klinik, Bad Gandersheim, 4Institut für Arbeits- und Sozialmedizin in der Paracelsus-Klinik an der Gande Hintergrund: Rund ein Drittel der Rehabilitanden in der orthopädischen Rehabilitation weisen besondere berufliche Problemlagen auf (Müller-Fahrnow und Radoschewski 2006). Unter der Bezeichnung medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBO-Rehabilitation) wurde in den vergangenen Jahren eine größere Zahl von Projekten begonnen, die die beruflichen Teilhabedefizite besonders beeinträchtigter Rehabilitanden mit ungünstiger Erwerbfähigkeitsprognose zu überwinden suchen. Die für solche Patienten mit besonderer beruflicher Problemlage konzipierten Behandlungsmodule beziehen sich in der orthopädischen Rehabilitation bisher jedoch eher auf das physische Fähigkeitsprofils, ohne dabei berufsbezogene psychosoziale Belastungen gleichermaßen in Rechnung zu stellen. Da neuere randomisierte kontrollierte Studien insbesondere die Wirksamkeit kognitiv-behavioraler Gruppenangebote belegen (Linton und Andersson 2000; Marhold et al. 2001; Linton et al. 2005), ist diese Situation durchaus kritisch zu bewerten. Die dort berichteten Größen der geschlossenen Gruppen von sechs bis zehn Personen sind bei einem angenommenen Bedarf von rund einem Drittel der orthopädischen Rehabilitanden und wöchentlichen Anreisezahlen von unter 20 Personen aber nur dann zu realisieren, wenn Patienten mit beruflichen Problemlagen bereits gezielt einbestellt werden. Die Paracelsus-Klinik an der Gande hat zum 1. August 2006 im Rahmen der integrierten medizinischberufsorientierten orthopädischen Rehabilitation (IMBO-Rehabilitation) mit der Implementierung eines aus sechs Modulen bestehenden, berufsbezogenen kognitiv-behavioralen Gruppenkonzepts begonnen. Die Implementierung wird vom Lehrstuhl für Versorgungssystemforschung und Grundlagen der Qualitätssicherung in der Rehabilitation, Charité Universitätsmedizin Berlin (VQS Rehabilitation) wissenschaftlich begleitet. Ziel: Das begleitende formative Evaluationsvorhaben war durch drei wesentliche Aufgaben bestimmt: Erstens die Entwicklung und Validierung eines Screening gestützten Verfahrens zur Patienteneinbestellung, zweitens die Manualisierung des Konzepts und drittens die Bestimmung der Innergruppeneffekte, um erste Aussagen zur Wirksamkeit des Programms zu treffen. Methodik: Das während der Implementierungsphase des Programms eingesetzte Screening nutzte vier Kriterien zur Erfassung einer beruflichen Problemlage (Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit bei Aufnahme, vorangegangene Arbeitsunfähigkeit von mindestens 6 Monaten oder eine subjektiv eingeschätzte Gefährdung der beruflichen Zukunft). Neben dem prästationären Screening wurden Daten zu Beginn und Ende der Rehabilitation erhoben, um eine Validierung der Einschlusskriterien und ggf. deren Weiterentwicklung leisten und die Innergruppeneffekte der Maßnahme bestimmen zu können. Die Manualisierung des Konzeptes erfolgte auf Grundlage einer Mitarbeiterbefragung. Der dazu entwickelte Fragebogen erhob Strukturmerkmale des jeweiligen Moduls (Ort, Zeit, Anzahl der Teilnehmer, Anzahl der Therapeuten, Qualifikation und verwendete Materialen bzw. Geräte), Therapieziele, Referenzquellen, typische, chronologische Durchführung des Behandlungselements, kritische Therapiesituationen, Vor- und Nachteile bei Durchführung in geschlossener Gruppe und Entwicklungspotenziale. Ergebnisse: Bis Anfang Januar 2007 wurden für 260 Patienten die genannten Einschlusskriterien überprüft. Das Anschreiben, das dem prästationär zugesandtem Screening beilag, forderte die Patienten auf, den Fragebogen innerhalb von fünf Werktagen zurück an die Klinik zu senden. Diese Frist wird eingehalten. Durchschnittlich vergingen zwischen Postausgang und -eingang sieben Wochentage. 199 (76,5%) der Patienten erklärten ihre Bereitschaft zur weiteren Studienteilnahme. Diese waren überwiegend weiblich (76,0%). Das durchschnittliche Alter lag bei 49,2 Jahren (SD 8,0). 93 (46,7%) der Studienteilnehmer erfüllten mindestens eines der Einschlusskriterien. Für diese war damit die Bedarfssituation für die Teilnahme an der IMBO-Rehabilitation gegeben. Diese Patienten zeigten neben einer stärker beeinträchtigten beruflichen Leistungsfähigkeit auch eine deutlich stärkere psychosoziale Belastung am Arbeitsplatz. Diese Patienten erfuhren geringere berufliche Gratifikationen, erlebten ihren 24 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik II. Arbeitsplatz als mit mehr beruflichen Problemen verbunden und sahen ihre berufliche Zukunft stärker gefährdet. Da die Implementierung der Screening gestützten Einbestellung in mehreren Schritten realisiert wurde, konnte in der ersten Studienphase nur ein Teil der Studienteilnehmer tatsächlich an der IMBORehabilitation teilnehmen. Von diesen 49 Personen liegen bisher für 36 Personen Daten aus der Befragung zu Rehabilitationsende vor. Ergebnisse für die Veränderung von Beginn bis Ende der Rehabilitation zeigen hohe Innergruppeneffekte für Schmerzintensität (d=-1,1) und Allgemeinen Gesundheitszustand (d=1,3), mittlere Effekte für die berufliche Leistungsfähigkeit (d=0,5) sowie geringe Effekte für Selbstwirksamkeit (d=0,3) und körperliche Funktionsfähigkeit (d=0,4). Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung wurden vom VQS Rehabilitation ausgewertet und zusammen mit Entwicklungsempfehlungen für die jeweiligen Module zusammengefasst. Diese Entwürfe wurden mit den jeweiligen Therapeutenteams in mehreren Treffen diskutiert. Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist ein Manual der IMBO-Rehabilitation entstanden, das die Durchführung der jeweiligen Behandlungsmodule detailliert beschreibt. Diskussion: Die Implementierung der IMBO-Rehabilitation hat sich als machbar erwiesen. Die Wirksamkeit des Behandlungsprogramms wird nach Abschluss der formativen Evaluation in einer randomisierten kontrollieren Studie überprüft. Literatur: 1) Linton, S. J. und Andersson, T. (2000). Can chronic disability be prevented? A randomized trial of a cognitive-behavior intervention and two forms of information for patients with spinal pain. Spine 25 (21): 2825-2831.; 2) Linton, S. J., Boersma, K., Jansson, M., Svard, L. und Botvalde, M. (2005). The effects of cognitive-behavioral and physical therapy preventive interventions on pain-related sick leave: a randomized controlled trial. Clin J Pain 21 (2): 109-119.; 3) Marhold, C., Linton, S. J. und Melin, L. (2001). A cognitive-behavioral return-to-work program: effects on pain patients with a history of longterm versus short-term sick leave. Pain 91 (1-2): 155-163.; 4) Müller-Fahrnow, W. und Radoschewski, F. M. (2006). Theoretische Grundlagen der MBO-Rehabilitation. In: Müller-Fahrnow, W., Hansmeier, T. und Karoff, M. (Hrsg.), Wissenschaftliche Grundlagen der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation. Lengerich, Pabst Science Publishers: 36-46. Psychosomatik II. MCD und ADHS bei psychosomatischen Störungen Enseroth T. Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation am Rehabilitationszentrum Seehof der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Charité Universitätsmedizin Berlin Hintergrund: Die einst umfangreiche Forschung zur Minimalen Cerebralen Dysfunktion (MCD), im Sinne milder organischer Psychosyndrome, setzt sich heute mit wesentlichem Fokus auf die Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) fort. Die ADHS ist eine kategorial definierte Störung, welche durch die Leitsymptome Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität und Impulsivität beschrieben wird. Im klinischen Alltag sehen wir einerseits immer wieder Patienten, welche die Kriterien der ADHS nicht erfüllen, aber dennoch milde psychoorganische Symptome zeigen. Andererseits sehen wir regelmäßig Patienten, welche die Kriterien einer ADHS erfüllen und dazu weitere typisch hirnorganische Symptome darbieten. Aus klinischen und epidemiologischen Überlegungen lässt sich ableiten, dass es unter erwachsenen Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen bis zu 10% mit Problemen geben muss, die auf eine persistierende MCD zurückzuführen sind. Diese milden psychoorganischen Syndrome können einen wesentlichen pathogenetischen Faktor bei Anpassungsstörungen und vielen anderen psychischen Störungen bilden. Die Forschungsfrage der vorliegenden Studie ist die Überprüfung einer MCD-Skala bei Patienten in psychosomatischer Rehabilitation. Methode: 974 unausgelesene Patienten (Alter 20 bis 50 J.) in psychosomatischer Rehabilitation wurden mit Hilfe der MCD-Skala untersucht. Die MCD-Skala ist ein Selbstbeurteilungsfragebogen mit 20 Items, welche Kernsymptome des organischen Psychosyndroms erfragen. Zur Auswertung mit SPSS wurde eine Häufigkeitsverteilung erstellt, eine Konsistenzanalyse und eine Dimensionalitätsüberprüfung mittels Faktorenanalyse durchgeführt. Konvergente Validitätsaspekte wurden in einer zweiten Stichprobe von 144 unausgelesenen Patienten in psychosomatischer Rehabilitation mit der ADHS-SB (Rösler et al. 2003) erhoben. 25 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik II. Ergebnisse: Bei einem potentiellen Range von 0 bis 20 wurde ein Mittelwert von 7,8 (s.d. 4,0) gefunden. Die Daten waren normalverteilt. Die Bestimmung der inneren Konsistenz ergab einen Wert für Cronbachs α von .80. Die Faktorenanalyse ergab 5 Faktoren mit einem Eigenwert > 1 und 49,4% extrahierter Varianz. Die drei Hauptfaktoren waren a) Störungen der Affektregulation, b) Störungen von Gedächtnis und Orientierung und c) Störungen von Antrieb und Arousal. Die Korrelation der MCD-Skala mit der ADHS-SB (Items 1 bis 18) lag bezüglich der Gesamtsumme signifikant bei .63, der Faktor a) korrelierte dabei signifikant auf mittlerem Niveau mit den Subskalen Hyperaktivität (.41) und Impulsivität (.45), die Faktoren b) und c) mit der Subskala Aufmerksamkeitsdefizit (.55, .52). Diskussion: Die Daten zeigen, dass organische Psychosyndrome als dimensionales Phänomen aufgefasst werden müssen. Die gefundene dreidimensionale Faktorenlösung spiegelt die klassische Psychopathologie des psychoorganischen Syndroms. Die MCD sollte erstens zum Verständnis der ADHS und zweitens bei chronifizierenden psychischen Störungen, hier speziell bei Anpassungsstörungen, größere Beachtung finden. Differentialdiagnostik von Arbeitsplatzbezogenen („Klassischen“) Angsterkrankungen Ängsten und Arbeitsplatzunspezifischen Muschalla B., Linden M. Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation an der Charité Universitätsmedizin Berlin und am Rehabilitationszentrum Teltow/Seehof, Deutschland Hintergrund: Arbeitsplätze lösen ihrer Natur nach Angst aus. Dies kann bis zu einer Arbeitsplatzphobie gehen und zu Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit führen. Die Frage ist, ob arbeitsplatzbezogene Ängste unabhängig von klassischen Angsterkrankungen vorkommen. Methode: 132 Patienten einer psychosomatischen Rehabilitation wurden mit einem standardisierten diagnostischen Interview auf Basis des DSM-IV untersucht bezüglich arbeitsplatzbezogener Ängste und allgemeiner psychischer Erkrankungen, inklusive klassischer Angsterkrankungen. Ergebnisse: 54% der Patienten berichteten von Ängsten sowohl im Allgemeinen als auch speziell am Arbeitsplatz, 14% erlebten Ängste nur am Arbeitsplatz. Formen der Arbeitsplatzängste sind situationsbezogene Ängste, arbeitsplatzbezogene Panik, Posttraumatische Belastungsstörung, spezifische oder unspezifische soziale Phobie, Beeinträchtigungs- und Ausbeutungsängste, Hypochondrische Ängste, Insuffizienzängste, Generalisierte Besorgtheit, Spezifische Besorgtheit. Diskussion: Arbeitsplatzängste sind krankheitswertige Störungen, deren Entstehung und Symptomatik sich nur im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz beschreiben lässt. Sie können unabhängig von klassischen Angststörungen vorkommen. Ebenso können klassische Angsterkrankungen zu sekundären arbeitsplatzbezogenen Ängsten führen und damit eine neue klinische Wertigkeit erhalten. Literatur: 1) Haines J, Williams CL, Carson JM (2002). Workplace Phobia: Psychological and psychophysiological Mechanisms. International Journal of Stress Management 9 (3), 129-145. Linden M, Muschalla B (2007). Arbeitsplatzbezogene Ängste und Arbeitsplatzphobie. Der Nervenarzt, 78, 39-44.; 2) Linden M, Muschalla B (2007). Anxiety disorders and workplace-related anxieties. Journal of Anxiety Disorders, 21, 467-474. Diagnostische Kriterien der Posttraumatischen Verbitterungsstörung (PTED) Lieberei B. Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation an der Charité und der Abteilung für Verhaltenstherapie und Psychosomatik des Reha-Zentrums Seehof der Deutschen Rentenversicherung Bund Hintergrund: Die Anpassungsstörungen und Posttraumatischen Störungen stellen häufige, aber unscharf definierte psychische Störungen dar, wenn man einmal von der Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTB) absieht. Eine neue Subkategorie stellt die Posttraumatische Verbitterungsstörung (Posttraumatic Embitterment Disorder = PTED) dar, die nach einschneidenden, wenn auch nicht außergewöhnlichen persönlichen Lebensereignissen auftreten kann. Für weitere wissenschaftliche Untersuchungen dieser Störung müssen standardisierte diagnostische Algorithmen vorliegen. Methode: Bei 50 stationären Patienten der Abteilung Verhaltenstherapie und Psychosomatik des Rehabilitationszentrums Seehof der Deutschen Rentenversicherung wurde aufgrund klinischen Urteils 26 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik II. unter Bezug auf die vorliegenden Beschreibungen der Störung eine posttraumatische Verbitterungsstörung durch einen der Forschungsärzte diagnostiziert. Sie wurden verglichen mit 50 Patienten mit anderen psychischen Störungen, die hinsichtlich des Alters und des Geschlechts mit der Experimentalgruppe parallelisiert war. Es wurde ein halbstandardisiertes diagnostisches Interview entwickelt das nach den psychopathologischen Charakteristika der PTED und dem Spektrum an Emotionen im Zusammenhang mit dem negativen Lebensereignis fragt. Tabelle 1: Diagnostische Kriterien der Posttraumatischen Verbitterungsstörung A. Es ist ein einmaliges schwerwiegendes negatives Lebensereignis zu identifizieren, in dessen Folge sich die psychische Störung entwickelt hat. B. Das kritische Lebensereignis wird folgendermaßen erlebt: (1) Dem Patienten ist das kritische Lebensereignis bewusst, und er sieht seinen Zustand als direkte und anhaltende Konsequenz aus dem Ereignis. (2) Der Patient erlebt das kritische Lebensereignis als ungerecht, als eine Beleidigung und Demütigung. (3) Der Patient reagiert auf das kritische Ereignis mit emotionaler Erregung, Verbitterung, Hilflosigkeit und Wut. (4) Wenn das kritische Ereignis angesprochen wird, reagiert der Patient mit emotionaler Erregung. C. Charakteristische Symptome sind wiederholte intrusive Erinnerungen und eine anhaltende Herabgestimmtheit. Die emotionale Schwingungsfähigkeit ist aber nicht beeinträchtigt und der Patient zeigt normalen Affekt, wenn er abgelenkt wird. D. Es trat keine manifeste psychische Störung im Jahr vor dem kritischen Lebensereignis auf. Der gegenwärtige Zustand ist kein Rezidiv einer bereits vor dem Ereignis bestehenden psychischen Erkrankung. E. Die soziale Funktionsfähigkeit des Patienten ist beeinträchtigt. F. Die Störung besteht seit mindestens 6 Monaten Ergebnisse: Das standardisierte Interview mit 2 x 50 parallelisierten Patienten erlaubte eine gute Differenzierung der beiden Gruppen. Es fand sich eine Sensitivität von 94% und eine Spezifität von 92%. Diskussion: Das vorliegende standardisierte diagnostische Interview operationalisiert die Kriterien für die Diagnose einer PTED (Tabelle 1). Es erlaubt eine Abgrenzung der PTED gegenüber anderen Störungen. Literatur: 1) Linden M: The Posttraumatic Embitterment Disorder. Psychother and Psychosom 2003;72:195 – 202.; 2) Linden M, Schippan B, Baumann K, Spielberg R: Die posttraumatische Verbitterungsstörung (PTED): Abgrenzung einer spezifischen Form der Anpassungsstörungen. Nervenarzt 2004;75:51-57.; 3) Linden M, Rotter M. Baumann K, Lieberei B: Posttraumaatic Embitterment Disorder. Hogrefe, Bern 2007 Bulimia Nervosa im Jugendalter im klinischen Setting- exotische Erkrankung oder klinischer Alltag Imgart H., Bittner C. Parkland-Klinik, Bad Wildungen In Medien und Literatur ist die Spitze der Zahlen der Erkrankungsfälle bei Bulimie in einem deutlich späteren Altersbereich angegeben als bei der Anorexie, was den Schluss nahe legt, dass die Bulimie eher eine Erkrankung des frühen Erwachsenenalters sei und die Anorexie ihren Verteilungsgipfel bereits in der Jugend aufzeigt. Dennoch zeigt unsere tägliche Arbeit im stationären Bereich eine Umverteilung, im Sinne von einer hohen Anzahl bulimischer Patientinnen bereits im Jugendalter. Es wurde eine Stichprobe von 286 jugendlichen Patientinnen im Alter von 14 – 17 Jahren mit einer Essstörung untersucht, die stationär in die Parkland-Klinik kamen. Das multimodale Behandlungsprogramm erfolgte in einer geschlossenen Jugendgruppe über den Zeitraum von 8 Wochen. Die Diagnosen wurden von den Therapeuten gemäß ICD-10 eingeschätzt. Des weiteren bekamen die Patientinnen bei Aufnahme den SCL-90-R und schätzten außerdem die Dauer ihrer Beschwerden subjektiv ein. 27 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik II. Wir vermuteten keinen statistischen Unterschied in der Patientenanzahl mit Anorexie und Bulimie in unserer Stichprobe zu finden. Außerdem sollte es keinen Unterschied im Alter der Patientinnen bei Beginn der jeweiligen Essstörung geben. Wir nahmen jedoch an, dass die bulimischen Patientinnen erst aufgrund einer depressiven Krise in Behandlung kommen. Die einzelnen Hypothesen wurden zum einen über die Gesamtdiagnose Anorexie vs. Bulimie überprüft und zum anderen nach Ausschluss der Mischdiagnose Anorexia nervosa, bulimischer Typus über die Diagnosegruppen Anorexie, restriktiver Typus und Bulimie. In unserer Stichprobe gab es entsprechend der ersten Hypothese keinen statistisch signifikanten Unterschied der Patientenzahlen mit Anorexie (45.1 %; Anorexia Nervosa restrictiver Typus: 31.5%) und Bulimie (38.5%). Patientinnen mit Bulimie waren signifikant älter bei Behandlungsbeginn als Patientinnen mit Anorexie, aber die Erkrankungsdauer war signifikant länger. Somit ergab sich kein signifikanter Unterschied im Erkrankungsbeginn zwischen beiden Gruppen. Hinsichtlich der Annahme einer depressiven Krise als Behandlungsgrund sahen wir bei Patientinnen mit Bulimie eine signifikant höhere Depressivität und suizidale Tendenz als bei Patientinnen mit Anorexie. Lässt man die Mischdiagnose der Anorexie, bulimischen Typus außen vor, so erhielten wir ähnliche Ergebnisse, jedoch erschienen die Unterschiede zwischen den Gruppen etwas deutlicher. Wir schlussfolgerten, dass Patientinnen mit Bulimie zwar mit höherem Alter als anorektische Patientinnen in stationäre Behandlung kommen, dass dies jedoch nicht auf einen späteren Erkrankungsbeginn zurückzuführen ist. Wir vermuten die Hintergründe in der besseren Möglichkeit, die Bulimie geheim zu halten, so dass diese Patientinnen erst mit schweren depressiven Dekompensationen auffällig werden und in stationäre Behandlungen kommen. Nach unseren Daten eines stationären Settings ist der spätere Beginn der Bulimia Nervosa als die der Anorexia Nervosa nicht zu halten, daher sollte die Prävalenz der Bulimie im Jugendalter überdacht werden. Der lange Krankheitsverlauf bulimischer Jugendlicher und die ungenügende ambulante Vorbehandlung deuten auf Verbesserungsbedarf hinsichtlich Diagnostik und Therapie der Bulimie im Jugendalter. Sind Essstörungen bei türkischstämmigen Patientinnen anders? Kulturbezogene Aspekte in der Diagnostik und Behandlung Imgart H., Bittner C. Parkland-Klinik, Bad Wildungen 90 % der deutschen Wohnbevölkerung haben nach der Definition des statistischen Bundesamtes einen Migrationshintergrund. Die größten Gruppen sind die Russlanddeutschen und die Türken. Uns hat interessiert, wie sich diese Verteilung in der Bevölkerung auf die Behandlungsgruppe der essgestörten Patientinnen abbildet und ob sich daraus Implikationen für die Therapie dieser Patientengruppe ergeben. Näher beleuchtet haben wir das an dem Beispiel der türkischen Patientinnen. Wir möchten zeigen, dass türkische Patientinnen als eigene Gruppe identifizierbar sind. Wir möchten zeigen, dass in dieser Patientengruppe besondere psychosoziale Hintergründe existieren, die in der Behandlung berücksichtigt werden müssen und wir möchten zeigen, dass die Einbeziehung türkischer Angehöriger eine Herausforderung darstellt, aber einen vielfachen Nutzen für die Therapie bringt. In den letzten fünf Jahren wurden 1.100 essgestörte Patientinnen behandelt. 2 % gehörten der 1. Generation der Migranten an, 41 % gehörten der 2. Generation an, 18 % gehörten der 3. Generation an und 39 % konnten nicht sicher nicht sicher der 2. oder 3. Generation zugeordnet werden. Bei den essgestörten Patientinnen sind türkische Migrantinnen mit 9 % hier überrepräsentiert, der türkische Anteil verglichen mit Erwachsenen ist bei Jugendlichen fast 50 % geringer. Wir vermuten, dass türkische Jugendliche es schwerer haben als türkische Erwachsene in die stationäre Behandlung zu kommen. Der überwiegende Anteil der türkischen Migrantinnen, die bei uns wegen Essstörungen behandelt werden, spreche fließend Deutsch und Türkisch, in den Familien wird meist türkisch gesprochen. Fast alle türkischen Patienten bekennen sich zur islamischen Religion, religiöse Minderheiten (z.B. Aleviten) sind überrepräsentiert. Familiäre Traditionen spielen eine wichtige Rolle. Die Patientinnen bewegen sich in Netzwerken, Familie und türkische Gemeinde haben einen großen Einfluss. Ein hoher Prozentsatz (oder deren Eltern) ist arbeitslos oder bekommt Sozialhilfe. Mädchen und Frauen haben sehr häufig (40 – 50 %) 28 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik II. Gewalterfahrungen. Türkische Migrantinnen und Migranten besonders der 2. Generation stehen zwischen türkischer und deutscher Kultur, zwischen Tradition und Moderne. Diese Konflikte und die geschilderte sozial schwierige Lebenssituation werden sich auch in der Entwicklung einer Essstörung sowie in der Behandlung niederschlagen. In der türkischen Kultur gibt es keine Tradition der Psychotherapie. Ärzte haben einen hohen Status, häufig ist jedoch auch der Gang zum Wunderheiler. Viele Patientinnen mit Essstörungen kommen daher nicht in Behandlung – und wenn sie in Behandlung kommen droht ein Therapieabbruch. Wichtigstes Therapieziel ist es daher, die Familie der Patientinnen in der Form einzubeziehen, dass eine Erlaubnis für eine psychotherapeutische Behandlung gegeben wird. Wir haben daher eine besondere Form der Einbeziehung der türkischen Familien entwickelt und stellen einzelne Punkte näher dar. Komorbidität bei Pathologischem Glücksspiel Premper V.1 , Schulz W.2 1 Klinik Schweriner See, 2Institut f. Psychologie, Technische Universität Braunschweig Hintergrund: Komorbide Störungen stellen stets einen komplizierenden Faktor bezüglich des Krankheitsverlaufes einer psychischen Störung und bei den therapeutischen Bemühungen dar. Zur Verbesserung der Indikationsstellung und der Behandlungsplanung wurden daher die Art und der Umfang psychischer Komorbidität bei pathologischem Glücksspiel untersucht. Weiter wurde festgestellt, ob die komorbiden Störungen dem pathologischen Glücksspielen zeitlich vorausgingen und somit als potenziell prädisponierender Faktor in Frage kommen, oder ob sie eher als Folge des Glücksspielens anzusehen sind. Ferner wurde geprüft, ob sich auf Basis von Komorbiditätsmustern verschiedene Typen von Glücksspielern unterscheiden lassen. Methode: Untersucht wurden 101 Patienten einer Fachklinik für Psychosomatik und Abhängigkeitserkrankungen mit der Zuweisungsdiagnose Pathologisches Spielen. Die Diagnose wurde überprüft anhand eines DSM IV basierten Erhebungsinstrumentes. Weiter wurden Kennzeichen des bisherigen Störungsverlaufes, das Vorliegen komorbider Achse I- und Achse II-Störungen die psychische Belastetheit, sowie soziodemographische Merkmale erhoben. Die Messungen fanden statt bei Beginn der stationären Behandlung. Ergebnisse: Bei 84,2% der Patienten lagen in der Zwölfmonatsprävalenz eine oder mehr komorbide Störungen vor, bezogen auf die Lebenszeitprävalenz bei 91,1%. Die höchsten Komorbiditätsraten zeigten sich für affektive Störungen (51,5%/61,4%) Angststörungen (47,5%/ 57,4%) und substanzbezogene Störungen (25,7%/60,4%). Angststörungen gehen zum weit überwiegenden Teil (zu 76,9%) dem Auftreten des Glücksspielens voraus, affektive Störungen hingegen treten zum überwiegenden Teil (zu 60,6%) nach Beginn des Glücksspielens auf. Die sichere Diagnose einer Persönlichkeitsstörung lag bei 27,7% der Untersuchten vor. Der Schwerpunkt lag auf den Persönlichkeitsstörungen aus dem Cluster C (ängstlich, furchtsam). Die relative Erkrankungswahrscheinlichkeit für eine komorbide psychische Störung ist bei pathologischen Glücksspielern sowohl gegenüber Patienten mit Alkoholabhängigkeit, als auch gegenüber einer Allgemeinbevölkerungsstichprobe deutlich erhöht. Aufgrund der komorbiden Psychopathologie lassen sich Subtypen von pathologischen Glücksspielern unterscheiden: Sie können bezeichnet werden als „Defensiv-leidende Glücksspieler“, „Reine Glücksspieler“, und „Expansiv-leidende Glücksspieler“. Diskussion: Das erhebliche Ausmaß der gefundenen psychischen Komorbidität bei pathologischem Glücksspiel zeigt, dass mit schwierigen Therapieverläufen zu rechnen ist und dass je nach Art der vorliegenden Komorbidität in der Behandlung ein differenziertes Vorgehen notwendig ist. Die gefundenen Subtypen pathologischer Glücksspieler unterscheiden sich in Art und Ausmaß ihrer komorbiden psychischen Störungen deutlich. Daraus sind therapeutische Konsequenzen abzuleiten. Je nach vorliegendem Komorbiditätsmuster muss der Schwerpunkt der Behandlung, neben dem Durchbrechen der Eigendynamik des glücksspielspezifischen Suchtgeschehens, auf den Aufbau sozialer Kompetenzen und Problemlösefähigkeiten sowie das Erlernen eines Umganges mit negativen affektiven Zuständen gelegt werden. Ausdrückliche Beachtung bei der Therapieplanung erfordert das Vorliegen von Angststörungen als potenziell prädisponierende und Spielrückfall auslösende Bedingung. Literatur: Premper, V. (2006). Komorbide psychische Störungen bei pathologischen GlücksspielernKrankheitsverlauf und Behandlungsergebnisse. Lengerich: Pabst 29 Samstag, 23.6.2007 Neurologie Chronifizierung und Multimorbidität psychosomatischer Rehabilitation als Prädiktoren des Behandlungsergebnisses von Smuga M., Dietsche S., Löschmann C. eqs.-Institut Hamburg Hintergrund: Psychische Störungen zeigen eine hohe und in den letzten Jahren zunehmende Bedeutung für das Erkrankungsgeschehen, besonders bei Erwachsenen (Zielke, 2004). Von etwa 400.000 von der DRV-Bund finanzierten Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation entfallen 14% auf die Psychosomatik (Grobe, 2004). Vor dem Hintergrund der zunehmenden Prävalenz von chronischen Krankheiten wird untersucht, inwieweit die Chronifizierung und die Multimorbidität den Therapieerfolg einer stationären psychosomatischen Rehabilitation beeinflussen bzw. beeinträchtigen können, und ob sich ein Zusammenhang zwischen Art der Diagnose und Behandlungsergebnis zeigt. Methodik: Als Grundlage der Untersuchung dienen Daten der Behandlungsdokumentation aus vier psychosomatischen Kliniken in Süddeutschland. Untersucht wurden 13589 Patienten mit den Primärdiagnosen nach ICD-10: F2, F3, F4, F6, welche 91,7% der Rehabilitandenpopulation ausmachten. Das Behandlungsergebnis wurde auf einer Veränderungsskala durch die Therapeuten beurteilt. Erfasst wurden körperliches und seelisches Befinden, Leistungsfähigkeit und Beschwerdengrad. Ergebnisse: Vor Beginn der Rehabilitation war die Krankheitsdauer von 38,2% der Rehabilitanden länger als fünf Jahre, 79,9% wurden mit mehr als einer Diagnose nach ICD-10 in die stationäre Rehabilitation eingewiesen. Die Krankheitsdauer und der Grad der Mulitimorbidität haben einen signifikanten Einfluss auf den Therapieerfolg. Je länger die Patienten erkrankt sind, desto geringer ist der Therapieerfolg. Ebenso verringert sich der Therapieerfolg signifikant mit jeder weiteren psychiatrischen oder somatischen Diagnose. Die Art der psychiatrischen Primärdiagnose korreliert nicht mit dem Behandlungsergebnis. Diskussion: Die Chronifizierung der Erkrankung und die Multimorbidität, jedoch nicht die Art der Diagnose einer psychischen Störung, sind essentielle Prädiktoren des Therapieerfolgs einer stationären psychosomatischen Rehabilitation. Diese Befunde treffen insbesondere für die zahlenmäßig größten Diagnosegruppen F3 und F4 zu. Dies sollte künftig bei der Versorgung der Rehabilitanden stärker berücksichtigt werden. Eine mögliche Lösung könnte eine bessere Vernetzung der stationären Rehabilitation mit krankheitsbezogenen Vorbehandlungen und mit der ambulanten psychosomatischen Nachsorge darstellen. Literatur: 1) Zielke et al. (2004) Evaluation stationärer verhaltensmedizinischen Behandlung und Rehabilitation auf der Basis objektiv erfassbaren Krankheitsdaten bei psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 67, 169-192; 2) Grobe, Dörning & Schwartz (2004) Versichertenbezogene Leistungen und Ausgaben von Krankenkassen – die Bedeutung psychischer Störungen. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 67, 193-199 Neurologie Nachweis kortikaler Reorganisation nach Phantomschmerzen - Eine fMRT Studie Armamputationen und deren Beziehung zu Adler T.1, Brückner L.1, Weiss T.2, Dettmers C.3 1 Orthop. Abt. Moritz-Klinik Bad Klosterl., 2Institut für biol. Psychologie der FSU Jena, 3ehem. FSU Jena, Klinik für Neurologie Hintergrund: Dank erweiterter diagnostischer Möglichkeiten gelangen in den letzten Jahren neue Erkenntnisse bezüglich physiologischer und pathologischer Prozesse des menschlichen Gehirns. Dabei stellte sich eine erhebliche Anpassungsfähigkeit des ZNS in Bezug auf die Ausnutzung neuer Hirnareale nach lokalen Defekten aber auch im Sinne der Reaktion auf veränderte afferente Signale dar (neuronale Plastizität). Solche reorganisatorischen Prozesse stellen für die Rehabilitation neue Chancen dar, können aber auch eher - wie am Beispiel der Reorganisation nach Amputationen bezüglich der Ausprägung von Phantomschmerzen nachgewiesen - hinderlich sein. Die Klärung der Pathomechanismen in Hinblick auf neue Therapieoptionen führt langsam zum Umdenken in Prophylaxe und Therapie der oft massiv einschränkenden Phantomschmerzen. Hoffnungsvolle Ansätze wurden mit der Spiegeltherapie und dem Entwicklungsversuch von Prothesen mit sensibler Rückkopplung gemacht. 30 Samstag, 23.6.2007 Neurologie Methode: Mittels fMRT-Untersuchungen wurden an 16 Armamputierten unter Verwendung verschiedener Bewegungsparadigmen Bildserien zum Nachweis kortikaler Reorganisation durchgeführt. Acht Amputierte davon klagten über Phantomschmerzen, die anderen acht gaben keine Phantomschmerzen an. Das paritätische Auftreten der Phantomschmerzen war zufällig. Es wurde keine Auswahl der zu Untersuchenden in dieser Hinsicht getroffen. Als Kontrollgruppe dienten sechs gesunde Probanden. Ergebnisse: In den Einzelbildern der Amputierten wurden sowohl kontralaterale als auch ipsilaterale Aktivierungsareale gesehen. Teilweise überschritten diese Aktivierungszonen deutlich neurophysiologisch zu erwartenden Grenzen, so dass eine „flächige Aktivierung“ sichtbar wurde. Die Gruppenanalysebilder erbrachten neben dem Nachweis einer Shift sowohl des Gesichts- als auch des Schulterareals in das ehemalige Handareal eine verstärkte Aktivierung/Entkopplung der SMA/Gyrus cinguli bei den Phantomschmerzpatienten. Diskussion: Es konnte an Armamputierten eine Shift angrenzender sensomotorischer kortikaler Repräsentationsareale in das ehemalige Handareal nachgewiesen werden. Bei den Patienten mit Phantomschmerz stellte sich zusätzlich eine deutliche Mehraktivität im SMA/Gyrus-cinguli-Bereich dar, die so bei Normalprobanden und Amputierten ohne Phantomschmerzen nicht beobachtet wurde. Diese Aktivität beim Auftreten von Phantomschmerzen wird über Interaktion thalamokortikaler Schleifen erklärt und gibt erste Hinweise auf den Wirkansatz der empirisch entwickelten Spiegeltherapie mit passagerer Besserung von Phantomschmerzen und die Schmerzarmut bei Nutzern von „aktiven“ Prothesen nach Sauerbruch-Operationen. Literatur: 1) Brückner,L.; Adler,T.; Weiss,T.: Der Wert des aktiven Sauerbruch-Armes und seine positive Auswirkung auf den Phantomschmerz. Med. Orthop. Technik, Heft 1, (2001); 2) Fink,G.R.; Marshall,J.C.; Halligan,P.W.: The neuronal consequences of conflict between intention and the senses. Brain, 122 (1999), p 497-512; 3) Flor,H., Elbert,T., Knecht,S., Wienbruch,C., Pantev,C., Birbaumer,N., Larbig,W., Taub,E.: Phantom-limb pain as a perceptual correlate of cortical reorganization following arm amputation. Nature, Vol. 375 (1995), p 482-484; Diagnostik und Verlauf der MS assoziierten Fatigue. Bamborschke S. Brandenburg Klinik Bernau bei Berlin Hintergrund: Fatigue bei MS ist verbunden mit einer abnorm gesteigerten Ermüdbarkeit bei andauernder körperlicher Belastung (Motor-Fatigue) und/oder bei andauernder konzentrierter geistiger Tätigkeit (mentale Fatigue). MS-Fatigue wird heute als organisch bedingtes Symptom der ZNS-Entzündung gewertet. Besonders typisch für MS-Fatigue ist die Verstärkung durch Hitze. MS-Fatigue wird bei ca. 80% aller MS-Patienten beobachtet, kann passager oder chronisch verlaufen, kann Erstsymptom sein, oder auch einem Schub vorauseilen. Häufig wird die MS-Fatigue von den Patienten als subjektiv belastendstes Symptom erlebt (Krupp 2001). Eine objektive Messung der Fatigue ist bisher nicht möglich, es gibt jedoch validierte Selbstbeurteilungsskalen, wie z.B. die Fatigue Severity Scale (FSS) nach Krupp (Krupp1989) die sich in der Praxis bewährt haben. Ziel der Studie: Bestimmung des Anteils an MS-Patienten mit Fatigue in der Phase D der neurologischen Rehabilitation und Messung der Veränderung der Symptomatik durch den Rehaprozess. Suche nach Prädiktoren, die mit einer Verbesserung der MS-Fatigue während der Rehabilitation korrelieren. Patienten und Methoden: 138 Patienten (35m, 103w, Alter 22-61 Jahre, (MW 44.1 Jahre) wurden untersucht. Der Krankheitsverlauf war primär chronisch progredient in 4%, schubförmig remittierend in 69%, sekundär chronisch progredient in 24% der Fälle. Der EDSS lag zwischen 1.0 und 7.0 (MW 4.1). Alle Patienten befanden sich in einer stabilen Krankheitsphase. 27% der Patienten erhielten Interferon ß 1b, 17% erhielten Interferon ß 1a subcutan, 11% Interferon ß 1a intramusculär, 16% Glatirameracetat, 4% Azathioprin und 2% Mitoxantron. Bei 101 der 138 Patienten wurde der FSS, bei 128 der 138 Patienten der Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC) nach Cutter (Cutter et al.1999) jeweils zu Beginn und am Ende der Reha bestimmt. Eine Fatigue wurde bei FSS-Werten von größer als 24 (mögliche Werte 6- 63) diagnostiziert (Filippi et al. 2002). Zusätzlich wurde bei allen Patienten der Beck´sche Depressionsfragebogen (Beck et al. 1961) und der SF36 Fragebogen für die Messung der Lebensqualität (Item "allgemeiner Gesundheitszustand") zu Beginn der Reha erhoben. Alle Patienten erhielten ein individuell angepasstes multimodales Therapieprogramm aus Physiotherapie, Ergotherapie, aerobem 31 Samstag, 23.6.2007 Neurologie Ausdauertraining, und soweit erforderlich ein neuropsychologisches Training während 4 Wochen stationärer neurologischer Rehabilitation. Die Mittelwerte (MW) und der Standardfehler des Mittelwertes (SEM) wurden für den FSS zu Beginn und am Ende der Reha berechnet und die Signifikanz der Veränderung wurde mit Hilfe des Wilcoxon Tests für gepaarte Stichproben bestimmt. Es wurde geprüft, inwieweit Geschlecht, Alter, Lebensqualität (SF36), EDSS, das initiale funktionelle Defizit (MSFC) oder die Depressivität (Beck´s Fragebogen) das Ausmaß bzw. die Besserung der Fatigue während des Rehaaufenthaltes beeinflussen (Pearson´s Test). Ergebnisse: 84% der Rehabilitanden hatten eine MS-Fatigue nach den o.g. Kriterien. Der FSS-Wert (MW +/- SEM) betrug 45.0 +/- 1.5 (Beginn) und 42.2 +/- 1.6 (Ende der Reha). Die Verbesserung der Fatigue war signifikant (P = 0.002). Es wurde keine Korrelation zwischen dem Ausmaß der Fatigue bzw. der Verbesserung und den o.g. Parametern gefunden. Insbes. war kein Zusammenhang mit den Werten des Beck´schen Depressionsfragebogen oder dem Behinderungsgrad zu erkennen. Diskussion: Die MS-Fatigue besserte sich signifikant während des 4-wöchigen Rehabilitationsaufenthaltes. Die Besserung bzw. das Ausmaß der Fatigue konnte nicht durch die Ausgangswerte für EDSS, MSFC, SF36 oder Depressivität vorhergesagt werden und war auch unabhängig vom Alter oder Geschlecht der Probanden. Literatur: 1) Bamborschke S, Weigt D (2004) Clinical impact of fatigue during neurological inpatient rehabilitation in MS, Multiple Sclerosis, 10 (Suppl.2) S144; 2) Bamborschke S., D. Weigt, P. Scherer (2006) Efficacy of neurological inpatient rehabilitation measured by Fatigue Severity Scale and Multiple Sclerosis Functional composite in multiple sclerosis patients, Multiple Sclerosis, 12 (Suppl.1): S117-118; 3) Beck A T, Ward C H, Mendelson M, Mock J E, Erbaugh J K (1961) An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4: 561-571 ; 4) Cutter G C,Baier M L, Rudick R A et al.: (1999) Development of a Multiple Sclerosis Functional Composite as a clinical trial outcome measure, Brain, 122:871-882; 5) Filippi M, Rocca M A, Colombo B, et al.: (2002) Functional Magnetic Resonance Imaging Correlates of Fatigue in Multiple Sclerosis. Neuroimage, 15: 559-567; 6) Krupp L B, La Rocca N G, Muir-Nash J and Steinberg A D (1989) The Fatigue severity scale. Application to patients with multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. Arch. Neurol. 46: 1121-1123; 7) Krupp L B (2001) Assessment and treatment of fatigue in multiple sclerosis. In: Kappos L, Johnson K, Kesselring J, Radü E W (eds.) Multiple Sclerosis. Tissue destruction and repair, Martin Dunitz, London, pp 177-183 Gerätegestützte motorische Rehabilitation nach Schlaganfall Werner C., Hesse S. Klinik Berlin, Neurologische Rehabilitation, Charité, Campus Benjamin Franklin Die Wiederherstellung motorischer Funktionen ist ein wesentliches Ziel der Rehabilitation nach Schlaganfall. Die Intensität der Therapie und das Outcome scheinen zu korrelieren. Der Wunsch nach möglichst viel Therapie findet seine Grenzen in der körperlichen Belastung der Therapeuten, um z.B. das paretische Bein zu setzen. Intelligente Geräte können die Therapie ohne Überforderung der Therapeuten intensivieren. Exoskeleton- (EX), Endeffektor- (EF) und rein mechanische Geräte werden unterschieden. Die obere Extremität Pionier war der MIT-Manus (EF), ein Roboterarm ermöglicht eine Schulter-Ellenbogenbewegung in der Horizontalen, die Bewegung erfolgt mittels Impedanzregelung (Prinzip der Feder) passiv, unterstützend oder gegen einen Widerstand. Kontrollierte Studien (KS) zeigten eine Verbesserung der proximalen Kraft. Der Bi-Manu-Track (EF) folgt einem bilateralen distalen Ansatz, der Patient kann eine Pro-Supination des Unteram sowie eine Flexion Extension der Hand und der Finger beidseitig üben. Eine KS zeigte eine deutlich überlegenen Effekt hinsichtlich der Kraft und der motorischen Kontrolle der gesamten oberen Extremität. Beispiele für EX-Geräte sind der ARMIN, Schweiz, und der ARMOR, Österreich, KS stehen noch aus. Rein mechanische Geräte sind das sog. Nudelholz (eine Stange mit zwei Griffen für eine dreidimensionale Bewegung) und das Batrac (zwei nicht verbundene Griffe, die vor und zurück gefahren werden können). Die untere Extremität Der Lokomat besteht aus einem EX mit programmierbaren Motoren, die die Hüft- und Knieflexion für die Schwungbeinphase leisten. Das Sprunggelenk wird passiv geführt. Ein Laufband dient der Simulation der Standbeinphase. Ein erste KS (n=30) zeigte keinen Unterschied zur konventionellen Gangrehabilitation. In dem Gangtrainer GT I (EF) steht der gurtgesicherte Patient auf zwei Fußplatten, deren Bewegungen die 32 Samstag, 23.6.2007 Neurologie Stand- u. Schwungbeinphase simulieren, zusätzlich werden die für das Gehen relevanten Bewegungen des Körperschwerpunkts gesteuert. Zwei KS (n = 155 u. n = 50) belegten eine Überlegenheit der Lokomotionstherapie auf dem GT I hinsichtlich der Gehfähigkeit und ADL-Kompetenz. Zusammenfassung Die gerätegestützte motorische Rehabilitation nach Schlaganfall ist vielversprechend, sie intensiviert die Therapie, und erste KS stützten ihre Effektivität. Nachweis der Erschöpfung der kompensatorischen Aktivierung bei Patienten mit Multipler Sklerose und Fatigue mittels funktioneller Kernspintomographie Lange R., Hassa T., Weiller C., Dettmers C. 1 Neurologische Universitätsklinik Freiburg, 2 Kliniken Schmieder Gailingen, Konstanz; Korrespondenz: [email protected] 3 Kliniken Schmieder Hintergrund: Motorische oder kognitive Fatigue, - eine abnorme, vorzeitige Ermüdbarkeit, im amerikanischen auch als „use dependent conduction block“ bezeichnet - tritt bei 70 – 90% der Patienten mit Multipler Sklerose (MS) auf. Bei einzelnen Patienten ist die Fatigue der wesentliche Grund für eine Erwerbsminderung. Fatigue ist bislang nicht objektiv messbar. Hohe Prävalenz, mangelnde Objektivierbarkeit und Einfluss auf die Erwerbsfähigkeit weisen auf die sozialmedizinische Relevanz hin. Ziel der vorliegenden Studie ist es, die organische Basis für Fatigue zu untersuchen oder möglicherweise einen objektiven Marker für Fatigue zu identifizieren. Methode: Patienten und Probanden: 30 Patienten (Alter 45 + 9 Jahre) mit gesicherter Multiplen Sklerose und 15 altersentsprechende gesunde Probanden wurden mittels funktioneller Kernspintomographie (fMRT) auf Basis des n-back Paradigmas untersucht (Matthews et al. 2006; Owen et al. 2005). Patienten wurden bevorzugt rekrutiert, wenn sie Beschwerden im Sinne einer motorischen Fatigue angaben. Stärkergradige motorische und kognitive Defizite, sowie Depression wurden ausgeschlossen. Durchschnittliche Beeinträchtigung auf der Extended Disability Status Scale (EDSS) betrug 3,3 + 1,7. Erkrankungsdauer war 14,4 + 9,4 Jahre. Fatigue wurde mittels zweier Fatigue Skalen erfasst: der etablierten Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) und einer derzeitig in Evaluation befindlichen Fatigue Skala für Motorik und Cognition (FSMC). Depressionswerte betrugen 9,5 + 5,8 auf der Skala nach Beck (Maximalwert 60). Kognitive Testungen wurden bei 17 Patienten durchgeführt und umfassten den d2 Aufmerksamkeitstest, den Revisionstest, und das Leistungsprüfsystem 1 bis 3. Der d2 Test zeigte geringgradige Auffälligkeiten. Die übrigen kognitiven Tests zeigten keine deutlichen Defizite. Die Läsionslast wurde mittels T2 gewichtetem MRT bestimmt. Paradigma: Probanden wurden im Scanner in langsamer Reihenfolge einzelne Buchstaben gezeigt. Für n=1 mussten die Probanden angeben, wenn ein Buchstabe identisch zu dem vorhergehenden war. Für n=2 mussten sie eine Maustaste drücken, wenn der präsentierte Buchstabe identisch war zu dem vorvorhergehenden. Dieser Test beansprucht vor allem das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeit und fällt vielen Patienten mit MS bekannter massen schwer. FMRT: Messungen mittels eines 1,5 T Philips Gyroscan und EPI-Technik im Block-Design. Auswertung mittels SPM5. Ergebnisse: Die Patienten führten den n-back Test im Scanner genauso gut aus wie die Probanden. Ihre Anstrengung war zu Beginn der Testung und am Ende signifikant höher. Probanden und Patienten zeigten ein symmetrisches kräftiges Muster mit Aktivierungen beiderseits frontal, prämotorisch, im Bereich der supplementärmotorischen Area (SMA) und im parietalen Kortex. Für n=2 stieg die Aktivierung in beiden Gruppen weiter an. Bei dem Vergleich zwischen Patienten und Probanden zeigten erstere eine diffuse Mehraktivierung im Bereich des gesamten Kortex. Eine fokale Korrelation zwischen den Aktivierungen und den verschiedenen klinischen Parametern fand sich nicht. Wenn man die diffuse, globale Aktivierung berechnete, erwies sich als einzige Korrelation – und zwar negativer Art – die zwischen Aktivierung und MFIS bzw. kognitiven Teils des FSMC. Diskussion: Im Vergleich zu Probanden zeigen MS Patienten eine diffuse Mehraktivierung im Sinne der Kompensation. Je stärker die Fatigue von den Patienten eingeschätzt wurde, desto geringer war die kompensatorische Mehraktivierung ausgeprägt. Fatigue stellt vermutlich einen kompensatorischen Entwicklungsprozess dar. Zu Beginn kommt es zu einer diffusen, kompensatorischen Mehraktivierung. Diese umfasst das gesamt kognitive Netzwerk. Mit Zunahme der Fatigue kommt es dann zu einer Abnahme der Mehraktivierung – vermutlich als Zeichen einer Erschöpfung dieses Kompensationsmechanismus. 33 Samstag, 23.6.2007 Neurologie Diagnostik und Therapie von Harninkontinenz bei Schlaganfall-Patienten in einer neurologischen Rehabilitationsklinik Vance W., Wissel J. Neurologische Rehabilitationsklinik Beelitz-Heilstätten Hintergrund: In den ersten Wochen nach dem Akutereignis sind ca. 60 Prozent der Patienten harninkontinent, nach sechs Monaten sind es nur noch 20 Prozent. Entsprechend englischer Studienergebnisse klagen nach einem Monat nur noch 29 Prozent, nach 6 Monaten nur noch 15 Prozent der Betroffenen Symptome einer Harninkontinenz. Die urologische Diagnostik führt in diesen Fällen häufig zur Diagnose einer temporär zerebral enthemmten Harnblase in Kombination mit einer funktionellen Harninkontinenz. Die Deutsche Kontinenz-Gesellschaft geht davon aus, dass Harninkontinenz einer der häufig-sten Gründe für die Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung ist, die GKV-Aufwendungen für die Inkontinenzversorgung und die Behandlung von urologischen Komplikationen durch Harnableitung-en betragen mehrere Milliarden Euro pro Jahr. Methode: In der neurologischen Rehabilitationsklinik Beelitz-Heilstätten wurde durch die Funktionsabteilung Urologie institutionell, organisatorisch und konzeptionell eine wissenschaftlich fundierte und begleitete Methode zum Screening, zur Diagnostik und Behandlung von Harn-inkontinenz bei Schlaganfall-Patienten erstellt und umgesetzt. In einer prospektiven Untersuchung des Jahres 2006 wurden die Behandlungsergebnisse der Zusammenarbeit von Physiotherapie, Neurologie, Innere Medizin, Urologie, Pflegeabteilung und einer Inkontinenzschwester und in einer Pilotstudie ermittelt. Ergebnisse: Insgesamt 128 der im ersten Halbjahr 2006 stationär neurologisch rehabilitierten Patienten mit der Diagnose Schlaganfall erfüllten die Einschlusskriterien der Untersuchung. Ohne oder nach kurzer Behandlungszeit waren 70 Patienten harnkontinent, 26 Patienten waren keiner Kontinenztherapie zugänglich und benötigten frühzeitig und dauerhaft eine Inkontinenzversorgung. Bei 32 inkontinenten Patienten wurde eine kontinuierliche Inkontinenzbehandlung durchgeführt, 29 Patienten konnten harnkontinent entlassen werden. Die ambulante Nachbefragung ist noch nicht abgeschlossen. Diskussion: Die Ergebnisse zeigen dass durch frühzeitige interdisziplinäre und konzeptionelle Therapie Harninkontinenz nach einem Schlaganfall behandelt werden kann und Harnableitungen mit den negativen Auswirkungen auf die neurologische Rehabilitation vermieden werden können. Literaturauswahl: 1) Burney TL, Senapati M, Desai S, Choudhary ST, Badlani GH. Effects of cerebrovascular accident on micturition. Urol Clin North Am. 1996;23:483; 2) Sakabibara R, Hattori T, Yasuda K, Yamanishi T. Micturitional disturbance after acute hemispheric stroke: analysis of the lesion site by CT and MRI. J Neurol Sci. 1996;137:47–56; 3) Kok ALM, Voorhorst FJ, Burger CW, Houten PV, Kenemans J, Janssens J. Urinary and faecal incontinence in community-residing elderly women. Age Ageing. 1992;21:211–21 Telemedizinische Rehabilitation von zerebral bedingten Sehstörungen Schmielau F. Institut für Medizinische Psychologie und spez. Neurorehabilitation, Universität zu Lübeck, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck Hintergrund: Die Effizienz der Behandlung von Gesichtsfelddefekten bei Patienten mit homonymen Hemianopsien ist in der Literatur der letzten zwei Jahrzehnte sehr umstritten. Insbesondere die Therapie mittels PC wird in letzter Zeit als wenig wirksam angesehen (Horton 2005). Die Inzidenz von Sehstörungen steht nach den Schädigungen des motorischen und Sprachsystems an dritter Stelle der häufigsten Folgen von Schädigungen des ZNS durch Schlaganfälle, Hirnblutungen, Tumoren und Schädelhirntraumen, sodass eine wirksame Behandlung wünschenswert ist. Methode: Aufbauend auf einer klinischen Studie zur Therapie von hemianopischen Gesichtsfelddefekten mit dem Lübecker Reaktionsperimeter LRP, in der die hohe Effizienz zur Restitution von Teilen des Gesichtsfeldes nachgewiesen werden konnte, wurde eine telemedizinische Therapie für Personal Computer entwickelt, die von den Patienten zuhause durchgeführt werden kann (Schmielau et al 2001). Voraussetzungen dafür sind: ein PC mit einem Betriebssystem ab WINDOWS 98, ein Röhrenmonitor (ab 17’’) und Internetzugang. Auf der Basis des erfolgreichen Therapie-Algorithmus des LRP wurde die VisionTrainer Software zur telemedizinischen Rehabilitation entwickelt und an 40 Patienten (Alter: 16 – 34 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik III. 70 Jahre) mit homonymen Gesichtsfelddefekten eingesetzt. Die Software ermöglicht neben der Therapie auch die wechselseitige Kommunikation zwischen Patient und Therapeut. Ergebnisse: Bei 32 (80%) der Patienten kam es infolge der durchschnittlich einjährigen Behandlung zu einer deutlichen Erweiterung des Gesichtsfelds und Verbesserungen anderer elementarer Sehfunktionen. Die Therapieeffekte wurden unabhängig vom PC (mittels statischer und kinetisches Perimetrie) evaluiert und erwiesen sich auch nach Beendigung der Therapie als stabil. Bei den meisten Patienten erfolgte ein Transfer der Sehverbesserungen auf visuell gesteuerte Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL). Diskussion: Die Erfolge der telemedizinischen Therapie mit der VisionTrainer Software sind im wesentlichen durch drei Faktoren bedingt: 1. hohes Aufmerksamkeitsniveau durch auditorisch-visuelle Stimulation 2. selektive visuelle Aufmerksamkeit auf den Übergang zum anopen Gesichtsfeld 3. schnelle Anpassung des Schwierigkeitsgrades der Therapie über das Internet bei Leistungssteigerungen des Patienten. Die Verbesserung der Sehfunktionen basiert auf zerebralen Plastizitätsprozessen vorrangig des partiell geschädigten primären visuellen Cortex bei gleichzeitiger Aktivierung des fronto-parietalen Aufmerksamkeitssystems. Anhand von Untersuchungen mit bildgebenden neuroradiologischen Verfahren (fMRI) ist zu klären, in wieweit zusätzliche subcorticale Prozesse und eine Beteiligung des extra-strären visuellen Systems zur Restitution des Sehvermögens beitragen. Literatur: 1) Horton J C Br. J Opthalmol 2005; 89:1-2.; 2) Schmielau F, Wong E K, Holbe F: Neurovisual rehabilitation via the internet. In: Telemedicine: medicine and communication, Buzug T M, Handels H und Holz D (Eds) Kluver Academic/Plenum Publishers, New York (2001) 77-92.; Psychosomatik III. Elektrophysiologische Indizes selektiver Aufmerksamkeit bei dekompensierten und kompensierten Tinntituspatienten im Behandlungsverlauf Mussgay L., Werth K., Gerges, J., Rüddel, H. Psychosomatische Fachklinik St.-Franziska-Stift, Bad Kreuznach, Abteilung für Verhaltensmedizin und Rehabilitation des Forschungszentrums für Psychobiologie und Psychosomatik (FPP), Universität Trier Hintergrund: Die gängigen Theorien zur Entstehung des chronisch komplexen Tinnitus greifen eine Störung der Aufmerksamkeit auf (Hallam, 1996; Jastreboff und Hazel, 1993), dessen Funktionszustand mit ereigniskortikalen Potentialen erfasst werden kann. In Erweiterung der Studie von Jacobson et al. (1996) sollte hier eine Schweregraddifferenzierung der Tinnitus-Patienten vorgenommen werden, um die Frage zu beantworten, ob eine gestörte selektive Aufmerksamkeit grundsätzlich vorhanden ist oder nur bei der chronisch-komplexen Symptomatik vorliegt. Weiterhin sollte bei chronisch-komplex beeinträchtigten Patienten untersucht werden, wie sich die Klinikbehandlung auf die Befunde auswirkt. Methodik: Untersucht wurden 16 chronisch-komplexe und 16 kompensierte Tinnituspatienten sowie 15 gesunde Probanden. Zur Anwendung kam ein modifiziertes Paradigma zur Untersuchung selektiver Aufmerksamkeit (Hillyard et al., 1973). Die Aufzeichnung der EEG-Signale von Fz, Cz und Pz sowie die Ermittlung der EKP-Komponenten (z.B. Nd; Näätänen, 1982) folgte dem etablierten Standard. Ergebnisse: Die querschnittliche Betrachtung zu Behandlungsbeginn ließ keine Unterschiede in der selektiven Aufmerksamkeit zwischen Gruppen erkennen. Es zeigte sich eine stärkere Hemmung irrelevanter Reize bei chronisch-komplex beeinträchtigten Patienten. Diese setzten auch weniger Verarbeitungsressourcen ein. Im Behandlungsverlauf ergab sich bei den chronisch-komplex beeinträchtigten Patienten ein ökonomischerer Einsatz von selektiven Aufmerksamkeitsprozessen. Auch zeigte sich die Hemmung inkompatibler Reize im unbeachteten Kanal reduziert. Die Targetreize rufen weniger Arousal und Orientierung hervor. Diskussion: Ein Defizit in der selektiven Aufmerksamkeit bei Tinnituspatienten liegt in unserer Studie nicht vor. Die Behandlung führt bei chronisch-komplex betroffenen Patienten zu einer gewissen Normalisierung von beeinträchtigten Wahrnehmungsprozessen. Die Studie konnte aufzeigen, dass solche experimentellen Ansätze geeignet sind, Verarbeitungsstrukturen bei Tinnituspatienten näher zu untersuchen. Literatur: 1) Hallam, R. S. (1996). Leben mit Tinnitus. München: Quintessenz Hillyard, S. A., Hink, R. F., Schwent, V. L., & Picton, T. W. (1973). Electrical signs of selective attention in the human brain. Science, 182, 177-180. ; 2) Jacobson, G. P., Jaynee, A. C., Craig, W. N., Jeanne, W. 35 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik III. W., Ahmad, B. K. (1995). Electrophysiological Indices of selective auditoy attention in subjects with and without tinnitus. Proceedings of the Fifth International Tinnitus Seminar, 106-113.; 3) Jastreboff, J. W. & Hazell, W. P. (1993). A neurophysiological approach to tinnitus: clinical implication. British Journal of Audiology, 27, 7-17.; 4) Näätänen, R. (1982). Processing Negativity: An evoked-potential reflection of selective attention. Psychological Bulletin, 92 (3), 605-640. Evaluation eines systematischen Screenings auf psychische und psychosomatische Störungen und eines speziellen Therapiemanuals für Patienten in der medizinischen Rehabilitation Schuster N.1, Rüddel H.2, Keck M.3 1 Reha-Kompetenzzentrum Bad Kreuznach/ Bad Münster am Stein-Eberburg, 2St. Franziska-Stift Bad Kreuznach, 3Drei-Burgen-Klinik, Bad Münster am Stein-Ebernburg Hintergrund: Somatische Erkrankungen gehen sehr häufig mit affektiven Störungen und häufig mit Somatoformen Störungen einher, was häufig eine Komplizierung der medizinischen Behandlung nach sich zieht. Erste Ergebnisse deuten darüber hinaus darauf hin, dass sich bei Patienten mit chronischen Gesundheitsstörungen klassischer medizinischer Indikationsfelder die Rehabilitationsergebnisse deutlich verbessern lassen, wenn es gelingt, parallel zur medizinischen Rehabilitation die psychischen und psychosomatischen Auffälligkeiten zu reduzieren. Hierzu wurde eine spezielle Intervention entwickelt, die auf die Behandlung psychischer und psychosomatischer Störungen bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen abzielt. Es soll überprüft werden, ob sich durch ein gezieltes Screening auf psychische oder psychosomatische Beschwerden bzw. die Behandlung solcher Störungen die Rehabilitationsergebnisse in der Kardiologie, Orthopädie und Onkologie verbessern lassen. Methode: In einem kontrollierten, randomisierten Design wird ein Screening auf psychische und psychosomatische Auffälligkeiten bei Patienten in kardiologischer, orthopädischer und onkologischer Rehabilitation durchgeführt. Danach findet eine diagnostische Absicherung der psychischen oder psychosomatischen Auffälligkeiten mithilfe des SKID-I statt. Anhand der Ergebnisse werden randomisiert eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe gebildet. Die Interventionsgruppe erhält eine gezielte Intervention in Bezug auf die Behandlung psychischer oder psychosomatischer Komorbiditäten. Die Kontrollgruppe wird hinsichtlich der psychischen oder psychosomatischen Auffälligkeiten im Rahmen der standardmäßigen klinikinternen Behandlungsmöglichkeiten behandelt. Zudem wird überprüft, ob im Hinblick auf die autonomen Funktionen bei Patienten mit und ohne gezielte Behandlung der Begleitsymptome Unterschiede bestehen. Der Gesamtbehandlungserfolg wird über einschlägige Fragebögen ermittelt. Nach 6 bzw. 12 Monaten wird eine Befragung zur Erfassung der langfristigen Rehabilitationsergebnisse durchgeführt. Ergebnisse: Erste Ergebnisse werden Ende 2007 vorliegen. Literatur (Auswahl): 1) Barth, J., Schumacher, M. & Hermann-Lingen, C. (2004): Depression as a risk factor for mortality in patients with coronary heart disease: A meta-analysis. Psychosomatic Medicine, Vol. 66, 802-13.; 2) Härter, M., Hahn, D., Baumeister, H., Reuter, K., Wunsch, A. & Bengel, J. (2006): Epidemiology of mental disorders in rehabilitation. In: W. Jäckel, J. Bengel & J. Herdt (Hrsg.): Research in Rehabilitation. Results from a Research Network in Southwest Germany (S. 61-72). Stuttgart: Schattauer. Arbeitsbezogene Erlebens- und Verhaltensmuster und psychische Symptombelastung bei Patienten einer psychosomatischen Rehabilitation Bernardy K.1,3, Köllner V.1,2 1 Fachklinik für Psychosomatische Medizin, Bliestal Kliniken, Blieskastel, 2Institut für Psychoanalyse, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, Universitätskliniken des Saarlandes, 3Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Universitätskliniken des Saarlandes, Homburg Hintergrund: Ziel der vorliegenden Studie ist die Untersuchung der arbeitsbezogenen Erlebens- und Verhaltensmuster, der psychischen Symptombelastung sowie sozialmedizinischer Variablen bei Patienten mit unterschiedlichen Diagnosen in einer psychosomatischen Rehabilitationsklinik. Methodik: Insgesamt umfasst die Stichprobe 914 konsekutive Patienten (74,6% Frauen) zu Beginn einer stationären psychosomatischen Rehabilitation. Erhoben wurden arbeitsbezogene Verhaltens- und 36 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik III. Erlebensmuster (AVEM, Schaarschmidt & Fischer 1996), die psychische Symptombelastung (SCL-90-R, Franke, 1995) sowie die Dauer der Arbeitsunfähigkeit bei Antritt der Rehabilitation und der Status der Arbeitsfähigkeit bei Entlassung. Die Diagnosen der Patienten umfassten: 37,3% (341) Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen (F43), 18,1% (165) Rezidivierende depressive Störungen (F33), 14,9% (136) Depressive Episode (F32), 13,5% (123) Somatoforme Störungen (F45), 8,9% (82) Angststörungen (F41) und 7,3% (67) Phobische Störungen (F40). Ergebnisse: Insgesamt beginnen 16,7% der Patienten arbeitsfähig, 42,2% mit einer Arbeitsunfähigkeitszeit (AU) von unter 3 Monaten, 17,5% mit einer AU von 3 bis 6 Monaten und die restlichen Patienten mit einer längeren AU die Rehabilitation. Zwischen den Diagnosegruppen zeigt sich ein signifikanter Unterschied (p: 0.05), wobei der Anteil der Arbeitsfähigen bei den Patienten mit Belastungsreaktionen am größten (20,2%) und in der Gruppe der Patienten mit einer depressiven Episode am niedrigsten ist (10,5%). Arbeitsfähig entlassen werden 59,3% der Patienten. Auch hier zeigt sich ein signifikanter Unterschied (p: 0,00) zwischen den Diagnosegruppen. Patienten mit Belastungsreaktionen (67,2%) und mit Angststörungen (67,1%) werden am häufigsten arbeitsfähig entlassen und Patienten mit einer depressiven Episode am seltensten (48,5%). Bezüglich ihrer psychischen Symptombelastung (GSI) schildern sich die Patienten mit Belastungsreaktionen am wenigsten belastet (T:66), alle anderen Gruppen weisen T-Werte zwischen 72 und 73 auf. In den arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmustern zeigen Patienten mit Belastungsreaktionen erhöhte Werte in der Verausgabungsbereitschaft sowie erniedrigte in der Ausgeglichenheit und der Lebenszufriedenheit. Depressive Patienten (F32,33) zeigen erhöhte Werte in der Resignationstendenz sowie erniedrigte in der offensiven Problembewältigung, der Ausgeglichenheit, dem beruflichen Erfolgserleben, der Lebenszufriedenheit sowie im Erleben sozialer Unterstützung. Patienten mit Angststörungen (F40, 41) weisen erhöhte Werte in der Resignationstendenz und dem Perfektionsstreben sowie erniedrigte Werte im beruflichen Ehrgeiz, der offensiven Problembewältigung, der Ausgeglichenheit, dem beruflichen Erfolgserleben, der Lebenszufriedenheit sowie in der sozialen Unterstützung auf. Patienten mit somatoformen Störungen zeigen erhöhte Werte im Perfektionsstreben, der Verausgabungsbereitschaft und Resignationstendenz sowie erniedrigte Werte in der Ausgeglichenheit, dem beruflichen Erfolgserleben und der Lebenszufriedenheit. Diskussion: Patienten mit Belastungsreaktionen zeigen die geringste Alteration im beruflichen Verhalten und Erleben und die niedrigste Symptombelastung, auch ihre Arbeitsfähigkeit ist am wenigstens gefährdet. Alle anderen Diagnosegruppen zeigen weitreichende Veränderungen im arbeitsbezogenen Erleben. Literatur: 1) Franke G (1995). SCL-90-R. Die Symptom-Checkliste von Derogatis – Deutsche Version. Göttingen: Beltz; 2) Schaarschmidt U, Fischer A (1996). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM). Frankfurt/M: Swets & Zeitlinger Selbstbeurteilung von Aktivitäten und Teilhabe bei psychischen Störungen Nosper M. Medizinischer Dienst Rheinland Pfalz Hintergrund: Die Rahmenempfehlungen der BAR sowie die Rehabilitations-Richtlinien sehen vor, dass sich medizinische Rehabilitationsleistungen am Gesundheitsmodell der ICF orientieren sollen [1]. Dafür muss die Rehabilitationsdiagnostik durch ICF-konforme Assessments ergänzt werden. Für den Anwendungsbereich psychische Störungen wurde ein Core-Set für Depressionen erstellt [2]. Linden und Baron konzipierten ein „Mini-ICF-Rating“ für die Fremdbeurteilung beeinträchtigter psychischer Aktivitäten [3]. Deck u.a. entwickelten den IMET, einen globalen Index zur Messung der Einschränkungen der Teilhabe [4]. Es wurde noch nicht systematisch untersucht, welche der einzelnen ICF-Domänen der Klassifikation von Aktivitäten und Partizipation von Rehabilitanden mit psychischen Störungen als beeinträchtigt eingestuft werden. Ausgehend vom Ergebnis dieser Analyse wird für die Diagnostik der relevanten ICF-Domänen der klinische Fragebogen ICF AT Psych entwickelt. Methode: Aus den ICF-Kapiteln Aktivitäten und Teilhabe wurden die 99 Domänen vorausgewählt, die auf der Grundlage klinischer Erfahrung bei Menschen mit psychischen Störungen betroffen sein können. Die zentralen Inhalte der einzelnen 99 Domänen wurden in je ein Fragebogenitem erfasst. Der Itempool von 99 Items wurde 433 Rehabilitanden in Rehabilitationseinrichtungen für Psychosomatik, Abhängigkeitserkrankungen und RPK vorgelegt. Die Probanden bewerteten jedes Item sowohl 37 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik III. hinsichtlich der Kapazität (Wie gut kann eine Aktivität ausgeübt werden?) und der Performance (Ist die Ausübung subjektiv mit Belastung/Stress verbunden?). Die beiden Bewertungsdimensionen Kapazität und Performance wurden korreliert. Für die Items wurden Schwierigkeitsindices und Trennschärfen berechnet. Die selektierten Items wurden einer Hauptkomponenten- und Faktorenanalyse unterzogen. Die Verständlichkeit der Items wurde an 10 Fällen mit der Laut-Lese-Methode geprüft. Ergebnisse: Die Interkorrelation der Bewertungen Kapazität und Performance war sehr hoch (Rho = 0,914), so dass beide Werte für die weiteren Berechnungen gemittelt wurden. Inhaltlich und metrisch optimal war die Extraktion von 6 Faktoren aus den selektierten Items mit einer aufgeklärten Varianz von 62,48% (F1 Verbale Kompetenz, F2 Anforderungen erfüllen, F3 Soziale Beziehungen und Aktivitäten, F4 Nähe in Beziehungen, F5 Soziale Rücksichtnahme, F6 Fitness und Wohlbefinden). Die Modellgüte nach Kaiser-Meyer-Olkin war mit einem KMO = 0,966 hervorragend. Unter Berücksichtigung der Parameter Schwierigkeitsindices, Trennschärfen, Faktorenstruktur und Iteminhalte wurden 50 Items für den Fragebogen ICF AT-50 Psych ausgewählt. Die interne Konsistenz der Gesamtskala betrug Chronbachs Alpha = 0,974. Die Ermittlung der Retest- Reliabilität ist geplant. Mit dem klinischen Einsatz des Fragebogens zur Bestimmung der Änderungssensitivität und Klärung der konvergenten und diskriminanten Validität wurde begonnen. Diskussion: Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, welche Aktivitäten und Teilhabebereiche bei Menschen mit psychischen Störungen besonders betroffen sind. Weitere Untersuchungen werden zur Zeit durchgeführt, um die Eignung des Verfahrens für den Einsatz in den Bereichen Psychotherapie, Rehabilitationsdiagnostik psychischer Störungen, Evaluierung von Behandlungsergebnissen und sozialmedizinische Fragestellungen zu belegen. Routinediagnostik in der stationären psychosomatischen Rehabilitation Haupt C. M.1, Löschmann C.1, Nübling R.2, Steffanowski A.3, Rundel M.4 1 eqs.-Institut Hamburg, 2Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg, Hauptstätter Str. 89, 70178 Stuttgart, 3Universität Mannheim, Lehrstuhl Psychologie II, 4GQE (Gesellschaft für Qualitätsentwicklung), Freiburg Hintergrund: Fragen nach der Ergebnisqualität psychosomatischer Rehabilitation implizieren immer auch Fragen nach dem Ausmaß der Kongruenz zwischen Behandlungszielen und tatsächlichen Ergebnissen. Maßgeblich ist Ergebnisqualität über den „Therapieerfolg“ definiert. Dieser ist am konkreten Behandlungsauftrag und an der Zielerreichung zu messen. In der Psychosomatischen Klinik Schömberg wurde dieser Therapieerfolg untersucht, konzipiert für drei Messzeitpunkte (Aufnahme, Entlassung und 1-Jahres-Katmnese). Im Mittelpunkt steht der IRESFragebogen (Indikatoren des Reha-Status IRES), ein rehabilitationsspezifisches und krankheitsübergreifendes Assessmentinstrument zur Erfassung des subjektiven Gesundheitszustands, das sich an der ICF orientiert. Methodik: Die verwendeten Erhebungsinstrumente umfassten standardisierte und normierte Fragebögen ebenso wie neu entwickelte, speziell auf bestimmte Fragestellungen zugeschnittene Messverfahren. Sie erfassen Beschwerden, Angst, Depression, Therapiemotivation sowie jeweils spezielle Fragen. Durch diese Messinstrumente wurden echte und retrospektive Statusmessungen im Rahmen der allgemeinen Ergebnismessungen ebenso möglich wie zielorientierte bzw. individualisierte Ergebnismessungen und Aggregationen zu multiplen Ergebniskriterien. Dieser Selbstbeurteilung der Patienten werden Fremdangaben gegenübergestellt: Therapeutenfragebögen, Fragebogen für Hausärzte und eine Krankenkassenbefragung. Ergebnisse: Bezogen auf den untersuchten IRES-3-Fragebogen ergeben sich beim Vergleich von Aufnahme und Entlassungsdatum der Patienten große Veränderungen. Die beobachtbaren Veränderungen des gesundheitlichen Befindens ergaben deutliche Besserungseffekte, wobei die kurzfristige Effektgröße die längerfristige übertraf. Bei beiden Messzeitpunkten konnten nach der Terminologie von Cohen (1992) „große“ Effekte (ES > 0,80) beobachtet werden. Die Veränderungsmaße korrelieren positiv mit dem Gesundheitszustand. Nur schwache Zusammenhänge zeigten sich mit den Merkmalen Geschlecht, Alter und Schulbildung. Diskussion: Der IRES-Fragebogen zeigt eine hohe Güte und gute Validität. Er eignet sich zur Messung von Therapieerfolg. 38 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik IV. Literatur: 1) Schmidt, J., Nübling, R., Steffanowski, A. & Wittmann, W. W. (2002). Evaluation der Effektivität psychosomatischer Rehabilitation: Wie gut stimmen echte und retrospektive Vorher- NachherVergleiche überein? Ergebnisse aus der EQUA Studie. DRV-Schriften, 33 (S. 271-273). Frankfurt: VDR.; 2) World Health Organization (WHO) (2005). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), Geneve, deutsche Fassung. Formen der Depression und sozialmedizinisches Behandlungsergebnis in der psychosomatischen Rehabilitation Geiselmann B., Brünahl C. Forschungsgruppe für Psychosomatische Rehabilitation am Reha-Zentrum Seehof der Deutschen Rentenversicherung Bund, Teltow, Abteilung Verhaltenstherapie und Psychosomatik Hintergrund: Depressive Störungen im weiteren Sinne machen den größten Teil der in der psychosomatischen Rehabilitation behandelten Erkrankungen aus. Das Spektrum beinhaltet Anpassungsstörungen, die Dysthymie sowie die typischen depressiven und rezidivierenden depressiven Störungen bis hin zu den bipolaren affektiven Erkrankungen. Da es sich in der Rehabilitation typischerweise um chronifizierte Erkrankungen oder residuale Leistungseinschränkungen nach Akutbehandlung handelt, ist die Frage, ob die aus der Akutpsychiatrie heraus entwickelte diagnostische Klassifikation nach ICD im verhaltenstherapeutischen Setting einer Reha-Klinik mit dem sozialmedizinischen Behandlungsergebnis korreliert. Methode: Die Datengrundlage bildet die Basisdokumentation der Abteilung. Zur Verfügung stehen die Datensätze von über 3000 Patienten, die eine psychosomatische Rehabilitation regulär beendet haben. Als Maß für den Rehabilitationserfolg stehen einerseits Selbstbeurteilungen in Form der SCL90R-Skala am Anfang und am Ende des Aufenthalts zur Verfügung; andererseits können Arbeitsfähigkeit und Leistungsprognose am Ende des Aufenthalts mit entsprechenden sozialmedizinischen Daten vor dem Aufenthalt verglichen werden. Ergebnisse: Etwas mehr als 50% der Patienten haben bei der Entlassung die Diagnose einer depressiven Erkrankung. Bei vergleichbaren soziodemografischen und sozialmedizinischen Voraussetzungen bei Aufnahme (z.B. Krankschreibung, Arbeitslosigkeit) können deutlich mehr Patienten mit Anpassungsstörung arbeitsfähig entlassen werden als Patienten mit einer affektiven Störung (F3 nach ICD). Darunter wiederum ist der Anteil bei der bipolaren Störung am geringsten. Die 6-MonteLeistungsprognose ist bei den Anpassungsstörungen vergleichbar mit derjenigen bei den affektiven Störungen. Eine Ausnahme bilden die Patienten mit bipolarer Störung, die eine schlechtere Prognose haben. Diskussion: Unabhängig von anderen Eingangsvoraussetzungen korreliert die diagnostische Klassifikation einer Depression als Anpassungsstörung mit einer schnelleren Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Bipolare affektive Störungen gehen mit dem ungünstigsten Reha-Ergebnis einher. Literatur: Tölle R (1995): Zur Rehabilitation depressiver Patienten. Nervenheilkunde 15, 255-260. Psychosomatik IV. Langfristige Veränderungen der Leistungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer durch ein kognitives Trainingsprogramm in der stationären psychosomatischen Rehabilitation Knickenberg R.1, Wagner S.1, Knickenberg R.J.2, Bleichner F.2, Beutel M.E.1 1 Psychosomatsiche Klinik Bad Neustadt/ Saale, 2Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Aus zahlreichen Erhebungen an der Psychosomatischen Klinik Bad Neustadt/Saale ließ sich herausarbeiten, dass ältere Arbeitnehmer (50 – 59 Jahre) in stationärer Rehabilitation sich in erheblichem Maße durch Umstrukturierungen und Einführungen neuer Technologien belastet bzw. überfordert fühlen. Unklar ist bislang, welche Rolle dabei kognitive Beeinträchtigungen (MCI) spielen und ob ein gezieltes Trainingsprogramm die kognitive Leistungsfähigkeit steigern bzw. im beruflichen Alltag die Anpassungsfähigkeit steigern kann. Im Rahmen eines Forschungsprojektes („Diagnostik und Therapie leichter kognitiver Beeinträchtigungen bei älteren Arbeitnehmern“) wurde daher ein kognitives 39 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik IV. Trainingsprogramm für ältere Psychosomatikpatienten entwickelt und durchgeführt. Eingeschlossen wurden alle Patienten der Psychosomatischen Klinik Bad Neustadt/Saale im Alter von 50 bis 59 Jahren, die ihr schriftliches Einverständnis zur Studienteilnahme gaben und in der kognitiven Leistungstestung „auffällig“ waren. Verglichen wurden Zeitkohorten (ABAB) von Studienteilnehmern, die kognitive Beeinträchtigungen aufwiesen und an der regulären Behandlung bzw. einem zusätzlichem kognitivem Training teilnahmen. 16 Trainingsgruppen wurden in Kleingruppen von 4 bis 8 Patienten mit jeweils 7 Terminen (zu 90 Min.) durchgeführt. Neben grundlegenden Informationen zu Gedächtnisprozessen wurden anhand von Verhaltensanalysen die Themenschwerpunkte prospektives Gedächtnis und strukturiertes Erschließen neuer Informationen die Gedächtnisprobleme der Patienten erarbeitet und der Transfer in den Alltag gezielt gefördert. Eingeschlossen wurden 133 Männer und 183 Frauen, von den 29 % als auffällig eingestuft wurden. Vollständige Daten liegen von 55 Trainingsteilnehmern und 24 Kontrollmitgliedern vor. Elektronisches Coaching - eine neue Methode zur Aufrechterhaltung verhaltenstherapeutischer Behandlungsergebnisse mit Hilfe von Handheld-Computern Bischoff C., Schmädeke S. Psychosomatische Fachklinik, Bad Dürkheim Körperliche und seelische Störungen werden meist durch ungünstige Erlebens- und Verhaltensweisen ausgelöst, verstärkt oder aufrechterhalten. Im Rahmen einer ambulanten oder stationären verhaltenstherapeutischen Behandlung können solche Erlebens- und Verhaltensweisen identifiziert und durch günstigere ersetzt werden. Die Umstellung des Verhaltens einzuleiten ist für den Patienten in der Regel nicht so schwierig, wie sie aufrechtzuerhalten. In der Tat ist die eingeschränkte Nachhaltigkeit von Verhaltensänderungen das zentrale Problem bei der Therapie und Rehabilitation chronischer Krankheiten überhaupt. E-Coaching ist eine neue verhaltenstherapeutische Interventionsform zur Selbstregulation des Verhaltens mit technischer Hilfe. Ein Handheld-Computer hat die Aufgabe, den Patienten beim Transfer des in der stationären Behandlung Gelernten, „bei der Eingewöhnung in die Umgewöhnung“ zu unterstützen. Der Patient wird mehrmals am Tag programmgesteuert aufgefordert, seine Aufmerksamkeit auf sein derzeitiges Verhalten und Erleben zu richten, es daraufhin zu überprüfen, ob es die Entstehung des körperlichen oder seelischen Symptoms (z.B. Schmerzen) begünstigt, es gegebenenfalls im Sinne der in der Behandlung erarbeiteten Strategien zu korrigieren und nach einer von ihm über den E-Coach festgelegten Zeitspanne zu überprüfen, ob diese Korrekturen erfolgreich waren. Den theoretischen Rahmen der Methode bilden die Arbeiten von Miller, Galanter & Pribram (1960); Kuhl (2001) und Prochaska & DiClemente (1992). Konzeptualisierung und Programmentwicklung sind abgeschlossen und sollen zusammen mit den ermutigenden Ergebnissen einer kontrollierten Einzelfallstudie dargestellt werden. Das Verfahren kann unter anderem in der Reha-Nachsorge von Patienten in psychosomatischen Fachkliniken eingesetzt werden. Nächster Schritt wird seine Evaluation in diesem Einsatzgebiet im Rahmen einer randomisierten Kontrollgruppestudie sein. Literatur: 1) Kuhl, J. (2001). Motivation und Persönlichkeit. Göttingen: Hogrefe.; 2) Miller, G. A., Galanter, E. & Pribram, K. H. (1960). Plans and the structur of behavior. New York: Holt, Rinehart & Winston.; 3) Prochaska, J.O. & DiClemente, C.C. (1992). Stages of change in the modification of problem behavios. In M. Hersen, R.M. Eisler & P.M. Miller (Ed.), Progress in behavior modification (pp. 184214). Sycamore, IL: Sycamore Press. Das Forschungsprojekt „Wirksamkeit einer internetgestützten Nachsorge nach stationärer psychosomatischer Rehabilitation“ Golkaramnay V., Wangemann T., Vogler J. Psychosomatische Klinik Alpenblick Hintergrund: Die Entlassung aus der stationären psychosomatischen Rehabilitation und damit die Konfrontation mit familiären, beruflichen und sozialen Gegebenheiten stellen sich für viele Patienten als eine große Herausforderung dar und unterstreichen die Bedeutung einer Nachbetreuung. Die langfristige 40 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik IV. Sicherung des Rehabilitationserfolges sowie die Vermeidung von Rückfällen hängen von der Umsetzung der erworbenen Kompetenzen und der Bewältigung alltäglicher und nichtalltäglicher Krisen nach dem stationären Aufenthalt ab. Zur Optimierung der gesundheitlichen Versorgung in diesem Bereich sind die bestehenden gesellschaftlichen und technologischen Ressourcen optimal einzusetzen (Golkaramnay, et. al., 2003, 2007; Bauer et. al., 2005; Kordy et. al., 2006). Im Rahmen des Forschungsprojektes, das von der Deutschen Rentenversicherung (DRV-Bund) gefördert wird, wird u.a. die Wirksamkeit der internetgestützten Nachsorge nach stationärer psychosomatischer Rehabilitation untersucht. An der Studie sind die psychosomatischen Kliniken Alpenblick und Frankenhausen beteiligt. Methode: Zur Untersuchung der Forschungsfragen ist eine randomisierte prospektive Längsschnittstudie angelegt worden. Im Anschluss an die stationäre psychosomatische Rehabilitation nehmen die Probanden einmal pro Woche (90 Minuten) für die Dauer von 15 Wochen an therapeutisch begleiteten Chatgruppen teil. Die Gruppengröße beträgt 8 Teilnehmer. Die Probanden werden zur Aufnahme in und bei der Entlassung aus der Klinik, sowie 3, 6 und 12 Monate nach der Entlassung anhand standardisierter klinischer Fragebögen zu ihrer psychischen, körperlichen und emotionalen Verfassung sowie ihren arbeitsbezogenen Verhaltensmustern befragt. Zudem werden die Probanden während der Teilnahme an dem Programm wöchentlich zu ihrer psychischen Verfassung befragt. In die Kontrollgruppe kommen die Probanden ohne eine Nachbetreuung. Ergebnisse: Die ersten Ergebnisse der Studie werden ab Mitte 2008 erwartet. Literatur: 1) Bauer S, Golkaramnay V & Kordy H (2005). E-Mental-Health – Neue Medien in der psychosozialen Versorgung. Psychotherapeut 50:7–15.; 2) Golkaramnay V, Wangemann T, Dogs J, Dogs P & Kordy H (2003). Neue Brücken für Lücken in der psychotherapeutischen Versorgung durch das Internet: Hoffnungen, Herausforderungen und ein Lösungsansatz. Psychother Psychosom Med Psychol 53:399–405.; 3) Golkaramnay, V., Bauer, S., Haug, S., Wolf, M. & Kordy, H. (in press). The exploration of the effectiveness of group therapy through an Internet chat as aftercare: A controlled naturalistic study. Psychotherapy and Psychosomatics.; 4) Kordy H, Golkaramnay V, Wolf M, Haug S & Bauer S (2006). Internetchatgruppen in Psychotherapie und Psychosomatik - Akzeptanz und Wirksamkeit einer Internetbbrücke zwischen Fachklinik und Alltag. Psychotherapeut, , 51: 144-153. Ergebnisqualität der medizinischen Rehabilitation von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen bei weiblichen Rehabilitanden Zielke M. Wissenschaftsrat der AHG AG, Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim Hintergrund: Das Gesundheitsverhalten, die Ausprägungen der klinischen Symptomatiken und die Inanspruchnahme von Ressourcen im Gesundheitssystem ist bevölkerungsbezogen zwischen Männer und Frauen so unterschiedlich , wie es ausgeprägter nicht sein kann. In welchem Ausmasse solche Unterschiede auch in klinischen Behandlungspopulationen anzutreffen sind und inwieweit sich bei der Ergebnisqualität medizinischer Rehabilitationsmassnahmen differenzielle geschlechtsspezifische Unterschiede aufzeigen lassen, ist bislang kaum Gegenstand systematischer Evaluationsstudien. Auf der Basis einer Rehabilitandenstichprobe von 338 Patienten und Patientinnen aus drei verhaltensmedizinisch arbeitenden psychosomatischen Rehabilitationskliniken wird untersucht, ob (1.) sich bereits vor Beginn der stationären Intervention Unterschiede in ausgewählten klinischen Parametern zwischen Männern und Frauen finden lassen, ob (2.) sich unterschiedliche Behandlungsergebnisse zeigen und (3) wie sich das poststationäre Gesundheitsverhalten entwickelt. Methode: In einer Multicenterstudie unter Beteiligung der psychosomatischen Fachkliniken Bad Dürkheim, Bad Pyrmont und der Klinik Berus sowie der DAK Hauptverwaltung in Hamburg wurden geschlechtsspezifische Unterschiede in folgenden Bereichen untersucht: (1) Prästationäres Krankheitsverhalten ( Ambulante Praxiskontakte, Arbeitsunfähigkeitsgeschehen, Medikamentenkonsum), (2) Veränderungen in klinischen Parametern zwischen der Aufnahme in die Klinik und der Entlassung und einer zweijährigen katamnestischen Nachuntersuchung (Psychosomatische Beschwerden, Depressivität, Angstsymptomatik, krankheitsbezogene Verhaltensmuster, soziale und interaktive Verhaltensmuster) und (3) Häufigkeit und Dauer der Krankheitsfälle und der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung zwei Jahre nach der Entlassung aus der Klinik. 41 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik IV. Ergebnisse: Bereits vor der stationären Rehabilitation haben die Patientinnen mehr ambulante ärztliche Kontakte und häufiger psychotherapeutischen Vorerfahrungen. Sie sind zwar häufiger krank, aber mit einer deutlich kürzeren Dauer je Krankheitsfall; auch der Gesamtumfang der prästationären Krankheitstage ist bei Frauen wesentlich geringer. In nahezu allen klinischen Parametern haben die weiblichen Patienten deutlich höhere Ausgangswerte und zeigen gleichzeitig stärkere Veränderungen. Die Frauen in der Stichprobe planen häufiger eine ambulante Psychotherapie im Anschluss an die stationäre Behandlung und setzten diese häufiger auch um. Diskussion: Die ausgeprägten Effekte der psychosomatischen Rehabilitation entstehen zum überwiegenden Teil durch die klinischen Erfolge bei den Patientinnen. Auch die Behandlungsqualität wird von Frauen besser eingeschätzt als dies Männer tun. Gleichwohl bleiben die Geschlechtsunterschiede in den klinischen Symptomatiken auch katamnestisch weiter bestehen. Es gibt Hinweise, dass auch die stationären Behandlungsprozesse sich unterschiedlich gestalten. Literatur: Stapel M (2005) Wirksamkeit stationärer Verhaltenstherapie bei depressiven Erkrankungen in der Psychosomatik. Pabst Science Publishers, Lengerich Zielke M et mult. al. (2004) Ergebnisqualität und Gesundheitsökonomie verhaltensmedizinischer Psychosomatik in der Klinik. Pabst Science Publishers, Lengerich Wieder im Trend - Wider dem Trend: Männergruppen Böttcher P.1, Jacobi E.2, Vogler J.3, Kaluscha R.+2 1 Praxis für psychotherapeutische Medizin in Mannheim; 2Forschungsinstitut für Rehabilitationsmedizin an der Universität Ulm, Bad Wurzach; 3Klinik Alpenblick, Isny-Neutrauchburg Hintergrund: Entgegen dem Trend Männer und Frauen zunehmend gleich zu behandeln, findet in der psychosomatischen Fachklinik Alpenblick (Chefarzt Dr. J. Vogler) die Erprobung einer Form der Rehabilitation einer besonderen Art statt. Seit 2004 nehmen Männer, die in der Klinik an einer konventionellen Rehabilitationsmaßnahme teilnehmen, auf eigenen Wunsch an einer Männergruppe teil. Von der Teilnahme sind, bis auf gelegentliche Ausnahmen, Frauen gänzlich ausgeschlossen, was unter den Männern tendenziell, insbesondere im Rahmen einer Klinik, in der etwa drei Viertel der Patienten Frauen sind, als kohäsionsfördernd und im Sinne einer gewissen Exklusivität erlebt wird. "Jungen sind von Natur aus assertiver als Mädchen" [Bischoff-Köhler, S. 344]. Dieses lässt sich mit Einschränkungen sicherlich auch auf Erwachsene übertragen. Methode: Einige der Mitglieder der Männergruppen nehmen an den vier- bis fünfmal jährlich stattfindenden Schwitzhüttenritualen teil. Die zugegebenermaßen etwas archaisch anmutende Veranstaltung findet über zwei Tage und zwei Nächte an einer Hütte im Wald statt. Das zentrale Ereignis ist die Teilnahme an einer Natursauna in einer Schwitzhütte. Bei der Auswertung nutzten wir einen Matched-Pair-Ansatz, wobei jedem Schwitzhüttenteilnehmer aus dem Pool der anderen männlichen Patienten ein Pendant mit gleicher Diagnose und möglichst gleichem Ausgangswert für psychische Beschwerden – gemäß des klinisch psychologischen Diagnosesystems 38 - zugeordnet wird. Erhoben werden auch ergänzende Parameter wie Alter oder Aufenthaltsdauer sowie die Veränderung des seelischen Befindens und die Veränderung der Eigenaktivität und Verantwortung. Ergebnisse: Unsere Untersuchungen haben ergeben, daß die Teilnehmer an der Schwitzhüttentherapie statistisch signifikant ein etwas besseres Outcome hatten als die Vergleichsgruppe (Männer in klassischer Rehabilitationsmaßnahme). Bezogen auf den Score des klinisch psychologischen Diagnosesystems 38 bei Entlassung beträgt die Effektstärke 0,21. Im Jahr 2005 haben von den Männern, die laut Selbsauskunft mindestens einmal an der Männergruppe teilnahmen, 58 Männer auch an der Schwitzhütte teilgenommen. Die Teilnehmerzahl für die Schwitzhütte war begrenzt. 67,6 Prozent der Männer, die 2005 in der Klinik Alpenblick behandelt wurden, haben mindestens einmal an der Männergruppe teilgenommen, was für ein ausgesprochen großes Interesse der Männer an der Gruppe spricht. Die Männergruppe wurde im Durchschnitt von den 301 Männern, die im Jahr 2005 erfasst sind, mit 2,37 bewertet. Die fünfstufige Skala umfaßte die Werte „1 = sehr geholfen“, „2 = ziemlich geholfen“, „3 = etwas geholfen“, „4 = nicht geholfen“ und „5 = geschadet“. Die Standardabweichung betrug 1,29. Die Männergruppe wird also im Durchschnitt zwischen „ziemlich“ und „etwas“ hilfreich erlebt. 42 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik IV. Das Schwitzhüttenritual wird als „ziemlich“ hilfreich in der Abschlußbefragung der Rehabilitation beschrieben. Die Schwitzhütte wurde mit 2,02 im Durchschnitt bei einer Standardabweichung von 0,96 bewertet. Im Gegensatz zu der Männergruppe lag der höchste Wert bei den Teilnehmenden an Schwitzhütte nur bei 4. Also hatte keiner der Teilnehmer angegeben, daß ihm die Schwitzhütte geschadet habe. Diskussion: Auch wenn mit einer Effektstärke von 0,21 lediglich ein schwacher Effekt der Schwitzhütte zu beobachten ist, ist dies angesichts der kurzen Intervention und der langwierigen Grunderkrankung sehr beachtlich. Offenbar findet im Zusammenhang mit dem Therapiemodul „Schwitzhütte“ häufig eine Veränderung der Motivationslage bei den Teilnehmern statt. Literatur: 1) Doris Bischoff-Köhler: Von Natur aus anders - die Psychologie der Geschlechtsunterschiede, Kohlhammer Verlag; 2) J. Vogler: "Schwitzhütte ein Angebot nur für Männer". Klinikkonzepte der Klinik Alpenblick.; 3) Online: www.klinik-alpenblick.de/210.html Wirkung der stationären Medizinischen Rehabilitation bei Morbus Crohn evidenzbasiert? Streit J.1, Grünhage F.2, Reichel C.1 1 Deutsche Rentenversicherung Bund, Reha Zentrum Bad Brückenau, Klinik Hartwald, Bad Brückenau; Medizinische Klinik und Poliklinik I, Universitätsklinikum Bonn, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Bonn 2 Hintergrund: Es existieren keine Daten über die Wirkungen einer leitliniengerechten Rehabilitation (Reha) bei Patienten mit Morbus Crohn (MC). Wir untersuchten daher die Wirkung von Reha auf die Medikation und Erkrankungsaktivität bei Patienten mit MC. Methodik: In einer retrospektiven Einzelzentrums Kohortenstudie wurden Entlassungsbriefe und Krankenakten von 355 Patienten mit ICD Verschlüsselung MC, deren Reha in 2006 komplett durchgeführt wurde, ausgewertet. Es wurde die Erkrankungsaktivität und die medikamentöse Therapie des MC vor und nach der Reha verglichen. Ergebnisse: Ein radiologisch bzw. histologisch gesicherter MC lag bei 337 Rehabilitanden (250 w, 87 m; mittleres Alter 40 ± 11 Jahre) vor. Die Aktivitätsindices Crohns Disease Activity Index (CDAI) und Harvey Bredshaw Index (HBI) lagen zu Beginn der Reha (Dauer 23 95% CI 20 - 35 Tage) bei 146,4 95% CI 37-283 bzw. 4,9 95% CI 1 - 11. Zu Beginn nahmen 113 Patienten ein systemisch wirksames Steroid (Cortisol Äquivalenzdosis (ÄD) 71 ± 61 mg). 45 Patienten nahmen Budesonid als einziges Steroid (7,2 ± 2,8 mg), sowie 13 Patienten Budesonid als zweites Steroid. 109 Patienten wurden mit Azathioprin (AZT) in einer Dosis von 113 ± 54 mg bzw. 1,6 ± 0,8 mg/kg behandelt. Während der Reha sank der HBI um 1,2 95% CI 1,0 - 1,3 Indexpunkte (p < 0,0001). Systemische Steroide wurden bei 15 Rehabilitanden (p < 0,001) abgesetzt. Bei 4 Patienten, die nur Budenosid erhielten konnte es abgesetzt werden (n.s). Bei 11 Patienten (p < 0.001) wurde AZT neu gegeben. Die Cortisol ÄD bei den mit systemisch wirksamen Steroiden Behandelten konnte um 20,3 95% CI 13,5 - 27,1 mg gesenkt werden. Die AZT Dosis stieg um 20 95% CI 14 - 27 mg auf 133 ± 44 mg bzw.1,9 ± 0,6 mg/kg (p < 0,001). Schlussfolgerung: Eine dreiwöchige Reha in einer gastroenterologischen Schwerpunktklinik führt zu einer signifikanten Reduktion der MC Aktivität und der verabreichten systemisch wirksamen Steroiddosis. Nach der Reha wurden signifikant mehr Patienten mit AZT behandelt und die AZT Dosis in Richtung auf die empfohlene Standarddosis (2,5 mg/kg) signifikant angehoben. Diese Dosiserhöhung erklärt bei bekanntem verzögertem Wirkeintritt des AZT die gefundene Akutwirkung der stationären Reha auf die MC Aktivität nicht. Unsere Daten zeigen, dass Reha evidenzbasiert die Ergebnisse der akut medizinischen Versorgung signifikant verbessern kann. 43 Samstag, 23.6.2007 Psychosomatik IV. Betriebliches Eingliederungsmanagement: Erste Ergebnisse einer bundesweiten Untersuchung zum Umsetzungsstand des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) nach § 84 Abs. 2 SGB IX Vater G.1, Niehaus M.1, Marfels B.1, Magin2, Werkstetter E.2 1 Universität zu Köln, Lehrstuhl für Arbeit und Berufliche Rehabilitation; 2Unternehmensberatung Magin Hintergrund: Betriebliche Prävention und Return to Work Ansätze zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit haben durch die Einführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 84,2 SGB IX neue Impulse erhalten. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die gesetzlichen Vorgaben in den Betrieben sehr unterschiedlich interpretiert und praktiziert werden (vgl. Magin, 2005; Hetzel et al., 2006). Bisher liegen noch keine systematisch gewonnenen empirischen Erkenntnisse zum Umsetzungsstand und zu den praktischen Auswirkungen der eingesetzten Instrumente und Verfahren vor (Niehaus, 2005). Methode: Ziel der Untersuchung ist die Erfassung quantitativer Aussagen zur Verbreitung des BEM und betrieblicher Prävention als auch qualitativer Aussagen über die Art und Weise, mit der die Betriebe bzw. die verschiedenen Beteiligten die Ziele des § 84,2 SGB IX realisieren. Das Forschungskonzept ist dreidimensional angelegt: Bundesweite Erhebung der Verbreitung des betrieblichen Eingliederungsmanagements und Prävention (Online-Befragung, schriftlicher Befragung) Meta Evaluation laufender Projekte und Maßnahmen zum § 84 Abs. 2 SGB IX (Experteninterview, Auswertung schriftlicher Dokumentation) Fallstudien in Betrieben die BEM durchgeführt haben (schriftlich Befragung, Interview) Die Auswertung erfolgt weitestgehend deskriptiv. Erste Ergebnisse: Bundesweite Befragung: Zur Zeit TN = 450, davon haben BEM durchgeführt N = 131. Struktur der Teilnehmer: 92% sind Groß- und Mittelunternehmen. Schwerpunkte der Präventionsmaßnahmen sind Bewegung, Sucht, Ergonomie und Partizipation. Schwerpunkte der Integration sind stufenweise Wiedereingliederung, Verbesserung der technischen Austattung des Arbeitsplatzes und Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz. Eine hohe Zustimmung der Beschäftigten existiert zu Bewegungsangeboten, Partizipation, Begrenzung der Verweildauer auf alterskritischen Arbeitsplätzen sowie Organisierung eines Arbeitsversuchs, Verbesserung der technischen Ausstattung und stufenweiser Wiedereingliederung. Einige Maßnahmen der Prävention und Integration weisen auf eine erfolgreiche Integration hin. Die Auswirkungen des BEM werden vornehmlich positiv beurteilt. Diskussion: Die ersten Ergebnisse zur Umsetzung der Ziele des § 84,2 SGB IX geben Hinweise auf positive Effekte von Prävention und BEM in Bezug auf die betriebliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung Bedrohter. Darüber hinaus liefern sie Ansatzpunkte zur Optimierung der betrieblichen Integration sowie zur Unterstützung der Verbreitung des BEM in Kleinstund Kleinbetrieben. Literatur: Hetzel, C., Flach, T. & Schian, H.-M. (2006). Zur Problematik der Implementierung des betrieblichen Eingliederungsmanagements in kleinen und mittleren Unternehmen. Das Gesundheitswesen 68: 303-308. Magin, J. (2005). Die Einführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements- Erste Erfahrungen aus der Praxis. Behindertenrecht 2: 52-59. Niehaus, M. (2005). Chancen und Barrieren der Teilhabe gesundheitlich beeinträchtiger und behinderter Menschen im Betrieb. Zeitschrift für Sozialreform 51: 73-86. 44