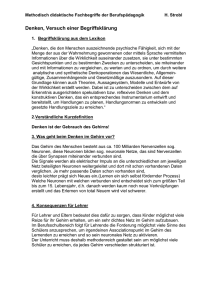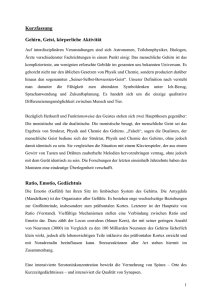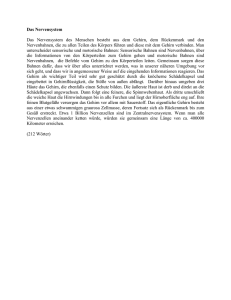und Hauptschulen Simmern Anne Rauen Stand: 27.01.11 FL AS
Werbung

Staatliches Studienseminar für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen Simmern Anne Rauen FL AS Stand: 27.01.11 Neurodidaktik Lernforschung und Konsequenzen für die Schule 1. Fragestellungen der Neurodidaktik Was kann uns die Hirnforschung über das Lernen lehren? Unter dieser Fragestellung eröffnen sich dem neuen Gebiet der Neurodidaktik viele Teilfragen: - Die Neurodidaktik fragt: Was kann uns die Hirnforschung über das Lernen lehren? Wie funktioniert das Lernen beim Menschen? Wie und wo speichert das Gehirn Lehr- und Lerninhalte ab? Unter welchen Bedingungen lernen wir am besten? Ist lebenslanges Lernen möglich? Was kann die Schule von der Hirnforschung lernen? Wie müsste man die schulische Praxis des Lernens mit Blick auf die Hirnforschung verändern? Wie müssten die Lehrpläne und Lernkonzepte der Zukunft dann aussehen? Sind bisherige Konzepte der Pädagogik und der Didaktik mit den Ergebnissen der Hirnforschung deckungsgleich? Vgl.: http://www.wz.nrw.de/wz/veran/Neuro2004_17.htm#P2 – Neuro 2004 : Hirnforschung für die Zukunft- Symposion im Wissenschafatszentrum Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf am 17. November 2004 Die Fragen signalisieren eine Trendwende. Bisher immer wieder auftauchende behaviouristische Konzepte können auf solche Fragen keine Antwort mehr geben. Als Gestaltungsprinzip von Lernprozessen können sie, wie die neuere Hirnforschung festgestellt hat, kein nachhaltiges Lernen bewirken. Die Ergebnisse der Hirnforschung legen vielmehr nahe, dass Lernen ein aktiver Prozess des lernenden Subjektes ist, der als Handlung aufgefasst werden muss, welche die ganze Person in Anspruch nimmt. Im Vorwort zu seinem Buch „Lernen – Gehirnforschung und die Schule des Lebens“ schreibt Professor Manfred Spitzer: „Schüler sind nicht dumm, Lehrer nicht faul und unsere Schulen nicht kaputt. – Aber irgendetwas stimmt nicht, das ahnen wir seit einiger Zeit.“ Die Auffassung des Lernens geht weg von behaviouristischen Konzepten hin zu einer konstruktivistischen Auffassung (siehe: Spitzer, M.: Lernen. – Heidelberg u. Berlin: Spektrum 2003 – korrigierter Nachdruck, S. XIV) All dies präsentiert uns die Forschungsrichtung der Neurodidaktik als ein spannendes Arbeitsfeld. Neurodidaktik ist eine verhältnismäßig neue Wissenschaft, die sich an der Schnittstelle von Pädagogik und Neurowissenschaften interdisziplinär entwickelt. Hirnforschung und Pädagogik arbeiten im Forschungsgebiet der Neurodid. Allerdings können die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse und Befunde nur dort eine stichhaltige Basis vorfinden, wo eine reformpädagogisch inspirierte Unterrichtspraxis die notwendigen Daten liefert. Im Labor können solche Daten nicht erhoben werden. Im Gegenzug erhält die Pädagogik stichhaltige Begründungen für erfolgreiches Lehren in Misserfolg vermeidenden Lernarrangements. Innerhalb der Gehirnforschung beschäftigen sich zahlreiche Teildisziplinen mit dem Zusammenhang zwischen dem Lernen und der Entwicklung des Gehirns, deren Ergebnisse hier kurz aufgeführt werden sollen: • Neurobiologie: Beschreibt evolutionär bewirkte Strukturen als Träger des Lernens (z. B. neuronale Veränderungen, Gedächtnis). • Neuropsychologie: Die Rolle des limbischen Systems für die Entstehung und die Steuerung von Emotionen. • Entwicklungsneurologie: Wissen über die Modellierbarkeit von Prozessen, die zu einer individuellen Lerngeschichte und damit zu einer individuellen Gehirnstruktur führen. • Neurophysiologie: Das Funktionieren des Gehirns in Netzwerken und ganzheitliche Auffassung der Gehirnfunktionen. Interdisziplinär zusammen. Viele Teildisziplinen der Hirnforschung beschäftigen sich mit dem Lernen: Neurobiologie Neuropsychologie Entwicklungsneurologie Neurophysiologie (siehe: Herrmann, Ulrich: Gehirngerechtes Lehren und Lernen: Gehirnforschung und Pädagogik auf dem Weg zur Neurodidaktik. – In: ders., (Hrsg.): Neurodidaktik. – Weinheim und Basel 2006 2. Abspeicherungs- und Strukturierungsprozesse im Gehirn 2.1 Der Bau von Nervenzellen Vereinfacht gesagt bestehen Nervenzellen aus dem Zellkörper mit dem genetischen Material, dem Dendritenbaum, einem hochverzweigten Ausläufer und dem Axon, das bis zu 1 m lang werden kann. 1) Zellkörper 2) Zellkern 3) Zellplasma 4) Ansatz des Axons am Zellkörper 5) Dendritenbaum 6) Axon 7) Synapsen 8) Synaptische Verbindung von einer anderen Zelle a) zum Zellkörper b) zum Dendriten Nervenzellen sind Informationsverarbeitungseinheiten. Sie empfangen Signale über die Dendriten, verrechnen sie im Zellkörper Quelle: http://rfhs8012.fhregensburg.de/~saj39122/pengl/ diplomarbeit/node4.htm (übernommen am 19. 4. 2005) und senden sie über das Axon und die Synapsen weiter. Die Dendriten sind die Empfangsorgane des Neurons. Mit ihren Verzweigungen können sie mit bis zu 10 000 anderen Nervenzellen in Verbindung treten. Der Zellkörper „verrechnet“ die ankommenden Signale. Dabei wird im Lernprozess das genetische Material des Zellkerns mit einbezogen. Das Axon mit den anhängenden Synapsen ist die Sendestruktur des Neurons, welches auf diese Weise Signale an andere Zellen weitergibt. Die Synapsen sind als Kontaktstellen zu den folgenden Zellen aufzufassen. Über dieser in didaktischer Reduktion vorgenommenen Information darf nicht vergessen werden, dass in Wirklichkeit diese Übertragungsprozesse mit sehr komplizierten chemischen Details ausgestattet sind. Angesichts der Vielzahl von Neurotransmittern, ihrer Entstehungsorte, Mengenverhältnisse, Wirkungs- und Kombinationsmöglichkeiten ist die Hirnforschung noch lange nicht am Ende ihrer Erkenntnismöglichkeiten angelangt. Wir dürfen aber annehmen, dass die Ergebnisse dieser Forschungen neurodidaktische Relevanz erlangen werden. 2.2 Die Signalübertragung zwischen Nervenzellen Bildquelle: http://www.buerlecithin.de/images/ Reizübermittlung_72dpi.jpg (übernommen am 19.4.05) Die Impulse, die eine Nervenzelle über die Synapsen erhält, erreichen den Zellkörper als chemische Ströme, die hier gesammelt, verrechnet und modifiziert werden. Nur wenn das elektrische Potential, das sich durch den Input in der Nachfolgezelle entwickelt, hoch genug ist, leitet die Zelle den Impuls über ihr Axon weiter. Am Endpunkt des Axons sitzen die Synapsen, in welchen der elektrische Impuls in einen chemischen Impuls umgewandelt wird. Es kommt zur Ausschüttung von Botenstoffen (Neurotransmittern), die den synaptischen Spalt durchwandern und auf der anderen Seite auf Rezeptoren stoßen, die passgenau geeignet sind, diese Botenstoffe aufzunehmen. Dadurch wird die nachfolgende Zelle für einen Einstrom von Ionen aus der Zellumgebung geöffnet, die in ihr eine neue elektrische Ladung auslösen. Das bedeutet, dass die Impulse in einer Zelle durch die Synapse mittels Enzymen und Botenstoffen zu sehr spezifischen Signalen verändert werden können. Die Synapse bestimmt dadurch sehr genau, welche Impulse durchgelassen werden und welche nicht. Wenn diese Signalübertragung auf Dauer chemisch-molekular verändert wird (Synapsenmodifikation), spricht man von Gedächtnis. Je häufiger solch spezifische Impulse von einer Die Übertragung von Impulsen der Out-putneuronen erfolgt über die Synapsen. Das sind Schaltstellen an den Endpunkten der Nervenfasern. Die Outputneuronen geben Impulse auf chemischem Wege mithilfe von Neurotransmittern weiter. Die Inputzelle wird durch die Neurotransmitter durchlässig für Ionen aus der Zellumgebung, die in ihr ein elektrisches Potential auslösen. Gedächtnis entsteht durch Synapsenmodifikation, vor allem Synapse gesendet werden, desto stärker wird die Verbindung und desto schneller wird ein elektrisches Potential ausgelöst und weitergegeben. Die Stärke der synaptischen Verbindung entscheidet also darüber, ob die folgende Zelle aktiviert wird oder nicht. Über die Synapsenstärke repräsentiert ein Neuron einen bestimmten Inhalt, z. B. den Impuls für eine bestimmte Reaktion. Es feuert nur, wenn es durch ausreichend Neurotransmitter aktiviert wird. durch Veränderungen in der Synapsenstärke. Vgl.: Spitzer, Manfred: Lernen.- Heidelberg u. Berlin: Spektrum, korrigierter Nachdruck 2003, 41 – 44 http://www.umm.uni-heidelberg.de/studium/tdl%20Programmheft.pdf (Baden-Württemberg: Tag der Lehre 2010, S. 6 f., Henning Scheich: Hirnbiologische Grundlagen optimalen Lernens) 2.3 Neuronale Netze Nervenzellen im Gehirn kann man sich als Informationseinheiten vorstellen, die entweder aktiv sind (1) oder nicht (0). Neuronen sind durch ausgedehnte Netzwerke miteinander verbunden. Jedes einzelne Neuron steht mit vielen anderen Neuronen in Verbindung, die alle gleichzeitig Impulse erhalten, wenn das eine Neuron feuert. Man nennt dies Parallelverarbeitung. In komplexen Mustern sind die Neuronen aktiv bzw. ruhen sie. Durch die Parallelverarbeitung erfolgt das Erkennen von Sachverhalten sehr schnell, gleichgültig, wie viele Neuronen beteiligt sind. Die Entwicklung des Gehirns besteht in den Veränderungen dieser Vernetzung. Beim Lernen wird das bereits vorhandene Netzwerk aktiviert und es bilden sich zunächst flüchtige Strukturen. (Arbeitsgedächtnis) Je häufiger eine Verbindung benutzt wird, desto dicker werden die Verbindungsfasern, was einen Zuwachs an Übertragungsschnelligkeit, Synapsenstärke und Stabilität bedeutet. Häufig genutzte Verbindungsfasern überzieht das Gehirn im Laufe der Zeit mit Myelinfasern um eine ungestörte Signalübertragung zu gewährleisten. Diese schützende Faserhülle führt zu einer weiteren Stabilisierung von Gedächtnisinhalten – aber auch zu ihrer weitgehenden Unveränderbarkeit. Das erklärt, weshalb in der Kindheit Gelerntes so besonders gut und sicher erinnert werden kann. Die Umbauprozesse in der Kindheit sind massiv und sie werden effektiv gespeichert. Später erworbene Nervenbahnen sind weniger gut myelinisiert. Die Gedächtnisinhalte, die durch sie repräsentiert werden, können daher leichter verändert und auch leichter vergessen werden. Allerdings erfolgt der Umbau im Erwachsenengehirn sehr viel langsamer. Er führt zu einer Ausdifferenzierung der in der Kindheit gelegten Grundlagen. Das Gehirn verarbeitet ungeheure Mengen an Informationen. Es kann dies leisten, weil die Neuronen vor allem hochgradig unter sich selber vernetzt sind. Nur eine von 10 Millionen Fasern ist mit Neuronen arbeiten „digital“. Sie sind entweder aktiv oder nicht. Ihr hohes Arbeitstempo erreichen sie durch Parallelverarbeitung. Eine dauerhafte Verankerung neuer Inhalte im Gedächtnis erfolgt durch wiederholte Aktivierung der Nervenbahnen. Durch die Myelinisierung der Nervenfasern werden Gedächtnisinhalte festgeschrieben. Wegen der hochgradigen internen Vernetzung ist unser Gehirn im der Außenwelt verbunden (Sinnesorgane, Muskeln). Alle anderen verbinden das Gehirn mit sich selbst! Infolge dessen ist das Gehirn, wenn wir reagieren, auch im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt. Der Effekt der von außen eingelassenen Erregungen ist verschwindend klein gegenüber dem internen Geschehen. Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt. (vgl. Roth, 2001, S. 214) 2.4 Karten im Gehirn Das Gehirn bildet seine Regeln selbst: Die Repräsentationen von Sachverhalten sind im Gehirn kartenförmig angeordnet und zwar erfolgt die Vernetzung der Neuronen nach den Prinzipien der Häufigkeit und Ähnlichkeit. Wenn also ein bestimmter Input weitergegeben wird, erreicht dieser nicht nur ein Neuron sondern auch die in der Umgebung. Sie alle reagieren auf ähnliche Signale und antworten deshalb auf diesen Input. Weiter entfernt liegende Neuronen dagegen werden gehemmt. (Centersurround-Prinzip). So kommt es, dass z. B. im visuellen Kortex benachbarte Zellen alle auf einen ähnlichen Typ von Farben oder Linien reagieren. Das Prinzip der Häufigkeit setzt sich im Sprachzentrum durch, wenn die Repräsentationen gegensätzlicher Wörter (Zucker – süß – sauer – Zitrone) plötzlich nahe beieinander auftauchen. Die Gegensatzbildung ist ein häufiges Mittel, um Adjektive voneinander abzugrenzen. Je häufiger eine Repräsentation aufgerufen wird, desto ausgedehnter ist das Areal, das sie im Gehirn einnimmt. So wächst z. B. das Areal für die Hände und für Töne, wenn jemand das Gitarrespiel erlernt. Die Karten auf der untersten Ebene (primäre Karten) projizieren über Nervenbahnen zu Karten in teilweise entfernten Hirnbereichen (sekundäre und tertiäre Karten), die höhere Inhalte (Verknüpfungen) repräsentieren. Die Grundprinzipien für die Strukturierung von Karten im Gehirn sind lt. Manfred Spitzer: • die Plastizität der Synapsen • die hohe Konnektivität des Gehirns und • die Ordnung nach Ähnlichkeit und Häufigkeit. Karten im Gehirn entstehen nach den Prinzipien der Ähnlichkeit, der Häufigkeit der Plastizität und der Konnektivität (siehe: Spitzer, Manfred: Lernen. – Heidelberg u. Berlin: Spektrum 2003, S. 102 ff.) Da diese vier Prinzipien für alle „Karten“ im Gehirn gelten, sind sie strukturell analog zueinander ausgebildet, gleich welcher ProjekDie Karten im tionsebene sie zuzuordnen sind. Man spricht deshalb auch von der Gehirn sind selbstähnlich. Selbstähnlichkeit der Strukturen im Kortex. Mit anderen Worten: Einmal geknüpfte Verbindungen entwickeln sich schrittweise zu Mustern und Strukturen. Diese „Schaltstrukturen“ reagieren immer dann, wenn sie in strukturähnlichen Situationen aktiviert werden. Das heißt, unser Gehirn konstruiert aktiv „Hypothesen“, wie in einer Situation mit dieser oder jener Struktur zu verfahren ist. Wir nehmen die Situation also nicht mehr so wahr wie sie ist, sondern wir reagieren nach der Maßgabe unserer Unser Gehirn arbeitet selbstreferentiell: Die Neuronen im Gehirn sind in intrakortikalen Verknüpfungen! Wir erleben die Welt also gemäß unserer Vorstellungen und halten diese unsere Vorstellungen für real – denn eine Alternative haben wir nicht. In der Hirnforschung wird von selbstreferentieller Wahrnehmung gesprochen und gemeint ist damit, dass wir immer gemäß unserer eigenen Struktur reagieren. hohem Grade mit sich selbst vernetzt und reagieren gemäß ihrer eigenen Struktur. (vgl.: Maturana, 2001, S. 18f., Singer, 2002, S. 72/S. 80/S. 92) 3. Der Einfluss der Emotionen Emotionen spielen beim Lernen eine wichtige Rolle. Sie entstehen in tiefliegenden Hirnstrukturen, in dem sog. limbischen System. Je nachdem, wie eine Situation bewertet wird, werden unterschiedliche Regionen des limbischen Systems aktiviert und es kommt zu sehr schnellen emotionalen Reaktionen, lange bevor es uns bewusst wird, woher dieses „Gefühl im Bauch“ kommt. Wir stellen uns auf Extremsituationen also sehr rasch ein. Manfred Spitzer schreibt: „Was den Menschen umtreibt, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschichten und vor allem andere Menschen“. (Spitzer 2003, S.160) Was wir lernen, verbinden wir mit der Situation, in der wir es lernen und hier wiederum speziell mit den Emotionen, die in dieser Situation vorherrschten. Sie bestimmen, ob wir einen Lerngegenstand als so bedeutsam erkennen, dass wir uns mit ihm lernend beschäftigen. Wenn wir die Lernsituation als unangenehm empfinden, stehen wir unter Stress. Negativ empfinden wir eine Situation besonders dann, wenn wir sie nicht kontrollieren können und alles über uns ergehen lassen müssen. Bekanntlich ist Stress einem schnellen Lernen förderlich. Aber nur für begrenzte Zeit. Hält der negativ empfundene Stress an, führt dies zur Ausschüttung von Hormonen, die zum Zelluntergang im Hippokampus führen können. Ohne den Hippokampus aber können wir nichts Neues lernen und behalten. Ein Mensch, der dem Lernen negativ gegenübersteht, der sich vor dem Lernen (vor der Schule) fürchtet, kann also nicht lernen! Auch gilt es zu bedenken, dass Gedächtnisinhalte, die mit Angst gelernt werden (z. B. im Fach Mathematik) diese unangenehme Emotion sofort aktualisieren, sobald nur ein Teilinhalt des Gelernten abgerufen wird. Es kommt zu einer Stressvermeidungsreaktion, welche eine Lernblockade hervorruft. Die räumliche Anordnung der entsprechenden Hirnregionen spiegelt diese Erfahrungen wider, denn direkt neben dem Hippocampus, der für die Bildung des Langzeitgedächtnisses eine wichtige Rolle spielt, befindet sich die Amygdala (Mandelkern), welche unsere Erlebnisse emotional bewertet. Im limbischen System werden Situationen emotional eingefärbt. Emotionen werden immer mitgelernt. Dauerstress führt zum Zelluntergang im Hippokampus und macht das Lernen zunehmend unmöglich. Begleiten negative Emotionen die Verankerung von Gedächtnisinhalten, werden sie bei deren Aktualisierung ebenfalls aktiviert. (Lernblockade) Gehirnregionen für Gedächtnisbildung und Emotionen sind eng benachbart. Lernen wir hingegen mit positiven Emotionen, ausgelöst durch das Positive Emotionen Gefühl, selbst steuernd eingreifen und den eigenen Erfolg voran beim Lernen treiben zu können, ist der Lerneffekt sehr zufriedenstellend. Solch positive Emotionen werden besonders dann entwickelt, wenn der Lernende eine Verbindung der zu lernenden Dinge zur eigenen Lebenswelt erkennt. Dies erzeugt innere Anteilnahme und die „Spannung des Dabei-Seins“ (Spitzer, 2003, S. 160). Die frühe Erfahrung der Selbstwirksamkeit ist deshalb für die Entwicklung von Lernbereitschaft eine zentrale Erfahrung. Diese Grundeinstimmung der Persönlichkeit ist eine Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. entstehen durch Selbststeuerung und damit verbundene Erfolgserlebnisse. Das Erleben von Selbstwirksamkeit wird zu einem zentralen Lern- und Handlungsantrieb. Diese kurze Einlassung zur emotionalen Steuerung des Lernens zeigt uns erneut: Wir erleben das, was wir schon kennen und das, was wir ertragen können! Wirklichkeit ist etwas, was in uns entsteht. Wenn wir Stress erleben, ist dies „... eine Frage der Bewertung und der Dosis.“ (Spitzer, 2003, S. 173) Stress entsteht im Kopf. Dazu stellt Gerald Hüther fest, dass das Gehirn „... nicht in erster Linie als Denk- sondern als Sozialorgan gebraucht und entsprechend strukturiert wird“. (Hüther, G.: Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturierung des menschlichen Gehirns.in: Herrmann, U.: Neurodidaktik. – Weinheim und Basel 2006, S. 47) Von Geburt an lernt der Mensch in sozialen Verbänden (Familie, Sippe, Freunde... ) durch Prozesse der Erziehung und Sozialisation. Keine kulturspezifische Leistung ist angeboren. Wir erlernen sie vielmehr durch die aktive Einflussnahme anderer Menschen. Das Stirnhirn (der präfrontale Kortex) ist die Gehirnregion, welche die Steuerungsfunktion all dieser Lernprozesse übernimmt und die als letzte ausreift. Ohne Frontalhirn wäre eine Handlungsplanung und Handlungsfolgen-Abschätzung nicht möglich, Empathie und Verantwortungsgefühl würden uns fehlen. Die Ausreifung des neuronalen Korrelates zu diesen Verhaltens- und Charakteraspekten kann nur durch die ständige zielführende Auseinandersetzung mit erwachsenen Vorbildern erfolgen, die das Kind entsprechend anleiten. Die Grundlage der Entwicklungs-, Erziehungs- und Sozialisierungsprozesse ist Sicherheit und Vertrauen. Nur dann kann der Mensch lernen. Kinder brauchen klare, offene und starke Bezugspersonen als Vorbilder um Selbstwirksamkeit und ein Sinnverständnis zu entwickeln. Die Herausbildung komplexer Verschaltungen im Gehirn – und damit die Entstehung von Sozialkompetenz und Interesse an der Welt – wird verhindert, wenn Kinder erleben, • dass Wissen und Bildung nicht geschätzt werden, • dass sie passiv bleiben müssen, • dass sie funktionalisiert werden, • dass sie überlastet, verwöhnt oder vernachlässigt werden. • Hüther fordert, dass die Erziehenden gestärkt werden müssen, diesen Tendenzen entgegenzuwirken. Ihre Verunsicherung behindert die Entwicklung der sozialen Kompetenzen bei den Kindern. (siehe: a. a. O., S. 41 ff. Das Gehirn ist in erster Linie ein Sozialorgan. Der präfrontale Kortex übernimmt die Steuerung von Teilfertigkeiten der Sozialkompetenz. Das Gehirn entwickelt sich nur gesund in einer Atmosphäre der Sicherheit und des Vertrauens. Die Erziehenden brauchen gesellschaftlichen Rückhalt. 4. Formen des Lernens Wir unterscheiden das deklarative und das prozedurale Lernen. Auf deklarativem Wege erwerben wir Wissen. Dafür benutzen wir in der Regel die Sprache. Das prozedurale Lernen erfolgt handelnd. (Gehen, schwimmen etc.) Deklaratives Wissen führt nicht zur Beherrschung prozeduraler Prozesse. Wer z. B. ein Buch über das Reiten gelesen hat, kann es deswegen noch nicht. Wohl aber hilft die Überführung prozeduralen Wissens in deklaratives zu einem besseren Verstehen dessen was man tut. (Wer bereits reiten kann, der kann seine Fähigkeit durch deklaratives Wissen verbessern). Wir unterscheiden deklaratives Lernen vom prozeduralen Lernen, Explizites und implizites Lernen unterscheiden sich insofern, als das explizite Lernen bewusst erfolgt und beim Belehrten Lerntätig- explizites vom keit fordert. Kinder, besonders Kleinkinder, lernen sehr rasch, wobei festzustellen ist, dass die meisten Kinder das explizite Lernen als mühsam ablehnen. Was sie explizit lernen (müssen), ist oft impliziten Lernen. auch nicht sehr nachhaltig (Phänomen des schulischen Lernens). Die Bahnung von Schaltstrukturen und die Ausbildung von Karten im Gehirn (s. o.) erfolgt in der Regel durch implizites Lernen. Während sich der Lernende mit einer Sache beschäftigt, extrahiert sich das Gehirn die Regelhaftigkeiten der Lernsituation selbsttätig. Das Gehirn lernt immer, es kann gar nicht anders. – Aber nur das, was es für sinnvoll hält ... Das können ganz andere Dinge sein als die, welche vielleicht gleichzeitig explizit gelernt werden sollen! So kann ein Spielfilm, der in einem entfernten Land spielt, zu implizitem Wissenserwerb über dieses Land führen. Dieses Wissen ist oft dann noch vorhanden, wenn die Handlung des Films längst vergessen wurde. Implizit wird auch der sog. „heimliche Lehrplan“ der Schule gelernt und in Verhaltensweisen transferiert. Wenn also Kinder schlecht vorbereitete, desinteressierte Lehrer erleben, lernt das Gehirn, dass das, was diese Lehrer zu bieten haben, uninteressant und unwichtig ist – und es beschäftigt sich anders! Eine hirnphysiologische Tatsache ist mittlerweile das Lernen im Schlaf. Mithilfe von Nervenableitungen in Tierexperimenten konnte man beweisen, dass das Wechselspiel von Tiefschlaf und Traumschlaf der Festigung von Lerninhalten des vorausgehenden Tages dient. Aus dem flüchtigen Speicher des Hippokampus (kurz- und mittelfristiges Gedächtnis) werden wiederholt Signalsequenzen an den Kortex (Großhirn) gegeben, die dort zum Synapsenwachstum und zur Veränderung von Synapsenstärken führen. Spitzer spricht in Analogie zum Internet von einer „Off-line-Verarbeitung“ neu gelernter Inhalte (a.a.O., S. 133). Schlafhygiene ist deshalb ein wichtiger Faktor für ein nachhaltiges Lernen. Das Gehirn lernt nur das, was es für sinnvoll hält. Implizit Gelerntes wird in der Regel nachhaltiger verankert als explizit erlernte Inhalte. In den Phasen des Traumschlafes werden Tagesreste vom Hippokampus in den Kortex signalisiert, was nachhaltiges Lernen auslöst. Wir lernen im Schlaf! 5. Aufmerksamkeit als Voraussetzung des Lernens Aufmerksamkeit existiert auf zwei Ebenen: Sie ist zunächst einmal eine allgemeine Wachheit (Vigilanz) und zum anderen eine zusätzliche selektive Aktivierung von Gehirntätigkeiten, wenn wir uns einem bestimmten Gegenstand zuwenden. Diese zusätzliche Aktivierung von Gehirnarealen spielt bei Gedächtnisprozessen die entscheidende Rolle. Diese Einsicht ist trivial aber für Lehrende schwer umzusetzen, denn für die willentliche Ausrichtung der Aufmerksamkeit der Lernenden bedarf es der Motivation und emotionaler Zuwendung zu Lernstoff. Wir unterscheiden die Vigilanz von der selektiven Aufmerksamkeit. Selektive Aufmerksamkeit ist abhängig von Motivation und Emotion. 6. Motivation (Bildquelle:übernommen am 30.9. 2008: http://images.google.de/imgres?imgurl=http://home.arcor.de/eberhard.liss/hirnforschung/RothBild1.jpg&imgrefurl=http://home.arcor.de/eberhard.liss/hirnforschung/rothgehirn%2Bseele.htm&h=502&w=530&sz=42&hl=de&start=1&usg=__sk9Y3q8wm1LxWqlQTFtETlpT _yQ=&tbnid=Ocaqnk5IZD9tM:&tbnh=125&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dventrales%2BTegmentum%26gbv%3D2%2 6hl%3Dde ) Ob Motivation entsteht und erhalten bleibt, hängt ab von einem hirneigenen Belohnungssystem: Zwei kleine Bereiche tief im Innern des Gehirns (limbisches System), das ventrale Tegmentum und der Nucleus accumbens, setzen den chemischen Botenstoff Dopamin frei und projizieren über Nervenbahnen bis in das Stirnhirn (frontaler Kortex). Angetrieben vom Tegmentum signalisiert der Nucleus accumbens dem frontalen Kortex und anderen Hirnteilen auf diese Weise: „Das macht Spaß!“ Gleichzeitig schüttet der Nucleus accumbens hirneigene Opiate aus, die zusätzliche Lustgefühle erzeugen und eine Wiederholung der angenehmen Erfahrung wünschenswert erscheinen lassen. Das Dopaminsystem scheint besonders dann zu feuern, wenn etwas geschieht, das besser ist als erwartet. Es sind also auch Formen der Bewertung mit im Spiel und wir müssen uns fragen, Das ventrale Tegmentum und der Nucleus accumbens erzeugen über ihr Dopaminsystem Lustgefühle und damit die Motivation zur Wiederholung der lustvollen Erfahrung. Das motivierende Dopaminfeuerwerk wird durch die was wir so positiv bewerten, dass es das Dopaminsystem auslöst. Ist es das Lob des Lehrers, sind es gute Noten, ist es das Interesse am Lernstoff oder das Gefühl (Lern-)Erfolg zu haben? Wünschenswert ist Letzteres, denn nur dann ist nachhaltiges Lernen zu erwarten. Die primäre Motivation, das Interesse am Lerngegenstand ist es also, welche geweckt werden müssen. Das erreicht man weder durch Notendruck oder Drohungen noch mit ablenkenden medialen Spielereien. Spitzer schreibt: „...ein vom Fach begeisterter Lehrer, der gelegentlich lobt und vielleicht auch mal einen netten Blick für die Schüler übrig hat, bringt deren Belohnungssystem auf Trab.“ (2003, a. a. O., S. 194) Vielleicht sollten Lehrer öfter daran denken, so schwer kann es doch nicht sein! positive Bewertung einer Situation ausgelöst, die sich besser gestaltet als erwartet. Durch die eigene Begeisterung am Fach und am Lernen der Schüler können Lehrer am besten nachhaltiges fachliches Lernen bewirken. Diese Aussage bedeutet auch, dass die Beziehung zwischen Lehrer und Schülern eine tragende Rolle beim Lernen spielt. Die Schüler wollen vom Lehrer gesehen und anerkannt werden in ihrem Bemühen. (emotionale Komponente des Lernens, s. o.) Wir sollen darüber jedoch nicht vergessen: Auch für Lehrer gilt, Nur zufriedene und was über Angst und Lust beim Lernen (und Lehren) geschrieben stressfreie Lehrer wird. Die psychosomatischen Klinikbetten Deutschlands werden können motivieren. vor allem von Lehrern belegt, die böse, zynisch, verängstigt, depressiv oder suchtkrank dort landen! Es wird Zeit, auch über die Bedingungen nachzudenken, welche in der Lage sind, die Berufszufriedenheit und damit die seelische Gesundheit von Lehrern zu erhalten. Auch Lehrer lernen am intensivsten implizit! Auch sie wollen gesehen und anerkannt werden in ihrer Arbeit mit den Kindern. Auch sie müssen Selbstwirksamkeit entwickeln, um ihr eigenes Dopaminsystem nutzen zu können. 7. Das Gedächtnis Brand und Markowitsch beschreiben den Weg eines Inhaltes von der Außenwelt in das Langzeitgedächtnis in Kurzform so: • • • • Entscheidung über die Bedeutsamkeit eines Reizes im Ultrakurzzeitgedächtnis. Bedeutsame Reize landen im Kurzzeitgedächtnis und werden dort zunächst für wenige Minuten eingespeichert. Werden Einspeicherungshilfen zu den bedeutsamen Reizen gegeben, werden diese Gedächtnisinhalte im Kurzzeitgedächtnis konsolidiert, Und bei großer Wichtigkeit, speziellem Interesse oder häufiger Wiederholung im Langzeitgedächtnis abgelagert. Man sieht: Gedächtnisbildung geschieht nicht automatisch. Sie ist vielmehr ein aktiver Prozess! • Werden Gedächtnisinhalte wieder abgerufen, führt dies grundsätzlich zu einer erneuten und durch die Umstände modifizierten Einspeicherung. Man nennt diesen Vorgang Stufen der Gedächtnisbildung: Ausfiltern Einspeichern Konsolidieren Ablagern Rekonsolidieren Rekonsolidierung. Beim Abruf unterscheidet man mit absteigendem Anforderungsniveau • den „Freien Abruf“ (ohne Hilfen), • den Abruf mit Hinweisreizen (verbal oder visuell) und den • Abruf durch Rekognition (Wiedererkennen). Brand und Markowitsch betonen die hierarchische und gleichzeitig modulare Struktur des Gedächtnisses. Die modulare Struktur bedingt es, dass ganz besonders die Inhalte gut behalten werden, die viele Gedächtnismodule auf unterschiedlichen Stufen ansprechen, z. B. durch Lernen auf verschiedenen Eingangskanälen, durch die Aktivierung des Vorwissens und durch die motivierende Gestaltung der Lernsituation und der Lernumgebung. Das Gedächtnis hat nach Brand und Markowitsch folgende Ebenen: Gedächtnisebenen: Episodisches G. a) Das episodische Gedächtnis: Höchste Gedächtnisstufe, Speicherung der Autobiographie, klarer Raum- Zeit- und Situationsbezug, starke emotionale Bewertung b) Das semantische Gedächtnis: Fakten des allgemeinen Weltgeschehens, Schulwissen c) Das perzeptuelle Gedächtnis: Vertrautheits- oder Bekanntheitsgefühl bei Personen, Objekten, Tönen. Präsemantisch d) Priming: Bessere Wiedererkennungsleistung von zuvor unbewusst Wahrgenommenem e) Das prozedurale Gedächtnis: Motorische Fähigkeiten und Routinehandlungen (schwimmen, Zähne putzen etc.) Semantisches G. Perzeptuelles G. Priming Prozedurales G. (siehe: Matthias Brand/Hans. J. Markowitsch: Lernen und Gedächtnis aus neurowissenschaftlicher Perspektive. – in: U. Herrmann: Neurodidaktik. – Weinheim und Basel 2006, S. 60 ff.) 8. Sieben Bausteine moderner Didaktik Schlussfolgernd aus den Erkenntnissen der Hirnforschung formuliert Franz Mechsner im Heft 11/Nov. 2004, Artikel: „Die Lust am Wissen“, S. 167 ff, folgende didaktischen Grundsätze: 8.1 Entdeckendes Lernen „Entdeckendes Lernen bedeutet, dass Schüler sich selbstständiges Fragen und Denken angewöhnen, dass sie Verantwortung für ihre Lernprozesse übernehmen und sich als erfolgreiche, manchmal gar als kreative Forscher erleben. Als Folge sind die Wissensnetze, die sie knüpfen, solider und dauerhafter.“ (S.173) Zu den Bausteinen moderner Didaktik gehören: entdeckendes Lernen, 8.2 Fehlerfreundlichkeit „Wir können nicht lernen, wenn wir keine Fehler machen dürfen. In den meisten Fehlern steckt eine geistige Leistung, oft eine wichtige FehlerfreundlichStufe auf dem Weg zu einer richtigen oder gar originellen Lösung. keit (S. 178) 8.3 Lernen im eigenen Tempo „... das Lernen im Standardtakt zerstört Neugier und Tatendrang, unterfordert einen Teil der Schüler und überfordert den anderen, stets die Differenz und die Konkurrenz betonend. Offene und kooperative Unterrichtsformen ermöglichen es, dass Kinder ihrem Lernstand entsprechend arbeiten. (S. 180) 8.4 Lernen lernen „Moderne Schule lehrt aber auch, Ergebnisse allein und im Team zu erarbeiten und zu präsentieren. ... dabei überzeugend, fair und konstruktiv zu argumentieren.“ (S. 182) 8.5 Verbale Zeugnisse „Reformer setzen auf Wortzeugnisse. (...) Berichte haben den pädagogischen Vorteil, Leistungen weit differenz8erter beschreiben und Hinweise geben zu können, wie sich Defizite ausgleichen lassen. Den Vorwurf, Wortzeugnisse seien im Unterschied zu Noten leistungshemmend, haben Bildungsforscher mittlerweile in mehreren Studien widerlegt.“ (S. 185) 8.6 Authentische, begeisterte Lehrer Kinder brauchen den Lehrer als Bezugsperson, der ihnen zeigt, dass er sich für sie interessiert und sich über ihren Lernfortschritt freut. Gleichzeitig sollte die Lehrperson ihre Unterrichtsthemen begeistert und begeisternd anbieten. 8.7 Selbstverantwortung und demokratische Strukturen Die Arbeit in Gruppen, gegenseitiges Lehren und die Möglichkeit der Mitgestaltung der Lernprozesse fördern in hohem Maße die Konsolidierung und Vernetzung des Gelernten. Lernen im eigenen Tempo, das Lernen lernen durch selbsttätiges Lernen, verbale Zeugnisse Aufmerksame, zugewandte Lehrpersonen Eigenverantwortliches Lernen und Demokratie 9. Lesen als Beispiel des selbstorganisierenden Lernens 9.1 Was ist Lesen? Lesen ist seitens des Lesers ein aktiver Prozess der Sinnfindung. Goodman spricht vom Lesen als einem „hypothesenbildenden Prozess“, in dessen Verlauf der geübte Leser immer neue Denkansätze hervorbringt, verifiziert und modifiziert. 1977 publizierte G. Scheerer-Neumann ein Modell des Prozesses beim Lesen im Satzzusammenhang: Lesen wird definiert als komplexer und aktiver Prozess der Sinnfindung Hypothese Kontext Visuelle Analyse globaler Merkmale Wort visuelle Detailanalyse Segmentierung phonetische Kodierung Artikulatorisches Programm Lesen ist ein interaktiver Prozess der Sinnfindung und führt zur Integrationsleistung des Textverständnisses. semantische Kodierung (Scheerer-Neumann: „Modell des Prozesses beim Lesen eines Wortes im Satzzusammenhang“. – bei: Niemeyer W.: Fördernder Leseunterricht. – Stuttgart 1981, S. 17) 9.2. Die kognitive Konstruktivität des Leseprozesses Die vereinfachte Skizze lässt uns bereits die Komplexität der geistig-seelischen Abläufe beim Lesen erahnen. Uns wird verständlich, dass die Leseleistung nicht allein durch lesetechnische Vorgänge beeinflusst wird, sondern dass auch das Allgemeinwissen und –befinden, das Welt- und Wertebild und soziale Aspekte Einfluss darauf nehmen, wie ein Kind lesen lernt und welches Textverständnis Leser entwickeln. Der modernen Leseforschung liegt heute allgemein die Annahme zu Grunde, dass Lesen mehr ist als ein rezeptiver Prozess, dass vielmehr beim Lesen immer eine Text-Leser-Interaktion stattfindet. Hörmann schreibt dazu bereits 1980: „Wir erfassen im Vorgang des Verstehens nicht nur Information, Der Leseprozess ist wir schaffen auch Information, nämlich jene Information, die wir konstruktiv. brauchen, um die Äußerung in einen sinnvollen Zusammenhang stellen zu können.“ Textverständnis ist also eine aktive integrative Leistung, die jeder Leser als Ergebnis des Leseprozesses vollbringt. Man bezeichnet diese Leistung als kognitive Konstruktivität des Leseprozesses. (Hörmann nach U. Christmann / N. Groeben: Psychologie des Lesens. – in: Handbuch Lesen. – Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren 2001, S. 146) Christmann/Groeben beschreiben deshalb das Lesen als Zusammenwirken aufsteigender und absteigender Prozesse. (s. o.) Bereits aus diesem kurzen Exkurs wird erkennbar, dass die moderne Auffassung des Lesens den Ergebnissen der Hirnforschung zum Lernen weitgehend entspricht. Analog gelten die o. g. didaktischen Grundsätze für das Erlernen dieser Kulturtechnik. Lesen wird durch auf- und absteigende Prozesse begleitet. 10. Mathematik Rechnen ist eine komplexe Fähigkeit, an der sich viele „Landkarten“ des Gehirns beteiligen. Mathematisches Können ist wie Textverständnis, das Musizieren und andere Fähigkeiten ein Ergebnis von Begabung und Übung. Besonders das freiwillige und durch die Sache motivierte Üben bringt uns weiter. Da Mathematik abstrakt ist, sollten Probleme der verschiedensten Art mathematisch behandelt werden. Die Vernetzung der zu lernenden Inhalte ist also von größter Bedeutung – und es spricht deshalb Vieles dafür, mathematisches Denken genau wie rechtschreibliches Denken oder das Lesen integrativ in möglichst jeder Unterrichtseinheit herauszufordern. Viele Fakten lassen sich mathematisch interpretieren oder werden erst durch mathematischen Umgang verständlich. In der Schule sollte ein Grundverständnis erworben werden, wie mit solchen Fakten umzugehen ist. Rechnen ist eine komplexe Fähigkeit, die auf vernetzten Strukturen beruht. Sie wird vor allem durch Üben erworben. Nur Übung an verschiedensten Aufgaben und Sachgebieten kann die notwendige Transferleistung hervorrufen. 11. Zeitfenster für das Lernen Immer wieder wird behauptet, dass bestimmte Fertigkeiten, wie das Erlernen von Sprache oder des Gehens nur innerhalb eines gewissen Entwicklungszeitraumes möglich seien. Würden dann die entsprechenden Nervenzellen des Gehirns nicht angeregt, folge ein irreversibler Abbau und damit die Unfähigkeit zu gehen bzw. zu sprechen. Die Regel für diesen Mechanismus wird in den USA als „use it or loose it“ beschrieben. Dem widerspricht die Erfahrung, dass ein lebenslanges Lernen möglich ist und dass nach Unfällen mit Verletzungen des Gehirns zunächst verlorene Fertigkeiten wiederkehren können. In diesem Zusammenhang spricht man von der Plastizität des Gehirns. Gibt es Zeitfenster für das Erlernen bestimmter Fertigkeiten? Neuere Forschungen machen für beide Auffassungen die „weiße Substanz“ unseres Gehirns verantwortlich. Darunter versteht man den fetthaltigen, weißlich erscheinenden Mantel, die Myelinscheide, in welchen die Axone der Nervenfasern gehüllt sind. (vgl. 2.3 – neuronale Netze) Die weiße Substanz spielt eine entscheidende Rolle beim Lernen. (Quelle: http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.tgschemie.de/nerven4.gif&imgrefurl=http://www.tgschemie.de/nervensystem.htm&h=343&w=539&sz=7&hl=de&start=11&usg=__9SZCJng0ZKHuldON_ jQTugNWyn4=&tbnid=0ZTw2AfddNVTRM:&tbnh=84&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dwei%25C3 %259Fe%2BSubstanz%26gbv%3D2%26hl%3Dde (28.10.2008) Die „use it or loose it“ – Regel widerspricht der Erfahrung von der Plastizität des Gehirns. Ungefähr in Millimeterabständen weist diese Myelinscheide eine kleine Lücke auf, den Ranvier-Schnürring. Die Myelinisierung der Axone unterscheidet sich a) in der Dicke der Myelinschicht und b) bezüglich der Abstände der Ranvier-Schnürringe. Diese Unterschiede haben funktionale Folgen: a) Je dicker die Myelinschicht ist, desto schneller wird ein Impuls durch das Axon weitergeleitet. b) Je höher die Dichte von Ranvier-Schnürringen auf einem Axon ist, desto langsamer erfolgt die Weiterleitung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt nimmt man an, dass die RanvierSchnürringe einen bremsenden Effekt haben. Man folgert daraus, dass diese Unterschiede dazu dienen, die Leitungsgeschwindigkeiten aufeinander abzustimmen, wenn es darum geht, bestimmten Nervennetzen ein starkes Gesamtsignal zu vermitteln. Wenn ein Signal einen langen Weg hat, muss die Übertragung schneller gehen, damit es gleichzeitig mit einem Signal ankommt, welches nur eine kurze Strecke zurücklegen muss, so dass hier durch eine erhöhte Anzahl von Ranvier-Schnürringen und evtl. durch eine dünnere Myelinschicht das Tempo des Signals verringert wird. Die Dicke der Myelinschicht und die Dichte der Ranvier-Schnürringe beeinflusst das Tempo der Signalübertragung. Das dient der Abstimmung der Leitungsgeschwindigkeiten. Eine Signalübertragung, die ungleichzeitig an das Übertragungsziel übermittelt wird, beeinträchtigt geistige Leistungen. So funktioniert beispielsweise bei Legasthenie die zeitliche Abstimmung nicht, mit welcher die Prozesse beim Lesen ineinandergreifen müssen. Legasthenie ist z. B. ein Problem der ungenügenden zeitlichen Abstimmung der Prozesse beim Lesen. Mithilfe der Diffusionstensorbildgebung kann man den Organisationsgrad der myelinisierten Axone sichtbar machen. In besonderer Dichte findet sich die weiße Substanz im Balken (Corpus callosum), der die beiden Hirnhälften verbindet, (siehe Abbildung in Punkt 6) und im Basalband des Kortex (Gyrus cinguli). Insgesamt besteht fast die Hälfte unseres Gehirns aus weißer Substanz. Besonders dicht ist die weiße Substanz im Balken und im Basalband. Die Myelinmenge wird besonders von frühen Erfahrungen und Übungen beeinflusst. So hat man festgestellt, dass bei Berufspianisten, die das Klavierspielen früh erlernt und viel geübt hatten, eine verstärkte Myelinisierung der Nervenbahnen für Fingerbewegungen und für kognitive Prozesse beim Musizieren vorhanden „Früh übt sich, was sind. Da die Myelinisierung im Laufe des Lebens vom Stammhirn ein Meister werden (hinten) in Richtung Stirnhirn fortschreitet, vermutet man, dass die will“. entscheidenden Fertigkeiten im Kindesalter grundgelegt werden. Wenn die frühe Myelinisierung abgeschlossen ist, lernt das Gehirn zwar noch weiter, aber der Grad von Fähigkeiten und Fertigkeiten ist nicht mehr so hoch ausgeprägt. Das würde erklären, weshalb eine Fremdsprache, die nach der Pubertät erlernt wird, in vielen Fällen nicht mehr akzentfrei gesprochen werden kann. Auch kognitive Lernprozesse werden durch eine gute Myelinisierung positiv beeinflusst. Bei Kindern korreliert eine höher entwickelte weiße Substanz mit einem höheren Intelligenzquotienten! Es ist also nicht gleichgültig, wann die Myelinisierung von Nervenbahnen erfolgt. Es gibt Zeitfenster, in denen das Lernen leicht fällt. Diese gilt es zu nutzen, um ein dichtes Netz gut myelinisierter Nervenbahnen anzulegen. Dies ist besonders wichtig für komplexe Fertigkeiten, die langes Üben und die Zusammenarbeit mehrerer von einander entfernter Regionen des Großhirns erfordern. (vgl.: R. Douglas Fields: Die unterschätzte weiße Hirnmasse. – in: Spektrum der Wissenschaft, Heft 10/08, S. 40 ff.) Literatur: Bion, W.: Lernen durch Erfahrung. – Frankfurt 1990 Brügelmann, H. und Brinkmann,E.: Die Schrift erfinden. – Libelle 1998 Czerwanski, Annette, Solzbacher, Claudia und Vollstädt, Witlof (Hrsg.): Förderung von Lernkompetenz in der Schule. Bd. 1: Recherche und Empfehlungen. 2002, Bertelsmann Stiftung Dies.: Förderung von Lernkompetenz in der Schule. Bd. 2: Praxisbeispiele und Materialien. 2004, Bertelsmann Stiftung. 1 DVD (20 Min. Film) und 1 CD (Materialien und Text des Buches) Foerster, H.v.: Sicht und Einsicht. – Braunschweig 1985 Hentig, Hartmut von: Die Schule neu denken. Eine Einführung in pädagogischer Vernunft. Beltz 2003 Herrmann, Ulrich (Hrsg.): Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen. – WeinHeim und Basel: Beltz 2006 Markowitsch, H. J.: Dem Gedächtnis auf der Spur. Vom Erinnern und Vergessen. – Primus Verlag, 2002 Maturana, H.R. Was ist erkennen? Die Welt entsteht im Auge des Betrachters. – München 2001 Metzig, Werner und Schuster, Martin: Lernen zu lernen. Lernstrategien wirkungsvoll einsetzen. – Springer 2003 Oelkers, Jürgen: Wie man Schule entwickelt. Eine bildungspolitische Analyse nach PISA. 2003 Ratey, John J.: Das menschliche Gehirn. Eine Gebrauchsanweisung. – Piper 2003 Roth, G.: Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. – Frankfurt 2001 Scheunpflug, Annette: Biologische Grundlagen des Lernens. – Cornelsen Scriptor 2001 Singer, W.: Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung. Frankfurt 2002 Spitzer: Geist im Netz. Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Darmstadt 1996 Ders.: Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. – Das Einüben einer komplexen Fertigkeit in der Kindheit beeinflusst die allgemeine Intelligenz günstig. Heidelberg und Berlin 2003, korrigierter Nachdruck Struck, Peter: Die 15 Gebote des Lernens. Schule nach PISA. – Primus 2004 Vester, F.: Denken, Lernen, Vergessen. – Stuttgart und München 1978 ders.: Leitmotiv vernetztes Denken. – München 19955, . ders.: Unsere Welt – ein vernetztes System. München 19989, Watzlawick,P./Krieg,P. (Hrsg.): Das Auge des Betrachters. Beiträge zum Konstruktivismus. – München 1991 Internetadressen (Hier nur eine kleine Auswahl. Geben Sie das Stichwort „Neurodidaktik“ in eine Suchmaschine ein und Sie haben stundenlang Beschäftigung!) http://www.blickueberdenzaun.de/ http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-AEA7DDE51D77560C/bst/hs.xsl/336.htm Stand: 27. Jan. 2011