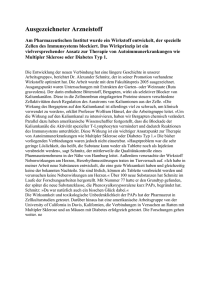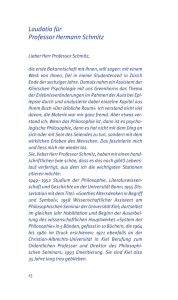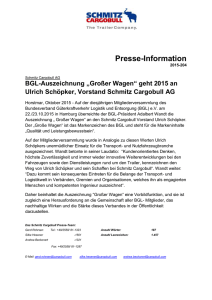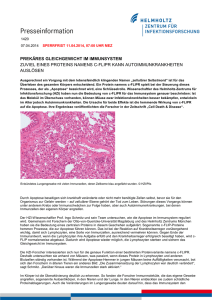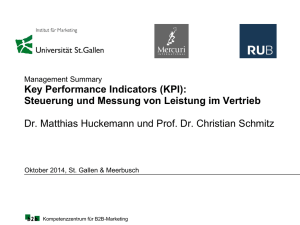Zwischen Unmittelbarkeit und Reflexion
Werbung

Friedrich-Schiller-Universität Jena Philosophische Fakultät Institut für Philosophie Zwischen Unmittelbarkeit und Reflexion Paradoxien des Selbstbewusstseins dargestellt anhand des Ansatzes von Hermann Schmitz Magisterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades MAGISTER ARTIUM (M.A.) vorgelegt von Sascha Pahl geboren am 28. Februar 1982 Erstgutachterin: Prof. Dr. Birgit Sandkaulen in Erlenbach am Main Zweitgutachter: Prof. Dr. Lambert Wiesing Jena, 15. Oktober 2008 Nicht nur zum Abschluss der Magisterarbeit, sondern auch am nahenden Ende des Studiums ist es Zeit für Danksagungen Allen voran danke ich meinen Eltern Doris und Burkard Pahl, die – in mehrfacher Hinsicht – all dies erst ermöglicht haben. Frau Prof. Dr. Birgit Sandkaulen danke ich für die Annahme der Arbeit, deren interessierte und intensive Betreuung sowie für ihr Engagement in der Lehre. In ihren Seminaren habe ich sehr viel gelernt. Herrn Prof. Dr. Lambert Wiesing danke ich für die Übernahme des Zweitgutachtens sowie die freundliche Einladung in sein Kolloquium. Herrn Prof. Dr. Hermann Schmitz danke ich für die umgehende, wohlwollende und aufschlussreiche Beantwortung der Fragen, die ich brieflich an ihn gerichtet habe. Zu guter Letzt danke ich den tapferen Korrekturlesenden: Allen voran gilt hier mein Dank Hendrikje Schauer, die sich intensiv durch den gesamten Text gearbeitet und durch ihre Genauigkeit und Insistenz der Struktur der Arbeit und meinem Denken wesentlich zu mehr Klarheit verholfen hat. Tobias Glöckner, Gustav Melichar und Marcel Müller haben sich die Zeit genommen, nahezu den kompletten Text inhaltsorientiert zu lesen. Respekt und Danke für die Hinweise! Schließlich haben sich zahlreiche Hilfsbereite teils sehr kurzfristig bereit erklärt, kleinere Abschnitte auf formale Fehler hin zu lesen. Ohne euch wäre ich nicht rechtzeitig fertig geworden: Tim Ackermann, Daniel Althof, Benjamin Bunk, René Büttner, Markus End, Karolin Freund, Lars Gertenbach, Gunter Heiss, Kenneth Hujer, Henning Laux, Christian Marxsen, Marieluise Otto, Markus Schwarzer, Sascha Seidel und Claudia Wirsing. Das Ich, das Ich ist das tief Geheimnisvolle! (Ludwig Wittgenstein, 5. 8. 1916) Ich bin. Aber ich habe mich nicht. (Ernst Bloch) Ja, wenn sie mir das sagen können, wer ich bin, da wäre ich ihnen vielen Dank schuldig. (Arthur Schopenhauer) Die Moral des Denkens besteht darin, weder stur noch souverän, weder blind noch leer, weder atomistisch noch konsequent zu verfahren. Die Forderung, gleichzeitig die Phänomene als solche sprechen zu lassen – das ‚reine Zusehen’ – und doch in jedem Augenblick ihre Beziehung auf das Bewußtsein als Subjekt, die Reflexion präsent zu halten, drückt die Moral am genauesten und in aller Tiefe des Widerspruchs aus. Vom Denkenden heute wird nicht weniger erwartet, als daß er in jedem Augenblick in den Sachen und außer den Sachen sein soll – der Gestus Münchhausens, der sich an dem Zopfe aus dem Sumpf zieht, wird zum Schema einer jeden Erkenntnis, die mehr sein will als entweder Feststellung oder Entwurf. Und dann kommen noch die angestellten Philosophen und machen uns zum Vorwurf, daß wir keinen festen Standpunkt hätten. (Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Aph. 92) Vorwort Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, was Selbstbewusstsein sei. Damit ist nicht das alltagssprachlich so bezeichnete Phänomen einer hohen oder geringen Meinung von sich gemeint, sondern die Tatsache, dass Menschen (und vielleicht auch andere Lebewesen) ein Bewusstsein nicht nur von Anderem, sondern auch von sich haben; sie wissen von sich oder sie sind »mit sich vertraut«. Dieses Phänomen – wir können es auch das »Ich-Phänomen« nennen – ist derart selbstverständlich und alltäglich, dass es kaum ausdrücklich in den Fokus der Aufmerksamkeit gerät. Geschieht dies doch einmal, so erweist es sich schnell als mindestens in dem Maße schwer verständlich, in dem es zunächst selbstverständlich erschien. Wie so oft ist das zunächst und zumeist Unhinterfragte das Fragwürdigste: In diesem Falle »das Ich«. Ist die Frage danach einmal virulent geworden, will sie kaum wieder verschwinden – und ruft Sätze wie die eingangs zitierten von Wittgenstein, Bloch und Schopenhauer hervor. Soviel vorweg zum Gegenstand der Untersuchung. Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Theorie von Hermann Schmitz. Ihr sind große Teile der Arbeit gewidmet. Dies hat einen systematischen und einen historischen Grund. Zum einen lassen sich anhand von Schmitz’ Ansatz Fragestellungen und Problemkomplexe, die mit dem Thema Selbstbewusstsein generell zusammenhängen, sehr gut verdeutlichen. Zum anderen hat Schmitz zur Erneuerung der Debatte um dieses Thema beigetragen, welche seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat und von der auch diese Arbeit in Sachen Motivation und Materialfülle zehrt. Noch vor Dieter Henrich, mit dessen Namen (sowie denen einiger seiner Schüler) die Debatte seither in erster Linie assoziierte wurde, hat Schmitz auf Probleme einer Auffassung aufmerksam gemacht, für welche Henrich später den Terminus „Reflexionsmodell des Selbstbewusstseins“ geprägt hat. So wird seither die Ansicht bezeichnet, Selbstbewusstsein komme durch die Rückwendung eines Subjekts auf sich selbst zu Stande. Um die mit dieser gängigen und oft unreflektiert vorausgesetzten Vorstellung (und anderen Eigentümlichkeiten des Selbstbewusstseins) verbundenen Paradoxien zu umgehen, sind Alternativen denkbar, die man als Unmittelbarkeitsmodelle des Selbstbewusstseins bezeichnen kann. Ihnen zufolge ist Selbstbewusstsein ein gänzlich reflexions- und relationsloses Phänomen. Zwar werden so manche Probleme des Reflexionsmodells vermieden, doch sehen sich solche Gegenentwürfe – wie zu zeigen sein wird – im selben Zug auch vor neue Schwierigkeiten gestellt. Dann scheint es nahe zu liegen, in einer Vereinigung beider Konzepte Selbstbewusstsein als Einheit von Unmittelbarkeit und Reflexion („vermittelte Unmittelbarkeit“, wie Hegel es nannte) zu IV konzipieren. Auch diese dritte Möglichkeit wird sich aber als problembehaftet erweisen. Die Paradoxien des Selbstbewusstsein spielen sich also – daher der Titel der Arbeit – zwischen Unmittelbarkeit und Reflexion ab. Was genau es mit diesen Modellen auf sich hat, die hier nur benannt wurden, kann freilich erst im Verlauf der Arbeit deutlich werden. Obwohl sie über weite Strecken mit Schmitz’ Ansatz beschäftigt ist, stellt diese Untersuchung keineswegs einen autorzentrierten, sondern eine problemorientierten und systematischen Versuch zum Thema Selbstbewusstsein dar. In Form von Seitenblicken und Exkursen werden, neben den bereits genannten von Schmitz und Henrich, zahlreiche andere Theorien thematisiert – gegenwärtige wie ältere; mal in knapper, mal in ausführlicherer Darstellung. Dadurch soll erstens (in systematischer Hinsicht) Schmitz’ oft schwer zugängliche Theorieanlage und Terminologie – durch Verweis sowohl auf inhaltlich nahe stehende Vorgänger als auch auf Gegenstände theoretischer Abgrenzungsbemühungen – besser verständlich werden. Zweitens wird dadurch (in historischer Hinsicht) deutlich, dass die erwähnte, seit den 60er Jahren wieder intensiver geführte Diskussion nicht neu, sondern nur die Wiederentdeckung eines Themas darstellt, das sich einst höchster Aufmerksamkeit erfreute und nur durch die zahlreichen Versuche der Abwendung von subjektorientierten Ansätzen des Philosophierens im späteren 19. und im 20. Jahrhundert – z.B. im Rahmen materialistischer, intersubjektivistischer, sprachanalytischer, poststrukturalistischer u.v.a. Ansätze – marginalisiert wurde. Drittens soll vermittels der genannten Seitenblicke und Exkurse am Ende ein Gesamtüberblick über Theoriemodelle des Selbstbewusstseins und deren Probleme versucht werden. Die Untersuchung besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil geschieht zunächst (Kap. I) eine Zergliederung des Begriffs Selbstbewusstsein, wodurch bereits erstmals Probleme deutlich werden, mit welchen sich Selbstbewusstseinstheorien konfrontiert sehen. Solche Probleme werden anschließend (Kap. II) anhand zweier „Paradoxien des Selbstbewusstseins“ konkret vorgestellt. Der erste Teil schließt mit einem Exkurs (Kap. III), in welchem verschiedenen Versuchen nachgegangen wird, diese Paradoxien zu vermeiden. Dadurch wird bereits die Behandlung von Schmitz’ Lösungsansatz im zweiten Teil vorbereitet, der sich ausgehend von den vorgestellten Positionen gut konturieren lässt. Dieser zweite Teil beginnt mit Schmitz’ Hauptthese zum Thema Selbstbewusstsein: Es wird im Rahmen seiner Theorie der Subjektivität als affektives Phänomen und jenseits jeglicher Reflexion konzipiert (Kap. IV). Er vertritt also, was wir eben als Unmittelbarkeitsmodell bezeichnet haben. Danach wird diese These in den größeren Zusammenhang seines V philosophischen Systems eingeordnet (Kap. V), wodurch sie einerseits einem besseren Verständnis zugeführt werden soll und andererseits ein weiterer Aspekt seiner Selbstbewusstseinstheorie vorbereitet wird, welcher anschließend (Kap. VI) zu thematisieren sein wird. Ein den zweiten Teil abschließender Exkurs (Kap. VII) vergleicht die nun komplett vorliegende Schmitzsche Theorie des Selbstbewusstseins mit verwandten Modellen. Durch diese Verortung seiner Untersuchungen in einem größeren Zusammenhang sowohl zeitgenössischer als auch älterer Theorien sollen Ziele, aber auch Stärken und Schwächen von Schmitz’ Theorie noch deutlicher hervortreten. Im selben Zug führt dieser Exkurs auch bereits zum nächsten Punkt, indem er Kritikpunkte, die unmittelbar anschließend im dritten Teil an Schmitz zu richten sind, bereits an Theorien adressiert, die der Schmitzschen in verschiedenen Punkten ähnlich sind. Die Kritik an Schmitz schließlich, welche den dritten Teil ausmacht, kreist um das Begriffspaar Unmittelbarkeit und Reflexion. Anhand verschiedener Begriffe, Methoden und Thesen von Schmitz wird gezeigt, dass er beide nicht in ein überzeugendes Verhältnis zu bringen vermag. Dabei Selbstbewusstseinstheorie bleibt fixiert. dieser Teil Weitergehende auf Kritik bloß Auseinandersetzungen an mit Schmitz’ seinem philosophischen Ansatz finden aus Gründen der Übersichtlichkeit und thematischen Zentrierung erst im Anhang statt. Historisch und systematisch weiter ausgreifend wird Schmitz dort ein Platz in der Geschichte der Metaphysik zugewiesen. Dem zuvor soll in einer Schlussbetrachtung der bereits erwähnte Überblick über verschiedene Theoriemodelle des Selbstbewusstseins und ihre Probleme versucht werden. Dies wird nach dem Muster des so genannten „Münchhausentrilemmas“ geschehen. VI Inhalt ERSTER TEIL: SELBSTBEWUSSTSEIN – BEGRIFF UND PROBLEME 3 I. ANNÄHERUNG AN DEN BEGRIFF 3 II. PARADOXIEN DES SELBSTBEWUSSTSEINS 5 1. DIE PARADOXIE DER ZWEIEINIGKEIT 2. DIE PARADOXIE DER SELBSTZUSCHREIBUNG BZW. REFLEXION a) Das Hase-und-Igel-Modell b) Das Münchhausen-Modell c) Zusammenfassung d) Beispiele 5 6 7 10 12 14 III. EXKURS I: EXEMPLARISCHE VERSUCHE, DIE PARADOXIEN ZU VERMEIDEN 16 1. »DAS ICH IST UNDENKBAR« (DER NEUKANTIANISMUS UND KANT) 2. »DAS ICH IST UNRETTBAR« a) Das Problem und Pothasts Konsequenz b) Das Ich als Vorfindung (Pothast, Empiriokritizismus, Hume) c) Das Subjekt als »Objekt« d) Zusammenfassung 17 22 22 23 26 28 ZWEITER TEIL: SCHMITZ’ THEORIE DES SELBSTBEWUSSTSEINS 29 IV. SUBJEKTIVITÄT, AFFEKTIVITÄT, SELBSTBEWUSSTSEIN – SCHMITZ’ LÖSUNGSANSATZ 29 1. DIE PROBLEMLAGE 2. SUBJEKTIVITÄT a) Wer bin ich? – Das Ich und seine Eigenschaften b) Kurze Überlegung dazu, wie es je für mich ist, jemand zu sein c) Subjektive Tatsachen d) Primäre Subjektivität 3. SELBSTBEWUSSTSEIN a) Affektivität b) Vom Ich zum Mir 4. ZUSAMMENFASSUNG 29 31 31 35 37 39 41 41 44 45 V. WAS WILL SCHMITZ? – ÜBER DIE GRUNDBEGRIFFE SEINER PHILOSOPHIE 47 1. LEIBLICHKEIT 48 2. ERSTE ANNÄHERUNG AN DIE GEGENWART 52 3. PERSON UND WELT 54 4. GANZES UND TEIL – ONTOLOGIE DER BEDEUTSAMKEIT, EPISTEMOLOGIE DER EXPLIKATION 58 a) Situation und Einzelheit, Chaos und Individuation 58 b) Die persönliche Situation 63 5. DIE GEGENWART UND IHRE FALTEN 66 6. ZUSAMMENFASSUNG 71 VI. ICH ALS REMIS – AMBIVALENTES SELBSTBEWUSSTSEIN ALS WEITERER ASPEKT DES LÖSUNGSANSATZES 73 1. PERSONALE AMBIVALENZ 2. PRÄPERSONALE AMBIVALENZ 73 76 VII. EXKURS II: VERGLEICH MIT ANDEREN ANSÄTZEN 78 1. HEGELS PHILOSOPHIE DES SELBSTBEWUSSTSEINS 2. ICH FÜHLE, ALSO BIN ICH? – THEORIEN DES SELBSTGEFÜHLS 3. SELBSTBEWUSSTSEIN UND SPRACHANALYSE – TUGENDHAT 79 84 88 DRITTER TEIL: ZWISCHEN UNMITTELBARKEIT UND REFLEXION – KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT SCHMITZ’ THEORIE DES SELBSTBEWUSSTSEINS 93 VIII. PROBLEME MIT DER UNMITTELBARKEIT 94 1. IDENTITÄT AUF DER SPITZE DES AUGENBLICKS 2. RELATIONALITÄT, REFLEXIVITÄT, REFLEXION 94 97 IX. PROBLEME MIT SCHMITZSCHEN BEGRIFFEN UND METHODEN 102 1. AMBIVALENTE MANNIGFALTIGKEIT 2. GEGENWART 102 104 X. ZUSAMMENFASSUNG: DENKEN ALS UR-TEILUNG DER UNMITTELBARKEIT? 106 SCHLUSSBETRACHTUNG: HASE, IGEL UND HEGEL – DAS MÜNCHHAUSENTRILEMMA DES SELBSTBEWUSSTSEINS 111 ANHANG: WEITERFÜHRENDE KRITIK AN SCHMITZ’ THEORIE 114 I. »DEKONSTRUKTION« DER GEGENWART 114 1. »METAPHYSIK DER GEGENWÄRTIGKEIT« 2. DAS SAGBARE UND DAS UNSAGBARE, DAS SYSTEM UND DAS ICH 114 120 II. DIE PERSON ZWISCHEN LEIB UND SEELE 123 1. HAT DIE PERSON EINEN LEIB ODER DER LEIB EINE PERSON? 2. WER, WIE, WAS 123 126 LITERATURVERZEICHNIS 130 Abbildungsnachweis Auf der Titelseite befindet sich eine Abbildung des Gemäldes »La reproduction interdite« von René Magritte aus dem Jahre 1937. 2 Erster Teil: Selbstbewusstsein – Begriff und Probleme I. Annäherung an den Begriff Der Mensch ist Geist. Doch was ist Geist? Geist ist das Selbst. Doch was ist das Selbst? Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, oder es ist in diesem Verhältnis jenes, daß dieses sich zu sich selbst verhält; das Selbst ist nicht das Verhältnis, sondern daß sich das Verhältnis zu sich selbst verhält. (Kierkegaard) Zuallererst wollen wir eine möglichst scharfe Fassung der mit dem Thema des Selbstbewusstseins verbundenen Probleme versuchen. Hierzu ist zunächst eine erste Annäherung an den Begriff des Selbstbewusstseins vonnöten. Für den Anfang genügt eine den Gegenstand approximativ umreißende Explikation, aus der sich die relevanten Elemente und Probleme ersehen lassen. Wir entnehmen eine solche Annäherung und Anregung dem »Historischen Wörterbuch der Philosophie«. Im redaktionellen Einleitungsabschnitt zum Stichwort »Selbstbewußtsein« (Bd. 9, Sp. 350) findet sich dort Folgendes verzeichnet: Der Begriff ›Selbstbewußtsein‹ steht für einen bestimmten Bereich des Bewußtseins, nämlich – im Unterschied zum Bewusstsein von äußeren Dingen – für das Selbstverhältnis des denkenden und wollenden Ich, das sich zum Objekt haben kann. Dieses Selbstverhältnis beruht auf einer Form von Selbstwahrnehmung – sei es (eher psychisch) auf einem Selbstgefühl oder (eher epistemisch) auf einer Vorstellung bzw. Erkenntnis seiner selbst – und konstituiert das Ich als Selbst, als einheitliches, mit sich selbst identisches Subjekt. Es sei schon vorweggenommen, dass nichts problematischer sein könnte, als diese Definition. Nach einer Ansicht, die in dieser Arbeit sehr viel Raum einnehmen wird, ist sie ganz grundlegend falsch. Doch bringt sie gerade dadurch die ebenso grundlegenden Probleme, die mit dem Selbstbewusstsein verbunden sind, sehr deutlich zum Ausdruck und ermöglicht es uns, die einzelnen Teile des Problemkomplexes zu sondern. Die folgenden Punkte scheinen ihm zuzugehören: (1) Bewusstsein, (2) Identität1, (3) Relationalität. Nimmt man die Punkte zusammen, ergibt sich außerdem, dass (3) Relationalität durch (2) Identität zur Selbstbezüglichkeit wird. Wenn etwas nicht nur eine Relation zwischen zweien ist, sondern beide Glieder identisch sind, bezieht etwas sich auf sich selbst. So scheint es im Selbstbewusstsein zu sein. Selbstbezüglichkeit, oder mit einem anderen Wort: Reflexivität, gibt es allerdings auch in anderen Fällen. So sind etwa Organismen selbstbezügliche Systeme, ohne dass sie dies mit (1) Bewusstsein wären. Den Fall, in welchem dies zur Reflexivität hinzu kommt, sich etwas also bewusste auf sich bezieht, fassen wir terminologisch als Reflexion.2 Die bloße Beziehung auf sich, kann so zu einem Verhalten zu sich werden; die 1 Unter »Identität« können wir zunächst »numerische Identität« verstehen, also »Selbigkeit«. Später werden wir allerdings noch sehen, dass Schmitz – hierin Hegel ähnlich – Korrekturen an der üblichen Vorstellung von numerischer Identität vornehmen wird, um das Phänomen zu verstehen. 2 Beide Termini stehen außerdem in einem noch zu erläuternden Sinn dem Begriff Unmittelbarkeit gegenüber und entsprechen dann der »Vermittlung«. So kann Reflexion für »Überlegung« oder »Denken« stehen; dies 3 Wissentlichkeit dieses Prozesses ermöglicht zudem eine Art der Selbstobjektivierung: Etwas weiß von sich, dass es so und so ist. Die Kombination von (1) und (2) scheint außerdem zu ergeben: Identitätsbewusstsein. Allerdings ist dies gegenüber den beiden Kombinata und anders als bei den bisherigen Kombinationen, die analytisch auseinander folgen, eine Erweiterung, denn es ist nicht auszuschließen, dass etwas bewusst und identisch ist, ohne über bewusste Identität zu verfügen: Es wäre sich dann nicht seiner Identität, sondern irgendetwas Anderem bewusst.3 Hinzufügen ist den drei Bestandteilen daher ferner, was im Zitat nur implizit genannt wird: (4) Meinigkeit. Dies wird bisweilen auch als »Ich-« oder »Erste-Person-Perspektive« oder als »Subjektivität«4 bezeichnet. Gemeint ist damit, dass nicht irgendwer oder irgendetwas selbstbezüglich oder identisch ist bzw. Bewusstsein hat, sondern ich es bin und, in welchem Modus auch immer, untrüglich dessen gewahr bin, dass dem so ist und die Eigenschaften und Aktivitäten, die ich mir zuschreibe, meine sind. Insofern bin ich stets »mit mir vertraut«. Die Frage: »Ist dieses Ich wirklich meins?« macht, anders als die Frage »Warum ist dieses Ich meins?«, keinen Sinn.5 Folglich gilt erst (1)+(2)+(4) als Identitätsbewusstsein. Festzuhalten bleibt, dass die vier Grundelemente, die wir hier extrapoliert haben, erstens scheinbar nicht weiter aufeinander reduzibel sind und zweitens ihre wechselseitigen Implikationsverhältnisse fast ausnahmslos6 fraglich, nämlich Teil des zu behandelnden Problems sind. Notieren wir eine kleine »Formelsammlung«: (1) Bewusstsein, (2) Identität, (3) Relationalität, (4) Meinigkeit. (2) + (3) = reflexive Relationalität / Reflexivität / Selbstbezüglichkeit (1) + (2) + (3) = Reflexion (1) + (2) + (4) = Identitätsbewusstsein Betreffs des Selbstbewusstseins steht also in Frage, ob alle vier Punkte notwendige (und zusammen hinreichende) Bestandteile des Selbstbewusstseins sind, oder einzelne wegfallen können. Es wäre zu fragen, ob Reflexion bzw. Identitätsbewusstsein für sich betrachtet schließt die Fähigkeit zur Distanznahme ein und ist insofern nicht unmittelbar. So werden zudem Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit und Erinnerung möglich. »Reflexion« im Sinne der »Rückwendung auf sich« hängt damit eng zusammen (Anderer Meinung ist diesbezüglich: Frank 2002, 102 f. Er hält Rückwendung und Überlegung für gänzlich verschiedene Bedeutungen des Terminus’.). 3 Identitätsbewusstsein meint in Kants Worten: »synthetische Einheit«: Vereinigung aller Aktivitäten und Eigenschaften in einem Bewusstsein (vgl. Kant, KrV, B 131 ff.). 4 »Subjektivität« hat verschiedenste Bedeutungen (vgl. z.B. Henrich 2007, 23). Auch dann, wenn sie wie hier Meinigkeit bezeichnet, meint dies nicht zwingend »bloß subjektiv« im Sinne von relativ oder scheinbar. 5 Vgl. Henrich 1970, 266. Diese Meinigkeit wird übereinstimmend von sehr verschiedenen Herangehensweisen an das Thema Selbstbewusstsein als Kriterium genannt. Vgl. neben Henrich und Schmitz z.B. Pauen 2000, 107 (dazu Kap. VII.3); Damasio 2000, 316 f. (dazu Kap. VII.2); Metzinger 2005, 245; Newen 2000, 37 ff. Meinigkeit wird uns vor allem in Kap. IV.1 beschäftigen. 6 Eine Ausnahme ist wohl, dass (4) Meinigkeit (1) Bewusstsein impliziert. Es ließe sich also erwägen, ob Meinigkeit doch keine Letztheit ist und welches Element dann zum Bewusstsein hinzu kommen müsste, um Meinigkeit zu »ergeben«. Damit sind wir aber schon mitten im Thema. 4 überhaupt möglich sind, ob Reflexion nicht auf Meinigkeit bzw. Identitätsbewusstsein auf Relationalität angewiesen ist. Ihre Möglichkeit vorausgesetzt, wäre die nächste Frage, ob sie als solche schon Selbstbewusstsein darstellten. Sollte unsere Auflistung ausschließlich notwendige Bestandteile enthalten, so müsste eine Selbstbewusstseinstheorie ein Konzept vorlegen, das all diese Punkte vereinigen kann, also kurz gesagt verdeutlichen, wie eine selbstbezügliche, bewusste Identität meine sein kann oder wie ein reflektiertes Identitätsbewusstsein möglich ist. Andernfalls müsste gezeigt werden, wie die genannten Punkte auf andere zu reduzieren sind, für illusionär oder zumindest nicht notwendig erklärt werden können. Diese noch abstrakt wirkenden Bestimmungen, werden sich im Laufe der Arbeit näher konkretisieren. Hermann Schmitz hat die Schwierigkeiten, die mit dem Begriff des Selbstbewusstseins verbundenen sind und die bereits zu Tage treten, in drei Paradoxien gegliedert (vgl. § 30; I, 245 ff.7), die wir uns nun, allerdings zusammengefasst in deren zwei, vergegenwärtigen wollen. II. Paradoxien des Selbstbewusstseins 1. Die Paradoxie der Zweieinigkeit Selbstbewusstsein zeichnet sich nach den Vorüberlegungen durch Selbstbezüglichkeit aus, es ist also eine reflexive Relation. Aber wie kann sich etwas auf sich selbst beziehen? Es scheint dann ja zweimal vorzukommen, einmal als sich Beziehendes und einmal als Bezogenes. Wenn es aber zweimal vorkommt, wie kann es dann in beiden Fällen dasselbe sein? Identität und Differenz scheinen hier einander zu implizieren und Selbstbezüglichkeit zu einem widersprüchlichen Begriff zu machen. Dies zeigt sich auch an zahlreichen formallogischen Paradoxien, die auf diesem Grundproblem der Selbstbezüglichkeit beruhen: etwa der Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten, oder dem Satz »Dieser Satz ist falsch«. Die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten, enthält sich selbst, wenn sie sich nicht selbst enthält, und umgekehrt. Wenn dieser Satz falsch ist, ist er zugleich wahr, et vice versa. Solcher Verstoß gegen den Satz des Widerspruchs hält Logiker seit Jahrtausenden in Atem. Nun sind solche Probleme lediglich formal. Man mag versuchen, »solche reflexiven Relationen in irreflexive zwischen verschiedenen Betrachtungsweisen einer Sache oder zwischen Zeichen für sie umzudeuten«, denn es »kann bezweifelt werden, ob sie sich wirklich 7 Werke von Schmitz werden direkt im Text, ohne Angabe des Autors und wie folgt zitiert: Sein »System der Philosophie« durch Angabe des Paragraphen oder durch »Bandnummer[.Teilbandnummer], Seitenzahl«, alle anderen Veröffentlichungen nur durch »Jahreszahl[Indexbuchstabe], Seitenzahl«. Im Literaturverzeichnis finden sich die entsprechenden Titel. Um Verwechslungen der Verweise auf Schmitz’ System, die z.B. »III.2« lauten können, mit Verweisen auf Kapitel dieser Arbeit zu vermeiden, geschehen letztere immer durch das Kürzel »Kap.«, z.B. »Kap. III.2«. 5 in der betrachteten Sache abspielen oder nur Metaphern für ein Verhältnis des Betrachters zu ihr« (I, 245) sind. Es gibt aber doch zumindest einen Fall von Selbstbezüglichkeit, der anders gelagert ist: mich selbst. Sofern ich Selbstbewusstsein habe, scheine ich ein »existierender Widerspruch« zu sein: Ich beziehe mich nicht nur auf Anderes und nicht nur Anderes nimmt auf mich Bezug, sondern ich beziehe mich, etwa indem ich dies sage, auf mich selbst und bin insofern Beziehendes und Bezogenes (in anderer Terminologie: Subjekt und Objekt) zugleich, identisch und verschieden, eins und doch zwei. In diesem Fall ist es ausgeschlossen, das Problem auf die Betrachterseite abzuwälzen, da der Betrachter selbst Teil der Relation ist, ich selbst der Betrachter bin. Es »spielt sich in dem seiner selbst bewußten Wesen eine Beziehung auf sich selbst ab, die von ihm selbst vollzogen wird, nicht bloß durch einen Betrachter von außen ihm zugesprochen wird« (I, 245). Im Selbstbewusstsein scheint somit unbestreitbar der paradoxe Fall einer reflexiven Relation einzutreten. »Es bleibt Eines und sondert sich doch, wie es scheint, von sich ab, indem es als Referens (beim Selbstbewußtsein: Subjekt) sich als dem Relat (hier: Objekt) gegenübertritt, z.B. sich betrachtet oder auch bloß meint. Das scheint den Widerspruch einzuschließen: 1 = 2« (I, 245). Zudem können Subjekt und Objekt in manchen Fällen von Selbstbewusstsein inhaltlich verschieden sein, z.B. bei Selbstbetrug oder Selbstkritik. Wer Selbstkritik übt, ist in sich gespalten, Kritisierender und Kritisierter zugleich, steht zwischen und in beiden Polen, und soll doch zugleich ein und derselbe sein. Der Widerspruch ist hier nicht nur formal (1 = 2), sondern auch inhaltlich (a = ¬ a). Der Selbstkritiker ist nicht nur Beziehendes und Bezogenes, sondern sich inhaltlich Widersprechendes soll in ihm identisch sein. Schmitz behandelt die beiden Fälle (Form und Inhalt) getrennt, als »Erste Paradoxie: Die Zweieinigkeit« (I, 245) und »Zweite Paradoxie: Die Identität des Unvereinbaren« (I, 247).8 Die nun zu behandelnde Paradoxie wurde von Schmitz als »Dritte Paradoxie des Selbstbewusstseins: Regressus in infinitum« formuliert und später in modifizierter Form als »Paradoxie der Selbstzuschreibung« bezeichnet. Wir bezeichnen sie durchweg so. 2. Die Paradoxie der Selbstzuschreibung bzw. Reflexion Das reine Selbstbewußtsein nun also, wen stellt es eigentlich vor? Das Ich stellt sich vor Sich, d.h. sein Ich, d.h. sein Sich vorstellen; d.h. sein Sich als Sich vorstellend vorstellen u.s.w. Dies läuft ins Unendliche. Man erkläre jedesmal das Sich durch sein Ich, und dieses Ich wiederum durch das Sich vorstellen, so wird man eine unendliche Reihe erhalten, aber nimmermehr eine Antwort auf die vorgelegte Frage, die sich vielmehr bei jedem Schritte wiederholt. Das Ich ist also ein Vorstellen ohne Vorgestelltes; ein offenbarer Widerspruch. (J. F. Herbart) 8 Auf diese zweite Paradoxie werden wir kurz in Kap. VI.1 wieder zurückkommen 6 Schmitz hat die nun zu behandelnde Paradoxie, ebenso wie die anderen, 1964 formuliert und betont häufig, sie als Erster aufgestellt zu haben. Dazu sah er sich genötigt, da Dieter Henrich sie 1966 vor allem unter Bezug auf Fichte aufgegriffen, die ihr zu Grunde liegende Annahme als »Reflexionsmodell« des Selbstbewusstseins bezeichnet und damit viel Beachtung gefunden hatte. Henrich führt allerdings zwei Versionen der Kritik an diesem Modell an und sieht betonter Maßen nur eine von beiden schon bei Fichte thematisiert, während er für die andere auf Schmitz’ Vorarbeit verweist.9 Wir werden uns die beiden Versionen nun nacheinander ansehen und sie in Anlehnung an Henrich10 als Münchhausen- bzw. Hase-undIgel-Modell bezeichnen. Dieses geht auf Schmitz zurück und ist strukturell orientiert, zeigt also Probleme in der Beschreibung der Verfassung des Selbstbewusstseins. Jenes lehnt sich an Fichte an und bezieht auch den genetischen Aspekt mit ein, problematisiert also auch Vorstellungen einer Erklärung der Entstehung von Selbstbewusstsein.11 Unterscheidet man innerhalb der Relation, in der jemand von sich Kenntnis hat, ein Ich-Subjekt und ein IchObjekt, so kann man sagen, dass das Hase-und-Igel-Model seinen Ausgang vom Ich-Subjekt, das Münchhausen-Modell vom Ich-Objekt nimmt und beide das jeweils andere zu erklären suchen (und daran scheitern). a) Das Hase-und-Igel-Modell Mein Name ist Hase. Und ich weiß von nichts. (Bugs Bunny) Wir beginnen mit dem, was Schmitz »Paradoxie der Selbstzuschreibung« nennt. Sie entsteht, wenn man betrachtet, dass das in der Paradoxie der Zweieinigkeit beschriebene Verhältnis von Subjekt und Objekt nicht nur besteht, sondern in ihm auch ein Bewusstsein von ihm bestehen muss, es also nicht nur eine reflexive Relation darstellt, sondern eine, die von sich weiß: Wir haben dies Reflexion genannt. Zwar war bereits zuvor vom Bewusstsein die Rede, aber nur innerhalb der paradoxen Relation: Das Subjekt war sich eines Objekts bewusst, das es selbst ist. Paradox daran war nicht das Bewusstsein, sondern die Identität zweier Verschiedener. Nun geht es darum, dass die Relation als ganze ihrerseits bewusst sein muss, damit von Selbstbewusstsein die Rede sein kann. Während es bisher nur um die paradox erscheinende Möglichkeit faktischer Identität von Subjekt und Objekt ging, geht es nun um 9 »Zwei [...] Frage[n] wollen wir ihr [der Reflexionstheorie; S.P.] stellen. Vor allem die erste stellen wir gemeinsam mit Fichte« (Henrich 1966, 193; auf der nächsten Seite folgt dann für die zweite Frage der Verweis auf Schmitz). Schmitz’ Unmut über die »Vordatierung« der Paradoxie (vgl. etwa 1982, 132 f.) ist also etwas vorschnell. Henrich behauptet gar nicht, Fichte habe schon gesehen, was Schmitz gesehen hat. 10 Vgl. Henrich 1999, 57. 11 Vgl. Arndt 2004, 18 ff., der allerdings meint, Henrich hielte beide für genetisch. 7 die Möglichkeit, von dieser Identität zu wissen (vgl. I, 245), so dass »nicht die bloße Identität eines Subjekts mit einem Objekt, sondern erst meine Stellung auf beiden Seiten dieser Identität« (IV, 29) diese Paradoxie kennzeichnet und so scheinbar die Möglichkeit eines solchen Selbstbewusstseins als Bewusstsein vom Ganzen generell in Frage stellt. Wenn Bewusstsein stets Bewusstsein von etwas sein soll, dies also auch für das Selbstbewusstsein gilt, scheint es sich unendlich selbst vorauszusetzen. Schmitz formuliert: »Selbstbewußtsein ist Bewußtsein von etwas a) entweder ohne Bewußtsein von dessen Identität mit mir b) oder mit Bewußtsein davon« (I, 250). Beides kann nicht zutreffen. Im Falle a) wäre Selbstbewusstsein schlicht Bewusstsein von irgendetwas, für das kein Anlass zu einer Identifikation mit sich bestünde, also gar kein Selbstbewusstsein. Fall b) stellt das eigentliche Problem dar. Wäre Selbstbewusstsein ein Bewusstsein von etwas, das Bewusstsein der Identität dessen mit sich einschlösse, so wäre es eine Selbstzuschreibung oder Identifizierung der Form: »Das bin ich.« Doch enthält diese Einsicht »eine – ausdrückliche oder unausdrückliche – Vorstellung, die sich sprachlich durch das Wort ›ich‹ wiedergeben läßt. Eine solche Vorstellung ist aber [...] nur möglich, wenn bereits Selbstbewußtsein besteht« (I, 251). Selbstbewusstsein kann also nicht darin bestehen, dass man sich etwas zuschreibt oder sich mit etwas identifiziert. Wer »Das bin ich« sagt, kann nicht dadurch erfahren, wer »ich« ist, sondern muss vorher schon mit sich »bekannt« sein (vgl. I, 249 f.). Schon das Reflexivpronomen »sich« deutet an, dass die Fähigkeit zur Identifizierung eine Kenntnis desjenigen, mit dem man sich identifiziert, voraussetzt. Diese Kenntnis ist aber auch schon Selbstbewusstsein. Sollte dieses nun auch in Identifizierung bestehen, würde es wiederum ein Weiteres voraussetzen, usf. Damit ein gewisser Gegenstand mir als ich selber zu Bewußtsein kommen kann, muß er mir vorschweben als identisch mit mir, d.h. mit einem Gegenstand, der mir wiederum vorschweben muß als identisch mit mir, und so fort ad infinitum. [...] Wenn jedes Selbstbewußtsein einen solchen Gedanken enthält, dann enthält jedes also einen Teilgedanken, der selbst schon Selbstbewußtsein ist (IV, 28 f.). Wir müssten fähig sein, unendlich viele Selbstzuschreibungen, die sich hier jeweils einander voraussetzen, zur selben Zeit zu vollziehen, um überhaupt Selbstbewusstsein haben zu können. Das scheint unmöglich zu sein.12 Also kann auch b) nicht der Fall sein. Selbstbewusstsein kann dann aber überhaupt nicht Bewusstsein von etwas sein, kann keine Identifizierung seiner selbst mit etwas 12 oder Selbstzuschreibung sein.13 »Jede Unter Berufung auf einen alternativen Begriff von Identität und Verschiedenheit glaubt Schmitz allerdings 1964 noch an eine derartige Lösung, in der unendlich viele Akte zugleich vollzogen werden (vgl. I, 265 f.). An einem solchen Begriff von Identität und Verschiedenheit hält er zwar auch später fest (vgl. Kap. V.4 und VI), vertritt diese Lösung aber nicht mehr. 13 Später formuliert Schmitz den Fehler noch einmal anders, indem er ein Axiom aufstellt, gemäß welchem sich Menschen niemals ihrer bewusst werden können: »Für jegliches Selbstbewußtsein ist es zureichend und notwendig, daß jemand etwas mit etwas, das er für sich selber hält, identifiziert«. Demnach enthielte jedes Selbstbewusstsein »die Identifizierung eines Referens mit einem Relat durch einen Bewußthaber, der dieses 8 Selbstzuschreibung muß zwei Annahmen zusammenführen: was ich bin und dass ich es selber bin« (2003a, 67). Was ich bin, kann ich durch Selbstzuschreibung ausdrücken; dass ich es selber bin, aber nicht, da es für jede Selbstzuschreibung schon vorausgesetzt ist. Wäre Selbstzuschreibung zureichend für Selbstbewusstsein, setzte es sich also ins Unendliche selbst voraus. Wie der Igel zum Hasen »Ich bin schon da« sagt, so müsste auch das Selbstbewusstsein sich immer schon selbst voraus sein. Sofern der Hase sich aber nicht selbst voraus sein kann, indem er unendlich schnell läuft (also unendlich viele Identifikationen auf einmal vollziehen kann), braucht er einen Igel, der immer schon da ist, aber nicht als seinen Gegner, sondern als Teil seiner selbst: Der Hase muss selbst Igel sein, um nicht in die paradoxe Lage zu kommen, dem Spruch »Mein Name ist Hase. Und ich weiß von nichts.« ein »Nicht einmal von mir selbst!« hinzufügen zu müssen. Was genau der Igel ist und inwiefern der Hase selbst Igel sein kann, werden wir im Rahmen des Schmitzschen Lösungsversuchs betrachten. Zunächst kommen wir aber noch zu Henrichs Darstellung dieser Variante: Es ist, meint er, für Selbstbewusstsein nicht hinreichend, daß irgendein Subjekt von irgendeinem Objekt ausdrückliches Bewußtsein erwirbt, um das Bewußtsein Ich=Ich zu erklären. Dies Subjekt muß auch wissen, daß sein Objekt mit ihm identisch ist. [...] Wie aber kann das Selbstbewußtsein wissen, daß es sich selber ergriffen hat, wenn durch eine Reflexion des Ich ein Ich-Objekt zustandegekommen ist? Offensichtlich kann es dies nur, wenn es zuvor schon von sich weiß. Denn nur aus solchem Wissen ist es ihm möglich zu sagen: Was ich erfasse, das bin ich selbst.14 Soll das Subjekt sich selbst als Objekt ergreifen und nicht irgendeines, muss der Selbstbezug, um als Selbstbewusstsein gelten zu dürfen, auch eine Erkenntnis seiner mit einschließen. Und nach dem Gesagtem scheint es, »daß solche Erkenntnis nur ein Wiedererkennen sein kann«15 und folglich seinerseits eine ursprünglichere Kenntnis von sich erfordert. Selbstbewusstsein ist dann aber nicht erklärt, sondern vorausgesetzt. Kurz: »Gibt es Selbstbewußtsein, so dadurch, daß Bewußtsein sich selbst kennt. Sofern es aber sich kennt, ist das, was bekannt ist, seinerseits bereits als Selbstbewußtsein zu denken. So setzt also Selbstbewußtsein sich unendlich voraus«.16 Auf jeder Stufe würde gelten: »Das Ich wäre nicht für sich, sondern für Relat für sich selber hält. Etwas für sich selber zu halten, ist abermals ein Selbstbewußtsein. Da für eine Identifizierung sowohl das Bewußtsein des Referens als auch das Bewußtsein des Relats der betreffenden echten oder vermeintlichen Identität vorausgesetzt ist, wird demnach für das Selbstbewußtsein erster Stufe, primäre Identifizierung, ein Selbstbewußtsein zweiter Stufe, bezüglich auf das Relat der primären Identifizierung, vorausgesetzt. Da das Axiom für jegliches Selbstbewußtsein gelten soll, muß es auch auf dieses Selbstbewußtsein zweiter Stufe angewendet werden. Diesem ist demnach ein Selbstbewußtsein dritter Stufe vorausgesetzt, und durch triviale Iteration kommt es zu einem regressus in infinitum mit dem Ergebnis, daß jedes Selbstbewußtsein unendlich vielfaches gleichzeitiges Selbstbewußtsein voraussetzt. [...] Das kann doch nicht stimmen« (1996a, 22 f.). Schmitz bedient sich hier nicht mehr der Subjekt-Objekt-Sprache, sondern wendet seine Argumentation ins Sprachphilosophische (vgl. dazu auch Kap. VII.3 und VIII). Dem Gedanken nach ist der Punkt aber derselbe: Wäre das Axiom richtig, könnte man sich seiner selbst nie bewusst werden, ohne »unendlich viele verschiedene Gedanken zugleich zu fassen« (1996b, 170). Sofern wir das nicht können, kann Selbstbewusstsein nicht allein in Selbstzuschreibung bestehen, das Axiom muss also falsch sein. 14 Henrich 1966, 194 f. 15 Henrich 1966, 212; vgl. dazu unter d) das Spiegelbeispiel. 16 Henrich 1982, 172. 9 ein höheres Ich«,17 keines dieser »Iche« aber fände jemals sich. 18 Dies entspricht der Schmitzschen Argumentation: Um mir etwas zuzuschreiben, muss ich mich schon »bewussthaben«. Durch Zuschreibung bzw. Objektivierung kann ich nicht zu einem Bewusstsein meiner gelangen. In diesem Fall ist das Problem vom Subjekt-Pol aus gedacht, der sich durch Selbstzuschreibung oder Reflexion auf sich als ein Objekt erkennt: »Das bin ich!«. Der Begriff »Reflexion« bedeutet hier offenbar nicht die optisch vorgestellte »Rückwendung auf sich«, sondern die oben behandelte »bewusste Selbstbezüglichkeit« im Sinne eines »Nachsinnens über sich«; erstere Bedeutung kommt ihm erst in der umgekehrten Variante zu, die vom Objekt-Pol ausgeht und die Genese des Subjekt-Pols daraus in einem Akt der Reflexion auf sich hinzugewinnen will: Dem Münchhausen-Modell. b) Das Münchhausen-Modell Was die Reflexion findet, scheint schon da zu seyn. (Novalis) Henrich nimmt wie gesagt auf, was Schmitz vorbringt, ergänzt es aber unter Berufung auf Fichte, indem er auch diejenige Variante dieser fehlerhaften Vorstellung problematisiert, vom Ich-Objekt des Selbstbewusstseins auszugehen. Mit diesem Ich-Objekt ist kein »äußerer« Gegenstand gemeint, sondern der Teil des Selbstbewusstsein, der gewusst wird, während das Ich-Subjekt derjenige ist, der weiß. Das Ich-Objekt ist also selbst Teil des sich seiner selbst bewussten Subjekts, aber eben der »objekthafte« Teil.19 In diesem Fall besteht das Problem darin, von einem Subjekt auszugehen, das »bisher« nur Bewusstsein von anderen Objekten, aber noch nicht von sich besitzt, also noch keinen Selbstbezug hat, dann auf sich reflektiert und so zu einem solchen kommt. Es wird zum Objekt seiner selbst, indem es sich als das Subjekt gegenüber Objekten, das es »bisher« war, objektiviert. Nun ist dieses Subjekt zum Ich-Objekt eines Ich-Subjekts geworden. Beides zusammen ist das Selbstbewusstsein, das durch diesen Akt der Selbstvergegenständlichung des Subjekts erst entstanden sein soll. Doch kann dieses »Sich« nicht erst in diesem Akt zu Stande kommen; vielmehr muss das Subjekt schon immer eben dieses selbe Ich-Subjekt gewesen sein: »Ich soll der sein, der sich reflektierend auf sich besinnt. Also muß der, welcher die Reflexion in Gang bringt, selbst 17 Henrich 1966, 210. Das Subjekt, das sich selbst als Objekt betrachtet, müsste im Betrachten sein Betrachten mitbetrachten, um wirklich Selbstbewusstsein zu sein. Fichte drückt dies seinerseits, seinen Lösungsversuch bereits andeutend, so aus: »Das Ich soll sich nicht nur selbst setzen für irgendeine Intelligenz außer ihm, sondern es soll sich für sich selbst setzen« (Fichte I, 274; Herv. S.P.). Womöglich hatte er also auch von diesem Modell schon eine Ahnung. 19 Dass der Terminus Subjekt hier zweimal auftaucht ist aus problemimmanenten Gründen nicht zu vermeiden: Im Selbstbewusstsein scheint das Subjekt sich ja in zwei Teile zu spalten. 18 10 schon beides sein, Wissendes und Gewußtes. Das Subjekt erfüllt somit die ganze Gleichung Ich=Ich. Doch durch Reflexion sollte sie erst zu Stande kommen«.20 In jedem Fall der Rede von Subjekt liegt schon ein Selbstbezug vor; er kann nicht durch die rückwendende Objektivierung erst zu Stande kommen.21 Um auf sich reflektieren zu können, muss es auf sich bereits bezogen sein, sonst wüsste es nicht, worauf es reflektieren sollte, es würde im Reflektieren nie sich finden. Kurz: Das selbstbezügliche »Sich« kann kein Ergebnis der Reflexion sein. »Reflexion kann nur bedeuten, daß ein bereits vorhandenes Wissen eigens ergriffen und damit ausdrücklich gemacht wird. Die Reflexionstheorie will aber nicht die Deutlichkeit, sondern den Ursprung des Selbstbewußtseins erklären«.22 Wer Selbstbewusstsein so erklären will, argumentiert zirkulär. Wir können dies als MünchhausenModell bezeichnen, da hier gleichsam versucht wird, sich am eigenen Schopfe aus dem Sumpf des Nicht-Sich ins Sich zu heben – ein aussichtsloses Unterfangen.23 Auch dieses Problem lässt sich als eines verdeutlichen, mit dem jede Intentionalitätstheorie des Bewusstseins betreffs des Selbstbewusstseins konfrontiert ist. Bewusstsein wäre gemäß dieser immer auf etwas gerichtet, immer Bewusstsein von etwas. Selbstbewusstsein nach diesem Modell zu denken, würde bedeuten, dass es auch Bewusstsein von etwas, nämlich sich selbst, wäre. Es müsste, gleichsam als auf sich zurück gerichteter Intentionalitätsstrahl, sich auf sich richten und als diese Intention der Intention wäre es Selbstbewusstsein. Wohin aber sollte es sich richten, wenn es noch nichts von sich weiß? Es könnte demnach entweder nie »zu sich« kommen und fände immer nur Anderes oder es wäre vorher schon es selbst, hätte dann aber diesen komplizierten Akt nicht nötig. »Wenn alles Bewußthaben Bewußthaben von etwas« wäre, »könnte Selbstbewußtsein nie stattfinden. Nun haben wir aber Selbstbewußtsein [...], also muß das zugrunde liegende Modell unhaltbar sein«.24 20 Henrich 1966, 194. Hier bedeutet Reflexion »Rückwendung«. Man sieht aber auch, dass dies von einem »Nachsinnen über sich« nicht gänzlich verschieden ist (vgl. Fußnote 2). 21 vgl. Henrich 1966, 193 f., 212. 22 Henrich 1966, 193 f. 23 Daraus hat Fichte geschlossen, dass das Ich sich selbst »setzen« bzw. immer schon gesetzt haben muss, da es anderweitig nicht ins Dasein zu treten vermöchte (vgl. z.B. Fichte I, 96). 24 Frank 1991b, 526. Hier ließe sich allerdings einwenden, das Intentionalitätsmodell von Brentano sei betreffs der Frage des Selbstbewusstseins komplexer, da es ein ständiges »Mitgegebensein« dessen als »sekundäres Bewusstsein«, welches alles »primäre« Bewusstsein von etwas begleite, beschreibe. Zu den nämlichen Problemen mit dem infiniten Regress, die hier auftreten und wiederum die Frage nach dem möglichen Bewusstsein des Ganzen betreffen vgl. z.B. Frank 1991b, 546 ff. oder Pothast 1971, 74 ff. Dieser meint, man werde bei der Rede vom »Gerichtetsein eines Vorgangs auf ein Objekt« zwangsläufig »genötigt [...] von einem Punkt zu sprechen, von dem der gerichtete Vorgang ausgeht; und ob der Ausgangspunkt in einem zusätzlichen ›Subjekt‹ oder das gesuchte ›subjektive‹ in dem Vorgang selbst liegt, ist, wenn er jenes Schema einmal angenommen hat, gleichgültig« (Pothast 1988, 55 f.). 11 c) Zusammenfassung Wie konnte man doch annehmen, daß durch Verknüpfung mehrerer Vorstellungen, in deren keiner das Ich läge, wenn nur die mehreren zusammengesetzt würden, ein Ich entstünde? (Fichte) Das Hase-und-Igel-Modell ist eine Strukturbeschreibung, die vom Ich-Subjekt ausgehend Selbstbewusstsein als Selbstzuschreibung deutet und in einen infiniten Regress gerät. Das Münchhausen-Modell ist eine genetische Erklärung, die vom Ich-Objekt ausgehend Selbstbewusstsein als Reflexion auf sich deutet und in einen logischen Zirkel gerät. Beide Modelle versuchen, den einen Pol aus dem anderen zu erklären. Selbstbewusstsein scheint etwas in sich geteiltes zu sein, weswegen es nahe liegt, es als zusammengesetzt zu verstehen und wie ein Chemiker die Verbindung zu analysieren. Wir haben gesehen, dass das nicht funktioniert. In beiden Fällen wurde schon vorausgesetzt, was erklärt werden sollte: der andere Pol. Beide können offenbar nicht isoliert betrachtet werden. Schon ihre begriffliche Trennung vereitelt ein Verständnis dessen, was Selbstbewusstsein ist, sowohl in struktureller als auch in genetischer Hinsicht. Schmitz und Henrich unterscheiden sich darin, dass Henrich vor allem die Unmöglichkeit einer genetischen Erklärung zu verdeutlichen sucht, indem er aufzeigt, dass dann schon vorausgesetzt wird, was erklärt werden sollte. Schmitz hingegen geht versuchsweise von einer Beschreibung der strukturellen Verfasstheit des Selbstbewusstseins aus und zeigt, dass es sich so nicht verhalten kann.25 Eine genetische Erklärung nimmt er von vorn herein nicht ernst und glaubt sogar, sie würde nur durch den irreführenden Ausdruck »Reflexion« nahe gelegt.26 Kierkegaard hat eine schöne Charakteristik des Selbstverhältnisses gegeben, die uns zur abschließenden Zusammenschau des Problems dienen kann: »Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, oder es ist in diesem Verhältnis jenes, dass dieses sich zu sich 25 Dabei setzt Schmitz ausschließlich auf den infiniten Regress. Henrich skizziert das Problem zumeist als logischen Zirkel, gelegentlich aber auch als Regress. Sicherlich lassen sich beide ineinander transformieren. Klaus Düsing etwa meint, der logische Zirkel müsse auf den Iterationseinwand rekurrieren, man können als diesen auf jenen anwenden. Der Iterationseinwand sei das allgemeiner gefasste Problem (vgl. Düsing 1997, 97 ff.). Für unsere Zwecke ist diese Prioritätsfrage nicht unmittelbar relevant. 26 Er spricht von einem »irreführenden Haften an der Metapher ›Reflexion‹, die zu der Annahme verführt, daß jedes Sichbewußthaben nachträgliche Rückwendung auf einen vorausgegangenen (noch reflexionsfreien) Zustand sei, während zugleich volle Identifizierung mit sich wie man leibt und lebt und u.a. auch reflektiert, zum Sichbewußthaben gehöre. Damit ist ein Widerspruch aufgetreten, der sogar einer doppelten Verführung durch die Metapher zur Last fällt: Erstens wird dem Ausdruck ›Reflexion‹ illegitim ein zeitlicher Sinn gegeben, vielleicht aufgrund so verbreiteter metaphorischer Reden wie der vom Zurückschauen in die eigene Vergangenheit; zweitens würde aber sogar das Bild eines augenblicklichen, zeitlosen Reflexionsprozesses (bei Annahme einer unendlichen Lichtgeschwindigkeit) immer noch Mittelbarkeit suggerieren und insofern dem Sichbewußthaben den Stempel des Sekundären, Nachträglichen aufprägen.« Was wir hier Münchhausen-Modell genannt haben, sei deshalb »nur ein Lernstück von der ›Sprachverführung des Denkens‹ (Friedrich Krainz) und kein ernst zu nehmendes Problem« (1982, 132). Es ist allerdings auch genau diese Sprachverführung im Begriff der Reflexion und der ihr zahlreich folgenden Theorien, die Henrich aufklären möchte! Inwiefern dieses stark an Heidegger angelehnte Vorurteil gegenüber den Vorurteilen, die angeblich im Begriff »Reflexion« liegen, gegen sich selbst gewendet werden kann, werden wir noch sehen (Kap. VIII.2). 12 selbst verhält; das Selbst ist nicht das Verhältnis, sondern dass sich das Verhältnis zu sich selbst verhält«.27 Wenn diese Beschreibung richtig ist, kann das Selbstverhältnis nicht aus dem Verhältnis resultieren. Keine noch so komplexe Kombinationen von Verhältnissen könnte ergeben, dass sich das Verhältnis zu sich selbst verhält, also ein »sich« produzieren. Selbiges gilt für den Ausdruck Reflexion: Zwar ist das Selbst ein reflexives Verhältnis, doch kann es nicht durch Reflexion zu Stande kommen oder nur darin bestehen. Was Henrich Reflexion, Schmitz’ Selbstzuschreibung oder Identifikation (»Das bin ich«), Kierkegaard Verhältnis und andere Intentionalität nennen, produziert immer dasselbe Problem: In diesen Ausdrücken allein kann man Selbstbewusstsein nicht beschreiben. Sie sind möglicherweise notwendig für Selbstbewusstsein – das wird noch zu klären sein –, sicher aber nicht hinreichend. Die Reflexion kann nur auf etwas reflektieren, das schon da ist oder nur jemand, der seinerseits schon »Selbst« ist, kann reflektieren. Das Verhältnis ist nur eines zwischen Zweien; um ein Wissen seiner zu sein, bedürfte es eines Dritten ganz eigener Art. Keine Identifikation kann mir sagen, dass ich das bin, womit identifiziert wurde. Intentionales Bewusstsein schließlich richtet sich per definitionem nur auf anderes, nicht aber auf sich; und selbst eine Intention der Intention würde kein Selbst in die Welt setzen.28 Wir sehen: »Selbstidentifikation ist für die Reflexionstheorie unvermeidlich und unerklärlich zugleich«.29 Zum Selbstbewusstsein gehört Identität. Die Identität des Selbstbewusstseins aber kann, anders als andere Identitäten, nicht durch Identifizierungen zu Stande kommen. Vielmehr setzt die Fähigkeit zu Identifizieren eine ursprüngliche Identität des Selbst voraus. Diejenige Art von Selbstbezüglichkeit, die wir Reflexion genannt haben, wird vollkommen unverständlich, wenn man der Versuchung nachgeht, sie nach dem Modus der Beziehung auf anderes verstehen zu wollen. Wer die Selbstbeziehung von Subjekten nach Art der Beziehung zu Objekten modelliert, begeht »den Fehler, das Ich nur als Objekt unter anderen vorzustellen«.30 Diesen komplizierten Sachverhalt wollen wir nun anhand dreier Beispiele betrachten. 27 Kierkegaard 1849, 13. Das Zitat klingt zwar prägnant, aber es ist doch schwer zu verstehen, weil »Verhältnis« hier offenbar mit ganz verschiedenen Bedeutungen belegt ist. Einmal ist es eine Relation, dann aber ein Verfügen über diese, das mehr ist als nur eine oder mehrere Relationen; wie dieses »mehr« näher zu bestimmen wäre, kann vorerst offen bleiben. 28 Vgl. dazu schon Jacobi: »was an sich keine Eigenschaft hat, in dem können durch Verhältnisse keine erzeugt werden, ja es ist nicht einmal ein Verhältniß in seiner Absicht möglich« (Jacobi 1789, 163). Dies kann als Vorwegnahme der Kritik an der »Reflexionstheorie« gedeutet werden (vgl. Sandkaulen 2004, 230 f.). Später meint Jacobi auch, »nicht erst hintennach durch Selbstvergleichung« könne sich ein Selbst finden »denn worin geschähe die Vergleichung [...] worin würde das Selbst dem Selbste gleich? Und was wäre das noch nicht gleichgesetzte Selbst, das Selbst noch ohne eigenes Seyn und Bleiben, das durch gleich- ungleich- und zusammensetzen, durch verknüpfen erst zu einem Selbste mit eigenem Seyn und Bleiben, mit eigenem Selbstsein würde? Wer endlich verübte alles dieses?« (Jacobi 1811, 26) 29 Henrich 1970, 267. 30 Henrich 1966, 195. 13 d) Beispiele Die Frage nach der Ich-Identität wird auch in soziologischen Diskursen gestellt. Als was man sich versteht, ist sicherlich im sozialen Miteinander, in Gruppenzugehörigkeiten fundiert. Was ich bin, mögen andere mir zuschreiben und ich mag mich dem fügen müssen. Ich mag etwa anerkennen müssen, dass ich in einer bestimmten Gesellschaft stigmatisiert bin. Um das zu können, benötige ich aber die Fähigkeit, zu verstehen, was es überhaupt bedeutet, als etwas stigmatisiert zu sein. Damit Fremdzuschreibungen nicht wie an einem Stein einfach abprallen, muss eine Angriffsstelle in mir vorhanden sein: Ich muss bereits befähigt sein, etwas als etwas und als zu mir gehörig anerkennen zu können. Die Vorstellung einer ursprünglichen Festschreibung einer Ich-Identität durch Fremdzuschreibung datiert also auf dasselbe Problem zurück, das wir im Falle der Selbstzuschreibung beobachtet haben. Selbstzuschreibungen unterscheiden sich, sofern ich nicht anderweitig meiner gewiss sein kann, nicht prinzipiell von Fremdzuschreibungen. Beide bestimmen bloß etwas als etwas. Ein solches etwas für mich selbst zu halten, besteht, wie die Paradoxie der Selbstzuschreibung gezeigt hat, solange kein Anlass, wie ich nicht aus anderweitiger Quelle als derjenigen der Zuschreibung weiß, dass ich bin und etwas bin. Ob ich mich selbst oder andere mich bestimmen ist in dieser Hinsicht offenbar irrelevant. Was ich mir selbst zuschreiben kann, kann mir auch jeder andere zuschreiben. Meine Eigenschaften können mich bestimmen, sie können mich aber nicht »besondern«, sie machen nicht, dass ich ich bin; sie sagen was, aber nicht wer ich bin (oder: wie es ist, all das zu sein).31 Das bloße Vorhandensein meiner Eigenschaften macht mich ebenso wenig zu mir wie Identifikationen mit etwas. Um mich als etwas zu bestimmen oder bestimmt zu werden, muss bereits eine Instanz vorhanden sein, die dies in beiden Fällen sozusagen »mit sich machen lässt«. Dass ich bin und ich selbst bin, kann darauf, dass andere mich für etwas halten, ebenso wenig zurückgeführt werden, wie darauf, dass ich mich für etwas halte. Kurz: Subjektivität im hier gemeinten Sinne kann schwerlich als das Ergebnis von »Subjektivierungen«,32 einem Gemenge aus Fremd- und Selbstzuschreibungen, verstanden werden noch überhaupt auf Intersubjektivität reduziert werden.33 Solche Ansätze scheinen Selbstbewusstsein auf Kombinationen von Verhältnissen reduzieren zu müssen.34 31 Diese Termini verweisen schon auf spätere Überlegungen (Kap. IV.2b und Anhang II). Vgl. Foucault 1975. 33 Was für »Subjektivierungen« gilt, ließe sich auch für intersubjektive Verständigungs- oder »Signifikationsprozesse« ausführen wie sie von linguistisch orientierten etwa poststrukturalistischen oder sprachanalytischen Philosophen vor allem im Anschluss an Heidegger und Wittgenstein bemüht wurden, um die Gegenüberstellung von Subjekt und Objekt zu überwinden (vgl. dazu Kap. VII.3, ferner Frank 1983, bes. 279 ff. sowie Frank 1991a, 158 ff.). Ein Beispiel für eine linguistisch inspirierte Soziologie der Rückführung von Subjektivität auf Intersubjektivität bietet Habermas (vgl. z.B. Habermas 1988). 34 Damit soll die Kraft soziologischer Erklärungen betreffs dessen, als was wir uns verstehen und deuten, in keiner Weise angezweifelt werden. Dafür sind sicherlich »Subjektivierungen« verantwortlich. 32 14 Selbiges gilt für die Vorstellungen, man könne durch Blick in einen Spiegel oder Betasten der eigenen Gliedmaßen Selbstbewusstsein »erlernen«. Darauf wollen wir noch kurz eingehen. Die Frage, ob Tiere und ab wann Menschenkinder Selbstbewusstsein haben, wird oftmals durch einen Test zu beantworten versucht, in dem untersucht wird, ob sie sich im Spiegel erkennen. Vermutlich ist es hinreichend für Selbstbewusstsein, sich im Spiegel zu erkennen: Wer sich dort sieht, hat Selbstbewusstsein, da er sich als sich selbst erkennt, also von sich weiß. Damit ist aber höchstens die Frage beantwortet, ob jemand Selbstbewusstsein hat. (Und dies scheint für manche Tiere zu gelten.35) Eine Erklärung, wie es zu Stande kommt, ist damit nicht gegeben. Anders gesagt: Sich im Spiegel zu erkennen, ist nicht notwendig für Selbstbewusstsein. Denn um etwas im Spiegel von etwas hinter einer Scheibe unterscheiden zu können und für sich selbst zu halten, muss schon ein – wie auch immer geartetes – Bewusstsein davon vorhanden sein, was dafür in Frage kommt, als »man selbst« zu gelten. Wer das nicht hat, wird auf ewig dumpf in den Spiegel starren und nichts verstehen. Sich im Spiegel zu erkennen, kann also nur ein Wiedererkennen sein; man kann so nicht ursprünglich »Bekanntschaft mit sich machen«. So wie Selbstzuschreibung und -reflexion eine solche Bekanntschaft voraussetzen, so auch Selbstwahrnehmung. Der Spiegel ist ein Prüfstein, aber weder eine Erklärung noch eine vollständige Beschreibung des Phänomens Selbstbewusstsein – genau wie die Reflexion.36 Selbiges gilt für das Betasten der eigenen Gliedmaßen:37 Berührungen der eigenen Körperteile können nicht verständlich machen, was »eigen« bedeutet. Wieso nicht? Die damit verbundenen Vorstellung würde bedeuten, dass ein Körperteil einen anderen berührt, so dass dann, weil im Gegensatz zu Berührungen fremder Körper hier eine »Rückmeldung« vorhanden ist, bemerklich würde, dass dies mein Körper ist und nicht der eines anderen sei. Wer aber sollte diese Rückmeldung erhalten? Um eine solche verstehen zu können, müsste auch bei Betastung anderer Körper etwas diese bereits als andere gegenüber den eigenen ausgezeichnet haben. So kann deswegen kein Selbstgefühl oder -wissen entstehen, weil sie irgendeine Art von Kenntnis darüber voraussetzen, dass zumindest eines der Körperteile 35 Als da wären: Schimpanse, Orang-Utan, Delfin, Elefant und neuerdings angeblich auch die Elster! (vgl. Prior/Schwarz/Güntürkün 2008) 36 Noch deutlicher wird die Verwechslung von Ursache und Wirkung in solchen Erklärungen anhand eines ähnlichen Beispiels: Kinder wissen irgendwann, dass sie, wenn sie die Augen verschließen, für Andere dennoch sichtbar sind. Vorher nehmen sie an, das Verschwinden ihres eigenen Sichtfeldes wäre gleichbedeutend mit dem Verschwinden der Welt für alle. Natürlich »wissen« sie das nicht theoretisch, sondern sie handeln de facto so, in dem sie sich beim Versteckspielen die Augen zuhalten und denken, so nicht gefunden werden zu können. Kinder, die verstanden haben, dass dies so nicht geht, haben offenbar die Unterscheidung von Eigenem und Fremdem, von Ich- und Er-Perspektive verstanden und insofern wäre dies ein geeigneter Prüfstein dafür, ob dies der Fall ist. Es wäre aber äußerst unplausibel zu behaupten, Kinder würden durch das Augenzuhalten beim Versteckspielen die Unterscheidung in Eigenes und Fremdes erlernen. 37 Nach diesem Schema stellt sich Condillac die allmähliche Genese auch des Selbstbewusstseins vor (vgl. Condillac 1754, 78 f.). 15 schon meins ist. Ohne eine solche wären die Berührungen so oder so ein anonymes Geschehen, das den wechselseitigen Berührungen von Ästen einer Weide im Wind gliche. Selbstberührungen können ein solches »Wissen« also höchsten aktualisieren, es aber allein nicht ins Leben rufen. Wer gar nicht wüsste, was »mein« bedeutet, würde »seine« eigenen Körperteile auf ewig wie alle anderen Körper behandeln und käme nicht auf die Idee des Meinigen. Kant stößt auf das nämliche Problem als er in einer Vorlesung erklären will, was es heißt, einen Körper zu haben: »Mein Körper heißt: Der Körper –, dessen Veränderungen meine Veränderungen sind«. Da das offenbar die Frage nicht beantwortet, sondern verschiebt, fügt er hinzu: »mein läßt sich nicht erklären«.38 Kantianische Vorstellungen über das Selbstbewusstsein sollen uns nun auch als nächstes beschäftigen. III. Exkurs I: Exemplarische Versuche, die Paradoxien zu vermeiden Wenn es also Selbstbewusstsein gibt, wovon wir stillschweigend ausgegangen sind, dann wissen wir jetzt wie es nicht erklärt oder beschrieben werden kann, weil die Erklärung oder Beschreibung in Aporien führt. Im Folgenden wird daher herauszufinden sein, wie wir es erklären können. Bevor wir dies aber in Angriff nehmen, drängt sich noch eine andere Möglichkeit auf: Was, wenn unsere stillschweigende Voraussetzung falsch war? Vielleicht gibt es gar kein Selbstbewusstsein oder nicht in dem Sinne, in dem wir es bisher aufgefasst haben: als bewusste reflexive Relation mit Subjekt-Objekt-Identität. Die vertrackten Paradoxien könnten allerdings zu solchen Schlussfolgerungen verleiten. Wir hätten es dann mit – womöglich verwirrendem Sprachgebrauch geschuldeten – Scheinproblemen zu tun; die Paradoxien lägen nicht in der Sache, sondern an unserer falschen Herangehensweise. Von den nun zu behandelnden zwei Positionen tendiert die erste lediglich zur Leugnung des Selbstbewusstsein im Sinne der reflexiven Subjekt-Objekt-Identität, die sie für »undenkbar« hält, die zweite hingegen zur gänzlichen Leugnung: Sie hält »das Ich« für »unrettbar«. Wo die erste an der reflexiven Relation Selbstbewusstsein lediglich die Reflexivität bestreitet oder für unerklärbar erklärt, sucht die zweite gar die Relationalität zu eliminieren. Während die erste vor allem mit der Paradoxie der Zweieinigkeit beschäftigt ist, wird die zweite auch als Antwort auf die der Selbstzuschreibung bzw. Reflexion gebraucht. 38 Kant 1924, 592. 16 1. »Das Ich ist undenkbar« (Der Neukantianismus und Kant) Das Ich verschwindet uns immer, wenn wir es fixieren wollen. (Novalis) Der Neukantianer Rickert schreibt: Ich weiß von mir. Den Satz versteht jeder, und ihn wird niemand bestreiten, der selbst ein Ich ist. Er ist ebenso gewiß, wie daß ich bin. Ja, nur weil ich von mir weiß, weiß ich, daß ich bin. Das Wesen des Ich besteht geradezu darin, daß es von sich wissen und sich dann als objektivierten Inhalt im Bewußtsein haben kann.39 So stößt er auf die Paradoxie der Zweieinigkeit: »Ich bin wissendes Subjekt und zugleich gewußtes Objekt. Das scheint dem Identitätsprinzip zu widersprechen, und in der Tat, dasselbe Ich kann nicht sowohl Subjekt als auch Objekt sein«. Dennoch muss aber, so Rickert, verständlich gemacht werden, was der genannte Satz »Ich weiß von mir« dann bedeuten soll, wenn, wie er meint, »Ich« und »mir« im Satz nicht dasselbe bedeuten können. Er muss »einen Sinn haben«, aber »es wäre ganz sinnlos«, damit die Identität von Wissendem und Gewusstem zu behaupten. Müßten wir das, dann wäre das von sich wissende Ich allerdings die ewige Paradoxie, der unlösbare Weltknoten, die Grenze aller Philosophie überhaupt. Wollen wir das nicht annehmen, so bleibt uns nur die eine Möglichkeit, das gegenwärtige wissende Ich [...] als einen anderen Teil des gesamten Ich zu betrachten als das gegenwärtige gewusste Ich. So kommen wir zu dem Ergebnis: das ganze Ich kann nie wissendes und gewußtes zugleich sein. [...] Soll das Wort ›Selbstbewusstsein‹ nicht Identität von Subjekt und Objekt, also einen verkörperten Widerspruch bedeuten, so bleibt nur diese Annahme einer Teilbarkeit des psychischen Subjekts übrig 40 Auch im Falle des Selbstbewusstseins stellt also – wie gemäß der zu Grunde liegenden Erkenntnistheorie in jeder Erkenntnis – ein Subjekt ein Objekt vor. Beide sind nicht identisch, sondern Teile eines Ganzen, das sich sozusagen zum Zwecke der Selbsterkenntnis aufspaltet. Das ist ein nahe liegender Versuch, die Paradoxie zu umgehen. Natorp argumentiert ähnlich wie Rickert und ebenfalls auf der Grundlage einer neukantianischen Erkenntnistheorie, dass Subjekt und Objekt im Selbstbewusstsein nicht identisch sein können: [...] so wie die Netzhaut nicht buchstäblich sich selbst sehen kann, sondern allenfalls nur ihr Gegenbild im Spiegel, so kann das Bewußtsein nicht wiederum sich selber bewußt sein im eigentlichen Sinne, sondern nur gleichsam durch seinen Reflex im Inhalt. [...] also muß wohl das Objekt des Akts, den wir Selbstbewußtsein nennen, nicht mehr das ursprüngliche Ich, sondern ein abgeleitetes sein.41 Demnach würden wir uns nur im Widerschein der Objekte unserer Erkenntnis erkennen, nur auf uns zurückkommen, unserer aber nicht »an uns selbst« habhaft werden können.42 Natorp schließt aus seinen Überlegungen dann aber doch auf ein ursprüngliches Ich als Erkenntnissubjekt, das in eigentümlicher Weise ungegenständlich ist und so alle Gegenständlichkeit begründen können soll. Er meint 39 Rickert 1892, 38. Rickert 1892, 38 f. 41 Natorp 1912, 30. 42 Interessanterweise ist das bis hierher der Heideggerschen Vorstellung einer zeitlichen Entwurfs- und Entzugsstruktur des »Daseins« gar nicht fern. 40 17 daß das ursprüngliche, reine Ich, das Ich der Bewußtheit, in eigentlicher Bedeutung weder Tatsache noch Existierendes noch Phänomen ist. Aber die Paradoxie hebt sich auf, sobald man sich klar macht: es ist Grund aller Tatsache, Grund aller Existenz, alles Gegebenseins, alles Erscheinens; nur darum kann es selbst nicht eine Tatsache, eine Existenz, ein Gegebenes, ein Erscheinendes sein.43 Da diese neukantianischen Ansätze auf Kant zurückdatieren, wird es dienlich sein, auch auf diesen noch einen Blick zu werfen. Wie Natorp findet es auch Kant sehr einleuchtend: daß ich dasjenige, was ich voraussetzen muß, um überhaupt ein Objekt zu erkennen, nicht selbst als Objekt erkennen könne, und daß das bestimmende Selbst, (das Denken) von dem bestimmbaren Selbst (dem denkenden Subjekt) wie Erkenntnis vom Gegenstande unterschieden sei.44 Erkenntnis hat nach Kant stets Subjekt-Objekt-Struktur. Das empirische (bestimmbare) Selbst ist ein Objekt unter anderen und vom Erkenntnissubjekt, dem transzendentalen (bestimmenden), verschieden. Zugleich soll es aber doch mit ihm identisch sein: Ich als Subjekt und Ich als Objekt sind dasselbe, weswegen Kant betont, durch die Trennung sei nicht eine doppelte Persönlichkeit gemeint, sondern nur Ich, der ich denke und anschaue, ist die Person, das Ich aber des Objekts, was von mir angeschaut wird, ist, gleich andern Gegenständen außer mir, die Sache. Von dem Ich in der erstern Bedeutung (dem Subjekt der Apperzeption) ist schlechterdings nichts weiter zu erkennen möglich, was es für ein Wesen, und von welcher Naturbeschaffenheit es sei; es ist gleichsam, wie das Substanziale, was übrig bleibt, wenn ich alle Akzidenzien, die ihm inhärieren, weggelassen habe, das aber schlechterdings gar nicht weiter erkannt werden kann, weil die Akzidenzien gerade das waren, woran ich seine Natur erkennen konnte. Das Ich in der zweiten Bedeutung (als Subjekt der Perzeption), das psychologische Ich, als empirisches Bewußtsein, ist mannigfacher Erkenntnis fähig [...].45 Wir kennen uns nur durch die Attribute, die uns zukommen, insofern wir etwa Gedanken oder Anschauungen haben. Wenn das allerdings alles wäre, so würden wir »ein so vielfärbiges, verschiedenes Selbst haben, als ich Vorstellungen habe, deren ich mir bewußt bin«,46 da Gedanken und Anschauungen allezeit wechseln. Dass wir uns als im Wechsel der Vorstellungen identisches Selbst erleben, führt Kant zur Annahme eines transzendentalen Subjekts (»der Apperzeption«) als eine Art Ankerpunkt, der synchron (analytische Einheit) wie diachron (synthetische Einheit) bei allen Vorstellungen mitschwebt und unser Erleben so überhaupt erst zu einem einheitlichen, nicht-chaotischen macht, so dass wir sagen können: »Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können«.47 Über das transzendentale Subjekt wissen wir allerdings empirisch nichts und transzendentallogisch nur diese Kleinigkeit, dass es in Analogie zu einer beharrlichen Seelensubstanz gedacht werden kann, die bei Weglassung aller Attribute übrig bleiben würde – eine dann allerdings bloß hypothetische Vorstellung, da ein solcher Zustand jenseits jeder Erfahrbarkeit liegt.48 »Das Denken selbst« – so spricht Kant im Zitat vom »transzendentalen Subjekt der Apperzeption« 43 Natorp 1912, 32. Kant, KrV, A 402. 45 Kant 1804, A 36 f. 46 Kant, KrV, B 134. 47 Kant, KrV, B 131; Herv. S.P.: Das »können« ist entscheidend. Man muss sich darauf besinnen können, es aber nicht jederzeit aktuell »bei sich führen«. 48 Seltsamerweise kennen wir aber eine Eigenschaft des transzendentalen Subjekts doch: Es ist – wie das Denken überhaupt – spontan und nicht rezeptiv (vgl. Kant 1804, A 37; KrV, B 278). 44 18 – kann nicht seinerseits nochmals Gegenstand des Denkens werden, denn »Gedanken, als faktische Bestimmungen des Vorstellungsvermögens, gehören auch mit zur empirischen Vorstellung unseres Zustands«.49 Dasjenige, was da die Gedanken denkt, ist eine bloße Voraussetzung. Wir kennen uns nur, wie wir uns erscheinen und nicht, wie wir an uns selbst sind. Nichts Substanzielles haben wir am transzendentalen Ich, sondern nur einen notwendig anzunehmenden, leeren Punkt: die einfache und für sich an Inhalt gänzlich leere Vorstellung: Ich, von der man nicht einmal sagen kann, daß sie ein Begriff sei, sondern ein bloßes Bewußtsein, das alle Begriffe begleitet. Durch dieses Ich oder Er oder Es (das Ding), welches denkt, wird nun nichts weiter als ein transzendentales Subjekt der Gedanken vorgestellt = x, welches nur durch die Gedanken, die seine Prädikate sind, erkannt wird und wovon wir, abgesondert, niemals den mindesten Begriff haben können, um welches wir uns daher in einem beständigen Zirkel herumdrehen, indem wir uns seiner Vorstellung jederzeit schon bedienen müssen, um irgend etwas von ihm zu urteilen.50 Dass da etwas ist, müssen wir transzendental voraussetzen, um die Einheit der Erfahrung zu erklären, ohne sagen zu können, was es ist. Jeder Versuch, Sachhaltiges über das transzendentale Subjekt anzugeben, muss scheitern, da Erkenntnis an die Subjekt-ObjektRelation gebunden ist. Um des Subjekts, das in all diesen Akten erkennt, selbst habhaft zu werden, müssten wir nach Kants Vorstellung gleichsam aus uns selbst heraustreten oder über intellektuelle Anschauung verfügen – beides ist uns versagt. Das transzendentale Subjekt ist ein rätselhaftes Zwitterwesen, das zwischen allen Stühlen steht und sich jedem Zugriff entzieht. Nicht nur ist es ebenso wenig eine Anschauung wie ein Begriff – denn ein solcher wäre völlig leer –, sondern als transzendentale Voraussetzung auch weder Erscheinung noch Ding an sich. Abgesehen davon, dass man fragen könnte, wie man denn überhaupt etwas davon wissen könne – ein Problem, das sich freilich durch Kants gesamtes transzendentalphilosophisches Unternehmen zieht – ist hier vor allem die vorausgesetzte Identität des transzendentalen mit dem empirischen Subjekt fraglich. Besteht diese Identität, so scheint das Subjekt tatsächlich gespalten, zugleich identisch und verschieden zu sein. Selbstbewusstsein wäre dann die paradoxe, selbstbezügliche Subjekt-Objekt-Identität. Besteht sie nicht, so könnte nichts diejenige Objekterkenntnis, die einer von sich hat, von der Erkenntnis fremder Objekte unterscheiden. Konsequentermaßen müssten dann alle dem Subjekt gegenüberstehenden Objekte gleichermaßen »fremd« sein. Es gäbe dann mangels Meinigkeit gar kein Selbst-, sondern nur Objektbewusstsein; dies war Rickerts implizite Konsequenz. So steht das empirische Selbst gleichsam zwischen Subjekt und Welt und macht das Faktum des Selbstbewusstseins, das für Kant unzweifelhaft besteht, ganz unverständlich. 49 50 Kant 1804, A 37. Kant, KrV, B 404. Hier scheint Kant auf Lichtenbergs »Es denkt« anzuspielen. Vgl. den nächsten Abschnitt. 19 Ich bin mir meiner selbst bewußt, ist ein Gedanke, der schon ein zweifaches Ich enthält, das Ich als Subjekt, und das Ich als Objekt. Wie es möglich sei, daß ich, der ich denke, mir selber ein Gegenstand (der Anschauung) sein, um so mich von mir selbst unterscheiden zu können, ist schlechterdings unmöglich zu erklären, obwohl es ein unbezweifelbares Faktum ist.51 Unverständlich ist die Tatsache, der offenbaren Subjekt-Objekt-Identität im Selbstbewusstsein für Kant ebenso wie für Rickert. Anders als bei diesem folgt für Kant daraus aber mitnichten, dass es uminterpretiert werden muss. Es ist ein unbezweifelbares Faktum. Wir begreifen es aber nicht. Als »das Vehikel aller Begriffe überhaupt«52 ist es selbst keiner begrifflichen Erkenntnis zugänglich. Wir können davon »niemals den mindesten Begriff haben«53 und auf die Frage nach ihm »keine andere als tautologische Beantwortungen [...] geben«.54 Das Selbstbewusstsein ist wie es ist, aber dieses sein Sein ist gleichsam an sich selbst eine Paradoxie. »Das Ich«, meint Kant, »ist eine Unerklärliche Vorstellung«.55 Anders als Rickert, der diese Unerklärlichkeit in Erklärlichkeit umzuinterpretieren sucht, lässt Kant sie aber als solche stehen. Wie so vieles andere in seinem Denken, dem er Unerklärlichkeit zuspricht, – etwa der Freiheit und dem kategorischen Imperativ, die beide nicht unwesentlich mit dem Selbstbewusstsein zusammenhängen – könnte man daher mit Lyotard sagen, das Selbstbewusstsein sei für Kant »ein legitimes Paradox«,56 in dem wir als Wesen mit dem »Vermögen, zu sich selbst Ich zu sagen«57 stets schon stecken. Fassen wir noch einmal zusammen: Der Paradoxie der Zweieinigkeit wird hier begegnet, indem Selbstbezüglichkeit im strikten Sinne geleugnet wird. Selbstbewusstsein soll keine reflexive Relation sein, sondern eine einfache. Rickert schlug eine Teilung des Ich vor, das so »in sich« eine Relation wäre, aber nicht »an sich«, als Ganzes. Darüber wird aber ganz unklar, wie die doch vorausgesetzte Einheit des Ich dann gewahrt und gewusst werden kann, zumindest, wenn die Voraussetzung gelten soll, dass jede Erkenntnis einer Subjekt-ObjektStruktur anheim gestellt ist, die Probleme macht, wenn man sie auf sich selbst anzuwenden sucht, also fragt, wie man innerhalb ihrer von ihr wissen kann. Dies rührt von Kant her, der aber immerhin zugab, das Paradox nicht lösen zu können und Selbstbewusstsein im genannten Sinn einer Subjekt-Objekt-Identität als »schlechterdings unmöglich zu erklärendes« Faktum aporetisch stehen ließ. Wir können Theorien, welche Selbstbewusstsein als Bewusstsein vom Träger des Bewusstseins, also in einem vorgängigen Ich oder Subjekt suchen – nach Sartre – als egologische Theorien des Selbstbewusstseins bezeichnen. Dazu gehören auch die Theorien 51 Kant 1804, A 36. Kant, KrV, B 399. 53 Kant, KrV, B 404. 54 Kant, KrV, A 366. 55 Kant 1926, 465 (Refl. 4225). 56 Lyotard 1991, 44. 57 Kant 1804, A 35. 52 20 von Kant und den Neukantianern.58 Für sie gibt es ein allem vorgängiges Selbst, aber kein Selbstbewusstsein im eigentlichen Sinne, so dass sie die Paradoxie nicht eigentlich beseitigen, sondern, im Falle Kants, als solche stehen lassen oder, im Falle der Neukantianer, durch ihre dogmatischen erkenntnistheoretischen Prämissen, die sie zwingen, die reflexive Relationalität des Selbstbewusstseins zu verkennen, nur in neue Paradoxien geraten und der Einheit des Selbstbewusstsein am Ende doch wieder verlustig gehen. Wenn in Ansehung der Paradoxie der Zweieinigkeit die Subjekt-Objekt-Identität aus dem transzendentalen Subjekt weginterpretiert und dadurch eigentlich mehr verdrängt als beseitigt wird, versteht man nicht mehr, wie man davon etwas wissen kann und findet sich in der Nähe der Paradoxie der Selbstzuschreibung wieder, welche das Problem des Bewusstseins der Identität problematisiert – hier gleichsam die »Wiederkehr des Verdrängten«. Das Ich ist nicht nur undenkbar, sondern auch unhintergehbar: Wir können ihm nicht auf den Grund gehen, weil es selbst dann noch unser Grund wäre, hinter unserem Rücken auf uns wartete. Es verkündet stets sein: »Ich bin schon da«, wir können es nicht einholen und finden uns unversehens vom Regen in die Traufe geraten – nämlich von der einen (Kap. II.1) in die andere (Kap. II.2) Paradoxie. Wir halten fest: Egologische Theorien des Selbstbewusstseins verfallen tendenziell dem Reflexionsmodell.59 Um die Probleme, die reflexive Relationen mit sich bringen, zu lösen, ließe sich neben der eben betrachteten Leugnung der Reflexivität ebenso eine der Relationalität denken. Johannes Rehmke, der zeitgleich mit den Neukantianer lehrte, hat deren Probleme erkannt und spricht daher von einem »beziehungslosen Haben«,60 einem Haben also, das nicht etwas hat oder gehabt wird, sondern ein »Haben an sich«. Derartige Konsequenzen aus der Problematik der Einheit im Selbstbewusstsein wollen wir nun behandeln. 58 vgl. Sartre 1936, 47. Dem widerspricht betreffs Kant Sturma 2008, 573: Dieser verfolge eine »nichtegologische Theorie«. Solche versuchen, Selbstbewusstsein als Bewusstsein von Akten oder Gegenständen von Akten zu deuten (vgl. Kap. IV.3, VII.2, VII.3 und Frank 2007, 417). 59 Fichte versuchte, sich dem Reflexionsmodell auf egologischer Grundlage zu stellen. Sein Beispiel zeigt, dass egologische Theorien nicht notwendig reflexiv sein müssen. »Irreflexiv« und »nicht-egologisch« fallen dem entsprechend ebenso wenig zusammen. Was Kant angeht, soll hier nicht die in der Forschungsliteratur umstrittene Frage entschieden werden, ob er den Problemkomplex der Paradoxie der Selbstzuschreibung bzw. Reflexion gesehen hat und ihr vielleicht gar zu entgehen versuchte (Pro: Düsing 1997; Contra: Schmitz 2003c, Frank 1991b). 60 Vgl. Rehmke 1918, 39 ff. 21 2. »Das Ich ist unrettbar« Es denkt, sollte man sagen, so wie man sagt: es blitzt. Zu sagen »cogito«, ist schon zu viel, sobald man es durch »Ich denke« übersetzt. (Lichtenberg) a) Das Problem und Pothasts Konsequenz Vergegenwärtigen wir uns nochmals die Problemlage in einer Form, die gleich zum nächsten Punkt weiterführt. Die Schwierigkeit, auf welcher die Paradoxie der Selbstzuschreibung beruht, lässt sich auch als Grundproblem von Einheit und Vielheit des Bewusstseins beschreiben. Was angesichts ihrer unklar wurde, war ja, dass ein Subjekt sich als eines seiner bewusst wird und nicht in Selbstzuschreibungen verliert; ebenso muss es ein Subjekt sein, das sich verschiedener anderer Dinge bewusst wird, etwa der Relation zwischen zwei Dingen. Schmitz meint, daß ein Fall einer Relation nur dem bewußt sein kann, dem auch die Beziehungsglieder bewußt sind [...] Das ist aber nicht möglich, wenn ein Teil von ihm diesen, ein anderer Teil jenen Gegenstand bewußt hätte; dann fehlte es an der für das Relationsbewußtsein nötigen Zusammenschau, und die entsprechenden Gedanken stünden unvermittelt neben einander, wie in der losen Assoziation bei Gedankenflucht. Also muß das Referens des Bewußthabers der mehreren Objekte bei Relationsbewußtsein ungeteilt und insofern einfach sein; da ihm beliebige Objekte im Horizont seines Bewußtseins für das Relationsbewußtsein zugänglich sind, muß ein einfacher Bewußthaber für alle diese Objekte ausreichen (1999a, 134 f.). Es scheint also auf Grund dessen die Annahme eines einheitlichen Subjekts, etwa einer immer währenden Seele, angezeigt zu sein. Es sei jedoch andererseits »das Argument [...] unbefriedigend, weil der Sprung von der Einfachheit zur Vielheit des Bewußthabens nicht einsichtig wird« (1999a, 135). Wie kann eine einfache Seele Verschiedenes »bewussthaben« ohne sich in es zu verlieren? Schmitz versucht dem Argument daher zu entgehen und meint, es gebe nur zwei Wege sich der Stringenz des Arguments zu entziehen. Der eine ist die Bestreitung der Subjektivität, der Verzicht auf Bewußthaber [...] Wenn es keinen Bewußthaber gibt – niemanden, der denkt, fühlt, spricht, tut und leidet, sondern nur entsprechende neutrale Ereignisse – kann es auch keinen einfachen Bewußthaber geben und die Einheit des Relationsbewußtseins wird zu einer bloßen Gestaltqualität nach Art einer Melodie (1999a, 135). Bevor wir dazu kommen, was Schmitz’ zweiter Weg, seine Lösung des Problems und ineins damit der Paradoxie der Selbstzuschreibung ist und was er gegen diesen ersten einwendet, sehen wir uns genauer an, wie man auf die Idee kommen kann, diesen ersten Weg zu beschreiten, Selbstbewusstsein im Sinne eines Habers des Bewusstseins prinzipiell zu leugnen und so der verhängnisvollen Relationsproblematik zu entgehen. Dazu sollen uns die Überlegungen von Ulrich Pothast als Leitfaden dienen, der sich ausführlich mit den von Schmitz und Henrich formulierten Paradoxien des Selbstbewusstseins, ihrer Behandlung bei Fichte und dessen paradoxen Lösungsversuchen auseinandergesetzt hat. Die Schwierigkeiten beim Versuch zu verstehen, was Selbstbewusstsein sei, verleiten Pothast nicht dazu, eine neue 22 Theorie dessen zu konzipieren. Seine Konsequenzen sind radikaler. Eben die Paradoxien, die notwendig die gemeinhin gängigen subjektphilosophischen Ansätze hinter ihrem Rücken am Selbstbewusstsein scheitern lassen und selbst bei Fichte, der sie bemerkt, nur paradoxe Lösungsvorschläge produzieren, legen seiner Ansicht nach nahe, Selbstbewusstsein im Sinne einer bewussten, reflexiven Relation für unmöglich und ergo unwirklich zu erklären, zu »leugnen, daß es ein Phänomen dieser Art überhaupt gibt und also das, was dafür gehalten wurde, anders [zu] bestimmen«.61 Zunächst wollen wir sehen, inwiefern er zur Leugnung des Phänomens neigt und auf welche historischen Vorläufer er sich dahingehend beruft. Anschließend untersuchen wir, wie er das Phänomen »anders bestimmen« möchte. b) Das Ich als Vorfindung (Pothast, Empiriokritizismus, Hume) In einem Satz ausgedrückt lautet Pothasts Konsequenz: »Es gibt nicht zusätzlich zum Bewußtsein noch ein Subjekt seiner«.62 Sobald man das annehme, verstricke man sich in Widersprüche, da »die naheliegende Frage, für wen die Daten des Bewußtseins da sind, auf einen Regreß von Subjekten führt, wenn man sie so beantworten will, daß man zusätzlich zu ihnen [d.h. den Daten; S.P.] ein Wissendes annimmt«.63 Um die infinit regressalen Probleme mit der Selbstbezüglichkeit und dem Bewusstsein ihrer zu umgehen, sei es »sinnvoll, die Gewohnheit, das Bewußtsein mit einem Eigentümer zu verbinden, überhaupt fallenzulassen«.64 Man müsse die Vorstellung eines solchen vorgängigen bzw. noch hinzukommenden Subjekts aufgeben. Zwar gebe es Bewusstsein, aber nicht für jemanden, der Bewusstsein habe, also kein Selbstbewusstsein eines Subjekts: »Wenn man das, was im Bewußtsein auftritt, als Gegebenes bezeichnet, so wird man sagen müssen, daß dieses Gegebene niemandem gegeben ist«.65 Da die Vorstellung eines »Ich, das dem Bewußtsein gegenübersteht und als ein anderes seine Gegebenheiten ›hat‹ [...] ein sehr unverständliches Ding« sei, sei man »gehalten, die skeptischen Zweifel, die seit Hume immer wieder an der Existenz geäußert wurden, für ganz berechtigt hingehen zu lassen«.66 Neben Hume sind solche Zweifel vor allem im so genannten »Empiriokritizismus« geäußert worden, der sich in Gestalt eines antimetaphysischen Szientismus als besonders radikaler Empirismus gab, so eine der Bezugsgrößen für spätere »Positivisten« darstellte und Ende des 19. Jahrhunderts von Richard Avenarius und Ernst Mach, zunächst unabhängig voneinander, vertreten wurde. Wir behandeln ihn hier, weil er wichtig ist, um einerseits Schmitz’ Position 61 Pothast 1971, 84. Pothast 1971, 56. 63 Pothast 1971, 67. 64 Pothast 1971, 59 65 Pothast 1971, 67. 66 Pothast 1971, 57. 62 23 in Anlehnung daran und Abgrenzung davon zu verstehen und Pothast sich andererseits tatsächlich darauf beruft, wenn er schreibt: »Die Abkehr vom Ich, das [...] dem Bewußtsein gegenübersteht und es ›hat‹, ist [von Mach67; S.P.] nicht unbillig als kopernikanische Wende beschrieben worden«.68 Avenarius schreibt: »Das Ich-Bezeichnete ist selbst nichts anderes als ein Vorgefundenes, und zwar ein im selben Sinn Vorgefundenes wie etwa ein als Baum Bezeichnetes. Nicht also das Ich-Bezeichnete findet den Baum vor, sondern das Ich-Bezeichnete und der Baum sind ganz gleichmäßig Inhalt eines und desselben Vorgefundenen«.69 Man solle dem gemäß nur noch von »Vorfindungen«, nicht aber von Vorfindendem und Vorgefundenem sprechen, um »das Befreitsein von [...] dem Gegensatz Subjekt-Objekt [...] zum Ausdruck zu bringen«.70 Dem sehr ähnliche Thesen stellt Ernst Mach auf: Er meint »daß die Welt nur aus unsern Empfindungen besteht«.71 Was wir für Dinge halten, wären dann nur Empfindungskomplexe von relativer Stabilität (vgl. II.1, 80). Das gilt nicht nur für »außenweltliche« Dinge, sondern auch für das Ich. »Nicht das Ich ist das Primäre, sondern die [...] Empfindungen«. Sie bilden das Ich. Ich empfinde Grün, will sagen, daß das Element Grün in einem gewissen Komplex von anderen Elementen (Empfindungen, Erinnerungen) vorkommt. Wenn ich aufhöre Grün zu empfinden, [...] kommen die Elemente nicht mehr in der gewohnten geläufigen Gesellschaft vor. [...] Das Ich ist unrettbar,72 da es nichts an sich selbst, sondern nur ein Komplex von Empfindungen ist, die – wie er halb im Scherz sagt – »allein in der Welt spazieren«73 gehen. Machs Anschauung wird schön illustriert durch seine Schilderung ihrer Genese: Nach intensiver Kantlektüre, schreibt er, empfand ich plötzlich die müßige Rolle, die das ›Ding an sich‹ spielt. An einem heiteren Sommertage im Freien erschien mir einmal die Welt samt meinem Ich als eine zusammenhängende Masse von Empfindungen, nur im Ich stärker zusammenhängend. Obgleich die eigentliche Reflexion sich erst später hinzugesellte, so ist doch dieser Moment für meine ganze Anschauung bestimmend geworden.74 Das ist freilich nicht wesentlich verschieden vom Humeschen Standpunkt,75 der im Rahmen einer konsequenten Radikalisierung des Empirismus von Locke und Berkeley bestrebt war, die impressions hinter den ideas aufzusuchen,76 also die Vorstellungen in unserem Geiste auf empirisch erfahrbare Eindrücke zurückzuführen. Betreffs der Vorstellung von uns selbst will er dahingehend aber nicht recht fündig werden: »For my part, when I enter more intimately 67 Seltsamerweise wirft Schmitz später Pothast vor, sich für seine Position nicht auf Mach berufen zu haben (IV, 41), obwohl er das in einer Fußnote explizit tut (vgl. Pothast 1971, 66). 68 Pothast 1971, 66. Pothast anerkennt Rehmkes Annahme der Irrelationalität. Dieser kritisiert die Rede von »Haben« lediglich, weil sie eine solche wider Willen doch nahe lege (vgl. das Folgende). 69 Avenarius 1891, 82. 70 Avenarius 1891, 119. 71 Mach 1885, 10. 72 Mach 1885, 19 f. 73 Mach 1905, 460. 74 Mach 1885, 24 Anm. 75 Vgl. auch Mach 1885, 299. 76 Schmitz bezeichnet Hume deswegen auch als »das Morgenrot der Phänomenologie« (2007b, 315). 24 into what I call myself, I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I never can catch myself at any time without a perception, and never can observe any thing but the perceptions«.77 Die Frage, was wahrgenommen werde, erntet stets nur die tautologische Antwort, es seien eben Wahrnehmungen (perceptions). Von sich selbst pflegt man nicht eigens eine Wahrnehmung zu haben, die verschieden von bestimmten dauerhaften perceptions unter anderen, wie etwa der des eigenen Körpers, wäre. Wenn zugleich alle ideas ihren Grund in empirischen impressions haben sollen, ist die Annahme eines beharrlichen Selbst demnach grundlos. In diesen Zusammenhang gehört Humes berühmte Theater-Metapher für den menschlichen Geist: »The mind is a kind of theatre, where several perceptions successively make their appearance; pass, re-pass, glide away, and mingle in an infinite variety of postures and situations: There is properly no simplicity in it at one time, nor identity in different«.78 Jeder von uns wäre demnach Viele, aber nicht auch Viele und außerdem Einer, sondern nur Viele. Jeder Augenblick enthält andere perceptions als der vorherige; und alle Augenblicke enthalten selbst verschiedenste perceptions. Nichts daran lässt vermuten, dass ich der bin, der ich eben noch war und ebenso wenig, dass ich auch nur in einem Moment Einer bin. Aber legt die Theater-Metapher nicht nahe, dass – wie es noch Berkeleys Ansicht gewesen wäre79 – ich eben das Theater bin, in dem all das aufgeführt wird? Nein, Hume ist hier noch radikaler: »The comparison of the theatre must not mislead us. They are the successive perceptions only, that constitute the mind; nor have we the most distant notion of the place, where these scenes are represented or the materials, of which it is compos’d«.80 Was wir unser Bewusstsein (mind) zu nennen pflegen, wäre demnach ein reichlich seltsames Theater: ohne Zuschauer, ohne Regisseur und ohne Austragungsort – eine bloße Aufführung für und von niemandem, sozusagen eine »Aufführung an sich«. Was wir als uns selbst bezeichnen, wäre diese flüchtige Aufführung und nichts weiter, insofern es lediglich »the composition« dieser perceptions sei, »which forms the self«.81 Und so für jeden anderen: »I may venture to affirm of the rest of mankind, that they are nothing but a bundle or collection of different perceptions«,82 weswegen Humes Standpunkt auch als »Bündeltheorie« des Selbst bezeichnet wird. Bis hierhin gleichen sich die Empiriokritizisten und Hume offensichtlich und es ist prinzipiell auch diese Vorstellung beider, an die Pothast anknüpfen möchte: Es gibt nicht zusätzlich zu 77 Hume 1740. 252. Zu den perceptions gehören sowohl ideas als auch impressions. Hume 1740, 253. 79 Vgl. Berkeley 1710, 24 ff. 80 Hume 1740, 253 81 Hume 1740, 634. 82 Hume 1740, 252. 78 25 den perceptions noch ein self oder Subjekt ihrer. Was Hume angeht, ist damit allerdings noch nicht das letzte Wort gesprochen. Betreffs unserer Thematik war er mit dieser seiner sehr konsequent empiristischen Theorie letztlich höchst unzufrieden: »[A]ll my hopes vanish, when I come to explain the principles, that unite successive perceptions in our thought or consciousness. I cannot discover any theory, which gives me satisfaction on this head«. 83 Hume sieht also sehr wohl das Problem, dass es eine Einheitlichkeit in der Erfahrung gibt und es zur Erklärung dieses Sachverhalts eines vereinheitlichenden Prinzips bedürfte. Allerdings sieht er sich außer Stande, dieses Rätsel zu lösen. »For my part, I must plead the privilege of a sceptic, and confess, that this difficulty is too hard for my understanding. I pretend not, however, to pronounce it absolutely unsuperable. Others perhaps, or myself, upon more nature reflexions, may discover some hypothesis, that will reconcile those contradictions«.84 Diesen Versuch, der Annahme eines »vielfärbigen, verschiedenen Selbst«85 etwas entgegenzusetzen, hat daraufhin Kant mit seiner Transzendentalphilosophie – insbesondere deren »höchstem Punkt«, der nichtempirischen, transzendentalen Apperzeption – unternommen. Letztendlich musste aber, wie wir gesehen haben, auch er angesichts dieser qua Unerkennbarkeit unverständlichen Annahme kapitulieren und sich auf die Unergründlichkeit des Selbstbewusstseins, also der Anerkennung der Paradoxie als solcher, zurückziehen. Damit erweisen sich aber Hume und Kant als die jeweils problemsensibleren und redlicheren Denker, insofern sie eingestehen, hier keine befriedigenden Lösungen anbieten zu können. Die Empiriokritizisten und Neukantianer hingegen prätendieren in ihrem Reduktionismus Erfolge, die keine sind, weil sie sich in Selbstwidersprüche verwickeln oder bestimmte Phänomene, wie die Einheitlichkeit der Erfahrung, ignorieren müssen. c) Das Subjekt als »Objekt« Ausgehend von Pothasts Überlegungen haben wir hier kurz die Tradition verfolgt, an welche er angesichts der Aporien der Selbstbewusstseinstheorien wieder anzuknüpfen gedachte. Seine These war aber nicht nur, man müsse mit Hume und den Empiriokritizisten leugnen, dass es so etwas wie ein Selbstbewusstsein gebe, sondern er wollte, »was man bisher dafür gehalten hat, anders bestimmen«. Sehen wir uns an, wie er sich das vorstellt. Er schreibt: »Das Bewußtsein ist demnach zu denken als gänzlich objektiver Prozeß in dem Sinn, daß kein Moment eines wissenden Selbstbezugs auftritt«. Dies sei »allerdings nicht in der Weise objektiv, wie man es von den uns umgebenden Gegenständen gewöhnlich denkt«,86 sondern 83 Hume 1740, 635 f. Hume 1740, 636. 85 Kant, KrV, B 134. 86 Pothast 1971, 76 84 26 in Abgrenzung zu dem Sinn von subjektiv zu verstehen, den man mit Selbstbezüglichkeit verbinde. »Objektiv« meine hier nur »eine besondere Eigenschaft«, die bezeichnen solle, »was man sonst seinen subjektiven Charakter nennt«. Diese könne »nur als nicht weiter analysierbares Prädikat, z.B. ›bewußt‹ genommen werden, das allen Teilen des psychischen Leben zukommt, mit denen wir bekannt sind«. Er könne »das Wort objektiv, das ich zur Charakterisierung der bewußten Verläufe benutze, nur negativ einführen. Es dient nur dazu, ausdrücklich eine relationale Auffassung der elementaren Bewußtseinsstruktur 87 fernzuhalten«. Weder dürfe irgendetwas darin »fürsichsein« noch etwas anderes »haben«. 88 Diese Negativcharakteristik ist dann allerdings auch schon alles, was er dazu zu sagen vermag. Dass damit soweit keine großartige Erklärungsleistung verbunden, ist ihm auch klar und er beschränkt sich darauf, zu skizzieren, wie Theorien nicht beschaffen sein dürfen: Offenbar sind wir auf eine angemessene Behandlung des Bewußtseins weder in der Sprache noch in der Theorie vorbereitet. Das hat auch zur Folge, daß man gegenwärtig zwar falsche Deutungen und Ansprüche abweisen, aber keine positiven an ihre Stelle setzen kann. Die Explikation aller Wendungen, die man gebrauchen möchte, führt zuletzt auf negative Ausdrücke, weil man sowohl das Für-sich fernhalten muß als auch die tote Objektivität, die spezifische Differenz des bewußten Objektiven von jenem aber nicht zureichend artikulieren kann.89 Er gesteht ferner, dass man angesichts seines Versuchs Gefahr laufe, »den Anblick dessen, der das Unsagbare sagen möchte«90 zu bieten und äußert dem gemäß lediglich Hoffnungen, eine der nächsten Generationen könne womöglich eine Theorieform und Sprache finden, dieser aporetischen Situation Abhilfe zu schaffen. Dergleichen ist zumindest bisher, etwa 40 Jahre später, weder geschehen noch in Sicht.91 87 Pothast 1971, 76 f. Vgl. Pothast 1971, 77 f. 89 Pothast 1971, 80. 90 Pothast 1971, 104. Vgl. zu diesem Thema Anhang I.2. Pothast hat später, nach literarischen Versuchen, dies Unsagbare als »Sich-Bekunden« oder »Spüren« bezeichnet: »Das Sich-Bekundende ist nicht ›für‹ ein anderes, und es ist auch nicht ›für‹ sich selbst; daß sich etwas bekundet, schließt nicht logisch ein, daß es ein Anderes gibt, dem bekundet werde, noch, daß der Adressat des Bekundens ›es selber‹ sei« (Pothast 1988, 44 f.). Im weiteren sind Pothasts Ausführungen dann den Versuchen von Schmitz gar nicht unähnlich. 91 Ähnlichen gearteten Versuchen der Leugnung der Realität des Phänomens Selbstbewusstsein begegnet man heutigentags im Rahmen naturalistischer Orientierungen allerorten, zumeist in Form epiphänomenalistischer Ansätze, die das Phänomen für existent, aber irrelevant erklären, insofern sie Bewusstsein überhaupt für einen Reflex (nicht aber für eine Reflexion) des (materiellen) Seins halten. Derartige Positionen sind nicht weniger aporetisch. Sie scheitern, noch ganz abgesehen davon, dass sie Bewusstsein überhaupt nicht im Materiellen verorten können und es deswegen zumeist zum unnützen Epiphänomen erklären, beispielsweise an der Erklärung ihrer eigenen Erklärungsleistung, die doch jedenfalls ein Selbstverhältnis einschließt, das – ob Epiphänomen oder nicht – nicht mit guten Gründen ignoriert werden kann. Wird Selbstbewusstsein in diesem Rahmen als »Kartierung einer Kartierung« oder als »Metarepräsentation« beschrieben (vgl. z.B. Metzinger 2005, Damasio 1999 und 2000), haben wir es wohl wiederum nur mit einer Kombinationen von Verhältnissen zu tun, von welchen, wie oben bemerkt, nicht zu sehen ist, wie sie ein Selbstverhältnis generieren sollten. Wir geraten offenbar von einer Aporie in die nächste. In diesem Zusammenhang interessant zu beobachten ist etwa Gerhard Roth, der in seinem Versuch, seiner objektivistischen Gehirnwissenschaft eine philosophische Deutung im Sinne des Konstruktivismus zu geben, einfach ein zweites, transzendentes Gehirn erfindet, das man nicht untersuchen könne, das aber all das hervorbringe, was uns als Wirklichkeit erscheint (vgl. Roth 1997, 314 ff.). Hier sieht man auf der Ebene des naturwissenschaftlichen Objektivismus all das wiederkehren, was zuvor ausgetrieben werden sollte. Roths Idee ist nicht prinzipiell verschieden von einem transzendenten oder transzendentalen, unerkennbaren Grund, etwa einem absoluten Ich, das Objekte nicht nur gegenüber hat, sondern diese »setzt« – 88 27 d) Zusammenfassung Im Rahmen unserer Beschäftigung mit Pothasts Ausgang von Schmitz und Henrich haben wir zwei Positionen kennen gelernt: Radikalen »Ideenempirismus« und »Objektivismus«. Einmal wurde auf phänomenaler Grundlage die Realität des Phänomens Selbstbewusstsein angezweifelt. Zum anderen wurde aus den Problemen der Annahme eines Selbstbewusstseins als bewusster, reflexiver Relation geschlossen, diese durch die Rede von einem objektiven Prozess fernzuhalten, der sich »einfach ereignet«.92 Aus beiden Positionen in ihrer radikalen Variante scheint jedenfalls der eingangs zitierte Aphorismus Lichtenbergs zu folgen: Es denkt, müsste man dann gegen Descartes’ cogito sagen. Schmitz, der diesen Aphorismus für sein Leben gerne zitiert, meint dazu: Diese [...] Bestreitung der Existenz von Bewußthabern[...] verträgt sich widerspruchsfrei mit der Anerkennung eines Bewußtseins, das [...] absolute, an niemand adressierte ›Lichtung‹ [wäre], um ein Wort Heideggers zu entwenden.93 So könnte Bewußtsein im Rahmen des Physikalismus Platz finden [...] Die Empiriokritizisten Mach und Avenarius haben so etwas durchdacht und in allem Ernst daran geglaubt (1987, 24 f.). Diese Position ist logisch widerspruchsfrei, aber empirisch falsch. Sie verdient Aufmerksamkeit, weil sie die Philosophen vor die Aufgabe stellt, nach der Evidenz dafür zu suchen, dass es sie selber gibt (2003c, 529). Was aber hat Schmitz dieser Position entgegenzusetzen? Was ist der oben erwähnte zweite Weg, sich der Stringenz des Arguments für die Einheit des Bewusstseins zu entziehen, was die empirische Evidenz dafür, dass es uns gibt? Der empiriokritizistische, »wirklichkeitsfremde Reduktionismus bezüglich der Subjektivtität«, meint er, »beruht einfach darauf, daß die Autoren nur die objektiven Tatsachen gelten lassen, obwohl das gleichsam nur die Schatten der wirklichkeitsnäheren subjektiven Tatsachen sind, nur Restprodukte einer neutralisierenden Abstraktion« (1987, 25). Was Schmitz damit meint, wollen wir uns nun ausführlich ansehen. nur dass Roth weder dies bemerkt noch sich über Probleme solch quasitranszendentaler Postulate Gedanken macht. Diesen Knoten hielt Kant zumindest für unlösbar und Fichte versuchte ihn dadurch zu lösen, dass das Ich nicht nur sein Objekt, sondern zuallererst sich setze und dies überdies als sich setzend (vgl. Fichte I, 528: »ein sich Setzen als setzend, [...] keineswegs aber etwa ein blosses Setzen«). 92 Pothast selbst war immerhin scharfsinnig genug, zu sehen, dass diese Art der Objektivität nicht anonym oder epiphänomenalistisch-reduktiv sein kann, ohne dass er sagen könnte, wie das denkbar ist (vgl. Pothast 1971, 80 (= Zitat oben), wo er sich gegen »tote Objektivität« wendet.). 93 Was Schmitz hier »absolut« nennt, entspricht dem, was Pothast »objektiv« nennt. Inwiefern das mit Heideggers »Lichtung« zusammenhängt, werden wir später noch sehen (Kap. VIII.2). 28 Zweiter Teil: Schmitz’ Theorie des Selbstbewusstseins Die drei Kapitel dieses Teils gliedern sich wie folgt: In Kap. IV wird im Anschluss an eine Rekapitulation der Fragestellung zunächst Schmitz’ grundlegender Lösungsansatz für die Paradoxien des Selbstbewusstseins dargestellt. In Kap. V werfen wir dann einen ausführlicheren Blick auf das Gesamtkonzept seines Philosophierens, soweit es im weiteren Sinne für unser Thema relevant ist. Wie er mit dem Selbstbewusstsein umgeht, wird sich dann durch dessen Einbettung in allgemeinere Zusammenhänge sowie durch Verweis auf philosophiehistorische Vorläufer besser konturieren und einordnen lassen. Ferner wird so die Behandlung eines weiteren Aspekts seiner Selbstbewusstseinstheorie, der in Kap. VI untersucht wird, vorbereitet. IV. Subjektivität, Affektivität, Selbstbewusstsein – Schmitz’ Lösungsansatz 1. Die Problemlage Wir haben gesehen, dass Selbstbewusstsein nicht allein darin bestehen kann, dass ich mir bestimmte Eigenschaften zuschreibe, weil jede solche Zuschreibung ein Bewusstsein nicht nur dessen, was zugeschrieben wird, sondern auch dessen, dem zugeschrieben wird, voraussetzt. Im Falle des Selbstbewusstseins bin ich selbst derjenige, dem zugeschrieben wird, also müsste ich von mir zuvor schon Bewusstsein besitzen, schon Selbstbewusstsein haben. Fehlt den Selbstzuschreibungen demnach etwas, das ich noch hinzufügen muss, damit es meine sind? Alles, was hinzukommen könnte, wäre lediglich eine weitere Eigenschaftszuschreibung. Der Möglichkeit meines Selbstbewusstseins ist nicht damit geholfen, dass etwas zu meinen Eigenschaften hinzukommt; es scheint vielmehr, ihnen müsse etwas vorausgehen. Nun haben wir bei Kant die These eines solchen Vorausgehens besprochen. Auch für Kant ist klar, dass zu den Attributen, die ich von mir als meinem empirischen Selbst kenne, etwas »immer schon hinzugekommen« sein muss, um zu erklären, dass ich mich überhaupt als identisches und nicht als »vielfärbiges, verschiedenes Selbst« erfahre, also Selbstbewusstsein habe. Was Kant als Attribute bezeichnet hatte, entspricht dem Gegenstand dessen, was eben als Selbstzuschreibung charakterisiert wurde: Eigenschaften, die wir über uns aussagen. Sowohl nach dem von Schmitz als auch nach dem von Kant Angeführten sind diese jedoch nicht hinreichend für Selbstbewusstsein: Ich muss etwas Bestimmtes sein, aber das kann nicht alles sein, was mich ausmacht. Die darüber hinaus gehende, anderweitige Quelle der Selbstgewissheit blieb bei Kant ein leeres X, das er nur paradox postulieren konnte. Selbstbewusstsein präsentiert sich als unbezweifelbares Faktum, das aber per definitionem weder anschaulich ausweisbar noch einer näheren Erklärung oder 29 Beschreibung fähig ist. Kant spricht dabei wie in der Paradoxie von einem Zirkel: Wir müssten uns dessen immer schon bedienen, wenn wir vom ihm sprächen und drehten uns daher beständig im Kreise um das bzw. mit dem geheimnisvollen transzendentalen Subjekt, das uns immer schon im Rücken liege, wenn wir es zu ergründen trachteten. In einen Zirkel möchte sich Schmitz ebenso wenig verstricken, wie in einen unendlichen Regress verfallen. Sein Versuch, den Widersprüchen der dritten Paradoxie zu entgehen, kann sich aber auch ebenso wenig wie der Kants in eine substanzielle Vorstellung retten. Was für Kant erkenntniskritisch ausgeschlossen ist und nur per analogiam angeführt wird, entzieht sich auch dem phänomenologischen Ausweis.94 Gleichwohl soll dem Abweisen einer Substanzvorstellung aber nicht eine generelle Leugnung eines Selbst wie bei Hume (Kap. III.2) folgen. Ein unbezweifelbares Faktum ist das Selbstbewusstsein für Schmitz ebenso wie für Kant. Seine Existenz soll aber nicht wie bei diesem transzendentallogisch-formal vorausgesetzt, sondern phänomenal-inhaltlich ausgewiesen werden, der idea soll eine impression entsprechen – wie Schmitz es ganz generell als »Forschungsmaxime« von Hume übernimmt (vgl. 1994b, 7). Selbstbewusstsein soll nicht leer sein, ohne aber nur durch eine zuzuschreibende Bestimmung angereichert zu werden (vgl. 1999a, 75). Man kann also durchaus sagen, dass sich Schmitz’ eigene Position zwischen Hume und Kant abspielen wird, wenn er auch de facto eher durch die Positionen von Avenarius, der an Hume anschloss und Fichte, der einen Ausweg aus den Kantischen Aporien suchte und ihn in der schlechthinnigen Selbstsetzung des absoluten Ich fand,95 beeinflusst wurde (vgl. 2005, 71). Auch können wir Schmitz’ Position als Versuch bestimmen, weder »Bewusstseins-« oder »Subjektphilosophie« noch »Seins-« oder »Objektphilosophie« zu betreiben (vgl. 2005, 5). Während jene vom denkenden Subjekt ausgeht, dem die Welt als seine Vorstellung oder gar als Ergebnis seiner Konstitution gegenübersteht (vgl. z.B. Kap. III.1), geht diese von etwas objektiv Existierendem (sei es materiell oder anders, jedenfalls nicht-subjektiv Bestimmtem) aus und hat dann ihre Mühen, Subjektivität dort zu verorten, sofern sie diese nicht gänzlich leugnet (vgl. z.T. Kap. III.2).96 Schon hier sieht man, wie schwer die Aufgabe ist: Nur eine 94 Man kann darüber spekulieren, ob Kant das X nicht doch als ein substanzartiges Etwas, als ein »vorhandenes« Ding denkt, weswegen ihm vielleicht der Fauxpas unterläuft, einmal »es denkt« zu sagen. Aber nicht irgendetwas soll ja all meine Vorstellungen vereinigen, sondern ich selbst! Wäre es bloß eine Substanz, wiederholte sich das obige Problem, müsste ich diese doch wiederum mit mir identifizieren, mich also – jenseits der Substanz – voraussetzen (vgl. 1999a, 83). 95 Auf Fichte wird in dieser Arbeit beständig nur am Rande verwiesen. Durch die Paradoxien, mit welchen auch er vornehmlich beschäftigt war, sowie durch den ständigen Bezug auf Schmitz und Henrich und dadurch, dass, wie wir noch sehen werden, Schmitz’ Position der Fichtes nicht unähnlich ist, ist er allerdings hintergründig stets anwesend. 96 Vgl. für die Unterscheidung in Subjekt- und Objektphilosophien bereits Fichte I, 425 ff. Man beachte, dass die beiden »Zwischenverortungen« nicht korrelativ sind, da Hume und Kant jedenfalls beide auf der Seite der Bewusstseinsphilosophien zu verorten wären. Auch sind Bewusstseins- und Subjektphilosophien nicht strikt identisch, insofern Hume kein Subjektphilosoph ist. 30 eingehende Auseinandersetzung mit all diesen Begriffen wie Subjekt und Objekt, Bewusstsein, Sein, Ich, Vorstellung etc., wenn nicht eine weit reichende Revision ihrer, wird auch nur vorgeben können, ihr gewachsen sein. Wir resümieren die an Schmitz’ Theorie gerichteten Forderungen, welche in diesem Kapitel nacheinander abgearbeitet werden sollen. Der Terminus »Selbstbewusstsein« ist dabei zunächst zu vermeiden – selbst dessen Existenz wurde ja bestritten –; wir sprechen neutral vom »Ich-Bezeichneten« der Empiriokritizisten. Schmitz wird versuchen zu zeigen, dass das Ich-Bezeichnete »objektiv« nicht erfassbar ist (Abschnitt 2), aber »ich« dennoch etwas bezeichnet (Abschnitt 3). Schließlich soll deutlich werden, dass dies Bezeichnete weder eine leere Form noch eine unerfahrbare und nicht weiter aufschließbare Vorauszusetzung, sondern eine phänomenal ausweisbare »subjektive Tatsache« ist, die mit Recht »Selbstbewusstsein« genannt werden kann (Abschnitte 4 und 5), wenn auch die Bezeichnung als »Ich« problematisch bleibt (Abschnitt 6). Dabei ist stets die Ausgangslage maßgeblich, dass Selbstbewusstsein nicht als Zuschreibung bzw. Identifikation und auch nicht als SubjektObjekt-Identität bestimmt werden darf. 2. Subjektivität Ich schreibe, ich habe also eine Vorstellung von meinem Schreiben, es schreiben aber auch andere neben mir. Woher weiß ich nun, daß mein Schreiben nicht das Schreiben eines anderen ist? (Fichte) a) Wer bin ich? – Das Ich und seine Eigenschaften Wer bin ich? Eine Antwort ist leicht zu geben. Ich bin ein Mann namens ›Hermann Schmitz‹, geboren in Leipzig, Professor der Philosophie, wirkend an einer deutschen Universität. Ich besitze allerlei Eigenschaften, die es gestatten, mich von allen anderen Wesen, die in diesem Universum vorkommen, vorkommen werden und vorgekommen sind, genau zu unterscheiden; Geburtsdatum, Beruf, Wirkungsstätte zusammengenommen ergeben eine Eigenschaft, die dafür schon bezeichnend genug ist. Eine Antwort, in der ich sozusagen meinen persönlichen Steckbrief aufsage, gehört zu dem Leichtesten von allem, was man von mir verlangen kann; ein Problem würde erst auftauchen, wenn der Frager sich nicht mit der bloßen Auskunft zufrieden gäbe, sondern eine Rechtfertigung und Begründung dafür verlangen sollte. Woher weiß ich eigentlich, daß ich der Hermann Schmitz bin, der in Leipzig geboren ist und Philosophie doziert? Diese Frage führt in eine ganz andere Richtung als die scheinbar so ähnliche: Woher weiß ich, daß dieser Hermann Schmitz in Leipzig geboren ist, den Professorentitel trägt und Philosophie doziert? (1968, 95) Ob Hermann Schmitz in Leipzig geboren und Philosophieprofessor ist, kann jeder nachprüfen. Diese Tatsachen sind in diesem Sinne objektiv. Auch dass ein bestimmtes raumzeitlich existierendes Individuum dieser Hermann Schmitz ist, kann prinzipiell jeder herausfinden. Man könnte etwa von Hermann Schmitz gehört haben, ihm dann zufällig über den Weg laufen und anschließend informiert werden, dass dieser Herr Hermann Schmitz sei. 31 All das sind Identifizierungen bzw. Zuschreibungen. Nichts davon macht aber diesen Hermann Schmitz zu ihm selbst. Interessanterweise versagt hier eigentlich schon die Sprache: Über Hermann Schmitz können wir das Problem nur formulieren als Frage, inwiefern Hermann Schmitz Hermann Schmitz ist. Das ist aber nicht das hier gemeinte Problem, schließlich fragen wir ja auch nicht, inwiefern Leipzig Leipzig ist. Zwar könnte man auch das fragen, aber die Problematik ist offensichtlich eine ganz andere als die, um die es hier geht, sondern eine konventionelle Festlegung, die auch anders sein könnte. Um die Frage angemessen zu formulieren, müssen wir in der ersten Person sprechen: Was für eine Tatsache ist es, dass ich Sascha Pahl bin? Dass ich in Jena wohnhaft und 1982 geboren bin, kann jeder bei Belieben nachprüfen und mir dies dann zuschreiben oder absprechen. All dies könnte auch nicht der Fall sein. Meine Hauptwohnsitznahme könnte sich etwa als ungültig herausstellen. Doch dies würde nichts daran ändern, dass ich Sascha Pahl wäre. Würde ich morgen herausfinden, dass ich eigentlich Pascha Sahl heiße und 1981 geboren bin, wäre ich immer noch ich selbst und ich wäre es auch vorher gewesen und jetzt derselbe, der ich war, als ich dachte, Sascha Pahl zu heißen. »Wahrscheinlich läßt sich gar keine Eigenschaft angeben, die mich vor allen anderen Mensch auszuzeichnen scheint und nicht in der Weise von irgend einer erdenklichen Erfahrung als trügender Schein entlarvt und weggewischt werden könnte« (1968, 96). Dennoch bliebe ich offenbar – ich. Nun haben wir bisher immer vorausgesetzt, dass schon verstanden ist, was mit »ich« gemeint ist. Der konsequente Empiriokritizist würde das bestreiten. Benötigen wir diese geheimnisvolle Information, dass wir es sind, überhaupt? Er könnte behaupten, diese entstünde nur durch eine Verwirrung des Sprachgebrauchs. Möglicherweise leiden wir hier bloß an einer »Verhexung unsres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache«, wie Wittgenstein meinte.97 Wir haben uns deswegen mit einem »Bedenken [...], das in unserem zur Sprachkritik geneigten Zeitalter sicherlich manchem potentiellen Leser auf der Zunge liegt« (1968, 97) auseinanderzusetzen. Dieses Bedenken besagt, das vermeintlich Rätselhafte am »Ich« komme nur durch eine Hypostasierung des Pronomens »ich« zu Stande. Im Wortsinne von »Pronomen« (pro nomine) könne man einfach einen Namen dafür einsetzen, je nachdem wer gerade spricht oder schreibt: »Hermann Schmitz«, »Sascha Pahl« oder wen auch immer. Es läge in der Willkür des Sprechers »ich« zu sagen, statt seinen Namen zu nennen. Dann läge im Satz »Ich bin Sascha Pahl« keineswegs ein Hinweis auf irgendein mysteriöses Problem, sondern er wäre bedeutungsgleich mit dem tautologischen Satz »Sascha Pahl ist Sascha Pahl«. Die Aussage »Dies da ist ein Wagen« fügt scheinbar dem Wagen neben 97 Wittgenstein 1953, § 109. 32 seinen objektiven Eigenschaften, etwa rot und alt zu sein, auch keine nicht-objektivierbare Tatsache, etwa die »Diesdaheit«, hinzu. So verhielte es sich dann auch mit dem Wort »ich«. Auch kleine Kinder sagen nicht sofort »ich will«, sondern bedienen sich zunächst ihres Namens, sagen also etwa »Martin will«. Scheinbar erhalten Kinder durch Verwendung des Pronomens kein gehaltvoll neues Verständnis von sich, sondern ersetzen dadurch lediglich ihren Namen und die Unbequemlichkeit, ihn ständig aussprechen zu müssen. »Ich« wäre dann ein ebenso bedeutungsloser Stellvertreter eines Namens wie »Dieses da«, so dass die zu erörternde These lautet, »daß das Pronomen der ersten Person entbehrlich sei, da alles, was uns begegnet, ebenso gut durch die Pronomina der dritten Person oder durch geeignete Namen oder Kennzeichnungen angegeben werden könne« (I, 6). Diese These erörtert Schmitz anhand des Beispielsatzes »Ich bin traurig«. Wäre die These richtig, müsste der Satz bedeutungsidentisch sein mit dem Satz »Sascha Pahl ist traurig«, der entweder von mir ohne das Wissen ausgesprochen wird, dass ich Sascha Pahl bin, oder von jemand anderem. Wenn »ich« tatsächlich überflüssig und ersetzbar wäre, könnten wir uns eine »verarmte Sprache« ausdenken, in der dieses Pronomen nicht vorhanden und durch Nomen ersetzt wäre. Die Frage ist, ob ich – den hypothetischen Fall angenommen, ich erführe erst nach Aussprechen und Verstehen des Satzes, dass ich dieser Sascha Pahl bin, von dem die Rede war – dadurch etwas lernen würde, das über den Bedeutungsgehalt des Satzes hinausgeht, den er vorher für mich hatte. Was bedeutet es also, zu sagen »Ich bin traurig?« »›Ich bin traurig‹ – dies meint etwas als solches, das mich angeht, das mir nahegeht, in dem ich befangen bin. Dabei handelt es sich nicht bloß um beiläufige begleitende Gefühle und Haltungen usw., sondern um etwas, das der Satz selbst meint [...] um eine wesentliche Nuance seines Sinnes« (I, 9). Diese »Nuance« fehlt dem Satz »Sascha Pahl ist traurig« offenbar. Etwas, das mir nahe geht, kann in ihm nicht ausgedrückt werden, wenn ich ihn unter der Voraussetzung, nicht zu wissen, dass ich er bin, ausspreche oder jemand anders ihn ausspricht. Nun spricht nichts gegen den Versuch, diesem Mangel abzuhelfen, indem man innerhalb der verarmten Sprache auf Ergänzungen des Satzes zurückgreift. Man könnte also sagen: »Dem Sascha Pahl geht etwas wirklich Trauriges zu Herzen, er ist von Trauer betroffen, in Trauer versunken, er ist traurig mit Ergriffenheit und Engagement« (vgl. I, 9; 1968, 101 f.). Da ich laut Voraussetzung nicht weiß, dass ich er bin, die bezeichnete »Ergriffenheit« also nicht als mich ergreifende verstehen darf, hilft diese Ergänzung aber nicht zur Ergänzung des Sinns. Dasselbe Problem hat jeder Andere, der etwa denkt, mir gehe etwas wirklich Trauriges zu Herzen: Meine leidvolle Trauer geht dabei verloren. Diese Nuance könnte man vielleicht eine »Ichtönung« nennen und versucht sein, diese fehlende Information an den Satz anzuhängen, indem man sagte: »Sascha Pahl ist traurig, mit 33 Ichtönung« (vgl. I, 9).98 Solange ich dabei nicht weiß, dass ich Sascha Pahl bin, hilft jedoch auch diese Verlegenheit nicht weiter. Ich kann dann diese »Ichtönung« ebenso wenig auf mich beziehen wie jeder andere. Die versuchten Ergänzungen helfen nicht, solange sie nicht enthalten, dass ich dieser Sascha Pahl bin, der ergriffen ist, und mit »Ichtönung« das gemeint ist, wie es für mich ist. Die gesuchte Nuance lässt sich offensichtlich gar nicht dem objektiven Satz »Sascha Pahl ist traurig« hinzuaddieren. Wenn sie ihm nicht schon innewohnt, hilft auch kein Verweis auf eine obskure »Ichtönung«. Im anderen Fall aber ist so eine umständliche Ausdrucksweise ganz unnötig.99 Das Experiment mit der verarmten Sprache hat ergeben, dass das Pronomen »ich« nicht durch Nomen ersetzt werden kann. Was wir mit Sätzen in der ersten Person bezeichnen, ist mehr als man in der dritten Person ausdrücken kann. Aber was wird mit »ich« bezeichnet? Der gemeinte Sachverhalt lässt sich sprachlich offenbar nur schwierig ausdrücken. Wir formulieren ihn vorläufig wohl am besten als Frage danach, warum ich ich bin. Wieso gilt Ich=Ich? Dabei muss aber klar sein, dass »ich« hier nicht wie ein beliebiger Gegenstand gehandhabt werden kann. Die Frage wieso Ich=Ich ist nicht dieselbe Frage wie die nach irgendeiner beliebigen numerischen Identität (»Selbigkeit«100). Auch soll nicht irgendein Ich mit sich selbst identisch sein bzw. irgendein Subjekt mit irgendeinem Objekt, das es selbst ist, sondern ich, der ich hier schreibe, bin gemeint. Es dreht sich also auch nicht um eine an-undfür-sich existierende Struktur der wissenden Selbstbezüglichkeit. Daher hatten wir einleitend Meinigkeit als Kriterium genannt. Zwar kann jeder andere auch mit denselben Worten fragen, inwiefern sie sie oder er er ist. Niemand aber kann fragen, inwiefern ich ich (im Sinne von 98 William James beschreibt etwas Ähnliches als »Wärme und Intimität« (vgl. 1982, 136). Das ist nicht unbedingt erhellend, zeigt aber, wie schwer es in Worte zu fassen ist. 99 Es handelt sich bei der Unmöglichkeit, in der verarmten Sprache das Gemeinte zu beschreiben, wohl gemerkt nicht um einen Mangel an Kennzeichnung, der verhindern würde, dass ich gemeint bin. So könnte es etwa der Fall sein, wenn jemand auf Grund zu geringer von ihm bekannter Merkmale nicht eindeutig identifiziert werden kann und deswegen Verwechslungen möglich sind. Nicht die Unkenntnis bestimmter Eigenschaften ist das Problem. Liegt es dann womöglich an der Unmöglichkeit, alle Eigenschaften aufzuzählen, die mir aktuell zukommen? Sicherlich ist das unmöglich. Aber man könnte dies dann immerhin auszudrücken versuchen, etwa durch den Satz: »Sascha Pahl ist traurig in der unerschöpflich reichen und konkreten Weise, die seine Eigenart und deren besondere Färbung durch den Augenblick mit sich bringen« (vgl. 1968, 105). Doch selbst hierdurch wird der Punkt verfehlt. Selbst wenn es möglich wäre, alle meine augenblicklichen Eigenschaften in ihrer spezifischen Eigenart auszudrücken, hätten wir dem Problem nicht abgeholfen. Daraus würde noch immer nicht das deutlich, was mich zu dem macht, der all dies innehat. 100 »Qualitative Identität« (Gleichheit) kommt ohnehin nicht in Frage: Ich bin nicht gleich dem Sascha Pahl von vor 10 Jahren, in dem Sinne, in dem ich drei mal das gleiche Hemd besitzen kann, sondern ich bin – so die These – derselbe Sascha Pahl wie eh und je. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass ich natürlich andere Eigenschaften habe als früher und bald andere haben werde. Wie bereits gesehen, machen diese meine Identität im strengen Sinne, meine Selbigkeit nicht aus. Es geht also nicht darum, dass ich deswegen als derselbe gelten kann, weil ich hinreichend viele Eigenschaften mein ganzes Leben über habe. Durch einen solchen Vergleich könnte ich lediglich herausfinden, inwiefern ich mir gleich geblieben bin und inwiefern mich verändert habe. Dann könnte auch ich oder jemand anderes sinnvoller Weise sagen, ich sei nicht mehr der Gleiche. Ich muss mich aber mit mir nicht vergleichen, um mich meiner Identität (Selbigkeit) zu vergewissern, sondern umgekehrt: um mich mit mir überhaupt vergleichen zu können, muss ich mich zuvor schon mit mir identisch wissen, um überhaupt zu wissen, was ich womit vergleichen soll. 34 Sascha Pahl) bin, also damit eben dies meinen, dass ich hier jetzt dies bin.101 Auch kann – um es noch einmal zu beleuchten – niemand meine Identität mit mir herausfinden, indem er dazu etwa zahlreiche Informationen beibringt. Nicht einmal ich selbst könnte mir ja durch noch so viele Informationen darüber klar werden, dass ich ich bin. Um mit solchen Informationen etwas anfangen zu können, muss ich vielmehr schon ich selbst sein. Schmitz fasst diesen seltsamen Sachverhalt zusammen: Dieses Ergebnis ist sehr befremdlich. Ich bin ihm gemäß etwas [...], das [...] nur ich selbst, und auch ich nur in bloß für mich verständlicher Weise, beschreiben kann, wobei jeder Versuch, zu erläutern, worum es sich handelt, in eine Art Zirkel verstrickt ist: Denn die Erläuterung kann ja nicht durch Angabe objektiver Attribute gelingen, also höchstens durch solche Angaben, die erst durch den Gedanken, daß ich mit etwas identisch bin, verständlich werden und damit eine Vertrautheit mit dem bereits voraussetzen, was erst erläutert werden sollte: mit dem nämlich, was ich aus der Mitteilung ›Hermann Schmitz ist traurig‹ zusätzlich heraushöre, wenn mir aufgeht, daß ich der bin, von dem die Rede ist (1968, 106). Die Frage »Wer bin ich?«, in dem Sinne, in dem nur ich sie stellen kann, verlangt nicht einfach inhaltlich andere oder reichere Angaben als die »Wer bin ich?« im Sinne von »Wer ist Sascha Pahl?«, sondern eine Antwort ganz anderer Art. Letztere verlangt eine bestimmte Antwort; eine endliche Anzahl von Eigenschaften sollte genügen, um Sascha Pahl eindeutig zu identifizieren. Um hinzuzufügen, dass ich Sascha Pahl bin, hilft aber keine weitere Bestimmung, sondern nur so etwas wie ein Sprung; man versteht nicht, was gemeint ist, wenn man es nicht schon verstanden hat. Diese paradoxe Konkurrenz von Bestimmbarkeit und Unbestimmbarkeit dessen, wonach in der Frage ›Wer bin ich?‹ gefragt wird, bezeichne ich als das I c h p r o b l e m: Jeder Mensch hat sein eigenes Ichproblem; aber da es sich jedem in gleicher Weise stellt, darf auch von dem Ichproblem im Singular gesprochen werden. Dieses Problem kann in die zugespitzte Form einer Antinomie gebracht werden, gemäß dem von Kant aufgestellten Muster: 1. Thesis: Ich bin [...] nicht einmal summarisch bestimmbar durch Angabe objektiver Attribute. 2. Antithesis: Ich bin in jeder Hinsicht, in der ich mich finde, mindestens summarisch bestimmbar durch Angabe jedes objektiven Attributs, das ich besitze und solche Attribute besitze ich in der Tat (1968, 107 ff.; vgl. auch I, 11 ff.). b) Kurze Überlegung dazu, wie es je für mich ist, jemand zu sein Schmitz meint, dass Fichte der erste gewesen sei, der auf dieses Ich-Problem aufmerksam gemacht habe (vgl. 1992; 2007b, 422 ff.). In Formulierungen wie der diesem Kapitel voran stehenden (oder auch »Mein Ich, nicht das deinige. Wo ist der Unterschied«?102) deutet Fichte an, dass der Unterschied seines Ichs zu einem anderen nicht darin bestehen kann, dass ihm andere Eigenschaften zukommen als dem Anderen. Selbst wenn er all die kennen würde, wüsste er immer noch nicht, wieso er denn nun dieser und nicht jener sei. Wir hatten dies einleitend als Meinigkeit charaktersisiert. In die Diskussion der angloamerikanisch geprägten Gegenwartsphilosophie sind solche auf den ersten Blick krude erscheinenden Fragen durch Überlegungen von Thomas Nagel geraten. 101 102 Diese Formulierung weist schon auf Schmitz’ Gesamtkonzept hinaus (vgl. Kap. V). Fichte 1801/02, 94. 35 »What kind of fact is it – if it is a fact – that I am Thomas Nagel?«,103 fragt er. Zu dieser Frage drängt ihn eine vorausgehende Überlegung, die der Schmitzschen ganz ähnlich ist. Ausgehend von Fragen über das Wesen des Bewusstseins wurde ihm bemerklich, dass eine objektive Beschreibung im Sinne des Physikalismus unmöglich erfassen könnte, was es heißt, in einem bestimmten mentalen Zustand zu sein. Die Irreduzibilität dieses »subjective character of experience«104 beruhe dabei nicht auf unterentwickelten naturwissenschaftlichen Methoden, sondern sei prinzipieller Natur: Jede erdenkliche Form des objektiven Erfassens aus der Perspektive der dritten Person, könne derjenigen der ersten Person nicht habhaft werden, weil diese Perspektive eben darin bestehe, nur subjektiv zugänglich zu sein.105 Diese sei »fully comprehensible only from one point of view«, weswegen »any shift to greater objectivity – that is, less attachment to a specific viewpoint – does not take us nearer to the real nature of the phenomon: it takes us farther away from it«.106 Wer etwa blind ist, kann noch so ein guter Wissenschaftler sein und alles über die objektiven Vorgänge im Gehirn beim Sehen von Farben wissen. Er wird doch nicht wissen, »what it is like for«107 – wie Nagel sagt und man in deutscher Übersetzung sagen kann: wie es ist für – jemanden, der Farben sehen kann.108 In den Worten John Searles: »Wenn es um Bewusstsein geht, dann ist die Erscheinung die Wirklichkeit«,109 es hat also keinen Sinn, subjektive Tatsachen auf objektive zurückführen zu wollen. Alles, was sie ausmacht, wäre dann verschwunden.110 Diese Schwierigkeit mit der Irreduzibilität subjektiven, introspektiv gegebenen Erlebens ist daher offensichtlich nicht nur verwandt mit dem, was Schmitz als »Ichproblem” exponiert hat, sondern beides lässt sich ähnlich schwer ausdrücken, obwohl man es für selbstverständlich zu halten geneigt ist. Auch das Wort »ich« selbst hilft nicht weiter. Es zeigt nur an, was gemeint ist.111 Wie sollen wir also sagen, was es heißt, dass ich es bin? Der frühe 103 Nagel 1986, 54. Nagel 1974, 436. 105 Die Anfänge der dortigen Diskussion liegen wohl 1966 (vgl. Frank 1994), also nach Schmitz. Ein Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass Nagel eine, wenn auch irreduzible, Perspektive beschreibt, Schmitz’ primäre Subjektivität aber noch ursprünglicher und daher diesseits der Perspektivität ist (vgl. Großheim 1994 und das Folgende). Ferner geht es Nagel um die Irreduzibilität der Erste- auf die Dritte-Person-Perspektive, während Schmitz auch die einer Ersten Person auf die einer anderen bestreiten würde, was Nagel für unproblematisch hält (vgl. Nagel 1974, 441 f.). 106 Nagel 1974, 444 f. 107 Nagel 1974, 442. 108 Dies ist ein Beispiel von Jackson 1986. 109 Searle 2006, 133; Herv. S.P. 110 Woher weiß man das? Durch Introspektion. Die ist schwer zu kommunizieren. Man weiß einfach, so seltsam das klingt, wie es ist, jemand zu sein und was damit so alles zusammenhängt. All die Beispiele, mit Blinden, Fledermäusen, chinesischen Zimmern, usf. sind nur komplizierte Argumentationskonstrukte, die diese einfache Einsicht plausibel machen sollen, zu der, vom Hinweis auf ihre bloße Gegebenheit abgesehen, nicht viel mehr zu sagen ist (vgl. Searle 2006, 142). 111 Damit ist also mehr gesagt als das, worauf die sprachanalytische These der Irreduzibilität indexikalischer Ausdrücke abzielt, die etwa auch Tugendhat vertritt (dazu Kap. VII.3). Über diese These hinaus soll geltend 104 36 Wittgestein hätte gesagt, dies zeige sich;112 der frühe Heidegger hätte von einer »formalen Anzeige«von etwas gesprochen,113 das sich direkt nicht benennen lasse, sondern nur im indirekten Modus des »aufweisenden Sehenlassens«114 zugänglich sei. Sucht man doch Worte dafür, scheint etwa der Ausdruck »Für-mich-sein«, im Gegensatz zur anonymen Formulierung »Für-sich-sein«,115 geeignet. Anschließend an die oben gestellte Frage »Wer bin ich?« könnte man auch eine »Wer«- von einer »Was«-Identität unterscheiden. Nur was ich bin, meine Eigenschaften, lässt sich durch objektive Attribute ausdrücken, nicht aber wer ich bin. Schließlich ließe sich in dem Sinne, in dem Heidegger schreibt: »Dasein ist daher nie ontologisch zu fassen als Fall oder Exemplar eine Gattung von Seiendem als Vorhandenem«, vom »Charakter der Jemeinigkeit«116 sprechen, um so zum Ausdruck zu bringen, das sich das so charakterisierte Seiende allgemeinbegrifflicher Erfassung nicht fügt. Jemeinigkeit in dem Sinne, dass »ich den Anderen nie bin«, 117 ist keine Charakteristik, die darin aufgeht, sie allgemein allen Menschen als Eigenschaft zuzusprechen. So würde ihre Spezifik, »je meine« zu sein, verloren gehen und in einen allgemeinen Begriff von »Meinigkeit überhaupt« verwandelt, der dann unter anderem auch mir zukäme. Sagen wir in Kombination all dieser Vorschläge und durchaus absichtlich holprig: Wie es je für mich ist, wer zu sein oder – im Beispiel – traurig zu sein, geht durch jeden Versuch der objektiven Ausdrucksweise verloren. Doch bleiben dies unbeholfen anmutende Versuche, etwas zu sagen, das sich kaum sagen lässt. Auf hier nur angedeutete »Unsagbarkeit« dessen, was sich nur »zeigt«, werden wir ebenso zurückkommen (Anhang I) wie auf die Unterscheidung in Wer (bzw. Wie) und Was (u.a. Anhang II). Sehen wir aber zunächst weiter, wie Schmitz mit diesem »Ichproblem« umgeht. c) Subjektive Tatsachen Am Beispiel »Ich bin traurig« hat Schmitz gezeigt, dass der Gehalt dieses Satzes, wenn er ihn aussagt, nicht in Ausdrücke übersetzt werden kann, die nicht enthalten, dass er es ist und ihm die Trauer nahe geht. Was ist es nun, was immer schon hinzugekommen sein oder vorausgehen muss? gemacht werden, dass uns auch die Gebrauchsregeln für das Wort »ich« nicht über den gemeinten Sinn informieren würden (vgl. Koch 1994, 33) . 112 Vgl. Wittgenstein 1921, 6.522: »Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische«. Wittgenstein meint damit nicht nur Ethik, Ästhetik und Logik, sondern auch das Subjekt (vgl. dazu auch ebd., 5.6 ff.; in einer Tagebuchaufzeichnung vom 5.8.1916 bekennt Wittgenstein ferner »Das Ich, das Ich ist das tief Geheimnisvolle!«). 113 Vgl. Denker/Kisiel/Zaborowski 2008. 114 Heidegger 1927a, 32. 115 Vgl. Henrich 1999, 61. 116 Heidegger 1927a, 42. 117 Vgl. Heidegger 1924, 115: »Das Dasein des Anderen habe ich nie in der ursprünglichen Weise der einzig angemessenen Art des Habens von Dasein: den Anderen bin ich nie«. 37 Die Tatsachen meines Soseins scheinen also in zwei scharf geschiedene Klassen zu zerfallen: Neben den objektiven Tatsachen, die [...] z.B. darin bestehen, daß Hermann Schmitz in Leipzig geboren ist, Philosophie doziert und sich gerade mit den und jenen Gedanken beschäftigt, gibt es die ›subjektiven‹, aber für mich weit wichtigeren Tatsachen, die daraus hervorgehen, daß gerade ich dieser Hermann Schmitz – und nicht Alexander oder Caesar – bin (1968, 97). Alle Eigenschaften, Zuschreibungen, Identifizierungen, etc. die ich oder andere mir anhängen können, sollen objektive Tatsachen heißen (sofern sie zutreffen; andernfalls sind sie objektive Sachverhalte). Unter diesen komme ich aber gar nicht vor. Um selbst vorzukommen, muss ich die subjektive Tatsache anfügen, dass ich Sascha Pahl bin. Diese ist »weit wichtiger«, weil ich ohne sie gar nicht wüsste, was ich mit dem Bericht von einem gewissen Sascha Pahl anfangen soll. »Ich muß es hinzubringen, damit alles, was ich über diesen Menschen weiß oder lerne, für mich sein besonderes Gewicht gewinnt; sonst könnte dieses Wissen mir so gleichgültig sein wie ein beliebiges Lehrstück aus dem Geschichtsunterricht« (1999, 75). Schmitz definiert subjektive Tatsachen als solche, die »höchstens einer im eigenen Namen aussagen kann« (1996b, 172). Der Nachweis der subjektiven Tatsachen am Beispiel der in der verarmten Sprache nicht aussagbaren Nuance zeigt, dass die subjektive Tatsache, dass ich es bin, der traurig ist, nicht auf objektive reduzibel ist. Umgekehrt lässt sich für die Existenz solcher subjektiven Tatsachen auch durch den Nachweis argumentieren, dass durch sie solche, die nur objektiv sind, entscheidend erweitert werden. Ersteres nennt Schmitz den Nachweis »von oben«, letzteres den »von unten« und führt ihn am Beispiel einer Erzählung ›frei nach Dürrenmatt‹. Sie berichtet von einem Kunstfreund, der, einen von ihm hochverehrten Dichter besuchend, von diesem die Absicht hört, einen Menschen zum Fenster herauszuwerfen, um durch Studium der Todesangst die dem Dichter höchst nötige Kenntnis der menschlichen Natur zu bereichern. Der Besucher hört sich das mit behaglichem Grausen an, bis er an der Beschreibung merkt, daß er es selber ist, der gestürzt werden soll. In diesem Augenblick bereichert sich ihm der mitgeteilte Sachverhalt um eine für ihn sehr bedeutsame Nuance, wie seine Reaktion zeigt, die nun nicht mehr behaglich, sondern – der Absicht des Dichters entsprechend – panisch ist (1990, 8). Man male sich zur Illustration einen dritten Anwesenden aus, der die Szene beobachtet und im übrigen mit keinem der beiden näher bekannt ist. Für diesen bereichert sich die Szenerie, während der Dichter erzählt, nur immer weiter um objektive Tatsachen. Auch wenn er irgendwann bemerkt, dass der Kunstfreund gemeint ist, ist das für ihn nur ein weiterer Aspekt des Planes des Dichters. Der Kunstfreund hingegen erfährt zwar auch immer mehr Objektives über des Dichters Pläne. Auch an dem Punkt, als er versteht, dass er gemeint ist »hat sich ihm der objektive Sachverhalt noch einmal bereichert, aber in völlig anderer Weise als vorher, nämlich durch Subjektivität, und das so sprunghaft, daß es ihm die Sprache verschlägt und er nicht einmal mehr zum Aussagen dieses für ihn subjektiven Sachverhaltes kommt« (1990, 9). Jeder Versuch aus der Perspektive der dritten Person objektiv zu beschreiben, was vor sich geht, könnte nicht das treffen, was es für den Kunstfreund in diesem Moment bedeutet, als er selbst betroffen zu sein. 38 d) Primäre Subjektivität Wir haben mit Schmitz gesehen, dass es subjektive Tatsachen gibt und dass sie nicht auf objektive reduzibel sind. Schmitz macht nun einen weiteren Unterschied zwischen subjektiven und objektiven Tatsachen: Jene sind ursprünglicher und »echter« als diese. Die subjektiven Tatsachen sind die aus dem Leben gegriffenen, die mit dem Gewicht der vollen Wirklichkeit, der schicksalshaften Verstrickung. Objektive Tatsachen sind Destillate, abgeblaßt zur Neutralität, daher in bloß registrierender Einstellung zugänglich; sie verhalten sich zu den für jemand subjektiven Tatsachen wie die bloße Erzählung von einem Geschehen zum Mitmachen dabei (1993a, 23). In diesem Sinne sollen sie keine bloße Zutat sein, die man der objektiven Welt anhängen müsste, um ihr Bild zu vervollständigen: »Jemand ist traurig« plus »ich bin dieser jemand«; das wäre lediglich die Zuschreibung einer objektiven Tatsache. Sie sind nach Schmitz kein Zusatz und auch keine subjektive Perspektive auf Objektives, sondern »primär subjektiv« (1996b, 175) »bevor« irgendetwas objektiv ist.118 Was bedeutet das? Man kann es sich ontogenetisch veranschaulichen: Für kleine Kinder ist zunächst alles subjektiv, sie können Eigenes und Fremdes gar nicht unterscheiden. Objektivität gibt es für sie erst durch »Abschälung der Subjektivität« (1990, 8), indem Dinge die Eigenschaft unmittelbaren Angehens oder Betroffenmachens verlieren.119 Kinder lernen, die Pronomen zu verstehen und zu verwenden und so »ich«, »es«, usf. zu unterscheiden. Hiernach gibt es für sie Objektives, unabhängig von ihnen Existierendes und erst dann können sie (durch Zuschreibung) ausdrücken, dass etwas für sie subjektiv ist, was natürlich nicht heißt, dass es vorher nicht für sie subjektiv gewesen wäre. Erwachsene sind zwar in hohem Maße fähig, sich davon zu emanzipieren, was sie unmittelbar angeht und betrifft, es »objektiv« zu betrachten, doch kennen auch sie solche »tierischen«, »idiotischen« Zustände des »Inneseins«, etwa bei Schreck, Scham oder Ekstase, in welchen sie jede Abstraktions- und Objektivierungsfähigkeit verlieren und gleichsam auf diese subjektive Tatsachen zusammenschrumpfen. Wer in tiefe, dumpfe Trauer versunken ist, kann nicht einmal mehr ›Ich bin traurig‹ sagen; um sich auf sich zu besinnen, muß er sich von dem Abgrund seines Brütens mindestens ein wenig distanzieren. Auf der anderen Seite pflegt man von einem Menschen in loderndem Affekt zu sagen, daß er sich z.B. im Zorn selbst vergißt. Erst recht trifft das auf Zustände ekstatischer, fieberhafter Hineingerissenheit in eine kollektive Atmosphäre zu, wie manchmal bei der heutigen Jugend in Diskotheken und auf Jazzoder Rock-Festivals, bei den Glossolalen im Urchristentum und in heutigen Sekten, beim Soldaten im Eifer des Gefechts; man kann auch an plötzlich aufzuckenden Schmerz und hemmungslose geschlechtliche Erregung denken (1996b, 171). Auch folgende Worte des frühen Hegel veranschaulichen dies: »Die Entgegensetzung des Anschauenden und des Angeschauten, dass sie Subjekt und Objekt sind, fällt in der 118 In fichtescher Terminologie gesprochen: Das Ich setzt sich im Ich ein Nicht-Ich. Es muss schon für sich sein, »bevor« ein Nicht-Ich für es etwas sein kann (vgl. z.B. Fichte I, 110) 119 Schmitz betont, dass deswegen aber »nicht jede objektive Tatsache aus einer entsprechenden subjektiven hervorgeht« (2003a, 16). »Viele Sachverhalte kommen von vorn herein als objektive vor. Die Abschälung ist summarisch geschehen« (1999a, 59). Wenn Objektivität einmal da sei, müsse sie nicht »an jedem Sachverhalt einzeln« (ebd.) erst »hergestellt« werden. 39 Anschauung selbst weg; ihre Verschiedenheit ist nur eine Möglichkeit der Trennung; ein Mensch, der ganz in der Anschauung der Sonne versunken wäre, wäre nur ein Gefühl des Lichts, ein Lichtgefühl als Wesen«.120 Für ein solches Lichtwesen wäre alles subjektiv, da keine Scheidung in Subjektives und Objektives statt fände; Subjekt und Objekt stünden sich in ihm nicht gegenüber, so wie es bei Avenarius eine bloße Vorfindung ohne Vorgefundenes und Vorfindendes gab (Kap. III.2). Schon hier ist erkennbar, wieso Schmitz von subjektiven Tatsachen spricht und nicht von Subjekt und Objekt. Eine sprachphilosophisch beeinflusste Ersetzung der »Dingontologie« durch eine »Sachverhaltsontologie«, wird ihm unter anderem ermöglichen, den Paradoxien des Selbstbewusstseins etwas entgegenzusetzen. Wir werden das noch genauer betrachten. Hier ist nur wichtig, dass in solchen subjektiven Tatsachen keine Scheidung in Subjekt und Objekt vorkommt, weil sie einer solchen noch vorausgehen. Zugleich soll die Rede von Subjektivität in diesem Sinne aber auch jede Vorstellung eines »bloß subjektiven« abhalten. Subjektivität als »primäre« ist, wie der Schmitz-Schüler Großheim erläutert, nicht im Sinne eines »erkenntnistheoretischen Unsicherheitsfaktors aufzufassen. Subjektiv soll hier nicht heißen: persönlich, privat, parteiisch, täuschend, fehlbar; unscharf, unklar, unsicher, beliebig, zufällig, unberechenbar, unverbindlich, willkürlich, wechselhaft«.121 Heidegger hatte, um solchen Assoziationen einer bloß perspektivischen Gegebenheit zu entgehen, von »Jemeinigkeit« statt von Subjektivität gesprochen.122 Schmitz spricht im selben Sinne (vgl. II.2, 74 f.) von »strikter Subjektivität« und grenzt sie gegenüber der »positionalen« ab, welche als »eine beliebige, höchstens durch die Position in einem Kontext ausgezeichnete Sache unter lauter Sachen vom Standpunkt eines neutralen Registrierens« (1996a, 1) bloß eine bestimmte subjektive Perspektive auf Objektives meine, während die strikte Subjektivität insofern »tiefer« liege, als sie noch vor jeder Reflexion und vor jeder Welt, die einem Menschen als objektiv gegenüber stehen könnte, verortet ist. Insofern sei sie »keine Perspektive, kein Verhältnis des Subjekts zu etwas« (1993a, 106). Wäre Subjektivität eine subjektive Perspektive oder Gegebenheitsweise auf etwas Objektives, so spräche nichts gegen ihre prinzipielle Objektivierbarkeit wie etwa, wenn »auf Grund eines momentanen Sehfehlers der Laternenpfahl vor mir nur in verschwommener Weise gegeben ist« (2004b, 224). Eine hinreichend genaue Kenntnis dieser Perspektive würde eine ganz 120 Hegel 1, 386 Vgl. Großheim 2003, 406. 122 Vgl. Heidegger 1927a, 106, wo er betreffs des Vorwurfs, was er beschreibe sei »bloß subjektiv« bemerkt, dies sei »eine ›Subjektivität‹, die vielleicht das Realste der ›Realität‹ der Welt entdeckt, die mit ›subjektiver Willkür‹ und subjektivistischen Auffassungen eines ›an sich‹ anders Seienden nichts zu tun hat«. Ferner lesen wir: »Dasein als je eigenes bedeutet nicht isolierende Relativierung auf äußerlich gesehene Einzelne und so den Einzelnen (solus ipse), sondern ›Eigenheit‹ ist ein Wie des Seins [...] Nicht aber eine regionale Abgrenzung im Sinne einer isolierenden Gegensetzung« (Heidegger 1923, 7; vgl. außerdem Großheim 1994, 43, der bemerkt, dass dieses Wie auffällig demjenigen Nagels (s.o.) gleicht). 121 40 objektive view from nowhere ermöglichen. Was Heidegger Jemeinigkeit und Schmitz Subjektivität nennt, meint dem gegenüber eine irreduzible Faktizität menschlichen Daseins, die wie gesagt schwer in Worte zu fassen ist. Für sie ist aber keine Privatsprache von Nöten (vgl. 2004b, 224), wenn sie auch zwecks Erhalt der Bedeutungsnuance der Subjektivität jeder nur im eigenen Namen aussagen kann. In diesem Sinne ist die Subjektivität der subjektiven Tatsachen »primär«. Subjektive Tatsachen sind hinreichend, um von Subjektivität, Jemeinigkeit oder Fürmichsein zu sprechen; diese Titel kommen nach Schmitz folglich auch schon Tieren und Säuglingen zu. Da das in den genannten Phänomenen beschriebene »Angegangenwerden« ohne Möglichkeit zur Distanznahme »das Urphänomen der Subjektivität« (1993c, 51) ist, sind sie außerdem auch notwendig: Nur dadurch haben auch Erwachsene Subjektivität. »Subjektivität ist in diesem grundlegenden Sinn nicht etwa eine Eigenschaft von Subjekten (d.h. Bewußthabern), sondern [...] von [...] Tatsachen« (1993c, 51). Nicht dadurch, dass es Subjekte gibt, gibt es Subjektivität, sondern umgekehrt »Subjekte gibt es, und gibt es nur, durch Subjektivität« (1987, 28) der subjektiven Tatsachen.123 Warum das so ist, betrachten wir nun. Welche Art von Tatsachen sind das, die mich zu mir machen? 3. Selbstbewusstsein Ein leichter Kopfschmerz muß alle meine Vorstellungen begleiten können. (Günter Schulte, frei nach Niklas Luhmann) a) Affektivität Dass das Beispiel für subjektive Tatsachen »Ich bin traurig« war, ferner vom unmittelbaren Angegangenwerden jenseits jeder Distanzierungsfähigkeit und entsprechenden Beispielen, im Hegel-Zitat vom Gefühl die Rede war und oben das Goethe-Zitat bemüht wurde, ist nicht zufällig. Schmitz behauptet nämlich: Subjektive Tatsachen sind nur in Phänomenen nachweisbar, die uns durch Affektivität unmittelbar angehen. Schmitz nennt das »affektives Betroffensein«. Es ist also nicht nur so, dass ich mich unter allen mir zuschreibbaren objektiven Tatsachen nicht finden könnte, dasselbe gilt für alle affektiv neutralen Tatsachen, ja: Objektive Tatsachen sind affektiv neutrale Tatsachen, die mich nicht angehen, von welchen ich mich distanzieren kann. Statt vom »bloß« subjektiven könnte man also vielmehr vom »bloß« Objektiven sprechen. »Objektivität heißt hier also nicht so viel wie gesicherte 123 Subjektivität ist hier also weder auf eine Bezeichnung für die Strukturverfassung von Subjekten (Was es heißt, ein Subjekt zu sein, welche Eigenschaften etwas zu einem Subjekt machen, etc.) zu reduzieren noch bezeichnet sie bloß dasjenige, was »(noch) nicht objektiv ist« (vgl. Henrich 2007, 23, der drei Bedeutungen unterscheidet, deren dritte für hiesige Zwecke aber nicht relevant ist.). Sie schillert gleichsam zwischen beiden Bedeutungen. 41 Erkenntnis, sondern meint affektive Neutralität, Gleichgültigkeit«.124 Allein im Modus des Fühlens und Spürens sei daher die Tatsache, dass ich es bin, erschlossen. »Schmerzen, Trauer, Freude usw. muß man nie wie eine Fundsache auflesen, um sich nach einem Besitzer, dem sie zugeschrieben werden, umzusehen; sowie ich einen Schmerz spüre, weiß ich auch schon, wer leidet, nämlich ich selbst« (1996b, 171). Das ist phänomenal sicher richtig, aber ist es nicht beim Denken genauso? Denkend weiß ich auch wer denkt, nämlich ich selbst. Kann man sinnvoll fragen, ob dieser Gedanke mein Gedanke ist? Muss ich mir meine Gedanken erst zuschreiben, damit es meine sind? Das scheint phänomenologisch falsch beschrieben zu sein. Schmitz meint dagegen, wer seine Betroffen- oder Ergriffenheit ausspreche oder einen Gedanken über sie fasse (sich etwas zuschreibe), nehme bereits Distanz dazu ein. Dann sei auch Täuschung möglich, die im unmittelbaren Innesein schon deswegen nicht stattfinden könne, weil gar keine Frage aufkomme: Um sich etwas zu fragen, ist ein Abstand zum Fraglichen von Nöten. Denken bedeutet Abstand zwischen Denkendem und Gedachtem, zwischen Selbst und Zuschreibung, wohingegen im unmittelbaren Innesein »kein Selbst mehr präsent [ist], dem etwas zugeschrieben werden könnte« (1996b, 171). Zwar muss man sich seine Gedanken de facto nicht erst zuschreiben, damit sie die eigenen werden, doch sind Gedanken als solche gleichwohl nicht unmittelbar die eigenen. Man kann also fragen, ob dies die eigenen Gedanken sind, einfach deswegen, weil man denkend nicht seine Gedanken ist, sondern ein Abstand zwischen beidem besteht, der Fraglichkeit ermöglicht. Dass ich ich bin, kann ich deswegen nicht durch Denken wissen oder im Denken herausfinden, sondern der Gedanke an etwas, das ich bin, setzt umgekehrt bereits voraus, dass ich durch die Erfahrung, dass mich etwas angeht, also durch affektives Betroffensein, mich erfahren habe und auf diesem Wege meiner Identität unmittelbar gewiss bin. Andernfalls – im reinen Nachdenken über sich (bei Schmitz: »Zuschreiben«, »Besinnung«) – könnte es bei Strafe der Paradoxie der Selbstzuschreibung nie zu einer Ich-Identität kommen. Wären wir nur denkende Wesen, so hätte nach Schmitz Lichtenberg recht: »Es denkt« müsste man dann sagen. »Wenn einer ein noch so gutes Bild von sich hat, kann er von Selbstbewusstsein noch himmelweit entfernt sein. Er muß nämlich noch merken, dass es sich um ihn selbst handelt« (2003a, 65). Und dieses unmittelbare Merken ist nach Schmitz eben kein Denken und kein Wollen, sondern ein Fühlen: Affektives Betroffensein. Nur wahre Unmittelbarkeit kann 124 Großheim 2003, 407. 42 Selbstbewusstsein garantieren, alle anderen Versuche seiner Grundlegung scheitern am Fehler des Reflexionsmodells.125 Schmitz’ These ist, dass der Grund der Ich-Identität und damit der Möglichkeit von Selbstbewusstsein in der Affektivität liegt und nicht – wie andere meinten – im Denken oder Wollen. Das affektive Betroffensein sei nicht nur das Urphänomen der Subjektivität, sondern damit auch schon des Selbstbewusstseins. Damit glaubt er, der Paradoxie der Selbstzuschreibung zu entgehen, denn in den genannten Phänomenen habe man eine solche Selbstzuschreibung gar nicht nötig, sondern erlebe sich als unmittelbar identisch. Affektives Betroffensein ist das gesuchte ursprüngliche, unmittelbare Selbstbewusstsein, für das keine Selbstzuschreibung von Nöten ist, da es unmittelbar Identität mit sich bringt, ohne identifizierender oder reflexiver Leistungen zu bedürfen. Das Hegelsche Lichtwesen wäre ganz es selbst, ganz mit sich identisch, aber ohne die Fähigkeit, sich etwas zuzuschreiben, sich als etwas von anderem abzuheben.126 Das affektive Betroffensein ist der Igel in uns, ohne welchen es kein Selbstbewusstsein geben könnte, weil »die Welt ohne affektives Betroffensein neutral wäre, d.h. niemandem einen Angriffspunkt [...] liefern würde, sich selbst für etwas bestimmtes zu halten; jeder könnte dann nichts und daher nur nicht sein« (1999c, 58). Affektives Betroffensein ist also notwendig für Selbstbewusstsein. Darüber hinaus gilt auch: Affektives Betroffensein ist bereits hinreichend für Selbstbewusstsein, weil derartiges Nahegehen nicht als neutrales, anonymes oder unbewusstes127 Datum »vor sich hin« existiert, sondern je mir nahe geht. Obwohl dies kein reflektiertes Selbst, kein Ich ist, ist affektives Betroffensein bereits Selbstbewusstsein: »Es handelt sich, paradox gesprochen, um ein Selbstbewußtsein ohne Selbst« (1999a, 79). Man kann [...] nicht leiden im Sinne des Leid-Tragens, des affektiven Betroffenseins von Leid, ohne zu merken, daß es sich um einen selber handelt [...] Demnach gibt es Selbstbewußtsein in Selbstvergessenheit, wenn nichts verfügbar ist, dem in der Weise der Selbstzuschreibung etwas zugeschrieben werden könnte (1996b, 172). Die Jemeinigkeit oder Wer-Identität hat also nach Schmitz ihren Grund im affektiven Betroffensein, darin, dass mich etwas angeht und so angeht wie es niemanden sonst angeht. Die Subjektivität der subjektiven Tatsachen des affektiven Betroffenseins macht mich zu mir. Das ist Schmitz’ Antwort auf die Frage »Warum bin ich ich?«. Es ist aber zugleich auch die 125 Als phänomenale Beschreibung bleibt allerdings richtig, dass wir uns auch im Denken und Wollen als uns selbst erleben. Dies gilt auch dann, wenn dieser Sachverhalt womöglich einer Erklärung durch das affektive Betroffensein bedarf. Darauf wird zurückzukommen sein (Kap. VIII). 126 Man kann das auch so ausdrücken: Dieses Wesen könnte sich, wie die sinnliche Gewissheit, nicht irren. Das ist der Sinn, den Unmittelbarkeit hier hat und den man etwa auch in der analytischen Philosophie gerne bemüht (vgl. Kap. VII.3). 127 Ein unbewusstes Angehen könnte niemanden angehen. Ein anonymes Angehen aber wäre gar kein Angehen. »Unter allen Weisen des Erlebens ist affektives Betroffensein die einzige, die nicht unbewußt sein kann. [...] Unbewußter Schmerz zum Beispiel würde nicht weh tun und wäre insofern kein Schmerz mehr. Unbewußtes Wollen, Planen, Denken sind dagegen widerspruchsfrei denkbar« (1999c, 55). 43 Antwort auf eine weitere drängende Frage »Subjektivität kann bestimmt werden als allgemeine Antwort auf die Frage ›Wer bin ich?‹, Subjektivität für mich also als mein Dersein-der-ich-bin, Subjektivität für jemand als dessen Sein-der-er-ist« (1999a, 82).128 Schmitz hat nun viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nicht nur ist das Beweisziel in Form des in Kap. IV.1 angeführten letzten Punkts erfüllt: Es gibt phänomenal ausweisbares Selbstbewusstsein, da das unmittelbare Selbstbewusstsein im affektiven Betroffensein niemanden benötigt, der sich etwas zuschreibt oder auf sich reflektiert. Zudem ist Schmitz’ Lösung sowohl von der Problematik der Selbstzuschreibung als auch von der verhängnisvollen Subjekt-Objekt-Identität frei und damit die Paradoxie der Zweieinigkeit ebenso gelöst wie die der Selbstzuschreibung. b) Vom Ich zum Mir Die subjektiven Tatsachen des affektiven Betroffenseins sind derart, dass ich sie mir nicht eigens zuschreiben muss, sie sind immer für mich (bzw. für jemand anderen), sofern sie sind, ich bin sie gewissermaßen. Doch Obacht – nicht eigentlich »ich«, denn sobald ich das sage, sobald ich zum Nachdenken darüber wieder fähig bin, etwa nachdem ich im Zorn mich selbst vergessen hatte oder so tief in Trauer versunken war, dass ich es nicht einmal auszudrücken vermochte, bin ich ja schon über sie hinweg. Wir können also nicht sagen, dass »ich« das bin, da es in diesen Zuständen ja gerade kein Ich gibt. Aber wenn nicht ich, wer dann bzw. wie dann? Der Sachverhalt lässt sich in der uns geläufigen Sprache offenbar noch immer nur schlecht ausdrücken. Wo kein Selbst ist, denkt man, kann auch kein Selbstbewusstsein sein. Schmitz sagt deswegen auch lieber »Sichbewussthaben« statt Selbstbewusstsein: »Jedes affektive Betroffensein ist ein Sichbewußthaben vom Typ des Sichspürens« (1999a, 78). Doch auch hier fragt sich sogleich: Wie kommt das reflexive »sich« ins unmittelbare Innesein? Man denkt sofort an ein substanzielles oder zumindest »quasisubstanzielles« Selbst, das in Relation zu bestimmten Eigenschaften steht, die ihm zukommen bzw. zugeschrieben werden. Dass wir zu Unrecht die Tendenz haben, ein solches anzunehmen, versucht Schmitz durch Sprachkritik zu beantworten: Reflexivpronomen müssten nicht zwangsläufig auf Reflexivität hindeuten. 128 Unschwer erkennt man im affektiven Betroffensein das Pendant zu dem, was Fichte im »System der Sittenlehre« (§ 1 = Fichte IV, 18 ff.) mit dem »Wollen« im Sinn hatte: Die Einheit von Subjekt und Objekt (des Handelns). Sowohl beim Fichte der Sittenlehre als auch bei Schmitz haben wir es mit einem »Finden« und nicht mit einem »Setzen« zu tun. Während Fichtes Auffassung des Sichfindens (§ 1, Auflösung) nur im Wollen möglich ist, weil es nur da sich findet, also etwas findet, das keine Spaltung in Subjekt und Objekt aufweist (vgl. § 1, Beweis, v.a. letzter Satz = Fichte IV, 22), ist es in Schmitz’ (vgl. § 1 seines »Systems«: »Das Sichfinden in der Umgebung«) aus demselben Grund nur im affektiven Betroffensein möglich. Wenn Fichte auf eine intellektuelle Anschauung verweist, die jeder in sich finden müsse, ist das auch gar nicht so verschieden von Schmitz Verweis auf die Erfahrungen eines jeden mit affektivem Betroffensein. Beides ist nicht deduzier- oder definierbar, sondern nur »jemeinig erschlossen«. 44 Wir sollen »sich«, »mich« oder »mir« lesen wie ein Adverb, also wie andere indexikalische Ausdrücke: etwa »hier«, »jetzt« oder »dieses«. So wie man zu einem »Jetzt ist es still« nicht »das Jetzt« hypostasieren muss, in welchem es still ist, und die Verwendung von »dieses« nicht zu einer »haecceitas« (Diesdaheit) erweitern muss, müsse man auch für den durch »mich friert es« oder »ich fürchte mich« ausgesagten Sachverhalt kein Ich (und schon gar keine »Ichheit überhaupt«) annehmen, das (bzw. die) sich dahinter verberge und friere oder gar sich selbst fürchte (obwohl für das besonnene Aussprechen sehr wohl ein solches erforderlich ist). Beides »ereigne« sich einfach, aber nicht neutral und objektiv, sondern subjektiv-für-jemanden, oder besser »mir-subjektiv«, insofern »das Michbewußthaben im affektiven Betroffensein kein Bewußthaben mit einem Ich oder Mich oder Selbst als intentionalem Objekt, sondern ein Geschehen mit adverbial charakterisierter Weise oder Nuance, die als Mir-Subjektivität oder Mich-Subjektivität bezeichnet werden kann« (1999c, 80), darstellt. Die Subjekt- oder Ichphilosophie wird so tiefer gelegt durch eine »MirPhilosophie« (vgl. 1990, 205).129 Damit ist gleichsam ein Mittelweg beschritten zwischen cartesianischer oder kantianischer Subjektphilosophie (Kap. III.1), die den Paradoxien anheim fällt und einem Anticartesianismus (Kap. III.2), der schwer um die Behauptung herum kommt, nicht ich, sondern es denke und damit Selbstbewusstsein letztlich leugnen muss. Schmitz Lösung dagegen lautet: Nicht das reflektierte Ich ist die Grundlage des Selbstbewusstseins, doch auch nicht das anonyme und blinde Es, sondern das weder reflektierte noch anonyme Mir oder Mich des affektiven Betroffenseins. Wenn mir nichts nahe geht, gibt es weder ein Ich noch ein Es. Selbstbewusstseinstheorien, welche das »Reflexionsmodell« durch ein unmittelbar gegebenes Selbstbewusstsein zu unterlaufen suchen, das jedem reflektierten Ich schon vorausgeht, also nicht als Bewusstsein eines Subjekts von sich bestimmt ist, sondern – allgemein gesprochen – als Bewusstsein, das von oder in psychischen Zuständen besteht, können wir gegenüber den in Kap. III.1 egologisch genannten, als nicht-egologisch bezeichnen.130 Schmitz vertritt offensichtlich eine solche und wir werden noch auf weitere zu sprechen kommen. 4. Zusammenfassung Wir fassen nochmals zusammen. Durch affektives Betroffensein, das in subjektiven Tatsachen besteht, die »schon da« sind, bevor Subjekte auf den Plan treten und explizit von sich wissen (sich etwas zuschreiben können), ist Subjektivität primär. Keineswegs wird damit die Existenz von Subjekten bestritten; subjektive Tatsachen werden lediglich für 129 130 Die Idee eines solchen »Mir« stammt ursprünglich von Gernot Böhme (vgl. Böhme 1986, 236). Vgl. Frank 2007, 417. 45 ursprünglicher als Subjekte erklärt: »Demnach sind subjektive Tatsachen ohne Subjekte möglich, Subjekte aber nicht ohne subjektive Tatsachen. Präpersonale Subjektivität fundiert die personale« (1999c, 58 f.). Dass ich bin, folgt nicht daraus, dass ich denke, sondern daraus, dass – Obacht: nicht ich fühle, sondern – mir fühlt. Wenn mich nichts angeht oder anmacht (»affiziert«), bin ich gar nicht. Für mir-subjektive Tatsachen ist keine Person notwendig, die sie hat, denn sie sind auch, wenn niemand sie aussagt oder über sie nachdenkt, – wie bei Tieren und Kleinkindern, die bloß diffuse subjektive Sachverhalte »bewusst haben«, ohne daraus einzelne explizieren oder gar aussagen zu können. »Viele von diesen Wesen können keinen distinkten Gedanken fassen; keine für sie subjektive Tatsache zeichnet sich für sie einzeln ab, und selbstverständlich können sie keine sprachlich beschreiben. Das ist für affektives Betroffensein und Bewussthaben auch nicht erforderlich« (1987, 27). Sie sind diese subjektiven Sachverhalte, die originär für sie sind, ohne aber dass »hinter« diesen noch ein reflektiertes Subjekt steckte, das sie haben würde. Diese »Protoselbstheit« des Mir ist bereits Selbstbewusstsein, da hier trotz fehlender Scheidung in Subjekt und Objekt schon ein »Sichbewussthaben« als unwillkürliches Angegangenwerden stattfindet. Wie im obigen Zitat werden wir diese Form des Selbstbewusstsein im Folgenden auch als »präpersonales« bezeichnen. Damit ist zudem gesagt, dass Bewusstsein immer auch Selbstbewusstsein ist. Es gibt nicht zunächst Bewusstsein und schließlich noch zusätzlich Selbstbewusstsein als höhere Stufe davon. Das folgt, wie bereits bei Fichte, unmittelbar aus der Kritik am Reflexionsmodell, das ja von einer ebensolchen Vorstellung (Bewusstsein + Reflexion = Selbstbewusstsein) ausging.131 Wäre dem so, würde nicht nur Selbstbewusstsein, sondern auch Bewusstsein überhaupt unverständlich: Es gäbe dann keinen, der es hätte. Bewusstsein wäre von etwas, aber für niemanden. Für Schmitz ist daher Bewusstsein nie anonym, sondern sobald es ist, ist auch Selbstbewusstsein als unwillkürliches »Angehen« mitgegeben: »tua res agitur«, wie er gerne mit Horaz sagt. Bei erwachsenen Menschen (Personen) kommt neben solchen Zuständen des unwillkürlichen Angegangenwerdens, die Fähigkeit zur Selbstzuschreibung, zur Besinnung auf ihr – wie wir unter Vorgriff auf Kap. VII.2 sagen können – »Kern-Selbst« hinzu. Ein bestimmtes einzelnes Selbst als »Sache«, die man als solche identifizieren kann, gibt es erst dann, obgleich Identität schon vorher vorliegt. Was das genauer bedeutet, werden wir im nächsten Kapitel durch einen umfassenderen Blick auf Schmitz’ Theoriegebäude klären. 131 Das ist die Formulierung für die »genetische Variante« von Henrich. Für die strukturelle Variante des Modells als Selbstzuschreibung müsste man formulieren: Sich (A) für etwas (B) halten = Selbstbewusstsein. (Wobei konstitutive Unklarheit bezüglich der Identität oder Verschiedenheit von A und B herrscht!) 46 V. Was will Schmitz? – Über die Grundbegriffe seiner Philosophie Um die in Kap. IV dargestellte Mir-Subjektivität des affektiven Betroffenseins besser verstehen zu können, ordnen wir sie nun in den Gesamtzusammenhang der Philosophie von Schmitz ein, den wir uns vor allem an Hand von vier Leitbegriffen vergegenwärtigen wollen: Leiblichkeit, Situationen, Gegenwart und Person. Leiblichkeit ist der Modus, in dem Menschen affektiv betroffen werden; was uns affektiv betrifft, sind »leibliche Regungen« und Gefühle. Schmitz meint, die europäische Kultur leide an einer Verdrängung des Leiblichen. Dieses sei im Interesse der Erhebung über unwillkürlich ergreifende Affekte unter das Primat des Vernünftigen gezwängt worden, das sich zwecks Beherrschung am sicht- und tastbaren, festen und einzelnen Körper orientiere. Damit einher sei die Konzeption einer Seele als abgeschlossener »Innenwelt« gegangen, welche die Frage nach deren Verbundenheit mit der körperlichen »Außenwelt« nach sich gezogen und zugleich unbeantwortbar gemacht habe. Der Leib sei so zwischen Seele und Körper bzw. Subjekt und Objekt vergessen worden. Dagegen setzt Schmitz erstens eine stark an Heidegger angelehnte »Ontologie der Situationen«, die das menschliche Leben als In-der-Welt-sein, d.h. mit und in der Welt – als einem nicht aus Einzeldingen zusammengesetzten, sondern Bedeutungsganzen – verstrickt sein ausweist, und so eine abgeschlossene Innen- und unerreichbare Außenwelt ebenso ab ovo unterlaufen soll wie die Aporien jeder Subjekt- (Descartes, Kant, Husserl) oder Objektphilosophie (Spinoza, Hegel, alle Spielarten des materialistischen Naturalismus; vgl. 2005, 5). Seine Phänomenologie ist dabei »streng naiv« in dem Sinne, dass sie keinerlei Unterscheidung in Empirisches und Transzendentales macht, sondern in einer Art direktem Realismus ohne subjektive Konstitutionskomponente Phänomene für unmittelbar erfahrbar erklärt. Damit verbunden ist zweitens eine umfassende phänomenologische Analyse des Leiblichen, die dieses vernachlässigte Gebiet der »unwillkürlichen Lebenserfahrung« zurückerobern soll, welche der »Entscheidungsgrund über Glaubwürdigkeit aller weiteren Konstruktionen und Spekulationen« (2004a, 52) sein müsse. Als »Prinzip« – arché, wenn man so will – dient seiner Philosophie dabei die Gegenwart, die hier nicht nur zeitlich zu verstehen ist, sondern ebenso als räumliche Gegenwart, Selbstgegenwart, Wirklichkeit132 und etwas, das Duns Scotus allgemeinbegrifflich als haecceitas (»Diesdaheit«) zu fassen suchte. Als »immer zugänglich und unverwechselbar« (I, 150) soll es das Denken so vor von unwillkürlicher Lebenserfahrung nicht gedeckten Hypostasierungen (d.h. Spekulationen und Konstruktionen) bewahren. 132 Sein, Dasein und Wirklichkeit werden von Schmitz und so auch hier und im Folgenden als äquivalente Termini verwendet. 47 Eine Person ist ein Wesen, das sich von seinen unmittelbar leiblich-gegenwärtigen, affektiven Regungen auch distanzieren kann und dem sich somit »eine Welt eröffnet«. Person und Welt sind eng verbunden und bewegen sich im Rahmen dessen, was Schmitz »entfaltete Gegenwart« nennt. Im Rahmen der genannten philosophiehistorischen und kulturgeschichtlichen Verfallsthese versucht Schmitz über zahlreiche »Verfehlungen des abendländischen Geistes« aufzuklären, die allesamt daraus resultieren, die entfaltete Gegenwart für selbstverständlich und selbstbegründet zu halten. Dafür erinnert er an die einerseits situationshaften und andererseits leiblichen Grundlagen, auf welchen das Personale und insofern auch das Weltliche basiert und die sich nicht in die starren Kategorien von Subjekt und Objekt, Innen und Außen, Seele und Körper fügen lassen. Auch scheinbar selbstverständlichen Voraussetzungen, wie etwa diejenige, alles sei von sich aus identisch und einzeln, unterzieht Schmitz in diesem Zusammenhang einer radikalen Kritik. Gegenüber den »mittelbaren« Phänomenen der entfalteten Gegenwart bezeichnet er dasjenige unmittelbare, leibliche Spüren, in welchem im Extremfall Person und Welt »zusammenbrechen«, als »primitive Gegenwart«. Sie schließt ein, was wir bereits als MirSubjektivität des affektiven Betroffenseins kennen gelernt haben. Ihre Thematisierung soll uns nun ermöglichen, dieses in einen größeren Zusammenhang zu stellen und so Schmitz’ These vom dadurch gegebenen unmittelbar identischen Selbstbewusstsein besser verstehen und einordnen zu können. Eine »ständige Rücksicht« auf Hegel und Heidegger dient in diesem Kapitel dabei sowohl dazu, die Konzeption von Schmitz durch Einordnung in ihre philosophiegeschichtlichen Vorläufer verständlicher zu machen als auch dazu, deren eigene Behandlung in späteren Kapiteln vorzubereiten und bei Schmitz auftretende Probleme auf solche, die schon Hegel oder Heidegger anzutreffen sind, zurückzuführen und so zu verdeutlichen. 1. Leiblichkeit Schmitz unterscheidet die »Statik« des räumlichen Aufbaus des Leibes von dessen »Dynamik«, die sich ständig zwischen zwei antagonistischen Tendenzen hin und her bewegt. Zunächst zur Statik: Was ist der Leib und was unterscheidet ihn vom Körper? Jedermann macht die Erfahrung, daß er nicht nur seinen eigenen Körper mit Hilfe der Augen, Hände u. dgl. sinnlich wahrnimmt, sondern in der Gegend dieses Körpers auch unmittelbar, ohne Sinneswerkzeuge zu gebrauchen, etwas von sich spürt: z.B. Hunger, Durst, Schmerz, Angst, Wollust, Müdigkeit, Behagen (II.1, 5). Derartige Phänomene sind leiblich, während alles, was wir an uns selbst sinnlich wahrnehmen, körperlich ist. Leibliche Regungen werden unmittelbar gespürt, während jede Wahrnehmung des Körpers sinnlich vermittelt ist. Sich diese Leiblichkeit klar zu machen, ist 48 gar nicht einfach, da man im Denken und Sprechen an das sinnlich wahrgenommene (»perzeptive«) Körperschema gewöhnt ist und dazu neigt, die leiblichen Phänomene dort einzuordnen. Wo liegen die Unterschiede? Körperliches hat eine klare Grenze und ist von anderen sinnlich ebenso wahrnehmbar wie von mir. Auch ist es von »relativer Örtlichkeit«, womit gemeint ist, dass es »durch räumliche Orientierung bestimmt ist, d.h. durch Lage- und Abstandsbeziehungen, wodurch mehrere Orte einander wechselseitig identifizierbar werden«. Das nur leiblich spürbare, sinnlich nicht wahrnehmbare (»motorische«) Körperschema hingegen ist von »absoluter Örtlichkeit«, d.h. »unabhängig von räumlicher Orientierung bestimmt oder identifizierbar« (II.1, 6). Leiblich gespürtes Wohlbehagen oder Mattigkeit sind ganzheitliche Phänomene, sie bilden ein »Gewoge verschwommener Leibesinseln« (vgl. II.1, 54) und sind nicht etwa auf rechte und linke Körperhälfte aufteilbar, noch überhaupt nach Abständen bestimmbar, während alles Körperliche prinzipiell teilbar ist, Oberflächen und Dimensionen aufweist. Das eigenleiblich Gespürte ist stets räumlich ausgedehnt, aber in wesentlich anderer Weise als der sichtund tastbare Körper. Dieser hat nach außen eine scharfe, flächige Grenze an der Haut. Der spürbare Leib besitzt keine Haut und keine Flächen. Man kann Flächen so wenig am eigenen Leib spüren, wie man sie hören kann [...]. Das leiblich Gespürte ist genauso unteilbar ausgedehnt wie das Volumen weit ausladender, etwa massig dumpf ergossener Klänge (1990, 117 f.). Akustische Sinneswahrnehmungen vermitteln uns in mancherlei Hinsicht eine näherungsweise Vorstellung von dem, was die unsinnlich gespürten Phänomene des Leibes, speziell gegenüber dem beim Menschen dominanten Gesichtssinn, auszeichnet. Klänge haben offensichtlich weder Flächen noch sind sie teilbar. Nichtsdestoweniger haben sie eine spezifische Ausdehnung, ein Volumen, das sich allerdings in dimensionalen Raumvorstellungen nicht beschreiben lässt. Leibliche Regungen gelten daher ebenso wie Klänge als prädimensional. Ein wohlig warmes Gefühl oder ein stechender Schmerz sind schwerlich als dreidimensionale Gebilde vorstellbar, ebenso wenig aber als zwei- oder eindimensionale; was keinerlei Fläche aufweist, kann weder geteilt werden noch räumlich dimensioniert sein. Deswegen sind sie aber keineswegs unausgedehnt wie Descartes’ res cogitans oder Kants Phänomene des »inneren Sinns«, sondern in einer Weise räumlich, die als unteilbare Ausdehnung der üblichen Raumauffassung entgegensteht und in ihr deswegen auch nicht verortbar ist. »Durst z.B.« ist »ausgedehnt und [...] lokalisiert [...] in der Kehle [...]. Teilbar aber ebenso wenig, wie Denk- oder Willensakte« (II.1, 57). Diese ursprünglich-leibliche Form der Räumlichkeit ist nach Schmitz unentbehrliche Grundlage für die menschliche Orientierung im relativen Raum, der davon nur ein Derivat darstellt. Knapp gesagt: Um mich im relativen Raum zurechtfinden zu können, muss ich 49 selbst einen Ort einnehmen, der nicht seinerseits bloß relativ sein kann.133 Relativer »Ortsraum«, der umkehrbare Lage- und Abstandsrelationen einschließt, sei gar nicht konsistent denkbar ohne den absoluten »Weiteraum«. Dazu gesellt sich »zwischen« beiden noch eine weitere Schicht der Räumlichkeit: der »Richtungsraum«. Er zeigt sich in Phänomenen des Blicks, Schreitens, Tanzens, etc., die unumkehrbar aus der »Enge« des absoluten Leibesorts in die »Weite« führen, »aber noch kein sie abschließendes Ziel in relativen Orten haben« (1990, 281). Deswegen und weil sie in der Regel flüssig beherrscht werden ist eine ortsräumliche Verortung nicht vonnöten (vgl. 1990, 279 ff.; §§ 118-121). Reinem Weiteraum fehlt eine Enge und Weite vermittelnde Richtung.134 Enge und Weite sind nun zentral für die leibliche »Dynamik«. Diese wird auch als »vitaler Antrieb« bezeichnet und ist vergleichbar mit dem psychoanalytischen Konzept der libido als frei flottierender, zielgehemmter Triebenergie, da er »von sich aus kein zielgerichteter Trieb ist, sondern eher so etwas wie der Dampf, unter dem ein Mensch wie ein Kessel steht«. Dieser Dampf ist der leibliche Ort des affektiven Betroffenseins und »besteht in der Verschränkung zweier gegenläufig wirkender Impulse oder Tendenzen, der Engung und der Weitung« (1999a, 32), die gleichsam in einem beständig mäandernden »Dialog« (1992b, 236) miteinander stehen, der das leibliche Erleben bestimmt. Affektives Betroffensein durch leibliche Regungen und Gefühle besteht im Spiel dieser Dynamik zwischen Engung und Weitung des Leibes. Schmerz beispielsweise wird dabei von Schmitz als engendes »Zusammenziehen«, Freude als weitendes »Zerfließen« interpretiert.135 133 Ähnlich hatte schon Kant argumentiert, relativräumliche Orientierung bedürfe einer absoluträumlichen, da nur diese eine Unterscheidung in rechts und links ermögliche (vgl. Kant 1768). Freilich geschieht dies bei ihm in anderem Zusammenhang und Schmitz geht noch »hinter« die ihm als richtungsräumlich geltende Orientierung in rechts und links zurück. Von einem »absoluten Hier« als eines leiblichen Orts hatte auch schon Husserl gesprochen (vgl. Husserl 1966b, 297 f. sowie Zahavi 2007, 58 ff.), der überhaupt als Initiator eines Einzugs der Leiblichkeit ins philosophische Denken im 20. Jahrhundert gelten kann (vgl. Gahlings 2008). Vgl. ferner die Analysen der Räumlichkeit in Heidegger 1927a, §§ 22-24, die allerdings den Leib nicht explizit thematisieren. 134 Diese abstrakten Bestimmungen bedürfen der Exemplifikation. Als Beispiel für den Weiteraum dient Schmitz »der strahlend blaue Himmel, wenn man liegend zu ihm aufblickt und dabei keine Richtungsbahn oder sonstige Gliederung sich abzeichnet [...] Wenn sich nichts zwischen dieses Ganzfeld und den liegenden Betrachter schiebt, findet man sich nach einiger Zeit in ein ungegliedertes Medium ohne Tiefe abstandslos eingebettet«. »Blickt« man so »ins Nichts«, fehlt jede Richtung. Das ändert sich, »wenn man sich etwa unter einem hohen, geraden, kaum durch Äste, Zweige und Blätter verhüllten Stamm befindet und daran entlang zum gleichmäßig blauen Himmel emporschaut. Der Eindruck ist nicht weniger intensiv, aber nun ein überwältigender Eindruck räumlicher Tiefe. Der Blick, der dem homogenen Stamm aufwärts folgt, hält sich an keinem Zielort auf, sondern läßt sich träumerisch in unbestimmt tiefe Weite entführen. Dies ist nun nicht mehr ein Ganzfeld, indem die Gliederung des Raumes aufgehoben ist, sondern etwas, das sich oben befindet. Die bloße Weite« wird so zu einer »von dem Stamm als Schiene vorgezeichneten Richtung« (1990, 280 ff.); ein Beispiel für den Richtungsraum. 135 Für Gefühle (Freude, Trauer, Angst, etc.) gilt in den hier relevanten Hinsichten insgesamt dasselbe wie für leibliche Regungen (Hunger, Durst, Schmerz, etc.). Ihre spezifische Differenz besteht darin, dass Gefühle nach Schmitz überindividuelle Atmosphären im »Gefühlsraum« (§ 153) sind, an sich also nicht subjektiv je am eigenen Leib existieren, sondern »objektiv«. Meine Gefühle werden sie erst, indem sie die Gestalt leiblicher Regungen annehmen, so dass wir beide für unsere Belange nicht weiter unterscheiden müssen und nur von leiblichen Regungen sprechen können. 50 Die Affektivität spielt gleichsam auf dieser leiblichen Klaviatur zwischen Engung und Weitung – daher ihre Relevanz für Fragen nach dem Selbstbewusstsein, dessen Wurzel ja im affektiven Betroffensein und das heißt im Leiblichen liegt. Leiblich sein bedeutet in erster Linie: zwischen Enge und Weite in der Mitte zu stehen und weder von dieser noch von jener ganz loszukommen, wenigstens so lange wie das bewußte Erleben währt. Im heftigen Schreck verschwindet es im Extrem einer Engung ohne Weitung, beim Einschlafen und in verwandten Trancezuständen im Extrem einer Weitung ohne Engung (1990, 122 f.). Enge und Weite an sich kommen »solange der Mensch bei Bewußtsein ist, in ganz isolierter Reinheit nicht vor«, denn sie gehen mit Bewusstseinsverlust – etwa beim Einschlafen (Weite) oder durch schreckhafte Ohnmacht (Enge) – einher. Erlebt werden können nur Tendenzen in die eine oder andere Richtung, in welchen die Pole als »Extrem vorgezeichnet« (1992b, 238; vgl. I, 198) sind. »Engung« bezeichnet daher bloß das relative Übergewicht der engenden Tendenz. Neben »zusammenziehenden« Affekten wie Angst, Schmerz und Schreck sind »im Einbruch des Neuen, das stutzen läßt [...] in der Exponiertheit auf dem Gipfel des Orgasmus oder in katastrophaler Scham, im Zusammenbruch des Menschen an etwas, dem er nicht gewachsen ist« Beispiele für drastische Engung, für »Getriebenwerden in die Enge« (1990, 122) gegeben. Dem gegenüber sind bestimmte meditativ-ekstatische Zustände, »Wollust« (§ 59), Freude oder Erleichterung stark weitend. Letztere sind demnach nicht unmittelbar diejenige Form des affektiven Betroffenseins, die ein »der-sein-der-ich-bin« und so Selbstbewusstsein mit sich bringen. In Freude und Ekstase löst sich das Selbsterleben vielmehr auf, als »mir-subjektiv« »auf sich festgenagelt« zu werden. Doch herrscht im Leiblichen insgesamt ein Primat der Enge: »Der vitale Antrieb tendiert durch Engung zur [...] Enge des Leibes [...]; sogar dann aber, wenn das affektive Betroffensein Weitung freisetzt (wie in beschwingter Freude und Entzücken), markiert es [...] privativ [...] die Enge, von der man loskommt« (1999a, 78). Wegen dieses Primats sagt Schmitz auch: »Leiblich sein heißt erschrecken können« (1992b, 231) und nicht: in Ekstase zerfließen können. Die Betonung liegt hier allerdings auf »können«: Es »braucht nicht zu jedem Sichbewussthaben ein gleichzeitiges affektives Betroffensein zu gehören. [...] Es genügt, wenn der Person durch ihr affektives Betroffensein die Perspektive für die Identifizierung von etwas mit ihr selbst geöffnet wird; sie braucht dieses Betroffensein nicht in jedem Moment deutlich mitzuführen« (2003a, 66). Darauf werden wir zurückkommen. Festzuhalten bleibt zunächst, dass die beiden Extreme dieser Dynamik nicht an sich selbst erfahren werden können, da das Bewusstsein aussetzt, sobald einer der beiden Pole schwindet, und dass die Enge das systematisch wichtigere Phänomen ist. Beides ist relevant für den Begriff der Gegenwart. 51 2. Erste Annäherung an die Gegenwart »Primitive Gegenwart« entspricht dem, was eben als »Enge des Leibes« beschrieben wurde (vgl. 1992b, 235). Was sich in Angst und Schmerz, ebenso wie im Schreck, Schaudern und ähnlichen leiblichen Phänomenen am Horizont offenbart, ist Gegenwart in ihrer primitiven Urform. Solch extreme leibliche Engung, die »erschütternde Spitze des Plötzlichen, in dem die Orientierung und die Bestimmtheit zerbrechen« (1999a, 60) interpretiert Schmitz als unmittelbaren »Zusammenfall von fünf Grundformen [...], die es normaler Weise dem Menschen ermöglichen, sich in der Welt zurechtzufinden« (III.1, 10). Dies leibliche Phänomen ist so zugleich »die primitive Wurzel von fünf Explikaten, die in ihr angelegt sind und bald mehr, bald weniger aus ihr hervortreten: Hier, Jetzt, Dasein, Dieses, Ich« (I, 204). Gegenwart ist hier also wie erwähnt nicht bloß im zeitlichen Sinn gemeint, sondern fünffach. Der Betroffene ist dann gleichsam auf einer Spitze reiner Gegenwart mit abgeschiedener Vergangenheit ausgesetzt, herausgerissen aus der Dauer, aber er selbst als er selbst in spielraumloser Unausweichlichkeit, doch ohne Aussicht darauf, wer oder was er ist, in einem absoluten Augenblick an dem absoluten Ort seiner leiblich gespürten Enge, die zugleich Sein oder Wirklichkeit ist, ohne Rücksicht darauf, was (der Bestimmtheit nach) wirklich ist. Diese fünffache Einheit von Identität, absolutem Hier und Jetzt, Sein und Subjektivität (als Selbst-da-sein), in der noch keine der fünf Seiten – wie im Rückblick – unterscheidbar sind, bezeichne ich als primitive Gegenwart (2008, 20). Primitive Gegenwart ist das ungetrennte Vorliegen der Momente in ursprünglich fünffältiger Komplexion, die aber die Einfach- und Einheit des Phänomens nicht aufheben soll. »Das Plötzliche« ist »trotz seiner Fünffältigkeit zugleich einfach, weil alle fünf Momente in ein UrDieses eingeschmolzen sind« (1999a, 30). Das ist nicht ganz einfach zu denken. Vom Hinweis auf die bereits angeführten Phänomene abgesehen, ist es vor allem schwierig, sich von der Ganzheit der primitiven Gegenwart einen Begriff zu machen. Jedes Moment für sich betrachtet, bezeichnet eine Form des unmittelbar gegenwärtigen Gegebenseins. Diese werden durch in der neueren Diskussion so genannte »indexikalische Termini« wie »hier«, »jetzt«, »dieses« und »ich« ausgedrückt, die eine spezifisch situations- und insofern unmittelbarkeitsbezogene Bedeutung tragen, welche deswegen als schwer fassbar gilt.136 Schmitz These ist nun: Nur primitive Gegenwart ermöglicht ein Verständnis der Bedeutung dieser fünf Momente. Wenn »wir nicht leiblich in die Enge getrieben werden könnten, wüßten 136 Indexikalische Termini, die auch »deiktisch« oder »okkasionell« genannt werden, können als solche bestimmt werden, die »erst durch Kenntnis der subjektiven, raumzeitlichen Position« (Wyller 1994, 18) dessen, der sie benutzt, verständlich werden. Die Fragen in der Debatte um ihre Bedeutung kreisen in erster Linie darum, ob sie durch nichtindexikalische ersetzbar sind, d.h. ihre Bedeutung auch durch diese ausgedrückt werden kann. Man würde dann etwa – in meinem Fall – »ich« durch »Sascha Pahl«, ein raumzeitliches Individuum mit bestimmten Eigenschaften, ersetzen können. Schmitz hält das, wie wir gesehen haben, nicht für möglich. – Das Moment der Wirklichkeit fällt hierbei aus dem Rahmen: »Seiend«, »daseiend«, »wirklich« sind keine indexikalischen Termini. In ihrer eigentümlichen Undefinierbarkeit und der Eigenschaft, wie Kant sagt, »kein reales Prädikat« zu sein, sind sie ihnen aber ähnlich, wenn sie auch nicht in deren Sinne situationsrelativ sind. Russell hat sie alle gleichermaßen und aus ähnlichen Gründen verworfen, weil sie keine objektivierbare Bedeutung besitzen (vgl. Wyller 1994, 22). Auch Hegel, der derartiges vielleicht als erster thematisiert hat, behandelt in der »sinnlichen Gewissheit« eben die fünf Momente, um die es Schmitz geht und spricht ihnen vermittelbare Bedeutung ab. 52 wir mit der Rede vom Dasein (im Gegensatz zum Nichtsein, etwa Fiktivsein) keine Bedeutung zu verbinden« (III.5, 201); dies gilt ebenso für alle anderen Momente. Sie lassen sich nicht definieren, explizieren oder konstruieren, sondern nur in den bezeichneten Phänomenen, der primitiven Gegenwart und ihrer Vorzeichnung in leiblicher Dynamik, erleben.137 Auf diese Weise gewinnen wir »ein unmittelbares, vorbegriffliches Wissen davon« (I, 201). Die Grundlage unserer begrifflichen Orientierung ist also selbst unbegrifflich138; der Ursprung aller Orientierung ist selbst gewissermaßen jenseits dieser Orientierung, da in ihm ja gerade alle Orientierung zerbricht. Wie sollte man also innerhalb der gewöhnlichen Orientierung an sie herankommen, wie begrifflich das Unbegriffliche fassen? Unsagbar scheint nicht nur das Ich, sondern dies scheinen auch alle anderen Momente für sich betrachtet zu sein. Nur das leibliche Erleben ihres Zusammenfalls verschafft uns ein Verständnis ihrer; sagbar ist dies dann allerdings ebenso wenig wie die einzelnen Momente.139 Zu dieser Schwierigkeit kommt hinzu, dass die primitive Gegenwart als Absolutum entsprechend der Enge des Leibes im Erleben nie in Reinform, nicht als solche, nicht als sie selbst, sondern nur als Extrem- oder Nullpunkt vorkommt, auf den hin (Engung) oder von dem weg (Weitung) sich der vitale Antrieb bewegt. Ebenso wie die Enge des Leibes ist sie also »ein ziemlich seltener Ausnahmezustand, der kaum je und vielleicht nie, solange der Mensch bei Bewußtsein ist, ganz rein dargestellt werden kann« (1999a, 30f.), uns somit nur als »Vorzeichnung« (1999a, 158) gegeben ist.140 137 Unleiblichen Wesen, sofern es solche geben sollte, könnte man daher unmöglich klar machen, was Hier, Jetzt, Dieses, Dasein und Ich bedeuten. Und wie wir noch sehen werden, könnte man ihnen deswegen auch nicht erläutern, was die Gegenstücke davon bedeuten: Dort, Bald, Jenes, Nichtsein, Anderes (Fremdes, Objektives). Man könnte ihnen also eigentlich gar nichts erläutern – vielleicht mit Ausnahme der Mathematik. 138 Zu nicht unähnlichen Ergebnissen kommt auch Wyller in seiner Analyse indexikalischer Termini: Seine Lösung lautet, wir seien alle »sozusagen Zentren wandernder Koordinatensysteme« (Wyller 1994, 144), die durch die genannten Begriffe orientiert sind. »In dem Sinne weiß man immer, wo man ist – sozusagen in einem möglicherweise gegenstandslosen Raum oder in einer ereignislosen Zeit« (Wyller 1994, 146) »Hier« wäre dann eine apriorische und unbegriffliche Koordinate (vgl. Wyller 1994, 163 ff.) und mit den anderen indexikalischen Termini Voraussetzung für empirische und nichtindexikalisch-begriffliche Orientierung. Diese hätten insofern selbst indexikalische Bedeutung, da sie nur unter der Voraussetzung indexikalischer Begriffe verständlich seien (vgl. für eine ähnliche Auffassung auch Koch 1994). Wir zeigen dies hier nur kurz an, um die terminologisch vereinsamenden Analysen von Schmitz durch Einbettung in aktuelle Diskussionen anschlussfähig und so verständlicher zu machen. 139 Auch Hegels Ergebnis ist, dass unsagbar ist, was mit diesen Ausdrücken gemeint ist. Bei ihm folgt daraus allerdings die Abwertung dessen »als das Unwahre, Unvernünftige, bloß Gemeinte« (Hegel 3, 92). Die Pointe von Schmitz ist, wie wir noch sehen werden, ganz anders. Für ihn gibt es tatsächlich derartige unmittelbare »sinnliche Gewissheit« und sie ist essentiell, während Hegel sie aufheben zu können meint. 140 Das ist zumindest deswegen etwas verwirrend, da sie doch zugleich das Prinzip von Schmitz’ philosophischem System, und d.h. »immer zugänglich und unverwechselbar« (I, 150) sein soll. (Dass Schmitz im Zitat »vielleicht« schreibt, deutet die Probleme bereits an.) Schon hier zeigt sich, welche Schwierigkeit darin liegt, Prinzipien immanent zu bestimmen. Auf diese beiden entscheidenden Themen: »Transzendenz« und »Unsagbarkeit« der Gegenwart werden wir im Anhang I zurückkommen. 53 3. Person und Welt Der schwierige Begriff der primitiven Gegenwart wird sich konturieren, wenn wir ihn mit seinem Gegenteil konfrontieren. Wie ist es, wenn die Momente nicht zusammenfallen? Schmitz nennt dies »entfaltete Gegenwart«. Sie bezeichnet, was »normaler Weise dem Menschen ermöglicht, sich in der Welt zurechtzufinden« (s.o.). Der Mensch kommt hier als Person in Betracht, die Schmitz definiert als »Bewußthaber mit Fähigkeit zur Selbstzuschreibung, d.h. mit der Fähigkeit, sich für etwas oder (im selben Sinn) etwas für sich zu halten« (1999a, 78). Entfaltete Gegenwart ist die Grundlage »personaler Orientierung«. Der Einfachheit halber kann sie auch als »die Welt« oder – mit Heidegger – »als eine Art Struktur, als die Weltlichkeit der Welt« (IV, 163) bezeichnet werden.141 Sich in der Welt zu orientieren, bedeutet für Personen, dass die fünf Momente der Gegenwart nie ganz vereint, sondern gegen einander »frei beweglich« sind. Jede Person kennt ein Dieses, das nicht wirklich (Phantasiewelten), nicht hier (die Welt im räumlichen Sinn, bis hin zum »Weltall«) oder nicht jetzt ist (Vergangenheit und Zukunft), ein Ich, das nicht jetzt ist (Erinnerung, Planung), usf. Und natürlich: Jede Person kann sich etwas zuschreiben, also ein Dieses als zu sich gehörig ansehen, sei es wirklich oder fiktiv. Dass die fünf Momente in entfalteter Gegenwart voneinander frei werden, kann man auch so beschreiben, dass sie in Relation zu ihrem Gegenteil treten, so ihre Absolutheit und Ungetrenntheit von den anderen Momenten verlieren und dadurch erst als solche in Erscheinung treten: Subjektives als Subjektives tritt hervor, indem sich Objektives, Anderes und Fremdes ihm gegenüber abzeichnet. Im gleichen Sinne werden die Weite des Raums gegenüber dem Hier (als Dort), die Dauer der Zeit gegenüber dem Jetzt (als Einst und Bald) sowie Dieses gegenüber Jenem (Identität und Verschiedenheit voneinander) offenbar; auch wird Seiendes als Seiendes explikabel, insofern es Nichtseiendem gegenübertritt. Kurz: Die »Entfaltung« der fünf Momente bringt für die personale Orientierung mit sich, vom unmittelbar gegenwärtigen Gegebensein, das man durch die genannten indexikalischen Termini auszudrücken pflegt, abstrahieren zu können – sowohl in Bezug auf sich selbst (Selbstzuschreibung) als auch in Bezug auf alles Andere; Personsein heißt, über das, was Hegel »sinnliche Gewissheit« nennt, hinaus zu sein. Die primitive Gegenwart ist von hier aus betrachtet einfach derjenige Zustand, in welchem all das nicht der Fall ist: der Verlust der Orientierung im genannten Sinn, der Zusammenbruch 141 Vgl. Heidegger 1927a, 86: »[...] die Struktur dessen, woraufhin das Dasein sich verweist, ist das, was die Weltlichkeit der Welt ausmacht«. Vgl. auch Hegel 3, 232: »Die Individualität ist, was ihre Welt als die ihrige ist; sie selbst ist der Kreis ihres Tuns, worin sie sich als Wirklichkeit dargestellt hat [...] eine Einheit, deren Seiten nicht [...] als an sich vorhandene Welt und als für sich seiende Individualität, auseinanderfallen«. An einen solchen Weltbegriff nach Art »einer komplizenhaften Intimität zwischen der Person und ihrer Welt« (IV, 382) möchte Schmitz gegen einen »realistischen«, also naturwissenschaftlich-objektivistisch reduzierten anknüpfen. 54 der Person und damit auch der Welt (als ihrer Welt) für einen Moment absoluter Einfachheit. Fünffältig ist die primitive Gegenwart insofern auch nicht an sich, da wie bemerkt alle Momente in einem identischen »Ur-Diesen« vereint sind, sondern nur »in der Rückschau von entfalteter Gegenwart aus« (1999a, 165), nur für uns oder: sofern »man die Welt-Brille aufsetzt« (1999a, 158); an sich ist sie einfach. Die begriffliche Erfassung dessen, was Schmitz als primitive Gegenwart bezeichnet, fällt, wie wir nun sehen können, deswegen so schwer, weil jedes Ur-teil über sie die vieleinige Ungeteiltheit der Momente notwendig auftrennt. Sofern wir als Personen zum Denken, d.h. zum Urteilen (oder auch: Besinnen, Reflektieren, Zuschreiben) befähigt sind, haben wir immer die »Welt-Brille« auf.142 Diese darf nun nicht so verstanden werden, als stünden sich Person und Welt wie Subjekt und Objekt gegenüber. Zwar haben wir hier immer von der Warte der Person aus gesprochen, doch ist die Entfaltung der Gegenwart keineswegs etwas, das sich »vor den Augen der Person« als etwas von ihr Unabhängiges ereignet. Die Person ist selbst Produkt der Entfaltung. Sie ist die Entfaltung des Ich-Moments.143 Der Mensch ist somit nachgerade als »Falte der Welt«144 anzusehen. »Personen kommen also nicht einfach als neu eintretende Gäste in einer schon fertig auf lauter einzelne Gegenstände verteilten Welt an, sondern dass sie vorkommen, ist eine Seite einer fünffältigen Entfaltung der primitiven Gegenwart zur Weltform« (2003a, 18). Diese Verfaltung von Mensch und Welt bedeutet einerseits, dass die Personwerdung nicht als eine Aktivität, etwa als Setzung, Reflexion, o. Ä. gedeutet werden kann, die bewusst von einem Akteur vollzogen würde; ein solcher Akteur entsteht ja gerade erst. Vielmehr ist sie als Teil eines Geschehens zu betrachten. Andererseits ist dieses Geschehen der Entfaltung zur Weltform keineswegs anonym, kein »Offenbarsein ohne Offenbarsein für jemand« (1982, 133), sondern es ist gar nicht anders als im Modus des fürjemanden-seins denkbar, da das personale Moment ihm wesentlich zugehörig ist und ja schon in der Verschmelzung der Momente das »Angehen« Mir-Subjektivität mit sich brachte und insofern »für-jemanden« war. Das Ich-Moment sorgt – als »Mir« – dafür, dass Gegenwart auch etwas mit uns zu tun hat. Als von den anderen Momenten Getrenntes wird das Ich-Moment zur Person (oder vom Mir zum eigentlichen Ich), die von sich abstrahieren, und d.h. sich etwas zuschreiben kann, sich darin aber nicht selbst genügt, sondern im affektiven Betroffensein gleichsam ihr Ich zum Mir 142 Wir müssen uns, ohne wie Kleist daran zu verzweifeln (vgl. Kleist 1801) und anders als Schmitz meint, fragen, ob diese Gläser uns nicht die Sicht versperren (vgl. den dritten Teil dieser Arbeit). 143 Schon in den vorherigen Kapiteln waren die Themen Gegenwart und Person insofern implizit anwesend, als wir mit dem Ich-Moment bereits eingehend beschäftigt waren. Dies nimmt auch eine durchaus herausgehobene Stellung ein (Schmitz widmet ihm gleich § 1 seines Systems), kann aber ohne Verortung im Rahmen der anderen Momente nur unzureichend verstanden werden kann. 144 Der (leibnizsche) Begriff »Falte« und der (hegelsche) Begriff »Moment« werden hier und im Folgenden synonym verwendet. 55 »erniedrigen« und so »geerdet« werden muss, um überhaupt etwas und mit sich identisch sein zu können. Wir hatten gesehen, dass Selbstbewusstsein mit Selbstzuschreibung auf solches ohne Selbstzuschreibung im affektiven Betroffensein angewiesen, Personsein nicht suisuffizient, sondern im Präpersonalen (Mir) verwurzelt ist. »Jede Selbstzuschreibung muß zwei Annahmen zusammenfügen: was ich bin und dass ich es selber bin. Für die erste genügt ein objektiver Sachverhalt; für die zweite kann eine Evidenz [...] nur aus dem affektiven Betroffensein geschöpft werden« (2003a, 67). Nun können wir denselben Sachverhalt allgemeiner formulieren und sagen: Die Person ist auf primitive Gegenwart angewiesen. Das kontraktive, engende affektive Betroffensein, das uns angeht und so ursprünglich Identität schenkt, hat sich als Teil dieses »fünffache[n], nicht bloß zeitliche[n] Plötzliche[n]« (1992b, 237 f.) herausgestellt. Es ist ein Zurückkommen auf primitive Gegenwart, in der im Extremfall alle fünf Momente unserer normalen Weltorientierung miteinander verschmolzen sind: »Ich-bin-jetzt-dieses-hier!« – würde man sagen, sofern man in diesem Moment aussprechen könnte, was passiert. »Die eindringliche Gewissheit, dass es sich um ihn selber handelt, gewinnt der Mensch nur durch kontraktives, ihn auf Enge des Leibes zusammenziehendes Betroffensein, das in reinster Form die primitive Gegenwart erreicht, das unbestimmte Eindeutige, das im Einbruch des Plötzlichen hervortritt« (2003a, 67). Diesen für personales Leben notwendigen »Rückfall in primitive Gegenwart« (1990, 156) bezeichnet Schmitz vom Ich-Moment aus betrachtet als »personale Regression«. Sie »findet statt, wenn man sich in irgendeiner Weise fallen läßt, sich von etwas gefangennehmen läßt, [...] gepackt oder überwältigt wird, [...] ausgelassen ist, im Affekt, im Lachen und Weinen« (1991, 167), kurz: im affektiven Betroffensein. Ihr gegenüber steht die »personale Emanzipation« als Erhebung oder »Rückzug« des Ich-Moments »aus der Verschmelzung mit Hier, Jetzt, Dasein und Dieses auf einen Rest, der als für es subjektiv verbleibt« (1990, 155). Das ist die oben bereits erwähnte »Abschälung der Subjektivität«, mit welcher das »IchSagen« verbunden ist: Ich und Nicht-Ich, Subjektives und Objektives treten erst nach ihrer Trennung als solche in Erscheinung, bleiben aber auf einander verwiesen. Nach der Personwerdung verbleibt diese nicht in den »höheren Sphären« des Personseins, sondern ist nicht nur unmittelbar, sondern auch die über Lebensspanne hinweg bei Strafe des »Selbstverlusts« auf personale Regression angewiesen. »Das Tauchbad personaler Regression ist also unerläßlich für das personale Subjekt, um zu sich zu kommen, ohne diese kann es sich nicht finden, sondern in einseitiger Verstiegenheit nur verlieren. Bloße Emanzipation gibt der Person nämlich keinen Umriß« (1993a, 181), den sie erst durch emotional prägende Erlebnisse bis hin zu Traumata (vgl. 1993a, 74) gewinnt, die ihr zwar gleichsam den Boden unter den Füßen wegziehen, aber gerade dadurch Halt geben und verhindern, dass sie »in der 56 zerstreuten Vielschichtigkeit des personalen Subjekts« (1991, 166) nicht nur ihr Selbstbewusstsein, sondern auch ihr (inhaltliches) Selbstverständnis verliert.145 Zwischen primitiver und entfalteter Gegenwart, Emanzipation und Regression, »bewegt sich das menschliche Leben, gelegentlich in primitive Gegenwart abstürzend, meist auf einem labilen Niveau personaler Emanzipation über dieser« (1990, 48).146 Beide, Emanzipation und Regression, entfaltete und primitive Gegenwart, sind für Personen gleich essentiell. Ohne letztere wäre keine Person, weil ihr Identität fehlte; die Frage »Wer bin ich?«, die darauf beruht, wie es je für mich ist dies-hier-jetzt-zu-sein und sich nur an subjektive Tatsachen adressieren kann, könnte keine Antwort finden. Ohne erstere wäre keine Person, da ohne die Fähigkeit zur Selbstzuschreibung als »Anknüpfung seiner selbst an eine Bestimmtheit, wodurch man sich als einzelnen Gegenstand versteht, der ein Fall der betreffenden Gattung ist« (1999a, 78), mangels objektiv zuschreibbarer Tatsachen Unbestimmtheit herrschte; die Frage »Was bin ich?« könnte keine Antwort finden. Personen müssen demnach sowohl etwas bestimmtes oder etwas als etwas als auch selbst etwas oder es selbst sein. Wäre die Person nur etwas als etwas, unterläge sie demselben infiniten Regress wie in der Selbstzuschreibungsparadoxie. Etwas als etwas sein, heißt Fall einer Gattung sein. So wäre alles immer nur wieder etwas anderes, aber nie an sich selbst etwas. Die Person würde gleichsam in einer metonymischen Struktur zerfließen und so nie zu sich kommen, sich immer entgehen. Sie unterlägen einer Verweisungsstruktur, die sich unendlich fortsetzte und nirgendwo definitiv würde.147 »Vor der Relation, identisch mit etwas und identisch als etwas 145 Das muss nicht immer der subjektive Weltuntergang sein, auch hier genügt die Tendenz dazu, denn es »läuft jedes affektive Betroffensein, indem es Subjektivität einführt, der Entfaltung der Gegenwart und der personalen Emanzipation entgegen; es hat eine Tendenz zur primitiven Gegenwart hin, und wenn es auch gewiß nicht immer in diese abstürzt, bringt es doch einen Zug oder Anflug personaler Regression mit sich, so oft es den personal emanzipierten Menschen ereilt« (1993c, 53). Hier deutet sich nochmals an, dass die gesamte Leiblichkeit und Affektivität Subjektivität mit sich bringt! Dies wird uns in Kap. VIII.1 wieder beschäftigen. 146 Die Vielfalt menschlicher Lebensstile und Weisen des Lebensvollzugs deutet Schmitz vor dem Hintergrund dieses Schicksals der Person, Emanzipation und Regression – »Lebensverstricktheit und Abstandnahme« (Figal 2001) wie man sagen kann – vereinen zu müssen. Wie die eben erwähnte »Verstiegenheit« unterscheidet er verschiedene »Niveaus« und »Stile« (§ 257) der Abstandnahme. »Die Niveaus unterscheiden sich nach der Spannweite des Abstandes; ein kühler Rechner ist [...] weiter weg von primitiver Gegenwart als ein affektiv labiler Mensch. Die Stile sind Haltungen der Überlegenheit, die doch nie vollkommen ist, im Verhältnis zur primitiven Gegenwart [...] z.B. die hochfliegende Überspanntheit des idealistischen Jünglings, die Ironie als Lebensform, die ruhig überschauende Besonnenheit mit einem Anflug von Weisheit, die stoische Unerschütterlichkeit und der nüchterne Realismus, Probleme nur am kurzen Stiel zu packen und sich mit kleinen Hilfen vor Schwankungen und Stürzen des Betroffenseins zu schützen« (1990, 155). Schmitz wendet dies auch auf kulturgeschichtliche Entwicklungen an. So meint er etwa, »Fichtes ursprüngliche Einsicht« (in die Subjektivität subjektiver Tatsachen) habe zu einer Radikalisierung der personalen Emanzipation geführt, die seit dieser Zeit fast grenzenlos abzuheben befähigt ist und mit einem fundamentalen Wechsel im menschlichen Selbstverständnis einher geht, der »neue Stile personaler Emanzipation« nach sich zieht: »romantische Ironie« (Schlegel), Arten der Entfremdung, schwarzen Humor, »Ich-Angst« (Kierkegaard) (vgl. 1999d; 1992; IV, 85 ff.). 147 Das entspräche Überlegungen Derridas, der so zu zeigen beabsichtigt, dass Bedeutung nie eindeutig feststehen kann, da sie sich durch Signifikationsprozesse ergibt, deren Signifikanten ihre Bedeutung bloß in Abgrenzung von anderen erhalten (sie sind immer etwas als etwas anderes und nie selbst etwas), die diese wiederum nur von anderen erhalten, usf., so dass es für Bedeutung konstitutiv ist, sich immer zu verschieben bzw. immer schon verschoben zu haben, sozusagen immer einer zeitlichen Verschiebungs- und 57 zu sein, liegt also als Bedingung ihrer Möglichkeit die absolute Eigenschaft, selbst (es selbst, selbst etwas) zu sein« (2008, 17). Wir verschaffen uns Überblick vermittels einer kleinen Tabelle, deren letzte Zeile jeweils die »Vermittlung«148 der ersten beiden darstellt. Den für Personen essentiellen Zusammenfall von selbst etwas sein und etwas als etwas sein zusammen bezeichnen wir provisorisch, da Schmitz dafür keinen eigenen Begriff hat, als jemand sein. Subjekt. Tatsachen Selbst etwas Primitive Gegenwart Pers. Regression Objekt. Tatsachen Etwas als etwas Entfaltete Gegenwart Pers. Emanzipation Subjektive und Jemand objektive Tatsachen »Der Spielraum der Person Gegenwart«149 4. Ganzes und Teil – Ontologie der Bedeutsamkeit, Epistemologie der Explikation a) Situation und Einzelheit, Chaos und Individuation Verschaffen wir uns nun in Form einer Antwort auf die Frage, was der Mensch sei, was also Personen gegenüber »Tieren, Säuglingen und Idioten« auszeichnet, auch noch einen Gesamtüberblick über die in diesem Kapitel bisher abgehandelte Spanne menschlichen Lebens zwischen primitiver und entfalteter Gegenwart, der uns zugleich mit den nächsten Themen, den Situationen und der Unterscheidung von Identität und Einzelheit, bekannt macht. Beim Menschen, sofern er sich aus der frühen Säuglingszeit erwachsend zur Person erhebt, kommt die Entfaltung der primitiven Gegenwart in die fünf bipolaren Dimensionen hinzu, je mit einer speziellen Emanzipation des ersten Pols jeder Dimension. Grundlegend ist dabei die Emanzipation der Identität (des Dieses) zur Einzelheit dadurch, daß aus der binnendiffusen Bedeutsamkeit ganzheitlicher, aber deswegen nicht schon im definierten Sinn einzelner Situationen einzelne Bedeutungen heraustreten, die es gestatten, die Identität durch Bestimmtheit als Fall von etwas zur Einzelheit zu ergänzen. Auf diesem Weg der Vereinzelung wird die primitive Gegenwart räumlich als Hier zum absoluten und weiter zum relativen Ort in einem Netz sich gegenseitig durch Lage und Abstand bestimmender Orte, einem Ortsraum, der die Weite überzieht, und zeitlich zum absoluten und weiter zum relativen Augenblick, der als vergangene und künftige Gegenwart nach zwei Seiten in den Horizont der primitiven Gegenwart exportiert werden kann und dadurch datierende Erinnerung und Erwartung ermöglicht. Die Emanzipation des Seins gelingt durch seinen kontradiktorischen Gegensatz gegen das Nichtsein, wodurch Planung, Phantasie, ins Nochnichtseiende gerichtete Erwartung und symbolische Formen (im Als-ob-Modus) möglich werden. Die Emanzipation der primitiven Gegenwart nach der Seite ihrer Subjektivität, daß es sich beim plötzlichen Betroffensein (in Vergänglichkeitsstruktur ausgeliefert zu sein, die nicht definitiv werden kann (vgl. z.B. Derrida 1988). Was Hegel in der Wesenlogik als Negativität der Reflexion bestimmt hat, gleicht dem in etwa. Hegel würde Derrida allerdings ebenso widersprechen wie Schmitz. Hegel übersteigt eine solche nie zu sich kommende Struktur durch den »Begriff«, der es vollbringen soll, das bloß Unmittelbare (Seinslogik) mit dem bloß Vermittelten (Wesenslogik) zu vereinen, um beide in »vermittelter Unmittelbarkeit« aufzuheben. Schmitz geht den genau umgekehrten Weg. Er hebt nichts auf, sondern geht einen Schritt zurück, indem er die Verweisungsstruktur in der (unvermittelten) Unmittelbarkeit der primitiven Gegenwart erdet. (Das ist in etwa so, als hätte Hegel nach der Wesenslogik abgebrochen und wieder auf »Sein, reines Sein, ohne jede weitere Bestimmung« verwiesen.) (Zum hier nicht beachteten Unterschied von Eigenschaften und Relationen vgl. 1990, 107 ff.) 148 Was genau hier »Vermittlung« heißt, klären wir in Kap. VI. 149 Dieser Titel eines Buches von Schmitz (1999a, vgl. v.a. 175 ff.) soll verdeutlichen, dass »Gegenwart kein Punkt ist« (1999a, 177), sondern ein Spielraum, in dem sich die Person »gleichsam zwischen zwei Abgründen: der primitiven Gegenwart und der entfalteten Gegenwart« (Fehige 2007, 70) bewegt. 58 meinem Fall) um mich selber handelt, schöpft gleichfalls aus der vereinzelnden Explikation der Bedeutsamkeit von Situationen, wodurch es möglich wird, diese aufzuspalten und von einem Teil der Bedeutungen (ganz oder teilweise) die Subjektivität abzuziehen, so daß die Form der Objektivität oder Neutralität von Bedeutungen (daß jeder sie aussagen kann, sofern er genug weiß und gut genug sprechen kann) zum Vorschein kommt. Dadurch kann sich die Subjektivität als das Eigene gegenüber dem Fremden (nicht nur anderen) ausbilden; das ist personale Emanzipation (2003d, 101 f.). Säuglinge (nach Schmitz auch Tiere) leben also »in« bzw. »aus« (wie Schmitz inzwischen formuliert) primitiver Gegenwart. Heißt das, sie stehen immer »auf der Spitze des Plötzlichen«? Natürlich nicht. Sie sind nicht ständig erschrocken. Präpersonales »Leben aus primitiver Gegenwart«150 bedeutet lediglich, durch leibliche Dynamik Ich-Hier-Jetzt-DiesesDasein zu »kennen«, also u.a. Subjektivität, unmittelbare Identität und Wirklichkeit. Sie können sich betroffen fühlen, es kann sie etwas angehen, ihnen etwas bedeuten. Dies ist freilich nicht so misszuverstehen, als verfügten sie über die fünf Orientierungen als einzelne und als könne ihnen so dieses oder jenes als Einzelnes etwas bedeuten oder sie ihm gar eine Bedeutung verleihen. Vielmehr ist gemeint, was man als »primäre Bedeutsamkeit« bezeichnen kann und neben der primitiven Gegenwart die zweite Zutat des präpersonalen Lebens etwa von Tieren und Säuglingen darstellt. Bedeutung ist Teil von Situationen (§ 224), in die präpersonales Leben verstrickt ist. In ihnen treten nicht schon einzelne Bedeutungen explizit und explizierbar hervor. Sie sind vielmehr ein »Ganzes von Bedeutsamkeit«. Deswegen können Tiere und Säuglinge nicht nur nicht überlegen – sie müssen es auch nicht, weil ihnen diese unreflektierte Form der Bedeutung stets schon »sagt, was Sache ist«. Dies ist hier nicht um einer Phänomenologie des tierischen Lebens Willen von Interesse, sondern weil es großenteils auch für Menschen gilt. Zwar geschieht menschliche Orientierung in entfalteter Gegenwart, und d.h. dass einzelne Sachverhalte und Objekte als solche identifiziert und mannigfach in Raum, Zeit, Sein und Nichtsein, auf Dieses, Jenes, Sich und die Anderen festgestellt und verteilt, kurz: vereinzelt, werden können. Doch auch sie leben in Situationen, deren Bedeutsamkeit »ganzheitlich«, »im gestaltpsychologischen Sinn der Geschlossenheit, Kohärenz und Abhebung« (1990, 67), und »chaotisch-mannigfaltig« ist. Chaotische Mannigfaltigkeit ist Schmitz’ Terminus für jedes Gemenge, in dem nicht alles als Einzelnes explizit, noch explizierbar vorliegt.151 Situationen sind von »Bedeutungselementen« erfüllt, die nicht strikt voneinander geschieden werden können, sondern ineinander verschwimmen, wie man es in Reinform etwa aus Zuständen des dösenden Tagträumens oder »vom ›glasigen‹ Blicken, das nichts ansieht« (1991, 163) kennt. 150 So bezeichnet er es inzwischen, wie der Verfasser einem Brief vom 27.8.2008 entnimmt, in dem Hermann Schmitz so freundlich war, dem Verfasser auf einige ebenfalls brieflich gestellte Fragen zu antworten. Im Folgenden wird darauf als »Brief« verwiesen. 151 »Das Wort ›chaotisch‹ ist nicht im Sinn von ›verworren‹ (nach dem Muster des Knäuels), sondern von ›verschwommen‹ (nach dem Muster des Wassers) zu verstehen« (2008, 11). 59 Solche Kontinuen aus »Dauerweite« (1990, 258)152 bestehen aus Schillerndem, das nichts Bestimmtes, aber doch keineswegs nichts ist – wie wenn man sich nicht im angebbaren Sinn auskennt, aber fraglos zurecht findet. Eine Situation ist ein undurchsichtiges Ganzes von Bedeutsamkeit. In diesem »Zusammenhang, der noch nicht festgelegt ist«,153 ist Vieldeutiges impliziert, aber nicht alles tritt als Geschiedenes und Unterscheidbares hervor. Was womit identisch und wovon verschieden ist, steht nicht fest – und dies nicht nur, weil wir es noch nicht festgestellt hätten, sondern es ist »an sich«, »objektiv«, in einem ontologischen und nicht bloß epistemologischen, subjektiven oder perspektivischen Sinn unentschieden. Dies gilt allerdings nur für »konfuses« chaotisches Mannigfaltiges. Im »diffusen« hingegen kann über Identität und Verschiedenheit – durch primitive Gegenwart – bereits entschieden sein. In beiden aber ist noch nichts einzeln (vgl. 2004a, 57). Nun erschließt sich auch die exakte Bedeutung der Begriffe Einzelheit und Identität, die Schmitz erst seit kurzem scharf unterscheidet. Beide entsprechen dem »Dieses«-Moment der Gegenwart. Einzelnes ist die entfaltete Version dessen: solches, das zählbar ist, also explizit als solches in Erscheinung tritt. Identität hingegen als primitive Version des Diesen kann noch unwillkürlich und unreflektiert sein, ist also mit chaotisch-mannigfaltiger Verschwommenheit durchaus vereinbar. Der Gegenbegriff zum chaotischen Mannigfaltigen ist also nicht Identität, sondern Einzelheit (vgl. 2003a, 112 ff.). Erst die entfaltete Gegenwart entfernt sich von Situationen, während die primitive noch ganz in ihnen verwoben ist. Wollte man eingedenk dessen, dass Situationen nicht zusammengesetzt sind, von Bestandteilen ihrer sprechen, so wären dies: Bedeutungen. Schmitz unterscheidet deren drei, die jeweils in Sätzen explizierbar, in der chaotischen Mannigfaltigkeit der Situationen aber vorsprachlich gegeben sind: »Sachverhalte« (Gegenstände von Aussagesätzen: Propositionen, Protentionen, etc.), »Programme« (Heideggers »Zuhandenheit«: Brauchbarkeit; Konventionen, Normen, Wünsche, Anziehung) und »Probleme« (Gegenstände von Fragesätzen) (vgl. 1999a, 48 ff.). Dreierlei zeichnet also Situationen aus: Sie sind (1) von vielsagend-eindrücklicher, aber uneindeutiger »primärer« Bedeutsamkeit, die (2) chaotisch-mannigfaltig strukturiert und (3) ganzheitlich verfasst ist, da sie weder aus Einzeldingen noch aus einzelnen Bedeutungen besteht154; das Ganze ist »vor« den Teilen, auch wenn Teile aus ihm isoliert werden können. 152 Dieser Begriff soll die Abwesenheit der primitiven Gegenwart (sowohl im zeitlichen Sinn des Jetzt also auch im Sinn der »Enge«) bezeichnen. 153 Soentgen 1998, 121. 154 Neu ist in Schmitz’ Situationsbegriff nur Punkt (2). Für die anderen Punkte gibt es, wie wir gleich vor allem an Hand Hegels und Heideggers sehen werden, viele Vorgänger. Dass selbst Punkt (2) gewisse Ähnlichkeiten zu Hegel aufweist, wird sich in Kap. VII.1 zeigen. 60 Der Gegenbegriff zur Situation ist bei Schmitz die Konstellation, ein aus einzelnen Elementen bewusst zusammengesetztes, aggregatartiges Gebilde, das sozusagen keinen »inneren«, sondern nur »äußeren« Zusammenhang aufweist. Im selben Sinne, in dem Bedeutsamkeit primär ist, sind Situationen ontologisch primär gegenüber Einzeldingen und daraus gebildeten Konstellationen, die wie die Einzelheit erst in entfalteter Gegenwart vorkommen.155 Bedeutungslose einzelne Objekte kann es [...] gar nicht geben, weil etwas einzeln nur als etwas, als Fall von etwas sein kann und das Fallsein bereits ein Sachverhalt und damit eine Bedeutung ist. [...] Die Bedeutsamkeit ist primär und kann nicht erst bedeutungslosen Einzelwesen nachträglich durch Projektion aufgeprägt werden (1999a, 61 f.). Für die Struktur des Selbstbewusstseins ist entscheidend, dass dies natürlich auch für Subjekt und Objekt gilt. Situationen und ihre Bedeutsamkeit sind derart, dass sie »Subjekt und Objekt dynamisch umgreifen und in ihren Bann ziehen« (1990, 67). Sie sind also nicht von sich aus immer schon einzeln, sondern vorgängig in Situationen verstrickt. Man darf sie nicht als strikt voneinander Getrennte betrachten: Sie sind selbst Bedeutungen, die nicht durchgehend voneinander abgehoben sind. Das präpersonale Selbstbewusstsein, das affektive Betroffensein der mir-subjektiven Nuance ist insofern ungegenständlich, »ein Milieu von Bedeutungen« (vgl. 1993a, 106) und kein Einzelding. Personen als einzelne Subjekte156 gibt es erst in entfalteter Gegenwart. Präpersonales Selbstbewusstsein hingegen ist kein eindeutiges, sondern ein chaotisches Phänomen, da es selbst eine Situationen bzw. unabgeschiedener Teil einer solchen ist und diesen nicht etwa gegenübersteht. Insofern ist es »in-der-Welt«. Schmitz vermeidet deswegen betreffs des Selbstbewusstseins inzwischen157 die Rede von SubjektObjekt-Identität, da er darunter eine konstellative Verknüpfung und keine »ursprüngliche Indifferenz« versteht. Nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern das gesamte menschliche Leben besteht nach Schmitz aus Phänomenen, die an sich selbst keineswegs eindeutig sind, von der gängigen Logik, die Identität und Verschiedenheit strikt scheidet sowie Einzelheit voraussetzt, aber zu solchen gemacht zu werden drohen.158 Solchen Phänomenen möchte Schmitz mit dem Begriff 155 Die Unterscheidung von Situation und Konstellation lässt sich gut auf der Ebene der Sozialphilosophie erläutern. Dort entspricht sie der zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, als einerseits organisch gewachsenem, fraglosem und damit unbewusst selbstzweckhaftem sozialen Zusammenhang und andererseits »künstlichem« Gebilde, konstruiert zu ihm selbst äußerlichen Zwecken und ohne innere Verbundenheit der Teilnehmer zu fordern. In der Debatte zwischen (an Aristoteles und Hegel orientierten) Kommunitaristen und (an Locke und Kant orientierten) Liberalisten, wäre Schmitz Kommunitarist (vgl. § 289 ff.), wenn er sich auch selbst nicht so bezeichnet. Schmitz’ Situation ist, was seit Rousseau als nahezu paradiesischer Zustand unmittelbarer (R)Einheit und Fügung beschrieben wird, auf welchen »Verstand« und »Reflexion« zerstörend einwirken, weil sie trennen, vereinzeln und als »Konstellation« zusammensetzen, es »zu genau wissen wollen« (Prominent beschrieben etwa in Kleist 1810). 156 Schmitz verwendet den Begriff »Subjekt« uneinheitlich. Manchmal meint er (noch präpersonale) »Bewussthaber«, manchmal einzelne Bewussthaber (Personen). 157 Spätestens seit 1990 und frühestens nach 1982. 158 In Schmitz’ letztem Buch ließt man vom »Nichtidentischen« (vgl. 2008, 60), wodurch eine unübersehbare, wenn auch unbeabsichtigte (vgl. Brief ) Nähe zu Adorno deutlich wird, dessen ganze Philosophie auf eine »Rettung des Nichtidentischen« abzielt, das sich dem gewöhnlichen Denken (»Denken heißt identifizieren«) 61 des chaotisch Mannigfaltigen gerecht werden. Die »allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden«159 oder auch beim Schreiben ist dafür ein schönes Beispiel. Gedanken stehen nicht nebeneinander geordnet und warten auf ihren Abruf, sondern sind diffus in einander verschwommene Bedeutungen. Durch die Ganzheit unserer Gedankengebäude kommen sie uns meist stimmig vor, oft führt erst die Explikation einzelner Gedanken beim Schreiben oder Reden auf vermeintliche Ungereimtheiten, die zuvor auf Grund ganzheitlicher Fügung nicht explizit wurden. Weitere Beispiele für Situationen sind nach Schmitz das sich wie von selbst einspielende Gespräch, unwillkürliche Eindrücke, soziale Verhaltensmuster, die Persönlichkeit oder die Sprache. (Auf die letzten beiden werden wir im nächsten Abschnitt nochmals zu sprechen kommen.) Von Situationen ist unser ganzes Leben durchzogen. Sie sind in die wahrgenommenen Dinge und [...] Mitmenschen, als Charaktere eingeschmolzen, nämlich als chaotisch-mannigfaltige Ganzheiten von Protentionen, d.h. von Sachverhalten, auf die man unwillkürlich gefaßt ist, ohne sie einzeln benennen zu können. Situationen beherrschen alle Sozialverhältnisse und bilden die kommunikativen Kompetenzen dafür. Situationen sind die Eindrücke, die wir gewinnen, wie ein Reisender, der von seiner neuen Umgebung Eindrücke aufnimmt, oder wie wenn man bei der Begegnung mit einem Menschen, in einer merkwürdigen Naturstimmung, beim Anhören von Musik oder angesichts eines fesselnden Portraits von einem mehr oder weniger tiefen Eindruck eigentümlich berührt (1993c, 36). Weil Menschen großenteils in derartige Situationen eingelassen sind, können sie zwar überlegen, und d.h. Bedeutungen einzeln aus ihnen »herauspicken«, aber sie müssen es nicht. Sie »verstehen« auch ohne dies, »was Sache ist«, weil es dafür auf vielsagende Eindrücke, nicht aber zwingend auf explizites Wissen (knowing that, wie man sagen kann) ankommt (vgl. III.4, 432 ff.). Ein Großteil menschlichen Lebens besteht in Routine und Gewohnheit (knowing how), in welchen stets schon bekannt ist, was zu tun ist. Man denke etwa an Sprechen, an Schreiben, an Gehen: Zumeist werden diese Tätigkeiten unreflektiert verfolgt. Überlegungen sind nur am Rande notwendig, z.B. wenn etwas nicht funktioniert und man genauer hinsehen, reflektieren, einzelne Bedeutungen isolieren muss, sich etwa fragt: Wie schreibt man dieses Wort noch gleich?160 Nicht zufällig erinnert diese Beschreibung der Situationen an das, was Heidegger als »Zuhandenheit« bzw. »In-der-Welt-bei-Zuhandenem-sein«161 bezeichnet und gegenüber der Vorhandenheit durch ähnliche Merkmale abgegrenzt hat wie Schmitz das unwillkürliche entzieht. Adorno ist der Ansicht, dass man solcherlei nicht der Kunst überlassen, sondern versuchen müsse, »das Unsagbare doch zu sagen«, »mit Begriffen über Begriffe hinauszugehen« (vgl. z.B. Adorno 1962, 56; Adorno 1966, 19). Schmitz’ Konzept des chaotischen Mannigfaltigen lässt sich durchaus als Einlösung dieses Postulats verstehen. Er sagt ganz ähnlich, man müsse sich mit »geschmeidigen Begriffen« der unwillkürlichen Lebenserfahrung, die von der gewöhnlichen Abstraktionsbasis (Adorno: »Verblendungszusammenhang«, vgl. auch Heideggers »Seinsvergessenheit«, »Gestell«) verdeckt werde, annähern und dies lasse sich nur über ein Denken, das Identität nicht blind voraussetze, bewerkstelligen. 159 Vgl. Kleist 1805. 160 Das sind Beispiele für diffuse chaotische Mannigfaltigkeit (mit Identität). Konfus (ohne Identität) sind die erwähnten Gedankenmannigfaltigkeiten oder Kontinuen wie das Dösen oder glasige Blicke »ins Nichts« (vgl. 2003a, 119 ff.; 2004a, 57 f.). 161 Vgl. Heidegger 1927a, §§ 15-18. 62 Dahinleben in Situationen mit vielerlei Implikationen gegenüber dem reflektierenden, besinnenden Explizieren einzelner Sachverhalte. Heideggers »Zuhandenes« ist wie Schmitz’ Situation durch die Idee der vorgängigen, d.h. vor-theoretischen und nicht-intentionalen, Erschlossenheit der Welt in »primärer Bedeutsamkeit« gekennzeichnet und ebenso ganzheitlich verfasst.162 Ferner ist sie »eigentlicher«, insofern bloße Vorhandenheit bzw. konstellative Verfügbarkeit die ganzheitliche Fügung zerstört. Im selben Sinne lässt sich eine Parallele des Situationsbegriffs zum Begriff des »Geistes« bei Hegel ziehen.163 b) Die persönliche Situation Der Mensch ist diese Nacht, dieses leere Nichts, das alles in ihrer Einfachheit enthält, ein Reichtum unendlich vieler Vorstellungen, Bilder, deren keines ihm gerade einfällt oder die nichts als gegenwärtige sind. Dies die Nacht, das Innre der Natur, das hier existiert – reines Selbst. In phantasmorgischen Vorstellungen ist es ringsum Nacht; hier schießt dann ein blutig Kopf, dort ein andere weiße Gestalt plötzlich hervor und verschwinden ebenso. Diese Nacht erblickt man, wenn man dem Menschen ins Auge blickt – in eine Nacht hinein, die furchtbar wird. (Hegel, Fragment 1805/06) Die menschliche Welt ist für Schmitz nunmehr durch drei Aspekte gekennzeichnet, die wechselseitig aufeinander bezogen, somit nicht strikt unterscheidbar sind und von denen nur der erste spezifisch menschlich ist: Entfaltete Gegenwart (einschließlich Personalität und Weltlichkeit), primitive Gegenwart (einschließlich leiblicher Dynamik und Subjektivität) und 162 »Diese Bezüge [des Bedeutens; S.P.] sind unter sich selbst als ursprüngliche Ganzheit verklammert, sie sind, was sie sind, als dieses Be-deuten, darin das Dasein ihm selbst vorgängig sein In-der-Welt-sein zu verstehen gibt. Das Bezugsganze dieses Bedeutens nennen wir die Bedeutsamkeit. Sie ist das, was die Struktur der Welt, dessen, worin Dasein als solches je schon ist, ausmacht« (Heidegger 1927a, 87; vgl. zur Ganzheit ferner ebd., 41 und 180 ff.). Man beachte, dass der Begriff der Bedeutung bei Heidegger wie bei Schmitz ontologisiert wird, d.h. von einem (erkenntnis)theoretischen Begriff zu einem Phänomen der praktischen und unreflektierten »Vertrautheit« des Daseins als In-der-Welt-seins wird. Heidegger leitet das »für« des Zeichens aus dem »um-zu« des »Zeugs« ab (vgl. ebd., § 17). Bedeutung in diesem primären Sinne (»Bedeutsamkeit«) ist stets »schon da« und muss nicht erst verliehen werden. Sie ist überhaupt »nichts Gedachtes, einem ›Denken‹ erst Gesetztes, sondern Bezüge, darin Besorgende Umsicht als solche je schon sich aufhält« (ebd., 88) und damit »ontologische Bedingung der Möglichkeit dafür, daß das verstehende Dasein als auslegendes so etwas wie ›Bedeutungen ‹ erschließen« (ebd., 87), also in Schmitz’ Worten: einzelne als solche explizieren kann. 163 Wenn Hegel vom Geist einer Zeit, eines Volkes oder auch eines Individuums spricht, meint er damit ebenfalls eine Ganzheit, die nicht darin aufgeht, in ihre einzelnen Aspekte zerlegt zu werden, wie trennende Urteile gegenüber der Ganzheit des Begriffs, und ebenso wenig bewusst verfügbar und disponibel zu sein braucht, sondern eine Identität und Verschiedenheit übergreifende Vermittlung der Momente in einem weder auf diese reduziblen noch jenseits der Teile zu verortenden Ganzen. Ein Unterschied zwischen Situation und Geist besteht allerdings darin, dass dieser als ganzer begreifbar ist, was für Schmitz’ Situationen deswegen nicht zutrifft, weil ihm Begreifen als Explizieren einzelner Sachverhalte gilt und insofern immer einer Zerstörung der Situation nahe kommt, die sich in ihrer Gänze nur in unwillkürlicher Bedeutsamkeit zeigt. Erkenntnistheoretisch bezeichnet Schmitz seine von Hegel und Heidegger inspirierte Position als »Explikationismus«. Erkenntnis ist demnach weder »realistisch« als Konstitution oder Abbildung von Sachen zu betrachten, aber auch nicht wie bei Hegel »holistisch« als tatsächliches Erfassen eines Ganzen, sondern eher wie bei Heidegger ein »abkünftiger Modus« der situational-ganzheitlichen Verfasstheit des menschlichen In-der-Welt-seins: die auf der explikativen Kraft der Sprache beruhende Fähigkeit, aus dem unwillkürlichen Ganzen etwas »auszueinzeln«. Zwar ist wie im Holismus »das Ganze vor den Teilen«, Gegenstand erkennenden Begreifens sind aber dennoch nur die Teile; das Ganze ist deswegen nicht das Wahre, weil es trotz seines ontologischen Primats der Erkenntnis nicht fähig ist. 63 chaotisch-mannigfaltige Situationen (einschließlich Bedeutsamkeit und Ganzheit). Unentfaltetes, präpersonales »Leben aus primitiver Gegenwart« ist selbst noch eine Situation, weil darin nichts einzeln heraustritt. Subjektivität und Selbstbewusstsein gibt es durch »mirsubjektive Färbung«, welche dem »Milieu« ineinander verschwimmender Bedeutungen zukommt (vgl. Tabelle im nächsten Abschnitt). Noch auf der personalen Ebene verhält es sich keineswegs so, dass das Chaos überwunden wäre. Es wandert nur gleichsam ins »Innere«, insofern noch reflektierte und besonnene Personen in unübersichtliche Situationen verstrickt sind: allen voran die »persönliche Situation« oder »volkstümlich gesprochen: [...] Persönlichkeit« (1999a, 114). Dieses verschwommene Ganze von nicht einzeln explizi(er)ten Bedeutungen enthält beispielsweise »Kristallisationskerne der Erinnerung, die auch ohne Weckung weiterwirken [...] Standpunkte politischer, sozialer, religiöser usw. Art bis hin zu Weltanschauungen, habituelle Interessen, Zu- und Abneigungen, Lebenstechniken [...] die oft geheimen, d.h. der Person schwer zugänglichen Wunsch-, Leit- und Schreckbilder« (1999a, 108 f.), d.h. Traumata, Neurosen, unbewusste Idealvorstellungen, usf. – in der Tat also das, was man gemeinhin »Persönlichkeit« nennt und größtenteils, was wir auch als Vor- und Unbewusstes bezeichnen können. Die Person und ihr bewusstes Ich sind »nicht Herr im eigenen Hause«, da die persönliche Situation nie vollends durchsichtig wird.164 Das wäre allerdings nach Schmitz auch gar nicht wünschenswert, da eine Bekanntschaft mit allen Einzelheiten die ganzheitliche Integration der Persönlichkeit zerstören würde. Zu deren Erhaltung – also um die persönliche Situation nicht zur Konstellation werden zu lassen, in der alle Elemente gleichgültig nebeneinander stünden – darf nicht alles explizit werden, sondern muss in den, wie Hegel es nennt, »nächtlichen Schacht, in welchem eine Welt unendlich vieler Bilder und Vorstellungen aufbewahrt ist, ohne daß sie im Bewußtsein wären« zurücksinken.165 Solche Rückführung ins Unbewusste geschieht nach Schmitz beispielsweise durch die am stärksten wirkende Kraft in der persönlichen Situation: das Vergessen. Vergessen ist kein Verschwinden, sondern Wechsel im Mannigfaltigkeitstyp, Einschmelzen numerischer [d.h. einzeln zählbarer; S.P.] Mannigfaltigkeit in chaotische. Die Explikate, die [...] aus der persönliche Situation hervortreten, sind so etwas wie Verletzungen ihrer binnendiffusen Ganzheit; durch Vergessen heilen 164 »Die Person kommt nur schwer an ihre persönliche Situation heran, und kaum je so, dass sie diese mit einem Schlage vor sich zu haben meint, wie der Mitmensch oft, wenn er seinem Mitmenschen gleich anzusehen glaubt, was für ein Mensch das ist (ohne es schon sagen zu können). [...] Obwohl die persönliche Situation eine gegliederte Struktur hat, ist sie daher dem Menschen, dessen Persönlichkeit sie ist, weitgehend undurchsichtig« (2008, 15 f.). 165 Hegel 10, 260. Eine Ahnung dieser Zusammenhänge, die Schmitz Situation nennt, scheint Hegel schon in den eingangs dieses Abschnitts zitierten, düsteren Worten zu artikulieren. Hegel spricht dort sowohl die Undurchsichtigkeit als auch die Ganzheit an, aus der aber doch bedeutsame Elemente einzeln »aufzucken« können, ohne dass man angeben könnte, wo oder wie sie vorher waren. In diesem Schacht ist alles »da«, das heißt aber nicht, dass wir es gerade »bewusst haben«, noch dass es einen angebbaren Ort hätte (vgl. auch Hegel 10, 122). 64 diese Wunden in die Ganzheit wieder ein. Ohne Vergessen stünden die einzelnen Erfahrungen, die die 166 Person im Laufe ihrer Lebensgeschichte macht, wie Bruchstücke nebeneinander (1999a, 108). Schmitz nennt solche Vorgänge der Rückbindung auch »Implikation«, der gegenüber die Explikation einzelne Bedeutungen (Explikate) aus der persönlichen Situation aussondert. Explikation holt aus der chaotisch-mannigfaltigen Bedeutsamkeit einer Situation einzelne Sachverhalte, Programme und Probleme heraus; Implikation läßt sie in solche Mannigfaltigkeit zurückfließen wie der Gesang, bei dem die z.B. im Volkslied gesungenen Sachverhalte, Programm und Probleme wie in einer Wolke von Bedeutsamkeit verschwimmen (1999a, 107). Durch diese dynamische »Umgestaltung der persönlichen Situation durch Prozesse der Explikation und Implikation [...] verschiebt sich die Grenze der persönlichen Situation«; sie ist »in beständiger Metamorphose« (1999a, 107 f.). Diese Unabgeschlossenheit, die ihrer Ganzheit keinen Abbruch tun soll, macht sie aufnahmefähig und grenzt sie daher von einer abgeschlossenen Innenwelt ab, die sich fragen muss, wie sie an die Außenwelt herankommen kann; vielmehr ist sie immer schon in untrennbarer Verschlingung mit der »Welt« begriffen.167 Sie ist »kein abgeschlossenes Gehäuse des privaten wie eine Seele, sondern [...] gleich einer zähflüssigen Masse schmiegsam zum An- und Einwachsen in überpersönliche Situationen befähigt« (1999a, 107). Eine überpersönliche Situation ist etwa die Sprache, die zugleich ein gutes Beispiel zur Erläuterung des Situationsbegriffs überhaupt darstellt, weil der Unterschied zur Konstellation deutlich wird. Jede neu zu erlernende Sprache ist zunächst eine Konstellation, weil man all ihre Elemente als einzelne erlernen muss und sie deswegen zunächst auch nur mechanisch beherrscht und über nahezu jedes zu verwendende Wort nachdenken muss. Sobald man die Sprache internalisiert hat, geht aber immer mehr wie von selbst und die Explikation dessen, was man da tut, wird stetig unnötiger.168 Sie kann schließlich so sehr in die persönliche Situation integriert sein, dass sie innigst mit ihr verwachsen, »Teil der Persönlichkeit« ist – wie etwa die Muttersprache. Neben der persönlichen Situation spricht Schmitz von der »persönlichen Welt«, die sich aus persönlicher Eigen- und Fremdwelt zusammensetzt. Das Eigene sind die für die Person 166 Die Ähnlichkeiten der Positionen von Hegel und Schmitz hierin, zeigen sich in der Bestimmung des Schlafens und Wachens bei Hegel. »Das Erwachen ist [...] das Urteil der individuellen Seele [...] Der Schlaf ist [...] Rückkehr aus der Welt der Bestimmtheiten, aus der Zerstreuung und dem Festwerden in den Einzelheiten« (Hegel 10, 87). So nötig für Hegel der Schlaf zur Erhaltung der Ganzheit des individuellen Geistes gegen die Einzelheit des am Tage Wahrgenommenen ist, so für Schmitz das Vergessen dessen. Beides ist eine Rückbindung des Einzelnen ins Ganze. 167 »Das Innen ist das Außen«, könnte man nahezu(!) mit Hegel sagen. »Der Tradition ist vorzuwerfen, daß sie, befangen im Festkörpermodell mit Vorstellungen von einem psychischen Apparat (Freud) aus Seelenvermögen (Scholastiker, Kant) oder von einem mechanischen Wirbel psychischer Atome (Assoziationspsychologie, Herbart), die für die Subjektivität der Person fundamentale, binnendiffus aus Sachverhalten, Programmen und Problemen gebildete Bedeutsamkeit der persönliche Situation, die sich nicht nach dem Muster fester Körper vergegenständlichen läßt, übersehen hat« (1999b, 23 f.). Eine solche Vergegenständlichung mache es unmöglich, die Verwobenheit von Person und Welt zu verstehen. Wer mit einem solchen abgeschlossenen Innen beginne, komme, so Schmitz, nie mehr zu einem Außen (vgl. dazu gleich Kap. V.5). 168 Die Festschreibung von Sprachregelungen stellt den Versuch dar, eine Situation zur Konstellation und damit beherrschbar zu machen. Wie man am unwillkürlichen Sprachwandel sieht, kann das nie gänzlich gelingen. 65 subjektiven, ihr nahe gehenden Bedeutungen, das Fremde die ihrer Subjektivität entledigten, »abgeschälten« neutralen Bedeutungen, die deswegen nicht weniger wichtig sein müssen, aber die Person – wie uninteressanter Lernstoff für eine Klausur – nicht »affizieren« oder »anmachen«.169 Die Fremdwelt ist genau der Punkt, an dem die »komplizenhafte Intimität« zwischen Person und Welt nicht mehr gänzlich aufgeht (vgl. IV, 382 ff.). Hier liegt der Keim möglicher »Entfremdung« der Person von der Welt, die dann nicht mehr »ihre« ist; sie findet im Andern nicht notwendig nur sich selbst wieder. 5. Die Gegenwart und ihre Falten Diese (persönliche) Welt ist, was sich der Person in entfalteter Gegenwart als ihr Horizont eröffnet. Etwas annähernd Welthaftes – man könnte mit Uexküll sagen: die Umwelt – bringt auch schon das »Aufzucken« der primitiven Gegenwart mit sich. Nun kann man fragen: Was oder wie war die Welt »vorher«? Die Frage ist natürlich schon deswegen tückisch, weil es eine Unterscheidung in Vorher und Nachher erst im Rahmen der Entfaltung der Gegenwart geben kann. Nach Schmitz’ dreistufiger »Kosmologie« aber kann man sagen, dass »bevor« sich Gegenwart je entfaltet hat und es Leiber gab, mit welchen primitive Gegenwart als leibliche Enge hätte einher gehen können, schon etwas war, das er als »Weltstoff« bezeichnet. Dieser muss folgerichtig als absolut konfuse chaotische Mannigfaltigkeit bestimmt werden, da in ihm »gar nichts hinsichtlich Identität und Verschiedenheit entschieden ist« (1999a, 158). Zunächst durch die primitive, schließlich durch die entfaltete Gegenwart wird dieser Stoff schließlich zur Welt »geformt«. Demnach ist »die Welt nur eine Ansicht des Weltstoffs« (1999a, 160). Wir veranschaulichen uns die letzten Erträge wieder in einer Tabelle. Situation Ontologischer Titel »Kosmolog.« Titel Weltstoff Mannigfaltigkeitstyp Konfus chaot. M. Konstellation Primitive Gegenwart Entfaltete Gegenwart Diffus chaot. M. (Zählbares Mannigf.) Dieses-Moment (Keine) Identität Einzelheit Ich-Moment170 (Keine) (Mir-)Subjektivität (Ich-)Personalität Der ominöse Weltstoff scheint nicht nur der aristotelischen hyle, sondern auch einer Art präkategorialem »Ding-an-sich« nahe zu kommen, über das man eigentlich nichts sagen kann, aber schwerlich umhin kommt, es doch zu tun, und so Schmitz eines impliziten Kantianismus bezichtigt.171 Im selben Sinne lassen sich Schmitz’ fünf Orientierungsmodi mit den 169 Zum Unterschied von persönlicher Situation und persönlicher Eigenwelt vgl. 1999a, 125 f. Dasselbeließe sich für die anderen Momente der Gegenwart einzeichnen, unterbleibt aber aus Gründen der Übersichtlichkeit. 171 Explizit verwehrt Schmitz sich dagegen: »[...] wenn wir uns [...] ein transzendent absolut eindeutiges ›nacktes‹ Ding an sich vorstellen, ist das unser Privatvergnügen ohne erkenntnistheoretisch zulängliche 170 66 kantischen Kategorien vergleichen, da sie eine formale und gleichsam apriorische172 Grundlage menschlichen »Welthabens« darstellen, deren Zusammentreffen mit dem Mannigfaltigen des Weltstoffs ergibt, was Schmitz »Welt« und Kant »empirische Realität« nennen. Dabei ist die primitive Gegenwart selbst als gedachter Vereinigungspunkt der Momente dem kantischen transzendentalen Ich als höchstem, die Kategorien unter sich vereinigendem Punkt vergleichbar, zumal beide ähnlich paradox strukturiert sind: als Grund aller Erkennbarkeit selbst unerkennbar. Da aber bei Schmitz betonter Maßen kein Ich den höchstem Punkt markiert, rücken seine Faltungen doch auch an Heideggers fundamentalontologischem Pendant zu Kants Kategorien, den »Existenzialien« und deren höchstem Punkt heran:173 Schmitz hält die Gegenwart hinsichtlich ihres Seins-Moments auch tatsächlich für die Einlösung dessen, wonach Heidegger unter dem Namen »Sinn von Sein« fahndete. Dieser liege einfach in der ursprünglichen Erfahrung des Seins in primitiver Gegenwart (vgl. 1999a, 30). Schmitz setzt den Punkt nochmals »höher« (oder »tiefer«) als Kant und Heidegger, insofern bei ihm Zeit, Sein und Ich ein- und zusammengeschlossen sind. Durch den Rekurs auf Heidegger erschließt sich nun auch ein weiterer Aspekt der Gegenwart. Wir haben bereits gesehen, wie Heidegger im Begriff der Jemeinigkeit von etwas zu sprechen versucht, das sich allgemeinbegrifflicher Erfassung nicht fügt. Jemeinigkeit soll nicht Fall einer Gattung sein, da umgekehrt die Tatsache, dass mir alles immer schon im Modus der Jemeinigkeit erscheint, die »existenziale« Grundlage dafür darstellt, dass überhaupt etwas als etwas anderes erscheinen kann. Das Existenzial ist deswegen keine Kategorie. In seiner eigentümlichen Seinsweise entzieht es sich dem Zugang durch die gewöhnliche, an Gattungsallgemeinheit orientierte Sprache und Logik. Es ist nur »indirekt« zugänglich und doch immer schon da. Weder kann es bewiesen noch definiert oder deduziert, sondern bloß aufgewiesen oder gezeigt werden.174 Ebenso verhält es sich bei Schmitz: Die Gegenwart ist einerseits (an sich selbst und in ihren fünf Falten) nicht als (1) Attribut, als zuschreibbare, allgemeinbegriffliche Eigenschaft zu verstehen, andererseits verfügen wir für sie über kein (2) Kriterium, das an Gegebenes angelegt werden und für dessen Erfüllung man notwendige und hinreichende Bedingungen angeben könnte, sondern etwas, das man nur kriterien- und Rechfertigung« (1999a, 50). Hier meint er allerdings nur Dinge an sich im Sinne von eindeutig festlegbaren Einzeldingen. Der chaotisch-mannigfaltige Weltstoff scheint ihm nicht als Ding an sich zu gelten. Wieso man diesen allerdings nicht als eine Art Welt an sich bezeichnen sollte, leuchtet nicht ein, zumal bei Kant mit dem »Ding an sich« wohl kein Einzelding gemeint ist. 172 Nur »gleichsam«, weil er sie für empirisch erfahrbar hält; dennoch »apriorisch«, weil sie de facto nicht (als sie selbst) erfahren, sondern nur im vitalen Antrieb »angedeutet« oder »vorgezeichnet« sind (vgl. Kap. IX.2 sowie Anhang I). 173 Vgl. Heidegger 1927a, 44, 88. Heidegger fühlt sich Schmitz hierin sicherlich auch mehr verpflichtet als Kant. Problematisch beim Verständnis als Kantische Kategorien wäre schließlich, dass sie nicht »unsere Kategorien« sind, sondern wir selbst eine davon. 174 Vgl. Heidegger 1924, 114; Heidegger 1952, 128; vgl. auch Kap. IV.2c. 67 zuschreibungsfrei erfahren, das sich nur zeigen kann. Dass etwas genau Dieses, Hier, Jetzt oder wirklich ist, ist ebenso wenig durch attributive Zuschreibung zu erfahren wie, dass ich es bin. Dass die subjektive Tatsache, dass ich es bin, keine Eigenschaft im Sinne einer objektiv zuschreibbaren Tatsache ist, wurde bereits erörtert. Ebenso wenig ist sie ein Kriterium, durch dessen Anwendung ich herauszufinden könnte, ob ich es bin oder nicht oder gar, ob ich bin oder nicht. Zwar ist affektives Betroffensein notwendige und hinreichende Bedingung für Selbstbewusstsein, doch kann es weder notwendige noch hinreichende Bedingungen für affektives Betroffensein geben. Vielmehr muss ich mir meiner selbst vor jeder Zuschreibungs- und Anwendungsfähigkeit solcher Bedingungen schon unmittelbar gewahr sein. Selbiges gilt nun auch für die anderen Falten und insofern auch für die Gegenwart als ganze. Weder sind sie Eigenschaften von etwas noch an sich selbst definierbar. Dass dem Sascha Pahl dadurch, dass ich er bin, nichts Bestimmtes hinzugefügt wird, die Sachlage aber dennoch inkommensurabel modifiziert, verhält sich analog dazu, dass die Tatsache, dass ein Ereignis jetzt oder hier ist, keine hinzukommende Eigenschaft des Ereignisses ist: Wenn ich morgen sage, dass es gestern war, oder jemand aus der Entfernung sagt, dass es dort ist, ist es ja dennoch dasselbe Ereignis. Ebenso wenig verfügen wir über Jetzt und Hier in dem Sinne, dass wir vermittels des Wissens um sie herausfinden könnten, ob etwas denn nun gerade jetzt ist oder schon vorbei, hier oder doch anderswo. Wir »wissen« es einfach, ohne angeben zu können, worin dies »Wissen« besteht. All das muss sich unmittelbar zeigen und kann nicht durch Reflexion (Denken, Besinnung) gefunden oder herausgeklügelt werden. Die primitive Gegenwart ist identisch und eindeutig, aber nicht [...] als Fall einer Gattung [...], durch die sie bestimmt wäre (z.B. der Gattung Gegenwart), sondern unbestimmt eindeutig. Daher kann sie nicht beliebig reproduziert, insbesondere nicht in Gedanken aus unserer Lebenserfahrung herausgehoben [...] werden (1999a, 36 f.). Die Gegenwart entzieht sich dem als explikatives Urteilen bestimmten Denken, das einem Satzsubjekt allgemeine Prädikate zuschreibt und mit Kriterien und Definitionen operiert. Ebenso wenig kann man daher über sie sprechen. »Wir subsumieren sie, indem wir über sie sprechen, und behandeln sie damit als gewöhnlichen Gegenstand, aber das ist eine uns durch unsere Sprachform aufgedrängt Hilfskonstruktion, die dem Gemeinten nicht angemessen ist« (1999a, 35). Schmitz unternimmt große Anstrengungen, um zu zeigen, dass unmittelbares Sein, Hier, Jetzt und Dieses Grundlage und notwendige Voraussetzung der entfalteten Formen von Wirklichkeit, Raum, Zeit und des Einzelnen sind, aber zugleich ebenso wenig attributiv zugeschrieben, definiert oder anderweitig ausgewiesen werden können, wie er es für das präpersonale als Grundlage des personalen Selbstbewusstseins vorgeführt hat, sondern nur 68 unmittelbar durch Regression auf primitive Gegenwart zu erfahren sind. Wir wollen uns das an dieser Stelle nur für das Moment des Seins etwas genauer ansehen.175 Dass Wirklichkeit kein Attribut sei, war auch schon Kants These. Seine berühmte Kritik am ontologischen Gottesbeweis läuft darauf hinaus, dass sich Wirklichkeit (Existenz, Sein, Dasein) nicht im reinen Denken, d.h. deduktiv aus Begriffen erschließen lässt, sondern der Anschauung bedarf. »Gedanken ohne Inhalt sind leer«,176 Hundert wirkliche Taler haben nicht mehr Eigenschaften als Hundert gedachte Taler177, sondern ihnen kommt etwas zusätzlich zu, das ganz anders ist als alles, was hinzugedacht werden kann: die Existenz oder das Sein.178 Schmitz argumentiert ähnlich, weswegen wir hier auf seine Ausführungen nicht eigens eingehen. Dass es für Wirklichkeit kein Kriterium geben kann, geht über Kant hinaus. Dieser glaubte nämlich über eines zu verfügen: Die Anschauung (bzw. deren Materie, die Empfindung).179 Das ist, so Schmitz, allerdings zirkulär, da Kant deren Wirklichkeit bereits voraussetzen muss: Schließlich könnte es sich auch um eingebildete oder geträumte Anschauung handeln. Um diese von wirklicher zu unterscheiden, wäre wiederum ein Wirklichkeitskriterium notwendig, usf. ins Unendliche. Der Versuch, ein Kriterium für Wirklichkeit anzugeben führt also in einen infiniten Regress, da man ein Verständnis dafür, was wirklich ist, bei jedem Definitionsversuch schon voraussetzen muss. Wir können zwischen Wirklichkeit und Traum oder Fiktion unterscheiden. Wir können aber nicht angeben, worin der Unterschied besteht (vgl. 1999a, 20 ff.). Ebenso ließe es sich auch für das Ich (»Ich weiß, wer ich bin, aber ich kann den Unterschied nicht angeben«) und alle anderen Falten formulieren. Von hier aus können wir nun endlich mehr über den Zusammenhang der einzelnen Falten erfahren. Vor dem exponierten Hintergrund lässt sich die anfangs gestellte Frage beantworten, 175 Für das Dieses haben wir es schon gesehen (Kap V.3): Identität kann bei Strafe des infiniten Regresses nicht in der Bestimmtheit als etwas bestehen, also kein Attribut sein kann. Definiert kann sie überdies nicht werden, weil für jede Definition Identität schon in Anspruch genommen werden muss (vgl. 2008, 17). 176 Kant, KrV, B 75. 177 Vgl. Kant, KrV, B 627. »Sein ist offenbar kein reales Prädikat, d.i. ein Begriff von irgendetwas, was zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen könnte« (Kant, KrV, B 626). »Wenn ich also ein Ding, durch welche und wie viel Prädikate ich will (selbst in der durchgängigen Bestimmung) denke, so kommt dadurch, daß ich noch hinzusetze, dieses Ding ist, nicht das mindeste zu dem Dinge hinzu« (Kant, KrV, B 628). 178 Man darf hier nicht den Fehler der modernen Logik machen, die seit Frege und Russell »Sein« mit der partikularen Quantifikation, der Operation des Existenzquantors in logischen Kalkülen, gleichsetzt. Dann wäre Sein identisch mit der Aussage »Es gibt mindestens ein X mit der Eigenschaft F«. Fragt man dann aber, was »gibt« in diesem Satz bedeuten soll, kann der moderne Logiker keine Antwort geben. Er kann Wirklichkeit per definitionem nicht vom bloß Gedachten (»möglichen Welten«) unterscheiden, hat also überhaupt keinen Begriff von der Existenz der Welt, weswegen er auch etwa die Verwunderung darüber, dass Seiendes ist, nicht verstehen kann (vgl. 2008, 49 ff.). »Die Welt existiert« wäre demnach kein sinnvoller Satz, weil »existieren« nichts anderes als Vorkommen in der »Welt« als einem beliebig bestimmten »universe of discourse« bedeuten kann und der Satz »die Welt existiert« dann die Welt als in sich selbst enthalten bestimmen würde. Wittgenstein hatte das Problem im Auge und ist zumindest darüber verzweifelt, dass er Sätzen wie »Wie seltsam, dass es die Welt gibt«, die ihm existenziell wichtig zu sein schienen, keinen Sinn zu geben vermochte (vgl. Wittgenstein 1930, 14 ff.). 179 Kant, KrV, B 33 f., B 273. 69 wieso in der Mir-Subjektivität des affektiven Betroffenseins Identität »enthalten« ist: Weil in primitiver Gegenwart das Dieses- und das Ich-Moment nicht getrennt sind und ein Dieses, das eindeutig und ursprünglich, zuschreibungs- und identifizierungsfrei Identität im Sinne des Selbst-etwas-seins, als Wie-Identität mit sich bringt, nicht nur gegeben, sondern unmittelbar mit dem Ich identisch ist. Aber nicht nur zu eindeutig Diesem werde ich durch primitive Gegenwart, sondern ich bin auch nur so überhaupt etwas Seiendes, das von Nichtseiendem unterschieden werden kann. Wirklichkeit lässt sich ebenso wenig denken wie Wie-Identität, man muss beide als ungetrennt voneinander erfahren. Auf Grund dieses Wirklichkeitsgehalts stellt das Selbstbewusstsein bei Schmitz keine »leere« transzendentallogisch-epistemische Form wie bei Kant dar, sondern ihm kommt so zugleich Sein zu, es ist ontologisch bestimmt. So wenig ich mich im denkenden und wollenden Ich, in bloß gedachter Wirklichkeit oder im radikal Nichtidentischen würde finden können, so wenig könnte ich mich in einer bloß naturwissenschaftlich gedachten Zeit, die nur nach Früher, Später und Gleichzeitig differenziert180, aber kein Jetzt und deswegen auch weder Vergangenheit noch Zukunft enthält, finden; und ebenso wenig in einem bloß geometrischen Ortsraum, der kein Hier, sondern nur mathematisch bestimmte Ortspunkte enthält. Die Person ist aber bei Strafe ihrer Inexistenz an ihr räumliches Hier, den absoluten Ort, von welchem bereits die Rede war, genauso gebunden wie an zeitliche Gegenwart. Sie ist immer Jetzt und Hier. Das wäre aber in den Hypostasen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Welt unmöglich, die selbst unabhängig von der Frage nach dem Platz des Subjekts in ihr nicht suisuffizient ist: Lagezeit und Ortsraum, meint Schmitz, könnten nur von ihrem Ursprung im Hier und Jetzt aus verständlich gemacht werden. Wir können dies hier nicht näher ausführen, rühren aber bereits an den eingangs genannten kulturkritischen Impuls von Schmitz’ Philosophie. Gegenwart ist nicht nur das Prinzip und der Kern ihrer Analysen, sondern auch Ausgangspunkt von »Ideologiekritik«. Schmitz’ philosophischer Impetus ist insgesamt vornehmlich eine Kritik dessen, was wir als »Gegenwartsvergessenheit«181 bezeichnen können: Der Irrtum, entfaltete Gegenwart – in all ihren Falten – für suisuffizient, dem Verständnis dafür, was ich-hier-jetzt-dieses-sein bedeuten, für unbedürftig zu halten. Ein Beispiel für Gegenwartsvergessenheit wäre etwa die Vorstellung einer vollständig naturwissenschaftlich beschreibbaren »Welt an sich«, die mit der Wirklichkeit identifiziert wird, in einer objektiven Zeit und einem objektiven Raum spielt 180 Schmitz sagt »Lagezeit« (vgl. 1990, 247 ff.); das entspricht McTaggarts »B-Reihe« (vgl. McTaggart 1908). Schmitz selbst spricht nicht von »Gegenwartsvergessenheit«, sondern von »Verfehlungen des abendländischen Geistes« (1999b, 32 ff.), etwa der »dynamistischen Verfehlung«: Der Utopismus christlichen Ursprungs, der auf Selbst- und Weltbemächtigung beruhe, das eigentliche Sein in die Zukunft projiziere, das Leben in der Gegenwart verteufele und am Ende aus Verzweiflung über die Unerreichbarkeit des Idealen im Nihilismus zu enden drohe (vgl. 1972; 1999b, 37 ff.). 181 70 und aus Einzeldingen besteht. Es ist wohl richtig beobachtet, wenn Schmitz meint, dies gelte »dem gemeinen Vorstellungsvermögen als selbstverständlich, geleitet durch die von allen Medien der Publikation machtvoll verstärkte Stimme der Naturwissenschaft« (1999a, 157). Dass es in einem solchen Weltmodell ohne Hier, Jetzt, Sein und Dieses auch kein Ich vorkommen könnte – also auch kein Naturwissenschaftler –, fällt dabei zunächst und zumeist ebenso wenig auf wie die in der nämlichen Hypostasierung entfalteter Gegenwart gegründete Tatsache, dass es sich in einem Selbstbewusstseinsmodell der Zuschreibung ebenso verhält.182 6. Zusammenfassung Welche Erträge ergeben sich aus diesem Kapitel für die Frage nach Selbstbewusstsein, Subjektivität und Person im Verhältnis zu Gegenwart, Leiblichkeit und Situation? Hierzu sind die problematischen Aspekte zunächst noch weitestgehend auszuklammern (diese folgen im dritten Teil) und lediglich die systematisch erhellenden zu erwähnen. Das Ganze der Situationen umhüllt gleichsam das Subjekt. Es geht dabei aber nicht in diesem Ganzen wie in einem alles umgreifenden System unter, sondern entspringt selbst erst dadurch, dass sich das Chaos teilweise lichtet und unbestimmt-eindeutige Identität frei gibt. Hier, Jetzt, Dieses und Dasein sind mit dieser aber zunächst noch in leiblicher Dynamik verschmolzen, das Mir-Subjekt lebt ganz in der primitiven Gegenwart und seiner Umwelt aus Situationen, inmitten von vager Unentschiedenheit, die ihm aber nicht auffällt, da es sich in der »primären« Bedeutsamkeit unwillkürlich zurecht findet. Es steht diesen Situationen nicht gegenüber, sondern ist Teil ihrer; es ist selbst nur die Nuance der subjektiven Tatsachen des affektives Betroffensein, die als Bedeutung mit der Situation verwoben sind und hat insofern Selbstbewusstsein im Sinne des selbst-etwas-seins. Allerdings weiß es nichts davon, da es sich aus dieser Verwobenheit nicht erheben kann. Dieses Selbstbewusstsein erfüllt daher die 182 Sind in einem objektivistischen Weltbild einmal alle subjektiven Elemente eliminiert, taucht die Frage nach deren Verortung auf. Bevor Hirnwissenschaftler sie unter den Gegenständen ihres Gebiets eingeordnet oder für eine Illusion erklärt haben (vgl. Kap III.2), habe man sich dafür, so Schmitz, einen »Abladeplatz« gesucht und ihn zunächst »Seele« (seit Demokrit), dann »Bewusstsein« (seit Wolff), heute oft »mind« genannt. Da am objektiv aufgefassten Menschen etwas zu fehlen schien, musste man eine eigentümliche, abgeschlossene Innenwelt erfinden, die unräumlich, teils auch unzeitlich sein sollte, und ging anschließend lange Zeit ergebnislos der Frage nach, wie diese denn mit dem objektiven Körper zusammenhänge. Eine solche Innenwelt, das ist Schmitz starke These, gibt es nicht, sie ist phänomenal nicht ausweisbar und ihre Erfindung kann nur darauf zurückgeführt werden, dass man fälschlicherweise alles nach dem keineswegs selbstverständlichen Festkörpermodell zu verstehen versuchte. Nur wer gemäß diesem Dogma alles auf Objektives reduzieren wolle, habe nachher einen »Abladeplatz« für alles Subjektive nötig und müsse sich dann unter anderem fragen, wie indifferente Objekte Bedeutung für ein Subjekt erlangen können, wie es sie auf sie beziehen kann, wenn es von ihnen, wie von anderen Subjekten, radikal geschieden ist. Schmitz entgeht dieser Frage zwar durch seine Konzeption, die unbedeutende Einzeldinge ab ovo ausschließt, muss in der Konsequenz aber den Menschen auf eine »Falte der Welt« reduzieren und überdies mit einem radikalen Dualismus aus phänomenologisch Beschreibbarem und naturwissenschaftlich Erklärbarem leben, die miteinander nichts zu tun zu haben scheinen. Eindrücklich zeigt sich das am Beispiel von Körper und Leib, die bei Schmitz ebenso dualistisch gegenüberstehen wie einst Körper und Seele. 71 Kriterien Jemeinigkeit sowie Bewusstsein und Identität für sich betrachtet, nicht aber Identitätsbewusstsein, da es sich seiner Identität nicht bewusst ist (in Schmitz Worten: weder einzeln ist noch über die Fähigkeit zur Selbstzuschreibung verfügt). Auch das personale Subjekt lebt noch in Situationen, kann über diese aber teils verfügen. Es kann Unterscheidungen treffen, indem es z.B. sich selbst von anderem abgrenzt. So ist ihm nicht mehr alles subjektiv und zugleich ist es erst jetzt ein Einzelnes. Sein Selbstbewusstsein ist nun von anderer Art, es weiß von sich als von sich, kann sich auf sich beziehen, sich mit anderen identifizieren und davon lossagen, weil es sich auch auf das, was nicht unwillkürlich und unmittelbar betrifft, beziehen kann. So erfüllt es auch die Kriterien Selbstbezüglichkeit und Identitätsbewusstsein (Schmitz: Einzelheit). Der Ursprung der Person aus dem Präpersonalen ist für die Frage des Selbstbewusstseins entscheidend. Sowohl Identität als auch Mir-Subjektivität gibt es nicht getrennt voneinander und den anderen, sondern nur im Verbund der fünf. Damit scheidet jede bloß transzendentale Konstitution, die dem Selbstbewussten kein Sein gibt, ebenso aus wie ein nicht zu sich kommender, zeitlicher und semantischer Verschiebungs- und Verweisungszusammenhang, der als bloßes Verhältnis von Verhältnissen die Möglichkeit vereitelt, identisch, jetzt und hier zu sein. Dass Selbstbewusstsein auch ein personales Phänomen ist, ist für Schmitz allerdings etwas »Abkünftiges«, dessen Grundlage im Präpersonalen, Dumpf-Identischen liegt; das Wie genügt, es muss nicht durch das Was ergänzt werden, um Selbstbewusstsein zu sein. Jedwede Relationalität – und damit Selbstbezüglichkeit – sucht Schmitz aus der Unmittelbarkeit der primitiven Gegenwart fern zu halten, um die daraus resultierenden Paradoxien des Selbstbewusstseins zu umgehen. Das ist zwar verständlich, lässt aber auch fragen, ob Selbstbewusstsein dadurch nicht unterbestimmt wird. Dem werden wir in Kap. VIII nachgehen. Nun kommt zunächst die Frage in den Blick, wie personales und präpersonales Selbstbewusstsein bei Schmitz zusammenspielen, wofür es nicht nur der Exposition des Personenbegriffs bedurfte, sondern auch der Mannigfaltigkeitstheorie, die dabei eine wichtige Rolle spielen wird. 72 VI. Ich als Remis – Ambivalentes Selbstbewusstsein als weiterer Aspekt des Lösungsansatzes 1. Personale Ambivalenz Nach diesen allgemeinen Ausführungen zum Hintergrund von Schmitz’ Theorie widmen wir uns nun wieder in Gänze dem Ich-Moment, da noch ein schwer wiegendes Problem innerhalb seiner Selbstbewusstseinstheorie aussteht. »Erhebliche Schwierigkeiten macht schon die widerspruchsfreie Beschreibung der präpersonalen Subjektivität. [...] Viel komplizierter ist die Subjektivität der Person, des Bewußthabers mit Fähigkeit zur Selbstzuschreibung« (2003a, 17). Denn angesichts der Lösung der Paradoxie der Selbstzuschreibung durch Selbstbewusstsein ohne Selbstzuschreibung fragt sich, ob wir es nunmehr nicht mit zwei Selbstbewusstseinen zu tun haben, »Hase« und »Igel« also auseinander fallen. Erwachsene Personen haben schließlich Selbstbewusstsein mit (Hase) und ohne (Igel) Selbstzuschreibung; aber nicht »nebeneinander« und oft nicht einmal nacheinander – so dass dieses jenes lediglich an irgendeinem Punkt »erdet« und vor dem Regress bewahrt –, sondern stets zugleich und ineins. Könnte man nur entweder betroffen oder distanziert sein, wäre zu fragen, was den Distanzierten zu dem macht, der eben noch betroffen war, was den Inneseienden zum Zuschreibenden, den Selbstverlorenen zum ausdrücklich Selbstbewussten macht. Das Problem lässt sich Schmitz zu Folge nicht durch ein Schichten- oder Apparatmodell des Selbst lösen, wofür gleichermaßen Platons drei Seelenteile, Kants intelligibles und empirisches Ich oder das freudsche Modell (Ich, Es und Über-Ich) Beispiele abgeben, die wir exemplarisch vor allem an Hand des Neukantianismus behandelt haben (Kap III.1). Diese Modelle bleiben solange defizitär, wie das Zusammenspiel bzw. die Identität der einzelnen Teile und das Wissen darum nicht begreiflich gemacht werden kann, die Teile, die doch ein Subjekt ausmachen sollen, das sich als solches weiß, nicht wie ein »Sack voll Vermögen«183 »gleichgültig« nebeneinander stehen. Das klassische Problem des Zusammenhangs von Ganzem und Teilen, Einheit und Vielheit bzw. Identität und Verschiedenheit tritt, wie wir gesehen haben, auch in Fragen des Selbstbewusstseins auf. Nicht nur ist die Identität im Selbstbewusstsein durch die Verschiedenheit der Teile und Gegenstände des Selbstbewusstseins bedroht, sondern die Paradoxie der Selbstzuschreibung bliebe ungelöst, solange das präpersonale »Selbstbewusstsein ohne« nicht mit dem personalen »mit Selbstzuschreibung« verbunden gedacht werden kann. Das personale Selbstbewusstsein ist, anders als das präpersonale, eine reflexive Relation: Etwas bezieht sich auf sich. Die Frage, wie derlei Selbstbezüglichkeit möglich ist, muss nun gelöst werden. 183 Hegel 2, 272. 73 Das Problem entspricht dem, was Schmitz einst als »Zweite Paradoxie des Selbstbewusstseins: Identität des Unvereinbaren« (I, 247) behandelt hat und wir in Kap. II.1 als zusätzlich inhaltliche Verschiedenheit der Elemente in der paradoxen Zweieinigkeit des Selbstbewusstseins kurz angesprochen haben: So wie bei Selbstbetrug oder Selbstkritik die Frage ist, wie dieselbe Person betrügen und betrogen werden kann, es also scheinbar zu einer Persönlichkeitsspaltung kommt, ist beim personalen Selbstbewusstsein die Frage, wie dieselbe Person zugleich Schmerz sein und Schmerzen haben kann (bzw. sie »bewussthaben« und sie als Schmerzen »bewussthaben«) oder traurig sein und darum wissen, dass sie jetzt traurig ist.184 Das Selbst, dem personal etwas zugeschrieben wird, soll identisch sein mit der vor jeder Zuschreibung gegebenen Mir-Subjektivität des affektiven Betroffenenseins. Dabei ist die Option, dass die Person sich das Präpersonal-affektive ebenso zuschreibt (»Der Betroffene bin ich!«) wie sie sich anderes zuschreibt nicht hinreichend, da so wiederum Selbstbewusstsein als Selbstzuschreibung begriffen würde und die nämlichen Aporien aufträten: Die so vorgestellte Person müsste dann entweder schon Selbstbewusstsein haben, was nicht sein kann, sofern sie sich das präpersonale ursprüngliche Selbstbewusstsein ja erst zuschreiben soll, oder es noch nicht haben, dann wüsste sie aber nicht, was sie sich zuschreiben soll und könnte es durch Zuschreibung auch nicht erfahren. Die Lösung kann nur lauten, dass beide »von vornherein zusammenfallen« (1996b, 177). Wie ist das möglich? Hegel hätte darauf eine »dialektische«, Identität und Verschiedenheit miteinander vermittelnde Antwort gegeben. Letzteres vollzieht auch Schmitz, allerdings nicht dialektisch, sondern durch eine »Logik der unendlichfachen Unentschiedenheit« im »instabilen Mannigfaltigen«. Zwar rettet er mit dieser Version einer »Vieleinigkeitslehre«185, was ihm sehr wichtig ist, gegen Hegel den Satz des Widerspruchs, muss aber den Satz des ausgeschlossenen Dritten aufgeben (vgl. 2008, 125 ff.); neben die Wahrheitswerte »wahr« und »falsch« tritt »unentschieden«. Es ist dann kein Widerspruch mehr, zwei scheinbar unvereinbare Eigenschaften zugleich zu besitzen, aber es ist auch nicht der Fall, dass man sie entweder besitzt oder nicht besitzt, sondern es ist unentschieden, ob man sie besitzt oder nicht. Die »Unentschiedenheit, ob a« ist das tertium datur dazu, a oder non-a zu sein. Soweit hatten wir dies schon bei der »chaotischen Mannigfaltigkeit« kennen gelernt, die als Unentschiedenheit darüber, ob Elemente miteinander identisch oder von einander verschieden sind, bestimmt wurde. In diesem Fall genügt aber nicht die einfache Unentschiedenheit, ob ich a oder non-a bin, weil das bloß ein indifferentes Weder-noch und nicht das gesuchte 184 Diese »zweite Paradoxie« wird nach Schmitz also erst hier gelöst und noch nicht mit der Konzeption des präpersonalen Selbstbewusstseins. 185 Er sieht erste Ansätze dazu bei Plotin, der so z.B. die ganze Seele in allen Teilen des Körpers zu verorten suche (vgl. 2007a, 326). 74 Sowohl-als-auch zur Folge hätte (vgl. 1999c, 63); schließlich sollen personales und präpersonales Selbstbewusstsein zusammen bestehen können und nicht wie eine Situation in Uneindeutigkeit zerfließen. Vielmehr ist unentschieden, ob unentschieden ist, ob unentschieden ist, usf. ins Unendliche. Schmitz nennt das »ambivalente« oder »instabile Mannigfaltigkeit« und meint damit ein Gemenge von Elementen, die hinsichtlich ihrer Identität und Verschiedenheit miteinander unendlichfach unentschieden sind und insofern ambivalent zwischen zweien oder mehreren Zuständen schillern, so dass »verschiedene Gegenstände mit unendlichfacher Unentschiedenheit um Identität mit demselben Gegenstand konkurrieren« (2003a, 119).186 Es ist dies allerdings eine »unendliche kleine oder schwache Unentschiedenheit [...], so etwa, wie der Winkel der Tangente mit einer konvexen Kurve unendlich klein und doch ein Winkel ist« (2008, 133). Da sie so »gegen die Entschiedenheit kaum noch ins Gewicht fällt« (2008, 143) sind Personen also nur relativ chaotisch und nicht so instabil, dass sie vom Zerfall in unzusammenhängende Schichten oder vom Zerfließen wie die persönliche Situationen in andere Situationen bedroht wären. Von einem festen, einheitlichen Kern kann allerdings, das hatten wir schon im letzten Kapitel gesehen, nicht die Rede sein. Personales Selbstbewusstsein ist zwar nicht so undurchsichtig wie die persönliche Situation, aber auch nicht eindeutig auf dieses oder jenes festlegbar. Was ich bin bzw. wofür ich mich halte, liegt zwar als Einzelnes vor, nicht aber wie ich bin; beides zusammen ergibt zudem weder eine unterschiedslose noch eine höhere Einheit. Weder Identität noch »Nichtidentität« haben die Oberhand. Etwas als etwas sein und selbst etwas sein werden nicht eigentlich aufgehoben, sondern eher: vermittelt, d.h. in der Schwebe gehalten. Die, nun präzisere, Antwort auf die Frage »Wer bin ich?« lautet: Ich bin instabiles Mannigfaltiges. Es ist unendlichfach unentschieden, ob mein Selbstbewusstsein unmittelbares, präpersonales oder zuschreibendes, personales ist. Als Person schillere ich ambivalent zwischen dem, was und dem, wie ich bin, denn es ist kein Widerspruch, dass ich beides, dass ich identisch und verschieden zugleich bin, ohne in einer höheren Einheit aufgehoben zu sein. Ich kann getrost sagen, dass ich Sascha Pahl bin, und muss nicht zweifeln, ob diese Identifizierung, die ich als personales (Hase) mit mir als präpersonalem (Igel) Subjekt vollziehe, zutrifft. Ich bin dadurch nicht zwei verschiedene Subjekte, sondern kann ohne Persönlichkeitsspaltung beide sein, weil deren Identität ihre gleichzeitige Verschiedenheit nicht ausschließt noch ihr widerspricht, sondern in ambivalentem Schillern »Nichtidentisches zulässt«. So geht das Rennen zwischen Hase und Igel in mir unentschieden aus, womit die Paradoxie der Selbstzuschreibung nach Schmitz endgültig gelöst ist, da neben dem Aufweis 186 Eine erstes »Modell« dessen, was Schmitz meint, erblickt er in Formulierungen Fichtes, der vom »Wechsel des Ichs in und mit sich selbst«, dem »Schweben der Einbildungskraft zwischen Unvereinbarem«, dem »Widerstreit derselben mit sich selbst« spricht (Fichte I, 215 ff.; vgl. 1996a, 16, 382). 75 der Voraussetzung für jede Selbstzuschreibung, nun auch deren Zusammenspiel mit dieser Voraussetzung geklärt ist. 2. Präpersonale Ambivalenz Dies ist nicht der einzige ambivalente Punkt in Schmitz’ Theorie. Noch jenseits der Selbstzuschreibung tritt ein ähnliches Problem auf. Das leibliche Geschehen des affektiven Betroffenseins von Gefühlen und leiblichen Regungen erschien bisher – ganz im Gegensatz etwa zur Philosophie Fichtes, dessen Ich sich in reiner Aktivität »setzt« – wie ein gänzlich passiv ablaufender Prozess: ich werde (bzw. mir wird) betroffen, angegangen, berührt. Nur so gibt es mich, jedoch ohne dass dazu etwas von mir beigetragen würde; es scheint bloß über mich zu ergehen. Zwar ließe sich die Aktivität auf der personalen Ebene der Selbstzuschreibung verorten, wo das Subjekt sich initiativ zum Angegangenwerden verhält, indem es sich beispielsweise von bestimmten Gefühlen distanziert und mit anderen emphatisch mitgeht. Dann wäre die präpersonale Grundlage des Selbstbewusstseins aber noch immer ganz passiv und fraglich, wie es durch einen solchen Prozess bloßer Widerfahrnis überhaupt etwas Selbsthaftes (bzw. Mirmäßiges, selbst-etwas-seiendes) zu Stande kommen könne.187 Noch so aktivische Selbstzuschreibung könnte ja bloß ins Leere laufen, wenn sie sich nicht auf etwas beziehen könnte, das selbst schon vollwertiges Selbstbewusstsein ist. Damit ist auch das Thema Freiheit berührt. Affektives Betroffensein wäre dann, wie die Sinnlichkeit bei Kant, unfrei und sittlich nicht verantwortbar. In diesem Zusammenhang betont Schmitz, dass affektivem Betroffenseins gegenüber den eben betonten rezeptiven Eigenschaften auch ein Moment der Spontaneität zukommt: »Wer so betroffen ist, kann nicht gleichgültig bleiben; er ›springt an‹ (wie ein Motor), nimmt Anteil an dem, was ihn betroffen macht, und geht ein auf das, was er affektiv hinnimmt. Spontaneität und Rezeptivität sind dabei nicht zu trennen« (1999a, 151). Dies zeige sich etwa bei Schmerzen, die »nicht nur erlitten [werden], sondern auch ausgehalten, etwa ärgerlich oder rasend oder geduldig« (1987, 29). Affektives Betroffensein ist demnach ohne Aktivität gar nicht denkbar, weil es »anmacht« (im Sinne von »affiziert«) und nicht über ein passiv bleibendes Subjekt abläuft bzw. ein solches allererst hervorbringt. Vielmehr kann sich als Subjekt nur erfahren, wer sich aktiv, aber unwillkürlich verstrickt, nicht nur rezeptiv betroffen, sondern auch spontan beteiligt ist. Das affektive Betroffensein hat eine passive und eine aktive Seite. Ohne das Betroffensein, die passive Seite, geschieht dem Bewussthaber nichts, er bleibt indifferent; ohne die aktive Resonanz, das 187 Vgl. dazu schon die Einsicht von Jacobi: »denn was nicht schon etwas ist, kann nicht zu etwas blos bestimmt werden« (Jacobi 1789, 163). 76 Sicheinlassen, das Sichverstricken in das Widerfahrende, geht ihn das, was ihm geschieht, nichts an, er nimmt keinen Anteil, nimmt nichts auf, lässt es nur geschehen (2007c, 66).188 Dieses aktivische Eingehen, das zugleich mit dem passivischen Angegangenwerden des Betroffenseins geschieht, nennt Schmitz: »Gesinnung.189 Sie ist eins mit dem Betroffensein, das ein aktiv-passives Doppelgesicht« (2003a, 74 f.) und dennoch ganz unwillkürlich statthat, ohne dass Personalität oder ein Subjekt-Objekt-Verhältnis gegeben sein müssten. Beim Ballspiel wirft der eine Spieler hin, der andere zurück; beide Vorgänge reihen sich an einander. Im affektiven Betroffensein sind Empfangen und Zuwendung dagegen zugleich; der Kreis ist von vornherein geschlossen in unbeliebiger Selbstverstrickung, gleich ob man sich mitreißen läßt oder das Betreffende abwehrt, und vor aller Selbstzuschreibung. [...] Dazu gehört kein Subjekt-Objekt-Verhältnis [...] Die Zuwendung, das Mitmachen ist dann eine reine Gebärde der mir-subjektiven Bedeutsamkeit ohne Subjekt (1999a, 151; vgl. auch III.2, 138 ff.). Personale Selbstzuschreibung wird so endgültig zum bloßen Mitläufer. Alles Entscheidende passiert bereits im Präpersonalen – selbst die Freiheit, zu welcher die Fähigkeit zur Selbstzuschreibung nur noch die Wissentlichkeit hinzu bringt (vgl. 1990, 370). Zwar weiß ich explizit von mir erst als Person, doch bin ich alles, was ich als Subjekt bin, nur durch die »unwillkürliche Verstrickung« im affektiven Betroffensein. Selbst »Reflexivität« schreibt Schmitz der präpersonalen Ebene angesichts dessen Janusköpfigkeit aus Spontaneität und Rezeptivität zu. »Das affektive Betroffensein durch Gefühle und leibliche Regungen ist in eigentümlicher Weise reflexiv. [...] In diesem Sinn bin ich das Geschöpf der Reflexivität meines affektiven Betroffenseins« (1999a, 151 f.). Affektives Betroffensein macht mich also nur insofern zu mir, als es selbst reflexiv verfasst ist! Allein dadurch kann ich mich überhaupt als jemand erleben. Dies ungetrennte und untrennbare Zusammen von Aktivität und Passivität der Mir-Subjektivität deutet Schmitz – deswegen behandeln wir es erst in diesem Kapitel – nach dem eben vorgestellten Muster der unendlichfach unentschiedenen Ambivalenz. »Das 188 Dass affektives Betroffensein eine aktive Seite (das affektive, gegenüber dem Betroffensein, das passiv ist) hat, die für es notwendig ist, macht Schmitz im Anschluss an dieses Zitat durch Beispiele von Emotionslähmung deutlich. Solchen Patienten fehlt gerade dieses affektive Moment, sie sind betroffen, aber es geht sie nicht aktiv und affektiv an. Dies scheint allerdings eher deutlich zu machen, dass seine These falsch ist, Subjekte gebe es durch und nur durch die Subjektivität des affektiven Betroffenseins. Emotionsgelähmte Menschen haben keinerlei Affekte und sind dennoch Subjekte (im Sinne von Bewussthaber), ihnen wird lediglich alles, auch sie selbst, gleichgültig (dazu Kap. IX.1). 189 Für die hier nicht eigens zu behandelnde Freiheitsfrage ist entscheidend, dass die Gesinnung causa sui ist, »sich selbst bewirkt [...] ihr eigener Realgrund ist« (1999a, 152) und damit sowohl dem Prädeterminismus als auch dem Indeterminismus entgehen soll. Menschliche Freiheit ist daher Gesinnungs- und nicht Willensfreiheit (vgl. 1999a, 153). »Gesinnung« meint hier wohlgemerkt keineswegs etwas bewusst Verfügbares, sondern verbleibt auf der Ebene des Unwillkürlichen. Dies mag sich deswegen etwas verwirrend ausnehmen, weil »Gesinnung« etwa in der Kantischen Gesinnungsethik als etwas auf der Ebene der Vernunft, oder des »Raums der Gründe« wie man heute gerne sagt, Angehöriges bestimmt zu sein scheint. Dem ist aber nicht so. Für unsere Gesinnung sind wir auch nach Kant verantwortlich, obwohl wir sie nicht selbst verschuldet haben, sondern sie uns a priori »zuziehen« bzw. immer schon zugezogen haben. Weder verfügen wir also darüber noch ist sie auf der Ebene der Vernünftigkeit anzusiedeln (vgl. Kant 1794, 1. Abschnitt, bes. B 14). Wo Kant sie oberhalb der Vernünftigkeit ansiedelt, da Schmitz unterhalb; die Konsequenzen sind aber sehr ähnlich. So seltsam diese auch scheinen mögen, muss man sich doch klar machen, dass Freiheit, sobald man sich einmal die Aporien von sowohl Prädeterminismus als auch Indeterminismus klar gemacht hat, nachgerade an sich selbst so paradox strukturiert ist, dass sie zugleich uns selbst und doch nicht uns selbst anzugehören scheint. 77 Verhältnis190 von Gesinnung und passivem Betroffensein im affektiven Betroffensein ist eine Ambivalenz der schon berührten Art« (2003a, 75; vgl. auch 1987, 30). Die »Lebensverstricktheit« ist also ebenso wie die »Abstandnahme« sind nur als ambivalentes Schillern zwischen zwei Zuständen, die so zugleich einer sind, zu begreifen. Nicht nur personales, sondern auch präpersonales Selbstbewusstsein ist instabiles Mannigfaltiges.191 Nur so kann dieses beides zugleich sein: Spontaneität und Rezeptivität – und sollten wir hier nicht auch schon sagen: Unmittelbarkeit und Reflexion oder gar Subjekt und Objekt? Ist das präpersonale Selbstbewusstsein nun etwa doch selbstbezüglich? Selbstbezüglich scheint es in der Tat zu sein. Da diese Selbstbezüglichkeit allerdings nicht bewusst vollzogen wird, sondern unwillkürlich, ist sie lediglich als Reflexivität und nicht als Reflexion zu bezeichnen. Auf dieses interessante Charakteristikum, dass hier in die Unmittelbarkeit selbst im Handumdrehen wieder ein reflexives Element eingetragen werden muss, wodurch auch die schon bewältigt geglaubte Zweieinigkeit zurückzukehren scheint, werden wir noch zu sprechen kommen – implizit bereits in der nun folgenden Auseinandersetzung mit Hegel, die sich an dieser Stelle natürlich anbietet, näherhin schließlich in den beiden darauf folgenden Kapiteln. VII. Exkurs II: Vergleich mit anderen Ansätzen Nachdem Schmitz’ Theorie nun vollständig vor uns steht, liegt es nahe, sie mit anderen Ansätzen zu vergleichen, die in bestimmten Punkten Ähnlichkeiten mit ihr aufweisen. Dies soll nochmals Schmitz’ bisweilen auf Grund ihrer eigentümlichen Terminologie schwer einzuordnende Position durch eine Verortung im philosophischen Diskurs erhellen. So können nicht nur ihre Stärken und Schwächen deutlicher zu Tage treten, sondern andererseits kann so auch bereits die Kritik an ihr vorbereitet werden, die im folgenden Kapitel geübt werden soll. Zudem wird die Vorstellung dieser Positionen zu einem Gesamtbild von Selbstbewusstseinstheorien beitragen, welches den Abschluss dieser Arbeit bilden wird. Die in Teil 2 und 3 dieses Kapitels behandelten Theorien haben mit Schmitz gemein, nichtegologische Ansätze zu sein. Teil 2 behandelt Theorien des Selbstgefühls, mit welchen Schmitz zusätzlich die Grundlegung des Selbstbewusstseins in der Affektivität teilt, Abschnitt 3 behandelt propositionale Theorien des Selbstbewusstseins, die wie Schmitz die Rede von Subjekt und Objekt durch eine sprachanalytisch fixierte Sachverhaltsontologie zu ersetzen 190 »Verhältnis« ist hier eigentlich schon zu viel gesagt, denn diese eigentümliche Reflexivität keine bewusste. Wie hier nicht weiter ausgeführt werden soll, gilt dies auch für jede Art des Bewusstseins, die nicht Selbstbewusstsein ist (vgl. z.B. 1996a, 31). Wahrnehmung etwa ist keine Repräsentation, sondern ambivalentes schillern zwischen Wahrnehmenden und Wahrgenommenem, die man daher gar nicht eindeutig von einander trennen kann (vgl. III.5). 191 78 gedenken. Zunächst aber zu Hegel, mit dem Schmitz nicht nur in holistischer, sondern auch in identitätstheoretischer Absicht Gemeinsamkeiten aufweist. 1. Hegels Philosophie des Selbstbewusstseins Um Hegel wirklich zu entrinnen, muß man ermessen, was es kostet, sich von ihm loszusagen; wissen, wie weit uns Hegel insgeheim vielleicht nachgeschlichen ist; man muß ermessen, inwieweit auch noch unser Anrennen gegen ihn seine List ist, hinter der er uns auflauert. (Foucault) Auf Hegel hatten wir, sowohl bezüglich des Selbstbewusstseins als auch im Rahmen der Darstellung von Schmitz’ Gesamtkonzeption, schon in mehrfacher Hinsicht verwiesen. An dieser Stelle bietet es sich an, einen näheren Blick auf seine Selbstbewusstseinstheorie zu werfen, da sie aufschlussreiche Ähnlichkeiten mit Schmitz’ eben behandelter Konstruktion des personalen Selbstbewusstseins als ambivalente Mannigfaltigkeit aufweist.192 Man könnte Hegels ganzes philosophisches Unternehmen als Versuch lesen, die Struktur des Selbstbewusstseins zu verstehen, die auftretenden Paradoxien dessen begrifflich zu verarbeiten. Doch ist Selbstbewusstsein nach Hegel nicht aus sich selbst heraus verständlich, sondern nur dann, wenn wir alles als nach dessen zunächst paradox erscheinender Struktur verfasst begreifen. Deswegen erscheint das eigentliche Selbstbewusstsein bei Hegel dann auch nicht mehr als Fundament und nur ein Thema unter vielen zu sein.193 Selbstbewusstsein ist nur als Erscheinungsform des »Begriffs« und seiner komplexen Struktur zu begreifen.194 In diesem Zug spricht Hegel dem Selbstbewusstsein eine Form der Unendlichkeit zu und nimmt eine Neubestimmung von Identität vor. Hegel konzipiert Identität als etwas, das die Verschiedenheit mit einbegreift, berühmt ausgedrückt in der Formel: »Identität der Identität 192 Schmitz sieht die Nähe selbst (vgl. 2003b, 876, wo er Hegels und seinen Lösungsversuch in einem Atemzug nennt; vgl. ferner 2007b, 474 ff.). 193 Dennoch oder eben deswegen ist zu vermuten, dass die Struktur des Selbstbewusstsein für Hegel gar der Anlass war, ebendiese komplexe Struktur zu entdecken. »Es ist möglich, Hegels gesamtes System als die Folgerung aus zwei Prämissen darzustellen: Die Subjektivität ist nur im Gebrauch einer Begriffsform zu explizieren. Eben deshalb darf diese Begriffsform aber durchaus nicht als der Subjektivität entsprungen und als an sie allein gebunden angesehen werden« (Henrich 2004, 1690; vgl. auch Jaeschke 1995, 361; Arndt 2004, 22). 194 Der Zusammenhang zwischen der Begriffsstruktur und dem Selbstbewusstsein ist nicht beliebig und man kann ihn sich vereinfacht dadurch klar machen, dass erstens die in der Begriffsstruktur kulminierende Logik Hegels den Anspruch verfolgt »das Denken« darzustellen und zweitens das Selbstbewusstsein derjenige Punkt in der Realphilosophie ist, an der eine Entität auftritt, welche dieses Denken selbst vollzieht und sich dessen bewusst wird. »Der Begriff, insofern er zu einer solchen Existenz gediehen ist [...] ist nichts anderes als Ich oder das reine Selbstbewußtsein« (Hegel 6, 253). Dieses Zitat macht überdies deutlich, dass Hegel zwischen »Ich« und »Selbstbewusstsein« unterscheidet. Gleichgesetzt wird das »Ich« nur mit dem »reinen Selbstbewusstsein«, während das »unreine« (d.h. empirische, begehrende, anerkennende, noch nicht allgemeine und d.h. noch nicht voll zu sich selbst gekommene, sich noch etwas nicht vollends als Teil seiner selbst Erkanntem, Äußerlichem gegenüber befindliche) Selbstbewusstsein eine Durchgangsstufe in der Realisierung der Ich-Struktur darstellt. Darauf müssen wir an dieser Stelle nicht weiter eingehen; wenn wir im Weiteren vom »Selbstbewusstsein« sprechen, meinen wir aber de facto, was bei Hegel »Ich« heißt; es geht uns um die allgemeine Struktur und nicht deren stufenweise, idealgenetische Realisierung (vgl. Hegel 3; Hegel 10, 199 ff.). 79 und der Nicht-Identität«.195 Beides: Neubestimmung der Identität und Rekurs auf Unendlichkeit haben wir auch in Schmitz’ Selbstbewusstseinstheorie gesehen.196 Paradoxal strukturiert ist das Selbstbewusstsein, wie wir ausführlich gesehen haben, deswegen, weil es zugleich mit sich identisch und von sich verschieden ist: schon durch die bloße Tatsache, dass es sich auf sich selbst bezieht; da es sich so zum Gegenstand macht, also doppelt vorkommt, bezieht es sich dadurch bereits instantan und unabdingbar auf Anderes. Kant hatte diese Struktur gesehen (Kap. III.1) und sie für ein unlösbares Paradoxon, für eine Grenze möglicher Erkenntnis erklärt: Wir könnten davon »niemals den mindesten Begriff haben« und würden »uns daher in einem beständigen Zirkel herumdrehen, indem wir uns seiner Vorstellung jederzeit schon bedienen müssen, um irgend etwas von ihm zu urteilen«.197 Von derlei Erkenntnisgrenzen dachte Hegel bekanntlich gering. Eine Grenze zu ziehen, heiße, sie bereits überschritten, das vorgeblich Unerkennbare bereits erkannt zu haben. So auch in diesem Fall. Die Beschreibung als Zirkel ist für Hegel durchaus korrekt. Er gibt ihr jedoch eine ganz eigentümliche Wendung, welche Kants kritische Behauptung einer Erkenntnisgrenze im Selbstbezug des Ich, in eine affirmative transformiert: Die Zirkularität ist keine Erkenntnisgrenze, sondern das Phänomen selbst. Sonderbar ist der Gedanke – wenn anders ein Gedanke genannt werden kann – , daß Ich mich des Ich schon bedienen müsse, um von Ich zu urteilen; das Ich, das sich des Selbstbewußtseins als eines Mittels bedient, um zu urteilen, das ist wohl ein x, von dem man, so wie vom Verhältnis solchen Bedienens, nicht den mindestens Begriff haben kann. Aber lächerlich ist es wohl, diese Natur des Selbstbewußtsein – daß Ich sich selbst denkt, daß Ich nicht gedacht werden kann, ohne daß es Ich ist, welches denkt – eine Unbequemlichkeit und als etwas Fehlerhaftes einen Zirkel zu nennen, – ein Verhältnis, wodurch sich im unmittelbaren, empirischen Selbstbewußtsein die absolute ewige Natur desselben und des Begriffs offenbart, deswegen offenbart, weil das Selbstbewußtsein eben der daseiende, also empirisch wahrnehmbare, reine Begriff, die absolute Beziehung auf sich selbst ist, welche als trennendes Urteil sich zum Gegenstande und allein das ist, sich zum Zirkel zu machen.198 Das Selbstbewusstsein ist dieser Zirkel, meint Hegel. Es besteht genau in der von Kant monierten Eigenschaft, sich selbst stets schon voraus zu sein. Pointiert formuliert: Kant hat die Struktur des Selbstbewusstseins erkannt, er hat es nur nicht bemerkt. Deswegen drückt er sich in Formulierungen wie »bedienen« aus, die suggerieren, das sich Bedienende und dasjenige, dessen es sich bedient, wären nur verschieden und nicht auch identisch199 und findet diesen Zirkel »unbequem«. Nach Hegel ist dies jedoch weder unbequem noch mangelhaft, sondern gleichsam die höchste Bequemlichkeit und Ehre, welche das Selbstbewusstsein zur ausgezeichneten empirischen Erscheinungsform des Absoluten selbst 195 Hegel 2, 96. Wo Hegel allerdings dialektisch vorgeht und Widersprüche zum Medium (notwendigen Durchgangsstadium) der Wahrheit erklärt, zielt Schmitz, wie wir gesehen haben, mit seiner Lösung gerade darauf ab, die Widersprüche der Selbstbewusstseinsparadoxien zu vermeiden. 197 Kant, KrV, B 404. 198 Hegel 6, 490. 199 Genau genommen taucht es in der Formulierung Kant sogar dreifach auf: Als Erkenntnissubjekt, als Erkenntnisobjekt und als Erkenntnismittel! 196 80 (der Begriffsstruktur) und es auch nur als solches und vor diesem Hintergrund begreifbar macht. Hegel gibt Kant darin Recht, dass das Ich sich nicht in einem »leeren an sich« – in reiner Selbstbeziehung – erfassen kann, sondern nur indem es sich in einer Subjekt-Objekt-Struktur zum Gegenstand macht, sich auf Anderes bezieht. »Wie das Licht die Manifestation seiner selbst und seines Anderen, des Dunklen, ist und sich nur dadurch offenbaren kann, daß es jenes Andere offenbart, so ist auch das Ich nur insofern sich selber offenbar, als ihm sein Anderes in Gestalt eines von ihm Unabhängigen offenbar wird«.200 Dieser Bezug auf sich als Anderes ist aber nur deswegen möglich, weil es – zugleich und dadurch – auch stets auf sich als sich bezogen ist. Die inhaltsreiche Subjekt-Objekt-Struktur ist für sich genommen ebenso wenig suisuffizient wie die leere Subjekt-Subjekt-Struktur. »Ein Ich-Objekt ohne selbstbezügliches Ich ist ebenso wenig denkbar wie ein selbstbezügliches Ich ohne reflektiertes Ich-Objekt«.201 Sowohl die Vorstellung des Selbstbewusstseins als bloß unmittelbarem Selbstbezug als auch die eines bloß reflektierten, vermittelten Bezugs scheitert; beides muss zusammengedacht werden. Unmittelbarer Selbstbezug und vermittelter Bezug durch und auf Anderes bedingen sich wechselseitig, setzten sich wechselseitig voraus. Das ist zirkulär. Es ist aber, so die Pointe, deswegen kein fehlerhafter Zirkelschluss, der voraussetzt, was er beweisen will, sondern die unhintergehbare Selbstbegründungsstruktur des Selbstbewusstseins, das an sich selbst und nicht nur für uns zirkulär ist und insofern das, was Hegel »wahrhafte Unendlichkeit« nennt.202 Gegenüber der »schlechten Unendlichkeit« des infiniten Regresses ist sie dadurch ausgezeichnet, nicht wie im Reflexionsmodell äußerlich auf ewig vorausgesetzt werden zu müssen, ohne sich je einzuholen und so immer nur Anderes, nie aber sich finden zu können. Wahrhaft unendlich zu sein, bedeutet für das Selbstbewusstsein vielmehr, seine Voraussetzungen selbst zu setzen und zu sein: nicht vorausgesetzt zu sein, sondern sich selbst vorauszusetzen. So ist es sich tatsächlich bei aller Selbstzuschreibung bzw. Identifizierung mit Anderem (Hase) immer schon als mit sich Identisches voraus (Igel) – oder besser: nicht voraus, sondern stets beides zugleich und jedes nur durch das jeweils Andere – und kann insofern durch, und nur durch, alle Verschiedenheit und Entäußerung hindurch bei sich selbst sein und bleiben. Dies heißt für das Selbstbewusstsein: sich zum Zirkel zu machen, wahrhaft unendlich zu sein, Hase und Igel ineins sein zu können. Hegels Konzept fällt also nicht einfach der »Reflexionstheorie« zum 200 Hegel 10, 201 (vgl. auch Hegel 10, 199: »Ich als diese absolute Negativität ist an sich die Identität in dem Anderssein; Ich ist es selbst und greift über das Objekt als ein an sich aufgehobenes über, ist eine Seite des Verhältnisses und das ganze Verhältnis«.). 201 Iber 2000, 66. 202 Vgl. Hegel 5, 175. 81 Opfer, weil das identische Selbst nicht durch Reflexion (»Bezug auf Anderes«) erst zu Stande kommt, sondern beides immer schon zusammen besteht.203 Als diesen Prozess des sich durch Anderes auf sich Beziehens und sich im Anderen Vorauszusetzens kann man die Ich-Struktur auch »ihre eigene Rückkehr«204 nennen: Sie besteht darin, stets schon »in-der-Welt« und zugleich zurückgekehrt zu sein. Eben deswegen kann es sich aber nicht, was Kant bemängelt, in dem Sinne auf sich zurückwenden, dass es sich wie ein beliebiges anderes Objekt betrachten kann. Es ist buchstäblich nicht zu fassen – so lange man es als Objekt missversteht.205 Dem gegenüber ist die Struktur der Subjektivität vielmehr ungegenständlich und erscheint deswegen dem vergegenständlichenden »Verstandesdenken« als unauflöslicher existierender Widerspruch von Selbstbezug und Bezug auf Anderes, der sich scheinbar nicht konsistent denken lässt, aber durch die Einsicht in die Begriffsstruktur aufgehoben werden kann. Von dieser erbt es das Selbstbewusstsein, »absolute Beziehung auf sich selbst«206 und das heißt: Differenzeinheit von (unmittelbarem) Selbstbezug und (vermitteltem) Bezug auf Anderes zu sein. Was wir hier Bezug auf Anderes genannt haben, nennt Hegel im Zitat oben »trennendes Urteil«, für das immer schon die zugleich zu denkende Ungetrenntheit vorausgesetzt ist,207 die aber als reiner, leerer Selbstbezug nicht für sich bestehen kann. In Schmitz’ Konzeption entspricht dem Urteil die (propositionale) Selbstzuschreibung. Diese ist wie das Urteil nur unter der Voraussetzung einer unmittelbaren »Selbsthaftigkeit« möglich, welche bei Schmitz das selbstzuschreibungslose affektive Betroffensein, die Mir-Subjektivität darstellt. Weiter hat auch Schmitz nach der Einheit, dem Zusammenspiel beider gefragt. Selbstbewusstsein mit 203 Vgl. Iber 2000, 63 f. sowie Figal 2001, 34. Frank spart Hegel in seiner Geschichte der Selbstbewusstseinstheorien fast komplett aus und beruft sich dafür auf Henrich (vgl. Frank 1991b, 593 f.), der von Hegel sagt: »Beharrlich beschreibt er das Selbstbewußtsein als Zusichkommen eines solchen, das an sich schon Selbstbeziehung ist, – somit ganz nach dem Reflexionsmodell, das bereits alles voraussetzt« (Henrich 1970, 281). Hier müssen wir genau sein. Das Selbstbewusstsein der Phänomenologie, von dem Henrich hier offenbar spricht, ist sicherlich nur eine genealogische Aktualisierung und Realisierung einer Struktur, die an sich schon vorhanden ist. Hegel verfährt aber insofern gerade nicht nach dem Reflexionsmodell, als er nicht beansprucht, Selbstbewusstsein bloß genetisch und allein aus der Reflexion eines Unreflektierten auf sich verständlich machen zu können, um sich dann fragen lassen zu müssen, ob die Ich-Idenität dafür nicht schon vorausgesetzt werden müsse. Natürlich muss sie dafür schon vorausgesetzt werden. Eben deswegen denkt Hegel die Struktur des Selbstbewusstseins nach dem Modell des Begriffs als Einheit von Reflexion und Unmittelbarkeit (»vermittelte Unmittelbarkeit«) und nicht allein nach dem wesenslogischen Modell der Reflexion – wie Henrich zu unterstellen scheint. Wer bei Hegel nach einem bloß genetischen Modell des Selbstbewusstseins sucht, wird nicht fündig werden; so betrachtet wird sein erstes Auftreten immer als eine Art »Blitz« (vgl. Hegel 10, 90; 198) erscheinen, dessen Einschlag, sei es onto- oder phylogenetisch, dann in der Tat nicht mehr darstellt als ein, wie Henrich schreibt, »Zusichkommen eines solchen, das an sich schon Selbstbeziehung ist« und einer näheren Erklärung nur innerhalb eines strukturellen Rahmens fähig ist. 204 Vgl. die seins- und wesenslogischen Vorarbeiten zu dieser Struktur: Hegel 5, 164, 175 sowie Hegel 6, 24 ff. 205 Genau besehen, wäre es aber auch um einiges seltsamer, wenn es sich selbst als Objekt betrachten könnte. Dann müsste es entweder sich in seinem Betrachten mitbetrachten oder ganz zum Objekt werden und also zu betrachten aufhören. 206 Hegel 6, 490; vgl. Zitat oben bei Fußnote 198. 207 Vgl. Hegel 10, 212: »Ich hat als urteilend einen Gegenstand, der nicht von ihm unterschieden ist, – sich selbst; – Selbstbewußtsein«. Es sei »dieser Unterschied ein Unterscheid [...], der keiner ist«. 82 und ohne Selbstzuschreibung können durch seine Logik der unendlichfachen Unentschiedenheit in ambivalenter Mannigfaltigkeit zusammen bestehen, in- und miteinander schillern: Sie können identisch sein, ohne einerlei zu sein, ohne ihre Verschiedenheit aufzuheben – genau wie bei Hegel. Dieser hebt Identität und Verschiedenheit in eine »höhere« Differenzeinheit beider auf. Schmitz vermittelt sie nicht in eine höhere, sondern gleichsam »auf derselben Ebene« verweilende Unentschiedenheit.208 Hegels Selbstbewusstseinstheorie ist nicht zu haben ohne sein ganzes System und dessen für viele Gemüter schwer verdauliche Thesen, allen voran der Einheit von Denken und Sein. Für ihn ist das Selbstbewusstsein nur zusammen mit der und durch die alles umfassende Begriffsstruktur verständlich. Es kann sich nur deswegen durch anderes auf sich beziehen, weil das andere derselben Struktur angehört wie es selbst, in seiner Verschiedenheit doch mit ihm identisch ist. »Ich ist der Inhalt der Beziehung und das Beziehen selbst; es ist es selbst gegen ein anderes, und greift zugleich über das andere über, das für es ebenso nur es selbst ist«.209 Selbstbewusstsein ist ebenso das Ganze wie das Wahre das Ganze ist. Bei Schmitz hingegen ist weder das Wahre noch das Selbstbewusstsein das Ganze: Situationen sind weder wahrheits- noch selbstbewusstseinsfähig. Daraus ergibt sich ein spezifischer Unterschied der Beiden bezüglich der Bedingungen, die wir anfangs an Selbstbewusstseinstheorien gestellt haben. Auf Grund seiner Diremption des einzelnen Selbstbewusstseins aus der allgemeinen Struktur des Begriffs als deren Besonderung kann Hegel jedenfalls die Kriterien »Selbstbezüglichkeit« und »Identität« erfüllen, verfehlt aber womöglich eo ipso, was wir als Jemeinigkeit bezeichnet haben: Wie nämlich könnte dieses Selbstbewusstsein je meines sein, wenn es vorgängig diese allgemeine Struktur ist und zu meinem erst in sekundärer Realisierung werden soll? Eben dies sollte der Begriff der Jemeinigkeit abwenden: Einsetzungsinstanz einer ansichseienden Struktur, »Fall einer Gattung« zu sein. Hegel verkennt, in Henrichs Worten, die entscheidende »Eigentümlichkeit« unseres Gegenstandes: Im Selbstbewußtsein hat nicht nur ein Bewußtsein Kenntnis von diesem Bewußtsein, sondern es ist von einem Bewußtsein gewußt, daß es selbst dieses Bewußtsein ist. Diese Eigenschaft der ersten Person läßt sich nicht nur aus keiner anderen herleiten, sondern auch nicht als ein Fall besonderer, möglicherweise infiniter Rationalität von einem anderen Standpunkt aus auffassen, als der es ist, in der sie erfüllt ist.210 Was aber Wissen von sich, das Subjekten zugeschrieben wird, überhaupt bedeutet, läßt sich gar nicht unabhängig davon verstehen, daß ein Fall von Wissen im Blick ist, der für jedes Subjekt jeweils der eigene ist. [...] Da das Wissen nicht anonym, sondern sein Wissen ist, muß der Gedanke der Selbstbeziehung nicht nur durch das ›Für-sich-sein‹, sondern genauer als ein ›Für-mich-sein‹ des Wissens sprachlich ausgedrückt werden. Was immer man sich zur Erklärung des Erwerbs eines solchen Gedankens ausdenken mag – er kann seiner Form nach unmöglich als ein allgemeiner Begriff gelten, der aufgrund irgendwelcher Fälle gebildet und dann auf den meinen angewendet werden muß. Denn er 208 Der Terminus »Vermittlung« soll hier gegenüber der »stärkeren« der »Aufhebung«, das »in der Schwebe bleiben«, »nicht in höherer Einheit Aufgehen« bezeichnen. 209 Hegel 3, 137 f. 210 Henrich 1982, 173. 83 hat seine Bedeutung überhaupt nur im aktuellen Gebrauch eines Subjekts in Beziehung auf sich selber.211 In diesem einzelnen Gebrauch aber ist nichts davon zu bemerken, Instanz dieser objektiven Struktur zu sein – eben deswegen ist das empirische auch nicht das wahre als das ganze Selbstbewusstsein in vollkommener Subjekt-Objekt-Identität. Wenn aber unklar ist, wie das einzelne Ich als je meines – und nicht nur der über es Philosophierende – sich dessen bewusst wird, diese Struktur zu sein, müssen wir Hegel nach dem Verfehlen des Jemeinigen wohl auch die Erfüllung des Kriteriums »Identitätsbewusstsein« verweigern.212 Hierin jedenfalls ist Schmitz Hegel voraus, der – wie wir sahen – nicht nur mit Henrich, sondern auch mit Heidegger gemein hat, die Subjektivität des Selbstbewusstseins für irreduzibel darauf zu halten, »Fall oder Exemplar einer Gattung« zu sein. 2. Ich fühle, also bin ich? – Theorien des Selbstgefühls Der Weg des Geistes zum vollständigen Selbstbewusstsein beinhaltet nach Hegel notwendig auch die Stufe des »Selbstgefühls«, das in einer noch dumpfen Weise Subjektivität anzeigt. Das Selbst muss sich auch (sogar leiblich) fühlen können, um Selbst zu sein.213 Bei Schmitz hingegen waren Phänomene der Affektivität bereits hinreichend für Selbstbewusstsein. Des Denkens etwa oder des Wollens bedarf es dafür nicht. Dieser Vorrang des Gefühls legt es nahe, einen Blick auf das Konzept eines gefühlsbasierten Selbst des Neurowissenschaftlers Antonio Damasio zu werfen. Obwohl scheinbar auf ganz anderer Basis gewonnen – Damasio untersucht Bewusstseinsstörungen und deren neuronale Korrelate im Gehirn – stimmen ihre Ergebnisse bezüglich der uns interessierenden Frage in zahlreichen Punkten überein. Nach Damasio gehört zu den entscheidenden Fragen einer Neurobiologie des Bewusstseins nicht nur diejenige, wie ein einheitliches Erleben, »ein einheitlicher ›Film-in-unseremGehirn‹ entsteht«, sondern vor allem, wie das »Gehirn etwas darstellt, das genügt, um anzuzeigen, dass Sie und kein anderer diesen Text lesen und verstehen«, also »dass es einen Besitzer und Beobachter des Films gibt [...] und wie eben dieser in den Film eingebaut 211 Henrich 1999, 60 f.; vgl. auch Frank 1983, 352 ff. Mit anderen Worten: Auch für Hegel ist die singuläre Bedeutung des Wortes »ich«, mit dem ein Einzelsubjekt auf sich Bezug nimmt, abgeleitet von derjenigen objektiv-allgemeinen eines erkenntnistheoretischen Subjekts, wie sie etwa Kants transzendentalem Ich zukommt (vgl. Frank 1991a, 19). Schmitz spricht ähnlich von der »Objektphilosophie [...] Hegels, der sich zwar schmeichelte, die Substanz Spinozas durch das Subjekt bereichert zu haben, von diesem aber nur das abstrakte Merkmal der Selbstbezüglichkeit (oder auch der Abstraktionsfähigkeit) in einem sich selbst vollbringenden Prozess des absoluten Denkens und seiner Selbstentfremdung erhaschte« (2005, 5). Ein Problem hat Schmitz allerdings mit Hegel gemeinsam: Dass Selbstbewusstsein als Realisierung einer ansichseienden Selbstbezüglichkeitsstruktur theoretisch und für uns durchaus konsistent und einsichtig, nicht aber für das einzelne Selbstbewusstsein selbst, hat bei ihm sein Pedant in der ambivalenten Mannigfaltigkeit. Nichts am Phänomen des Selbstbewusstsein deutet darauf hin, dass es sich so verhalten könnte (vgl. Kap. IX.1). 212 Wir stoßen hier auch auf den Unterschied von Reflexivität und Reflexion. Es wäre daher zu erwägen, ob Hegel der Reflexionstheorie insofern, bezüglich des Jemeinigen und sozusagen gegen die bessere Anlage seiner Theorie, am Ende nicht doch zum Opfer fällt. 213 Vgl. Hegel 10, 160. 84 wird«.214 Wenn wir einmal von der ganz unklaren Rede vom Gehirn als Akteur absehen sowie davon, wie überhaupt eine Verbindung zwischen dem Gegenstand der Wissenschaft, die Damasio betreibt, und der Phänomenologie gedacht werden könnte, wird hier doch jedenfalls die gleiche Frage gestellt: Warum bin ich ich? Wie weiß ich, dass ich es bin und nicht jemand anders? Uns interessieren hier freilich nicht die neurologischen Befunde selbst, also wo sich die hierfür relevanten Prozesse im Gehirn lokalisieren lassen und wie sie zusammenspielen, sondern deren Interpretation durch Damasio. Diese besagt u.a., es gebe ein Selbstsein auf Gefühlsbasis, welches nicht von reflektierten Funktionen abhänge. Dies sei bereits in einem »Kernbewusstsein« vorhanden, das »ein Selbstgefühl bezüglich des Hier und Jetzt«215 beinhalte, also ganz in sich und der Gegenwart sei, ohne die Fähigkeit zur Zuschreibung, Reflexion oder Abstandnahme. Damasio nennt diese »vorübergehende, immer neu wiedergeschaffene Entität [...] Kernselbst«. 216 Nur das primäre Selbstgefühl im Kernbewusstsein, so Damasio, vermag das bewusste Erleben zu einem zu machen, das mir angehört. Ohne ein solches »ist es so, als erhöbe niemand Anspruch auf die Gedanken, die man erzeugt, weil der rechtmäßige Besitzer fehlt«. Es gäbe dann »niemanden, dem diese Gedanken gehören«,217 so dass »die Welt [...] neutral wäre, d.h. niemandem einen Angriffspunkt [...] liefern würde, sich selbst für etwas bestimmtes zu halten; jeder könnte dann nichts und daher nur nicht sein« (1999c, 58). Das letzte Zitat stammt schon von Schmitz, passt aber nahtlos zu Damasios Worten, dessen Kernselbst tatsächlich Schmitz’ unmittelbaren präpersonalen Selbstbewusstsein der phänomenalen Beschreibung nach entspricht. Es ist nicht nur ebenso affektiv, sondern auch ebenso flüchtig, nur »auf der Spitze des Augenblicks« gegeben: Nur hier und jetzt bin ich eindeutig dieses. Auch sprechen beide dies schon Tieren zu. Das darauf aufbauende, reflektierte Selbst, das Damasio »autobiographisch« nennt, im »erweiterten Bewusstsein« verortet und das mit Gedächtnis, Sprache und Aufmerksamkeit, kurz: »reason« einhergehe, also all dem, was Schmitz auf der personalen Ebene ansiedelt, steht ganz wie das Personale zudem in einseitiger Abhängigkeit vom »Kern«, den es »umgibt«. Während Patienten mit gestörtem erweiterten Bewusstsein weiterhin Kernbewusstsein haben, lässt schwindendes Kernbewusstsein auch kein erweitertes übrig. In Schmitz’ Terminologie gesprochen, heißt das: Es sind »subjektive Tatsachen ohne Subjekte 214 Damasio 2000, 315 f. Damasio 2000, 318. 216 Damasio 2000, 319. 217 Damasio 1999, 160. 215 85 möglich, Subjekte aber nicht ohne subjektive Tatsachen. Präpersonale Subjektivität fundiert die personale« (s.o.) bzw. präpersonales Selbstbewusstsein das personale.218 Was besagen diese Übereinstimmungen? Sicherlich bestätigen die Befunde Damasios Schmitz’ Stoßrichtung, dass Selbstbewusstsein erstens basal und nicht »nachträglich« im menschlichen Erlebnisapparat anzusiedeln ist und dies zweitens unabdingbar mit Affektivität verknüpft ist. Allerdings hat Schmitz Recht, wenn er bemerkt: »Beobachtungen bei neurologisch Kranken könnte man auch machen, wenn man nicht wüßte, daß sie neurologisch sind«. Die Übereinstimmung, die wir hier konstatieren können, enthält also »kein neurowissenschaftliches Resultat« (2004c, 227), sondern ist einer der phänomenalen Befunde, die sowohl Schmitz als auch Damasio – vom eigenen Erleben ausgehend und das Anderer rückschließend mit einbeziehend – konstatieren.219 Das schmälert das Ergebnis, welches für die Stoßrichtung beider spricht, keineswegs, beugt aber allzu schnellen Kurzschlüssen über die Erklärungskraft neurologischer Forschungsergebnisse vor: Wenn diese auch die phänomenalen Befunde durch Korrelationen stützen mögen, so erklären sie doch weder deren Auftreten noch ersetzen sie ihre phänomenologische Beschreibung. Kurzschlüsse müssen auch bezüglich weiterer Vorstellungen, die Damasio vertritt, fern gehalten werden. So meint er, das Selbstgefühl als eine Art Reflexion auf eine unbewusste Emotion deuten zu können. Dem Kernselbst gehe ein »Protoselbst« voraus, welches abbildend das Kernselbst entstehe; selbiges geschehe dann nochmals in der Entstehung des autobiographischen Selbst. Neuronale »Karten« im Gehirn würden reflexiv jeweils nochmals kartiert. Diese Vorstellung krankt unübersehbar an ihrer Orientierung am Reflexionsmodell: Etwas (A) reflektiert auf sich (A/B) und wird sich so seiner bewusst. Das Modell ist nur plausibel, wenn in der Schwebe bleibt, was A und B sind. Sollen beide das Protoselbst sein, bleiben sie es auch, weil dieses sich nicht selbst abbildet – wäre dem so, wäre es schon Kernselbst. Sind beide das Kernselbst, war dieses offenbar schon vor der Reflexion da. Ist A das Proto- und B das Kernselbst gilt dasselbe. Etwas reflektiert sich selbst spaltend auf sich und wird so es selbst – diese verwirrenden Zusammenhänge haben wir bereits zu Genüge gesehen. Das Selbstgefühl erdet hier nicht die Reflexion in Unmittelbarkeit, sondern ist selbst Teil einer Reflexionsschleife mit drei Gliedern: Protoselbst, Kernselbst und autobiographisches Selbst, von der man nicht sieht wie sie durch wechselseitige Bezugnahme auseinander »autopoietisieren« und selbstbewusst werden könnten.220 218 Vgl. zur Gegenüberstellung beider Positionen Blume 2004. Auch Damasio wüsste ja weder mit den Berichten seiner Patienten noch mit den Bildern, die seine Rechner aus Gehirnvorgängen erzeugen, etwas anzufangen, wenn er nicht selbst wüsste, was ein Selbstgefühl, eine Emotion oder eine Erinnerung ist. 220 Vgl. Zizek 2006, 198 ff.; Frank 2002, 121 ff. 219 86 Doch muss man ein Selbstgefühl nicht als Reflexion oder Protoreflexion verstehen. Verschiedene Denker im 18. Jahrhundert banden an diesen Terminus und gegen Descartes’ cogito-sum-Formel die unmittelbare Existenzgewissheit an das Gefühl.221 Zu nennen sind etwa Hamann, Herder und nicht zuletzt Jacobi, welcher damit stark auf Novalis, Friedrich Schlegel und andere Zeitgenossen gewirkt hat.222 Fraglos gewiss könne nichts im Denken sein, sondern nur im sinnlichen Gefühl, das präintentional nur die Existenz selbst anzeige. »Gefühl« meint hier also keine wahrnehmungsähnliche Empfindung, sondern eher eine Art »Grund-« oder »Hintergrundsinn«. Zwar wurde dies Selbstgefühl häufig als eine Art »innere Selbstbeobachtung« interpretiert, was dieselben Reflexionsprobleme mit sich bringt wie bei Damasio,223 bisweilen aber auch als unmittelbare Selbstvertrautheit, die gerade keiner Reflexion bedürfe. Anders als beim Zeitgenossen Fichte, der die Probleme des Reflexionsmodells auf dem Boden einer egologischen Theorie zu überwinden suchte, sehen wir auch hier nicht-egologische Theorien am Werk. Es setzt sich nicht wie bei Fichte ein Ich schlechthin als sich selbst in reiner Aktivität, sondern was wir Ich nennen, beruht – so bei Novalis – auf einem rezeptiv gewahrten Selbstgefühl, auf dessen Grundlage erst durch Reflexion ein Ich, als »mittelbares Ich«224 gegenüber dem unmittelbaren Selbstgefühl sich erhebt.225 Jacobi spricht ebenfalls vom »Selbstgefühl«226, denn »von unserem eigenen Daseyn« hätten wir »nur ein Gefühl; aber keinen Begriff«. Er plädiert daher auch für die Ersetzung des Wortes »Bewusstsein« in diesem Zusammenhang. Dieses »scheint etwas von Vorstellung und Reflexion zu involvieren, welches hier gar nicht statt findet«. Die Abwesenheit solcher Mittelbarkeit und Begrifflichkeit lasse sich besser als »sentiment de l’etre«, ein Seinsgefühl, bezeichnen, das Jacobi in seiner Funktion mit der transzendentalen Apperzeption Kants gleichsetzt.227 Deren Aporie war ja, dass man sich dieses Bewusstseins unmöglich bewusst werden, also nichts davon wissen konnte, es immer nur voraussetzen musste. Dieser Voraussetzung den Status der Unmittelbarkeit zuzusprechen, erlöst zumindest von diesem Problem. Wir wissen davon tatsächlich nichts, so Jacobi, der dies jederzeit 221 Vgl. die Rekonstruktion von Frank 2002. Vgl. Frank 2002, 77 ff. 223 Vgl. Frank 2002, 93 ff. 224 Vgl. Novalis 1795, 126. Zum Begriff der Mittelbarkeit vgl. Jacobi 1789, XXII. 225 »Selbstbewusstsein« wäre demnach zwar erst der Terminus für die reflektierte Version, dies allerdings eine bloß terminologische Frage. Auch Schmitz hatte ja erwägt, auf der Grund der unerwünschten Konnotationen nicht mehr Selbstbewusstsein zu sagen und von Mir-Selbst, Mir-Subjektivität usw. gesprochen, damit aber jedenfalls schon ein vollwertigen Kandidaten dessen, wonach wir hier suchen, gemeint. 226 Jacobi 1789, 61. Zum Verhältnis von Jacobi und Novalis vgl. Koch 2004. 227 Alle Zitate: Jacobi 1789, 105. Schon Kant hatte diese einmal als »Gefühl eines Daseins« (Kant 1783, § 46) erläutert. 222 87 allerrealste Faktum, dass wir selbst etwas sind, für unbegreiflich erklärt.228 Das Selbstgefühl lasse sich nicht erklären, hinter seine Faktizität nicht nochmals zurückgehen. Bei Schmitz gibt es kein eigenes solches Gefühl. Bei ihm ist aber gewissermaßen jedes »affektiv betreffende« Gefühl (als leibliche Regung) derart, dass es ein unreflektiertes »MirSelbst« im Modus des Gefühls mitliefert. Bevor wir Schmitz Theorie selbst kritisch beleuchten ist hier zunächst nur zu bemerken, dass dies eben behandelte Selbstgefühl ein Gefühl sui generis, also nicht einfach wie bei Schmitz mit bestimmten ausgezeichneten Affekten identisch ist. Es ist daher auch nicht nur im Augenblick des abstandslosen »Selbstbewusstseins ohne Selbst«, sondern eine dauerhafte Grundlage, während es bei Schmitz (und Damasio) immer wieder neu entstehen muss. Zudem ist es natürlich ganz anders als bei diesen als metaphysische Größe ausgezeichnet, und wird keineswegs als empirisches Phänomen (Schmitz) oder Ergebnis unbewusster (Hirn-)Vorgänge (Damasio) ausgegeben. 3. Selbstbewusstsein und Sprachanalyse – Tugendhat Analoge Unterscheidungen wie die von Schmitz in Selbstbewusstsein mit und ohne Selbstzuschreibung finden sich auch bei zahlreichen anderen Autoren, etwa den eben behandelten. Man spricht dann etwa von intentionalem und zuständlichem, begrifflichem und nichtbegrifflichem, propositionalem und nichtpropositionalem, repräsentationalem und phänomenalem Selbstbewusstsein.229 So wird auch in der nun zu behandelnden analytischen Philosophie unterschieden, die aber auch noch einen weiteren Anknüpfungspunkt an das Vorausgegangene zu haben scheint; zwischen der eben behandelten Affektivität und der Aufhebung der Subjekt-Objekt Trennung durch Analyse propositionaler Gehalte scheint es einen Zusammenhang zu geben: »Unter Selbstbewusstsein verstehen die meisten Autoren der sprachanalytischen Philosophie das spezifische Wissen, das begriffsverwendende Wesen über ihre eigenen Bewußtseinszustände besitzen und in Sätzen des Typs ›Ich weiß, daß ich Schmerzen habe (etwas Rotes sehe etc.)‹ aussprechen können«.230 Die Beispiele in diesen Diskursen sind in der Tat immer wieder solche, die Affektivität einschließen, da es Beispiele für mentale Phänomene sein sollen, die man sich nicht erst zuschreiben muss, sondern unmittelbar als die seinigen hat. Sie drücken eine »Letztheit, die nicht in die zwei Faktoren des Gegenstandes des Subjektsausdrucks und des Prädikats auseinandergenommen werden 228 Jacobi 1789, 28. Vgl. Krämer 1996, 11 f.; die Unterscheidungen sind Freilich jeweils etwas unterschiedlich akzentuiert. Die »klassischen« Termini »Reflektiertes« und »Unmittelbares« gehören ebenso hierher. Auch Heideggers Termini Zuhandenheit und Vorhandenheit weisen, eingedenk der Tatsache, dass dieser bewusst fast alle vorher genannten Begriffspaare vermeidet (das gilt aber auch für Schmitz), Ähnlichkeiten auf. 230 Heckmann 1995, 371. Natürlich gibt es nicht »die« analytische Philosophie. Einen guten Überblick über sehr verschiedene und teils sehr avancierte Ansätze gibt Frank 1994 und 2007. 229 88 kann«,231 aus. Soweit sieht es ganz nach einer Spielart des schon bei Schmitz beobachteten Versuchs aus, im Rahmen einer Sachverhaltsontologie durch Rückgang auf ein präpersonales Selbstbewusstsein die scheinbar alle Selbstbewusstseinstheorien vereitelnde Subjekt-ObjektRede und damit die »subjektphilosophische« Theorietradition nicht-egologisch zu überwinden. Wir sehen uns Gemeinsamkeiten und Unterschied zu Schmitz an, indem wir Ernst Tugendhat heranziehen, der sich nicht nur als einflussreicher deutschsprachiger Vertreter der sprachanalytischen Herangehensweise ans Selbstbewusstsein, sondern auch deswegen anbietet, weil Schmitz sich explizit mit ihm auseinandergesetzt hat, womöglich sogar implizit von ihm beeinflusst ist: Schmitz’ Rezension von Tugendhats Buch zum Thema232 scheint eine Schlüsselstellung in der Genese seiner eigenen Anschauung zu besitzen. Er schreibt dort, Selbstbewusstsein solle bei Tugendhat »nicht mehr als reflexive Relation verstanden werden, zu der eine Subjekt-Objekt-Identität gehören würde« (1982, 131). Dies ist jedoch kein Lob, sondern hier noch in kritischer Absicht vorgetragen, da er selbst zu diesem Zeitpunkt Selbstbewusstsein noch als Subjekt-Objekt-Identität auffasst. Nun haben wir gesehen, dass sich dies inzwischen geändert hat. Der Gegenstand der damaligen Kritik ist inzwischen exakt seine Ansicht: Selbstbewusstsein ist in seiner präpersonalen Grundform keine reflexive Relation, keine Subjekt-Objekt-Identität.233 Kommen wir aber zu Tugendhat selbst. Dieser erblickt in älteren Herangehensweisen an Fragen des Selbstbewusstseins Missverständnisse, die daher rühren, dass »die Wissens- und die Identitätsrelation ineinandergeschoben werden«,234 die er mittels Sprachanalyse zu entflechten gedenkt. Für die Frage des Wissens sei allein die Eigenschaft des Sprechenkönnens relevant. Hier sei erstens zu bemerken, dass man sich bestimmte psychische 231 Tugendhat 2005, 249. Tugendhat 1979. 233 1982 kann er sich dies noch nicht vorstellen, befindet sich aber sichtlich schon im Übergang zur späteren Meinung, die er spätestens 1990 vertritt: Er geht dann kurzfristig sogar so weit, vom »Scheinproblem der Selbstzuschreibung« (1990, 201) zu sprechen, was er später wieder zurücknimmt, wenn er nur noch die Paradoxie der Zweieinigkeit als Scheinproblem bezeichnet (vgl. z.B. 1999a, 192 f.). 1982 jedenfalls beschreibt er Selbstbewusstsein noch als »Anerkennung des Sachverhalts, daß es mit dem Objekt identisch ist, durch das Subjekt« (1982, 135). Zwar sieht er bereits, dass dies das Selbstzuschreibungsproblem nicht umgeht, da dies Anerkennen die Funktion der Zuschreibung übernimmt (vgl. 1982, 137 f.); auch spricht er von den subjektiven Tatsachen des affektiven Betroffenseins (vgl. 1982, 135 ff.). Er vermag dies allerdings noch nicht zu der späteren These zu verbinden, dies sei bereits Selbstbewusstsein, sondern bringt ein hochgradig seltsames Argument vor, dass tatsächlich eine Mittelstellung zwischen der Auffassung des Selbstbewusstsein als Anerkennung und als unmittelbarer Identität zu sein scheint: Er meint, Anerkennen sei identisch damit, mit dem Anerkannten tatsächlich identisch zu sein. Anerkennen scheint dann eine Art unbewussten Vollzugs zu sein, irgendwo zwischen Identifizierung und Identität (vgl. 1982, 138); später dann auch ein »Sicheinlassen auf etwas [...], das auch dumpf und unabsichtlich sein kann« (1982, 139). Da sich dieser Übergang von der einen zur anderen Position in der Tugendhat-Rezension abspielt, lässt sich womöglich auf eine Beeinflussung etwa betreffs des Terminus »Selbstzuschreibung« rückschließen. Die Propositionalitätsthese hat er allerdings nicht von Tugendhat selbst, sondern bereits 1967 von Paul Lorenzen übernommen (vgl. 1999a, 181 ff.; in Anwendung seit III.2 von 1969). 234 Tugendhat 1979, 58. 232 89 Prädikate nicht erst zuschreiben müsse, diese also nicht nach Art einer »inneren Wahrnehmung«, sondern unmittelbar habe, wie z.B. traurig sein, Schmerzen haben, etc. Wie bei Schmitz gibt es also nicht ein Ich und außerdem Schmerzen, die es sich nach Beobachtung oder gar Abwägung zuschreibt, sondern es gibt das Schmerzerlebnis, das unmittelbar jemandem angehört. Um sich dieses psychische Prädikat auch zuschreiben zu können, bedürfe es der Fähigkeit sprachlicher Bezugnahme. Diese werde intersubjektiv erlernt und schließe ein Verständnis indexikalischer Termini, also deren Situationsrelativität, ein. Als derart »kompetenter Sprecher« wisse man, dass »ich« das bezeichne, was andere als »er« bezeichnen: einen sprechenden Körper mit Raum- und Zeitstelle, eine Person.235 Demnach ist »ich« lediglich der Terminus, mit dem diese Person als kompetenter Sprecher einer Sprache zu verstehen gibt, was vor sich geht; durch Selbstzuschreibung bestimmter psychischer Prädikate, die nicht identifiziert werden müssen, weil sie unmittelbar »gehabt« werden, bringt sie Selbstbewusstsein zum Ausdruck: »Ich habe Schmerzen«. Sagt jemand anderes »Der da hat Schmerzen«, meint er dasselbe, bringt aber kein Selbstbewusstsein zum Ausdruck. Das ist alles. Tugendhat meint: Selbstbewußtsein ist nicht ein innere Reflexionsakt auf das sog. Ich, sondern erfolgt, indem ich meine bewußten Zustände – die Absichten, Gefühle usw. – mittels Prädikaten mir und damit einer Person zuspreche, die innerhalb des realen, objektiven Universums unterscheidbarer Gegenstände einer unter allen ist. In der klassisch-neuzeitlichen Tradition erschien das Selbstbewußtsein als Bewußtsein von sich im Gegensatz zu einem Bewußtsein von Objekten; [...] hier [...] ist jedoch mit ›bloßem Bewußtsein‘ nicht das Objektbewußtsein gemeint, sondern das vorsprachliche Phänomen, daß es mentale Zustände gibt, die lediglich die Eigenschaft des Bewußtseins haben, das noch kein Bewußtseinvon ist, und mit der prädikativen Sprache ergibt sich in eins ein Bewußtsein von anderen Objekten und von sich als einem Objekt unter anderen, beides im Zusammenhang eines Bewußtseins von einer objektiven Welt, in der sowohl ich wie die anderen Personen jeweils eine Stelle haben.236 Es lässt sich folgendes festhalten: Ganz wie bei Schmitz ist erstens personales Selbstbewusstsein bei Tugendhat etwas, das zugleich mit einer Welt eintritt, die sich durch Sprachfähigkeit, inklusive der Fähigkeit zur Selbstzuschreibung, eröffnet. Zweitens fassen beide solches Selbstbewusstsein als propositional auf. Es ist ein Phänomen nicht von Subjekten und Objekten, sondern von Sachverhalten. Anders als bei Schmitz will Tugendhat aber Selbstbewusstsein erst als das propositionale Bewusstsein von mentalen Zuständen gelten lassen. Diese Zustände selbst sind ihm noch kein Selbstbewusstsein, während bei Schmitz die subjektiven Tatsachen schon Selbstbewusstsein und auch schon propositional waren. Bei Tugendhat hingegen ist beides erst im Bezug eines Sprechers auf dieses »bloße Bewusstsein« gegeben. Tugendhat erachtet es ferner anders als Schmitz nicht für nötig, auf die eigentümliche Asymmetrie der Fremd- und Selbstzuschreibungen, die er durchaus 235 236 Vgl. Tugendhat 1979, z.B. 74. Tugendhat 2003, 28 f. 90 anerkennt,237 näher zu reflektieren: Während ich meine Zahnschmerzen unmittelbar habe, kann jemand anderes von diesen nur mittelbar, etwa durch mein verzerrtes Gesicht, wissen. Da Tugendhat nur auf der Sprachebene argumentiert, erscheint ihm die Relation des Sprechers zu seinen Schmerzen als ebenso wenig reflexiv wie die eines anderen der sagt: »Ich weiß, dass der da Schmerzen hat«: Beide beziehen sich nicht auf sich, sondern auf einen Sachverhalt. Selbstzuschreibung ist für Tugendhat daher auch gar nichts prinzipiell Verschiedenes von Fremdzuschreibung. Dass aber für beides die Identität des jeweiligen Sprechers conditio sine qua non ist, interessiert ihn nicht weiter. Dann ist aber das Hauptproblem der Frage nach dem Selbstbewusstsein ausgeklammert, das ursprüngliche »Mitsichvertrautsein«, das sich als Identität des Sprechers mit dem, worüber er in diesen unmittelbar gewissen Sätzen spricht, ausdrückt.238 Da Sätze wie »Ich weiß, dass ich Schmerzen habe« den Bezug eines Sprechers auf sich beinhalten, drücken sie durchaus eine reflexive Relation aus. Würde der Satz keine reflexive Relation zum Ausdruck bringen, gäbe es keinen Grund, den Sprecher mit dem Schmerzhabenden für identisch zu halten. Das Problem eines solchen »Sprachidealismus«239 ist also, dass er nicht »tief« genug ansetzt. Die präpersonale Dimension (sei sie schon selbstbewusst oder nicht) kann so nur konstatiert, aber weder näher aufgeschlossen noch in ihren Zusammenhang mit dem personalen Selbstbewusstsein deutlich gemacht werden. Die Hypostasierung der satzförmigen, propositionalen Rede und deren intersubjektive Sinnkonstitution befreien nur vermeintlich vom Subjekt-Objekt-Gegensatz. Die Sprachanalyse vergisst über zu viel Sprache hinweg den Sprecher, der doch nicht nur ausführen kann, was die Sprachstruktur ihm an Regeln vorgibt, sondern diese auch missachten und verändern kann und sie nicht zuletzt verstehen können muss. Dazu muss er aber selbst etwas und jemand sein. Sein Subjekt- und Sprechersein, sein Selbstverständnis und -verhältnis ist aber nicht durch den Verweis darauf, dass er mit dem 237 vgl. Tugendhat 1979, 89. Er spricht von einer »epistemischen Asymmetrie«, bei einer »veritativen Symmetrie« der beiden Perspektiven. 238 Tugendhat gibt spät zu: »Ich hätte vielleicht hinzufügen sollen: ›und wie das zu erklären ist, weiß ich nicht‹« (Tugendhat 2005, 249). Sollte dies wirklich auch schon früher seine Ansicht gewesen sein, wäre ihm freilich nicht vorzuwerfen, dass er dafür keine Erklärung liefert. Seltsam ist es aber doch, mit einem Buch gegen eine mächtige Tradition von Selbstbewusstseinsauffassungen aggressiv anzutreten und dann dasjenige Problem, um das es dieser wesentlich ging, einfach unter den Tisch fallen zu lassen (vgl. für teils ähnliche Kritiken an Tugendhat: Henrich 1989; Frank 1991a, bes. 252 ff., 410 ff.). Im selben Maße unbefriedigend bleibt die Position von Michael Pauen: »Das eigentliche Problem besteht also nicht darin, daß meine Schmerzen meine sind, sondern vielmehr darin, daß es Schmerzen gibt, die nicht meine Schmerzen sind. [...] Da ich meine Zustände ja immer schon de facto als meine erfahre, hängt das explizite Bewußtsein, daß ich es bin, der diese Empfindung hat, von der Unterscheidung zwischen meiner Perspektive und der Perspektive eines anderen empfindungsfähigen Wesens ab: Daß ich es bin, heißt eben nicht zuletzt, daß es nicht jemand anders ist« (Pauen 2000, 110 f.). Wie Tugendhat verschiebt Pauen die Frage auf die intersubjektive Bezugnahme auf sich, als auf Einen unter Vielen. Was Pauen als Faktum, »als unmittelbare, faktisch bestehende Bekanntschaft« (ebd., 110 Fußnote) bloß hinnimmt, ist aber das Fragliche: »Das eigentliche Problem« besteht ebenso sehr darin, dass meine Schmerzen meine sind, und nicht bloß darin, dass ich sie mir zuschreiben kann. 239 Vgl. Frank 1991a, 421. 91 Indexwort »ich« eben auf sich als raumzeitliches Individuum verweist, beantwortet, da die Identität dieses objektiv identifizierbaren Individuums nicht nur mit dessen identifikationsfreier Bezugnahme, sondern auch mit ihm als Sprechendem ungeklärt bleibt. Die reflexive Relationalität verschwindet nicht dadurch, dass man dem Bezugsgegenstand den Charakter der Unmittelbarkeit zuspricht, ihn für die Möglichkeit der (sprachlichen) Bezugnahme unter der Hand in eine Proposition verwandelt und die Identität des beziehenden Sprechers damit in die eines bloß noch Wissenden uminterpretiert, dessen Wissen kontingenterweise in diesem Falle unfehlbar sei. Tugendhat fragt zweifach nicht nach der Identität im Selbstbewusstsein, die Schmitz interessiert: Einmal nicht beim Präpersonalen, das er gar nicht für Selbstbewusstsein hält, und ein andermal nicht beim Personalen, dessen in der Selbstzuschreibung enthaltene Identität mit dem präpersonalen »bloßen Bewusstsein« er nicht thematisiert, sondern voraussetzt. Schmitz teilt zudem dessen Hypostasierung der Sprache nicht, weil seine Sachverhalte betonter Maßen vorsprachlich sind. Gemein hat er allerdings mit ihm die Absicht, durch die Rede von Selbstzuschreibung und einer dieser vorausgehenden nicht weiter zerlegbaren »Letztheit« – bei ihm die Phänomene des affektiven Betroffenseins – den Subjekt-Objekt-Dualismus zu überwinden, Selbstbewusstsein propositional, nicht-egologisch und nicht mehr als reflexive Relation zu bestimmen. Dabei ist Schmitz, mag man seine Antworten plausibel finden oder nicht, wesentlich problemsensibler als Tugendhat. 92 Dritter Teil: Zwischen Unmittelbarkeit und Reflexion – Kritische Auseinandersetzung mit Schmitz’ Theorie des Selbstbewusstseins Verdienste und Verirrungen der sowohl betreffs des Selbstbewusstseins als auch darüber hinaus ausführlich behandelten Theorie von Schmitz sollen uns nun beschäftigen. Dabei ist durchweg eine immanente Kritik beabsichtigt. Nicht von außen sollen Forderungen an die Theorie herangetragen, sondern ihre immanenten Voraussetzungen sollen auf ihre Konsistenz in der Durchführung und auf ihre Durchführbarkeit hin überprüft werden. Zunächst (Kap. VIII) behandeln wir Probleme des präpersonalen Selbstbewusstseins bei Schmitz und ihm ähnlichen Konzeptionen einer Unmittelbarkeit im Selbstverhältnis, die sich als weniger reflexionslos herausstellen werden als beabsichtigt. Die Nachträge innerhalb der Schmitzschen Theorieentwicklung selbst zeigen die Problematik einer bloß unmittelbaren »Identität im Augenblick«. Ferner scheint dies Selbstbewusstsein in seiner Relations- und Reflexionslosigkeit unterbestimmt, was sich ebenfalls anhand der Überlegungen, die Schmitz selbst anstellt, deutlich machen lässt. Schließlich (Kap. IX) werden weitere methodischbegriffliche Probleme mit Schmitz’ Konzeption des personalen Selbstbewusstseins als ambivalenter Mannigfaltigkeit und des Prinzips Gegenwart als unerreichbarem Extrem behandelt, die sich auf die Unterbestimmung des »Denkens« bei Schmitz zurückführen lassen. Abschließend (Kap. X) wird all dies zusammengeführt und nochmals explizit auf die durchwegs thematischen Paradoxien des Selbstbewusstseins bezogen. * Zunächst sei auf Schmitz’ Verdienste hingewiesen. Seine Theorie der subjektiven Tatsachen, sein Plädoyer für die Wiederbesinnung auf das Leibliche und das Affektive sowie sein »identitätskritischer« Blick für nicht eindeutig festlegbare Phänomene sind für sich betrachtet nicht nur überzeugend, sondern zum Teil auch innerhalb der Geschichte der Philosophie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als sehr innovativ zu bezeichnen. Wie man subjektives Erleben in ein naturwissenschaftlich objektiviertes oder auch nur komplett intersubjektiv zugängliches Weltbild integrieren können sollte, ist in der Tat nicht zu sehen. Was Schmitz unter subjektiven Tatsachen fasst, sorgte auch in der analytischen Philosophie mit einiger Verzögerung für rege Diskurse, die aus deren stark naturwissenschaftlicher Prägung erwachsen. Um den Punkt, den wir als Meinigkeit bezeichnet haben, macht Schmitz sich also betreffs des Selbstbewusstseins verdient. Auch seine Auseinandersetzung mit den Gefühlen weist ihm eine Vorreiterrolle zu. Gefühle spielen im philosophischen Diskurs erst seit ein bis zwei Jahrzehnten wieder eine größere Rolle. All dies hat Schmitz bereits in den 60er Jahren beschäftigt. Interessant ist Schmitz zudem als jemand, der sich auf nicht bloß strikt sprachanalytische Weise mit Phänomenen der Deixis auseinandersetzt, nicht bloß ihre 93 sprachstrukturinterne Bedeutung, sondern ihren Sitz im Leben thematisiert. So ist auch ganz generell – und trotz oder gerade wegen allen Lächelns, das eine solches Interesse bei vielen »Denkbeamten« hervorrufen mag – sein Insistieren auf einer Thematisierung der »unwillkürlichen Lebenserfahrung« positiv hervorzuheben; dies gilt auch dann noch, wenn – anders als er glaubt und wie wir gleich sehen werden – sich so nicht alle Probleme lösen lassen. Mag die genannte Vorreiterrolle auch für die Theorie des Leiblichen nur eingeschränkt gelten, so hat Schmitz doch auch hier entscheidende Beiträge zu verzeichnen.240 Eine Besinnung auf leibliche Phänomene macht in der Tat deutlich, dass sie einen Bereich sui generis gegenüber der üblichen Aufteilung in Körper und Seele bilden. Dies und zahlreiche weitere Elemente dessen, was wir als seine Kulturkritik der »Gegenwartsvergessenheit« bezeichnet haben, kann man bei Schmitz – aber freilich nicht nur dort – lesen und sich zur Besinnung empfehlen lassen. Zu guter Letzt hat Schmitz die Paradoxie der Selbstzuschreibung bzw. Reflexion früh erkannt, sie treffend und noch vor Henrich beschrieben. Seine Folgerung, dass wir eine andere Quelle der »Ich-Identität« bzw. »Selbsthaftigkeit« (die man beide anders formulieren müsste) benötigen, wenn Selbstbewusstsein möglich sein soll, ist konsequent und überzeugend – auch unabhängig von seinem konkreten Lösungsansatz, den wir nun kritisch betrachten werden. VIII. Probleme mit der Unmittelbarkeit 1. Identität auf der Spitze des Augenblicks Die Spitze des Augenblicks, die Identität des im selben Augenblick gegenwärtigen Erlebnisses trägt also die gesamte Last der Beweisführung. (Derrida, Die Stimme und das Phänomen) Angesichts der aufgezeigten Mängel des Reflexionsmodells spricht einiges dafür, Selbstbewusstsein in einer unmittelbaren, d.h. präreflexiven, »Selbstvertrautheit« zu fundieren. Wir haben dieses Theoriemodell auch als nicht-egologisch bezeichnet. Solche Theorien sind eine Antwort auf die schwer begreifbare Selbstbezüglichkeit im Selbstbewusstsein, welche sie deswegen aus dessen Begriff fernzuhalten gedenken. Deswegen müssen sie das Identitätsbewusstsein jenseits jeder Relationalität verorten. Hier sind u.a. Schmitz’ Position zu subsumieren, die eines Selbstgefühls (Kap. VII.2) sowie die betreffs des Modus unbestimmte von Frank. Letzterer schreibt: »Unter Selbstbewusstsein verstehe ich die unmittelbare (nicht-gegenständliche, nicht-begriffliche, nicht-propositionale) 240 Vgl. Gahlings 2008. 94 Bekanntschaft von Subjekten mit sich«.241 Als Reaktion auf das Reflexionsmodell scheint, will man Selbstbewusstsein nicht schlichtweg leugnen (Kap. III.2) oder zur »Weltstruktur« erheben (Kap. VII.1), gar nichts Anderes übrig zu bleiben, als die vollständige Vermeidung jedweder Rede von einem Subjekt-Objekt-Verhältnis, von Relationalität, Gegenständlichkeit, Begrifflichkeit, etc. Doch bringen auch nicht-egologische Ansätze prinzipielle Probleme mit sich. Wir untersuchen zunächst, wie sich bei Schmitz selbst solche zeigen und betrachten dann nicht-egologische Theorien im Allgemeinen. Was Schmitz angeht, ist erstens fraglich, ob die subjektiven Tatsachen ausschließlich an Phänomene der Affektivität und Leiblichkeit gebunden werden können und diese so bestimmten dann zweitens als alleinige Quelle der Ich-Identität (als Mir-Identität) hinreichen. Erstens ist unklar, wieso es nicht eine subjektive Tatsache sein sollte, dass ich jetzt denke. Das kann ebenso wenig jemand Anderes unter Erhalt der Bedeutung aussagen wie, dass ich jetzt traurig bin. An der Subjektivität dessen ändert auch nichts, dass ich denkend Distanz einnehmen kann und dies in tiefer Traurigkeit nicht möglich sein mag.242 Als phänomenale Beschreibung bleibt nämlich richtig, dass wir uns auch im Denken und Wollen de facto selbst bei erheblicher Distanzierungsleistung vom Leiblichen als uns selbst erleben. Dies gilt auch dann noch, wenn dieser Sachverhalt einer Erklärung durch gelegentliches affektives Betroffensein bedürfen sollte, wir uns also nur deswegen denkend als identisch erleben, weil wir auch affektiv involviert sind oder werden können. Dies Affektive ist aber zweitens ebenso problematisch: Zwar ist es bestimmt richtig, dass heftige Affekte besonders »individuierend« wirken: Wem Verlust seiner (Ich-)Identität droht, ritzt sich heutigentags nicht selten in die Haut – um sich zu spüren. Reflektieren scheint da oftmals nicht zu helfen. Auch erwacht man durch Schreck aus dösigen Zuständen und ist so plötzlich wieder bei sich. Aber können solche Phänomene zum Ursprung der faktisch erlebten Identität und somit des Selbstbewusstseins erklärt werden? Eher scheinen sie eine besonders augenscheinliche Aktualisierung eines ihnen strukturell Vorgängigen – worin auch immer bestehenden – zu sein, welches selbst für ihr Vorkommen schon vorhanden sein muss, aber in Schmitz’ Konzept »streng naiver« Phänomenologie nicht eingeholt werden kann. Dies zeigt sich in seiner Theorie selbst, etwa im Kontrast der Plötzlichkeit der von Schmitz herangezogenen Phänomene zum faktisch dauerhaften Identitätserleben. Da wir offensichtlich nicht ständig erschrocken o. Ä. sind, muss er eine Brücke von den extremen Phänomenen leiblicher Engung zum alltäglichen Leben schlagen. Sie erweisen sich als so flüchtig, dass unter der Hand die komplette leibliche Dynamik, also jede Art der Affektivität (und nicht nur 241 Frank 1991a, 7. In seinem Sinne können wir als weitere Charakterisierungen ergänzen: Nicht weiter analysierbar, nicht intersubjektiv erklärbar, nicht relational, kriterienfrei und nicht reflexiv (vgl. ebd. 5 f.). 242 Vgl. auch Spitzer 1991, 170 f. 95 die extrem engenden) zum »Selbstbewusstseinsgenerator« werden, weil Leiblichkeit durch eine Tendenz zur Enge ausgezeichnet sei, und somit »affektives Betroffensein [...] immer, wenn auch noch so leise, die primitive Gegenwart anklingen läßt, schon allein wegen der unvermeidlichen Beteiligung des vitalen Antriebs an leiblichen Regungen« (1999a, 78). Bereits dies vereitelt Schmitz’ ursprüngliche Intention. Diese war schließlich nicht, unsere leibliche Existenz würde uns per se zum Selbstbewusstsein verhelfen. Wieso sollte das auch so sein? Auf eine solche »verallgemeinerte« Leiblichkeit als Identitätsgarant läuft seine Argumentation aber hinaus: Es ist die Tatsache der leiblichen Dynamik aus Enge und Weite, mit besonderer Auszeichnung der Enge, welche die für das Selbstbewusstsein benötigte Identität gewährleistet. Diese Entfernung von der ursprünglichen Intention wird noch einmal dadurch gesteigert, dass nicht einmal dies leiblich-affektive Erleben selbst ständig vorhanden sein muss: Es müsse »nicht zu jedem Sichbewussthaben ein gleichzeitiges affektives Betroffensein« gehören. »Es genügt, wenn der Person durch ihr affektives Betroffensein die Perspektive für die Identifizierung von etwas mit ihr selbst geöffnet wird; sie braucht dieses Betroffensein nicht in jedem Moment deutlich mitzuführen« (2003a, 66). Hier scheint es – wie in Kants Rede vom »Ich denke,« das »alle meine Vorstellungen begleiten können« muss – nur noch um die Möglichkeit zu gehen, affektiv betroffen zu werden, nicht um dessen unmittelbar gegebene Wirklichkeit. Dann aber haben wir es bereits mit einer distanzierten Gestalt des menschlichen Lebens zu tun, damit dass wir zwar auch unausweichlich leibliche Wesen, nicht unwesentlich aber zur Distanz und Perspektive (vgl. Zitat) befähigte Personen sind, deren Selbstbewusstsein folglich nicht allein am Affektiv-Leiblichen zu haften scheint.243 Dies Unmittelbare, Präpersonale allein scheint als Garant für Identitätsbewusstsein nicht hinzureichen, sondern weist auf eine Quelle jenseits dessen hin. Wenn Schmitz schließlich von der »wichtigste[n] Gabe«, dem »Geschenk unwillkürlicher Identität« (1991, 163) spricht, meint er damit zwar den vitalen Antrieb mit Tendenz zur primitiven Gegenwart, die Formulierung klingt aber wie eine transzendente Gabe. Am Ende ist es die primitive Gegenwart, welche die Identitätsfunktion übernimmt und wie wir noch sehen werden, als Prinzip nicht immanent bestimmt werden kann. Dies ist ein prinzipielles Problem, das nicht nur bei Schmitz auftritt. So wie wir egologischen Theorien allgemein das Reflexionsproblem unterstellt haben, lässt sich vielen nicht243 Damit hängt auch die Diskussion um »Emotionslähmung« zusammen. Nach Schmitz’ Theorie dürften emotionsgelähmte Patienten keine »Bewussthaber« sein, weil dies nur durch Affektivität möglich ist, welche diesen Menschen abgeht. Er meint daher, ihr »Sichbewussthaben« bestünde dann nur noch »als Erinnerungsrest ohne Deckung durch die sinngebende Erfahrung fort« und dies sei »wohl nur für kurze Zeit möglich« (Brief). Diese Frage kann freilich nur empirisch geklärt werden. Auch hier sehen wir aber, dass es hochproblematisch ist, Selbstbewusstsein einzig an die Affektivität binden zu wollen. Emotionsgelähmte sind offenbar, ob für kurze oder lange Zeit, Bewussthaber ohne Affektivität. Sollte ihre Identität nun – so wie oben von der Eröffnung einer Perspektive die Rede war – in der Erinnerung bestehen, so befinden wir uns bereits auf der personalen Ebene. 96 egologischen das Identitäts- oder Einheitsproblem ankreiden.244 Wenn punktuelles Identitätsbewusstsein unter Fernhaltung jeder Art von Reflexion als Selbstbewusstsein gelten soll, stellt sich stets die Frage: Wie können die einzelnen unmittelbaren »Akte« dieses präreflexiven Selbstbewusstseins, mag ihnen synchron »analytische Einheit« auch zukommen, darüber hinaus diachron »synthetische Einheit« erlangen, wie können sie einem Subjekt zugehören? Auch das Phänomen der Meinigkeit wäre sonst nur punktuell, ein immer wieder Neues, kein dauerhaftes Erleben. Soll es Selbstbewusstsein gemäß nicht-egologischen Theorien nicht jeweils nur einen Moment lang, nur »auf der Spitze des Augenblicks« geben, »das bewußte Leben nicht auf einen Pointillismus unverbunden-einzelner Akte reduziert werden«, müsste »ein die einzelnen Akte übergreifendes Bewußtsein«245 eingeführt werden. Nimmt man ein solches als notwendige Bedingung für Selbstbewusstsein an, scheint man sich aber dem Reflexionsmodell hinzugeben: Selbstbewusstsein bestünde wieder in der Selbstzuschreibung dieses die einzelnen Punkte übergreifenden Subjekts. Schmitz wählt diesen Weg nicht: Auch personale Identität ist ihm lediglich eine des Augenblicks (vgl. 2008, 91 ff.). 2. Relationalität, Reflexivität, Reflexion Das Gefühl kann sich nicht selber fühlen. (Novalis) Ferner ist an nicht-egologische Theorien die Frage nach der Möglichkeit eines ganz beziehungslosen Bewusstseins zu richten. Hat die Formel »immer Bewusstsein von etwas« nicht doch ihre Berechtigung darin, dass wir uns »bloßes Bewusstsein« als solches und bloß punktuelles gar nicht vorstellen können?246 Faktisch scheint in jedem Bewusstsein ein Bezug enthalten und es somit nicht ganz einfach zu sein. Ein solches bloßes Bewusstsein lässt sich höchstens als notwendige Bedingung postulieren. Selbstbewusstsein scheint als absolut einfaches, gänzlich undifferenziertes schlicht falsch beschrieben zu sein. »Denn«, so meint Henrich, »in ihm fungiert immer schon der Gedanke des ›von mir selbst‹, der seinerseits bereits eine Komplexion aufweist«.247 244 In beiden Fällen soll das nicht heißen, jede solche Theorie müsse diese Probleme notwendig haben. Fichte versucht sich – wie erwähnt – an einer dem Reflexionsproblem gewachsenen egologischen Theorie. Auf nichtegologischer Basis mag es Konzeptionen von Unmittelbarkeit geben, die dem Einheits- und/oder anderen Problemen, die hier noch folgen, zu entgehen vermögen, da sie nicht bestimmte Einzelphänomene, sondern eine metaphysisch verstandene Grundlage beschreiben (Kap. VII.2). Zudem gibt es mindestens eine Theorie, die weder egologisch noch nicht-egologisch zu sein versucht: diejenige Hegels. 245 Frank 1991b, 562. 246 Vgl. Henrich 1970, 261 f. 247 Henrich 1999, 62. 97 Womöglich müssten wir uns dann im Rahmen der nicht-egologischen Theorien entweder von dem irreführenden Wort »Bewusstsein« verabschieden und etwa »Gefühl« einsetzen, wie Jacobi vorgeschlagen hat, oder von dem Wort »Selbst« und etwa »Mir« einsetzen. Es ist in der Tat unklar, mit welchem Recht Theorien der präreflexiven Selbstvertrautheit ihren Gegenstand noch »Selbstbewusstsein« nennen. Da nichts daran reflektiert, begrifflich oder wissentlich ist, entspricht das zumindest nicht unserem intuitiven Vorverständnis des Begriffs. Da ferner nichts daran »ichlich« oder explizit »selbsthaft« sein darf, gerät ein solches Verständnis wider Erwarten in die Nähe eines subjektivitätsüberwindenden »Seinsdenkens« etwa des späten Heidegger. Dieser schreibt: »Wir meinen zwar, ein Seiendes werde dadurch zugänglich, daß ein Ich als Subjekt ein Objekt vorstellt. Als ob hierzu nicht vorher schon ein Offenes walten müßte, innerhalb dessen Offenheit etwas als Objekt für ein Subjekt zugänglich [...] werden kann«.248 Ob man dieses vorgängig Offene als Lichtung, Erschlossenheit oder Ereignis249 des Seins oder des Selbstbewusstseins250 beschreibt, ist gar nicht mehr weit von einander entfernt und dies scheint auch einen Grund in der Sache zu haben: Sein ist ebenso wenig ein Prädikat (eine Zuschreibung) wie Selbstbewusstsein. Beides sind keine Eigenschaften von etwas; sie sind vielmehr immer »schon da«, wenn irgendetwas anderes ist: Beide bringen eine schwer fassbare, vorgängige Erschlossenheit zum Ausdruck.251 Nicht zufällig hat Schmitz beide in seinem Begriff der »primitiven Gegenwart« in Form des Seins- und des Ich-Moments vereint. Auch die sowohl in der Seins- wie in der nichtegologischen Selbstbewusstseinsphilosophie beliebte Metapher des Lichts rückt sie aneinander. Frank schreibt: »Ist Subjektivität nicht der helle Punkt, von dem aus sich Licht verbreitet über alle unsere Bezugnahmen auf Gegenstände und Verhältnisse der Welt?«252 So reden nicht nur Frank und Schmitz (vgl. III.2, 86); Heideggers »Lichtung« ist davon nur dadurch verschieden, dass er das Wort »Subjektivität« meiden würde. Wenn aber hier mit Subjektivität nicht mehr etwas gemeint ist, das reflexionsfähige Personen beinhaltet, scheint der Unterschied von dumpfem tierischem Dahinleben oder einer anonymen Seinsdimension erstaunlich gering zu sein. In beiden Fällen lässt sich schwerlich von Selbst im Bewusstsein sprechen. Es ist interessant zu sehen, wie sich angesichts dieser Relations- und Reflexionslosigkeit tatsächlich viele Vertreter eines präreflexiv-vertrauten Inneseins dazu genötigt sehen, in die unmittelbare Identität selbst schon eine Differenz, in die Einfachheit eine Relation, in das präreflexive Innesein doch eine Protoreflexivität einzutragen; so auch Schmitz, wie wir in 248 Heidegger 1940, 138. Vgl. z.B. Heidegger 1946 , 321. 250 Vgl. Formulierungen bei Henrich 1970, 277. 251 Vgl. Frank 1991b, 560. 252 Frank 1991a, 7. 249 98 Kap. VI.2 sahen: Schon im affektiven Betroffensein müssen wir trotz passiver Betroffenheit zugleich »anspringen« und aktiv-affektiv mitgehen. Es ist also selbst schon in sich differenziert, wenn auch nicht ausdrücklich als solches; es ist freilich keine Reflexion oder Selbstzuschreibung noch ein Subjekt-Objekt-Verhältnis gemeint, sondern eine unwillkürliche, »eigentümliche« Reflexivität, die noch ganz auf der präpersonalen Ebene statt hat. Solcherlei Binnendifferenzierung soll eine Art Protorelationalität bezeichnen, die nicht zwischen Einzeldingen, sondern zwischen unabgehobenen Bestandteilen einer Situation besteht.253 Doch ist nicht zu übersehen, welche theorieimmanente Rolle dies spielt: So werden Eigenschaften des personalen Selbstbewusstsein schon ins präpersonale eingetragen, um deren Vermittlung vorzubereiten und schließlich glatter von statten gehen zu lassen: Einmal sind beide schon durch instabile Mannigfaltigkeit ausgezeichnet und zum anderen ist die Reflexivität des affektiven Betroffensein gewissermaßen eine Vorstufe der ausdrücklichen Reflexion auf der personalen Ebene. Diese Tendenz der Unmittelbarkeitstheoretiker, für die Schmitz hier nur ein Beispiel darstellt, ist angesichts der Mängel des Reflexionsmodells überaus verständlich, vereitelt aber die Idee einer wahrhaft unmittelbaren Gegebenheit. Diese Problematik zeigt sich schön am eingangs zitierten Aphorismus: »Das Gefühl kann sich nicht selber fühlen«. Sofern es das aber nicht kann, muss es in sich differenziert sein, damit jemand es fühlen kann. Dann ist aber die Unmittelbarkeit so unmittelbar wieder verschwunden, wie sie prätendiert wurde. Dies machen selbst Formulierungen wie die oben zitierte von Frank einer »unmittelbaren Bekanntschaft von Subjekten mit sich« deutlich. Wie nämlich ist dieses »sich« hier zu interpretieren, wenn nicht als Reflexivität? Frank gibt somit selbst ein Beispiel für die von ihm kritisierte Theorie ab.254 Figal meint in diesem Sinne, die unreflektierte Selbstgenügsamkeit einer solchen unmittelbaren Selbstvertrautheit sei weder sinnvoller Weise als Selbstbewusstsein noch als dessen Grundlage zu beschreiben: »Das Innesein ist gleichbedeutend damit, ganz und gar in sich selbst zu ruhen – wie eine vor Wohlbehagen schnurrende Katze –, deshalb jedoch auch, wie zum Beispiel im Schmerz, ganz in sich und der andrängenden Umwelt gefangen zu bleiben. Zwischen Sein und Innesein gibt es keine Differenz«. In ihm besteht kein Anlass, der »zum Fragen und Nachdenken motivieren könnte«, so dass sich aus »dem Innesein [...] die 253 Schmitz verwehrt sich – aus verständlichen Gründen, aber entgegen jeder Plausibilität – dagegen dies als reflexive Relation zu bestimmen. Dies erscheine nur im Rückblick aus entfalteter Gegenwart so (vgl. 2004a, 50). Gerade die Verschränkung von »Anspringen« und »Mitnehmen lassen« hatte er doch als im Gegenstand selbst stattfindende Ambivalenz und nicht als nachträgliche Projektion ausgezeichnet. 254 Frank wirft anderen Positionen vor, was er in der genannten Formulierung selbst vollzieht: »Die Wiederkehr des Reflexivpronomens in diesen Formeln« – einer »Beziehung [...] eines Bewußtseins unmittelbar auf sich selbst« – »ist eine sichere Probe auf die Unhaltbarkeit des zugrunde liegenden Modells« (Frank 1991a, 29; vgl. für diesen Hinweis Koch 1994, 30). Was er offenbar meint, ist vielmehr, dass die Rede von »Beziehung« die Unhaltbarkeit des Modells zeigt. Tatsächlich fragt sich aber, ob nicht jede derartige (wohl nicht jede) Rede von »sich« eine Beziehung anzeigt. 99 entwickelten Formen des Selbstbewußtseins nicht erklären« lassen. »Dann spricht freilich auch nichts dafür, dieses elementare Lebensgefühl als Selbstbewußtsein oder auch nur als Grund für Selbstbewußtsein zu verstehen«.255 Wir sehen uns also nicht nur mit dem Problem eines Selbstbewusstseins Relationslosigkeit lassen ohne sich Selbst konfrontiert, entwickelte Formen sondern des angesichts Selbstbewusstseins, dieser die Reflexionfähigkeit etc. einschließen, nicht plausibel machen. Selbst wenn man die Eintragung der Reflexivität zugestehen würde, bliebe noch immer ein weiteres Problem: Wie kommt es von der Reflexivität zur Reflexion? Dies lässt sich ausgehend von der »primären Bedeutsamkeit« exemplifizieren, die wir in Kap. V.4 behandelt haben: Die Frage, wie ein Subjekt sich auf die Welt beziehen und wie sie ihm etwas bedeuten kann, wird von Schmitz in Heideggers Nachfolge dahingehend unterlaufen, dass Subjekte immer schon mit einer bedeutsamen Welt verwoben sind (»In-der-Welt-sein«). Bedeutung ist immer schon weltlich und keine nachträgliche, intellektuelle Projektion auf zuvor Gegebenes. Eingedenk der Tatsache, dass Heidegger de facto dem Weltverhältnis einen Vorrang vor dem Selbstverhältnis einräumt, wie schon die Rede vom »In-der-Welt-sein« anzeigt, kommt das Konzept unreflektiert-praktischer Selbstbestimmung des frühen Heidegger dem einer präreflexiven Selbstvertrautheit durchaus nahe. Doch schließt dieses Konzept lediglich eine unthematische und untheoretische Reflexivität ein, insofern er das menschliche Dasein für dadurch ausgezeichnet erachtet, »daß es ihm in seinem Sein um dieses Sein selbst geht [...] daß es sich in seinem Sein zu diesem Sein ein Seinsverhältnis hat«.256 So plausibel dies ist und dem einer bloß theoretischen und intentionalen Konzeption von Bedeutung anhaftenden Problem einer weltlosen Subjektivität begegnet, tritt die scheinbar nivellierte Differenz zwischen Subjekt und Objekt, Ich und Welt doch an anderer Stelle wieder auf: Bei der Frage der »sekundären« Bedeutsamkeit, der Reflexion, dem Wissentlichen, Begrifflichen. Bedeutung mag bereits primär sein, aber was unterscheidet sie von sekundärer, von verliehener Bedeutung, bewusster Bezug- und Abstandnahme von der Welt und sich selbst, die es doch offensichtlich auch gibt? Wie ist der Zusammenhang beider zu verstehen? Für Schmitz ist Reflexion im Anschluss an Heidegger ein »abkünftiges« Phänomen, dem eine Tendenz zur Vergegenständlichung innewohnt.257 Mag dies auch der 255 Figal 2001, 29. Figal erachtet auch Heideggers Konzept für unzulänglich (vgl. ebd., 15 f.), allerdings nicht aus dem eben genannten Grunde. Im Weiteren erachtet er diese Unzulänglichkeit des Unmittelbarkeitsmodells für ein Argument dafür, die Differenzeinheit von Unmittelbarkeit und Reflexion phänomenologisch als »Faktum des Selbstbewusstsein« (ebd., 34) schlicht hinzunehmen und mit Hegel zu beschreiben. 256 Heidegger 1927a, 12. 257 Vgl. für Heidegger: Figal 1996, 34. Schmitz nennt diese Vergegenständlichung »Explikation von Einzelnem«. Vgl. ferner Heidegger 1927b, 226: »Die Reflexion im Sinne der Rückwendung ist nur ein Modus der Selbsterfassung, aber nicht in der Weise der primären Selbst-Erschließung. Die Art und Weise, in der das Selbst im faktischen Dasein sich selbst enthüllt ist, kann man dennoch zutreffend Reflexion nennen, nur darf 100 Fall sein, so macht es doch nicht plausibel, wie sie überhaupt als solche möglich ist, wie es von unmittelbar selbstvertrautem Innesein zu einem reflektierten Wissen von sich kommen kann. (Ein solches leugnen wollen schließlich beide nicht.) In der Tat krankt Heideggers Konzept genau daran, das Verhältnis von ursprünglich-vorprädikativer Reflexivität zu ausdrücklich-prädikativer Reflexion oder zum bewussten Denken nicht deutlich machen zu können.258 Diese schlägt auf Schmitz durch, denn betreffs des präreflexiven Selbstbewusstseins, das ja selbst eine »primäre Bedeutung« ist, fragt sich, wie ein solcher »präkognitiver Geisteszustand eine Kognition auf den Plan rufen kann, die ohne Gehaltserweiterung zu einem Selbstwissen führt«.259 Würde es den Gehalt relevanter Maßen verändern, z.B. ihn als zunächst unbewussten erst bewusst machen, wäre das präreflexive kein Selbstbewusstsein, sondern erst das reflexive. Veränderte es ihn nicht, müsste er selbst ganz unbegrifflich sein und es fragt sich, wie er begrifflich, reflektiert als Selbstwissen überhaupt erfasst werden kann. Schmitz hat dies zu umgehen versucht, indem er das Phänomen des unmittelbaren Selbstbewusstsein als »quasipropositionale« Bedeutung aufgefasst hat. Der Weg zur und der Modus der ausdrücklichen, begrifflichen Propositionalität als etwas, also die Frage, wie Selbstzuschreibung möglich wird, verbleibt allerdings auch hier unklar. Halten wir fest: Das Bewusstsein droht zu schwinden, wenn Relationalität fehlt. Das Selbst droht zu schwinden, wenn Reflexivität fehlt. Beides wird de facto von Schmitz nachholend eingetragen und so die theorieimmanent benötigte Unmittelbarkeit vereitelt: Selbstbewusstsein ist nun doch als selbstbezügliches Phänomen bestimmt, wenn auch nicht als eins der Reflexion. Deren Rolle verbleibt vielmehr ebenso fraglich wie bei Heidegger. Beide tendieren dazu, die Rolle des »Denkens«, wie wir statt Reflexion auch sagen können, unterzubestimmen. Darauf wird nun noch näher einzugehen sein. man hierunter nicht das verstehen, was man gemeinhin mit diesem Ausdruck versteht: eine auf sich zurückgebogene Selbstbegaffung, sondern [...] sich an etwas brechen, von da zurückstrahlen, d.h. von etwas her im Widerschein sich zeigen«. 258 Vgl. Wetzel 1985, 85 f. Das zeigt sich schon an Heideggers Übergang vom zuhandenen »Um zu« der »Verweisung« zum vorhandenen »Für« des »Zeichens«, dessen Problematik er zu übergehen versucht, indem er den Zeichenbegriff erweitert, schon der Zuhandenheit Zeichencharakter zuspricht (Heidegger 1927a, § 17). Das ändert aber nichts am Problem, wie es von unreflektierter Zeichenhaftigkeit zu reflektierter kommt. 259 Frank 2002, 256. Frank bemerkt dies betreffs des Konzepts von Novalis, der als Vertreter eines nichtegologischen Modells mit demselben Problem kämpft. 101 IX. Probleme mit Schmitzschen Begriffen und Methoden Die ertrinkende Phänomenologie sucht mit ihrem eigenen Wesenszopf sich aus dem Sumpfe des verachteten blossen Daseins zu ziehen. (Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie) 1. Ambivalente Mannigfaltigkeit Der Bezug zwischen Unmittelbarkeit, Reflexivität und Reflexion war bei Schmitz noch in einer anderen Weise fraglich als der eben behandelten. Kap. VIII führte von der Unmittelbarkeit sukzessive zu immer mehr Reflexion, bei welcher wir nun angekommen sind und die uns nun unter dem Begriff »Denken« weiter beschäftigen wird. Die instabile Mannigfaltigkeit benutzt er nicht nur, um das präpersonale durch Reflexivität bereits zum vollen Selbstbewusstsein zu machen (Kap. VI.2), sondern um dieses mit dem personalen zu vermitteln, die Einheit beider plausibel zu machen (Kap. VI.1). Wir haben Schmitz’ Logik der unendlichfachen Unentschiedenheit mit Hegel konfrontiert, um auf die Ähnlichkeiten der beiden Ansätze in ihren Versuchen, dem Selbstbewusstsein durch Reinterpretation des Verhältnisses von Identität und Verschiedenheit habhaft zu werden, hinzuweisen und so Schmitz’ Ansatz besser einordnen und verstehen zu können. Er führt unter Einführung neuer logischer Kalküle präzise aus, dass seine Logik anders als Hegels Dialektik widerspruchsfrei möglich ist. Ob er damit recht hat oder nicht, sei dahin gestellt. Wichtiger ist, dass er sich damit auf der Ebene des Denkens befindet.260 Zwar versteht er Denken als »Besinnung« auf in unwillkürlicher Lebenserfahrung Erlebtes, doch was Schmitz von unendlichfacher Unentschiedenheit zu berichten weiß, hat mit solch unmittelbar Erlebbarem nichts zu tun. Schmitz gibt selbst zu, dass ihm dafür kaum ein Beispiel einfällt.261 Wie könnte sich auch der unwillkürlichen Lebenserfahrung etwas Unendliches zeigen? Spätestens beim personalen Selbstbewusstsein wird also das Verhältnis von (phänomenologischer) Beschreibung von Erlebtem und (logischer) Erklärung bzw. 260 Was Denken sei, ist alles andere als klar. Vielleicht lässt sich das immanent, im Denken selbst, auch gar nicht beantworten. Ebenso unklar ist seine Rolle in Schmitz’ Theorie. Er hält den Begriff des Denkens für so unbestimmt, dass er ihn zumeist lieber vermeidet. In seinem 5000seitigen »System«, in dem eigentlich alles behandelt wird, gibt es keinen Abschnitt über das Denken. Der Band über »Die Person« (IV) sowie ein zugehöriger Teil eines anderen Bandes (III.4, 3. Kapitel) enthalten viel über Emanzipation und Regression, Lachen und Weinen, Wahrheit und Kategorien, Bedeutungen und Rede, usf. Das Denken hingegen kommt nur indirekt in dem Kapitel »Denken in Situationen« (IV, 373) vor, das Intuition, Gespür u.ä. behandelt. Die Relevanz all dessen sei unbestritten. Das Denken als tatsächliches Nachdenken, als Explikation, Rechenschaft und Kritik ist bei Schmitz systematisch aber ebenso unterbewertet wie bei Heidegger, der erst spät überhaupt von »Denken« spricht und dann »Vernehmen« meint. Nur in einer einzigen Veröffentlichung von Schmitz (1968, 23 ff.) finden sich vier dem Thema gewidmete Seiten. (Schmitz’ unklares Verhältnis zum Denken wird auch kritisiert in Christians 1998, der zum Teil aber andere Schwerpunkte legt.) 261 Vgl. 2008, 126 f. Für einfache Unentschiedenheit gibt Schmitz phänomenale Beispiele an: das Kapieren von Witzen etwa, bei dem man zugleich verblüfft und »entblüfft« sein müsse, damit die Pointe zünde oder Ambivalenzen in der Dingwahrnehmung (vgl. 2008, 117 ff.). 102 Konstruktion unklar. Die Logik der unendlichfachen Unentschiedenheit ist keine bloße Beschreibung des Phänomens, dass wir uns als selbstbewusste Personen erleben, sondern ein kompliziertes logisches Konstrukt, das den Sachverhalt erklären soll.262 Das wäre an sich nicht problematisch, sofern man, wie etwa Hegel, dem Denken und der Reflexion eine die Unmittelbarkeit und das Erleben übergreifende und sie sogar modifizierende Rolle zuwiese. Schmitz allerdings ist davon weit entfernt. Denken im Sinn des Reflektierens ist ihm wie Heidegger, der auch lieber von »Besinnung« spricht, ein sekundäres Phänomen. Auch beruft er sich immer wieder auf Hume und dessen Methode, die impressions hinter den ideas aufzufinden. Das verpflichtet ihn keineswegs auf empiristische oder nominalistische Verkürzungen, wie schon seine Ontologie der Situationen und überdies seine Annahme vorbegrifflich wahrnehmbarer Gattungen (vgl. 1990, 102 ff., 182 ff.) zeigt, bindet ihn aber doch hintergründig an das Dogma, über nichts »bloß Konstruiertes« zu philosophieren und das Denken an den Phänomenen der »unwillkürlichen Lebenserfahrung« zu eichen. Man solle, meint er, »die Empirie nicht mit falscher Metaphysik vernebeln« (1999a, 180). Auf diesem Wege war schon Hume daran verzweifelt, kein Selbst auffinden zu können (vgl. Kap. III.2). Dass wir eine idea von uns haben, aber gerade keine impression, ließ sich auf der Grundlage seiner Philosophie nicht verstehen. Wie sollte aber auch, hätte Kant transzendentalphilosophisch entgegnet, die Bedingung der Möglichkeit von impressions selbst ein impression sein?263 Zwar sucht Schmitz, gemäß der Humeschen Forderung und entgegen Kants Einwand, eine Grundlage auch dieser idea in der unwillkürlichen Lebenserfahrung und findet sie in bestimmten Phänomenen, die er als unmittelbares Selbstbewusstsein kennzeichnet. Das Problem des Zusammenhangs dessen mit personalem Selbstbewusstsein aber, so scheint es, kann auch Schmitz nur durch eine der impression harrende idea, den Begriff des instabilen Mannigfaltigen lösen, also (konstruktiv) denkend und ohne Grundlage im erlebten Phänomen.264 Eine Logik der unendlichfachen 262 Vgl. auch Christians 1998, 171: »der Begriff der ›instabilen Mannigfaltigkeit‹ ist konstruiert und nicht erlebt«. Das unklare Verhältnis von Deskription und Konstruktion wird auch kritisiert von Rentsch 1993, 127. 263 Vgl. Kant, KrV, B 1. 264 An dieser Stelle ist noch ein Ausweg zu erwägen, der diese Kritik der falschen Voraussetzung, Denken müsse immer bewusst sein, bezichtigen könnte. Kann Schmitz’ Konstruktion des Selbstbewusstseins als Ambivalenz nicht die Explikation eines latent, implizit oder unbewusst ablaufenden Prozesses sein? Diese Erwägung stellt Pothast an, aber nur als Argument dagegen, sich mit einer früheren Version der Schmitzschen Konzeption einer Unendlichkeit im Selbstbewusstsein überhaupt näher zu befassen: »Diese These erscheint mir so fragwürdig, daß ich davon Abstand nehmen möchte, sie ausführlich zu kritisieren« (Pothast 1971, 23). Schmitz spricht bezüglich dieser frühen Version tatsächlich davon, dies müsse »latent oder unbemerkt vollzogen werden« (I, 276). Ob er dies auch für die spätere Konzeption der instabilen Mannigfaltigkeit erwägt, wird zwar nirgendwo deutlich. Als etwas dem Unbewussten Ähnliches hatten wir aber in Kap. V.5 die persönliche Situation in ihrer chaotischmannigfaltigen Ganzheit ausgemacht, aus der sich in beständiger Explikation und Implikation bewusstes Denken abhebt und wieder versenkt. Gemäß diesem Muster gedacht wäre Selbstbewusstsein deswegen so schwer zu verstehen, weil wir immer bloß beschrieben, was uns zu Bewusstsein käme, und dort alles identisch und verschieden zu sein schiene, während es sich eigentlich ganz anders verhielte, nämlich unendlichfach unentschieden zwischen beidem. Hier zeigt sich allerdings, dass man Unbewusstes nur dann sinnvoll postulieren 103 Unentschiedenheit aber ohne Verankerung auf der unmittelbar phänomenalen Ebene ist von einer spekulativ-logischen Konstruktion nicht eben weit entfernt. Dies zeigt sich auch daran, dass Schmitz ebenso wie Hegel auf den Begriff der Unendlichkeit Rekurs nimmt, die kaum als alltägliches Phänomen der Lebenserfahrung zu bezeichnen ist, sondern ihren Ort im Denken hat. So gilt auch für Schmitz wider Willen: »Die durch das Denken entstandene Trennung von der Wirklichkeit kann nur durch es selbst aufgehoben werden«.265 Ein solches Denken ist dann aber mehr als bloß analytisches Explizieren aus vorgängig erschlossenem Ganzen – wie Schmitz meint – , sondern hat eine synthetische, konstruktive Dimension. 2. Gegenwart Neben dem instabilen Mannigfaltigen ist noch auf einen weiteren mit einer ähnlichen methodischen Schwierigkeit behafteten Begriff hinzuweisen: die primitive Gegenwart. Was Schmitz damit meint, sei im Erleben »vorgezeichnet«, der vitale Antrieb »tendiere« zu ihr hin, so dass er sie »anklingen« lasse, wenn sie auch »vielleicht nie, solange der Mensch bei Bewußtsein ist, ganz rein dargestellt werden« (1999a, 31) könne. Sie ist »gewissermaßen die reine Gestalt der Enge, auf die die leibliche Engung spürbar zuläuft, auch ohne sie zu erreichen« (1999a, 32) »Sie ist die Enge des Leibes als das Extrem leiblicher Engung, die freilich meistens nicht so weit führt, aber dieses Extrem immer irgendwie vorzeichnet oder anklingen läßt« (1991, 163; Herv. S.P.), so dass »die primitive Gegenwart im Alltag nicht durch Reindarstellung, sondern mittelbar durch den Sog zur Enge hin im vitalen Antrieb (und eben durch das Gefälle personaler Regression) zur Geltung kommt« (1999a, 103; Herv. S.P.), und dem Menschen so eine »Offenheit zur primitiven Gegenwart hin, die Empfänglichkeit für sie« (2008, 90) schenkt. Man achte auf die kursivierten Worte. Das Wort irgendwie ist ein Indikator dafür, dass jemand nicht genau weiß, wie etwas mit etwas anderem zusammenhängt. Schmitz scheint in der Tat nicht recht zu wissen, inwiefern sie nur kann, wenn es dem Bewusstsein prinzipiell zugänglich ist. Dabei muss nicht gefordert sein, dass alles einmal oder gar auf einmal bewusst werden müsste. Lediglich generelle Bewusstseinsunfähigkeit wäre problematisch, weil sich dann gar nicht sinnvoll darüber sprechen ließe. Schmitz’ persönliche Situation erfüllt diese Kriterien. Nichts an ihr ist prinzipiell unzugänglich und wenn es zugänglich wird, etwa als einzelne Erinnerung ins Bewusstsein tritt, ist es nicht sinnlos zu schließen, dass es schon vorher unbewusst »da« gewesen ist. Hinzu kommt, dass Erinnerungen einmal bewusst waren, also nur ins Unbewusste gesunken sind und von dort aus wieder werden können, was sie schon einmal waren: bewusst. Im personalen Selbstbewusstsein hingegen tritt nie etwas auf, das darauf hindeuten könnte, es könne an sich so beschaffen sein, dass es in unendlichfacher Unentschiedenheit zwischen zwei Zuständen schillert, dies aber zumeist unbewusst bleibt. Weder ist es unbewusst im Sinne einer Erinnerung, die einmal bewusst war noch im Sinne einer »Hintergrundaktivität«, etwa dem kantischen »Ich denke«, das meist nicht ins aktuelle Bewusstsein fällt, auf das man aber aufmerksam werden kann. Auch Schmitz behauptet für die instabile Mannigfaltigkeit nicht, dass es so sei. Er trägt das Konstrukt äußerlich an das Phänomen heran, entwickelt es nicht aus ihm selbst oder auch nur einem Korrelat seiner, das einen solchen Rückschluss erlauben würde. Es gibt also keinen Grund anzunehmen, die instabile Mannigfaltigkeit würde im personalen Selbstbewusstsein latent oder unbewusst vollzogen. Vielmehr ist sie eine aus fremder und unzulänglicher Quelle gespeiste Erklärung und keine Beschreibung des Phänomens selbst. 265 Christians 1998, 171. 104 »vorgezeichnet« ist und »anklingt«. Die Gegenwart sollte schließlich das Prinzip seiner Philosophie und als solches »immer zugänglich und unverwechselbar sein« (I, 150). Schon zu Beginn von Kap. V zeigte sich aber, dass dieser Anspruch im Kontrast dazu steht, dass die Gegenwart an sich selbst gar nicht erlebt werden kann, da Enge und Weite des Leibes als Extreme im Erleben gar nicht vorkommen und auch nicht vorkommen können, da sie gleichsam als Bewusstseinsverlust definiert sind. Wir erleben die primitive Gegenwart de facto nur mittelbar. Eben dann kann sie aber nicht das »unbestimmte Eindeutige«, »immer zugänglich«, »unverwechselbar« sein und bar jedes Zweifels und jeder Reflexion Ich-HierJetzt-Dieses-Dasein darstellen. Das könnte sie nur, wenn sie nicht gewissermaßen, sondern in einem absoluten Sinn wirklich unmittelbar wäre. Derartige Unmittelbarkeit aber scheint per definitionem unerfahrbar – steht sie bevor, schläft man ein oder fällt in Ohnmacht; sie zu »erleben«, wäre mit Bewusstseinsverlust identisch (vgl. Kap. V.1). Angesichts dessen spricht Schmitz auch davon, sie sei wie ein mathematischer Extremwert nur in Annäherung, aber nie an sich selbst erreichbar (vgl. Brief). Dieser Extremwert ist jedoch wiederum etwas rein Ideelles, das zudem wie die instabile Mannigfaltigkeit die Unendlichkeit bemühen muss und dem nichts in der unwillkürlichen Lebenserfahrung entspricht. Die als Enge des Leibes bestimmte primitive Gegenwart ist ein idealer Punkt, der nicht erreicht werden kann und nach Schmitz’ eigener antimetaphysischer, antitranszendentaler Auffassung, die alles in den erlebten Phänomenen selbst auffinden will,266 als »bloß konstruiert« gelten müsste. Das ideelle Prinzip spaltet das Phänomen gleichsam in Wesen (primitive Gegenwart) und Erscheinung (affektives Betroffensein). Dieses Wesen aber ist transzendent.267 Das transzendente Wesen Gegenwart erscheint immanent im affektiven Betroffensein. Was Adorno im Zitat oben an Husserl moniert (der »Wesenszopf«, hier: transzendente Gegenwart, gegenüber dem »bloßen Dasein«, hier: immanentes Betroffensein), trifft also noch auf Schmitz zu. Woher wissen wir von dieser Gegenwart, wenn sie nicht erlebt werden kann? Wie die ambivalente Mannigfaltigkeit scheint sie ein Konstrukt des Denkens zu sein, Transzendenz und Denken, die Schmitz beide nur implizit in Anspruch nimmt, scheinen sich einander anzunähern. Dem steht von seiner Seite aber nicht nur entgegen, dass sie dann eine bloße Konstruktion wäre, sondern wir haben auch bereits gesehen: Wenn in primitiver Gegenwart alle Orientierung schwindet, bieten die Orientierungen der entfalteten Gegenwart keinen 266 Vgl. Andermann 2007, bes. 252 ff., die Schmitz neben Merleau-Ponty und Deleuze als »Kritiker der transzendentalen Konstitution« liest. 267 Auch Wolfgang Sohst vertritt die Ansicht, der gesamte »prozedurale Dreischritt vom gestaltlosen Weltstoff über die primitive Gegenwart zur »Welt als [...] entfalteter [...] Gegenwart« sei eine »offenbar transzendente[] Prozessfolge« (Sohst 2005, 20) und vergleicht Schmitz mit Kant, der ständig über Dinge spricht, über die er nach eigener Aussage nichts wissen dürfte. 105 Aufschluss darüber. Ich-Hier-Jetzt-Dieses-Dasein lassen sich als selbst Unbegriffliche weder einzeln noch in ihrem Zusammenfall begreifen (vgl. Kap. V.1 und V.5). Wenn wir aber weder einen Begriff noch eine sinnliche Erfahrung davon haben, scheint nur noch eine Art intellektuelle Anschauung als Modus übrig zu bleiben. Zwar kennt Schmitz natürlich keinen solchen Erkenntnisweg, doch scheint man ihm nach dem Gesagten einen solchen implizit in Ansrpcuh genommenen unterstellen zu müssen. Im selben Sinne ließe sich dies für die Instabile Mannigfaltigkeit erwägen. In beiden Fällen müsste Schmitz entweder seinen Begriff des Denkens um eine synthetische Dimension erweitern (d.h. synthetische Urteile a priori zulassen) oder eine Art intellektuelle Anschauung geltend machen. Freilich ist ihm auf Grund seiner Theorieanlage beides versagt. Diese implizit metaphysische Dimension wird im Anhang nochmals thematisiert. Nun aber abschließend nochmals zum Denken. X. Zusammenfassung: Denken als Ur-Teilung der Unmittelbarkeit? Was »Denken« sei, ist wohl auch deswegen so schwer zu verstehen, weil es stets eine Trennung zwischen dem Denkenden und dem Gedachten zu implizieren scheint. Außerdem denken wir eben selbst, wenn wir das Denken betrachten. Als ein Verhältnis zwischen mindestens Zweien und dazu noch uns selbst, lässt es sich nicht vergegenständlichen. Die Paradoxien des Selbstbewusstseins haben hierin ihre Wurzel. Im Selbstbewusstsein denkt jemand sich selbst als denkend – und dass dies so sein soll, lässt sich kaum denken (vgl. Kap. III.1). Schmitz und andere, die wir gemeinsam als nicht-egologische Unmittelbarkeitstheorien bezeichnet haben, lösen dieses Problem, indem sie Selbstbewusstsein »tiefer legen« und damit vom jeglicher Differenz fern zu halten suchen. Der Dualismus, d.h. die Trennung, das Urteil, die Explikation, etc., die Schmitz vermeiden will, richtet sich, wie wir nun gesehen haben, hinter seinem Rücken aber in gleich mehrfacher Weise wieder auf: Nicht nur gelingt ihm erstens (Kap. IX.1) die Vereinigung von personalem und präpersonalem Selbstbewusstsein nur auf der Ebene des synthetisch-konstruktiven Denkens, er muss auch zweitens (Kap. XIII.2) die eigentlich abzuhaltende Trennung des Selbstbewusstseins in Subjekt und Objekt in die Unmittelbarkeit des affektiven Betroffenseins als »eigentümliche Reflexivität« doch wieder eintragen. Auch hier ist auf der Ebene der Theorie das Denken deswegen am Werk, weil das Zusammenspiel im Modus der instabilen Mannigfaltigkeit gedacht wird, die – wie oben erläutert – keine Grundlage im Phänomen hat. Drittens (Kap. IX.2) kommt das Trennende dadurch ins Spiel, dass die primitive Gegenwart selbst eine zur Erklärung herangezogene Konstruktion ohne Korrelat im beschriebene Phänomen ist und so das beschriebene Phänomen (affektives Betroffensein) von seinem erklärenden Prinzip (Gegenwart) trennt. Viertens (Kap. XIII.1) muss Schmitz die 106 Leiblichkeit »verallgemeinern«, um die herangezogenen Phänomene für das erwünschte Ergebnis verwenden zu können. Der Verweis auf Unmittelbarkeit der Affektivität und die mit ihr verbundene Leiblichkeit leistet also nicht nur phänomenal (beschreibend oder deskriptiv) zu wenig, da wir uns ja auch im Denken stets als identisch erleben, sondern auch kategorial (erklärend oder explikativ), insofern die Kategorie der Identität letztlich erst durch das Konstrukt der primitiven Gegenwart, das Schmitz den beschriebenen Phänomenen zuordnet und weder durch die punktuelle erlebte noch die »verallgemeinerte« Leiblichkeit gesichert werden kann. Die prätendierte differenzlose Unmittelbarkeit ist zumindest für uns immer schon verloren, spätestens sobald wir davon sprechen. Schon der Versuch, die unwillkürliche Lebenserfahrung zu systematisieren, lässt diese nicht unberührt. Ähnlich meint Christians: Seine [gemeint ist das affektive Betroffensein; S.P.] Struktur ist gewiß nicht Phänomen, sondern Begriff, mit dem Weisen unseres Erlebens [...] rekonstruiert werden sollen. [...] Der Begriff ist vielmehr eine Antwort auf die Frage, wie es möglich ist, daß ich Gefühle erleben und mit ihnen umgehen kann. So wird die Phänomenologie von Schmitz an dieser Stelle zu dem Bemühen, unser Betroffensein selbst in seiner Struktur aufzuklären mit der Frage, wodurch wird unser Erleben bedingt, bzw. was ist die Bedingung der Möglichkeit des menschlichen Erlebens (also eine transzendentalphilosophische Fragestellung). [...] So trennt sich der Mensch im Denken einerseits von der Wirklichkeit [...], andererseits kann er durch das Denken auf die im unmittelbaren Erleben hervortretende Wirklichkeit antworten, indem er z.B. ein Gefühl in einen Zusammenhang hineinstellen und so differenziert, nicht einfach nur sich einlassend oder dagegen sperrend, Stellung nehmen kann. [...] Bei allem Bemühen darum, die unmittelbare Lebenserfahrung wiederzugewinnen, beachtet Schmitz in seiner ganzen Philosophie nicht das tätige Denken, das sich in allen Aussagen und Konstruktionen hindurchzieht. [...] Seine Philosophie ist alles andere als eine Überwindung der abendländischen Tradition, vielmehr kommt darin der die Moderne kennzeichnende Widerspruch zwischen Denken und Wirklichkeit in aller Mächtigkeit zum Vorschein. Das zu beobachten ist äußerst interessant, zumal sich dieser Vorgang auf hohem Niveau abspielt und wohl kaum einer sich von diesem Gegensatz frei weiß.268 Dieser treffenden Analyse bleibt betreffs der Probleme, die Schmitz mit dem Denken hat, nicht mehr viel hinzuzufügen. Nach allem, was wir gesehen haben, scheinen Unmittelbarkeit und Reflexion derart ineinander verschränkt, dass ihre angelegentliche Trennung jede Wiedervereinigung vereitelt. Wir kommen offenbar – sowohl genetisch als auch strukturell – weder von der Reflexion zur Unmittelbarkeit (Reflexionsmodell) noch von der Unmittelbarkeit zur Reflexion (Unmittelbarkeitsmodell). Das heißt aber, dass eine Kritik des Reflexionsmodells, die nur auf reflexionsfreie Unmittelbarkeit setzt, vom Regen in die Traufe kommt. Es scheint sich anzudeuten, dass Selbstbewusstsein eben beides ist: Unmittelbarkeit und Reflexion. Selbst bei radikalen Trennungsversuchen muss am Ende der Zusammenhang mit den jeweils anderen Pol doch wieder erklärt werden und dies scheint nur dann möglich zu sein, wenn Ansätze dazu in den isolierten Pol bereits eingetragen werden. Daher mag ein erneuter Verweis auf Hegel angebracht sein, welcher der Problematik bloßer Reflexion nicht durch Verweis auf das bloß Unmittelbare, sondern durch eine Neubestimmung des Denkens selbst begegnet ist. Denken ist für ihn keineswegs nur 268 Christians 1998, 173 ff. 107 trennendes Urteilen und Analysieren, sondern im selben Maße Identifizieren und Synthetisieren. Selbstbewusstsein ist nur möglich, weil es in seiner getrennten Erscheinung zugleich eins ist. Hegel geht dadurch über die Trennung in Unmittelbarkeit und Reflexion hinaus und erklärt das unmittelbar Gegebene, das Schmitz als solches rein behalten und beschreiben will, für an sich selbst vermittelt; beides lässt sich nur zusammen denken. Er meint, dass es »nichts gibt, nichts im Himmel oder in der Natur oder im Geiste oder wo es sei, was nicht ebenso die Unmittelbarkeit enthält als die Vermittlung«.269 Ob Hegel recht hat und Denken notwendig mehr als Urteilen ist, sich das Ganze also denken und nur denken lässt, soll hier nicht entschieden werden; es könnte sich etwa auch im Modus der Anschauung oder der Vorstellung erschließen. Doch werden zwei Dinge bezüglich Schmitz deutlich. Zum einen sehen wir das vereinigende Moment des Denkens, das Hegel stark macht, in Form der Ambivalenz des personalen Selbstbewusstsein auch bei Schmitz de facto am Werk: Nur mit dieser konstruierten quasidialektischen Konstruktion kann er die beiden Sphären vereinen. Insofern ist aber Denken nicht nur ein analytisches Explizieren, ein besinnendes Vereinzeln aus einer Ganzheit, sondern hat – in Schmitz’ Theorie selbst, wenn auch nicht in ihrem Gegenstand – auch eine synthetische Dimension. Zum anderen wurde auf die Problematik des Denkens der Unmittelbarkeit hingewiesen: Zwar ist im Denken stets eine Differenz vorhanden, welche die Identität im Selbstbewusstseins aus den genannten Gründen zu bedrohen und unmittelbar Identisches zu erfordern scheint, doch gibt es ohne Differenz offenbar auch keine Identität – zumindest keine, die nicht eo ipso unerlebbar, wenigstens für uns nichts sein, per definitionem nichts mit uns zu tun bekommen könnte. So hat sich herausgestellt, dass das Prinzip von Schmitz’ Philosophie transzendent, weder begreif- noch erfahrbar ist. Dies muss es sein, wenn es die gewünschte Erklärungsleistung vollbringen soll. Nur so kann es die unbeschreibliche absolute Relations-, Begriffs- und Differenzlosigkeit sein, die nötig zu sein scheint, um Unmittelbarkeit als Grundlage des Selbstbewusstseins gegen die Problematik der Zweieinigkeit und die der Selbstzuschreibung bereit zu stellen. In dieser Transzendenz verfehlt es jedoch zugleich die Grundlegungsfunktion, weil es für uns nichts sein kann. Zwar ist das affektive Betroffensein als empirische Erscheinungsform dessen für uns, aber dadurch geht die theorieimmanent benötigte Indifferenz verloren.270 Es ist zumindest protorelational und protobegrifflich und jedenfalls in sich selbst reflexiv verfasst, wodurch die Differenz Einzug erhält und so die Behebung der Paradoxien vereitelt, die Schmitz weder zu lösen noch aufzulösen vermag. 269 270 Hegel 5, 66. Darauf wird in Anhang I nochmals zurückzukommen sein. 108 Die Identität des präpersonalen Selbstbewusstseins ist Schmitz zu Folge deswegen keine Subjekt-Objekt-Identität, weil gar keine Trennung in ihm vorhanden ist. Dieser gedenkt er im Rahmen seiner Ontologie der Bedeutungen eine Ebene der Unabgehobenheit von Subjekt und Objekt vorauszulagern.271 Auf Grund seiner ihm eigenen Reflexivität ist das affektive Betroffensein allerdings nicht einfach, sondern zweierlei zugleich. Selbst wenn es als solches identisch wäre, ist es doch zum anderen zur Differenzierung in Form einer »Spreizung«, zum »Spagat« fähig. So erhält die fernzuhaltende Zweieinigkeit hinterrücks doch wieder Einzug. Das seltsame »1=2« tritt dennoch auf. Zwar glaubt Schmitz dies durch seine Scheidung in Identität und Einzelheit behoben zu haben: Nur Einzelheit sei zahlfähig, Identität hingegen hebe sich im (diffus) chaotischen Mannigfaltigen noch nicht explizit von Anderem ab und sei doch selbst etwas. Doch kann diese Schwebestellung im affektiven Betroffensein nur durch eine Konstruktion – die instabile Mannigfaltigkeit, welche hier zur chaotischen hinzu kommt – aufrecht erhalten werden, die dem Phänomen nicht entspricht, so dass das Denken, die Reflexion, das Trennende hier dennoch Einzug erhält. Schmitz’ Lösung der Paradoxie der Zweieinigkeit durch absolute Indifferenz geht nicht auf, weil es doch immer zwei sind, sei es implizit oder explizit, sofern es denn Selbstbewusstsein und nicht etwas anderes sein soll. »Das eben unterscheidet Selbstbewusstsein von allem anderen Wissen, daß in ihm derselbe Sachverhalt in zweifachem Stellenwert auftritt«.272 Nicht nur die Selbstbezüglichkeit, sondern damit einher gehend auch die seltsame Subjekt-Objekt-Identität ist ihm nicht auszutreiben. Schmitz verschiebt das Problem lediglich, indem er »Subjekt-Objekt-Identität« nur noch als Terminus für die Zusammensetzung aus einzelnen Bestandteilen gelten lassen will. Das ist offensichtlich eine bloße Wortfrage und keine Lösung der Paradoxie. Schmitz’ Lösung der Paradoxie der Selbstzuschreibung krankt am selben Punkt: Auch für deren Lösung hat er für absolute Indifferenz optiert, die im unmittelbaren Selbsterlebnis gegeben sein sollte, so dass keine Zuschreibung mehr von Nöten sei. Aber von hier aus wurde die Möglichkeit einer Zuschreibung überhaupt ganz unklar und die selbst paradoxe Vermittlung durch ambivalente Mannigfaltigkeit vermochte dem nicht abzuhelfen. So sahen wir ein bloß deskriptives Vorgehen zu kurz greifen, dem derartige punktuelle Phänomene ihr 271 Dabei war es auch seine Absicht, weder eine Subjekt- noch eine Objektphilosophie vorzulegen, sondern durch seine Verschlingung von Person und Welt sowie das Mir als weder anonymem Es noch reflektiertem Ich die Einseitigkeiten beiderseits zu vermeiden. Im Ergebnis tendiert Schmitz aber doch stark zur Subjektphilosophie: »In der Tat ist die Welt, in der wir leben, nicht ein homogenes Milieu, sondern Überlagerung unzähliger Mir-Subjektivitäten, die nur durch die Abblassung und Abmagerung zu objektiven Tatsachen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden« (1999a, 83). Wenn es denn stimmt, dass es, wie Dilthey meint, nur drei Arten von philosophischen »Weltbildern« gibt (vgl. Dilthey 1991, 94 ff.): Realismus, subjektiven und objektiven Idealismus, dann muss Schmitz doch als subjektiver Idealist gelten. Dies wird von einer psychologischen Beobachtung flankiert: »Schmitz wettert gegen die ›Ich-Ideologie‹ [z.B. III.3, 587; S.P.], doch gibt es nur wenige Philosophen, die so gerne ›Ich‹ gesagt und Originalitätsansprüche angemeldet haben wie er« (Soentgen 1998, 117). 272 Henrich 1966, 193; Herv. S.P. 109 Letztes sind, dann aber doch den Deutungsansprüchen nicht genügen: Immer wieder muss Schmitz in seine Beschreibungen Erklärungen und Verallgemeinerungen einfügen, um die gewünschten Deutungen aufrecht erhalten zu können. Selbstbewusstsein im Sinne eines Wissens um die eigene Identität entgeht dem infiniten Regress nicht dadurch, dass es sich stets auf unmittelbare Identität beziehen kann, da sich in diese selbst die Reflexion stets schon eingeschlichen hat.273 Die Kritik an Schmitz’ Theorie wird, soweit sie die Selbstbewusstseinstheorie nur mittelbar betrifft, im Anhang fortgesetzt. Nun kommen wir zunächst zu einer allgemeinen Schlussbetrachtung über das Scheitern aller behandelten Theorien des Selbstbewusstseins. 273 Aus den genannten Gründen ist auch seinen Begriff der Person unterbestimmt. Reflexion, Denken, Abstandnahme werden ihm aus dem Ansatz immanenten Gründen zum Problem. Dies wird wir in Anhang II behandelt. 110 Schlussbetrachtung: Hase, Igel und Hegel – Das Münchhausentrilemma des Selbstbewusstseins Am Ende gibt es gegenüber dem bereits Entwickelten nichts Neues zu sagen. Es gilt nur noch aufzuzeigen, was schon da ist. Wie in Hegels absolutem Wissen ist das Ziel gegenüber dem Weg nicht ein Zuwachs, sondern nur die Einsicht in das Ganze des Weges selbst. An dieser Stelle ist jedoch keineswegs absolutes Wissen zu verkünden; eher absolutes Nichtwissen. Wir haben mit Paradoxien des Selbstbewusstseins begonnen und dann im Rahmen der Auseinandersetzung mit Schmitz zahlreiche »Behandlungsversuche« derer kennen gelernt. Zu einer befriedigenden Lösung ist keine der Theorien gelangt. Der Blick auf verschiedene Ansätze innerhalb der Philosophiegeschichte scheint zudem nahe zu legen, dass nur wenige Modelle immer wieder neu durchgespielt werden. Wir können daher die These wagen, dass ähnlich dem »Münchhausentrilemma« der Unmöglichkeit einer vollständigen Begründung bzw. Angabe von Ursachen274 eigentlich nur drei Optionen zur Debatte stehen, die allesamt nicht recht zufrieden stellen. Man kann sie sich durch Punkt, Linie und Kreis veranschaulichen. Im Kreis geht, wer zirkulär argumentiert, auf einer Linie, wer hinter jede Begründung immer noch weiter zurückgehen muss und so im infiniten Regress endet. Da scheint es nur zu helfen, an einem Punkt stehen zu bleiben, um den Regress abzubrechen und die mittelbaren Begründungen in Unmittelbarkeit zu »erden«. Analog der Linie verfährt die »Reflexionstheorie« des Selbstbewusstseins: Sie mündet, wie wir gesehen haben, im infiniten Regress, da sie immer schon voraussetzen muss, was sie begründen will. Man scheint, will man das Phänomen nicht leugnen, gezwungen zu sein, sich auf irgendeine Art von Unmittelbarkeit zu berufen, in welcher Selbstbewusstsein schlicht an einem Punkt gegeben ist, damit der Hase das »Ich bin schon da« des Igels selbst einlösen kann. Ein solches Konzept haben wir nicht nur bei Schmitz in Gestalt des affektiven Betroffenseins, in dem wir uns unmittelbar identisch erleben, kennen gelernt, sondern auch in Kap. VII.2 und 3 sowie VIII.1 bei Theoretikern des Selbstgefühls oder allgemein der »präreflexiven Selbstvertrautheit«. Schmitz’ Unmittelbarkeitstheorie wurde freilich ergänzt durch die unendlichfache Unentschiedenheit zwischen, wie man sagen kann, Punkt (Unmittelbarkeit/ohne Zuschreibung) und Linie (Reflexion/mit Zuschreibung), so dass zu fragen wäre, ob er dem Kreis gerade angesichts der Unendlichkeitsdimension nicht schon 274 Dies hier so bezeichnete »Münchhausentrilemma« ist nicht zu verwechseln mit dem »Münchhausenmodell« (Kap. II.2b), auch wenn die Ähnlichkeit in der Bezeichnung natürlich auf die Gemeinsamkeit in einem der drei Teile des Trilemmas verweist. Bereits die Antike kennt Versionen des Trilemmas (vgl. Sextus Empiricus, I 178 f.). Die Thematisierung der Figur in der Neuzeit geht auf Jacobis Rede von Unmittelbarkeit und Vermittlung zurück, in dessen Nachfolge Fries es zum Trilemma ausgearbeitet hat. Im 20. Jahrhundert wurde es von Karl Popper erneut aufgegriffen und von dessen Schüler Hans Albert ausgearbeitet, der ihm auch den Namen »Münchhausentrilemma« gab (vgl. Albert 1968, 13 ff.). 111 nahe kommt. Das Paradebeispiel für ein kreisförmiges Organisationsmuster ist aber Hegel (Kap. VII.1). Selbstbewusstsein ist in seinem System nur ein, wenn auch ausgezeichneter, Fall einer allgemeinen Struktur. Es besteht darin, sich selbst vorauszusetzen, macht sich in wahrhafter Unendlichkeit zum Zirkel und stellt so die Differenzeinheit von Unmittelbarkeit und Reflexion dar: Vermittelte Unmittelbarkeit. Wir können diese drei Optionen – Reflexion, Unmittelbarkeit und Einheit beider im Zirkel – auch als »Hase«, »Igel« und »Hegel« bezeichnen. Alle diese Optionen im Münchhausentrilemma des Selbstbewusstseins haben sich aber im Laufe der Arbeit als in irgendeiner Hinsicht unbefriedigend herausgestellt. Das wird deutlich, wenn wir uns nochmals an die Bedingungen erinnern, die wir anfangs an Selbstbewusstseinstheorien gestellt haben: (1) Bewusstsein, (2) Identität, (3) Relationalität, (4) Meinigkeit. Sie scheinen allesamt notwendige Bedingungen zu sein275, ohne dass wir jedoch eine Theorie kennengelernt hätten, die alle zu vereinigen wüsste. Hegels Zirkelmodell ist ein objektiv-ideell ablaufender Prozess, die (2+3) Selbstbezüglichkeit einer objektiven Struktur (die den Namen »Subjektivität« trägt). (4) Meinigkeit oder Jemeinigkeit aber scheint in einer solchen keinen Ort zu haben, da an keiner Stelle einsichtig wird, wie ein einzelnes Subjekt mehr sein könnte als nur die Aktualisierung einer objektiv-allgemeinen Potenz, die Instanz einer ansichseienden Weltstruktur, welche dann als bloßes Insichkreisen über meinen Kopf hinweg abzulaufen scheint. Genau dies, »Fall oder Exemplar einer Gattung zu sein«, war es aber, wogegen die Ausführungen über Jemeinigkeit, Selbst-etwas-sein oder Wie- und Wer-Identität sich richteten. Was Schmitz »subjektive Tatsachen« nennt, ist in Hegels Theorie ein Ding der Unmöglichkeit. Das zumeist auf Basis einer nicht-egologischen Theorie vertretene Punkt- oder Unmittelbarkeitsmodell (Igel) macht nicht einsichtig, wie man von einer irreflexiven, ja irrelationalen und selbstlosen Gegebenheit, die wie bei Schmitz übrigens durchaus »jemeinig« und identisch sein mag, zur bewussten Selbstbezüglichkeit, d.h. (1+2+3) Reflexion, gelangen kann, wie Unmittelbarkeit und Reflexion zusammenspielen können. Dabei ist nochmals auf das »Einheitsproblem« hinzuweisen: Im Rahmen des Unmittelbarkeitsmodells wird nicht einsichtig, wieso nicht in jedem Moment ein neues präreflexives Selbstbewusstseinssubjekt angenommen werden müsste. Eine diachrone Einheit kann erst durch Formen der Reflexion 275 Bzgl. (1) Bewusstsein wurde vor allem der Terminus angezweifelt (Kap. VII.2). Leugner des Bewusstseins als solchem haben wir nur kurz behandelt (Kap. III.2). (2) Identität wurde von Tugendhat (Kap. VII.3) nicht geleugnet, aber für trivial erklärt. Wir haben gesehen, dass dies nicht das Phänomen, sondern die Theorie trivial erscheinen lässt. (3) Relationalität wurde von allen nicht-egologischen »Unmittelbarkeitstheorien« (Kap. IV, VII.2, VII.3, VIII) geleugnet. Es zeigte sich, dass sie aus guten Gründen dann doch wieder eingetragen werden musste. (Kap. VIII.2) (4) Meinigkeit wurde nicht geleugnet, wurde aber z.T. nicht genügend beachtet oder konnte nicht eingeholt werden (Kap. VII.1, III). Schmitz hat diesen Punkt besonders deutlich herausgestellt (Kap. IV.2). 112 wie Erinnerung usw. gewährleistet werden, die aber die Unmittelbarkeitstheorie als Identitätsgarant nicht in Anspruch nehmen darf; nimmt sie diese in Anspruch, wird sie selbst zum Linien- oder Reflexionsmodell (Hase), in welches egologische Theorien scheinbar notwendig wider Willen geraten. Dieses arbeitet mit einer Selbstbezüglichkeit, die etwas hervorbringen soll, was sie immer schon voraussetzen muss; (1+2+4) Identitätsbewusstsein kann es nicht erklären, da es die unendlich iterierte Reflexion weder in Unmittelbarkeit zu erden vermag noch im Stande ist, aus sich heraus Identität in einem von sich wissenden Subjekt zu gewährleisten. Es erscheint demnach unmöglich und doch zugleich notwendig, alle vier Punkte in einer Theorie zu vereinen. Dies ist die eigentliche Paradoxie, oder besser: Aporie, des Selbstbewusstseins. Sollten wir angesichts dieser Situation am Ende nicht doch mit Kant sagen, Selbstbewusstsein sei »schlechterdings unmöglich zu erklären«, oder uns im selben Sinn mit Jacobis existenziell gefühltem, aber unvordenklichem Selbstsein zufrieden geben? Selbst Henrich, der Jahrzehnte mit der Suche nach näherem Aufschluss über das Selbstbewusstsein zugebracht hat, ist, was dies betrifft, inzwischen auf deren Seite. Selbstbewusstsein gilt ihm nun ganz kantisch als Erkenntnisgrenze und er konstatiert in Jacobischem Ton: »Zu dieser Art von Wissen müssen wir wohl durch einen Sprung kommen«.276 So plausibel diese »Kapitulation« der bloßen Vernunft nach alledem scheint, sollten wir uns aber andererseits hüten, solche Unerklärlichkeiten vorschnell »getrost nach Hause tragen« zu wollen. Kant warnt vor solchen Ruhekissen der Vernunft: Es ist immer etwas Mühsames beim Gebrauch der Vernunft – man muß Scharfsinnigkeit gebrauchen, das Spiel des Witzes dabei unterscheiden. Daher sieht man gerne Wunder, i.e. solche Dinge die nicht durch unsere Vernunft zu begreifen sind. Sie geben der Vernunft Ferien. Wir hören gerne Wunderdinge, dergleichen Erzählungen sind angenehm, weil wir dadurch von den Beschwerungen der Vernunft losgesprochen werden.277 276 277 Henrich 1999, 14 f. Kant 1772, 159. 113 Anhang: Weiterführende Kritik an Schmitz’ Theorie Hier sind nun noch zwei Themenkomplexe zu behandeln, die sich aus dem dritten Teil ergeben haben, aber sowohl vom Umfang als auch von der thematischen Weite her über eine Kritik bloß an Schmitz’ Selbstbewusstseinstheorie hinausgewachsen sind. Zwar sind die drei nun in erster Linie noch zu behandelnden Begriffe: Gegenwart, Leib und Person, wie wir gesehen haben, auch für das Schmitz’ Selbstbewusstseinstheorie von höchster Relevanz. Doch greift die nun daran zu übende Kritik weiter auf Schmitz’ Gesamtkonzept aus, so dass sich eine separate Behandlung anbietet. I. »Dekonstruktion« der Gegenwart Ich bin nicht, inwiefern ich mich setze, sondern inwiefern ich mich aufhebe. (Novalis) 1. »Metaphysik der Gegenwärtigkeit« Nachdem die Schlachten um’s Selbstbewusstsein geschlagen sind, legen wir den Fokus nochmals eine Stufe tiefer und betrachten Schmitz’ Prinzip, das nicht nur die des Selbstbewusstseins, sondern auch viele andere Problem hat lösen sollen. Obwohl Schmitz die Gegenwart natürlich nicht als transzendentes Prinzip auszeichnet, sondern alles in der Immanenz des Erfahrbaren verorten will (vgl. 2005, 21), hat sie in seiner Philosophie de facto die Funktion eines solchen.278 Als solches ist sie ein metaphysisches Prinzip. Mit Derrida kann man im wahrsten Sinne des Wortes von einer »Metaphysik der Gegenwärtigkeit« sprechen, denn Schmitz versucht absolute Gegenwärtigkeit zu denken. Derridas Auseinandersetzung mit Husserls Phänomenologie vermag deswegen ein interessantes Licht auf Schmitz’ Theorie zu werfen, die sich als hintergründig sehr viel mehr an den von Schmitz früh bewunderten Husserl gebunden erweist, als er dies heute meint (vgl. 1996a). Wir versuchen Schmitz’ Prinzip einer »dekonstruktiven« Lektüre zu unterziehen. Das soll nicht mehr heißen, als dass wir aufzuzeigen versuchen, in welche Abgründe man immer schon geraten ist, wenn man bestimmte Fragen beantworten will. Mit einer bloßen »Destruktion« hat das nichts zu tun. Wir zeigen nur auf, wieviel Metaphysik im Versuch stecken kann, ihr aus dem Weg zu gehen. Auch Husserl versucht Selbstbewusstsein letztlich als unmittelbare Indifferenz von Subjekt und Objekt zu begreifen. Da er dies allerdings im Rahmen einer Konstitutionstheorie der Bedeutung zu leisten versucht, gerät er ständig in die Lage, Konstituierendes und 278 Auch transzendental fungiert sie gelegentlich, wenn Schmitz die Notwendigkeit der fünf Momente dadurch zu plausibilisieren versucht, dass sie Bedingungen der Möglichkeit ihre entfalteten Entsprechungen sind: dass ohne absolute Vorstellungen von Jetzt, Hier, Mir, Identität und Wirklichkeit nicht verstanden werden kann, was Zeit, Raum, Ich und Einzelheit sind sowie, was Wirklichkeit von Fiktion unterscheidet. 114 Konstituiertes zugleich unterscheiden zu müssen und es doch nicht zu können.279 Die »lebendige Selbstgegenwart« eines Transzendentalsubjekts soll den Grundstein für alle Bedeutung legen können, sofern es für sich selbst absolut unmittelbare und nicht auf »anzeigende«, »bedeutungslose« indexikalische Ausdrücke angewiesene Bedeutung hat. Derrida zeigt, dass dieser Versuch, eine absolut reine Bedeutung zu finden, die alle anderen grundzulegen vermag, daran scheitert, dass Husserl ihrer nie habhaft werden, sondern eine Annäherung an eine solche, die ohne anzeigende Indexikalität auskäme, nur teleologisch in ein transzendentes Jenseits hinein postulieren kann.280 Husserl scheitert, so Derrida, daran, dass die Aufhebung alles bloß Anzeigenden die Abwesenheit je meiner selbst bedeuten würde. Nur dann aber könnte die Selbstgegenwart als absolut Erstes, alles andere in reiner Bedeutung Konstituierendes, gelten und würde nicht von der »bedeutungslosen« (»anzeigenden«) Indexikalität bedroht. Die absolute Selbstgegenwart ist, wie Derrida es pointiert ausdrückt: mein eigener Tod.281 Als bloß anzeigend wurde dazu nicht nur das Ich, sondern auch jede Räumlichkeit und Zeitlichkeit sowie jeder anzeigende Verweis (Dieses) und die Wirklichkeit ohnehin durch phänomenologische Reduktion eingeklammert. Dann bleibt aber nichts mehr übrig als eine absolut transzendente Ewigkeit, von der niemand etwas wissen kann. Sie ist für uns ebenso unerreichbar wie Schmitz’ Gegenwart. So gilt für beide: Das Prinzip Gegenwart ist unerreichbar genau in dem Maße, in dem es etwas mit uns zu tun bekommt. An sich kann es, wie bei Schmitz, nur bei vollkommenem Bewusstseinsverlust – Enge ohne Weite oder Weite ohne Enge – gegeben sein. Es ist also a priori unmöglich, dass es jemals als es selbst erscheint, es wird – in Derridas Worten – immer schon »a priori zerspaltet«.282 Für uns wird es nur, wenn man Bewusstsein einträgt, das aber sein Ansich, seine absolute Indifferenz, zerstört. Zwar ist Schmitz’ Konzept natürlich vom transzendentalphilosophischen Husserls sehr verschieden und steht Heideggers Kritik an solcher Subjektphilosophie weit näher. Das Interessante ist hier aber, dass sie zum selben aporetischen Ergebnis kommen. Ob sie mit dem Ich, dem Sein oder wie Schmitz mit fünf Momenten zugleich beginnen,283 sie geraten doch auf der Suche nach deren Urgrund zur absoluten Indifferenz, in der all dies dasselbe ist, in der »alle Kühe schwarz sind«.284 Absolute 279 Vgl. Husserl 1966a, bes. 73 ff., 113 ff., 324 ff. sowie Frank 1991b, 527 ff., bes. 538 ff. Vgl. Derrida 1967, 135. 281 Vgl. Derrida 1967, 75 f., 129 f. Für eine ähnliche, aber an Schmitz anschließende Überlegung vgl. Schulte 1997, 53 ff. 282 Derrida 1967, 14. 283 Darin, dass Schmitz weder transzendentale Ich- noch fundamentalontologische Seinsphilosophie (sondern beides zugleich und doch nichts davon) vertreten will, zeigt sich sein – sei es bewusstes oder unbewusstes – Bestreben, Motive Husserls und Heideggers zu vereinen (vgl. Christians 1998, 176), die in seinem Begriff der Gegenwart gleichsam kulminieren. 284 So Hegel in seiner Kritik an Schellings Konzeption des Absoluten. »Irgendein Dasein, wie es im Absoluten ist, betrachten, besteht hier in nichts anderem, als daß davon gesagt wird, es sei zwar jetzt von ihm gesprochen 280 115 Indifferenz, sei es als Ichheit überhaupt, als Sein überhaupt oder alles zusammen, eliminiert die Möglichkeit ihrer Erfahrung. In Derridas Worten: »Mein Tod ist strukturell notwendig für die Verkündigung des ich«. 285 Nicht wie es ist, dies hier jetzt zu sein, wäre dann das Erlebnis der Gegenwart, sondern nur das unmögliche Wissen wie es ist, nicht zu sein, würde uns ihrer habhaft werden lassen. Ich wäre dann weder, insofern ich mich als dies hier jetzt erlebe, noch – pointiert mit Novalis gesprochen – insofern ich mich setze, sondern insofern ich mich aufhebe (freilich nicht im Hegelschen Sinne). Derrida hält solcherlei Philosophie für »im Schema einer Metaphysik der Gegenwärtigkeit gefangen, die sich unermüdlich, bis zur Atemlosigkeit abmüht, die Differenz auszutreiben«.286 »Das Lebendig-Gegenwärtige, ein nicht in ein Subjekt und ein Attribut zerlegbarer Begriff, ist also der grundlegende Begriff der Phänomenologie der Metaphysik«.287 Diese Aussagen von Derrida lassen sich auf Schmitz anwenden. Mit der primitiven Gegenwart konstruiert er einen nicht in ein Subjekt und ein Prädikat zerlegbaren Begriff und versucht so, die Differenz zwischen Subjekt und Objekt auszutreiben. Da diese ihm unter der Hand transzendent und so unklar wird, wie man davon etwas wissen kann, scheint sein Prinzip weder immanent noch transzendent sein zu können. Es soll zugleich an-sich-seiendes Prinzip (Gegenwart) und für uns unmittelbar erlebbar sein (affektives Betroffensein). Wie eine kantische regulative Idee ist die Gegenwart selbst nur durch unendliche Annäherung, also gar nicht erreichbar. In ihrem Erscheinen im affektiven Betroffensein verbirgt sie sich zugleich. Sie zeigt sich genau in dem Maße, in dem sie sich entzieht, und weist so eine Struktur auf, die an Formulierungen des späten Heidegger erinnert: Es entzieht sich ihm, indem es sich ihm vorenthält. Das Vorenthaltene aber ist uns stets schon vorgehalten. Was sich nach der Art des Vorenthaltens entzieht, verschwindet nicht. Doch wie können wir von dem, was sich auf solche Weise entzieht, überhaupt das geringste wissen? Wie kommen wir darauf, es auch nur zu nennen? Was sich entzieht, versagt die Ankunft. Allein – das Sichentziehen ist nicht nichts. Entzug ist hier Vorenthalt und ist also solcher – Ereignis.288 worden als von einem Etwas; im Absoluten, dem A = A, jedoch gebe es dergleichen gar nicht, sondern darin sei alles eins. [...] sein Absolutes für eine Nacht auszugeben, in der alle Kühe schwarz sind, ist die Naivität der Leere an Erkenntnis« (Hegel 3, 22; vgl. zu Schelling das Folgende). 285 Derrida 1967, 129. 286 Derrida 1967, 136. 287 Derrida 1967, 133. Derrida betont dies nur deswegen eigens für die Phänomenologie, weil sie einen antimetaphysischen Anschein mit sich trägt. Im Grunde will er sagen, dass jeder Art von Philosophie stets diese Tendenz zum Absoluten innewohnt und meint in diesem Sinn, Gegenwart als das sich in indifferenter Selbstgleichheit Gegebene könne als das Prinzip der Philosophie schlechthin gelten (vgl. Derrida 1967, 86). Wenn wir uns mit Schmitz’ Konzeption des Absoluten als Gegenwart beschäftigen, haben wir es also, nach Derrida, stellvertretend mit der Philosophie im Ganzen zu tun. Man kann indes Derridas Kritik teilen, ohne seine Konsequenz ziehen zu müssen. Sollte er aus der Kritik vorgängiger differenzloser, selbstgegenwärtiger Identität schließen wollen, es sei die Nicht-Identität (als différance) vorgängig (»ultratranszendental«), wäre das nicht plausibler als die kritisierte These: Wie Husserl von der Identität nicht zur Differenz, so käme Derrida von der Differenz nicht zur Identität, d.h. er könnte wie Hume, das Faktum der Identität des Selbsterlebens nicht plausibel machen, ohne es doch leugnen zu wollen (vgl. Frank 1983, 326 ff.; Derrida 1972, 80). 288 Heidegger 1952, 128 f. 116 Was Heidegger »Ereignis« nennt, entzieht sich genau wie Schmitz’ Gegenwart in dem Maße, in dem es sich zeigt. Das Ereignis ist deswegen aber nicht nichts, auch wenn es weder einfach transzendent noch immanent ist und Heidegger ebenso wenig wie Schmitz es auszuweisen vermag, d.h. im Modus des »Wissens« darüber Rechenschaft geben kann. Heidegger fährt fort: Was sich entzieht, kann den Menschen wesentlicher angehen und inniger in den Anspruch nehmen als jegliches Anwesende, das ihn trifft und betrifft. Man hält die Betroffenheit durch das Wirkliche gern für das, was die Wirklichkeit des Wirklichen ausmacht. Aber die Betroffenheit durch das Wirkliche kann den Menschen gerade gegen das absperren, was ihn angeht, – angeht in der gewiss rätselhaften Weise, daß das Angehen ihm entgeht, indem es sich entzieht.289 Auch hier ist die Struktur auffallend ähnlich. Wie bei Heidegger liegt auch bei Schmitz trotz seiner Transzendenz- und Metaphysikfeindlichkeit hinter dem affektiven Betroffensein noch etwas verborgen. Wie bei Heidegger gegenüber dem Seienden das Sein (oder Ereignis), so bei Schmitz sein Prinzip, die Gegenwart, als Wesen gegenüber den Erscheinungen des affektiven Betroffenseins. Betroffensein ist Betroffensein von etwas, das sich im Betroffensein zugleich zeigt und entzieht. Nicht nur diese Transzendenzmetaphysik wider Willen, sondern auch die Vorstellung einer unvordenklichen absoluten Einfachheit (vgl. IV, 3), einer Ungetrenntheit von Momenten, die sich schließlich entfalten, scheinen zu berechtigen, die Gegenwart als Schmitz’ Ersatz für das Absolute aufzufassen.290 Dieses erhielt im »Verlauf der Geschichte der Philosophie [...] verschiedene Namen: idéa tou agathoú bei Platon, theoría, nóeseos nóesis bei Aristoteles, das Eine bei Plotin, Indifferenz bei Schelling, absolute Idee bei Hegel, Ereignis bei Heidegger«.291 Schmitz nun nennt das Absolute Gegenwart, die zunächst als Indifferenz von fünf Momenten, dann als affektives Betroffensein und schließlich als voll entfaltete Gegenwart auftritt. Zusammen ist es – gleichsam das Absolute als Insichsein und Entäußerung – der »Spielraum der Gegenwart« (1999a, 175 ff.). Es muss sich entäußern, um nicht an sich zu bleiben, sondern für uns zu werden – ohne affektives Betroffensein einerseits und Entfaltung der Gegenwart andererseits könnten wir nichts davon wissen. Zur Illustration dieser These wollen wir Schmitz’ Absolutes mit dem Schellings vergleichen. Dieser eignet sich insbesondere, weil er zwischen System und Nicht-System ebenso unentschieden zu sein scheint wie Schmitz.292 Auch ihm ist das Chaos primär. Zwar tritt es 289 Heidegger 1952, 129. Gelegentlich taucht das auch in Schmitz’ Formulierungen auf: etwa wenn er von der primitiven Gegenwart als »dieser absoluten, d.h. losgelösten, Reinheit« (1999a, 30) spricht oder sie mit einem »Anker, an dem [...] die Welt hängt« (1999a, 31) vergleicht und natürlich, wenn er in ihrem Zusammenhang neuerdings von »absoluter Identität« (vgl. 2008) spricht. 291 Agamben 1982, 151. 292 Natürlich würde sich auch Fichte anbieten, den wir gelegentlich schon als Pate für Schmitzsche Anschauungen erwähnt haben und dessen »intellektuelle Anschauung«, und wie er es sonst in verschiedensten Ausdrücken bezeichnet, freilich auch genau diese Indifferenz von Subjekt und Objekt ausdrücken soll, die 290 117 zumeist nicht ins Bewusstsein, denn es »ist in der Welt wie wir sie jetzt erblicken, alles Regel, Ordnung und Form; aber immer liegt noch im Grunde das Regellose, [...] und nirgends scheint es als wären Ordnung und Form das Ursprüngliche, sondern als wäre ein anfänglich Regelloses zur Ordnung gebracht«.293 Solch Chaos passt eigentlich nicht in ein System, da es per se unverständlich und unintegrierbar zu sein scheint. Schelling, der hier natürlich die Idee des Unbewussten vorwegnimmt, nennt es in einer berühmten Formulierung den »nie aufgehende[n] Rest, das, was sich mit der größten Anstrengung nicht in Verstand auflösen läßt, sondern ewig im Grunde bleibt«.294 Selbiges gilt für Schmitz’ chaotisches Mannigfaltiges, das sich in der Welt wie wir sie kennen nur selten explizit zeigt, aber als Situation die Grundlage des In-der-Welt-seins darstellt; als persönliche Situation etwa ist es nie restlos erfassbar. Auch Schellings Denken ist unentschieden zwischen Chaos und Einheitlichkeit: Wenige Zeilen später im Text gibt es plötzlich im verstandlosen Chaos eine »unbewußt, als in einem Samen, aber doch notwendig enthaltene Einheit«, welche erst der Verstand zu entfalten vermag; so wie im Menschen in die dunkle Sehnsucht, etwas zu schaffen, dadurch Licht tritt, daß in dem chaotischen Gemenge der Gedanken, die alle zusammenhängen, jeder aber den andern hindert hervorzutreten, die Gedanken sich scheiden und nun die im Grunde verborgen liegende, alle unter sich befassende Einheit sich erhebt.295 Neben dem erneuten Beispiel für das chaotische Moment des Denkens (vgl. Kap. V.4) wird hier deutlich, dass ein Chaos, in dem gar keine Einheit statt hat, nicht nur undenkbar, sondern vor allem unmöglich in eine Beziehung zum vereinheitlichenden Verstand zu setzen wäre. Ist im Chaos nicht schon unbewusst, an sich, Einheit, kann sie auch nicht durch den Verstand hineinkommen; ein radikal nichtidentisches Ansich wäre für uns nichts. Exakt dies ist auch Schmitz’ Einsicht gewesen an derjenigen Stelle seiner Denkentwicklung, an welcher er, anschließend an die Differenzierung von Identität und Einzelheit, zwei Typen des chaotischen Mannigfaltigen unterschieden hat. Nur so können primitive Gegenwart als absolute Identität und chaotische Mannigfaltigkeit zusammen gedacht werden. War es bisher die Unentschiedenheit zwischen Identität und Verschiedenheit, die das chaotisch Mannigfaltige auszeichnen sollte, so gilt dies nun nur noch für einen Typ: den »konfusen«. Der andere (»diffuse«) ist genau derjenige, in welchem, wie beim unwillkürlichen Sprechen, das kein »Gebrabbel« ist, sondern einer ausgefeilten Regelmäßigkeit folgt, Identität vorhanden, aber unbewusst ist. »Identität« spricht Schmitz diesem chaotischen Mannigfaltigen deswegen zu, Schmitz umtreibt. Bei Schelling wird die Seinsdimension des Absoluten stärker gemacht als beim (frühen) Fichte, dem es ums Ich geht. Wie oben schon an Hand von Heidegger und Husserl festgestellt, steht Schmitz zwischen diesen beiden Polen (Ich und Sein). 293 Schelling 1809, 32. 294 Schelling 1809, 32. 295 Schelling 1809, 33. 118 weil es vor Verwechslung geschützt ist, also nicht gänzlich unentschieden bezüglich Identität und Verschiedenheit sein kann (vgl. Kap. V.4). Was an sich vorhanden ist, kann so auch für uns, also ausdrücklich bewusst werden. Nur weil das Chaos schon an sich Ordnung aufweist, können wir etwas damit anfangen, zum Beispiel in unwillkürliche Rede bewusst eingreifen. Diese dann bewusste Identität fasst Schmitz durch den Terminus »Einzelheit«, womit wiederum eine nicht nur terminologische Parallele zu Schelling gezogen ist: »Indem also der Verstand« – so Schellings Terminus für das bewusste Prinzip – die im unbewussten Chaos »verschlossene Einheit, den verborgenen Lichtblick, hervorhebt, so entsteht auf diese Art zuerst etwas begreifliches und Einzelnes, und zwar nicht durch äußere Vorstellung, sondern durch wahre Ein-Bildung [...] Erweckung [...] Entfaltung«.296 Der letzte Satz hat wiederum eine Entsprechung zu Schmitz’ Vorstellung, dass die Entfaltung der Gegenwart nicht als Projektion oder Konstruktion eines schon vorhandenen Subjekts äußerlich nur aufgeprägt wird, sondern dass durch sie beides – einzelne Subjekte und Objekte – erst hervorgebracht wird, die als Identische schon zuvor angelegt sind. Das affektive Betroffensein, als Modus der Indifferenz von Subjekt und Objekt, weist zudem bereits eine Reflexivität auf, auf welche sich das personal entfaltete Subjekt beziehen kann. Schellings »innere reflexive Vorstellung« im Absoluten, die nur »sich selbst«297 reflektiert, der »Zirkel, aus dem alles wird«, ein in sich Dynamisches, in der »kein Erstes und kein Letztes« ist, »weil alles sich gegenseitig voraussetzt«,298 entspricht dabei der Schmitz’ Konzept, dass Spontaneität und Rezeptivität im affektiven Betroffensein in eins fallen sollen, ohne jedoch eine reale Verschiedenheit von Beziehungsgliedern zu bezeichnen. Bei beiden bleibt indes gleichermaßen fraglich, wie eine Reflexivität zu denken sei, die nur ein Glied hat. Neben dieser in sich differenzierten Erscheinung des Absoluten für uns haben beide auch noch einen höheren Urgrund dessen anzubieten: Das Absolute an sich selbst, das Schmitz primitive Gegenwart und Schelling »absolute Indifferenz« nennt, um die Ungeschiedenheit zu betonen. Die Indifferenz ist nicht ein Produkt der Gegensätze, noch sind sie implicite in ihr enthalten, sondern sie ist ein eignes von allen Gegensatze geschiedenes Wesen, an dem alle Gegensätze sich brechen, das nichts anderes ist als eben das Nichtsein derselben und das darum auch kein Prädikat hat als eben das der Prädikatlosigkeit, ohne daß es deswegen ein Nichts oder ein Unding wäre.299 An paradoxalen Formulierungen im Versuch, das Unsagbare zu sagen, das Prädikatlose in prädikativer Sprache auszudrücken, sich urteilend über den Zustand vor der Urteilung zu äußern, stehen sich Schmitz und Schelling in nichts nach. An diesem exemplarischen Vergleich sollte deutlich geworden sein, wie nahe sich Philosophien kommen, die »aufs Ganze gehen« und dabei zugleich den divergenten Phänomenen gerecht zu werden suchen, 296 Schelling 1809, 34. Schelling 1809, 33. 298 Schelling 1809, 31. 299 Schelling 1809, 78. Damit richtet sich Schelling wohl gegen Hegels Vorwurf (vgl. Fußnote oben). 297 119 also weder nur Einzelprobleme für sich behandeln noch alles unter eine einheitliche Idee zu subsumieren suchen. Das ist in jedem Einzelfall eine Gratwanderung zwischen der vereinheitlichenden Kraft von Prinzipien, welche die Phänomene in ihrer Differenz gerade nicht zu erfassen droht und der Versuchung die Diversität und Nichtidentität so stark zu machen, dass jede aufschließende Kraft, sei es des Erklärens oder nur Beschreibens, abhanden kommt. Gerade der Versuch, noch das irrationale Chaos rationalem Begreifen zugänglich zu machen, spricht – selbst wenn der Versuch für gescheitert erklärt werden müsste – für die Problemsensibilität von Schmitz (und natürlich von Schelling), mag er zuletzt aber doch andeuten, wie Adorno es auszudrücken einmal sich durchgerungen hat, »daß man eigentlich nur dann philosophieren kann, wenn man das Absolute will«.300 2. Das Sagbare und das Unsagbare, das System und das Ich All dies bringt uns erneut in die Mitte eines grundlegenden philosophischen Problems, das wir bisher nur gelegentlich streiften: des Unterschieds zwischen Sagen und Zeigen. Schmitz’ Prinzip Gegenwart entzieht sich nicht nur dem aussagbaren Urteilen in Definition, Kriterium und Prädikat – wie in Kap. V.5 ausgeführt –, sondern auch – wie schon in Kap. V.1 angedeutet und oben erläutert – der Immanenz des Erfahr-, Begreif- und Beschreibbaren: der Sagbarkeit. In seiner Transzendenz ist es unsagbar.301 Mit dem Unterschied zwischen Sagbarem und Unsagbarem, Sagen und Zeigen beginnt nicht nur und nicht ohne Grund Hegels Phänomenologie. Im 20. Jahrhundert kommt diese »Grenzerfahrung« – wie wir in Kap. IV.2b gesehen haben – in den frühen Arbeiten Heideggers und Wittgensteins in den Blick; auch Schmitz führt derlei in seinen frühen Schriften noch aus. Bezüglich unseres eigentlichen Ausgangspunkts, des Ich, sprach er vor 1969 noch vom »Unsagbaren«. Was mit »ich« gemeint sei, könne »mit Hilfe des Pronomens der ersten Person [...] angedeutet werden [...], ohne daß es je gelingen könnte, zu benennen und dadurch sprachlich zu explizieren, worum es sich dabei handelt« (I, 10). Es sei unsagbar, was fehle, wenn wir uns nur objektiv beschreiben. Dieses Ergebnis ist sehr befremdlich. Ich bin ihm gemäß etwa gewissermaßen Unsagbares, das nach einer gewissen Hinsicht nur ich selbst, und auch ich nur in bloß für mich verständlicher Weise, beschreiben kann, wobei jeder Versuch, zu erläutern, worum es sich handelt, in eine Art Zirkel verstrickt ist (1968, 106). 300 Adorno 1962, 200. Damit soll weder hier noch bei Adorno gesagt sein, dass man dessen auch habhaft würde, noch dass man sich dieses Willens bewusst sein müsste; beides ist bei Schmitz nicht der Fall. Ähnliches meint Derrida der dies allerdings als Argument gegen Philosophie überhaupt verstanden wissen will (vgl. Derrida 1967, 86). Es ist in der Tat nicht klar, ob dieses Diktum Adornos, wenn es denn wahr sein sollte, überhaupt für Philosophie spricht. 301 Denkbar mag es wohl sein. Hier ist Wittgenstein zuzustimmen, der meint »um dem Denken eine Grenze zu ziehen, müssten wir beide Seiten dieser Grenze denken können (wir müssten also denken können, was sich nicht denken lässt). Die Grenze wird also nur in der Sprache gezogen werden können« (Wittgenstein 1921, 9). Oben hatten wir die Gegenwart ja auch bereits als »bloß gedacht« bezeichnet. 120 Im Versuch mit der verarmten Sprache hatte sich überdies herausgestellt, dass diese Unsagbarkeit, dass ich es bin, kein Mangel der Sprache ist. Der Punkt ist nicht, dass man manche Dinge in manchen Sprachen nicht genau oder gar nicht sagen kann. Wie sehr wir auch unsere Ausdrucksmittel bereichern und geschmeidiger machen mögen, werden wir doch dem Mangel nicht abhelfen können [...] Dieser Mangel ist also nicht im Sprachlichen, sondern in der Natur der Sache begründet. Dem eigentlichen Gegenstand unseres Selbstbewußtsein fehlt eine gewisse Sagbarkeit, d.h. die Eignung, durch eine gewisse Folge benennender Ausdrücke [...] beschrieben zu werden (I, 11). Diese Unmöglichkeit der Beschreibung hat Schmitz später in erheblich komplizierte Erklärungen verwandelt. Dieser Weg beginnt mit seiner Rede von subjektiven Tatsachen (1969), auf deren Grundlage es so scheinen könnte, als mache Propositionalität sie auch sagbar. Allerdings macht das Wort »ich« dahingehend Probleme, so dass es zum »Mir« wurde (1990). Die Mir-Subjektivität der subjektiven Tatsachen wurde zuletzt mit »absoluter Identität« (2008) ausgestattet, die so das unbeschreibliche des Ichseins, des Selbstbewusstseins bar jeder reflektierten Ichheit, gegenüber der »relativen Identität« oder Einzelheit verdeutlichen sollte. Wir haben aber oben gesehen, dass diese Rede keine Grundlage im Phänomen hat, sondern sich eines transzendenten Erklärungsgrundes – im Wort »absolut« ist dies ja auch unfreiwillig angedeutet – bedienen muss. Schmitz hätte vielleicht besser daran getan, weiter vom Unsagbaren zu reden. Denn wie die Rede von einem transzendenten Prinzip ausgewiesen werden könnte, inwiefern es sagbar sein könnte, ist in Ermangelung einer phänomenalen Grundlage unklar. Als Quelle dessen, was es heißt, dass ich jetzt dies hier bin, wurde es zunächst als undefinierbar und ausdrückbar, sondern nur erfahrbar erwiesen, bis klar wurde, dass es selbst auch nicht erfahren werden kann. Wie sollen wir dann darüber etwas sagen? Die indexikalischen Termini entziehen sich jeder objektiv angebbaren Bedeutung. Was es heißt, dass ich dies hier jetzt bin, zeigt sich nur. Es ist aber auch nicht erfahrbar, wie Schmitz meinte, sondern in jeder Erfahrung schon vorausgesetzt. Agamben behauptet gar, dass »das Problem des Zeigens und des ›Dieses‹ [...] das in gewisser Hinsicht ursprüngliche Thema der Philosophie abgibt«.302 Was sich als Dieses, als Jetzt, als Hier, als Ich und als bloßes »dass« des Seins sagen lässt, verweist nicht nur auf nichts Seiendes, »hat keine Bedeutung«, sondern, im Versuch, das Unsagbare zu sagen, auf das Absolute. Darüber zu staunen, dass überhaupt etwas ist, ist wohl einer der grundlegenden philosophischen Impulse, der sich schließlich in Fragen nach Raum, Zeit (Schopenhauer: »Warum ist dieses jetzt denn gerade jetzt?«), Identität usf. differenziert. Die unscheinbar und selbstverständlich wirkenden indexikalischen Termini entpuppen sich zusammen mit dem 302 Vgl. Agamben 1982, 34. Er verortet es schon bei Aristoteles, der in seiner Kategorienlehre die Unterscheidung dessen, was allgemeinbegriffliche Gattung ist und dessen, was – wie etwa eine einzelne Person – nur durch Demonstrativpronomen gezeigt werden kann. 121 »Sein« als »Ur«- oder »Ungrund«303 der Welt. Sie offenbaren die unvordenkliche Faktizität des Da-seins, »das Geheimnis des Da, nicht dessen, was da ist, sondern daß ›da‹ ist«,304 die ontologische Differenz zwischen dem Seiendem und dem Sein (Heidegger), dem Gesprochenen und der Existenz der Sprache selbst (Wittgenstein, mittlerer), dem Ungrund vor aller Begründung und Existenz (Schelling), der Welt und dem, was kein Teil der Welt, sondern dessen Grenze (Wittgenstein, früher) bzw. »unterhalb der Welt« (1999a, 158) ist und zugleich dem, was kein Was, sondern ein Wie ist und nur so ein Wer werden kann, wie wir im Anschluss an und in Weiterentwicklung von Schmitz gesagt haben. * All dies hat sich uns im Anschluss an die Frage »Wer bin ich?« ergeben, die auf die »paradoxe Konkurrenz von Bestimmbarkeit und Unbestimmbarkeit« (1968, 107) subjektiver und objektiver Sachverhalte, von Wie- und Was-Identität etc. verwies, die Schmitz »das Ichproblem« (1968, 108) im Selbstbewusstsein nannte. Von diesem aus bekamen wir es im Handumdrehen mit dem Unendlichen, dem Absoluten und Transzendenten zu tun. In mehrfacher Hinsicht hat sich nun gezeigt, dass auch Schmitz dieses Problem weder löst noch auflöst, sondern in seinen selbst paradoxen Lösungsversuchen für die Paradoxien des Selbstbewusstsein dies nur in seiner Fraglichkeit vor Augen führt. Die Frage »Wer bin ich?« bleibt offen, insofern wirklich unentschieden ist und bleibt, wie das, was ich bin, mit dem zusammenhängt, wer ich bin. Weder vermochte der Verweis auf die unmittelbar spürbare Leiblichkeit das Wie als Brücke zwischen Was und Wer bereitzustellen noch der Verweis auf Unentschiedenheit die Bauweise dieser Brücke plausibel zu machen. Schmitz prätendiert zunächst eine Unmittelbarkeit im präpersonalen und dann eine Vermittlung zum personalen Selbstbewusstsein, die er empirisch-phänomenal beide nicht ausweisen kann. Schmitz’ Ansatz könnte fruchtbar sein, wenn er das Absolute als Absolutes einerseits, andererseits aber auch dessen Problematik anerkennen würde. Womöglich sind es tatsächlich genau die fünf Momente der Gegenwart, die sich der systematischen Erfassung versperren: dass überhaupt etwas ist, dass ich es bin, dass eben dies, jetzt und hier ist. Nicht umsonst hat Hegel ihnen gleich zu Anfang den Eingang ins System verwehrt. Indem sich nicht sagen lässt, was mit ihnen gemeint ist, indem sie keine allgemeine Bedeutung haben, entziehen sie sich der systematischen Erfassbarkeit. Wir können es nicht weiter erklären, wir wissen einfach, was es heißt ich, dieses, hier, jetzt usf. zu sein. Sein, Ich, Wirklichkeit, Identität, Raum und Zeit sind offenbar Themen, die einen Bogen um Metaphysik nicht erlauben – auch nicht als dezidierter Antimetaphysiker wie Schmitz. Als metaphysisches Prinzip, das gewährleistet, 303 304 Schelling 1809, 78. Gadamer 1989, 65. 122 was anderweitig nicht beigebracht werden kann, wäre die Gegenwart geeignet. Auch dann noch würde sie freilich verdächtig viele Fliegen mit einer Klappe schlagen und auf den Modus des Wissens von ihr, ihre Begründung oder den Grund ihrer Unbegründbarkeit hin zu befragen sein. So aber will Schmitz ständig zu viel, überschreitet die Grenzen des Sag- und phänomenal Ausweisbaren, indem er ständig Konstruiertes mit Erlebtem vermengt und zeigt sich so als unentschlossen dazwischen, einerseits ein »System der Philosophie« zu entwerfen und andererseits den Phänomenen der unwillkürlichen Lebenserfahrung gerecht zu werden – ein Unterfangen, das man ohnehin schon lange für unvereinbar hielt und das ihn, wenn man so will, zwischen Hegel und Kierkegaard oder Spinoza und Jacobi verortet. Deshalb exemplifiziert sich hier schön der Aphorismus von Schlegel, dass man zugleich ein System haben müsse, aber auch keins. Wer eins hat, tendiert dazu, über das Systematisieren die Phänomene, zum Beispiel sich selbst, zu vergessen. Wer keins hat, tendiert dazu, im ungeordneten Chaos gleichgültiger Einzelteile zu versinken. Was aber könnte es heißen, wie Schlegel fordert, beides zu verbinden? II. Die Person zwischen Leib und Seele 1. Hat die Person einen Leib oder der Leib eine Person? Präpersonales Selbstbewusstsein ist ein leibliches Phänomen. Die Tendenz hin zur – als primitive Gegenwart bestimmten – leiblichen Enge bringt unmittelbare Selbstidentität mit sich. Das personale Selbstbewusstsein ist an diese Leiblichkeit gebunden. Was aber ist es selbst? Wodurch erheben sich Personen über den Leib? Das ist nicht ganz klar. Schmitz’ Menschenbild ist keines der Schichten, etwa aus Leib und Person statt Körper und Seele. Der Leib ist ihm generell der Ausgangspunkt und »irgendwie leiblich« sind im Grunde alle Phänomene.305 Noch Denken versucht Schmitz als »leibliches Geschehen« zu interpretieren (vgl. 1968, 23 ff.). In der Tat zeigt Schmitz eine »Tendenz, das leibliche Befinden weit über das hinaus, was die Phänomene zulassen, zu autonomisieren«.306 »Der Leib ist in gewisser Weise alles«, könnte man in Abwandlung einer Spruchs des Aristoteles über die Seele sagen, hätte sich diese Tendenz nicht in Schmitz’ späteren Arbeiten etwas gelichtet. Nun empfiehlt er, sich zu »hüten, das Schlagwort ›Leib‹ durch Überbetonung zu Tode zu reiten« (2004a, 143) Und in der Tat ist es ja nicht gerade plausibel den Begriff der Leiblichkeit so weit auszudehnen, dass er mangels Entgegensetzung jede Spezifik und damit Aussagekraft 305 306 Wahrnehmung etwa ist »Einleibung« (III.5). Soentgen 1998, 58. 123 verliert.307 Was sagt es noch aus, wenn mein Hunger und mein Gedanke daran, dass ich diese Arbeit bald abgeben muss, beide leiblich sein sollen? Fragt man allerdings, was zur Leiblichkeit hinzu kommt, sind Schmitz’ Auskünfte noch immer etwas dürftig. Beim Menschen, sofern er Person ist, kommt hinzu, daß er sich in Preisgabe oder Widerstand mit seinem affektiven Betroffensein durch Gefühle und leibliche Regungen auseinandersetzen kann; dadurch gewinnt seine Art, leiblich zu sein, ihre persönliche Prägung. Das verdankt die Person ihrer Fähigkeit zur Selbstzuschreibung. [...] Das ist aber nicht so zu verstehen, als ob eine höhere Instanz, der Geist, aus einer ihm vorbehaltenen Oberschicht, wenn auch getragen und bedient vom Leib, auf diesen zurückkäme. Im Gegenteil ist die Selbstzuschreibung [...] nur durch eine Art Spagat zwischen affektivem Betroffensein und Distanzierung möglich. [...] Die Person in ihrer vom Leib sich distanzierenden Geistigkeit ist [...] Person und Geist nur dadurch, daß sie zur Ermöglichung der sich [...] distanzierenden personalen Selbstzuschreibung und Rechenschaft in das leiblich-affektive Betroffensein eintaucht. An die Stelle des Dualismus von Seele (Geist) und Körper tritt die Ambivalenz von personaler Emanzipation vom Leib durch Neutralisierung einerseits und Eintauchen in leiblichaffektives Betroffensein in der Person andererseits. Personsein ist Leibsein im Sich-distanzieren davon durch Objektivierung (Neutralisierung) der subjektiven Tatsachen des affektiven Betroffenseins und in Resubjektivierung durch dieses Betroffensein (2004a, 144 f.). Wir haben es also nicht mit zwei Substanzen zu tun, die irgendwie zusammenwirken oder auch nicht und sich in beiden Fällen nach ihrer Einheit fragen lassen müssen, sondern mit nur einer »Substanz«, welche die Grundlage bildet und ein »Attribut« besitzt, das allerdings die seltsame Fähigkeit hat, »sich selbst« etwas zuzuschreiben. Distanzierung vom und Zurückkommen auf den Leib sind »eine Art Spagat«, den die leibliche Substanz selbst vollzieht. Sollte dies nur besagen, dass Personsein an Leibsein gebunden ist, wäre daran nichts zu bemängeln. Von unleiblichen Wesen wissen wir nichts, nicht einmal von unkörperlichen. Nun soll es aber gerade nicht eine Oberschicht sein, die sich auf ihre Voraussetzungen bezieht, sondern nur eine Art Elastizität oder »Spreizung« (Brief) der einzigen Schicht beschreiben, welche an die Ur-Teilung des Einen ursprünglich indifferenten Absoluten erinnert (vgl. Anhang I). Die enge, nicht-dualistische Bindung an den Leib soll deswegen mehr besagen, als dass Personsein daran nur gebunden ist, da es sonst nahe läge, Personen als einen Leib habend zu bestimmen. Die Unterscheidung in »Körper-Haben« und »Leib-Sein«, welche die Unmittelbarkeit des leiblichen Erlebens gegenüber dem mittelbaren Körpererleben verdeutlichen soll, wäre dann hinfällig.308 Folgt aber aus dieser im Prinzip plausiblen Unterscheidung, dass Personsein Leibsein ist? Offenbar nicht. Auf Grund der Personen bis zur Leibverneinung möglichen Distanzierungsfähigkeit von leiblichen Regungen und nicht zuletzt der schwerlich auf Engung, Weitung und absolute Örtlichkeit reduzierbaren Fähigkeit zur Reflexion, zum Denken, sagt Leib-Sein zu viel. Leib-Haben hingegen trägt der von Schmitz richtig beobachteten Unmittelbarkeit des leiblichen Erlebens nicht Rechnung. 307 Dem Körper bleibt er allerdings strikt entgegengesetzt, sodass der alte Dualismus zwischen Körper und Seele (allerdings zumeist unter dem hier ungenauen Titel »Leib-Seele-Dualismus« firmierend), lediglich zu einem von Körper und Leib zu werden scheint (dazu gleich). 308 Vgl. für eine solche Unterscheidung etwa Plessner 1928, 294 ff., der ebenso vom absoluten, leiblichen HierJetzt spricht (vgl. ebd., 288). 124 Dieses »haben« wir nicht in reflektierender, zuschreibender Verfassung, wie etwa ein Buch in der Hand oder etwas sich gegenüber zu haben. Starke Schmerzen, panische Angst, etc. sind phänomenal in der Tat unmittelbar meine, im Moment ohne Distanzierungsfähigkeit bin ich sie gewissermaßen (auch wenn sie kategorial zur Erklärung der Ich-Identität nicht hinreichen mögen). Zum Leibsein und Körperhaben kommt also das Personsein hinzu. Das kann Schmitz nicht sagen, obwohl er im Prinzip sieht, dass eine Identifizierung von Personsein und Leibsein nicht einfach aufgeht. Doch so schwierig scheint das Verhältnis von Person und Leib tatsächlich zu sein, dass weder bloßes Leib-Sein noch bloßes Leib-Haben eine angemessene Formulierung darstellt. Dieser Trialismus aus Person/Seele/Denken, Leib und Körper mag unbefriedigend sein, ist aber redlicher als seine vorschnelle Auflösung nach einer oder zwei der Seiten wie etwa im Materialismus (Körper), bei Descartes (Körper und Seele), Leibniz (Seele), Schmitz (Leib und Körper) usf. Schmitz selbst hatte vor 1969 noch Körperliches, Leibliches und Seelisches unterschieden (vgl. II.1, 6; 1968, 5), ist dann aber vom letzten Begriff abgerückt. Sofern die Person aber nicht als bloß leiblich charakterisiert werden kann, mag sich der Begriff des Seelischen als des Denkenden erneut anbieten.309 309 Allerdings hat Schmitz vielerlei gegen den Seelenbegriff eingewendet. Prüfen wir daher, ob er in seiner Konzeption diesen Einwände etwas entgegenzusetzen vermochte. Erstens sei die Seele gegenüber dem Körper als unausgedehnt konzipiert. So werde das leibliche Gespürte vergessen, das zwar unteilbar, aber dennoch ausgedehnt sei: Schmerz oder Mattigkeit etwa könnten daher in einer Seele keinen Platz haben. Nun ist das durchaus einleuchtend und Schmitz Betonung des Leiblichen gegen die cartesianische Tradition hat hierin ihr Recht. Doch was sollen wir über das eigentliche Charakteristikum der klassischen Seelenvorstellung, das Denken, sagen? Ist Denken ausgedehnt? Es soll hier nicht die Rede von einem »reinen Denken« sein, das vom Leib ganz abgelöst wäre. Davon wissen wir nichts. Aber selbst wenn es stimmt, dass wir immer durch Im-Raum-sein gekennzeichnet sein mögen, so fällt es doch schwer, dies für das Denken zu behaupten und nicht nur für das stets auch gegebene eigenleibliche Spüren. Was am Gedanken, dass etwas unendlichfach unentschieden ist, ist beispielsweise räumlich? Wenn aber nicht alles Seelische fraglos als ausgedehnt gelten kann, ist das Argument im Ganzen hinfällig. Zweitens, und damit zusammenhängend, seien abgeschlossene Innenwelten phänomenologisch schlicht nicht ausweisbar, sondern der Mensch sei durch In-der-Welt-sein gekennzeichnet, durch Verstrickung in Situationen. Dieses konnte aber durch Schmitz von einem anonymen Prozess nur dadurch unterschieden werden, dass dem Subjekt eine »Basis« in der Mir-Subjektivität zugewiesen wurde, die sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie für mich und nur für mich ist. Das ist zwar keine »Innenwelt«, doch aber ein Innen, das kein äquivalentes Korrelat im Außen, ein Mir, das kein Korrelat im Dir bzw. Euch hat. »Subjektivität« in diesem Sinne »sorgt für eine unaufhebbare Einsamkeit im Erleben jedes Einzelnen« (Großheim 1994, 45). Wenn dem aber so ist, gibt es, wenn auch keine Innenwelt, so doch einem unzugänglichen Kern eines jeden, dem kein In-der-Welt-sein seine Abgeschlossen- und Abgeschiedenheit nimmt. Drittens wendet er sich gegen die Statik einer Schichtenvorstellung des Seelenbegriffs und setzt dem sein Konzept der persönlichen Situation mit der Dynamik aus Emanzipation von und Regression auf primitive Gegenwart entgegen. Nun ist die persönliche Situation aber gerade nicht die Person, sondern diese »bewohnt gleichsam ohne Lokal, ohne Wohnsitz« jene. »Für die Person ist die persönliche Situation einerseits die bergende Hülle, andererseits ein Partner, der sie herausfordert, über den sie sich nicht hinwegsetzen kann« (1999a, 114 f.). Das sind leider nur schöne Metaphern: wohnen, umhüllen, andernorts findet sich auch: aufhalten (vgl. 1999a, 106 f.). Das Verhältnis von Person und persönlicher Situation ist nicht durchsichtig – und zwar nicht nur in praxi, sondern für uns, die es theoretisch zu verstehen suchen. Schmitz’ Ablehnung des Seelenbegriffs beschert uns also drei Alternativen, den räumlichen Leib, das einsame Mir und die wandelbare persönliche Situation, die für die Bestimmung der Person aber allesamt nicht aufschlussreich sind. Weiter könnte man meinen, gegen den Seelenbegriff spräche zudem seine ganz unklare Verbindung mit dem Körper; die ist aber bei Schmitz ebenso unklar: Leib und Körper haben ebenso wenig miteinander zu tun wie Person und Körper (nicht 125 Nicht weil das sonderlich innovativ oder unproblematisch wäre, sondern weil Schmitz’ Konzept keine bessere Bestimmung der Person anbietet. Ihm ist die Person keine Entität sui generis, sondern nur eine ambivalente, dynamische Einheit mit allerdings einseitigem Kern in der Affektivität und Einheitsmoment in der primitiven Gegenwart ist. Diese wird gegenüber der entfalteten überbewertet, obwohl sie uns im Gegensatz zu ihr gar nicht als solche bekannt ist. Zwar wurde der »Spielraum der Gegenwart« als zwischen den beiden Abgründen der primitiven und entfalteten Gegenwart bestimmt, doch leidet dieser unter einer einseitigen Fixierung auf erstere, von welcher letztere und damit die Person nur ein Derivat zu sein scheint. Bestimmen wir Denken nicht nur im Sinne von Schmitz analytisch als Explikation von Einzelnem aus dem vorgängigem Ganzen, sondern beziehen auch dessen synthetische Leistungen mit ein, so ist es diejenige grundlegende Eigenschaft der Person, die unter anderem zur Selbstzuschreibung befähigt und ihr außerdem eine Welt erschließt, die Gegenwart zur Welt entfaltet. Dann ist die Person allerdings nicht nur eine Seite der Entfaltung der Welt, sondern hat selbst Anteil daran.310 2. Wer, Wie, Was Die Verschlingung von Person, Leib und Welt in Schmitz’ Theorie untergräbt einen angemessenen Begriff der Person. Die »komplizenhafte Intimität« (IV, 382) zwischen Person und Leib muss, ebenso wie die zwischen Person und Welt, auch aufbrechen können. Sonst verschwimmen sie ineinander und vereiteln eine zureichende Thematisierung der Person, die ihrer Eigenständigkeit gegenüber primitiver (Leib) ebenso wie gegenüber entfalteter Gegenwart (Welt) gerecht zu werden vermag. Das Verhältnis von Personen zu ihrem Leib und ihrer Welt ist wesentlich durch die Befähigung zur Abstandnahme gegenüber beiden ausgezeichnet. Personen sind weder korrelativ zur Welt noch nur ein Spagat des Leiblichen. einmal Person und Leib ließen sich ja in ein verständliches Verhältnis bringen, s.o.). Körper sind für Schmitz Gegenstand der Naturwissenschaft und ihre wundersame Entsprechung zum spürbaren und phänomenologisch thematisierbaren Leib gilt ihm als unerklärlich (vgl. 1990, 116). 310 Hieran lässt sich ein Gedanke von Henrich anschließen: Person und Welt sind auch seiner Ansicht nach nicht korrelativ, »sondern in einem grundlegenden Ungleichgewicht. [...] Die Alternative zwischen einer reinen Weltimmanenz [...] und einer Weltkonstitution durch das Bewußtsein ist auf beiden Seiten kurzschlüssig. Die korrelativen Mängel beider Positionen lassen sich aber nicht durch die Behauptung einer einfachen Korrelation von Welt und Bewußtsein heilen« (Henrich 1982, 140 f.). Da Schmitz inzwischen selbst die »satzförmige Rede« als »Ursprung« der Entfaltung der Gegenwart auszeichnet, liegt eine Aufwertung der Person auch von seiner Warte aus im Grunde nahe. Zwar interpretiert er dem gemäß die Person einfach als Ergebnis der satzförmigen Rede, doch: »das können wohl nur Menschen sein, die so geredet haben«. Aus dieser paradoxen Feststellung folgt aber entweder, dass »die Sprache spricht« (Heidegger 1950, 10) und nicht die Person, oder dass Menschen ohne Fähigkeit zur Selbstzuschreibung (die also keine Personen sind) schon satzförmig reden und dadurch zur Person werden. Oder eben, dass die Person doch gegenüber der Entfaltung vorgängig ist und an ihr mitwirkt. Schmitz meint hingegen: »Damit haben sie aber nicht gleich die Welt konstituiert, sondern nur den Funken entzündet, an dem sich Gegenwart entfalten konnte« (alle Zitate: 2005, 18). Das macht freilich nichts klarer, sondern veranschaulicht lediglich die Probleme mit Aktivität und Passivität, welche Schmitz’ ganzes Philosophieren durchziehen. 126 Da bei Schmitz aber alles Entscheidende bereits auf der präpersonalen, nur leiblichen Ebene verortet und was darüber hinaus geht bloß weltkorrelativ ist, sieht er die Frage »Wer bin ich?« auch schon wie folgt beantwortet: »Subjektivität« – und nicht Personalität – »kann als Antwort auf die Frage ›Wer bin ich?‹ bestimmt werden« (1999a, 82) Damit ist zwar richtig gesehen, dass diese Frage nicht durch die Angabe von bestimmten Eigenschaften geschehen kann: Nichts an der Aufzählung derer macht aus, dass ich es bin, dem sie zukommen. Schmitz’ Lösung leidet aber an dem Manko, das Ungenügen der bloß reflektierten Ebene mit dem Rekurs auf das bloß Unmittelbare zu beantworten. Zwar mag ein solches Subjekt implizite Kenntnis davon haben, wie es ist, dies hier jetzt zu sein und so selbst etwas sein. Da es aber um sein Was-sein, sein etwas als etwas sein weder implizit noch explizit weiß, müssen wir ihm sowohl Selbstbewusstsein im vollen, Reflexion und Denken einschließenden Sinne als auch das »jemand« sein absprechen, das als Antwort auf die Frage »Wer bin ich?« sehr viel angemessener erscheint. Beides zusammen (wie es ist, je dies hier jetzt zu sein und was sie ist), so unser Gegenvorschlag, machen erst die Person aus, die »Wer bin ich?« fragen und dies prinzipiell auch beantworten kann, weil sie denken kann, nicht nur selbst etwas ist, sondern auch überlegen kann, was sie ist, sein will, etc. Demnach lassen sich die »personalen Identitäten« auch als Wer-, Was- und Wie-Identität bezeichnen.311 Personen haben Wer-Identität, die sich daraus zusammensetzt, was sie sind und wie es ist, dies hier jetzt zu sein. So können wir die Tabelle aus Kap. V.3 (hier blau gekennzeichnet, wegen Platzmangels unter Auslassung einer Spalte) mehrfach erweitern: Erstens um eine Spalte »personaler Identitäten«, zweitens um den missing link zwischen Leiblichkeit und Personalität: das Denken, welches wir hiermit gegenüber Schmitz rehabilitieren, bei dem es in dem Maße zu kurz kommt, in dem Leiblichkeit und Unmittelbarkeit überbewertet werden. Drittens tragen wir eine »Tiefenschicht« als Zeile ein, welche die Basis in chaotisch-mannigfaltigen Situationen darstellt, die all dies nach Schmitzschem Verständnis hat. 311 Die in diesem Zusammenhang eingeführten Begriffe Wer, Wie und Was stammen nicht von Schmitz und sie gehen auch inhaltlich über seine Überlegungen hinaus. Die Unterscheidung in Wer- und Was-Identität entlehnen wir von Jacobi (vgl. Sandkaulen 2004, 229 ff.), die Ergänzung durch die Wie-Identität aus Nagels »What it is like to be ...«-Formulierung, die sich im Deutschen am besten als »Wie es ist, sich anfühlt, ... zu sein« wiedergeben lässt (vgl. Nagel 1974) und sich auch schon bei Heidegger findet, der das dass der existentia gegenüber dem was der essentia bisweilen als wie bestimmt (vgl. 1996a, 252 ff.; Großheim 1994, 43). 127 Identitäts- Seins- Ontolog. Person. art weise Grundlage Dynamik (Keine Anonym Chaot. mannigf. Persönliche Un- u. Vor- (Unbestimm- Weltstoff Situation bewusstes Pers. Regr. Leiblichkeit Besonderheit Identität) Wie-Identität Selbst etw. Prim.Gegenwart Modus »Quantität« barkeit) Was-Identität Als etwas Entf. Gegenwart Pers. Emanz. Denken Allgemeinheit Wer-Identität Jemand Spielraum Person Personalität Einzelheit Nach wie vor darf die letzte Zeile als Vermittlung der vorherigen beiden verstanden werden, die nach Schmitz im Modus der instabilen Mannigfaltigkeit bewerkstelligt werden soll. Die Problematik dieses quasidialektischen Ansatzes haben wir gesehen; wie die Vermittlung tatsächlich vor sich geht, wagen wir hier nicht zu beantworten. Ein dynamisches Konzept scheint angezeigt, doch litt das Schmitzsche an seiner einseitigen Anbindung an einen Pol. Zwar läge es nahe, die dynamische Vermittlung schlicht im Denken anzusiedeln. Man geriete dann aber in diffizile Referenzprobleme und fände sich am Ende wohl bei Hegel wieder, dem letztlich alles (im) Denken (aufgehoben) ist, worüber die Unterschiede und insbesondere die Jemeinigkeit, das selbst etwas sein der Wie-Identität verloren zu gehen drohen. Durchaus jedoch in der Hegelschen Terminologie und nahe an Schmitz lässt sich das Wie als Besonderheit, das Was als Allgemeinheit und deren Vermittlung im Wer als Einzelheit fassen.312 Doch verstehen wir sie nicht wie bei Hegel, und hier ganz im Sinne von Schmitz, als Instantiierungen einer allumfassenden Struktur, des Begriffs, da uns die Besonderheit des Wie kein Derivat der Allgemeintheit des Was ist, sondern einer Quelle sui generis bedarf. Auch deswegen werden die beiden heterogenen Momente in der Einzelheit des Wer nicht aufgehoben, sondern nur vermittelt. Für das Selbstbewusstsein bedeutet dies, dass nur diese Vermittlung der beiden ersten Ebenen, wie immer die auch geschieht, als Selbstbewusstsein im vollen Sinne gelten kann. Das personale Selbstbewusstsein ist nicht ein abkünftiger Modus des präpersonalen, sondern beide Elemente, unmittelbare und reflexive Identität sind essentiell für seine Struktur. Weder im reinen Denken noch bloß in der Leiblichkeit findet sich ein Grund wirklicher Ich-Identität. Während diese nur dumpf und momentan vor sich existiert, zwar selbst etwas sein, aber nichts davon wissen kann, könnte jenes sich nur identifizieren, wenn es bereits identisch wäre, wovon nicht zu sehen ist, wie dies geschehen soll. Demnach hat Schmitz auch deswegen keinen zufrieden stellenden Begriff von Selbstbewusstsein, weil er keinen solchen der Person 312 Schmitz sagt »Bestimmtheit« statt Allgemeinheit, betrachtet diese aber auch zusammen mit der Besonderheit, die er als Entschiedenheit über Identität und Verschiedenheit definiert, als Zutaten der Einzelheit (vgl. 1999a, 32 ff.). 128 hat. Weder das präpersonale noch das personale Selbstbewusstsein können als das ihrige der Person gelten. Wir sehen, dass eine Theorie des Selbstbewusstseins auch eine Theorie der Personalität sein muss und die Unzulänglichkeit der letzteren auch erstere zu vereiteln droht. Nur Personen haben Selbstbewusstsein im vollen Sinne. Sie sind Einzelne, weil sie Allgemeines und Besonderes vereinen. Da ihre Besonderheit, ihr selbst etwas, ihr Wie, ihre Jemeinigkeit kein Derivat der Allgemeinheit ist, laufen sie nicht Gefahr nur Instantiierungen einer übergeordneten Struktur zu sein. Obwohl sie Ergänzungen enthält, die über Schmitz hinausgehen, ist obige Tabelle (und die angeschlossenen Reflexionen) nicht so sehr schon als Lösung, sondern als Veranschaulichung des Ansatzes und seiner Problematik zu begreifen. So haben wir versucht, einen Begriff von Person und Selbstbewusstsein zu entwickeln, der Unmittelbarkeit und Reflexion vereinen und doch nicht ineinander aufheben muss. Dafür müssen wir, durchaus im Sinne von Schmitz’, sowohl auf weitere Erklärung als auch auf Aufhebung in eine höhere Sphäre verzichten, sondern können nur konstatieren. Selbstbewusstsein im vollen Sinne, das nur Personen zukommt, kann nur beides sein: Unmittelbarkeit und Reflexion, Affektivität bzw. Leiblichkeit und Denken, Besonderheit und Allgemeinheit, Wie und Was, selbst etwas und etwas als etwas, subjektive und objektive Tatsache, jemeins und doch nicht nur meins, unsagbar und sagbar, usf. 129 Literaturverzeichnis Literatur von Hermann Schmitz 1964-1980: System der Philosophie. 5 Bände in 10 Teilbänden, Studienausgabe, Bonn: Bouvier 2005. 1968: Subjektivität. Beiträge zur Phänomenologie und Logik, Bonn: Bouvier. 1972: Nihilismus als Schicksal?, Bonn: Bouvier. 1982: Zwei Subjektbegriffe. Bemerkungen zu dem Buch von Ernst Tugendhat: Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung, in: Philosophisches Jahrbuch 89, S. 131-142. 1987: Mannigfaltigkeit ohne Verschiedenheit. Zur Einheit des Bewußtseins, in: H. Kimmerle (Hg.), Das Andere und das Denken der Verschiedenheit, Amsterdam: Grüner, S. 23-35. 1989: Was wollte Kant?, Bonn: Bouvier. 1990: Der unerschöpfliche Gegenstand. Grundzüge der Philosophie, Bonn: Bouvier 32007. 1991: Leibliche und personale Konkurrenz im Selbstbewußtsein, in: B. Kienzle & H. Pape (Hg.), Dimensionen des Selbst. Selbstbewußtsein, Reflexivität und die Bedingungen der Kommunikation, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 152-168. 1992a: Die entfremdete Subjektivität. Von Fichte zu Hegel, Bonn: Bouvier. 1992b: Zeit als leibliche Dynamik und ihre Entfaltung in Gegenwart, in: Forum für Philosophie Bad Homburg (Hg.), Zeiterfahrung und Personalität, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 231-246. 1993a; Die Liebe, Bonn: Bouvier. 1993b: Selbstbewußtsein und Selbsterfahrung, in: Logos N.F. 1, S. 104-122. 1993c: Gefühle als Atmosphären und das affektive Betroffensein von ihnen, in H. Fink-Eitel & G. Lohmann (Hg.): Zur Philosophie der Gefühle, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 33-56. 1994a: Neue Grundlagen der Erkenntnistheorie, Bonn: Bouvier. 1994b: Wozu Neue Phänomenologie?, in: M. Großheim (Hg.), Wege zu einer volleren Realität. Neue Phänomenologie in der Diskussion, Berlin: Akademie, S. 7-18. 1996a: Husserl und Heidegger, Bonn: Bouvier. 1996b: Bewußtsein als instabiles Mannigfaltiges, in: S. Krämer (Hg.), Bewußtsein. Philosophische Beiträge, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 167-183. 1999a: Der Spielraum der Gegenwart, Bonn: Bouvier. 1999b: Adolf Hitler in der Geschichte, Bonn: Bouvier. 1999c: Personale und präpersonale Subjektivität, in: Logos N.F. 6, S. 52-66. 1999d: Ironie und Pathos im nachromantischen Zeitalter, in: Sinn und Form. Beiträge zur Literatur 51, S. 862880. 2003a: Was ist Neue Phänomenologie?, Rostock: Koch. 2003b: Die Grenzen des »exzentrischen« Subjekts [Renzension zu: Helmut Plessner, Elemente der Metaphysik], in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 51, S. 873-876. 2003c: »Ja, wenn Sie mir das sagen können, wer ich bin« [Rezension zu: Klaus Düsing, Selbstbewußtseinsmodelle], in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 51, S. 526-532. 2003d: Wie Tiere sind, in: Andreas Brenner (Hg.), Tiere beschreiben, Erlangen: Fischer, S. 86-104. 2004a: Situationen und Konstellationen. Wider die Ideologie totaler Vernetzung, Freiburg/München: Alber. 2004b: Naturwissenschaft und Phänomenologie, in: Erwägen Wissen Ethik 15/2, S. 147-154. 2004c: Phänomenologie als Anwalt der unwillkürlichen Lebenserfahrung, in: Erwägen Wissen Ethik 15/2, S. 215-228. 2005: Hermann Schmitz im Dialog. Neun neugierige und kritische Fragen an die Neue Phänomenologie, hg. v. H. Schmitz und W. Sohst, Berlin: Xenomoi. 2007a: Der Weg der europäischen Philosophie. Eine Gewissenserforschung, Bd. 1: Antike Philosophie, Freiburg/München: Alber. 2007b: Der Weg der europäischen Philosophie. Eine Gewissenserforschung, Bd. 2: Nachantike Philosophie, Freiburg/München: Alber. 2007c: Freiheit, Freiburg/München: Alber. 2008: Logische Untersuchungen, Freiburg/München: Alber. 130 Weitere Literatur Adorno, Theodor W. (1956): Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über Husserl und die phänomenologischen Antinomien, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1970. Adorno, Theodor W. (1962): Philosophische Terminologie, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1973. Adorno, Theodor W (1966): Negative Dialektik, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Agamben, Giorgio (1982): Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività, dt. Übers.: Die Sprache und der Tod. Ein Seminar über den Ort der Negativität, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2007. Albert, Hans (1968): Traktat über kritische Vernunft, Tübingen: Mohr Siebeck 51991. Andermann, Kerstin (2007): Spielräume der Erfahrung. Kritik der transzendentalen Konstitution bei MerleauPonty, Deleuze und Schmitz, München: Fink. Arndt, Andreas (2004): Unmittelbarkeit, Bielefeld: Transcript. Avenarius, Richard (1891): Der menschliche Weltbegriff, Leipzig: Reisland. Berkeley, George (1710): A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, in: ders., Principles of Human Knowledge and Three Dialogues, Oxford University Press 1999, S. 1-95. Bloch, Ernst (1963): Tübinger Einleitung in die Philosophie, Frankfurt am Main: Suhrkamp 31982. Blume, Anna (2003): Scham und Selbstbewusstsein. Zur Phänomenologie konkreter Subjektivität bei Hermann Schmitz, Freiburg/München: Alber. Blume, Anna (2004): »Ich denke Gehirn«. Phänomenologie und Neurowissenschaft, in: Erwägen Wissen Ethik 15, Heft 2, S. 157-159. Böhme, Gernot (1986): Philosophieren mit Kant, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Christians, Ingo (1998): Hermann Schmitz und die Grundlegung einer neuen Phänomenologie, in: Philosophisches Jahrbuch 105, S. 162-177. Condillac, Étienne Bonnot de (1754): Traité des sensations, dt. Übers.: Abhandlung über die Empfindungen, Hamburg: Meiner 1983. Damasio, Antonio R. (1999): The feeling of what happens. Body and emotion in the making of consciousness, dt. Übers.: Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins, München: List 32001. Damasio, Antonio R. (2000): Eine Neurobiologie des Bewußtseins, in: A. Newen & K. Vogeley (Hg.): Selbst und Gehirn. Menschliches Selbstbewußtsein und seine neurobiologischen Grundlagen, Paderborn: mentis, S. 315-331. Denker, Alfred/Kisiel, Theodor/Zaborowski, Holger (2008): Heideggers formale Anzeige. Ein Gespräch, in: Information Philosophie 01/2008, S. 102-104. Derrida, Jaques (1967): La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl, dt. Übers.: Die Stimme und das Phänomen. Einführung in das Problem des Zeichens in der Phänomenologie Husserls, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003. Derrida, Jaques (1972): Positions, dt. Übers.: Positionen. Gespräche mit Henri Ronse, Julia Kristeva, JeanLouis Houdebine, Guy Scarpetta, hg. v. P. Engelmann, Graz: Böhlau 1986. Derrida, Jaques (1988): La différance, dt. Übers.: Die différance, in: P. Engelmann (Hg.): Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart, Stuttgart: Reclam 1990, S. 76-113. Dilthey, Wilhelm (61991): Die Typen der Weltanschauung und ihre Ausbildung in den metaphysischen Systemen, in: ders.: Weltanschauungslehre. Abhandlungen zur Philosophie der Philosophie, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. Düsing, Klaus (1997): Selbstbewußtseinsmodelle. Moderne Kritiken und systematische Entwürfe, München: Fink. Fehige, Joerg H. Y. (2007): Sexualphilosophie. Eine einführende Annäherung, Berlin: Lit. Fichte, Johann Gottlieb: Fichtes Werke in 11 Bänden, hg. v. I. H. Fichte, ND Berlin: de Gruyter 1971. (zitiert als »Fichte [Band], [Seite]«) Fichte, Johann Gottlieb (1801/02): Zur Ausarbeitung der Wissenschaftslehre, in: ders., Nachgelassene Schriften 1800-1803, Gesamtausgabe Bd. II.6, hg. v. R. Lauth, H. Gliwitzky, u.a., Stuttgart-Bad Canstatt: FrommannHolzboog, S. 45-103. Figal, Günter (1996): Vom Sinn des Verstehens. Stuttgart: Reclam. Figal, Günter (2001): Lebensverstricktheit und Abstandnahme: »Verhalten zu sich« im Anschluß an Heidegger, Kierkegaard und Hegel, Tübingen: Attempo. Frank, Manfred (1983): Was ist Neostrukturalismus?, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984. Frank, Manfred (1991a): Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis. Essays zur analytischen Philosophie der Subjektivität, Stuttgart: Reclam. Frank, Manfred (1991b): Fragmente einer Geschichte der Selbstbewußtseins-Theorie von Kant bis Sartre, in: ders. (Hg.), Selbstbewußtseinstheorien von Fichte bis Sartre, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 413-599. Frank, Manfred (1994): Vorwort, in ders. (Hg.): Analytische Theorien des Selbstbewußtseins, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 7-34. 131 Frank, Manfred (1997). »Unendliche Annäherung«. Die Anfänge der philosophischen Frühromantik, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Frank, Manfred (2002): Selbstgefühl. Eine historisch-systematische Erkundung, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Frank, Manfred (2007): Ungegenständliche Subjektivität, in: ders., Auswege aus dem Deutschen Idealismus, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 415-441. Foucault, Michel (1975): Surveiller et punir. La naissance de la prison, dt. Übers: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977. Gadamer, Hans-Georg (1989): Hermeneutik und ontologische Differenz, in ders.: Hermeneutik im Rückblick, Gesammelte Werke Bd. 10, Tübingen: Mohr Siebeck 1995, S. 58-70. Gahlings, Ute (2008): Die Wiederentdeckung des Leibes in der Phänomenologie, in: Information Philosophie 02/2008, S. 36-47. Gloy, Karen (1998). Bewußtseinstheorien. Zur Problematik und Problemgeschichte des Bewußtseins und Selbstbewußtseins, Freiburg/München: Alber 32004. Großheim, Michael (1994): Perspektive oder Milieu von Sachverhalten? Zur Theorie der Subjektivität, in: ders. (Hg.), Wege zu einer volleren Realität. Neue Phänomenologie in der Diskussion, Berlin: Akademie, S. 3149. Großheim, Michael (2003): Heidegger und Hermann Schmitz, in: D. Thomä (Hg.), Heidegger-Handbuch. Leben-Werk-Wirkung, Stuttgart/Weimar: Metzler, S. 405-407. Habermas, Jürgen (1987): Metaphysik nach Kant, in ders., Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988. Heckmann, H. D. (1995): Selbstbewußtsein, III. Analytische Philosophie, in: J. Ritter, K. Gründer u.a. (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 9: Se-Sp, Basel: Schwabe, Sp. 371-379. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Werke in 20 Bänden (Theorie-Werkausgabe), hg. v. E. Moldenhauer und K. M. Michels, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986. (zitiert als »Hegel [Band], [Seite]«) Heidegger, Martin (1923): Ontologie (Hermeneutik der Faktizität), Gesamtausgabe Bd. 63, hg. v. K. BröckerOltmanns, Frankfurt am Main: Klostermann 1988. Heidegger, Martin (1924): Der Begriff der Zeit, Gesamtausgabe Bd. 64, hg. v. F.-W. v. Hermann, Frankfurt am Main: Klostermann 2004. Heidegger, Martin (1927a): Sein und Zeit, Tübingen: Niemeyer 171993. Heidegger, Martin (1927b): Die Grundprobleme der Phänomenologie, Gesamtausgabe Bd. 24, hg. v. F.-W. v. Hermann, Frankfurt am Main: Klostermann 1975. Heidegger, Martin (1940): Der europäische Nihilismus, in: ders., Nietzsche. Zweiter Band, Pfullingen: Neske 1961, S. 31-256. Heidegger, Martin (1946): Brief über den Humanismus, in: ders., Wegmarken, Frankfurt am Main: Klostermann 2 1967, S. 311-360. Heidegger, Martin (1950): Die Sprache, in: ders., Unterwegs zur Sprache, Gesamtausgabe Bd. 12, hg. v. F.-W. v. Hermann , S. 7-30. Heidegger, Martin (1952): Was heißt Denken?, in: ders., Vorträge und Aufsätze, Pfullingen: Neske 71994, S. 123-137. Henrich, Dieter (1966): Fichtes ursprüngliche Einsicht, in: ders. & H. Wagner (Hg.), Subjektivität und Metaphysik. Festschrift für Wolfgang Cramer, Frankfurt am Main: Klostermann, S. 188-232. Henrich, Dieter (1970): Selbstbewußtsein. Kritische Einleitung in eine Theorie, in: R. Bubner, K. Cramer & R. Wiehl (Hg.), Hermeneutik und Dialektik. Festschrift für Hans-Georg Gadamer, Tübingen: Mohr, S. 257284. Henrich, Dieter (1982): Fluchtlinien. Philosophische Essays, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Henrich, Dieter (1989): Noch einmal in Zirkeln. Eine Kritik von Ernst Tugendhats semantischer Erklärung von Selbstbewußtsein, in: C. Bellut & U. Müller-Schöll (Hg.): Mensch und Moderne. Beiträge zur philosophischen Anthropologie und Gesellschaftskritik. Festschrift für Helmut Fahrenbach, Würzburg: Königshausen & Neumann, S. 93-132. Henrich, Dieter (1999): Bewußtes Leben. Untersuchungen zum Verhältnis von Subjektivität und Metaphysik. Stuttgart: Reclam. Henrich, Dieter (2004): Grundlegung aus dem Ich. Untersuchungen zur Vorgeschichte des Idealismus. Tübingen – Jena 1790-1794, 2 Bde., Frankfurt am Main: Suhrkamp. Henrich, Dieter (2006): Mystik ohne Subjektivität? [Rezension zu: Ernst Tugendhat, Egozentrizität und Mystik], in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 54/2, S. 169-188. Henrich, Dieter (2007): Denken und Selbstsein. Vorlesungen über Subjektivität. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Hume, David (1740): Treatise of Human Nature, ed. by L.A. Selby-Bigge, Oxford: Clarendon 1978. Husserl, Edmund (1966a): Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins (1893-1917), Husserliana Bd. X, hg. von R. Boehm, Den Haag: Nijhoff. 132 Husserl, Edmund (1966b): Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesungs- und Forschungsmanuskripten 1918-1926, Husserliana Bd. XI, hg. v. M. Fleischer, Den Haag: Nijhoff. Iber, Christian (2000): In Zirkeln ums Selbstbewußtsein. Bemerkungen zu Hegels Theorie der Subjektivität, in: Hegel-Studien 35, S. 51-75. Jackson, F. (1986): What Mary Didn't Know, in: Journal of Philosophy 83, S. 291-295. Jacobi, Friedrich Heinrich (1789): Über die Lehre des Spinoza in den Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn. Mit den Erweiterungen der zweiten Auflage, in: ders. Werke, Bd. 1,1, hg. v. K. Hammacher & I.-M. Piske, Hamburg: Meiner 1998, S. 149-268. Jacobi, Friedrich Heinrich (1811): Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung, in: ders. Werke, Bd. 3, hg. v. K. Hammacher & W. Jaeschke, Hamburg: Meiner 2000, S. 1-136. Jaeschke, Walter (1995): Selbstbewußtsein, II. Neuzeit, in: J. Ritter, K. Gründer u.a. (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 9: Se-Sp, Basel: Schwabe, Sp. 352-371. Kant, Immanuel (1768): Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume, in: ders, Werkausgabe Bd. II, hg. v. W. Weischedel, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977, S. 991-1000. Kant, Immanuel (1772): Vorlesungen über Anthropologie. Erste Hälfte, in: Kant’s gesammelte Schriften, Bd. 25.1, hg. v. d. Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Berlin: de Gruyter & Co. 1997. Kant, Immanuel (1781/1787): Kritik der reinen Vernunft, Werkausgabe Bd. III/IV, hg. v. W. Weischedel, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1980. (zitiert als »Kant, KrV«) Kant, Immanuel (1783): Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, in: ders, Werkausgabe Bd. V, hg. v. W. Weischedel, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977, S. 109264. Kant, Immanuel (21794): Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, in: ders., Werkausgabe Bd. VIII, hg. v. W. Weischedel, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977, S. 645-879. Kant, Immanuel (1804): Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnizens und Wolf’s Zeiten in Deutschland gemacht hat?, in: ders., Werkausgabe Bd. VI, hg. v. W. Weischedel, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977, S. 585-676. Kant, Immanuel (1924): Die philosophischen Hauptvorlesungen, hg. v. A. Kowalewski, Leipzig/München: Rösl & Cie. Kant, Immanuel (1926): Reflexionen zur Metaphysik. in: ders., Kant’s handschriftlicher Nachlaß, Bd. IV. Metaphysik. Erster Teil, Akademieausgabe Bd. XVII, Berlin/Leipzig: de Gruyter, S. 227-745. Krämer, Sybille (1996): Einleitung, in: dies. (Hg.), Bewußtsein, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 9-15. Kierkegaard, Søren (1849): Sygdommen til Døden, dt. Übers.: Die Krankheit zum Tode, Stuttgart: Reclam 1997. Kleist, Heinrich von (1801): Brief an Wilhelmine von Zenge vom 22. März 1801, in: ders., Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 4, hg. v. K. Müller-Saget und S. Ormanns., Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1997, S. 201-207. Kleist, Heinrich von (1805): Über die allmählige Verfertigung der Gedanken beim Reden, in: ders., Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 3, hg. v. K. Müller-Saget, Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1997, S. 534-540. Kleist, Heinrich von (1810): Über das Marionettentheater. in: ders., Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 3, hg. v. K. Müller-Saget, Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1997, S. 555-563. Koch, A. F. (1994): Unmittelbare Bekanntschaft mit sich? Kurze Gegenrede zu Manfred Frank, in: Philosophische Rundschau 41, S. 29-35. Koch, Oliver (2004): Novalis und Jacobi. Vom Gefühl des Entzugs und Entzug des Gefühls, in: B. Sandkaulen & W. Jaeschke (Hg.), Friedrich Heinrich Jacobi. Ein Wendepunkt in der geistigen Bildung der Zeit, Hamburg: Meiner, S. 278-297. Lyotard, François (1991): Leçons sur l’analytique du sublime, dt. Übers.: Die Analytik des Erhabenen. KantLektionen, Kritik der Urteilskraft §§ 23-29, München: Fink 1994. Mach, Ernst (1885): Die Analyse der Empfindungen, Jena: Fischer 51906. Mach, Ernst (1905): Erkenntnis und Irrtum, Leipzig: Barth 31917. McTaggart, J. M. E. (1908): The Unreality of Time, in: Mind XVII, S. 457-474. Metzinger, Thomas (2005): Eine Selbstmodell-Theorie der Subjektivität: Eine Kurzdarstellung in sechs Schritten, in: S. Schicktanz, M. Pauen, u.a. (Hg.), Bewußtsein. Philosophie, Neurowissenschaften, Ethik, München: Fink, S. 242-269. Nagel, Thomas (1974): What is it like to be a bat?, in: The Philosophical Review 83, S. 435-450. Nagel, Thomas (1986): The view from nowhere, Oxford University Press 1989. Natorp, Paul (1912): Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Erstes Buch: Objekt und Methode der Psychologie, Tübingen: Mohr Siebeck. Newen, Albert (2000): Selbst und Selbstbewußtsein aus philosophischer und kognitionswissenschaftlicher Perspektive, in: ders. & K. Vogeley (Hg.): Selbst und Gehirn. Menschliches Selbstbewußtsein und seine neurobiologischen Grundlagen, Paderborn: mentis, S. 19-55. 133 Novalis (1795): Fichte-Studien, in: ders., Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs, Bd. 2, hg. v. R. Samuel, Stuttgart: Kohlhammer 1960. Pauen, Michael (2000): Selbstbewußtsein. Ein metaphysisches Relikt?, in: A. Newen & K. Vogeley (Hg.): Selbst und Gehirn. Menschliches Selbstbewußtsein und seine neurobiologischen Grundlagen, Paderborn: mentis, S. 101-121. Plessner, Helmut (1928): Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, Berlin/Leipzig: de Gruyter. Pothast, Ulrich (1971): Über einige Fragen der Selbstbeziehung, Frankfurt am Main: Klostermann. Prior, Helmut/Schwarz, Ariane/Güntürkün, Onur (2008): Mirror-Induced Behavior in the Magpie (Pica pica): Evidence of Self-Recognition, in: Plos Biology 6 (8), als pdf-Datei zugänglich unter: http://www.bio.psy.rub.de/papers/10.1371_journal.pbio.0060202-L.pdf Rehmke, Johannes (1918): Logik oder Philosophie als Wissenslehre, Leipzig: von Quelle & Meyer. Rentsch, Thomas (1993): Rezension zu: Hermann Schmitz, Der unerschöpfliche Gegenstand, in: Philosophische Rundschau 40, S. 121-128. Rickert, Heinrich (1892): Der Gegenstand der Erkenntnis. Einführung in die Transzendentalphilosophie, Tübingen: Mohr Siebeck 51921. Roth, Gerhard (1997): Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Sandkaulen, Birgit (2004): Daß, was oder wer? Jacobi im Diskurs über Personen, in: dies. & W. Jaeschke (Hg.), Friedrich Heinrich Jacobi. Ein Wendepunkt in der geistigen Bildung der Zeit, Hamburg: Meiner, S. 217-237. Sartre, Jean-Paul (1936): La transcendance de l’ego, dt. Übers.: Die Transzendenz des Ego, in: ders., Die Transzedenez des Ego. Philosophische Essays 1931-1939, Reinbek: Rowohlt 1982, S. 39-96. Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1809): Über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände, Hamburg: Meiner 1997. Schulte, Günter (1997): Philosophie der letzten Dinge. Über Liebe und Tod als Grund und Abgrund des Denkens, ND Erftstadt: Area 2004. Searle. John R. (2004): Mind. A brief introduction, dt. Übers.: Geist. Eine Einführung, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2006. Sextus Empiricus, Grundriß der pyrrhonischen Skepsis, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985. Soentgen, Jens (1998): Die verdeckte Wirklichkeit. Einführung in die neue Phänomenologie von Hermann Schmitz, Bonn: Bouvier. Sohst, Wolfgang (2005): Hermann Schmitz im Dialog. Neun neugierige und kritische Fragen an die Neue Phänomenologie, hg. v. dems. & H. Schmitz, Berlin: Xenomoi. Spitzer, Manfred (1991): Affektivität und Leiblichkeit als Prinzip des Selbstbewußtseins? Koreferat zu Hermann Schmitz, in: B. Kienzle & H. Pape (Hg.), Dimensionen des Selbst. Selbstbewußtsein, Reflexivität und die Bedingungen der Kommunikation, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 169-178. Sturma, Dieter (2008): Selbstreferenz, Zeit und Identität. Grundzüge einer naturalistischen Theorie personaler Identität, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 56, S. 569-583. Tugendhat, Ernst (1979): Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung. Sprachanalytische Interpretationen, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Tugendhat, Ernst (2003): Egozentrizität und Mystik, München: Beck. Tugendhat, Ernst (2005): Über Selbstbewusstsein. Einige Missverständnisse, in: V. Zanetti, H. Grundmann, u.a. (Hg.), Anatomie der Subjektivität. Bewusstsein, Selbstbewusstsein und Selbstgefühl, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 247-254. Wetzel, Manfred (1985): Dialektik als Ontologie auf der Basis selbstreflexiver Erkenntniskritik. Neue Grundlegung einer »Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins« und Prolegomena zu einer Dialektik in systematischer Absicht, Freiburg/München: Alber. Wittgenstein, Ludwig (1914/16): Tagebücher 1914 – 1916, in: ders., Werkausgabe Bd. 1, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984, S. 87-223. Wittgenstein, Ludwig (1921): Tractatus logico-philosophicus, in: ders., Werkausgabe Bd. 1, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984, S. 7-85. Wittgenstein, Ludwig (1930): Vortrag über Ethik, in: ders., Vortrag über Ethik und andere kleine Schriften, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, S. 9-19. Wittgenstein, Ludwig (1953): Philosophische Untersuchungen, in: ders., Werkausgabe Bd. 1, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984, S. 225-580. Wyller, Truls (1994): Indexikalische Gedanken. Über den Gegenstandsbezug in der raumzeitlichen Erkenntnis, Freiburg: Alber. Zahavi, Dan (2007): Phänomenologie für Einsteiger, Paderborn: Fink. Zizek, Slavoj (2006): The parallax view, dt. Übers.: Parallaxe, Frankfurt am Main: Suhrkamp. 134 Ich erkläre, dass ich vorliegende Arbeit selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Hilfsmittel und Literatur angefertigt habe. Jena, 15. Oktober 2008 135