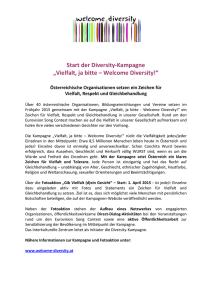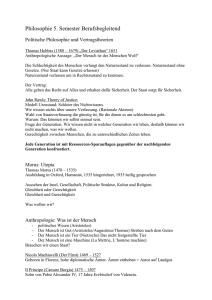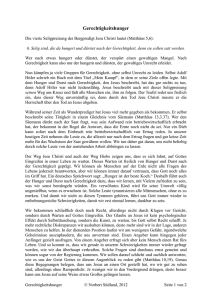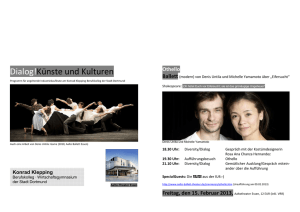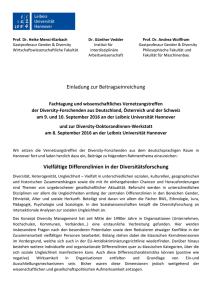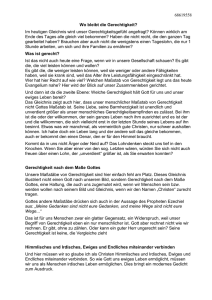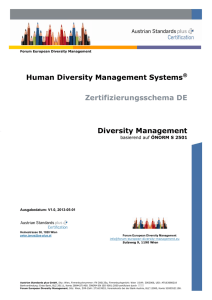Fallstudien zum Diversity Management
Werbung

Die Fallstudienmethode verfolgt das Ziel, interessierten Studierenden die praktische Anwendbarkeit des theoretischen Wissens in einem bestimmten Handlungsfeld zu vermitteln. Sie ist in unterschiedlichen Disziplinen der Wirtschaftswissenschaften inzwischen weit verbreitet. Lehrende greifen gerne auf dieses didaktische Instrument zurück, wenn es darum geht, vernetztes Denken zu fördern, Entscheidungssituationen adäquat zu analysieren, pragmatisch mit unvollständigen Informationen umzugehen oder einen Sachverhalt kritisch zu würdigen. Dieser Band stellt anhand von fünf allgemeinen und sieben speziellen Fallstudien das breite Spektrum des Diversity Managements und seiner Schnittstellen vor. Die fiktiven Armchair Cases wurden in verschiedenen Branchen (Automobil, Handel…), im Profit- und Non-Profit-Bereich (Krankenhaus, Hochschule…) sowie in großen und kleineren Organisationen (Pflegedienst, Druckerei…) angesiedelt. Sie stellen Bezüge zu aktuellen Themen wie dem Fachkräftemangel, dem demographischen Wandel oder auch der Frauenquote her. Zwei der Fallstudien liegen in englischer Sprache vor. Zu jedem Fall werden zwölf unterschiedlich komplexe Fragen gestellt und mit passenden Literaturhinweisen abgerundet. Der Band richtet sich insbesondere an Dozierende und Studierende im Bereich Diversity Management bzw. Diversity Studies. Die Fallstudien können aber auch in der Lehre zum Internationalen Management, zum Personalmanagement oder zur Unternehmensethik eingesetzt werden. Schlüsselwörter: Alter, Auslandsentsendung, Behinderung, Diversity Management, Diversity Marketing, Frauenquote, Gerechtigkeit, Kultursensible Pflege, Religion, Sexuelle Orientierung, Umgang mit Vielfalt in Organisationen Die Herausgeberin des Bandes Dr. Elisabeth Göbel ist außerplanmäßige Professorin im Fach Betriebswirtschaftslehre der Universität Trier und Expertin für Fragen der Unternehmensethik. Die Herausgeber des Bandes Dr. Günther Vedder und Dipl.-Vw. Florian Krause arbeiten im BWLSchwerpunkt „Arbeit, Personal, Organisation“ an der gleichen Hochschule. Sie haben seit 2001 mehrere Bände der „Trierer Beiträge zum Diversity Management“ mitgestaltet. Rainer Hampp Verlag München, Mering 2011 € 29.80 0631_15.indd 1 ISBN 978-3-86618-631-6 (print) ISBN 978-3-86618-731-3 (e-book) ISSN 1612-8419 DOI 10.1688/9783866187313 Band 12 Günther Vedder Elisabeth Göbel Florian Krause (Hrsg.) Fallstudien zum Diversity Management Günther Vedder, Elisabeth Göbel Florian Krause (Hrsg.) Fallstudien zum Diversity Management Fallstudien zum Diversity Management Trierer Beiträge zum Diversity Management Rainer Hampp Verlag 11.04.2011 11:24:04 Uhr Inhaltsverzeichnis I Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung – Hinweise zum Aufbau des Buches..................................III Günther Vedder, Elisabeth Göbel und Florian Krause 2. Die Grundlagen von Diversity Management........................................1 Günther Vedder 3. Diversity Management als ethisches Konzept..................................19 Elisabeth Göbel Allgemeine Fallstudien zum Diversity Management 4. Diversity Management beim Automobilkonzern AIDA.........................47 Gilmar Frey 5. Vielfalt bei der Stadtverwaltung SIGMA............................................69 Maren Nafe und Timo Welgen 6. Umgang mit Vielfalt an der Universität UMBRA..................................91 Sevgi Gezer 7. Managing Diversity at ALPHA AIRLINES..........................................113 Christin Deimer 8. Diversity at HOPE HOSPITAL.........................................................131 Benedikt Noll Diversity-Fallstudien mit Schwerpunktthemen 9. Anonyme Bewerbungen bei der BELLA AG......................................147 Leysan Mingazova 10. Auslandsentsendungen in der AQUA AG.........................................167 Tobias Galizdörfer und Leopold Läßle 11. Rechtliche Besonderheiten im AGAPE-Verband................................187 Lena Schmädtke und Thomas Gebhardt 12. Die Frauenquote bei TONI.............................................................207 Annika Gorholt 13. Fachkräftemangel in der Offsetdruckerei OMEGA.............................227 Maria Catana und Katharina Mau II Fallstudien zum Diversity Management 14. Kultursensible Pflege beim Pflegedienst PARIS................................247 Viktoria Pint und Miriam Schwarz 15. Die Dimension Alter in der SIERRA GmbH.......................................263 Carolin Razen und Katrin Hahn Diversity Management als ethisches Konzept 23 1. Vom ethischen zum ökonomischen Verständnis von DiM Als Diversity Management (DiM) bezeichnet man den planvollen Umgang mit Vielfalt in Organisationen. Speziell interessiert die Vielfalt in den Belegschaftsstrukturen von Unternehmen, wobei die Ähnlichkeiten und Abweichungen zwischen Beschäftigten an allen möglichen Merkmalen festgemacht werden können. Als Kerndimensionen gelten Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Alter, Behinderung und sexuelle Orientierung. DiM gilt noch als ein recht neues Managementkonzept, hat aber seit seiner ersten Verbreitung in Nordamerika in den 1980er Jahren bereits eine deutliche Entwicklung durchgemacht. Häufig werden drei unterschiedliche DiMKonzepte unterschieden, die zugleich als zeitlich hintereinander liegende Phasen dieser Entwicklung aufgefasst werden. Diese drei Ansätze sind23: - The discrimination-and-fairness paradigm, - the access-and-legitimacy paradigm, - the learning-and-effectiveness paradigm. Die drei Ansätze kann man zu zwei unterschiedlichen Sichtweisen verdichten. Der Diskriminierungs- und Fairnessansatz gilt als Repräsentant einer ethischen Sichtweise von DiM, die beiden anderen Ansätze werden dagegen als ökonomisch-ergebnisorientiert eingestuft. Aus ökonomischer Sicht lautet die zentrale Frage: Welche Kosten und welchen Nutzen bringt eine vielfältige Belegschaft dem Unternehmen? Verwiesen wird vor allem auf Vorteile der Vielfalt.24 So kann man auf Kundenbedürfnisse gezielter eingehen, wenn Angehörige der wichtigsten Kundengruppen im Unternehmen beschäftigt werden. Aber auch der Zugang zu einem größeren Talentpool bzw. das Abwenden des drohenden Fachkräftemangels, kreativere und innovativere Problemlösungen, mehr Austausch von Wissen und Erfahrung sowie eine höhere Motivation gelten als positive Effekte einer gemischten Belegschaft. Die zusätzlichen Kosten, die etwa durch vermehrte Konflikte und Kommunikationsprobleme entstehen, werden auch thematisiert, aber eher gering geschätzt. Aufgrund der Vorteilserwartungen wird empfohlen, nicht nur die bereits vorhandene Vielfalt zu managen, sondern aktiv mehr Vielfalt zu fördern. Die Ethik fragt dagegen: Ist ein bestimmtes Maß an Vielfalt im Unternehmen moralisch geboten, unabhängig von den Kosten und dem Nutzen? Ausgangs23 24 Vgl. Thomas/Ely 1996, S. 80. Vgl. Stuber 2007. Fallstudien zum Diversity Management 24 punkt für ein ethisch motiviertes DiM ist die Überlegung, dass in den homogenen Belegschaftsstrukturen vieler Unternehmen ein Indiz für die unfaire Benachteiligung (Diskriminierung) bestimmter Gruppen zu sehen ist (daher Diskriminierungs- und Fairnessansatz, im Folgenden einfach Fairnessansatz). Dem Fairnessansatz wird einerseits eine große Bedeutung zugesprochen als dem „klassischen“ Ansatz, mit dem die Diskussion des Themas „Diversity“ überhaupt erst begonnen habe. Auch sei er bis heute am weitesten verbreitet.25 Andererseits gilt der Fairnessansatz aber offensichtlich zugleich als unmodern und von den nachfolgenden ökonomischen Ansätzen überholt. So meint Sepehri: „Wer Managing Diversity hauptsächlich aus moralischen Gründen definiert, vernachlässigt die eigentliche und umfassendere Betrachtungsweise, nämlich die ökonomische“.26 Und auch für Stuber besteht in der „klaren wirtschaftlichen Orientierung von Diversity“ ein Fortschritt gegenüber den Antidiskriminierungskonzepten.27 Diese Verschiebung von einer moralischen hin zu einer Kosten-Nutzenorientierten Wahrnehmung von Vielfalt in den Belegschaftsstrukturen wird als Weiterentwicklung gelobt, die Fairness-Perspektive überwiegend negativ dargestellt. Von den Unternehmen, die als Vertreter dieser Perspektive gelten, wird behauptet, sie seien oft stark hierarchisch, bürokratisch und kompliziert, sie würden mit übertriebener Gleichmacherei ihre unterschiedlichen Mitarbeiter unter einen Assimilationsdruck setzen und sie mit Zwang und Unterdrückung überziehen.28 Eine ökonomische Perspektive führe dagegen zu offenen und toleranten Unternehmenskulturen, in welchen sich die Mitarbeiter als Individuen frei entfalten können.29 Ist demnach eine ethische Wahrnehmung von DiM tatsächlich überholt und vielleicht sogar kontraproduktiv für ihr eigentliches Anliegen? Diese Frage soll im Folgenden beantwortet werden. Dazu ist zunächst zu klären, was ethisch fundiertes DiM bedeutet. Für die Diversity-Diskussion zentrale ethische Begriffe wie Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Chancenausgleich, Fairness, Diskriminierung, Toleranz und Wertschätzung sollen erläutert und deren Bedeutung im Zusammenhang mit DiM dargestellt werden. Auf dieser Grundlage soll die Kritik des Fairnessansatzes hinterfragt werden. In einem Vergleich von ethischer und ökonomischer Perspektive sollen danach Unterschiede und Berührungspunkte der beiden Sichtweisen thematisiert werden. 25 26 27 28 29 Vgl. Sepehri 2002, S. 134f. Sepehri 2002, S. 97. Stuber 2004, S. 20. Vgl. Thomas/Ely 1996, S. 81. Vgl. Sepehri 2002, S. 149ff. Diversity Management als ethisches Konzept 25 Abschließend wird der Bezug zu den Fallstudien hergestellt und gezeigt, an welchen Stellen die ethische Perspektive eine besondere Rolle spielt. 2. DiM in ethischer Perspektive 2.1. Klärung ethischer Grundbegriffe 2.1.1. Gerechtigkeit Gerechtigkeit ist ein zentraler ethischer Begriff. Mit ihm stehen die Beziehungen der Menschen zueinander im Blick, also der Bereich des Sozialen, insofern in ihm Interessen, Ansprüche und Pflichten konkurrieren. Gerechtigkeit ermöglicht die Kooperation von Menschen in Freiheit. Kooperation in Freiheit ist nur möglich bei gleichzeitigen Freiheitsbeschränkungen, denn in sozialer Perspektive ist uneingeschränkte Freiheit unmöglich, weil es immer auch konfligierende Interessen gibt. Das „Recht auf Alles“ führt zu dem schon von Hobbes30 beklagten Zustand des Krieges eines Jeden gegen Jeden und ist also im Grunde das Recht auf Nichts. Man muss zur Ermöglichung friedlicher Kooperation die Verteilung von Positionen, Gütern und Rechten, aber auch Pflichten, Beschränkungen und Lasten verbindlich regeln, und zwar nicht zufällig bestehenden Machtverhältnissen entsprechend, sondern gerecht.31 Die negative Bestimmung der Gerechtigkeit ist das Willkürverbot. Eine nicht willkürliche, gerechte Regelung folgt bestimmten Prinzipien. Den Kern der Gerechtigkeitsvorstellung bilden schon seit Aristoteles 32 zwei von ihnen, nämlich „Jedem das Gleiche“ und „Jedem das Seine“ zu gewähren. Diese beiden Prinzipien widersprechen sich auf den ersten Blick, lassen sich aber tatsächlich ineinander überführen. Ausgehend vom Kerngedanken der Gleichheit kann man eine absolute und eine proportionale Gleichheit unterscheiden. Wenn zwei Personen A und B sich in einem für die Verteilung wichtigen Punkt unterscheiden, dann ist es gerecht, sie unterschiedlich zu behandeln. Aber eben nicht willkürlich, sondern entsprechend ihrer Unterschiedlichkeit, also angemessen oder proportional. „Denn wenn die Personen nicht gleich sind, so werden sie nicht gleiche Anteile haben können, sondern hieraus ergeben sich die Streitigkeiten und Zerwürfnisse, wenn entweder gleiche Personen nicht-gleiche Anteile oder nicht-gleiche Personen gleiche Anteile haben und zugeteilt erhalten.“ 33 Das bedeutet: Gleiches soll man gleich, Ungleiches aber ungleich behandeln. „Jedem das Seine“ zu geben 30 31 32 33 Vgl. Hobbes 1996, S. 104. Vgl. Höffe 1995, S. 895f. Vgl. Aristoteles 1960, V/1129a-1138b. Aristoteles 1960, V.6/1131a, 22-24. Fallstudien zum Diversity Management 26 kann bedeuten, verschiedene Personen absolut gleich zu behandeln, aber nur, wenn sie in den für die Verteilung wichtigen Aspekten auch gleich sind. In allen anderen Fällen ist die ungleiche Behandlung gerecht. Aus den Gerechtigkeitsprinzipien lassen sich konkrete Handlungsnormen nicht deduzieren. Sie sind vielmehr Direktiven für die praktische Urteilskraft, welche je situativ entscheiden muss, was gerecht ist. 34 Insbesondere ist oft schwer zu entscheiden, welche Unterschiede zwischen Personen dazu berechtigen, sie angemessen unterschiedlich zu behandeln. Als gerecht empfinden wir es bspw. unterschiedliche Noten bei unterschiedlichen Schulleistungen zu geben, Sozialhilfe nach dem Grad der Bedürftigkeit zu gewähren, Rechte nach dem Alter zu staffeln. Dass Gerechtigkeit absolute Gleichbehandlung bedeutet, ist eher die Ausnahme als die Regel. Selbst dem zentralen Grundsatz: „Vor dem Gesetz sind alle gleich“ folgen wir in unserer Rechtsprechung z. B. insofern nicht, als jugendliche Straftäter bei gleichen Vergehen mildere Strafen erhalten als ältere Straftäter oder sogar ganz straffrei ausgehen, wenn sie noch nicht strafmündig sind. Auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nennt zahlreiche Gründe für eine „zulässige unterschiedliche Behandlung“, etwa wegen beruflicher Anforderungen oder wegen des Alters. Seit Aristoteles 35 werden zwei Grundformen der Gerechtigkeit unterschieden, nämlich die austeilende und die ausgleichende Gerechtigkeit (iustitia distributiva und iustitia commutativa). Die iustitia distributiva bezieht sich auf das Verhältnis eines Ganzen (oft: des Staates) zu den Einzelnen. Sie impliziert ein vertikales Verhältnis, eine Hierarchie, zwischen einem Gebenden und einem Empfangenden. Beispiel: Der Staat muss dem Bürger das Seine zuteilen. Er garantiert bspw. gleiche Grundrechte für alle, gewährt das Wahlrecht nach Alter, bestimmt die Wehrpflicht nach Geschlecht, verteilt Ehrungen nach Verdienst. Die iustitia commutativa bezieht sich dagegen auf das horizontale Verhältnis zwischen Einzelnen, auf ein Vertragsverhältnis. Gerechtigkeit heißt in diesem Fall, Ausgleich von Leistung und Gegenleistung. Man spricht auch von der Tauschgerechtigkeit. Beide Seiten sind gleichermaßen Gebender und Nehmender und sollen etwas Gleichwertiges tauschen. Ein Händler verlangt etwa einen gerechten Preis für ein Gut, ein Arbeitgeber zahlt einen gerechten Lohn für eine Leistung. Was gerecht ist, kann zwischen den Beteiligten ausgehandelt werden. 34 35 Vgl. Höffe 2001, S. 113. Vgl. Aristoteles 1960, V.5/1130b, 30-32. Diversity Management als ethisches Konzept 27 Als Unterform der iustitia commutativa macht Aristoteles noch die iustitia correctiva zum Thema, die korrigierende Gerechtigkeit. 36 Wenn ein „Zwangstausch“ stattgefunden hat, etwa ein Diebstahl, ist die Gleichheit wieder herzustellen, bspw. durch eine Entschädigung des Bestohlenen, welche der Dieb zu leisten hat. Über diese enge Fassung hinaus kann man aber die iustitia correctiva auch so verstehen, dass erlittenes Unrecht wieder gut gemacht, „korrigiert“ werden soll, auch wenn die konkreten Opfer und Täter nicht mehr existieren. Solche „Entschädigungsaufgaben“ ergeben sich etwa aus Sklaverei, Kolonialisierung und einer jahrhundertelangen Ungleichbehandlung der Frau.37 In dieser erweiterten Fassung ist die iustitia correctvia nicht mehr mit der Tauschgerechtigkeit gleichzusetzen, sondern stellt eine eigene Form der Gerechtigkeit dar. Im AGG ist §5 Ausdruck des Gedankens einer korrigierenden Gerechtigkeit, denn dort wird eine Ungleichbehandlung erlaubt, wenn dadurch „bestehende Nachteile…verhindert oder ausgeglichen werden sollen.“ Um die komplexe Struktur der Gerechtigkeit angemessen zu erfassen, ist eine weitere Art der Einteilung notwendig, und zwar die in personale und institutionelle Gerechtigkeit. Als personale Gerechtigkeit bezeichnet man eine individuelle Lebenshaltung oder Tugend. Der gerechte Mensch erfüllt die Forderungen der Gerechtigkeit freiwillig und beständig. Im institutionellen Verständnis meint Gerechtigkeit dagegen die sittliche Struktur von sozialen Institutionen, wie Staat, Wirtschaft, Rechtsprechung.38 Beide Formen der Gerechtigkeit sind wechselseitig aufeinander angewiesen. Man braucht den gerechten Menschen, welcher gerechte Institutionen schafft bzw. Ungerechtigkeit anprangert und korrigiert, gerechte Regeln einhält und institutionelle Lücken überbrückt. Der Mensch braucht aber auch gerechte Institutionen, welche ihn anleiten, entlasten und überindividuelle Verbindlichkeit schaffen. Schließlich sollte nach Rawls Verfahrensgerechtigkeit von Ergebnisgerechtigkeit unterschieden werden.39 Die Verfahrensgerechtigkeit betrachtet Zuständigkeiten, Abläufe und Formen als Momente von Prozessen im Hinblick auf ihre sittliche Richtigkeit. Die Ergebnisgerechtigkeit richtet den Blick dagegen auf den „Output“ dieser Verfahren. Die ganze Gerechtigkeit kann schon im Verfahren selbst liegen, wenn es kein verfahrensunabhängiges Maß für ein gerechtes Ergebnis gibt. Eine solche „reine Verfahrensgerechtigkeit“ liegt bspw. vor beim Ziehen eines Loses im Glücksspiel. Gibt es dagegen ein unabhängiges Maß für ein gerechtes Ergebnis, dann ist das Verfahren nur ein Mit36 37 38 39 Vgl. Vgl. Vgl. Vgl. Aristoteles 1960, V.5/1131a, 2f. Höffe 2001, S. 88. Höffe 1995, S. 895f. Rawls 1979, S. 106f.