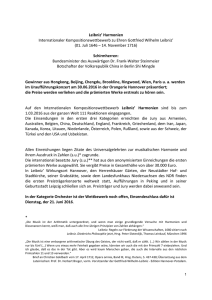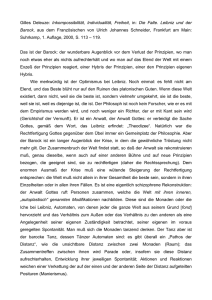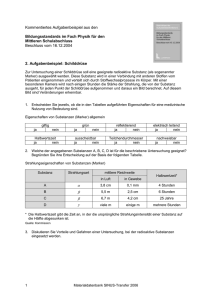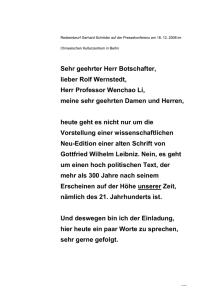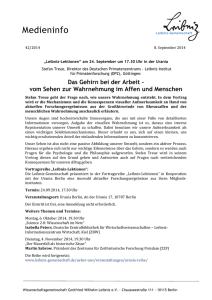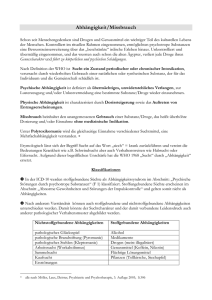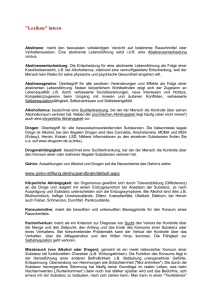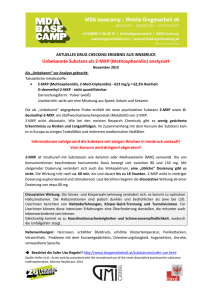kurze einführung in die metaphysische abhandlung
Werbung
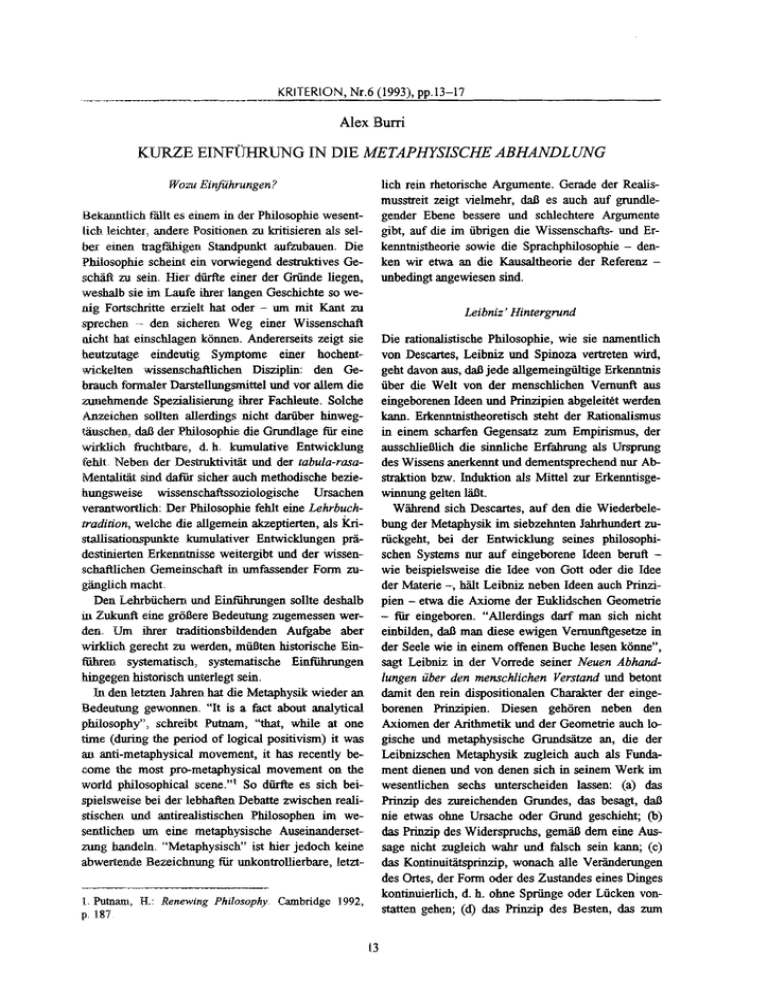
KRITERION, Nr.6 (1993), pp. 13-17 Alex Burri KURZE EINFÜHRUNG IN DIE METAPHYSISCHE ABHANDLUNG Wozu Einführungen? Bekanntlich fällt es einem in der Philosophie wesentlich leichter, andere Positionen zu kritisieren als selber einen tragfähigen Standpunkt aufzubauen. Die Philosophie scheint ein vorwiegend destruktives Geschäft zu sein. Hier dürfte einer der Gründe liegen, weshalb sie im Laufe ihrer langen Geschichte so wenig Fortschritte erzielt hat oder - um mit Kant zu sprechen -- den sicheren Weg einer Wissenschaft nicht hat einschlagen können. Andererseits zeigt sie heutzutage eindeutig Symptome einer hochentwickelten wissenschaftlichen Disziplin: den Gebrauch formaler Darstellungsmittel und vor allem die zunehmende Spezialisierung ihrer Fachleute, Solche Anzeichen sollten allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Philosophie die Grundlage für eine wirklich fruchtbare, d. h. kumulative Entwicklung fehlt Neben der Destruktivität und der tabula-rasaMentalität sind dafür sicher auch methodische beziehungsweise wissenschaftssoziologische Ursachen verantwortlich: Der Philosophie fehlt eine Lehrbu.chtradition, welche die allgemein akzeptierten, als Kristallisationspunkte kumulativer Entwicklungen prädestinierten Erkenntnisse weitergibt und der wissenschaftlichen Gemeinschaft in umfassender Form zugänglich macht, Den Lehrbüchern und Einfiihrungen sollte deshalb in Zukunft eine größere Bedeutung zugemessen werden. Um ihrer traditionsbildenden Aufgabe aber wirklich gerecht zu werden, müßten historische Einführen systematisch, systematische Einführungen hingegen historisch unterlegt sein, In den letzten Jahren hat die Metaphysik wieder an Bedeutung gewonnen, "It is a fact about analytical philosophy", schreibt Putnam, "that, while at one time (during the period of logical positivism) it was an anti-metaphysical movement, it has recently become the most pro-metaphysical movement on the world philosophical scene." So dürfte es sich beispielsweise bei der lebhaften Debatte zwischen realistischen und antirealistischen Philosophen im. wesentlichen um eine metaphysische Auseinandersetzung handeln. "Metaphysisch" ist hier jedoch keine abwertende Bezeichnung für unkontrollierbare, letzt1. Putnam, H.: Renewing Philosophy. Cambridge 1992, p. 187 lieh rein rhetorische Argumente. Gerade der Realismusstreit zeigt vielmehr, daß es auch auf grundlegender Ebene bessere und schlechtere Argumente gibt, auf die im übrigen die Wissenschafts- und Erkenntnistheorie sowie die Sprachphilosophie - denken wir etwa an die Kausaltheorie der Referenz unbedingt angewiesen sind. Leibniz' Hintergrund Die rationalistische Philosophie, wie sie namentlich von Descartes, Leibniz und Spinoza vertreten wird, geht davon aus, daß jede allgemeingültige Erkenntnis über die Welt von der menschlichen Vernunft aus eingeborenen Ideen und Prinzipien abgeleitet werden kann. Erkenntnistheoretisch steht der Rationalismus in einem scharfen Gegensatz zum Empirismus, der ausschließlich die sinnliche Erfahrung als Ursprung des Wissens anerkennt und dementsprechend nur Abstraktion bzw, Induktion als Mittel zur Erkenntisgewinnung gelten läßt. Während sich Descartes, auf den die Wiederbelebung der Metaphysik im siebzehnten Jahrhundert zurückgeht, bei der Entwicklung seines philosophischen Systems nur auf eingeborene Ideen beruft wie beispielsweise die Idee von Gott oder die Idee der Materie -, hält Leibniz neben Ideen auch Prinzipien - etwa die Axiome der Euklidschen Geometrie - für eingeboren. "Allerdings darf man sich nicht einbilden, daß man diese ewigen Vernunftgesetze in der Seele wie in einem offenen Buche lesen könne", sagt Leibniz in der Vorrede seiner Neuen Abhandlungen über den menschlichen Verstand und betont damit den rein dispositionalen Charakter der eingeborenen Prinzipien. Diesen gehören neben den Axiomen der Arithmetik und der Geometrie auch 10-gisehe und metaphysische Grundsätze an, die der Leibnizschen Metaphysik zugleich auch als Fundament dienen und von denen sich in seinem Werk im wesentlichen sechs unterscheiden lassen: (a) das Prinzip des zureichenden Grundes, das besagt, daß nie etwas ohne Ursache oder Grund geschieht; (b) das Prinzip des Widerspruchs, gemäß dem eine Aussage nicht zugleich wahr und falsch sein kann; (c) das Kontinuitätsprinzip, wonach alle Veränderungen des Ortes, der Form oder des Zustandes eines Dinges kontinuierlich, d. h. ohne Sprünge oder Lücken vonstatten gehen; (d) das Prinzip des Besten, das zum KRITERION Ausdruck bringt, daß jeder Mensch stets das wünscht, was ihm das Beste zu sein scheint; (e) das ln-esse-Prinzip, dem zufolge bei jeder wahren Aussage der Form "A ist B" der Prädikatsbegriff B im Subjektsbegriff A enthalten ist; (f) das Prinzip von der Identität des Ununterscheidbaren, wonach sich in der realen Welt - im Gegensatz zur Geometrie zwei Dinge nie bloß der Zahl nach (solo numero) unterscheiden, Aus zwei Gründen gestaltet sich die Bestimmung des systematischen Stellenwerts dieser Prinzipien schwieriger, als es diese Zusammenstellung vermuten läßt: Zum einen verwendet Leibniz zu ihrer Darlegung an unterschiedlichen Stellen seines umfang.. reichen Werks jeweils auch unterschiedliche Formulierungen" deren Gleichwertigkeit namentlich aus heutiger Sicht bezweifelt werden kann; zum anderen leitet er die Prinzipien in variierender Reihenfolge gegenseitig auseinander ab, was hinsichtlich ihrer logischen Unabhängigkeit und mithin ihrer Fundamentalitär wichtige, aber schwer abschätzbare Konsequenzell.Ua<:'Meine Prinzipien sind so, daß sie kaum voneinander getrennt werden können, Wer eines gut kennt, kennt alle". bemerkt Leibniz in einem Brief vom 7 November 1710 an des Bosses und scheint damit die von Spinoza für die Metaphysik angestrebte streng deduktive Darstellungs- und Rechtfertigungsart implizit in Frage stellen zu wol.. len, Jedenfalls muß Leibniz' Rationalismus wegen seiner verhältnismäßig vielen Prinzipien als voraus.. setzungsreicher gelten als derjenige Descartes', der hauptsächlich methodologisch ausgerichtet ist und einen metaphysischen Grundsatz nur dann als sol.. chen anerkennt, wenn er mit demselben Grad an Klarheit und Deutlichkeit aufgefaßt werden kann wie ein mathematisches Axiom. das Wollen selbst, sondern der Grund des Wollens bestimmt, ob eine Handlung wie beispielsweise die Erschaffung der Welt gut ist, "Nehmen wir [..,] an", resümiert er, "Gott wähle zwischen A und B und entscheide sich für A, ohne irgendeinen Grund zu haben, es B vorzuziehen, so sage ich, daß diese Handlung Gottes zumindest nicht lobenswert wäre; denn alles Lob muß einen vernünftigen Grund haben, der hier er hypothesi nicht zu finden ist" (S. 7 f.). Was sowohl dem göttlichen als auch dem menschlichen Wollen zugrunde liegt, ist das Prinzip des Besten, und zwar in der Formulierung "der Wille [erstrebt] immer das ihm gut Scheinende" (S. 73) im Falle des Menschen und in den Formulierungen "Gott [tut] alles zum besten" (S. 11) bzw. "Gott [tut] allemal das Beste" (S. 31) im Falle Gottes. Bezüglich des Schöpfungsaktes bedeutet "das Beste" für Leibniz nichts anderes, als daß Gott von allen möglichen Welten diejenige geschaffen hat, "die zugleich die einfachste an Prinzipien und die reichhaltigste an Erscheinungen ist" (S. 15), die also ein Maximum an unterschiedlichem Seienden und ein Minimum an Naturbzw. Vernunftgesetzen enthält. Diese Überlegungen deuten darauf hin, wie die beiden Prinzipien des zureichenden Grundes und des Besten, also (a) und (d), zusammenhängen, Obwohl Leibniz die zur Formulierung von (a) verwendeten Termini "Grund" und "Ursache" manchmal für synonym zu halten scheint, sollten ihre Bedeutungen hier unterschieden werden: Während "Ursache" raumzeitliche Ereignisse oder Zustände bezeichnet, die andere Ereignisse oder Zustände kausal hervorbringen, bezieht sich "Grund" auf die Intentionen vernünftiger Wesen, d. h. auf den gedanklichen Ge~ halt von Handlungsmotiven. Unter das Prinzip des ZUreichenden Grundes fallen also sowohl kausale (d. h, determinierte) als auch intentionale (d. h. durch freie Entscheidungen initiierte) Geschehnisse. Um Zureichender Grund und Wahl des Besten diese in ihrer Gesamtheit adäquat beschreiben zu In der i 686 französisch verfaßten, aber erst postum können, müssen neben Kausalerklärungen, die sich erschienenen Metaphysischen Abhandlung2 stellt. auf mechanistische Naturgesetze stützen, dementLeibniz die Hauptzüge seines philosophischen Den.. sprechend auch Finalerklärungen herangezogen werkens erstmals zusammenhängend dar. Zu Beginn der den, die dem zweckgerichteten Aspekt bestimmter in 37 Paragraphen aufgeteilten Schrift wendet er sich Abläufe Rechnung zu tragen vermögen. So oder so gegen eine Auffassung, wonach die Werke Gottes al.. ist das Prinzip des zureichenden Grundes aber eine lein deshalb gut seien, weil Gott sie gewollt hat ~ apriorische Voraussetzung jeglicher Erkenntnis: Es nämlich mit dem vom Prinzip des zureichenden gewährleistet nicht nur, daß sich die erkenntnistheoGrundes ausgehenden Argument, "daß jeder Wille retisch fundamentalen warum-Fragen überhaupt beeinen Grund des Wollens voraussetzt" (S. 5). Nicht antworten lassen, sondern weist auch darauf hin, worin Erklärungen (d. h. echte Erkenntnisse) eigent.. lieh bestehen - nämlich im Wissen um die Ursachen 2. Leibniz, G. W,: Metaphysische Abhandlung. Übersetzt und Gründe allen Geschehens. von HerbertHerring,Harnburg 21985. 14 KURZE EINFüHRUNG lN DIE METAPHYSISCHE ABHANDLUNG Das Prinzip des Besten hingegen liefert nichts anderes als die Grundlage für Finalerklärungen. Das heißt allerdings nicht, daß es einen kleineren Anwendungsbereich besitzt als das Prinzip des zureichenden Grundes. Denn die Naturereignisse, die aus menschlicher Sicht bloß einer Kausalerklärung bedürfen, bilden einen Teil der Schöpfung und hängen als solche von der göttlichen Wahl der besten aller möglichen Welten ab. Deshalb sieht Leibniz in der Wahl des Besten auch "das Prinzip alles Existierenden und der Naturgesetze" (S. 49, meine Hervorhebung). Folglich kann es für das Geschehen in der unbelebten Natur jeweils zwei ganz unterschiedliche Erklänmgsansätze geben: einen mechanistischen aus der Innenperspektive und einen teleologischen aus der Außenperspektive . "Ich finde", hält Leibniz in diesem Zusammenhang denn auch fest, "daß man manche Wirkungen der Natur in doppelter Weise beweisen kann, und zwar durch die Betrachtung der Wirkursache und außerdem durch die Betrachtung der Zweckursache" (S. 53). kann insofern als vollkommen gelten. "Hingegen ist ein Akzidens etwas, dessen Begriff nicht alles das enthält, was man dem Subjekt, dem dieser Begriff beigelegt wird, zuschreiben kann" (S. 19). Im Gegensatz zu individuellen Substanzen besitzen Akzidenzien mit anderen Worten keinen vollkommenen Begriff. Aus dieser Konzeption der individuellen Substanz zieht Leibniz im Laufe der Abhandlung mehrere wichtige Konklusionen, ohne aber zu begründen, wie diese genau aus der Vollkommenheit der substantiellen Subjektsbegriffe gewonnen werden können. Erstens folgert er, daß es in jeder individuellen Substanz Nachwirkungen und Vorzeichen dessen gibt, was ihr jemals geschehen ist bzw. ihr jemals zust0ßen wird, "wenngleich es nur Gott allein zukommt, dies alles zu erkennen" (S. 19; vgl. auch S.37 und 83 f.). Wenn nämlich, so könnte die entsprechende Begründung lauten, der Begriff einer individuellen Substanz wirklich vollständig ist, dann enthält er nicht nur die Prädikatsbegriffe, unter die sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt fallt, sondern gibt auch über alle früheren und späteren Eigenschaften des sich wandelnden Dinges Auskunft. Und weil die Substanz ihrem Begriff entspricht, existieren in ihr auch sämtliche Nachwirkungen bzw. Vorzeichen ihrer eigenen Geschichte. Zweitens leitet er aus der Vollkommenheit substantieller Subjektsbegriffe das Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren ab: Es kann also nicht zutreffen, "daß zwei Substanzen sich völlig gleich und nur der Zahl nach verschieden sind" (S. 19). Hier fällt es nicht ganz leicht, die Konklusion auf überzeugende Weise aus der Prämisse zu gewinnen. Eine einfache Deduktion könnte jedoch wie folgt aussehen: Trivialerweise fällt ein Ding A unter den Prädikatsbegriff "mit Aidentisch", was natürlich für jede andere Substanz nicht gilt; also enthält der Begriff von A zwangsläufig einen Prädikatsbegriff, unter den kein zweites Ding fällt; infolgedessen unterscheiden sich zwei Substanzen nicht bloß der Zahl, sondern auch ihrem Begriff nach. Drittens folgert er, "daß eine Substanz nur durch Schöpfung entstehen und nur durch Vernichtung vergehen kann; daß man eine Substanz nicht zweiteilen und nicht aus zweien eine machen kann" (S. 19 f.; vgl. auch S. 83). Zur Begründung der Unmöglichkeit einer Zweiteilung ließe sich vielleicht eine reductio ad absurdum der folgenden Art vorbringen: Angenommen, eine Substanz Ao zerfalle zu einem bestimmten Zeitpunkt in zwei Substanzen Al und A2; sei nun B eine derjenigen Eigenschaften, die zwar Al, Wahrheit und Substanz In den Paragraphen acht bis sechzehn behandelt er auf kleinem Raum einen zentralen Teil seiner Philo-sophie - die Lehre von den individuellen Substanzen, die drei Jahrzehnte später in der Monadologie ihre endgültige Ausprägung erhalten hat. Um den Begriff der Substanz (des Dinges, des Köpers oder des unum per se) näher zu bestimmen und vorn Begriff des Akzidens (der Eigenschaft, des Attributs, der Qualität) klar abzugrenzen, greift er auf das In-esse-Prinzip zurück: "Nun steht fest, daß jede wahre Aussage einen Grund in der Natur der Dinge hat, und wenn ein Satz nicht identisch, d. h., wenn das Prädikat nicht ausdrücklich im Subjekt enthalten ist, so muß es doch virtuell in ihm enthalten sein" (S. 17). Wenn nämlich in jeder wahren Aussage der Prädikatsbegriff Teil des Subjektsbegriff ist, dann kommt einer individuellen Substanz ein vollkommener Begriff zu, d. h. ein Begriff, aus dem sich alle ihre Eigenschaften erschließen lassen. Damit will Leibniz vermutlich das folgende sagen: Ein Ding A ist durch alle wahren Aussagen der Form HA ist H" vollständig bestimmt; durch die Menge aller wahren Aussagen über A ist gleichzeitig auch die Menge aller Prädikatsbegriffe gegeben, unter die A fällt und die gemäß dem Inesse-Prinzip im Begriff von A enthalten sein müssen; folglich gibt der Subjektsbegriff - unter der Voraussetzung, daß wir ihn vollständig verstehen ~" über alle Eigenschaften des betreffenden Dinges Auskunft und 15 KRITERION nicht aber A2 zukommen (gemäß des Prinzips von der Identität des Ununterscheidbaren müßte es ja mindestens eine solche geben); dann würde sich die Frage stellen, ob der Satz "A o ist B" wahr ist oder nicht; da A o (wegen des Kontinuitätsprinzipsl) sowohl in A J als auch in A2 fortbestünde, müßte er zugleich wahr und falsch sein, was das Prinzip des Widerspruchsaber ausschließt; somit kann die Annahme nicht richtig sein. Ein analoges Argument könnte auch zur Begründung der Unmöglichkeit einer Fusion zweier Substanzen vorgebracht werden. Viertens bzw. fünftens sagt Leibniz, jede Substanz drücke das ganze Universum in einer ihr eigentümlichen Weise aus (vgl. S. 19 f., 33 und 85) und bilde gleichsam eine Welt für sich (vgl. S. 21, 35 und 39). Wie diese beiden Konklusionen aus der Vollkommenheit der substantiellen Subjektsbegriffe begründet werden können, bleibt allerdings unklar. Für seine Theorie der Perzeption erweist sich aber namentlich letztere als zentral: Wie später auch in der Monadologie betont er nämlich, es sei "eine üble Gewohnheit, zu denken, unsere Seele empfinge irgendwelche Kunde bringende Bilder und hätte TÜTen und Fenster" (S. 65 f.). Dementsprechend bringe es die Konzeption der individuellen Substanzen mit sich, "daß alle ihre Erscheinungen oder Perzeptionen (spontan) ihrer eigenen Natur entstammen müssen" (S. 85, meine Hervorhebung). Veränderungen ihrer Form zurückzuführen. Die Scholastik differenziert zwischen zwei Arten von Formveränderungen. Änderungen, bei denen das ihnen unterworfene Ding dasselbe bleibt und nur seine akzidentelle Form sich wandelt, und Änderungen, bei denen es seine Identität und damit auch seine substantielle Form verliert - wie etwa die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Die substantiellen Formen wiederum zerfallen in drei Typen: solche, die für sich - ohne Materie - eine eigene Substanz ausmachen (Gott), solche, welche zur Konstitution einer Substanz Materie, d. h. einen Körper benötigen, aber zeitweilig (zwischen Tod und Jüngstem Gericht) ohne letzteren existieren (menschliche Seelen), und solche, die immer auf Materie angewiesen sind. Im Gegensatz zur Scholastik hält Descartes sowohl die Seelen als auch die Körper für selbständige Substanzen: Jene sind reine Formen, die vollkommen ohne Materie auskommen, diese sind Substanzen, die nur geometrische und kinematische Eigenschaften besitzen, nämlich Größe, Gestalt, Position und Bewegung. Leibniz hingegen widerspricht Descartes mit der Behauptung, "daß jeder, der über das Wesen der Substanz [...] nachdenkt, finden wird, daß das gesamte Wesen des Körpers nicht bloß in der Ausdehnung besteht, d. h. in der Größe, Gestalt und Bewegung, sondern daß man notwendigerweise darin etwas anerkennen muß, das eine Beziehung zu den Seelen hat und das man gewöhnlich substantielle Form nennt" (S. 25). Weshalb sich nicht alle Eigenschaften eines Körpers auf Größe, Gestalt und Bewegung reduzieren lassen, versucht Leibniz im Abschnitt 17 zu beweisen. Dort zeigt er mit einem physikalisch korrekten Argument, daß die Bewegungsgröße (modem gesprochen: der Impuls) nicht - wie Descartes glaubt - mit der bewegenden Kraft (der kinetischen Energie) identisch ist. Folglich muß die Kraft als irreduzible Eigenschaft von Körpern aufgefaßt werden, "und man kann daraus schließen, daß alles, was unter .dem Begriff Körper verstanden wird, nicht einzig in der Ausdehnung und in ihren Modifikationen besteht, wie es sich unsere Modemen einreden. Daher sind wir auch genötigt, gewisse Wesenheiten oder Formen wieder einzusetzen, die sie verbannt haben" (S. 47). Weshalb die bewegende Kraft nicht einfach als zusätzliche materiale Eigenschaft verstanden werden kann, sondern "notwendigerweise [...] eine Beziehung zu den Seelen hat", erörtert er nicht. Aber es drängt sich die Vermutung auf, Leibniz denke hier in irgend einer Form vitalistisch. Jedenfalls bilden für ihn weder die Seele noch der Substantielle Form und Notwendigkeit Bei der Ausarbeitung seiner Auffassung von Substanz stützt sich Leibniz nicht nur auf das ln-essePrinzip und die daraus abgeleiteten Sätze, sondern auch auf die von allen namhaften Denkern seiner Zeit verworfene scholastische Doktrin von den substantiellen Formen. Obwohl er vorerst die von Descartes, Hobbes und anderen neuzeitlichen Philosophen vertretene Ansicht geteilt hatte, die Scholastik sei unfruchtbar, sieht er sich später gezwungen, auf die Doktrin der substantiellen Formen zurückzukommen, "deren Kenntnis in der Metaphysik so sehr vonnöten ist, daß man ohne sie meines Dafürhaltens weder die ersten Prinzipien recht erkennen noch den Geist zur Erkenntnis der unkörperlichen Wesenheiten und der Wunderwerke Gottes erheben kann" (S. 23). Form und Materie sind die Grundbegriffe der scholastischen Philosophie, gemäß der alle Dinge aus derselben Art Materie bestehen, sich aber in bezug auf die ihnen innewohnende Form unterscheiden. Da die Materie weder geschaffen noch zerstört werden kann, sind Veränderungen an und in den Dingen auf 16 KURZE EINFÜHRUNG IN DIE METAPHYSISCHE ABHANDLUNG Körper eine unabhängige Substanz Die Seele ist digen Folgerung schließt einen Widerspruch ein, während das Gegenteil einer hypothetisch notwendigen keinen Widerspruch enthält, also logisch möglich ist. Im zweiten Fall setzt die "Beweisführung [...] den von Gott frei gewählten Lauf der Dinge [voraus]; und dieser beruht auf seinem ersten freien Ratschluß, der darin besteht, allemal das Vollkommenste zu tun [...]. Alle Wahrheit nun, die in Ratschlüssen solcher Art begründet ist, ist zufällig, mag sie auch gewiß sein; denn diese Ratschlüsse ändern nichts an der Möglichkeit der Dinge, und obwohl Gott [...] gewiß allemal das Beste wählt, so hindert das nicht, daß das weniger Vollkommene an sich möglich ist und bleibt" (S. 31). Leibniz differenziert also zwischen "gewiß" und "notwendig" und sagt, alle wahren Aussagen seien gewiß und deshalb träten auch alle von ihnen beschriebenen Ereignisse mit Sicherheit ein. Diese Gewißheit ist aber nicht absolut, sondern hängt von der vorgängigen, freien Entscheidung Gottes ab, von allen möglichen Welten die beste zu schaffen. Im Gegensatz dazu "beruhen die [absolut] notwendigen Wahrheiten auf dem Prinzip des Widerspruchs und auf der Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Wesenheiten selbst, ohne daß man dabei den freien Willen Gottes [...] in Betracht zu ziehen braucht" (S. 33). Insofern hat das Prinzip des Widerspruchs als stärker zu gelten als das Prinzip des Besten: Selbst Gott kann sich bei der Schaffung der Welt nicht über es hinwegsetzen. vielmehr die substantielle Form des Körpers und konstituiert nur mit diesem zusammen eine selbstän- dige: Einheit Das In-esse-Prinzip, das sich im Zusammenhang mit der Theorie der Substanz als besonders fruchtbar erwiesen hat, führt in einem anderen Bereich zu Schwierigkeiten: Wie ist die Annahme, in jeder wahren Aussage sei der Prädikatsbegriff im Subjektsbegriff enthalten, mit der von Leibniz wie von den meisten bedeutenderen Philosophen des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts anerkannten Tatsache vereinbar, daß es notwendige und kontingente Wahrheiten gibt? Denn da in jeder wahren Aussage der Prädikatsbegriff im Subjektsbegriff enthalten ist, muß im Prinzip auch für jede wahre Aussage ein apriorisches Beweisverfahren existieren. Dieses Problem hat Leibniz lange Zeit beschäftigt, und er hat zu seiner Behebung verschiedene Ansätze vorgelegt, so den Vorschlag, eine notwendige Wahrheit unterscheide sich von einer kontingenten dadurch, daß sie vermittels einer endlichen Anzahl von Definiens-fürDefiniendum-Substitutionen in eine identische (d. h. analytische) Aussage übergeführt werden könne. In der Metaphysischen Abhandlung legt er allerdings eine andere Lösung vor, indem er von der Unterscheidung zwischen absolut notwendigen und'hypothetisch notwendigen Beweisführungen ausgeht: Das Gegenteil (die Negation) einer absolut notwen- 17