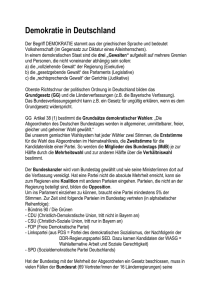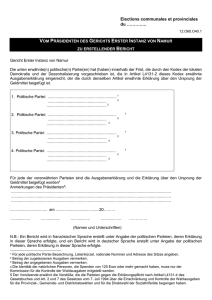NPD-Verbotsantrag des Bundestags
Werbung
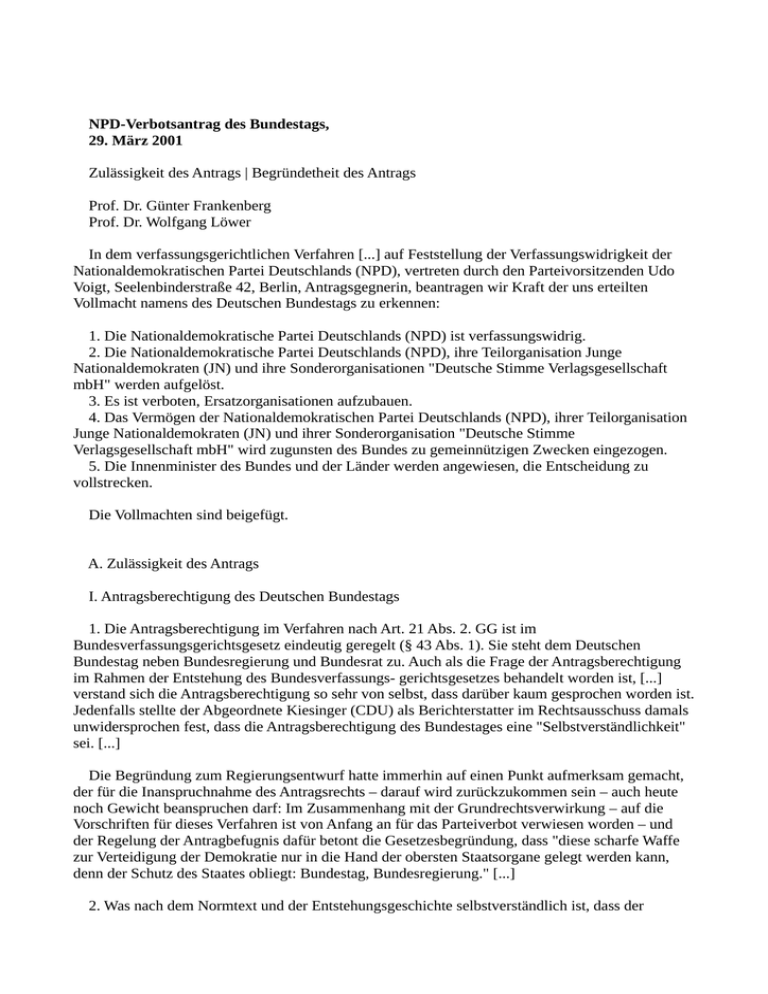
NPD-Verbotsantrag des Bundestags, 29. März 2001 Zulässigkeit des Antrags | Begründetheit des Antrags Prof. Dr. Günter Frankenberg Prof. Dr. Wolfgang Löwer In dem verfassungsgerichtlichen Verfahren [...] auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD), vertreten durch den Parteivorsitzenden Udo Voigt, Seelenbinderstraße 42, Berlin, Antragsgegnerin, beantragen wir Kraft der uns erteilten Vollmacht namens des Deutschen Bundestags zu erkennen: 1. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) ist verfassungswidrig. 2. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), ihre Teilorganisation Junge Nationaldemokraten (JN) und ihre Sonderorganisationen "Deutsche Stimme Verlagsgesellschaft mbH" werden aufgelöst. 3. Es ist verboten, Ersatzorganisationen aufzubauen. 4. Das Vermögen der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD), ihrer Teilorganisation Junge Nationaldemokraten (JN) und ihrer Sonderorganisation "Deutsche Stimme Verlagsgesellschaft mbH" wird zugunsten des Bundes zu gemeinnützigen Zwecken eingezogen. 5. Die Innenminister des Bundes und der Länder werden angewiesen, die Entscheidung zu vollstrecken. Die Vollmachten sind beigefügt. A. Zulässigkeit des Antrags I. Antragsberechtigung des Deutschen Bundestags 1. Die Antragsberechtigung im Verfahren nach Art. 21 Abs. 2. GG ist im Bundesverfassungsgerichtsgesetz eindeutig geregelt (§ 43 Abs. 1). Sie steht dem Deutschen Bundestag neben Bundesregierung und Bundesrat zu. Auch als die Frage der Antragsberechtigung im Rahmen der Entstehung des Bundesverfassungs- gerichtsgesetzes behandelt worden ist, [...] verstand sich die Antragsberechtigung so sehr von selbst, dass darüber kaum gesprochen worden ist. Jedenfalls stellte der Abgeordnete Kiesinger (CDU) als Berichterstatter im Rechtsausschuss damals unwidersprochen fest, dass die Antragsberechtigung des Bundestages eine "Selbstverständlichkeit" sei. [...] Die Begründung zum Regierungsentwurf hatte immerhin auf einen Punkt aufmerksam gemacht, der für die Inanspruchnahme des Antragsrechts – darauf wird zurückzukommen sein – auch heute noch Gewicht beanspruchen darf: Im Zusammenhang mit der Grundrechtsverwirkung – auf die Vorschriften für dieses Verfahren ist von Anfang an für das Parteiverbot verwiesen worden – und der Regelung der Antragbefugnis dafür betont die Gesetzesbegründung, dass "diese scharfe Waffe zur Verteidigung der Demokratie nur in die Hand der obersten Staatsorgane gelegt werden kann, denn der Schutz des Staates obliegt: Bundestag, Bundesregierung." [...] 2. Was nach dem Normtext und der Entstehungsgeschichte selbstverständlich ist, dass der Bundestag Antragsteller sein kann, ist unter dem Gesichtswinkel, ob er auch einen Antrag stellen soll, in der Plenardebatte um die Antragstellung [...] problematisiert worden (ohne dass die rechtliche Zulässigkeit der Antragstellung bezweifelt worden wäre). Zu den öffentlich vorgetragenen Argumenten der Inopportunität der Antragstellung gehört auch der Hinweis, die Phalanx von Antragstellern wolle möglicherweise fehlendes Gewicht von Argumenten kompensieren oder gar das Gericht unter Druck setzen. Die Genese des Bundestagsantrags belegt jedoch., dass der Bundestag seinen Antrag aus wohlerwogenen Sachgründen gestellt hat, so dass also gewiss nicht von einer rechtsmissbräuchlichen Antragstellung gesprochen werden kann. [...] Die Argumente gegen einen eigenen Verbotsantrag des Bundestages verweisen darauf, dass der Verbotsantrag selbst "klassische Aufgabe der Exekutive" sei [...] und dass deshalb die bisherigen Parteiverbotsanträge auch nur von der Exekutive gestellt worden seien. [...] Daran ist richtig, dass der Deutsche Bundestag nicht selbst jene Informationen erheben kann, die die Grundlagen dafür bieten, einen Parteiverbotsantrag stellen zu dürfen. Das heißt aber nicht, dass der Bundestag nicht in der faktischen und rechtlichen Lage wäre, aus dem präsentierten Material auf das rechtliche Verbotensein einer Partei im Sinne von Art. 21 Abs. 2 GG schließen zu können. Diese "Subsumtion" des Materials hat der Innenausschuss sorgfältig vorgenommen. Er ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die NPD - verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, - mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt ist, - Grundprinzipien der freiheitlichen und demokratischen Verfassung des Parlamentarismus bekämpft, - eine aktiv-kämpferische aggressive Haltung gegenüber der freiheitlich demokratischen Grundordnung einnimmt, - in den letzten Jahren eine herausgehobene Bedeutung für das rechtsextreme und gewaltbereite Spektrum erlangt hat. [...] Dieser Einschätzung haben im übrigen alle Parteien bis auf die F.D.P. im Bundestag zugestimmt; dabei hegt auch die F.D.P. keine substantiellen Zweifel an der "Verfassungsfeindlichkeit" der NPD sie will nur das Risiko eines Scheiterns mit einem Verbotsantrag nicht eingehen. [...] Aber nur dieser Teil der Entscheidungsbildung ist von den von der Exekutive erarbeiteten Materialien ein Stück weit abhängig. Hinzu tritt die Entscheidung, ob der feststehenden Überzeugung vom Verbotensein auch ein auf den konstitutiven Ausspruch [...] hinzielender Beschluss über die Verfahrenseinleitung, die im politischen Ermessen der antragsberechtigten Verfassungsorgane steht, herbeigeführt werden soll. [...] An dieser Stelle müssen die politischen Einschätzungen der Opportunität, einen Verbotsantrag zu stellen, in der Meinungsbildung der antragsberechtigten Verfassungsorgane nicht notwendig parallel verlaufen. Die Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat gleichermaßen anvertraute Befugnis dekonzentriert diese wichtige Weichenstellung, indem sie diese drei Verfassungsorgane zur je selbständigen Willensentscheidung in dieser Frage ermächtigt. Das ist wiederum deshalb konsequent, weil diesen Organen schwergewichtig der Schutz der Verfassung anvertraut ist; deshalb muss die Einschätzungsprärogative, ob eine Verfahrenseinleitung erforderlich ist, auch jedem Organ für sich zustehen. Wie die Debatte um den Verbotsantrag zeigt, hat der Bundestag sich über die Sinnhaftigkeit der Rolle als Antragsteller auch vergewissert. Thematisch gehe es gerade darum, die Teilnahme der verfassungswidrigen NPD an der parlamentarischen Willensbildung zu verhindern; es sei aus der Sicht des Bundestages nicht vertretbar, der NPD ihre verfassungsfeindlichen Aktivitäten mit Steuermitteln aus der Wahlkampfkostenerstattung zu finanzieren. [...] Die Komplikation, dass eine verfassungsfeindliche Partei, solange sie nicht durch bundesverfassungsgerichtliches Erkenntnis verboten ist, durch Steuermittel in ihrem verfassungsfeindlichen Agieren (teil-)alimentiert wird, ist jünger als die beiden bedeutenden Verbotsanträge im SRP und KPD-Verfahren und begründet insoweit auch ein zusätzliches Verantwortungsmoment der antragsbefugten Verfassungsorgane, insbesondere auch des Bundestages, der für die Art der Parteienfinanzierung wegen deren Gesetzesabhängigkeit besondere Verantwortung trägt. [...] Staatsrechtlich ist der Bundestag insofern zum Verbotsantrag legitimiert, weil der Bundestag das Volk vertritt, diesen gegenüber die Gesamtverantwortung für das bonum commune trifft, das erst in der verbindlichen Zuordnung der außenwirksamen Entscheidungskompetenzen arbeitsteilig verwirklicht wird. Schon wegen dieser Vertretungsfunktion des Parlaments für das Volk, steht die Staatsleitung nach dem berühmten Diktum Ernst Friesenhahns Parlament und Regierung "zur gesamten Hand" zu. Dieses Gesamthänderische äußert sich zunächst in der gewaltenteilungsrechtlich nicht begrenzten Beobachtungsfunktion des Parlaments, gesellschaftliche Entwicklungen – nicht anders als die Regierung – daraufhin zu analysieren, ob Notwendigkeiten für hoheitliche Einwirkungen bestehen, denen mit dem Formenreichtum staatlicher Intervention (die Interventionsmittel stehen darin nur gewaltengeteilt zur Verfügung) begegnet werden soll. Die Initiativfunktion, was die aufzugreifenden Gegenstände der Aufmerksamkeit betrifft, steht dem Parlament unbegrenzt zu. Klaus Stern hat deshalb ganz zurecht Paul Laband für die (an sich triviale) Erkenntnis zitiert, "dass die Zuständigkeit des Reichstages ebenso weit wie die Zuständigkeiten des Reiches (reicht)". [...] In diesem Sinne hat sich der Deutsche Bundestag in der jüngsten Vergangenheit beobachtend und auch Maßnahmen initiierend mit dem Phänomen des Rechtsextremismus beschäftigt. [...] Infolge dieser Anträge hat der Deutsche Bundestag beschlossen, zum Thema Rechtsextremismus im Innenausschuss eine öffentliche Anhörung durchzuführen. [...] Der Bundestag hat sich in wichtigen Plenardebatten mit dem Thema beschäftigt. [...] Das substantiell Beunruhigende des Rechtsextremismus hat das Parlament folglich mit seiner auch ihm zukommenden Initiativ- und Gestaltungsfunktion – neben der Regierung – als Problem aufgegriffen. [...] Darauf ist in der "Antragsdebatte" im Plenum ausdrücklich hingewiesen worden und damit auch das auf dem Feld des Parteiverbots nach der Rechtslage des Bundesverfassungsgerichts (konkurrierend zu Bundesregierung und Bundesrat) mögliche letzte Wort (eigene Antragsstellung) verbunden worden: Der Abg. Dr. Michael Bürsch (SPD) hat ausdrücklich auf die Wesentlichkeitsrechtsprechung rekurriert nach der alle "wesentlichen Entscheidungen, die von grundsätzlicher, verfassungsrechtlicher normativer Bedeutung sind, ins Parlament gehören. Der Bundestag als unmittelbar demokratisch legitimierte Volksvertretung sollte und muss hier eine eigene Entscheidung treffen". [...] In der Debatte ist auch die Linie von den sonstigen Maßnahmen – auch des Bundestages – zur Bekämpfung des Rechtsextremismus gezogen worden hin zu einem in der Demokratie konsequenterweise vom Bundestag als Vertretung des Volkes zu stellenden Verbotsantrag. [...] Der Antragsteller handelt also mit seiner Antragstellung zweifelsfrei prozessordnungsgemäß und verfassungsstaatlich legitim: Der Bundestag ist nicht weniger Hüter der Verfassungsintegrität als die anderen Verfassungsorgane. Auf diesem Rechtsgrund hat der Bundestag sich dazu entschlossen, von seinen politischen Opportunitätsermessen im Sinne der Antragstellung Gebrauch zu machen, wohl wissend, dass menschenverachtende und totalitäre politisch-ideologische Verirrung und dementsprechendes Handeln nicht aufhört, wenn ein organisatorischer Rahmen dafür verboten wird. Natürlich entziehen sich Gedanken und Ideen jeder Verbotsverfügung – unbeschadet ihres Inhalts. Deshalb sind die weiteren Maßnahmen von Bundestag und Bundesregierung zur Bekämpfung des Rechtsextremismus die zweite Säule einer offensiven Strategie des Staates, mit diesen seine freiheitlichen Grundlagen zerstörenden Tendenzen fertig zu werden. In diesem Zusammenhang ist das Parteienverbot als das andere Bein keineswegs ohne Effektivität, weil es eine aufgebaute und funktionierende Organisation zur Verbreitung der inkriminierten Ideen zerschlägt. In einer Organisation zur Verbreitung der Idee steckt aber ein Stück des spezifischen Gefahrenpotentials einer solchen "Bewegung". Das vielbeschworene Abdrängen in den Untergrund der verbotenen Partei erschwert zwar die Beobachtung der Entwicklungstendenzen; andererseits schneidet sie die NPD von allen Foren ab, die ihr als nicht verbotener Partei zustehen. Von der Zuteilung von Sendezeiten in Rundfunk und Fernsehen zu Wahlkampfzeiten, vom Zugriff auf Stadthallen, vom Zugriff auf den öffentlichen Raum in Wahlzeiten, mit der Möglichkeit für sich zu werben, von den staatlichen Geldzuflüssen wird sie nur durch das Verbot abgeschnitten; kurz, es endet die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, die NPD als objektiv verfassungswidrige Partei mit den verfassungsmäßigen Parteien gleichbehandeln zu müssen, weil sie nicht verboten ist. [...] Schließlich ist aus dem Gesichtswinkel der Opportunität noch bedeutsam, dass zukünftige etwaige Ersatzorganisationen als solche erleichtert zu verbieten sind, so dass verfestigte Nachfolgeorganisationen nicht mehr etabliert werden können. II. Sonstige Zulässigkeitsvoraussetzungen Der Hauptantrag ist zulässig, weil er sich auf das Verbot der NPD als Partei richtet (1). Auch soweit der Antrag sich auf das Verbot der "Jungen Nationaldemokraten", sowie auf das Verbot der "Deutsche Stimme Verlagsgesellschaft mbH" bezieht, ist er zulässig (2a) b)). Das gilt auch für die sonstigen Nebenanträge (2c)). 1. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands ist Partei im Sinne von Art. 21 Abs. 1 GG i.V.m. § 2 PartG. a) Der Hohe Senat hat zuletzt in dem Verfahren zum Verbot der Nationalen Liste – BVerfGE 91, 262 – und der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei – BVerfGE 91, 276 – den Parteibegriff des § 2 PartG im Lichte des Art. 21 GG näher erläutert. Danach ist von folgenden Tatbestandsmerkmalen auszugehen: Wegen ihrer Funktion, an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken, sind Parteien notwendig Wahlvorbereitungsorganisationen; sie nehmen an Parlamentswahlen teil. Sie sind (kumulativ dazu) nur dann Parteien, wenn sie auch zwischen den Wahlen ihre "Bündelungsfunktion" wahrnehmen, d.h. dass sie dem Bürger programmatische Alternativen anbieten und dass sie auf die Bürger im organisatorischen Rahmen der Partei einwirken können, um so an der Rückkoppelung zwischen Staatsorganen und Volk mitzuwirken; das setzt dann außenwirksames Sich-Positionieren der Partei im Parteienwettbewerb auch zwischen Wahlen voraus. Die Parteiqualität hängt nicht vom Willen ab, Partei zu sein; die Frage, ob ein soziales Gebilde Partei ist, richtet sich nach objektiven Kriterien; das gilt jedenfalls, wenn es sich nicht um eine Neugründung einer Partei handelt. Hinter der Partei müssen folglich "gewisse Wirklichkeiten stehen, die es erlauben, sie als Ausdruck eines Ernsthaften, in nicht zu geringem Umfang im Volk vorhandenen politischen Willens anzusehen." [...] Dieser Test auf die Ernsthaftigkeit wird unter anderem durch die einzelnen Tatbestandsmerkmale des § 2 Abs. 1 PartG (Umfang und Festigkeit der Organisation, Mitgliederzahl, Hervortreten in der Öffentlichkeit) im Sinne einer Indizfunktion ausgefüllt. Entscheidend ist aber immer eine Gesamtbeurteilung, die nicht schon aus dem Fehlen eines einzelnen oder einzelner Merkmale notwendig auf das Fehlen einer Parteieigenschaft schließen darf. Gemessen an diesen Tatbestandsvoraussetzungen ist an der Parteieigenschaft der Nationaldemokratischen Partei nicht zu zweifeln. aa) Die NPD ist zunächst Partei ihrem Selbstverständnis nach, wie sich aus § 2 ihrer Satzung eindeutig ergibt. [...] Sie bietet den Bürgern auch ein Programm an, mit dem sie sich als politische Alternative im Parteienspektrum präsentiert. [...] Aus einem programmatischen Strategiepapier ergibt sich weiter, dass die NPD sowohl fortdauernd an Wahlen teilnehmen will und dass sie permanent daran arbeiten will, ihre Programmatik auch durchzusetzen. Die dynamische Weiterentwicklung der völkisch-nationalen Programmatik müsste zu einem integralen Bestandteil des täglichen politischen Kampfes werden. Alle Ideen und Begriffe müssten hinsichtlich ihrer mobilisierenden Wirkung auf die Massen immer wieder in einem dynamischen Prozess erprobt werden. "Der Weg von der Schreibstube zur Straße – und wieder zurück zur Schreibstube – muss kurz und frei von Hindernissen sein." (Was man immerhin als Rückkoppelung zwischen den phänomenal so ansprechbaren Bürgern und der Partei verstehen kann.) [...] Die Partei weist auch einen organisatorisch verfestigten Rahmen auf. Sie hat einen Bundesvorstand und derzeit 15 Landesverbände mit Untergliederungen auf der Kreisverbands und Ortsebene. bb) Bei objektiver Gesamtbetrachtung steht hinter der Programmatik und dem Willen auch eine "Wirklichkeit", die es erlaubt, die NPD als Partei zu erkennen. Seit 1998 hat die NPD an 14 von 17 überregionalen Wahlen teilgenommen, darunter auch an der Bundestagswahl 1998 und an der Europawahl 1999. Bei den Landtagswahlen in MecklenburgVorpommern (1998), in Sachsen (1999) und in Schleswig-Holstein (2000) ist es ihr jeweils gelungen, mindestens 1 Prozent der Wählerstimmen zu erreichen und damit die rechtliche Relevanzschwelle für die staatliche Wahlkampfkostenerstattung zu übertreffen (§ 18 Abs. 4 i.V.m. § 18 Abs. 3 Nr. 1 PartG). Damit erreicht die NPD in der endgültigen staatlichen Teilfinanzierung 1999 zum 15. Februar 2000 eine staatliche Transferleistung von ca. 1,2 Mio DM. [...] Mit dem Überschreiten der gesetzlichen Förderungsschwelle ist fraglos geworden, dass die Probe auf die Ernsthaftigkeit für den Aspekt der Teilnahme an der staatlichen Willensbildung durch Wahlteilhabe zu bejahen ist. Der Grenzwert für die Teilnahme am Erstattungsverfahren will solche Splittergruppen ausschließen, deren geringer Wahlerfolg erkennen lässt, das sie diesen gar nicht ernsthaft anstreben. [...] Der relativ niedrige Wert von 0,5 v.H. (für Europa und Bundesebene) resp. 1 v.H. (für die Ebene der Landtagswahlen) in § 18 PartG beruht gewissermaßen auf der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das eine Schwelle von 2,5 v.H. unter dem Gesichtswinkel der Chancengleichheit der Parteien für zu hochgehalten hatte. [...] Damit formuliert die Rechtsordnung eine Beachtlichkeitsschwelle, die notwendig eine gesetzlich gegriffene Größe sein muss, die aber gleichwohl auch hier Bedeutung erlangt: Wahlkampfkostenerstattung sollen solche Parteien erhalten (die auch nur dann solche sind), die im Wettbewerb der Parteien auch von anderen Parteien als Konkurrenten gesehen werden müssen. Das gilt z.B. für die NPD im Konkurrenzspektrum zu anderen Parteien der äußersten Rechten wie DVU und REPUBLIKANER. In diesem Segment hat z.B. die Ausschaltung einer Partei für den eigenen Wahlerfolg durchaus einige Relevanz. Die Relevanz der NPD wird schließlich noch durch die Teilnahme an Kommunalwahlen bekräftigt. Die NPD will gegenwärtig mehr als 60 Mandate in kommunalen Vertretungskörperschaften innehaben. [...] Die NPD will auch fortdauernd an Wahlen teilnehmen. So ist für das Jahr 2001 die Teilnahme an den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz angekündigt. [...] Aber auch das zweite ernstlich zu verfolgende Merkmal die aktive Teilnahme an der politischen Willensbildung durch entsprechendes Hineinwirken in den gesellschaftlichen Raum außerhalb der Wahlen – lässt sich ohne weiteres bejahen: 1996 betrug die Mitgliederzahl laut dem Rechenschaftsbericht der Partei 3240, 1998 waren es 5980 und 1999 6079 (jeweils nach den dem Bundestag eingereichten Rechenschaftsberichten). Die Partei ist also in der Mitgliederakquisition erfolgreich. Am 12. August 2000 hat die Partei sogar erklärt, 7000 Mitglieder zu haben. [...] Der "Ertrag", des Hineinwirkens in die Gesellschaft zeigt sich neben der Mitgliederwerbung auch im Spendenaufkommen. Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 1999 weist ca. 1,6 Mio DM Einnahmen aus Spenden aus. Die politische Arbeit nach außen – ohne die Aufwendungen für Wahlkämpfe.Personalausgaben, Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb sowie Ausgaben für allgemeine politische Arbeit – betrugen laut Rechenschaftsbericht 1999 rund 2 Mio DM. [...] Diese Zahlen belegen die allgemeinkundige Tatsache, dass die NPD über einen organisatorischen Rahmen verfügt, der es ihr ermöglicht, Bundesparteitage abzuhalten und z.B. als Veranstalter von Demonstrationen in erheblicher Zahl aufzutreten. Allein im Zeitraum 1997 bis Herbst 2000 hat die NPD (oder ihre Jugendorganisation) – dazu sogleich 2b) – mehr als 300 Demonstrationen angemeldet, die sie gelegentlich selbst dann noch durchgeführt hat, wenn sie verboten worden sind. [...] Durch ihr Parteiorgan "Deutsche Stimme", der auch ein Versandbuchhandel angeschlossen ist, – dazu sogleich 2c) – wirkt sie auch mit dem Mittel der Druckschrift in den gesellschaftlichen Raum hinein. Auch das Internet wird als Informationsmedium bekanntlich intensiv genutzt. Weiteres ließe sich anfügen; darauf kann aber angesichts der Eindeutigkeit des Befundes verzichtet werden. Hinter der NPD steht eine beachtliche "Wirklichkeit", die mit den Fällen, die im 91. Band zu Verneinung der Parteieigenschaft bei der NL und FAP geführt haben, unvergleichlich ist. 2a) In die Verbotsentscheidung einzubeziehen ist auch die Jugendorganisation der "Jungen Nationaldemokraten" als Teil-(oder Sonder-)Organisation der Partei (§ 42 Abs. 2 BVerfGG). Nach § 46 Abs. 2 BVerfGG kann das Verbot auf einen rechtlich oder organisatorisch selbstständigen Fall der Partei beschränkt werden. Der Sinngehalt der Vorschrift ist eigentlich eher der, dass das Verbot auf einen Teil zu beschränken ist, wenn nur ein Teil verfassungswidrig ist. Ansonsten ist alles zu verbieten, was "die Partei" ist, also unter prinzipieller Außerachtlassung der organisatorischen Trabantierung einer Partei. [...] Insofern ist der in Bezug auf die jungen Nationaldemokraten gestellte Verbotsantrag an sich nur deklaratorisch, verdeutlicht bei entsprechendem Tenor aber die Verbotsreichweite. Insofern erstreckt sich das Verbot "der Partei" prinzipiell auch auf Teil- und Sonderorganisationen. [...] Dabei mag dahinstehen, ob die Jungen Nationaldemokraten Teil- oder Sonderorganisation sind; die Abgrenzung zwischen den Kategorien ist ohnehin wohl nicht trennscharf, im Ergebnis auch unerheblich, weil sowohl Teil- wie Sonderorganisationen so dicht mit der Partei verwoben sind, dass sie "die Partei" sind, so dass sich der Verbotsausspruch ohne weiteres auch auf sie erstrecken darf. [...] Die "Jungen Nationaldemokraten (JN)" lassen sich als organischer Teil der NPD bis in das Jahr 1968 zurückverfolgen. [...] Sie sind stets als besonders radikaler Teil der Partei hervorgetreten. [...] Ihr Selbstverständnis als "Speerspitze der nationalen Bewegung" reicht bis in die 70er Jahre zurück. [...] Sie ist Teilorganisation (oder Sonderorganisation), [...] weil die Parteisatzung [...] die Jungen Nationaldemokraten als "integralen Bestandteil der NPD" (§ 19) bezeichnet; personal wird dieses Einfügen der Jungen Nationaldemokraten dadurch gesichert, dass der Bundesvorsitzende der JN kraft Amtes zugleich Mitglied des NPD-Parteivorstandes ist (Ziff. 2 der NPD-Satzung). Folglich sind die "Jungen Nationaldemokraten" auch "die Partei". 2b) Auch der Antrag festzustellen, dass die "Deutsche Stimme Verlagsgesellschaft mbH" mit Firmensitz in Riesa verboten ist, ist zulässig. Sonderorganisationen einer Partei sind Parteiunternehmen, "d. h. von der allgemeinen Parteiverwaltung abgesetzte, organisatorisch und zum Teil auch rechtlich verselbständigte Einheiten von Kapitalmitteln und Arbeitskräften zur laufenden Erfüllung besonderer Parteiaufgaben (z.B. Verlage und Druckereien zur Herstellung von Parteischriften)", so Karl Heinz Seifert [...]. Auch Wilhelm Henke [...] betont, dass es nicht auf die Rechtsform ankommt; erfasst werden sollen solche Unternehmen, die sich im Verhältnis zur Partei wie eine dienende Anstalt verhalten. Laut Handelsregistereintragung ist der Gegenstand des Unternehmens die "Herstellung und der Vertrieb von Zeitungen, Zeitschriften und Druckschriften; insbesondere die Herausgabe der Deutschen Stimme' sowie die Produktion von und der Handel mit Drucksachen, Büchern, Tonträgern, Videos, Textilien und weiterer Devotionalien" (sic!). [...] Der Verlag hat also ersichtlich dienende Funktion für die NPD. Das Stammkapital beträgt 430.000,- DM. [...] Zwar ist nicht ersichtlich, wer das Stammkapital der GmbH aufgebracht hat. Die NPD selbst ist nicht Gesellschafter der GmbH. Gesellschaftsrechtlich wirft die Frage, ob eine politische Partei als nicht rechtsfähiger Verein Gesellschafter einer GmbH sein könnte, auch schwierige Fragen auf. Zwar ist mittlerweile anerkannt, dass die BGB-Gesellschaft als Gesamthandsgemeinschaft tauglicher Gründer sein kann [...]. Da auch der nichtrechtsfähige Verein als Gesamthand begreifbar ist [...] wäre auch der Schritt denkbar (geworden), einen nicht rechtsfähigen Verein als tauglichen Gründer einer Ein-MannGmbH anzusehen. Die Publizitätsprobleme wären bei einer Partei allerdings eher noch größer als schon bei der BGB-Gesellschaft als gesamthänderischer Vereinsgründer. Aber danach fragt die Zurechnung einer Organisation an die Partei auch nicht. Die Zweckverfolgung für die Partei in Verbindung mit der Tatsache, dass die Gesellschafter des Verlages und der Geschäftsführer jeweils Vorstandsmitglieder der NPD sind, [...] dokumentiert eine personelle Verflechtung, die die Zurechnung als Sonderorganisation rechtfertigt. Die Einkünfte aus dem Verlag fließen auch offensichtlich der NPD wieder zu, wie dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen ist. [...] Es handelt sich folglich bei der "Deutsche Stimme Verlagsgesellschaft mbH" um eine Sonderorganisation. Als solche ist sie "die Partei" und damit verbotsfähig. c) Die Zulässigkeit der weiteren gestellten Anträge zu 3) -5) ergibt sich aus § 46 Abs. 3 BVerfGG. 3. [Beteiligung der NPD an Europawahlen] Der Zulässigkeit des Verbotsantrags (oder eines Verbotsausspruches) steht auch nicht entgegen, dass sich die NPD an den letzten Wahlen zum Europaparlament beteiligt hat (a). Auch eine Vorlage der Frage, ob eine Partei verboten werden kann, wenn sie sich als eine "europäische Partei" an den Wahlen zum Europaparlament beteiligt hat, seitens des Bundesverfassungsgerichts an den Europäischen Gerichtshof kommt nicht in Betracht (b). a) Ansatzpunkte für eine Sperrnorm gegenüber den Parteiverbot könnte nur aus europäischem Parteienrecht (aa) oder aus europäischem Wahlrecht hergeleitet werden (bb). Beide Aspekte ergeben indes im Ergebnis keinen rechtlichen Befund in Richtung einer solchen gedachten Sperrnorm. aa) Ein Ansatzpunkt, für eine solche Sperrnorm könnte allenfalls das primäre Gemeinschaftsrecht liefern (Art. 191 EGV), weil sekundäres Parteienrecht nicht existiert. Dieser Fehlbefund im sekundären Gemeinschaftsrecht führt auch schon unmittelbar zur Problematik des Art. 191 (ex138a) EGV hin, der sozusagen einen staatstheoretischen Befund – dass politische Parteien ein wichtiger Integrationsfaktor sind – kodifiziert, aber keine Anordnung enthält. Deshalb ist in der Literatur auch zurecht darauf hingewiesen worden, dass Art. 191 keine Strukturvorgaben für die Statuten europäischer Parteien noch einen Verbotstatbestand noch die Ermächtigung zu einem Gemeinschaftsrechtsakt enthält, der die Grundlage für ein europäisches Parteiengesetz bilden könnte. [...] Aus dieser Sicht ist dem europäischen Parteienrecht eine Sperrnorm für ein nationales Verbot nicht zu entnehmen. Soweit angenommen wird, Art. 191 EGV sei der normativen Ausgestaltung durch die Organe der europäischen Gemeinschaft zugänglich und Art. 191 habe für diese Ausgestaltung auch eine normative Bedeutung, [...] ist die Bestimmbarkeit des Begriffs der europäischen politischen Partei Mindestvoraussetzung; danach ist zu fragen, ob die NPD nach ihrer Europawahlteilnahme unter diesen europäischen Parteibegriff subsumiert werden kann. Die Schwierigkeit bei einer Norm wie Art. 191 EGV liegt darin, dass sie sozusagen den Finger auf eine Wunde des Europäischen Entscheidungssystems legt; die Norm verdeutlicht, dass es das landläufig konstatierte Demokratieprinzip gibt, wenn man die Legitimationserwartung europäischer Willensbildung durch ein europäischen Staatsvolk hegt. Insofern bietet Art. 191 EGV eine zukunftszugewandte Therapie an: Europäische Parteien, die Integrationsinstrument für die Unionsbürger sein sollen. Europäische Parteien sind in dieser Sicht Teil eines Prozesses, der abschlossen sein wird, wenn es ein "europäisches Volk" geben wird. [...] Sie sollen also den europäischen Willen – in einer gewissen Ablösung von den jetzt die Legitimation der Gemeinschaftsrechtsausübung neben dem Europäischen Parlament "liefernden" Staatsvölkern der Mitgliedstaaten bilden helfen. Die derzeitige Situation ist durch die Schwierigkeit gekennzeichnet, die Kapteyn/Verloren van Themaat auf die Formel gebracht haben: "The members of the European Parliament represent not only their own people, but also the other peoples of the Community". [...] Dieser schwierige Befund muss sich im Begriff der Europäischen Partei wiederfinden, da einerseits die gegenwärtige Befindlichkeit des europäischen Entscheidungssystem reflektiert werden und andererseits funktional die oben beschriebene Entwicklungsschiene in den Blick genommen werden muss. Deshalb geht das Schrifttum zum Teil insoweit von einem "empirischen Begriff der Europäischen Partei aus", [...] um wenigstens die "Parteienkonföderationen", die hinter der Fraktionsbildung im Europaparlament stehen, als europäische Partei erfassen zu können. Diese Parteienkonföderationen bleiben aber in dem beschriebenen Dilemma stecken. Als Dachorganisation auch für die Fraktionsbildung können sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass zwar die Fraktionen der Willensbildung des Parlaments ihren Stempel aufdrücken und eben nicht die Parteien. [...] Im übrigen sind diese Dachorganisationen ohne persönliche Mitgliedschaft von Unionsbürgern ausgestaltet, sie leisten zwar inzwischen auch programmatische Arbeit für den europäischen Willensbildungsprozess. Gemeinsame Listen haben sie indes für Wahlen bisher nicht präsentieren können. Der Begriff der europäischen politischen Partei wird deshalb anspruchsvoller sein müssen. Insofern besteht auch im Schrifttum ein weitgehender Konsens, dass solche Parteien, neben anderen Merkmalen eine transnationale Organisationsstruktur aufweisen müssen. [...] Dieses Erfordernis transnationaler Organisationsstruktur mit unmittelbarer,, Mitgliedschaft von Unionsbürgern ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit gehört auch zu dem vom Europäischen Parlament inzwischen formulierten Modellvorstellungen. Nach der Entschließung vom 10. Dezember 1996 [...] sind prägende Merkmale einer europäischen politischen Partei: - die Stellungnahme zur Europapolitik und das Vertretensein im Europaparlament oder eine darauf gerichtete Absicht oder die sonstige Beteiligung am europäischem Willensbildungsprozess; - eine Organisation zur Äußerung des politischen Willens von Unionsbürgern; - eine Zielsetzung jenseits der Wahlkampfunterstützung für eine Fraktion im Europaparlament; - eine transnationale Vertretung in mindestens einem Drittel der Mitgliedstaaten. Damit ist klar, dass die NPD für sich aus dem europäischen Parteienrecht nichts herleiten kann. In § 1 der Satzung [...] heißt es: "Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) ist der politische Zusammenschluss nationaler Deutscher aller Stände, Konfessionen, Landsmannschaften und Weltanschauungen." Sie kann insoweit den Status einer europäischen Partei nicht für sich beanspruchen. [...] bb) Auch dem europäischen Wahlrecht lässt sich eine Sperrnorm für einen Verbotsantrag nicht entnehmen. Art. 190 (ex-Art. 138) EGV enthält in Abs. 4 immer noch die unausgeführte Regelungskompetenz für ein einheitliches europäisches Direktwahlrecht des Europäischen Parlaments. Solange diese Regelungskompetenz nicht genutzt ist, bleibt es bei dem europäischen Rahmen, den der "Beschluss und Akt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten der Versammlung" (Direktwahlakte-DWA) vom 20. September 1976 [...] gegeben hat. Die Direktwahlakte überlässt den Mitgliedstaaten das Wahlrecht zum Europäischen Parlament sehr weitgehend. Insbesondere weist Art. 7 Abs. 2 DWA den Mitgliedstaaten die Regelung des Wahlverfahrens "nach den innerstaatlichen Vorschriften" zu. Deshalb konnte die Bundesrepublik auch eine 5-Prozent-Klausel im Europawahlgesetz (§ 2 Abs. 6 EuWG) vorsehen. [...] Zu der Frage, ob ein Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft ein Parteiverbot mit der Folge der Illegalisierung der Partei und der daraus folgenden rechtlichen Unmöglichkeit an Wahlen teilzunehmen und dem Mandatsverlust bei erfolgreicher Wahlteilnahme und nachgängigem Verbot anordnen darf, setzt sich die Direktwahlakte nach ihrem Wortlaut nicht auseinander. Sie verweist auch diese Frage (mindestens einstweilen) in die nationale Zuständigkeit. Das verdeutlicht insbesondere Art. 12 Abs. 2, DWA. Danach wird die Kompetenz bezüglich der verbindlichen Feststellung eines Mandatsverlustes zwischen dem Mitgliedstaat und dem europäischen Parlament geteilt. Wenn das Freiwerden des Mandats seine Ursache in einer mitgliedstaatlichen Vorschrift hat, so unterrichtet der Mitgliedstaat das Europäische Parlament, das. gegenüber einem solchen Mandatsverlust keine eigene Entscheidungskompetenz hat, sondern den Mandatsverlust lediglich zur Kenntnis nehmen kann. Das bedeutet aber, dass hier mittelbar zugleich die Mandatsverlustgründe Sache des mitgliedschaftlichen Rechts sind, soweit europäische Wahlrechtsgrundsätze dem nicht entgegenstehen. Folglich ist es den Mitgliedstaaten freigestellt, ein Prinzip streitbarer Demokratie zu praktizieren. Die Bundesrepublik Deutschland ist deshalb durch Europarecht nicht gehindert, in § 22 Abs. 2 Nr. 5 EuWG den Mandatsverlust bei der Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei durch das Bundesverfassungsgericht vorzusehen. Deshalb kann auch aus dem Wahlrecht zum Europäischen Parlament keine Sperrnorm gegen ein Parteiverbot entwickelt werden. b) Das Verbotsverfahren ist auch nicht etwa so lange auszusetzen, bis der Europäische Gerichtshof über eine Vorlagefrage entschieden haben wird, ob das Verbot einer Partei, die sich an Wahlen zum europäischen Parlament beteiligt hat, mit Gemeinschaftsrecht vereinbar ist. Eine solche Aussetzung kommt hier nicht in Betracht, weil das Bundesverfassungsgericht zur Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 234 EGV nicht verpflichtet ist. Das liegt allerdings nicht etwa daran, dass Verfassungsgerichte nicht als letztinstanzliche Gerichte im Sinne von Art. 234 Abs. 3 EGV verstanden werden müssten. [...] Eine Vorlage ist aber dann nicht geboten, wenn ein innerstaatliches Gericht nach einer an objektiven Maßstäben ausgerichteten Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass die entscheidungserheblichen gemeinschaftsrechtlichen Normen nicht mehrere, für einen kundigen Juristen vernünftigerweise gleichermaßen mögliche Auslegungen zulassen, wobei auch das gesamte Gemeinschaftsrecht, seine Ziele und sein Entwicklungsstand z.B. der Anwendung der betreffenden Vorschrift heranzuziehen ist. [...] So liegen die Dinge hier: Die Frage nach einer Sperrnorm ist hier zwar ernst genommen worden, es ist aber zweifelhaft, ob die Frage wirklich juristisch ernst ist. Dass die NPD keine "europäische Partei" ist, ist angesichts ihrer Satzung evident. Ebenso evident ist, dass aus der Direktwahlakte keine Sperrnorm gegen ein Parteiverbot zu entwickeln ist. Folglich gibt es keine Gründe von hinreichendem Gewicht, dem EuGH eine diesbezügliche Auslegungsfrage zum europäischen Recht vorzulegen. 4. [Vereinbarkeit des Parteiverbots mit der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)] Schließlich sei nur am Rande noch vermerkt, dass das angestrebte Parteiverbot auch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar ist (unbeschadet der Frage, wie das Verhältnis von Verfassungsrecht und den Rechten aus den EMRK zu bestimmen ist). Diese garantiert in Art. 11 Abs. 1 die Vereinigungsfreiheit und auch das Demokratieprinzip. [...] Die Vereinigungsfreiheit aus Art. 11 EMRK gilt gewiss auch für politische Parteien, ist also Maßstabsnorm für Parteiverbote. [...] Genauso klar ist aber auch, dass Parteiverbote grundsätzlich mit der EMRK vereinbar sein können. Die Konvention sieht zum einen in Art. 11 Abs. 2 die Einschränkbarkeit durch Gesetz vor (ein Erfordernis, dass durch die Verfassung zweifellos erfüllt wird) . Der Gesetzesvorbehalt wird dadurch begrenzt, dass Einschränkungen unter anderem in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen und öffentlichen Sicherheit notwendig sein müssen. Überdies sieht Art. 17 EMRK ebenfalls ein Missbrauchsverbot bezüglich der Rechte aus der EMKR vor. Deshalb ist die Beschwerde der KPD wegen der Verletzung der EMRK durch das ihr gegenüber ergangene Verbot der damals entscheidungsberufenen Europäischen Kommission für Menschenrechte auch zurückgewiesen worden. [...] Die Kommission hatte damals angenommen, dass Art. 1-7 EMRK praktisch denselben Zweck verfolge wie Art. 21 Abs. 2 GG; es solle das Aufkommen totalitärer Gruppen verhindert werden, die sich auf die Grundrechte beriefen, um sie um so leichter vernichten zu können. Deshalb hätten die Beschwerdeführer ihr Recht verwirkt, sich in diesem Verfahren auf die Grundrechte der Konvention zu berufen. Ob der EGMR diese Position heute noch bestätigen würde, ist zweifelhaft, weil die Große Kammer in den vorzitierten Entscheidung en nicht mehr auf Art. 17 EMRK zurückgekommen ist. Dass Parteiverbote aber dem Grunde mach mit dem EMRK vereinbar sind, bestätigt der Gerichtshof gleichwohl. In der Entscheidung zur Kommunistischen Partei der Türkei vom 30. Juli 1998 heißt es dazu: "Consequentley, the exceptions set out in Article 11 are, where political parties are concerned, to be construed strictly; only convincing and copelling reasons can justify restrictions on suchs parties' freedom of association." 'Convincing' und 'compelling' müssen auch nach nationalem Recht die Gründe für eine Entscheidung nach Art. 21 Abs. 2 GG sein (s. sogleich die Ausführungen unter B I). Das Gericht behält sich in diesem Zusammenhang nur die Prüfung vor: "It (gemeint ist: der EGMR) must look at the interference complained of in the light of the cases as a whole and determine whether it was 'proportionate for the legitimate aim pursued' and whether the reasons adduced by the national authorities to justify it are 'relevant and sufficient'. In so doing, the Court has to satisfy itself that the national authorities applied standards which were in conformity with the principles embodied in Article 11 and, moreover, that they based their decisions on an acceptable assessment of the relevant facts." (a.a.O., § 47) Damit ist klargestellt, dass der Mechanismus eines Parteiverbots der EMKR nicht a limine widerspricht. Die von der EGMR geforderten Maßstäbe sind mit denen kompatibel, die auch nach nationalem Recht zu fordern sind. Der Gerichtshof behält sich allerdings die Prüfungskompetenz vor sowohl das nationale Recht wie seine Anwendung "including the hose given by independent courts" (a.a.0. § 46) nachzuprüfen. Das aber ist selbstverständlich. B . Begründetheit des Antrags I. Grundlagen verfassungsmäßiger Anwendung des Verbotsmaßstabs 1. Vorbemerkungen Bevor nachgewiesen wird, dass die Tatbestandsmerkmale der Verbotsnorm des Art. 21 Abs. 2 GG vorliegen, – unten B II und III will der Antragsteller darlegen, dass auch gegenwärtig unter den Bedingungen einer im allgemeinen Bewusstsein festverankerten Verfassungsstaatlichkeit das staatsrechtliche Konzept einer streitbaren bzw. wehrhaften Demokratie, soweit das Parteiverbot betroffen ist, nicht an rechtlicher Bedeutung eingebüßt hat, dass seine Anwendung nicht etwa an zeitbedingte Voraussetzungen geknüpft ist, die nicht mehr vorliegen – will der Antragsteller darlegen, dass auch gegenwärtig unter den Bedingungen einer im allgemeinen Bewusstsein festverankerten Verfassungsstaatlichkeit das staatsrechtliche Konzept einer streitbaren bzw. wehrhaften Demokratie, soweit das Parteiverbot betroffen ist, nicht an rechtlicher Bedeutung eingebüßt hat, dass seine Anwendung nicht etwa an zeitbedingte Voraussetzungen geknüpft ist, die gegenwärtig – etwa wegen der gewachsenen Verankerung des Verfassungsstaates im allgemeinen Bewusstsein – nicht mehr vorliegen. Verfassungsrechtlich undenkbar wäre es immerhin nicht, dass eine Norm - auch eine Verfassungsrechtsnorm - [...] ausführt, dass ein Wandel der Verhältnisse und Anschauungen zur Verfassungswidrigkeit einer ursprünglich verfassungsmäßigen Regelung führen kann, "wenn sich maßgebende Umstände so tiefgreifend und nachhaltig geändert haben, dass die gesetzliche Regelung die ihr zu Grunde liegende Wertung sich als offensichtlich fehlsam und den gegenwärtigen tatsächlichen Verhältnissen nicht mehr rechtwerdend" erweisen. [...] Der Gedanke, Art. 21 Abs. 2 GG könne an einer aktuellen Geltungsschwäche leiden, ist im Schrifttum in der Tat schon erwogen worden. So berichtet Hans Meyer, dass Ernst Friesenhahn auf einem ihm zu Ehren veranstalteten Symposium "Bewährung und Bewahrung der Verfassung" 1983, bezweifelt hat, dass das Parteiverbot nach so langer Zeit noch je einmal effektuiert werden könne. [...] Auch Ernst Benda wendet sich zwar gegen den Gedanken der Obsolenz der Vorschrift, deutet aber auch an, dass der Einwand denkbar wäre, das Konzept der "streitbaren Demokratie sei in einer bestimmten historischen Situation entstanden, und in diesen 40 Jahren (1991) habe sich die Situation in vielfältiger Beziehung geändert. Die Schlussfolgerung, dass damit der Normbestand gefährdet sei, will Benda aber nicht ziehen, weil unter veränderten Umständen oder einer veränderten Beurteilung es möglich wäre, das Instrument wieder einzusetzen. [...] Auch Christian Pestalozza merkt an, Art. 21 Abs. 2 GG sowie Art. 18 GG und Art. 9 Abs. 2 GG "sind Ausdruck der angesichts unserer Vergangenheit verständlichen Skepsis des Parlamentarischen Rates, ob sich demokratische Vernunft allein mit Hilfe der allgemeinen Rechtsordnung, insbesondere des allgemeinen Strafrechts und der Politik würde behauptet können. Heute, 40 Jahre danach, sollten wir auf diese Vorschriften verzichten können." [...] K. Groh nimmt ausweislich des Titels ihres Beitrages ZRP 2000, S. 500 ff.,Der NPD-Verbotsantrag - eine Reanimation der streitbaren Demokratie' offenbar an, dass die streitbare Demokratie schon auf dem Sterbelager gelegen hatte. Diese Außerungen belegen, dass es tunlich ist, die Anwendungsvoraussetzungen von Art. 21 Abs. 2 GG erneut zu reflektieren. Wenn auch eine Obsolenz der Vorschrift ernstlich nicht in Betracht kommt, [...] so bietet die Vergewisserung über den Normzweck unter den Bedingung konsolidierter Verfassungsstaatlichkeit doch die Gelegenheit, die Anwendungsvoraussetzungen der Norm zu präzisieren. 2. Zur Rechtsgrundlage des Parteiverbots in Art. 21 Abs.2 GG Die ohnehin mehr gegen die Legitimität, denn gegen die verfassungsrechtliche Legalität erhobenen prinzipiellen Einwände gegen das Parteiverbot als Ausprägung der "streitbaren Demokratie" greifen nicht durch. Art. 21 Abs. 2 GG konstituiert auch gegenwärtig eine immanente Beschränkung des demokratischen Prinzips. a) Vereinbarkeit von Art. 21 Abs. 2 GG mit dem Demokratieprinzip und den politischen Freiheitsrechten Als verfassungsunmittelbare Schranke der Freiheit der Parteien sieht Art. 21 Abs. 2 GG die Möglichkeit vor, "Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden," für verfassungswidrig zu erklären (sog. "Parteiverbot"). Dieser Normbefehl steht nicht in Widerspruch zu höherem oder gleichrangigem Recht. Insbesondere handelt es sich beim Parteiverbot nicht wegen Verstoßes gegen das grundrechtliche Demokratieprinzip oder die Meinungsfreiheit um verfassungswidriges Verfassungsrecht. Dabei kann hier dahinstehen, ob die Rechtsfigur verfassungswidrigen Verfassungsrechts für Normen der ursprünglichen Fassung des Grundgesetzes überhaupt in Betracht kommen kann oder ob nur verfassungsändernde Gesetze wegen der für den Verfassungsänderungsgesetzgeber zur beachtenden Normen unterschiedlicher Geltungsstärke in der Verfassung (Art. 79 Abs. 3 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 und Art. 20 GG) verfassungswidrig sein könne. Zu dieser Differenzierung zwischen ursprünglichem und änderndem Verfassungsrecht [...] hat das Bundes- verfassungsgericht bereits im dritten Band (S. 231 f.) im Zusammenhang mit dem damals hoch umstrittenen Art. 117 Abs. 1, Hs. 2 GG festgestellt: "Das Grundgesetz kann nur als Einheit begriffen werden. Daraus folgt, dass auf der Ebene der Verfassung selbst ranghöhere und rangniedrigere Normen in dem Sinne, dass sie aneinander gemessen werden könnten, grundsätzlich nicht denkbar sind. ... Es liegt im Wesen des pouvoir constituant, dass er von seinen eigenen Grundsatznormen Ausnahmen statuieren kann, die nach der Regel vom Vorrang der speziellen gegenüber der allgemeinen Norm zu beachten sind." Das Gericht will nur gegebenenfalls Verstöße gegen überpositives Recht für theoretisch denkbar halten, fügt dem aber gleich an: "Die Wahrscheinlichkeit, dass ein freiheitlich-demokratischer Verfassungsgeber diese Grenzen irgendwo überschritte, ist freilich so gering, dass die theoretische Möglichkeit originärer verfassungswidriger Verfassungsnormen' einer praktischen Unmöglichkeit nahezu gleichkommt." Die verfassungsändernde Gewalt ist hingegen eine limitierte Gewalt, so dass sie richterlich überprüft wird. [...] aa) Das Bundesverfassungsgericht ist stets von der Gültigkeit der Verbotsnorm ausgegangen. [...] Auch die verfassungsrechtliche Literatur geht einhellig von der Parteiverbotsnorm als geltendem Verfassungsrecht aus. [...] Im übrigen wird zwar die Frage eines möglichen Widerspruchs zwischen der Gewährung von Freiheit und ihrer gleichzeitigen Begrenzung erörtert, die Gültigkeit von Art. 21 Abs. 2 GG aber nicht erwähnt, sondern vorausgesetzt. [...] Selbst die schärfsten Kritiker (dazu sogleich bb) - etwa Helmut Ridder oder Ekkehard Stein - bezweifeln die Verfassungmäßigkeit der Parteiverbotsnorm nicht. bb) Auch die Einwände, die gegen die Konzeption der "streitbaren" bzw. "wehrhaften" Demokratie gerichtet sind, in die das Institut des Parteiverbots gem. Art. 21 Abs. 2 GG eingebettet ist, führen zu keiner anderen Beurteilung. [...] Was die Begrifflichkeit der streitbaren Demokratie betrifft, sind zwei denkbare Sichtweisen zu unterscheiden. Zum einem kann man darunter eine Abbreviatur, einen Sammelbegriff für die Einzelnormen verstehen, mit denen das Grundgesetz sich wehrhaft macht gegen bestimmte Erscheinungsformen der Verfassungszerstörung. Diese Sicht ist sozusagen verfassungsrechtsdidaktisch und deshalb unproblematisch. [...] Umstritten ist demgegenüber, ob und inwieweit die "wehrhafte" oder "streitbare" Demokratie den darüber hinausweisenden Gehalt eines Prinzips hat mit der Folgefrage, ob das Ganze (das Prinzip) in der Rechtsanwendung mehr ist als seine Bausteine.In der Judikatur des BVerfG zeigt sich ein Wandel von einem engen zu einem weiteren Verständnis [...] Auch soweit die Annahme einer Entscheidung für die "streitbare Demokratie" für grundsätzlich verfehlt gehalten wird, weil das Grundgesetz eine Entscheidung für die Demokratie und nicht für deren Streitbarkeit getroffen habe, [...] folgt nach dieser Auffassung daraus lediglich, dass Art. 21 Abs. 2 GG als Durchbrechung der Demokratie eine begründungsbedürftige Ausnahme darstellt und das Parteiverbot mit besonderer Sorgfalt anzuwenden ist. [...] cc) Dass die grundgesetzliche Demokratie nach Maßgabe von Art. 21 Abs. 2 GG parteimäßig organisierten "Verfassungsstörungen" entgegentreten darf, findet heute nicht mehr nur als notwendige Reaktion auf die relativistische und wertneutrale Weimarer Verfassung in Lehre und Rechtsprechung verfassungsrechtliche Anerkennung. [...] Dabei kommt es nicht darauf an, ob die historisch-empirische Sicht des Parlamentarischen Rats aus heutiger historiographischer Perspektive eher skeptisch zu beurteilen ist, [...] da sich die durch Art. 21 Abs. 2 GG konkretisierte Streitbarkeit unabhängig davon sehr wohl als immanente Beschränkung des grundgesetzlichen Demokratieprinzips begründen und sich die These widerlegen lässt, jede Verteidigung der Demokratie verwickele diese zwangsläufig in einen Selbstwiderspruch. [...] Ausgangspunkt ist auf der einen Seite die Besonderheit der Demokratie als einziger Staatsform bzw. Form der Organisation politischer Willens- und Entscheidungs- bildungsprozesse, die sich dauernd zur Diskussion und zur Kritik stellt, und deren Freiheitlichkeit sich im Schutz der gleichen Freiheit Aller, vornehmlich in der Verteidigung der schwächsten Gruppen der Gesellschaft erweist. [...] Dieser Ausgangspunkt lässt sich bereits in den Leitentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nachweisen. [...] Danach gehört die Verfügbarkeit der jeweils institutionalisierten politischen und rechtlichen Ordnung grundsätzlich zur demokratischen Freiheit. [...] Folglich sind Eingriffe in den Prozess demokratischer Meinungs- und Willensbildung - und ein solcher Eingriff ist auch das Parteiverbot in der Tat prekär und in besonderem Maße rechtfertigungsbedürftig. Ein Widerspruch zum Demokratieprinzip und zu den fur eine Demokratie konstitutiven Freiheiten könnte ein Parteiverbot jedoch nur unter der zusätzlichen Prämisse sein, dass die unbegrenzte demokratische Selbstthematisierung und Deliberation auch die Freiheit einschlösse, nicht nur Kritik an der Demokratie, an demokratischen Institutionen und an den von demokratischen Mehrheiten oder Regierungen verfolgten Programmatiken äußern zu dürfen, wie radikal diese Kritik auch immer sein möge, sondern darüber hinaus gestatten müsse, die Abschaffung der Demokratie zum Programm zu erheben und dieses Programm auch zu realisieren. Diese Prämisse lässt sich jedoch den an Art. 20 Abs. 1 und 2 GG orientierten Konzeptionen von Demokratie nicht entnehmen. Schon in der Entstehungsphase des Grundgesetzes ist die Frage aufgeworfen worden, ob einer demokratischen Verfassungsurkunde "eine Hemmung gegen das Recht auf Selbstmord" eingefügt werden sollte. [...] Die Vorschriften über die streitbare Demokratie werden denn auch als Absage an die These verstanden, die Demokratie müsse wegen ihrer freiheitlichen Ordnung auch ihre Abschaffung durch Gegner dieser Staatsform hinnehmen, wenn es dafür legale Mehrheiten gebe. [...] Auch hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung immer angenommen, dass bestimmte Staatsfundamentalnormen auch der Verfügbarkeit im politischen Meinungskampf entzogen sind, [...] um "die Legalisierung eines totalitären Regimes" zu verhindern. Die zum Demokratieprinzip des Grundgesetzes entwickelten Konzeptionen konzentrieren sich auf "Art und Verfahren der Konstituierung des demokratischen Gemeinwillens". Sie stimmen überein im Entwurf eines komplexen Systems von Freiheiten und Bindungen, von Kompetenzen und Kontrollen, - das sich aus dem Zusammenspiel von Volkssouveränität und Menschenrechten ergibt, - das besonders deutlich im Vorrang der Verfassung und in dem von Art. 79 Abs. 3 GG umrissenen änderungsfesten Kern zutage tritt [...] und - das nur den Schluss zulässt, dass das menschen- und freiheitsrechtliche, demokratische Fundament des Ganzen unverfügbar ist, d. h. weder zur Disposition des einfachen Gesetzgebers noch des verfassungsändernden Gesetzgebers noch des Souveräns oder gar einzelner parteimäßig organisierter Teile desselben stehen soll. [...] Nahezu einhellig begründen Lehre und Rechtsprechung also weder die notwendige Verteidigungsunfähigkeit von Demokratie, noch zielen sie darauf ab, eine bestimmte Form der Institutionalisierung einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder gar bestimmte Inhalte als Ergebnis demokratischer Herrschaftsausübung zu sichern. Im Zentrum der Überlegungen steht vielmehr die Offenheit des politischen Prozesses und dessen experimenteller Charakter, die beide gerade "die Möglichkeit [implizieren], solche Inhalte neu zu beschließen oder an bestehenden festzuhalten." [...] Dem gemäß gehören zu den Bedingungen demokratischer Willensbildung die "dauernde Offenheit des politischen Prozesses" und die Möglichkeit der Selbstkorrektur. D. h. es müssen "inhaltliche Entscheidungen, mögen sie so oder anders getroffen sein, revidierbar" sein. Die inhaltlichen Entscheidungen "können in Frage gestellt und neu bedacht, abgeändert oder bestätigt werden. Nicht schon, wenn inhaltlich ungerechte Entscheidungen ergehen, wohl aber, wenn dieses Fundament in Frage gestellt oder ausgehöhlt wird, hebt Demokratie sich auf." [...] Das grundgesetzliche Demokratieprinzip gebietet also, nicht nur einer Bürgerschaft zu jeder Zeit ein Recht auf politische Selbstbestimmung und Selbstkorrektur einzuräumen, sondern impliziert zugleich die Verpflichtung, die Integrität des demokratischen Prinzips zum Schutz der Rechte überstimmter Minderheiten zu wahren. [...] Das Verfassungsprinzip der Demokratie darf nicht zur Disposition, einer Majorität oder einer Minorität gestellt werden. Sonst würde man dem von der Aufhebung dieses Prinzips unmittelbar Betroffenen und einer späteren Generation die Möglichkeit zur demokratischen Selbstkorrektur vorenthalten und damit gegen das Demokratieprinzip verstoßen. Folglich erweist sich die Verteidigung des grundgesetzlichen Demokratleprinzips nicht als dessen äußere Schranke oder als Antinomie, sondern als immanente Beschränkung. Selbst unter Berücksichtigung der Schwere eines solchen Eingriffs aktualisiert das Verbot einer Partei, welche meint, zur Durchsetzung ihrer mit absolutem Geltungsanspruch ausgestatteten Ideologie die für alle geltenden demokratischen Prinzipien, Verfahren und Institutionen missachten und insbesondere die politischen Gegner zu Feinden erklären, mit Gewalt bedrohen und sie nach der Machterlangung vom politischen Prozess ausschließen zu dürfen, eine Selbstbeschränkung des demokratischen Prinzips. Den internen Zusammenhang zwischen dem demokratischen Prinzip und seiner immanenten Beschränkung hat D. Grimm zusammenfassend formuliert: "In der Tat liegt im Verbot einer politischen Partei ein außerordentlich schwerer staatlicher Eingriff in die Offenheit und Unabschließbarkeit des politischen Prozesses. Er lässt sich nur im Interesse eben dieser Offenheit und Unabschließbarkeit rechtfertigen. Gehören sie zu den Konstitutionsbedingungen der grundgesetzlichen Demokratie, dann dürfen sie ihrerseits nicht zur demokratischen Disposition stehen." [...] Aufgrund seiner gründlichen Untersuchung des amerikanischen Verfassungsrechts kommt H. Steinberger ebenfalls zu diesem Schluss. Die Freiheit der geistigen und politischen Auseinandersetzung ist dem Wandel gegenüber offen und erstreckt sich gerade auch auf das disagreement on fundamentals", ein Verhalten jedoch, welches diese Offenheit zu beseitigen trachtet, verliert seine Legitimation aus der Idee der Freiheit. "Selbstzerstörung ist nicht der Sinn der Freiheit und gewiß auch kein Auslegungsprinzip freiheitlichen Verfassungsrechts." [...] b) Art. 21 Abs. 2 GG aus demokratietheoretischer Sicht Nicht unmittelbar verfassungsrechtliche und an der Konzeption des Grundgesetzes orientierte, sondern philosophische oder politologische Demokratietheorien, stützen die hier dargelegte Auffassung. Auch soweit sie den demokratischen Prozess in der politischen Autonomie der Bürger gründen, dem Schutz überstimmter Minderheiten gegenüber der Mehrheit einen prinzipiellen Vorrang einräumen, die Legitimität des unabschließbaren Diskurses über die Legitimität betonen oder Demokratie als nicht-staatliche und daher von staatlichen Interventionen grundsätzlich frei zu haltende Veranstaltung konzipieren, liefern sie die Demokratie nicht Bestrebungen aus, die auf die Abschaffung der Demokratie hinausliefen. Solche theoretischen Ansätze teilen insofern ein anspruchsvolles - und auch grundgesetznahes - Konzept von Demokratie, als letztere allen Teilnehmern demokratischer Prozesse ein Element der Anerkennung abverlangt, nämlich die wechselseitige Anerkennung ihrer individuellen Autonomie, des weltanschaulichen Pluralismus und vor allem der gleichen Freiheit aller Bürgerinnen und Bürger. [...] Diese Anerkennung hat Folgen für die Austragung politischer Kontroversen. Sie impliziert nämlich ein Minimum demokratischer Selbstdisziplinierung: die Wahrung der unverzichtbaren "fairen Bedingungen politischer Kooperation auf der Grundlage gegenseitiger Achtung" (John Rawls, Gerechtigkeit als Fairneß: politisch und nicht metaphysisch). Diesen Achtungsanspruch, den freie und gleiche Bürger vernünftigerweise erheben dürfen und den Demokratie als faires Kooperationssystem zur Geltung bringt, verletzt, wer sich mit der Anwendung von Gewalt ein Sonderrecht gegenüber seinen Mitbürgern und mit Feinderklärungen ein politisches Ausbürgerungsrecht zu Lasten der Gegner anmaßt, wer also die Ebene gleicher Freiheit verlässt, den Modus demokratischer Deliberation und der Ausübung kommunikativ erzeugter Macht durchbricht. [...] Eine solche Anmaßung und Missachtung hat in der Demokratie keinen demokratietheoretisch ausweisbaren Platz und kann nicht unter Berufung auf eben das demokratische Prinzip legitimiert werden. Viel weniger noch muss sie im Namen der Demokratie oder der demokratischen Freiheiten toleriert werden. Das Verbot verfassungsfeindlicher Parteien schützt also die vom Demokratieprinzip gewollte, Herrschaftsausübung des Volkes nach Maßgabe der Verfassung. Die dahinter stehende Grundidee ist ersichtlich zeitlos und nicht von konkreten Bedrohungsszenarien abhängig. Deshalb betont Wilhelm Henke ganz zu recht, dass das Parteienverbot zu jenen Sicherheitsvorkehrungen gehört, "die auch durch langen Nichtgebrauch keineswegs überflüssig werden." [...] 3. Anwendungsbedingungen von Art. 21 Abs. 2 GG Auch die Einwände, die sich nicht gegen die grundsätzliche Legitimation von Parteiverboten, sondern ihre missbräuchliche Anwendung richten, greifen nicht durch. Mit der verfassungsrechtlichen (wie auch demokratietheoretischen) Legitimierung von Parteiverboten als dem Grunde nach zulässiger Konkretisierung einer dem demokratischen Prinzip als eines Systems fairer Kooperation immanenten Beschränkung verlagern sich etwaige Bedenken und Einwände gegen Art. 21 Abs. 2 GG allenfalls auf die Ebene der tatbestandlichen Voraussetzungen und Anwendung im Einzelfall- Es geht also verfassungsrechtlich (und demokratietheoretisch) nicht mehr um die Frage, ob eine Demokratie und ihr grundrechtliches Fundament verteidigt werden dürfen, sondern darum zu bestimmen, jenseits welcher Grenze und auf welche Weise demokratische Selbstverteidigung in rechtsstaatlichen Formen durchgeführt werden kann. [...] Generell wird diese Norm, weil bereits das Ziel der Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausreichen soll, als "Bestrebungstatbestand mit ausgeprägtem Präventivcharakter" bezeichnet. [...] Die dem zulässigen demokratischen "Selbstschutz" immanenten Risiken in Hinsicht auf eine offene demokratische Meinungs und Willensbildung und speziell durch Parteiverbote - für ein pluralistisches, "nicht-lizenziertes" Parteiensystem lassen sich nicht unter Hinweis auf den notwendigen Präventivcharakter überspielen. Vielmehr sind Sicherungen geboten, welche die Risiken eines Missbrauchs minimieren und insbesondere verhindern, dass unter Rückgriff auf Art. 21 Abs. 2 GG lediglich unliebsame politische Gegner nach Belieben ausgeschaltet werden. a) Der Missbrauchsgefahr wirken zunächst die vorgesehenen rechtsstaatlichen Sicherungen entgegen - die Monopolisierung der Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit von Parteien beim Bundesverfassungsgericht und verlässliche verfahrensrechtliche Regelungen (§§ 43 ff. BVerfGG). Diese gewährleisten, dass einer von einem Verbotsantrag betroffenen Partei die Möglichkeit offen steht, ihre Verfassungsmäßigkeit darzulegen. [...] b) Hinsichtlich der Auslegung von Art. 21 Abs. 2 GG errichtet die in diese Norm eingelassene, doppelte Schutzwirkung eine weitere Missbrauchssperre: Geschützt wird nicht nur vor verfassungswidrigen Parteien, sondern geschützt werden auch die Parteien vor einem verfassungswidrigen Verbot. [...] Diese doppelte Schutzwirkung bringt sowohl die Offenheit und Integrität des demokratischen Prozesses wie auch die Bedeutung der Parteien, die verfassungsrechtlich verbürgte Parteienfreiheit (Art. 21 Abs. 1 GG) sowie die diese stützenden Konnexgarantien politischer Kommunikation zur Geltung. c) Bei der Auslegung und Anwendung von Art. 21 Abs. 2 GG ist ferner zu berücksichtigen, dass die Abwehr politischer Gefahren bzw. von "Verfassungsstörungen" nicht nur in den Wettbewerb der Parteien eingreift. Betroffen ist zugleich die Freiheit der politischen Kommunikation der in der Partei organisierten Mitglieder. Zwar sind ihnen nicht Meinungsäußerungen schlechthin untersagt, wohl aber das Werben für die für verfassungswidrig erklärte Parteiprogrammatik. Gemäß der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts genießt insbesondere die Meinungsfreiheit als eine für Demokratie konstitutive Freiheit den besonderen Schutz der Verfassung. Aus dieser Bedeutung lässt sich auch im Kontext von Parteiverbotsverfahren die Regel ableiten, dass hinsichtlich bloßer Äußerungen, die einen Bezug zur öffentlichen Meinungsbildung haben, eine "Vermutung zugunsten der Freiheit der Rede" gilt. [...] Diese Vermutung wird seit dem Lüth-Urteil von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bekräftigt. [...] d) Den Gefahren einer missbräuchlichen Anwendung von Art. 21 Abs. 2 GG begegnet, wie im Folgenden unter B II 3 ausgeführt wird, vor allem eine restriktive Interpretation der tatbestandlichen Voraussetzungen. So hat das Bundesverfassungsgericht betont, es genüge nicht, wenn eine Partei einzelne Bestimmungen oder sogar ganze Institutionen des Grundgesetzes ablehnt, vielmehr muss sie "die obersten Werte der Verfassungsordnung, die elementaren Verfassungsgrundsätze, die die Verfassungsordnung zu einer freiheitlichen demokratischen machen", verwerfen (BVerfGE 5, 85). [...] 4. Tatbestandsvoraussetzungen Die befürchtete missbräuchliche Anwendung von Art. 21 Abs. 2 GG lässt sich durch eine am demokratischen Prinzip, an der doppelten Schutzwirkung und am Ausnahmecharakter dieser Norm orientierten restriktiven Auslegung der Tatbestandsvoraussetzungen ausräumen. a) Schutzgüter Ein begründeter Antrag auf Erklärung der Verfassungswidrigkeit einer Partei setzt voraus, dass eines der in Art. 21 Abs. 2 S. 1 GG aufgeführten Schutzgüter -die freiheitliche demokratische Grundordnung oder der Bestand der Bundesrepublik Deutschland - nach Maßgabe der dort geregelten Intensitätsstufen durch Beseitigung oder Beeinträchtigung bzw. Gefährdung betroffen ist. Eine Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland ist durch die Existenz, Programmatik und Aktivitäten der NPD und ihres Umfeldes derzeit nicht zu besorgen. Daher erübrigen sich Ausführungen zu diesem Schutzgut in diesem Verfahren. Nach ihren Zielen und nach dem Verhalten ihrer Anhänger geht diese Partei je'doch darauf aus, wie unter II und III ausgeführt, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen und zu beeinträchtigen. aa) Das Bundesverfassungsgericht hat die freiheitliche demokratische Grundordnung als eine Ordnung bestimmt, "die unter Ausschluß jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen: die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition." (BVerfGE 2, 1). [...] Vom Bundesverfassungsgericht ist diese Formel in späteren Entscheidungen bestätigt worden. Dabei sind - je nach Entscheidungskontext Schwerpunkte gesetzt worden; das Bundesverfassungsgericht wendet die Formel durchaus nicht schematisch an. [...] Hervorzuheben ist, dass die Achtung der Menschenrechte an der Spitze der Aufzählung steht. bb) Gemeinsamer Bezugspunkt der verschiedenen Aussagen des Bundesverfassungsgerichts ist die Sicherung der Offenheit und Freiheitlichkeit des demokratischen Willensbildungsprozesses. Eine besondere Akzentsetzung erfährt die pluralistische Freiheit und demokratische Chancengleichheit, womit Struktur und Form des politischen Prozesses geschützt werden, nicht aber bestimmte Inhalte der Politik. [...] Die an der Demokratiekonzeption des Grundgesetzes und an den oben erörterten Leitlinien ausgerichtete Konkretisierung der freiheitlich demokratischen Grundordnung rückt damit neben den Menschenrechten den funktionellen Gesichtspunkt der Integrität der grundlegenden demokratischen Verfahrens- und Organisationsprinzipien in den Vordergrund und ist wohl eher enger zu fassen als Art. 79 Abs. 3 GG. [...] Die grundsätzliche Offenheit des politischen Prozesses des Grundgesetzes auch für Fundamentalkritik gebietet die Unterscheidung zwischen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung als solcher und der konkreten Ordnung, die mit dem Grundgesetz errichtet wurde. [...] Bereits in der SRP-Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht darauf hingewiesen, dass die freiheitliche demokratische Grundordnung nicht "mit den Formen, in denen sie im Staat Gestalt annehmen kann," verwechselt werden darf. (BVerfGE 2, 1) Dem gemäß werden nur die schlechthin konstitutiven Grundlagen einer freiheitlichen Demokratie und nur die Verfassungsbestimmungen, die eben diese verbürgen, vom Demokratieprinzip selbst vor ihrer Abschaffung geschützt. Alle anderen Institutionen, Verfahren und Regelungen hingegen werden gegen Kritik, ja auch die Forderung nach ihrer Abschaffung nicht in Schutz genommen. Diese restriktive Interpretation der "Makrostruktur" des Schutzgutes "freiheitliche demokratische Grundordnung" aktualisiert damit die immanente Beschränkung des demokratischen Prinzips. [...] b) Intensität der Störung des Schutzgutes Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei setzt eine Störung des Schutzgutes voraus. Hinsichtlich der Intensität einer solchen Störung lässt Art. 21 Abs. 2 GG die beiden Alternativen "beeinträchtigen" und "beseitigen" zu. Es besteht Einigkeit darüber, dass der Begriff des "Beeinträchtigens" weiter ist als der Begriff des "Beseitigens" [...] und deshalb der Präzisierung bedarf. Zur Verhinderung einer missbräuchlichen Ausdehnung des Geltungsbefehls von Art. 21 Abs. 2 GG und einer übermäßigen Anwendung des Instruments des Parteiverbots erscheint allerdings eine Differenzierung zwischen "Beseitigung" und "Beeinträchtigung", zumal im Kontext einer konsolidierten Demokratie, auch deshalb geboten, weil zu diesen Tatbestandsvoraussetzungen nicht auf eine einmütige Auffassung zurückgegriffen werden kann. An "Beeinträchtigungen" sind erhöhte Anforderungen zu stellen. [...] Die Worte "zu beeinträchtigen" waren nämlich durch den Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates zunächst gestrichen worden. Diese Streichung ist aber dann in den weiteren Textberatungen nicht berücksichtigt worden. [...] Ob man deshalb von einem "Redaktionsversehen" sprechen kann, [...] ist indes nicht so sicher. Der Text der Parteiverbotsnorm ist nämlich auch nach dieser für das weitere Verfahren unbeachtet gebliebenen Streichung noch Gegenstand reflektierter Normveränderungen gewesen. In den weiteren Beratungen ist die mangelnde Präzision des Rechtsbegriffs "Beeinträchtigung" (das war der Grund für die Streichung im Hauptausschuss) nicht mehr geltend gemacht worden. Es handelt sich jedenfalls um eine markante Irregularität in der Normentstehung. Das Erfordernis einer engen Auslegung des Ausnahmetatbestands Art. 21 Abs. 2 GG wird von einigen Autoren in die Forderung übersetzt, dass die Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung wesentlich sein müsse. [...] Diese Auffassung vermag nicht zu überzeugen, da das Schutzgut freiheitliche demokratische Grundordnung ohnehin nur wesentliche Elemente umfasst. Näher liegt, die Beeinträchtigung als auf eine teilweise Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zielend zu verstehen. [...] Diese Auslegung wahrt die aus dem Blickwinkel des Rechtsstaatsprinzips gebotene Symmetrie zwischen "Beseitigung" und "Beeinträchtigung" und orientiert die "Wesentlichkeit" nicht tautologisch am Schutzgut, sondern systematisch richtig an der Intensitätsstufen der Verfassungsstörung: Beeinträchtigung als erste Stufe, Beseitigung als zweite Stufe, wobei beides prozesshaft gekoppelt ist. Zugleich bringt sie den präventiven Schutz des demokratischen Prinzips dadurch zur Geltung, dass sie einer Partei den Weg verlegt, sich durch das (Lippen-)Bekenntnis zu einem Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Gefahr eines Verbots zu entziehen. [...] c) Modalität der Störung: "Darauf ausgehen" als planvolles Handeln Die betroffene Partei muss nach dem Wortlaut von Art. 21 Abs. 2 GG "darauf ausgehen", das Schutzgut der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Damit ist ein weiteres ausdrücklich in der Norm enthaltenes Tatbestandsmerkmal genannt. Der Begriff des "Darauf-ausgehens" präzisiert die Modalität der "Verfassungsstörung" durch Einführung einer zeitlichen und teleologischen Dimension und stellt damit entscheidende Weichen für die Erfassung der Struktur des Tatbestandes im Ganzen. [...] Nach dem Wortlaut könnte ein "Daraufausgehen" bereits in der Kundgabe einer Absicht liegen. Die Verwendung des Wortes "gehen" in Art. 21 Abs. 2 S. 1 GG spricht jedoch dafür, dass sich die Partei bereits in die Richtung auf ein von ihr verfolgtes Ziel hinbewegt haben muss. [...] Das Bundesverfassungsgericht hat im KPD-Urteil diese Auslegung präzisiert "Eine Partei ist auch nicht schon dann verfassungswidrig, wenn sie diese obersten Prinzipien einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht anerkennt, sie ablehnt, ihnen andere entgegensetzt. Es muss vielmehr eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung hinzukommen; sie muss planvoll das Funktionieren dieser Ordnung selbst beseitigen wollen. Das bedeutet, dass der freiheitlich-demokratische Staat gegen Parteien mit einer ihm feindlichen Zielrichtung nicht von sich aus vorgeht; er verhält sich vielmehr defensiv, er wehrt lediglich Angriffe auf seine Grundordnung ab." (BVerfGE 5, 85) [...] Das Erfordernis einer kämpferischaggressiven Haltung, zu der als aktives Moment ein planvolles Vorgehen hinzutritt, betont den Defensivcharakter von Art. 21 Abs. 2 GG und stellt zugleich sicher, dass die geäußerte Gesinnung und bloße Kritik, auch Fundamentalkritik an einer freiheitlichen demokratischen Ordnung für sich genommen ein Parteiverbot nicht auslösen. Daraus folgt, dass für das "Darauf-ausgehen" die bloße Kundgabe verfassungswidriger Absichten nicht genügt. [...] Teilweise wird für die Feststellung, ob ein entsprechendes Tätigwerden vorliegt, die strafrechtliche Versuchsdogmatik herangezogen. [...] Einigkeit herrscht jedoch darüber, dass dieses Tätigwerden unterhalb der Schwelle eines hochverräterischen Unternehmens i.S.v. § 81 StGB liegt, [...] dass Art. 21 Abs. 2 S. 1 GG nicht erst den gewaltsamen Umsturz und seine Vorbereitung erfasst. Ein "Darauf-ausgehen" kennzeichnet vielmehr ein zielstrebiges Handeln, welches möglicherweise gewalttätig sein kann, es aber nicht notwendigerweise sein muss. Für diese Auslegung spricht nicht nur der Wortlaut, sondern auch die Systematik. In der ursprünglichen Textfassung des Grundgesetzes gab es mit dem 1951 aufgehobenen Strafrechtsänderungsgesetz vom 30. 8. 1951, BGBl. I, S. 739, Art. 143 GG eine Vorschrift, die den gewaltsamen Umsturz unter Strafe stellte, während in Art. 21 Abs. 2 GG gerade auf den Begriff der Gewalt verzichtet wurde. [...] Auch ein Vergleich mit Art. 18 GG zeigt, dass Art. 21 Abs. 2 S. 1 GG keine Gewalt voraussetzt. Während die Formulierung in Art. 18 GG - "zum Kampfe" - noch eine deutliche militante Tendenz aufweist, ist diese beim bloßen "Darauf-ausgehen" nicht feststellbar. Die Anwendung von Gewalt ist demnach nicht Teil der Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 21 Abs. 2 GG. [...] Das Bundesverfassungsgericht hat sich in der KPD-Entscheidung, die von ihren Kritikern, für die Ansicht zitiert wird, es genüge die Kundgabe der Absicht, [...] missverständlich geäußert. Einerseits hat es das Argument der Antragsgegnerin zurückgewiesen, das Tatbestandsmerkmal "darauf ausgehen" erfordere mehr als nur eine Absicht, nämlich ein Tätigwerden, weil ein solches Erfordernis praktisch bedeuten würde, die Erfüllung des Tatbestandes von § 81 StGB zu verlangen. (BVerfGE 5, 85) Andererseits hat das Gericht in den folgenden Überlegungen festgestellt, diese Absicht müsse "so weit in Handlungen (das sind u.U. auch programmatische Reden verantwortlicher Persönlichkeiten) zum Ausdruck kommen, dass sie als planvoll verfolgtes politisches Vorgehen der Partei erkennbar wird." (BVerfGE 5, 85) Zwar lehnt das Gericht den Rekurs auf die strafrechtliche Versuchs- oder Vorbereitungsdogmatik ab, konkretisiert jedoch die tatbestandlich relevanten Verhaltensweisen als "planvoll verfolgtes politisches Vorgehen", das in Handlungen, wie z.B. in programmatischen Reden verantwortlicher Persönlichkeiten, zutage tritt. [...] Die Kritik, das BVerfG habe das "Darauf-ausgehen" als bloße Absicht interpretiert, trifft nicht zu. [...] Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das "Darauf-ausgehen" im Sinne einer am demokratischen Prinzip und den diesen korrespondierenden Freiheiten ausgerichteten Auslegung von Art. 21 Abs. 2 GG gewährleistet, dass nur solche gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Ideen tatbestandsmäßig sind, die erstens den "politischen Kurs der Partei" zum Ausdruck bringen, [...] und zweitens sich in planvollem Handeln manifestieren, mit dem die Partei ihre politischen Ziele in politische Praxis umsetzt. Als solche Handlungen kommen die Formen nicht zuletzt öffentlicher Auseinandersetzung, die Darstellung eigener Positionen sowie die Schulungen von Funktionären und Mitgliedern in Betracht. [...] Neben das subjektive Element der Zielsetzung (etwa im Parteiprogramm) tritt damit ein objektives Moment, das der Zielverfolgung. [...] d) Verantwortlichkeit der Partei und Kriterien der Zurechnung Art. 21 Abs. 2 GG setzt voraus, dass die Partei "nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger" darauf ausgeht, das Schutzgut der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu beeinträchtigen. Bereits der Wortlaut macht mit der zweifachen Verwendung von "nach" deutlich, dass es hier um die Kriterien der Zurechnung des verfassungsstörenden Verhaltens zu einer Partei geht. Die mit den beiden Tatbestandsmerkmalen "Ziele" und "Verhalten" vorgegebene Unterscheidung betrifft zwei unterschiedliche Ebenen, die Politikinhalte und die Politikform. [...] aa) Das Tatbestandsmerkmal "Ziele" wird teilweise für entbehrlich gehalten, weil bereits das "Darauf-ausgehen" notwendig die Prüfung der Ziele beinhalte. [...] Dies trifft nur dann zu, wenn die Ziele isoliert betrachtet werden. Der Wortlaut stellt jedoch eine eindeutige Verbindung her zwischen Parteien und ihren politischen Zielen und unterscheidet diese von der Absicht der Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Damit erhält das Merkmal "nach ihren Zielen" als Zurechnungskriterium eine eigenständige Begrenzungsfunktion. Während das "Darauf-ausgehen" planvolles Verhalten im oben definierten Sinne fordert, wird auf der Ebene der Zurechnung anhand des Kriteriums "Ziele" gefragt, ob diese Absicht den Zielen der Partei entspricht. Bei der Anwendung von Art. 21 Abs. 2 GG ist folglich zu prüfen, was als Ziel der Partei gelten kann. Diese Auslegung ermöglicht eine sinnvolle Unterscheidung zwischen beiden Tatbestandsmerkmalen. Solche Vorgehensweise entspricht der Auslegungsregel, wonach Normen so auszulegen sind, dass sie nichts Überflüssiges enthalten; resp. jedes normative Tatbestandsmerkmal möglichst eigenständige Bedeutung haben soll. Primäre Quelle für die Feststellung der Ziele einer Partei sind das Parteiprogramm und sonstige ersichtlich programmatische Äußerungen. Es ist eine authentische, von der Partei selbst zumeist lange vor einem Verbotsverfahren formulierte, schriftliche Grundlage. Daraus ist allerdings nicht zu folgern, dass das Parteiprogramm die einzige oder auch nur die entscheidende Erkenntnisquelle darstellt. Vor dem Hintergrund der Sanktionsmöglichkeit nach Art. 21 Abs. 2 GG ist der Stellenwert des Parteiprogramms zu relativieren. [...] Anderenfalls würde eine Partei bereits durch eine vieldeutige Formulierung ihres Programms ein Verbot aufgrund ihrer Zielsetzungen unterlaufen können. So war das Programm der SRP sehr allgemein und unverbindlich gehalten und hatte nur geringen Erkenntniswert für die Feststellung der Ziele der Partei [...]. Es wird zwar zu Recht darauf hingewiesen, dass legale politische Parteien keine Geheimbünde sind und deshalb die grundlegenden politischen Vorstellungen in den Programmen formuliert werden. [...] Andererseits ist nicht anzunehmen, dass eine Partei angesichts von Art. 21 Abs. 2 GG ihre verfassungswidrigen Ziele offen und ausdrücklich in ihrem Parteiprogramm formuliert. Vor diesem Hintergrund ist die Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts aus dem SRP-Urteil nach wie vor zutreffend, dass die Verfolgung des Ziels, die bestehende Ordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen, jedenfalls auch, wenn nicht vorrangig mit verdeckten Mitteln innerer Zersetzung betrieben wird. Die offene Propagierung einer verfassungswidrigen Programmatik erfolgt realistischer Weise erst dann, wenn die politische Macht errungen oder zumindest beträchtlich geworden ist. Vor diesem Zeitpunkt sind Loyalitätserklärungen und Lippenbekenntnisse zur demokratischen Verfassung von geringem Beweiswert. [...] Einer Partei wird damit keine geheimbündlerische oder verschwörerische Tätigkeit, sondern nur ein - im Sinne ihrer Absichten politisch reflektiertes oder strategisch geschicktes Verhalten unterstellt. Das Parteiprogramm oder auch programmatische Erklärungen von Funktionären verlieren ihren Erkenntniswert ganz offensichtlich, wennangesichts eines drohenden Verbotsverfahrens "Bereinigungen" vorgenommen werden. Auch das Abweichen der Führungskader in der Tagespolitik von den programmatischen Grundlinien reduziert deren Erkenntniswert beträchtlich. [...] Bei der Feststellung der Ziele mittels anderer Quellen als dem Parteiprogramm ist sowohl aus rechtsstaatlichen Gründen als auch im Lichte des demokratischen Prinzips insofern Zurückhaltung geboten, als der Partei nicht zugerechnet werden darf, was sie nicht zu verantworten hat. Bei der Würdigung von Äußerungen sind drei Aspekte entscheidend: - Erstens muss die sich äußernde Person legitimiert sein, für die Partei zu sprechen. Die Legitimation kann formal auf der Stellung in der Partei (Funktionäre) beruhen oder darauf, dass die Äußerung in Parteiorganen publiziert oder dass sie vom offiziellen Redner auf Parteiveranstaltungen herrührt. Es kommt also auf die Unterstützung oder Duldung (auch im Sinne des Sich-Nicht-Distanzierens) solcher Äußerungen durch die zuständigen Gremien der Partei an. - Zweitens ist zu verlangen, dass die Äußerungen aus verlässlicher Quelle belegt sind. Demzufolge haben schriftliche Äußerungen grundsätzlich den verlässlichsten Beweiswert. Es kommen aber selbstverständlich auch zeugenschaftliche Nachweise in Betracht. Gerade dann wenn sich eine Partei oder ihre Führung bewusst in der Öffentlichkeit verstellt, kann eine Vielzahl verfassungswidriger mündlicher Äußerungen eine Programmatik erkennen lassen, die erheblich von der veröffentlichten abweicht. - Drittens sind einzelne Äußerungen von leitenden Funktionären einer Partei stets zurechenbar. Es sei denn, es handelt sich um Entgleisungen, die nach dem Erscheinungsbild und der Programmatik der Partei untypisch sind, und von denen sich der Äußernde oder die zuständigen Gremien eindeutig distanziert haben, weil sie dem politischen Kurs der Partei widersprechen. bb) Hinsichtlich des Anhängerverhaltens bedürfen beide begrifflichen Komponenten der Klärung. Außer Frage steht die Anhängereigenschaft von Mitgliedern einer Partei, die aber nur eine Teilmenge des Kreises der Anhänger bilden. Sollen Schutzzweck und Präventivfunktion von Art. 21 Abs. 2 GG nicht ins Leere laufen, sind zu den Anhängern außer den Mitgliedern alle diejenigen zu zählen, die sich - als Angestellte, Förderer, Sympathisanten etc. - für eine Partei einsetzen und diese bei der Zielverfolgung unterstützen. [...] Der weite Anhängerbegriff ist rechtsstaatlich unbedenklich, da das Kriterium der Zurechnung als Korrektiv wirkt. Die Zurechnung des Anhängerverhaltens lässt sich freilich nicht abstrakt bestimmen, sondern nur unter Berücksichtigung der anderen Tatbestandsmerkmale von Art. 21 Abs. 2 GG und der einer Partei durch die Verbotsdrohung nahegelegten taktischen Erwägungen. [...] Eine Partei, deren "verbandsmäßige Wirkungsmöglichkeit" [...] und Taktik gerade darin besteht, ihre Ziele durch Anhänger, die keine formellen Mitglieder sind, oder verbündete Organisationen verfolgen zu lassen, also Verantwortung informell zu delegieren oder aus dem Parteiapparat auszulagern, kann sich im Verbotsverfahren nicht mit dem Hinweis auf die vermeintliche Distanz solcher Anhänger oder Organisationen zu den Führungsgremien entlasten. Hinsichtlich der Zurechnung einzelner Handlungen von Anhängern besteht insofern Einigkeit, als diese ein Verbot der Partei nur dann rechtfertigen können, wenn sie nachweislich eine Grundtendenz der Partei manifestieren, also nicht "Ausreißer" darstellen. Zwischen den Zielen einer Partei und dem Verhalten ihrer Anhänger besteht jedoch eine Wechselwirkung: Ebenso wie sich die Ziele im Verhalten der Anhänger spiegeln können, lässt auch dieses Verhalten Rückschlüsse auf die Zielsetzung der Partei zu. [...] e) Konkrete Gefährlichkeit? Umstritten ist, ob die Feststellung der Verfassungswidrigkeit als zusätzliches, ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal die objektive Gefährlichkeit der Partei voraussetzt. Dafür könnten zunächst der Präventivcharakter von Art. 21 Abs. 2 GG und sein Zweck - die Abwehr von politischen Gefahren bzw. "Verfassungsstörungen" - sprechen. Damit rückte Art. 21 Abs. 2 GG jedenfalls in eine strukturelle Nähe zu den Eingriffsbefugnissen des Polizei und Ordnungsrechts. Mit der Einforderung des Vorliegens einer konkreten Gefahr als eingriffsbeschränkender Voraussetzung könnte in den Tatbestand des Art. 21 Abs. 2 GG eine zusätzliche Missbrauchssperre eingebaut und die Betroffenheit der beiden Schutzgüter ("Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden") symmetrisiert werden. [...] Dieser Punkt ist auch ausdrücklich Gegenstand der Debatte um die Antragstellung gewesen. Für die F.D.P. hat der Abg. Dr. Guido Westerwelle geltend gemacht, ein "Verbot wäre im Falle einer tatsächlichen Gefährdung der Demokratie durch eine extremistische Partei das richtige Mittel." In einer solchen Ausnahmesituation müsse die wehrhafte Demokratie auch vorbeugend zum Mittel der Auflösung einer Partei greifen. Die Wahlergebnisse der NPD zeigten aber, dass diese Gefahr nicht bestehe und dass die NPD von allen rechtsextremistischen Parteien die erfolgloseste sei. [...] In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wird ein solches zusätzliches Tatbestandsmerkmal nahegelegt, wenn das Gericht argumentiert, durch Art. 21 Abs. 2 GG solle "Gefahren begegnet werden, die von der Existenz einer von einer verfassungsfeindlichen Grundtendenz geprägten Partei und ihrer typischen verbandsmäßigen Wirkungsmöglichkeit ausgehen". [...] Das Bundesverfassungsgericht argumentiert im Übrigen sehr vorsichtig: Es geht um "Gefahren", die von der "Existenz" einer solchen Partei ausgehen; das ist etwas anderes als eine "Gefahr" für die Demokratie im Sinne einer Bestandsbedrohung bestimmter Intensität durch eine Partei, wie dies der Debattenbeitrag des Abgeordneten Dr. Westerwelle nahe legt. Eine "Gefahr", die von der Existenz einer solchen Partei ausgeht, hat der Abgeordnete Cem Özdemir dahingehend beschrieben, dass Menschen in Folge rechtsextremistischer Aktivitäten eingeschüchtert und verängstigt zu Hause bleiben, dass sie Angst haben, an der Demokratie teilzunehmen. Ein solches an bestimmten Orten erzeugtes Klima der Angst für diejenigen, die nicht Sympathisanten der NPD sind, ist z.B. eine "Gefahr", die von der "Existenz" der NPD ausgeht, soweit diese die gleiche Freiheit Aller und insbesondere das Recht Aller auf ein Leben in Würde missachtet. [...] Im KPDUrteil wird, wenn nicht die bloße Absicht der Verfassungsstörung - s.o. unter B I 4 - so doch die Erkennbarkeit des "planvoll verfolgten Vorgehens der Partei" für ausreichend gehalten. Es komme darauf an, "Gefahren rechtzeitig abzuwehren, mit deren Eintreten nach der allgemeinen Haltung der Partei gegenüber der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerechnet werden muß." Von besonderer Bedeutung ist die richtige Schlussfolgerung des Gerichts; es führt nämlich aus, dass eine Partei auch dann verfassungswidrig sein kann, "wenn nach menschlichem Ermessen keine Aussicht darauf besteht", daß sie ihre verfassungswidrige Absicht in absehbarer Zukunft werde verwirklichen können. (BVerfGE 5, 85) Folglich ist nicht vorauszusetzen, dass die Gefahr bereits besteht. Auf die Erfolgsaussichten der Beseitigung oder Beeinträchtigung kann es mithin nicht ankommen. [...] Für diese Auslegung spricht der spezifische Präventivcharakter von Art. 21 Abs. 2 GG, der der Maxime "wehret den Anfängen" geschuldet ist und gerade kein Zuwarten bis zur einer unmittelbar drohenden Beschädigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung fordert. Insofern ist die Entscheidung über ein Parteiverbot mit der Entscheidung über eine polizeiliche Einzelmaßnahme nicht zu vergleichen. Für diese Auslegung spricht ferner, dass ein Parteiverbot nicht nur ausgesprochen werden soll, um die Stabilität der demokratischen Ordnung zu sichern, sondern auch um die Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten. Auch die Entstehungsgeschichte und Systematik stützen diese Auslegung. Im Entwurf von Herrenchiemsee war von "zum Ziel gesetzt haben" die Rede. Die Ersetzung dieser Formel durch das "Darauf-ausgehen" sollte der Norm keinen anderen Inhalt geben. [...] Der deutlich präventivere, vom Vorliegen einer konkreten Gefahr unabhängige Sinn von Art. 21 Abs. 2 GG erschließt sich auch aus dem Vergleich mit anderen grundgesetzlichen Vorschriften der "Gefahrenabwehr": Besonders deutlich zeigt sich die Differenz zu Art. 8a Abs. 4 und 91 Abs. 1 GG, in denen ausdrücklich von einer "drohenden Gefahr" die Rede ist. Der Unterschied zu Art. 18 GG, der jedenfalls die künftige Gefährlichkeit des Antragsgegners voraussetzt, tritt weniger offensichtlich zutage, erschließt sich jedoch aus dem Erfordernis des Kampfes gegen die freiheitliche. demokratische Grundordnung und aus der differenziellen Gefährlichkeit von individuellem Grundrechtsmissbrauch und parteimäßig organisierter "Verfassungsstörung". [...] Letztlich müssten sich die Befürworter eines Kriteriums der "Gefahr" damit auseinandersetzen, dass der Gefahrenbegriff auch im Polizeirecht nach der bekannten Je-desto-Formel die Hochrangigkeit der Rechtsgüter auf dieTatbestandsvoraussetzungen der Gefahrenprognose einwirkt, so dass Gefahrenabwehr und Gefahrenvorsorge sich schon fast berühren. Für die Je-desto-Formel ist weiter zu beachten, dass nicht notwendig die Gefahr der Beseitigung der Verfassungsordnung drohen muss, sondern schon die Gefahr der Beeinträchtigung ausreicht. Die Befürworter polizeilicher Argumentation müssten weiter darlegen können, dass gerade Gefahrenvorsorge von Art. 21 Abs. 2 GG nicht erfasst sein soll. Schließich musste diese Auffassung auch noch gedanklich verarbeiten, dass die letztverbindliche Entscheidungszuständigkeit für die Gefahreneinschätzung bestimmt werden müsste. Hier spricht dann alles dafür, dass die Einschätzungsprärogative für die Gefahrenprognose bei den antragsberechtigten Verfassungsorganen liegt. [...] Die Idee, den Begriff der Gefahr polizeirechtlich zu nehmen, würfe mehr Fragen auf, also sie zu lösen im Stande ist. Insbesondere ist ihr entgegenzuhalten, dass sie mit ihrer Gefahrenkonzeption recht einseitig nur die Bedrohung der gesamten Ordnung ins Auge fasst, dabei übersieht, dass deren Freiheitlichkeit bereits dann beeinträchtigt ist, wenn eine Partei durch Drohungen und Einschüchterungen einzelne Personen oder Gruppen, die ihr im Wege stehen, als "Nichtbürger" behandelt, also darauf ausgeht, deren Menschenrechte außer Kraft zu setzen. Im Übrigen könnte die Einfügung des Kriteriums der konkreten Gefährlichkeit einer Partei nur den Zweck haben, die missbräuchliche Anwendung des Art. 21 Abs. 2 GG zu verhindern. Zu bedenken ist dazu, dass das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Zulässigkeit bereits prüft, ob eine missbräuchliche Antragstellung vorliegt, und dass die oben erläuterte restriktive Auslegung der Tatbestandsmerkmale einer Überziehung des Präventivcharakters hinreichend wirksam entgegensteht. Für ein zusätzliches Tatbestandsmerkmal der konkreten Gefährlichkeit ist also weder Raum noch Notwendigkeit. f) Verhältnismäßigkeit Im Schrifttum wird in jüngerer Zeit auch die Frage aufgeworfen, ob, und inwieweit der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei der Entscheidung nach Art. 21 Abs. 2 GG als Eingriffsschranke zur Anwendung kommt. [...] In den beiden Verbotsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hat der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit keine Rolle gespielt. Allerdings liegen die beiden Entscheidungen vor der Karriere des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes als einem verfassungsrechtlichen Schlüsselprinzip [...] und können insofern nicht dafür herangezogen werden, dass das Prinzip offenbar keine Anwendung findet. Es lässt sich die Frage auch nicht mit dem Hinweis abtun, der Hohe Senat habe doch (richtigerweise) dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aus dem Staatsorganisationsrecht verabschiedet und dem Reich grundrechtlicher Freiheit zugewiesen. [...] Indes sind Parteien, wie Post-Leibholz klargestellt hat, eben nur Mitwirkende an der politischen Willensbildung, nur punktuell staatsorganschaftlich vereinnahmt und ansonsten im Reich der Freiheit agierende Bürgerverbände. Dann lässt sich also argumentieren, die Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei greife in deren Betätigungsfreiheit und zugleich in Grundrechte ihrer Mitglieder ein. Danach käme es in erster Linie auf die Vergleichbarkeit der Eingriffssituation bei Art. 21 Abs. 2 GG mit typischen Grundrechtseingriffen an, ohne dass man andererseits die Staatsorgannähe gänzlich vernachlässigen dürfte. [...] Das Parteiverbot wird als eine verfassungsunmittelbare Grundrechtsschranke angesehen [...]. Auf die Beantwortung der umstrittenen Frage, ob das Parteiverbot ein grundrechts-ähnliches Recht [...] einschränkt oder einer grundrechtlichen Eingriffssituation soweit vergleichbar ist, dass nur "verhältnismäßige" Parteiverbote verfassungsrechtlich gerechtfertigt wären, kommt es jedoch nicht an, da das Übermaßverbot von Art. 21 Abs. 2 GG hier nicht anwendbar ist und Elemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung ohnehin in die Feststellung der Verfassungswidrigkeit eingelassen sind. Die Befürworter der Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzip setzen sich mit der Normstruktur des Art. 21 Abs. 2 GG nicht angemessen auseinander. Die Norm ist konditional programmiert; sie gibt auf der Rechtsfolgenseite keinen Spielraum ("ist verfassungswidrig"), wenn ein Antrag gestellt ist und die Tatbestandsvoraussetzungen der Norm erfüllt sind. Das Bundesverfassungsgericht hat nach § 46 Abs. 3 BVerfGG keine Entscheidungsalternative. Wenn es eine verfassungsmäßige Regelung ist, aus der Verfassungswidrigkeit nach Art. 21 Abs. 2 GG gesetzlich zwingend das einfach-rechtliche Rechtsfolgenreglement des Verbots etc. anzuordnen, bleibt für das Bundesverfassungsgericht jedenfalls kein Rechtsfolgeermessen, in dessen Rahmen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit moderierend wirken könnte. Der "Rechtsfolgenautomatismus" ist bisher noch nicht ernstlich in Zweifel gezogen worden. [...] Das Bundesverfassungsgericht selbst hat im KPD-Urteil dazu den richtigen Hinweis gegeben, dass die Auflösung, "die normale, typische und adäquate Folge der Feststellung der Verfassungswidrigkeit" ist. (BVerfGE 5, 85) Das trifft auch zu: Die Organisation ist mit der Verfassung unvereinbar; sie kann also keinen Bestand haben. Der Weg zu Minus-Maßnahmen, den das Vereinsrecht kennt, [...] ist folglich verschlossen. [...] Damit ist in dieser Richtung auch kein Ansatz für den Einbau einer zusätzlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung in die Verbotsnorm gegeben. Eine solche "freihändige" Varianz im Rechtsfolgenausspruch qua Verhältnismäßigkeit könnte im übrigen eigene Verhältnismäßigkeitsprobleme aufwerfen: Das geltende "Alles-oder-Nichts-Prinzip" - entweder gleichheitsgerechte Teilhabe an der Willensbildung oder Ausschluss davon - schützt extremistische Parteien vor einem sonst drohenden Kuratel des Staates. Es würde ihnen z.B. die Wahlteilnahme für eine Bundestagswahl verboten. Wie ein Gewerbetreibender, dem die Gewerbeausübung untersagt ist, einen Antrag auf Wiedergewährung der Gewerbeausübungsberechtigung stellen kann, weil er sich "gebessert" habe, geriete eine solche Partei unter eine partielle "Lizenzierung" die mit Art. 21 Abs. 1 GG nur schwer kompatibel wäre. Für die Parteien bedeutet es ein Stück "Zensursicherheit", wenn es nur eine, allerdings durchgreifende, Sanktion gibt, statt eine Vielzahl weniger schwerwiegender Maßnahmen. So müssen sich die Verfassungsorgane sehr sorgfältig überlegen, ob sie das Verbotsmittel einsetzen oder nicht. Für Minus-Maßnahmen hinge die Schwelle deutlich niedriger. Zum Teil werden - darauf wird gleich zurückzukommen sein - auch ganz unsystematische Verhältnismäßigkeitsüberlegungen angestellt. Maurer meint, eine ersichtlich erfolglose Partei dürfe auch nicht verboten werden. Ein Verbot sei dann im Sinne der Verhältnismäßigkeitskontrolle nicht notwendig. [...] Im Sinne Maurers wäre dann auf der Tatbestandsseite der Gefahrenbegriff in spezifischer Weise auszulegen, also z.B. in Ansehung der Verbots-Rechtsfolge und deren Gewicht. [...] Das mag man als verhältnismäßige Rechtsanwendung bezeichnen. Maurer gesteht [...] übrigens zu, dass mit seinem Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht viel gewonnen ist: Die Frage, wann Gefährlichkeit anzunehmen sei, führe sozusagen in ein Dilemma: Wenn eine Partei eine gewisse Größe erreicht habe, "und damit wirklich gefährlich wird", stoße ein Verbot auf politische Schwierigkeiten, weil dann (z.B. bei 15 oder 20 Prozent Wählerstimmen) die Durchsetzung schwierig sei. Man müsse also früher ansetzen und auf die potentielle Gefährlichkeit abstellen. Es gelte den Anfängen zu wehren. Wo aber Anfänge lägen, lasse sich nur schwer sagen und noch schwerer nachweisen. [...] Ansonsten könnte sich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit noch auf der Rechtsfolgenseite bei der Antragsberechtigung auswirken, als Moderation des Opportunitätsermessens der Verfassungsorgane. [...] Allerdings ist hier zu bedenken, dass das Opportunitätsermessen nicht über den Umweg der Verhältnismäßigkeitskontrolle zugunsten der Parteien justitiabilisiert werden darf, wenn es dem politischen Ermessen nicht entfremdet werden soll. Dieses politische Entscheidungselement ist aber gerade der Grund dafür, dass eine Rechtspflicht zur Antragstellung verneint wird. [...] Das Bundesverfassungsgericht hat zuerst im 5. Band (BVerfGE 5, 85) und dann nochmals im 40. Band (BVerfGE 40, 287) den Zusammenhang verdeutlicht: Die Verfassungsorgane hätten nach pflichtgemäßen Ermessen, für das allein sie politisch verantwortlich seien, zu prüfen und zu entscheiden, ob sie den Antrag stellen wollten oder ob die die Lösung in der Auseinandersetzung auf politischem Felde suchen wollten. Auch mit dem Versuch, eine verfassungswidrige Partei mit Argumenten in die Schranken zu verweisen, genügten die Verfassungsorgane gegebenenfalls ihrem Auftrag, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu verteidigen. Diese Abwägung der Verfassungsorgane darf aber nicht via einer Verhältnismäßigkeitsprüfung letztlich auf den kontrollierenden Richter verschoben werden. - Zusammenfassend ergibt sich also, dass der legitime Zweck von Parteiverboten in Art. 21 Abs. 2 GG als verfassungsunmittelbare Schranke der Betätigungsfreiheit von Parteien vorgegeben ist. Ob dieser Zweck im konkreten Verfahren verfolgt wird, wird vom Bundesverfassungsgericht bei der Missbrauchskontrolle von Anträgen im Rahmen der Zulässigkeit (§ 45 BVerfGG) überprüft. - Hinsichtlich der Eignung von Parteiverboten zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung hat der Verfassungsgeber eine grundsätzlich bejahende Vorentscheidung getroffen. Ob sich die in einem konkreten Verfahren beantragte Feststellung der Verfassungswidrigkeit zum Schutz der Grundlagen der Demokratie eignet, ist nach Maßgabe von Art. 21 Abs. 2 GG stets dann zu bejahen, wenn das Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis kommt, dass die Antragsgegnerin darauf ausgeht, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. - Die Erforderlichkeitskontrolle scheitert daran, dass nach dem Wortlaut des Art. 21 Abs. 2 GG die Verbotsfolge bei festgestellter Verfassungswidrigkeit zwingend ist, folglich ebenso wirksame, aber weniger eingreifende Mittel nicht zur Verfügung stehen. Ob mögliche mildere Mittel, wie das Suchen der politischen Auseinandersetzung, sozialpolitische Initiativen, aber auch das Verbot von Umfeldorganisationen, die keine Parteien sind, das strafrechtliche Vorgehen gegen Mitglieder und Anhänger aufgrund ihres individuellen Verhaltens oder die Anwendung von Art. 18 GG, ebenso effektiv sind, und wem es zusteht, dies zu beurteilen, kann dahingestellt bleiben. Denn diese Maßnahmen stehen zu einem Parteiverbot nicht in einer vom Prinzip der Verhältnismäßigkeit gebotenen Relation strikter Alternativität. Im übrigen stellt das Ausweichen auf andere Mittel wie etwa auf die politische Auseinandersetzung jedenfalls dann keine gleich wirksame Alternative dar, wenn - Parteien sich aufgrund ihrer totalitären Programmatik, ihres absoluten Wahrheits- und Machtanspruchs hermetisch abschotten gegen eine Welt, in der sie sich von "Feinden" umstellt sehen, - wenn sie auf die für demokratische Auseinandersetzungen unabdingbaren Voraussetzungen Kompromissbereitschaft, Verhandlungslösungen, offener und fairer Wettbewerb um die politische Macht - missachten. Mithin ergibt sich aus der spezifischen Struktur von Art. 21 Abs. 2 GG, dass allenfalls der Gedanke der Angemessenheit Anwendung finden könnte. Die Prüfung der Angemessenheit ist jedoch bei der Auslegung der Tatbestandsmerkmale von Art. 21 Abs. 2 GG ohnehin geboten (s.o. unter B I 1-4). Für eine Anwendung der Angemessenheit aufgrund der Besonderheiten der Tatbestandsvoraussetzungen, insbesondere bezogen auf die freiheitliche demokratische Grundordnung. [...] Die restriktive Auslegung, erstens, des Schutzgutes freiheitliche demokratische Grundordnung, welches auch im Kontext des Einzelfalles zu konkretisieren ist, und zweitens der Intensität der "Verfassungsstörung" - "Beeinträchtigung" als prozesshafter Vorgang, der auf die "Beseitigung" zielt - trägt dem Gebot der Angemessenheit Rechnung. Zwar ist es zutreffend, dass der Wortlaut von Art. 21 Abs. 2 GG keinen Raum dafür lässt, eine Partei für in größerem oder geringerem Maße verfassungswidrig zu erklären, jedoch ist die in die beiden genannten Tatbestandsmerkmale eingelassene Abwägung Voraussetzung für die Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei nach Art. 21 Abs. 2 GG. In diesem Rahmen - und nicht in einer zusätzlichen Prüfung der Verhältnismäßigkeit - prüft das Bundesverfassungsgericht, ob die nachgewiesene Intensität einer teilweisen Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung in einem angemessenen Verhältnis zur der in der Feststellung der Verfassungswidrigkeit liegenden Beschränkung der freiheitlichen Demokratie steht. Wie oben ausgeführt, aktualisiert diese Prüfung die rechtsstaatliche Einbindung des Verfahrens nach Art. 21 Abs. 2 GG und dessen doppelte Schutzrichtung. Für eine nachgeschaltete Prüfung der Verhältnismäßigkeit fehlen daher sowohl der Raum wie auch die Notwendigkeit. g) Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus Eine politische Partei, die dem Nationalsozialismus wesensverwandt ist, gilt als verfassungswidrig nach Maßgabe von Art. 21 Abs. 2 GG. aa) Der "Wesensverwandtschaft" einer politischen Partei mit dem Nationalsozialismus kommt im Parteiverbotsverfahren ein besonderer normativer Status zu. Aufgrund einer auf die Entstehungsgeschichte von Art. 21 Abs. 2 GG gestützten, vergleichenden Argumentation hat das Bundesverfassungsgericht im SRP-Urteil dazu ausgeführt: "Daß die ehemalige NSDAP, nach ihrer Entwicklung, wie sie heute rückschauend überblickt werden kann, als in der Gegenwart existierende Partei nach Art. 21 Abs. 2 GG verfassungswidrig wäre, unterliegt keinem Zweifel; die Erfahrungen gerade mit dieser Partei sind der unmittelbare Anlaß für die Schaffung des Art. 2 Abs. 2 GG gewesen." (BVerfGE 2, 1) Diese Begründung, die fortzuentwickeln das Bundesverfassungsgericht in späteren Entscheidungen keinen Anlass hatte, ist vom Bundesverwaltungsgericht in seinen Entscheidungen zu Vereinsverboten nach Art. 9 Abs. 2 GG weiter geführt worden. [...] Die mit dem Nachweis der Ziel- und Methodenverwandtschaft begründete Vermutung der Verfassungswidrigkeit stützt sich auf die bewusste Entscheidung des Verfassungsgebers, den Rückfall in eine nationalsozialistische Barbarei zu verhindern, d.h. im Grundgesetz eine antinationalsozialistische Rückwärtssperre zu errichten. [...]. Die antinationalsozialistische Ausnahme bzw. Rückwärtssperre lässt sich systematisch aus einer Zusammenschau der Grundgesetzbestimmungen ableiten, die einerseits die Freiheitlichkeit der Verfassungsordnung verbürgen und andererseits Sorge tragen sollen für die Diskontinuität des nationalsozialistischen Herrschaftssystems. [...] Der zwingende, rechtfertigende Grund für diese Einschränkung des demokratischen Experimentalismus ist die Singularität der nationalsozialistischen Verbrechen. Eine Verfassungsordnung, die einerseits die Menschenwürde und gleiche Freiheit Aller verteidigen will, würde sich im Übrigen in einen Widerspruch verstricken, ließe sie andererseits auch nur eine Chance einer Neuauflage jenes Terrorregimes zu. Dieses aus der Wesensverwandtschaft abgeleitete Verbot ist ein besonderer Anwendungsfall des Verstoßes gegen das Verbot, aggressiv-kämpferisch die freiheitliche demokratische Grundordnung zu bekämpfen. Denn Ziel- und Methodenverwandtschaft zur NSDAP ist die manifeste Negation dessen, was mit dem Konzept der streitbaren Demokratie gerade geschützt werden soll. Deshalb wird die Untersuchung der Wesensverwandtschaft hier vorangestellt. Das schließt den Nachweis, dass Programmatik und Verhalten der NPD auch gegen die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen des Parteiverbots in seinen Einzelausprägungen verstößt, nicht aus. Auch das SRP-Urteil behandelt Wesensverwandtschaft einerseits und den Kampf gegen Menschenrechte und das "freiheitlich demokratische Entscheidungssystem" andererseits als kumulative Verbotsgründe. BVerfGE 2, 1: "Dieser festgestellte Sachverhalt erfüllt den Tatbestand des Art. 21 Abs. 2 GG. Das bedarf für die Missachtung der Menschenrechte ... keiner weiteren Ausführung. Es gilt aber auch für die Wesensverwandtschaft ...". bb) "Wesensverwandtschaft" kann bei einem soziopolitischen Phänomen wie einer Partei wegen des zeitlichen Abstands, der zwischen ihrem Auftreten und dem Nationalsozialismus liegt und wegen des je unterschiedlichen historischen und politischen Kontexts nicht Identität im strengen Sinne bedeuten. Gleichwohl sind an eine Ziel- und Methodenverwandtschaft strenge Kriterien anzulegen, die die charakteristischen Merkmale der zu vergleichenden Phänomene angemessen erfassen, um angesichts der gravierenden Rechtsfolge die rechtsstaatlich gebotene Tatbestandswirkung von Art. 21 Abs. 2 S. 1 GG nicht ins Leere laufen zu lassen und dem demokratischen Prinzip auch insoweit Rechnung zu tragen. Aus der Perspektive eines unvoreingenommenen, informierten Beobachters muss daher nach Maßgabe dieser Kriterien zwischen den zu vergleichenden Phänomenen eine solche Übereinstimmung bzw. Ähnlichkeit bestehen, dass demgegenüber einzelne Abweichungen als unwesentlich, weil den historisch-zeitlich veränderten, äußeren Rahmenbedingungen geschuldet, zurücktreten. Bezüglich der Kriterien einer solchen Wesensverwandtschaft haben das Bundesverfassungsgericht und, ihm folgend, das Bundesverwaltungsgericht auf "Programm, Vorstellungswelt und Gesamtstil" einer Partei abgestellt. [...] Gestützt auf zahlreiche geistes- und sozialwissenschaftliche und rechtswissenschaftliche Untersuchungen [...] ist davon auszugehen, dass die charakteristischen Merkmale des Nationalsozialismus und der NSDAP in deren Vorstellungswelt, Organisationsstruktur und Praxis in Erscheinung treten und sich erfassen lassen durch eine vergleichende Betrachtung der politischen Programmatik (handlungsleitende Ideologie bzw. Weltanschauung), der strategischen und taktischen Konzepte sowie der Rhetorik und politischen Sprache, die in den Dienst der operativen Programmatik gestellt wird. Ein weiteres Kriterium sind die expressiven und rituellen Bezüge, die eine Partei in ihrer Praxis zum Nationalsozialismus oder zur NSDAP, zu Repräsentanten oder Verteidigern des Nationalsozialismus im Sinne der Traditionspflege herstellt. II. Wesensverwandtschaft der NPD mit dem Nationalsozialismus Die NPD ist aufgrund ihrer politischen Programmatik, Strategie und Taktik, ihrer politischen Sprache und Rhetorik, ihrer affirmativ-apologetischen Darstellung nationalsozialistischer Verbrechen und ihrer nationalsozialistischen Traditionspflege eine dem Nationalsozialismus wesensverwandte und daher nach Maßgabe von Art. 21 Abs. 2 GG verfassungswidrige politische Partei. 1. Politische Programmatik Die programmatische Wesensverwandtschaft der NPD mit dem Nationalsozialismus erschließt sich aus einer vergleichenden Analyse des Parteiprograrnms der NPD von 1996, der Schulungsmaterialien und anderer programmatischer Schriften, der Reden und Veröffentlichungen von führenden Funktionären der NPD und JN sowie der Beiträge in den offiziellen Medien ("Deutsche Stimme", Internet) der Partei mit den für die nationalsozialistische Ideologie maßgeblichen Programmen, Publikationen und Äußerungen von Funktionären der NSDAP. [...] Nachweise für die Übereinstimmung von NSDAP und NPD im Hinblick auf die zentralen Programmaussagen lassen sich zahlreichen geistes- und sozialwissenschaftlichen Untersuchungen entnehmen. [...] Die Einschätzung der NPD als einer "neonazistischen Partei" [...] ist durchaus vereinbar mit der Beschreibung des Rechtsextremismus als eines "weitgefächerten Phänomens". [...] Von der Wesensverwandtschaft zwischen NPD und Nationalsozialismus geht auch das Bundesverwaltungsgericht in einer Reihe von Entscheidungen aus. [...] Die programmatische Übereinstimmung ergibt sich aus den zentralen, den politischen Kurs und die Vorstellungswelt der NPD definierenden Elementen: (a) Ideologie der "Volksgemeinschaft", (b) Reichsidee und Großraum-Denken, (c) Sozialdarwinismus, Rassismus und (d) Antisemitismus. a) "Volksgemeinschaft": aa) Für den Nationalsozialismus stand der ideologisch aufgeladene Begriff der "Volksgemeinschaft" als Gemeinschaft der "Volksgenossen" im Gegensatz zur als künstlich und "undeutsch" empfundenen "Gesellschaft". Ihm korrespondierten zum einen die Unterordnung des Individuums und seiner Interessen und Rechte unter den Willen und die Bedürfnisse der Gemeinschaft gemäß dem u.a. im Parteiprogramm der NSDAP formulierten Grundsatzes "Gemeinnutz geht vor Eigennutz", [...] und zum anderen die spezifische Differenzierung zwischen "Verrätern" der Gemeinschaft, die zu ächten, also aus der "Volksgemeinschaft" auszuschließen waren, und "Verbrechern", denen zwar Strafe, aber nicht der Ausschluss drohte. [...] Ideengeschichtlich war "Volksgemeinschaft" einer der Schlüsselbegriffe der Jugendbewegung im beginnenden 20. Jahrhundert. Unter Berufung auf Fronterlebnis und Schützengrabenkameradschaft während des Weltkrieges avancierte die illusorische "Volksgemeinschaft" in der Weimarer Republik zum Ausdruck eines gegen den bürgerlichen Liberalismus und Individualismus des 19. Jahrhunderts gerichteten bürgerlich-nationalen Erneuerungsstrebens. Ein übersteigerter Nationalismus verband sich mit einer biologistisch-organizistischen Gesellschaftslehre zur "Negierung aller Unterschiede in Herkunft, Stand, Beruf, Vermögen, Bildung, Wissen, Kapital." (R. Höhn, Rechtsgemeinschaft und Volksgemeinschaft, 1935) [...] Hinter dieser egalitären Maske wurde die Verheißung der "Volksgemeinschaft" zum wirksamen Mittel der nationalsozialistischen Wahlpropaganda. Allerdings zeichnet sich bereits im NSDAP-Parteiprogramm von 1920 der Ausschluss aller sogenannten "Fremdvölkischen"