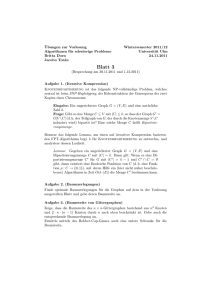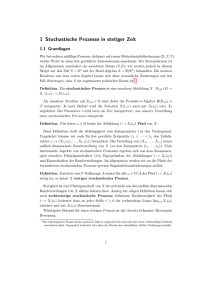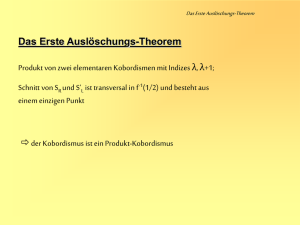Einführung in die zeitdiskrete Finanzmathematik
Werbung

Jan Kallsen
Einführung
in die zeitdiskrete
Finanzmathematik
CAU zu Kiel, WS 08/09, Stand 11. Februar 2009
Inhaltsverzeichnis
0
Hinweise für Nebenfachstudenten
1
Mathematische Hilfsmittel
1.1 Absolutstetigkeit und Äquivalenz
1.2 Lp -Räume und Trennungssatz .
1.3 Der Hilbertraum L2 . . . . . . .
1.4 Bedingter Erwartungswert . . .
4
.
.
.
.
8
8
9
10
11
2
Diskrete stochastische Analysis
2.1 Stochastische Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Martingale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Stochastisches Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
22
25
3
Mathematische Marktmodellierung
3.1 Wertpapiere und Handelsstrategien
3.2 Arbitrage . . . . . . . . . . . . .
3.3 Wertpapiere mit Dividenden . . .
3.3.1 Explizite Modellierung . .
3.3.2 Implizite Modellierung . .
3.4 Konkrete Marktmodelle . . . . . .
.
.
.
.
.
.
34
34
37
43
44
46
48
.
.
.
.
.
.
.
.
.
54
55
57
61
64
64
64
65
68
70
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bewerten und Hedgen von Derivaten
4.1 Termingeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Marktbewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Individuelle Sichtweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Beispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1 Forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2 Future . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.3 Europäische Call- und Put-Optionen im Binomialmodell . . .
4.4.4 Europäische Call- und Put-Optionen im Standardmarktmodell
4.5 Amerikanische Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
INHALTSVERZEICHNIS
3
5
Unvollständige Märkte
5.1 Martingalmodellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Varianz-optimales Hedgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
78
80
6
Ausblick in die zeitstetige Finanzmathematik
6.1 Zeitstetige Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Black-Scholes-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
85
89
Literatur
92
Kapitel 0
Hinweise für Nebenfachstudenten
Diese Vorlesung setzt im Grunde Kenntnisse in maßtheoretischer Wahrscheinlichkeitstheorie voraus. Hier werden die einige wichtige Begriffe zusammengestellt. Sie reichen zum
Verständnis der wesentlichen Ideen und Resultate der folgenden Kapitel aus, wenn auch
nicht in der dargestellten mathematischen Allgemeinheit.
Grundlage der Wahrscheinlichkeitstheorie bildet ein Grund- oder Ergebnisraum Ω, der
die möglichen Ausgänge oder Ergebnisse eines Zufallsexperiments umfasst (z.B. Ω = {1, 2,
3, 4, 5, 6} für einen Würfelwurf oder Ω = R für die zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessene Temperatur). Diese Ergebnisse treten mit gewissen Wahrscheinlichkeiten auf. Diese
werden durch ein Wahrscheinlichkeitsmaß P ausgedrückt. In der Regel betrachtet man allerdings nicht Wahrscheinlichkeiten von einzelnen Ergebnissen, da diese bei Expreimenten
mit überabzählbarem Grundraum wie Ω = R oft alle 0 sind. Die Wahrscheinlichkeit, genau 20,1258◦ C zu messen, ist wie bei jeder anderen ganz genau angegebenen Temperatur
„unendlich klein“, also 0. Stattdessen betrachtet man Wahrscheinlichkeiten von Teilmengen des Ergebnisraums wie etwa [20; 20,5], also einer Temperatur zwischen 20◦ und 20,5◦ .
Solche Teilmengen von Ω heißen Ereignisse. Die Menge aller Teilmengen A ⊂ Ω ist die
Potenzmenge P(Ω).
Man stößt bei überabzählbaren Grundräumen auf tiefligende mathematische Probleme,
wenn man versucht, jedem Ereignis A ⊂ Ω eine Wahrscheinlichkeit zuzuordnen. Man beschränkt sich daher auf hinreichend viele, nämlich solche aus einer vorgegebenen σ-Algebra
F . Darunter versteht man eine Teilmenge der Potenzmenge, die abgeschlossen unter abzählbaren Mengenoperationen wie Vereinigung, Schnitt, Komplementbildung ist. Formal
ausgedrückt:
Definition 0.1 F ⊂ P(Ω) heißt σ-Algebra, falls
1. Ω ∈ F ,
2. AC ∈ F für alle A ∈ F (wobei AC := Ω \ A),
3. ∪∞
i=1 Ai ∈ F falls A1 , A2 , . . . ∈ F .
4
5
Man kann dann zeigen, dass auch Schnittmengenbildung usw. nicht aus der σ-Algebra herausführen. Anschaulich kann man sich eine σ-Algebra als etwas Ähnliches wie die Potenzmenge vorstellen, nur vielleicht etwas kleiner. Ab jetzt sei neben dem Grundraum Ω auch
die σ-Algebra F festgelegt; man spricht von einem meßbaren Raum (Ω, F ). Unter Ereignissen versteht man im engeren Sinne die Elemente von F , also die Teilmengen von Ω, die
zur betrachteten σ-Algebra gehören. Sie werden auch messbare Mengen genannt. Wenn es
sich bei dem Grundraum um R oder allgemeiner Rd handelt, verewendet man üblicherweise
die sogennante Borel-σ-Algebra B bzw. B d , ohne dies zu erwähnen. Das ist formal die
kleinste σ-Algebra, die alle offenen Mengen enthält. Konkret ist es nicht leicht, eine Teilmenge von R bzw. Rd anzugeben, die keine Borelmenge, also nicht in der Borel-σ-Algebra
enthalten ist. Bei endlichen und allgemeiner abzählbaren Grundräumen hat man es einfacher. Hier verwendet man in der Regel die Potenzmenge als σ-Algebra, die angedeuteten
Probleme treten in solch „kleinen“ Räumen nicht auf.
Das Wahrscheinlichkeitsmaß, das unser Zufallsexperiment beschreibt, ordnet jedem Ereignis eine Wahrscheinlichkeit zu. Formal:
Definition 0.2 P : F → R heißt Wahrscheinlichkeitsmaß auf (Ω, F ), falls es normiert
und σ-additiv ist, d.h. falls gilt:
1. P (Ω) = 1,
2. P (∪∞
i=1 Ai ) =
P∞
i=1
P (Ai ), falls A1 , A2 , . . . ∈ F paarweise disjunkte Mengen sind.
(Ω, F , P ) heißt Wahrscheinlichkeitsraum.
Aus Normiertheit und σ-Additivität kann man weitere allgemein bekannte Rechenregeln
für Wahrscheinlichkeiten ableiten. Die beiden Bedingungen lassen sich durch die entsprechenden Eigenschaften relativer Häufigkeiten motivieren. In der Tat kann man sich Wahrscheinlichkeiten als eine Art idealisierte relative Häufigkeiten vorstellen: Eine Wahrscheinlichkeit P ([20; 20,5]) = 0,05 bedeutet anschaulich, dass man nach millionenfacher erneuter
Durchführung des Zufallsexperiments unter gleichen Bedingungen (hier: der Temperaturmessung) in etwa 5% der Fälle ein Ergebnis im Intervall [20; 20,5] erhält. Dass eine solche
Wiederholung des Zufallsexperiments nicht immer tatsächlich möglich ist, soll dabei außer
Acht gelassen werden.
Wenn man die Normierungsbedingung P (Ω) = 1 in Definition 0.2 weglässt, erhält man
übrigens den allgemeineren Begriff eines Maßes, der sich auch für Länge, Fläche, Volumen,
Masse und anderes eignet. Das Lebesguemaß λ auf R etwa ordnet jeder Menge deren Länge
zu, d.h. es gilt λ((a, b]) = b − a für Intervalle mit a ≤ b.
Oft interessiert man sich nicht für das genaue Ergebnis ω ∈ Ω eines mitunter sehr komplexen Zufallsexpreiments, sondern nur für einen quanitativen Aspekt X(ω) davon. Bei ω
könnte es sich z.B. um den Zustand des gesamten Finanzmarkts an einem festgelegten Zeitpunkt handeln, bei X(ω) hingegen nur um den e-$-Wechselkurs in diesem Moment. Solche
X bezeichnet man als Zufallsvariable oder Zufallsgröße. Formal versteht man darunter eine Abbildung X : Ω → R, die die technische Bedingung der Messbarkeit erfüllt, die für die
Theorie benötigt wird.
6
KAPITEL 0. HINWEISE FÜR NEBENFACHSTUDENTEN
Definition 0.3 Eine Abbildung f : Ω → R heißt messbar (genauer: F -B-messbar), falls
f −1 (B) ∈ F für alle B ∈ B.
Messbarkeit ist automatisch gegeben, wenn es sich bei der σ-Algebra F um die Potenzmenge P(Ω) handelt.
Der Erwartungswert E(X) einer Zufallsvariablen steht anschaulich für den Mittelwert
der Werte von X, den man bei millionenfacher Durchführung des Experiments unter identischen Bedingungen erhält. Im Falle eines endlichen oder abzählbaren Grundraums ist dies
X
E(X) :=
X(ω)P ({ω}).
(0.1)
ω∈Ω
Auf der rechten Seite werden die möglichen Werte X(ω) mit der Wahrscheinlichkeit
P ({ω}) ihres Auftretens gewichtet, die ja anschaulich dem Anteil der Versuchswiederholungen entspricht, in dem man das Ergebnis ω erhält. Für überabzählbare Grundräume wie
R ist (0.1) sinnlos; man verwendet dann die allgemeinere Definition
Z
Z
E(X) := XdP = X(ω)P (dω),
(0.2)
zu deren Verständnis man allerdings zunächst das Lebesgue-Integral auf der rechten Seite
einführen muss. Es lehnt sich schon in der Notation an (0.1) an: Das von Leibniz eingeführte
Integralzeichen symbolisiert ein stilisiertes S für Summe; das P (dω) erinnert an den Term
P ({ω}) in (0.1). Die fomale Definition des Integrals ist schwierig und führt hier zu weit.
Wichtig ist an dieser Stelle nur, dass (0.2) in abzählbaren Grundräumen nichts anderes als
(0.1) bedeutet.
Allgemeiner sind Integrale
Z
Z
f dµ = f (ω)µ(dω)
für Maße µ auf (Ω, F ) und messbare Abbildungen f : Ω → R definiert. Für endliches Ω
wird daraus ebenfalls eine Summe
Z
X
f (ω)µ(dω) =
f (ω)µ({ω}).
(0.3)
ω∈Ω
Integrale über Mengen A ∈ F sind einfach durch
Z
Z
f dµ := f 1A µ
A
definiert, wobei
1A (ω) :=
1
0
falls ω ∈ A,
sonst
die Indikatorfunktion von A bezeichnet. Im endlichen Falle ist also
Z
Z
X
f dµ =
f (ω)µ(dω) =
f (ω)µ({ω}).
A
A
ω∈A
7
Auch für endliches Ω sind die rechten Seiten von (0.1) und (0.3) strenggenommen nur
dann definiert, falls die einelementigen Mengen ω in F liegen, d.h. falls F = P(Ω). Andernfalls gilt aber immerhin
Z
X
E(X) = XdP =
xP (X = x).
(0.4)
x∈R
wobei wir die übliche abkürzende Schreibweise
P (X = x) := P ({ω ∈ Ω : X(ω) = x})
verwenden. Die Summe auf der rechten Seite erstreckt sich dabei nur über die endlich vielen
Werte x, die tatsächlich von X angenommen werden. Ähnlich kann auch die rechte Seite
von (0.3) umgeschrieben werden.
Allen Lesern ohne maßtheoretischen Hintergrund empfehlen wir, bei allen Aussagen
der Vorlesung einen endlichen Grundraum Ω mit σ-Algebra F = P(Ω) vorauszusetzen.
Der ökonomische Gehalt wird dadurch kaum gemindert, die mathematische Theorie aber
wesentlich einfacher. An vielen Stellen wird durch Fußnoten deutlich gemacht, wie sich
Aussagen im Fall endlichen Ergebnisraums vereinfachen. Dabei wird implizit immer F =
P(Ω) angenommen.
Kapitel 1
Mathematische Hilfsmittel
In diesem Kapitel werden einige maß-, wahrscheinlichkeitstheoretische und funktionalanalytische Begriffe vorgestellt, die in einführenden Stochastik- und Analysis-Vorlesungen vielleicht nicht zur Sprache kamen. Beweise liefern wir dabei nur in Abschnitt 1.4 über bedingte Erwartungswerte, ansonsten sei auf die Literatur verwiesen, z. B. [Bau78, JP04, Wer02,
RW98].
1.1
Absolutstetigkeit und Äquivalenz
Ein ganz wesentlicher Kunstgriff in der Finanzmathematik besteht darin, neben dem eigentlichen Wahrscheinlichkeitsmaß weitere zu betrachten, unter denen bestimmte Erwartungswerte verschwinden. Dabei interessiert man sich aber vorwiegend für solche Maße, unter
denen die Mengen mit positiver Wahrscheinlichkeit dieselben wie unter dem ursprünglichen Wahrscheinlichkeitsmaß sind. Solche äquivalenten Maßwechsel spielen auch in der
Statistik eine wichtige Rolle.
Seien µ, ν Maße auf einem messbaren Raum (Ω, F ). Später werden wir fast ausschließlich Wahrscheinlichkeitsmaße betrachten.
Definition 1.1 Das Maß ν heißt absolutstetig bezüglich µ, falls jede µ-Nullmenge auch
eine ν-Nullmenge ist. Man schreibt dafür ν µ. 1
Dabei ist eine µ-Nullmenge eine beliebige Teilmenge einer Menge N ∈ F mit µ(N ) =
0. Man fordert bei Nullmengen also nicht unbedingt die Messbarkeit. Dies ist bisweilen aus
technischen Gründen sinnvoll.
Definition 1.2 µ und ν heißen äquivalent, falls µ ν und ν µ. Man schreibt dafür
µ ∼ ν.
Der Satz von Radon-Nikodým besagt, dass das dominierte Maß bei Absolutstetigkeit
schon eine Dichte bzgl. des dominierenden Maßes besitzt.
1
µ ν bedeutet für endliches Ω einfach, dass aus ν({ω}) = 0 schon µ({ω}) = 0 folgt.
8
1.2. LP -RÄUME UND TRENNUNGSSATZ
9
Satz 1.3 (Radon-Nikodým) Sei µ σ-endlich (d.h. es existieren Mengen A1 , A2 , . . . ∈ F
2
mit ∪∞
i=1 Ai = Ω und µ(Ai ) < ∞ für alle n). Dann sind äquivalent:
1. ν hat eine µ-Dichte f (d. h. es gibt eine nichtnegative messbare Abbildung f : Ω → R
R
mit ν(A) = A f dµ für alle A ∈ F ).3
2. ν µ.
Die Dichte
dν
dµ
:= f ist µ-fast überall eindeutig.4
1.2 Lp-Räume und Trennungssatz
Sei (Ω, F , P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum.
Satz 1.4 Für p ∈ [1, ∞) ist
Lp (Ω, F , P ) := {X : Ω → R : X F -messbar, E(|X|p ) < ∞}
ein Banachraum bzgl. der Norm kXkp := (E(|X|p ))1/p , falls man P -fast sicher gleiche
Zufallsvariablen miteinander identifiziert.5
Im strengen Sinne ist X 7→ kXkp nur eine Seminorm, da auch fast sicher verschwindende Zufallsvariablen den Wert 0 erhalten. Formal exakt kommt man zu einem Banachraum,
wenn man statt der Menge der Zufallsvariablen die Menge der Äquivalenzklassen unter der
Äquivalenzrelation fast sichere Gleichheit betrachtet. Wir folgen hier der üblichen praktischen, wenn auch etwas ungenauen Tradition, fast sicher gleiche Zufallsvariablen überall
dort miteinander zu identifizieren, wo dies geboten erscheint (z. B. auch bei Gleichungen
über bedingte Erwartungswerte).
Definition 1.5 Für X : Ω → R definiere das P -wesentliche Supremum durch
ess sup X := inf{α ∈ R : X ≤ α P -fast sicher}.
Satz 1.6
L∞ (Ω, F , P ) := {X : Ω → R : X F -messbar, ess sup |X| < ∞}
ist ein Banachraum bzgl. der Norm kXk∞ := ess sup |X|, falls man P -fast sicher gleiche
Zufallsvariablen miteinander identifiziert.6
2
3
Im Falle endlichen Grundraums heißt das einfach µ({Ω}) < ∞.
Für endliches Ω heißt das also
X
µ(A) =
f (ω)ν({ω}).
(1.1)
ω∈A
Für endliches Ω ist f (ω) = µ({ω})
ν({ω}) , und Gleichung (1.1) ist offensichtlich.
5
Auf diesen Raum können wir für endliches Ω verzichten. Er enthält in diesem Falle übrigens alle Zufallsvariablen.
6
Auch auf diesen Raum können wir für endliches Ω verzichten. Auch L∞ enthält dann alle Zufallsvariablen; ferner ist kXk∞ = max{|X(ω)| : ω ∈ Ω}.
4
10
KAPITEL 1. MATHEMATISCHE HILFSMITTEL
Satz 1.7 Für p ∈ [1, ∞), q ∈ (1, ∞] mit p1 + 1q = 1 ist Lq der Dualraum von Lp bzgl. der
Identifikation Y (X) := E(XY ) für X ∈ Lp , Y ∈ Lq .
Satz 1.8 (Trennungssatz) Seien X ein normierter Raum, M ⊂ X abgeschlossen und konvex, x0 ∈ X \ M . Dann gibt es ein x0 ∈ X 0 := {T : X → R : T linear und stetig} und
α ∈ R derart, dass x0 (x) ≤ α für alle x ∈ M und x0 (x0 ) > α.
Der Beweis basiert auf dem Satz von Hahn-Banach, vgl. z. B. [Wer02], Theorem III.2.5.
Anschaulich besagt der vorstehende Satz, dass man eine abgeschlossene, konvexe Menge M und einen nicht in ihr liegenden Punkt x0 durch eine Hyperebene, nämlich die Menge
{x ∈ X : x0 (x) = α}, in dem Sinne voneinander trennen kann, dass alle Punkte von M auf
der einen Seite, der Punkt x0 hingegen auf der anderen Seite der Hyperebene liegen.
Im endlichdimensionalen Fall werden wir den folgenden Satz verwenden.
Satz 1.9 (Trennungssatz) Seien U ⊂ Rn ein Unterrraum, K ⊂ Rn kompakt und konvex,
U ∩ K = ∅. Dann existiert ein λ ∈ Rn mit λ> x = 0 für alle x ∈ U und λ> x > 0 für alle
x ∈ K.
1.3
Der Hilbertraum L2
Satz 1.10 L2 (Ω, F , P ) ist ein Hilbertraum bzgl. des Skalarprodukts (X, Y ) 7→ E(XY ).
Im Rest des Abschnitts sei p
H ein beliebiger Hilbertraum mit Skalarprodukt h·, ·i und der
dazugehörigen Norm kxk := hx, xi. Wir werden die folgenden Aussagen später nur für
den L2 verwenden.
Elemente x, y heißen orthogonal, falls hx, yi = 0. Entsprechend heißen x ∈ H, Γ ⊂ H
orthogonal, falls hx, yi = 0 für alle y ∈ Γ. Das orthogonale Komplement von Γ ⊂ H
wird definiert als Γ⊥ := {x ∈ H : x orthogonal zu Γ}. Es gilt der
Satz 1.11 (Pythagoras) Für orthogonale x, y ∈ H ist kx + yk2 = kxk2 + kyk2 .
Satz 1.12 Das Skalarprodukt und die Norm sind stetig, d. h. hxn , yn i → hx, yi und kxn k →
kxk für Folgen (xn )n∈N , (yn )n∈N in H mit xn → x, yn → y.
Satz 1.13 Für Γ ⊂ H ist Γ⊥ ein abgeschlossener Unterraum von H.
Der Abstand von x ∈ H und Γ ⊂ H ist definiert als d(x, Γ) := inf{kx − yk : y ∈ Γ}.
Satz 1.14 Seien Γ ⊂ H ein abgeschlossener Unterraum und x ∈ H. Dann existiert ein
eindeutiges y ∈ Γ mit kx − yk = d(x, Γ). Dieses y heißt die Orthogonalprojektion von x
auf Γ. Die Abbildung Π : H → Γ, x → y heißt Orthogonalprojektion auf Γ.
Satz 1.15 Für die Orthogonalprojektion Π auf einen abgeschlossenen Unterraum Γ gilt:
1. Π ist idempotent, d.h. Π2 = Π.
1.4. BEDINGTER ERWARTUNGSWERT
11
2. Π(x) = x gilt genau dann, wenn x ∈ Γ.
3. Π(x) = 0 gilt genau dann, wenn x ∈ Γ⊥ .
4. Für alle x ∈ H ist x − Π(x) orthogonal zu Γ.
Satz 1.16 Seien Γ ⊂ H ein abgeschlossener Unterraum und x ∈ H. Dann existiert eine
eindeutige Zerlegung x = y + z mit y ∈ Γ, z ∈ Γ⊥ . Dabei sind y = Π(x), z = x −
Π(x), wobei Π die Orthogonalprojektion auf Γ bezeichnet. Ferner ist x 7→ x − Π(x) die
Orthogonalprojektion auf Γ⊥ , und es gilt (Γ⊥ )⊥ = Γ.
Satz 1.17 Die Orthogonalprojektion Π auf einen abgeschlossenen Unterraum Γ ist linear
und selbstadjungiert (d. h. hΠ(x), yi = hx, Π(y)i für alle x, y ∈ H).
27.10.08
1.4
Bedingter Erwartungswert
Bei einfachen Zufallsexperimenten hat man es in der Regel mit nur zwei unterschiedlichen
Informationsständen zu tun. Vor dem Experiment liegt der Ausgang noch weitgehend im
Dunkeln, und man kann lediglich Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Ereignisse
angeben. Nach dem Experiment hingegen ist der eingetretene Zustand vollständig determiniert. Dies spiegelt sich auch bei Zufallsvariablen X wider. Nach dem Experiment kennt
man X exakt, vorher gibt man sich z. B. mit dem Erwartungswert E(X) als „erwartetem“
Mittelwert zufrieden.
Wenn sich Zufallsexperimente jedoch über einen längeren Zeitraum hinziehen, erscheint
diese Betrachtungsweise unangemessen. Mit dem Fortschreiten der Zeit werden die Vorstellungen über den Ausgang des Experiments immer präziser. Es erscheint daher wünschenswert, Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte auf Grundlage der zum augenblicklichen
Zeitpunkt vorhandenen Information zu betrachten. Dazu muss man jedoch zunächst den
etwas vagen Begriff der vorhandenen Information mathematisch präzisieren. Es gehört zu
den außerordentlich fruchtbaren Ideen der Wahrscheinlichkeitstheorie, dies mit Hilfe von
σ-Algebren zu bewerkstelligen, die ja in der Maßtheorie zunächst nur als Definitionsbereiche von Maßen in Erscheinung treten, für die sich — wie etwa beim Lebesguemaß — die
Potenzmenge als zu groß erweist.
Inwiefern steht nun eine σ-Algebra C für den Umfang an Information, der zu einem
gegebenen Zeitpunkt zur Verfügung steht? Dies geschieht in der Form, dass C genau die
Ereignisse enthält, von denen wir schon zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicher sagen können,
ob sie eintreten oder nicht.
Betrachten wir dazu ein konkretes Beispiel. Wir würfeln dreimal mit einem Würfel und
bezeichnen die Ergebnisse als X1 , X2 , X3 . Nach dem ersten Würfelwurf sind bereits all die
Ereignisse entschieden, die sich nur auf diesen ersten Wurf beziehen, z. B. das Ereignis {X1
ist gerade}. Die zu diesem Informationsstand passende σ-Algebra C ist daher die von der
12
KAPITEL 1. MATHEMATISCHE HILFSMITTEL
Zufallsvariablen X1 erzeugte, d. h. C = σ(X1 ) = {X −1 (B) : B ∈ B}.7 Aber auch die
Vorstellungen hinsichtlich noch nicht determinierter Ereignisse und Zufallsvariablen können
sich nach dem ersten Wurf geändert haben. Zum Beispiel gilt für die Augensumme E(X1 +
X2 + X3 ) = E(X1 ) + E(X2 ) + E(X3 ) = 10,5; nach dem ersten Wurf hingegen erwarten
wir im Mittel X1 + E(X2 ) + E(X3 ) = X1 + 7, da die Zufallsvariable X1 für uns nun nicht
mehr zufällig ist.
Man bezeichnet diesen Erwartungswert auf Grundlage der Information C als bedingten
Erwartungswert gegeben C und schreibt E(X|C ). Bedingte Wahrscheinlichkeiten lassen
sich durch die Definition P (A|C ) = E(1A |C ) als Spezialfall bedingter Erwartungswerte
auffassen. Damit die Abbildung A 7→ P (A|C ) aber auch σ-additiv ist, wie man es von
einem Wahrscheinlichkeitsmaß erwartet, sind einige maßtheoretische Hürden zu überwinden, auf die hier nicht eingegangen werden soll. Wir beschränken uns daher auf bedingte
Erwartungswerte.
Seien (Ω, F , P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum und C eine Unter-σ-Algebra von F (d. h.
C ⊂ F ). Ferner sei X eine R-wertige Zufallsvariable.
Satz 1.18 Falls X nichtnegativ (oder integrierbar8 ) ist, dann existiert eine P -fast sicher
eindeutige C -messbare nichtnegative (bzw. integrierbare) Zufallsvariable E(X|C ) derart,
dass
Z
Z
XdP
(1.2)
E(X|C )dP =
C
C
für alle C ∈ C .
Beweis. 1. Schritt: Sei zunächst X ≥ 0 und fast sicher endlich. Wir definieren ein neues
:= X. Für die auf die Unter-σ-Algebra C eingeschränkten
Maß Q P durch die Dichte dQ
dP
Maße P |C , Q|C gilt Q|C P |C : Für jede Q|C -Nullmenge N existiert nämlich ein A ∈ C ⊂
F mit N ⊂ A und Q|C (A) = Q(A) = 0, was wegen Q P auch P |C (A) = P (A) = 0
impliziert. Nach dem Satz von Radon-Nikodym existiert eine C -messbare, nichtnegative
R
C
Dichte Y := dQ|
,
d.
h.
Q|
(C)
=
Y dP |C für alle C ∈ C . Damit Y die Eigenschaften
C
dP |C
C
einer bedingten Erwartung hat, bleibt zu zeigen, dass
Z
Z
Y dP =
XdP
(1.3)
C
C
für alle C ∈ C . Dies folgt aus
Z
Z
Z
(?)
XdP = Q(C) = Q|C (C) =
Y dP |C =
Y dP,
C
C
C
wobei die letzte Gleichung (?) vielleicht nicht offensichtlich ist.
Wir beweisen sie mit Hilfe der bisweilen als algebraische Induktion bezeichneten Beweismethode. Darunter versteht man, dass eine Aussage zunächst für Indikatorfunktionen,
Für endliches Ω enthält σ(X1 ) beliebige Vereinigungen von Mengen der Form X −1 (x) = {X = x} :=
{ω ∈ Ω : X(ω) = x}, wobei x ∈ R.
8
Integrierbarkeit ist für endliches Ω automatisch gegeben, falls die Zufallsvariable nur endliche Werte
annimmt.
7
1.4. BEDINGTER ERWARTUNGSWERT
13
dann für Zufallsvariablen mit endlich vielen Werten, danach für allgemeine nichtnegative
und schließlich durch Zerlegung in Positiv- und Negativteil ggf. für beliebige Zufallsvariablen gezeigt wird.
Für Z = 1A mit A ∈ C gilt
Z
Z
ZdP |C = P |C (A) = P (A) = ZdP
R
R
wie gewünscht. Wegen der Linearität des Integrals gilt die Aussage ZdP |C = ZdP
daher auch für Linearkombinationen solcher Indikatoren. Nach dem Satz über monotone
Konvergenz erhalten wir sie auch für beliebige nichtnegative C -messbare Z, denn jedes solche Z lässt sich als monotoner Limes von Linearkombinationen von Indikatoren schreiben.
2. Schritt: Wir betrachten nun integrierbare X. Wir konstruieren deren bedingten Erwartungswert als
E(X|C ) := E(X + |C ) − E(X − |C ),
wobei die rechten Seiten durch den 1. Schritt bereits definiert sind. Die rechte Seite ist
offenbar C -messbar. Integrierbarkeit gilt wegen
E(|E(X + |C ) − E(X − |C )|) ≤ E(E(X + |C ) + E(X − |C ))
= E(E(X + |C )) + E(E(X − |C ))
= E(X + ) + E(X − )
= E(|X|) < ∞
Gleichung (1.2) folgt aus der Linearität des Integrals.
3. Schritt: Der Vollständigkeit halber wird noch der weniger wichtige Fall einer allgemeinen nichtnegativen Zufallsvariablen X betrachtet. Setze A := {X = ∞}. Wir definieren
Y := ∞E(1A |C ) + E(X1AC |C ), wobei die rechte Seite durch den ersten Schritt bereits
erklärt ist und wir die übliche Konvention ∞ · 0 = 0 verwenden. Offenbar ist Y nichtnegativ
und C -messbar. Sei C ∈ C . Im Fall P (C ∩ A) > 0 sind
Z
Z
Y dP ≥
∞1A dP = ∞P (C ∩ A) = ∞
C
und
C
Z
XdP ≥ ∞P (C ∩ A) = ∞,
C
so dass (1.3) gilt. Im Fall P (C ∩ A) = 0 folgt (1.3) aus
Z
Z
Z
Y dP = ∞P (C ∩ A) +
X1AC dP =
XdP.
C
C
C
4. Schritt: Es bleibt noch die Eindeutigkeit zu zeigen. Dazu seien Y, Ye zwei C -messbare
Zufallsvariablen, die die Eigenschaften des bedingten Erwartungswerts besitzen. Für n ∈ N
setze C := {Y > Ye und |Y | ∨ |Ye | ≤ n}. Dann gilt
Z
Z
Z
Z
Z
e
e
(Y − Y )dP =
Y dP −
Y dP =
XdP −
XdP = 0,
C
C
C
C
C
14
KAPITEL 1. MATHEMATISCHE HILFSMITTEL
also P (C) = 0, da Y − Ye > 0 auf C. Stetigkeit von unten impliziert P (Y > Ye ) = 0.
Analog folgt P (Y < Ye ) = 0 und somit Y = Ye fast sicher.
Definition 1.19
1. E(X|C ) heißt bedingte Erwartung von X gegeben C .
2. E(X|C ) kann durch die Festlegung E(X|C ) := E(X + |C ) − E(X − |C ) auch noch
im Falle E(|X||C ) < ∞ definiert werden.
Der bedingte Erwartungswert ist also implizit über gewünschte Eigenschaften und nicht
explizit durch eine Formel festgelegt. In abzählbaren Wahrscheinlichkeitsräumen kann aber
auch eine explizite Definition angegeben werden.
Satz 1.20 Sei C = {∪i∈J Ci : I ⊂ J}, wobei (Ci )i∈I eine abzählbare Partition von Ω ist (d.
h. die Ci sind paarweise disjunkt, und es gilt ∪i∈I Ci = Ω).9 Sei X ferner nichtnegativ oder
integrierbar. Dann ist
E(X|Ci ) falls ω ∈ Ci mit P (Ci ) > 0,
E(X|C )(ω) =
0
falls ω ∈ Ci mit P (Ci ) = 0.
Dabei ist E(X|Ci ) der Erwartungswert unter der durch A 7→
Wahrscheinlichkeitsverteilung P (·|Ci ), für den gilt
E(X|Ci ) =
P (A∩Ci )
P (Ci )
definierten bedingten
E(X1Ci )
.
P (Ci )
Beweis. Sei B ∈ B mit 0 ∈
/ B. Die in der Behauptung definierte Abbildung sei als Y
bezeichnet. Dann ist {Y ∈ B} = ∪i∈J Ci für J := {i ∈ I : P (Ci ) > 0 und E(X|Ci ) ∈ B}.
Insbesondere ist Y C -messbar. Sei nun C ∈ C , o.B.d.A. C = Ci für ein i ∈ I. Dann ist
Z
Z
Z
E(X1Ci )
Y dP =
E(X|Ci )dP = P (Ci )
=
XdP
P (Ci )
C
C
Ci
im Falle P (Ci ) > 0 und ähnlich auch für P (Ci ) = 0. Y ist offenbar nichtnegativ, falls dies
für X gilt. Im Fall E(|X|) < ∞ ist
X
X
E(|Y |) =
P (Ci )|E(X|Ci )| ≤
P (Ci )E(|X||Ci ) = E(|X|) < ∞.
i∈I
i∈I
Damit hat Y die Eigenschaften von E(X|C ).
Im folgenden Satz sind wichtige Rechenregeln für den bedingten Erwartungswert zusammengestellt.
Satz 1.21 Sei X nichtnegativ oder integrierbar. Dann gelten:
9
Wenn Ω endlich ist, hat jede σ-Algebra eine solche Form, wobei man mit endlich vielen Atomen Ci
auskommt.
1.4. BEDINGTER ERWARTUNGSWERT
15
1. E(X|C ) = X, falls X C -messbar ist.
2. E(X|C ) = E(X), falls σ(X) und C unabhängig sind.10
3. E(E(X|C )) = E(X)
4. E(E(X|C )|D) = E(X|D), falls D Unter-σ-Algebra von C ist.
5. Die Abbildung X 7→ E(X|C ) ist linear und monoton.
6. Es gilt der Satz von der monotonen Konvergenz, d. h. für jede wachsende Folge
(Xn )n∈N nichtnegativer Zufallsvariablen mit Limes X := supn∈N Xn gilt
E(Xn |C ) ↑ E(X|C ).
7. Es gilt der Satz von der majorisierten Konvergenz, d. h. für jede fast sicher konvergente Folge (Xn )n∈N von Zufallsvariablen mit Limes X und E(supn∈N |Xn |) < ∞
gilt
E(Xn |C ) → E(X|C ).
(1.4)
8. Es gilt die Jensensche Ungleichung, d. h. für integrierbares X und jede konvexe
Abbildung f : R → R derart, dass f (X) integrierbar ist, gilt
f (E(X|C )) ≤ E(f (X)|C ).
9. Für C -messbares Y 7→ R gilt E(XY |C ) = E(X|C )Y , falls die Ausdrücke sinnvoll
sind, d. h. falls X, Y ≥ 0 oder X, XY integrierbar sind. Insbesondere gilt E(XY ) =
E(E(X|C )Y ).
Beweis.
1. X hat offenbar die in der Definition geforderten Eigenschaften.
2. C -Messbarkeit sowie Nichtnegativität bzw. Integrierbarkeit des Kandidaten sind offensichtlich. Sei C ∈ C . Da X σ(X)-messbar und 1C C -messbar sind, gilt wegen der
Unabhängigkeit der σ-Algebren E(X1C ) = E(X)E(1C ) und somit
Z
Z
E(X)dP = E(X)E(1C ) = E(X1C ) =
XdP
C
C
wie gewünscht.
3. Dies gilt wegen
Z
E(E(X|C )) =
Z
E(X|C )dP =
Ω
10
d.h. falls P (A ∩ B) = P (A)P (B) für alle A ∈ σ(X), B ∈ C
XdP = E(X).
Ω
16
KAPITEL 1. MATHEMATISCHE HILFSMITTEL
4. Wir zeigen, dass der Kandidat E(E(X|C )|D) die Eigenschaften der bedingten Erwartung E(X|D) erfüllt. D-Messbarkeit gilt nach Definition. Für D ∈ D ⊂ C gilt
ferner
Z
Z
Z
E(E(X|C )|D)dP =
E(X|C )dP =
XdP
D
D
D
wie gewünscht.
5. Für Zufallsvariablen X, Y ist E(X|C ) + E(Y |C ) C -messbar: Mit
Z
Z
Z
(E(X|C ) + E(Y |C ))dP =
E(X|C )dP +
E(Y |C )dP
C
C
ZC
Z
=
XdP +
Y dP
C
C
Z
=
(X + Y )dP
C
für C ∈ C folgt, dass E(X|C ) + E(Y |C ) die Eigenschaften des bedingten Erwartungswerts E(X + Y |C ) besitzt. Analog zeigt man E(cX|C ) = cE(X|C ) für c ∈ R,
sofern cX nichtnegativ oder integrierbar ist.
Im Falle X ≤ Y zerlegen wir Y = X + (Y − X). Wegen Y − X ≥ 0 ist auch
E(Y − X|C ) ≥ 0. Aus der Additivität folgt E(Y |C ) = E(X|C ) + E(Y − X|C )
und somit E(Y |C ) ≥ E(X|C ).
6. Wegen der Monotonie der bedingten Erwartung ist (E(Xn |C ))n∈N eine aufsteigende
Folge. Offenbar ist ihr Limes Y := supn∈N E(Xn |C ) C -messbar. Es bliebt zu zeigen, dass (1.3) für beliebiges C ∈ C gilt. Nach dem üblichen Satz über monotone
Konvergenz gilt
Z
Z
Z
Z
XdP
Y dP = lim
E(Xn |C )dP = lim
Xn dP =
C
n→∞
n→∞
C
C
C
wie gewünscht.
7. Definere Y := supn∈N |Xn |, Xn0 := supk≥n Xk , Xn00 := inf k≥n Xk . Dann gilt
−Y ≤ Xn00 ≤ Xn ≤ Xn0 ≤ Y,
n ∈ N.
Für n → ∞ gilt
Y − Xn0 ↑ Y − lim sup Xn = Y − X,
n→∞
Y +
Xn00
↑ Y + lim inf Xn = Y + X.
n→∞
Nach Aussage 6 folgt
E(Y − Xn0 |C ) ↑ E(Y − X|C ),
E(Y − Xn0 |C ) ↑ E(Y − X|C )
1.4. BEDINGTER ERWARTUNGSWERT
17
und somit E(Xn0 |C ), E(Xn00 |C ) → E(X|C ). Wegen
E(Xn0 |C ) ≤ E(Xn |C ) ≤ E(Xn00 |C )
ergibt sich (1.4).
8. Konvexe Funktionen lassen sich nach Sätzen der Analysis schreiben als
f (x) = sup(an x + bn )
n∈N
mit rellen Koeffizienten an , bn . Es folgt
f (E(X|C )) = sup(an E(X|C ) + bn )
n∈N
= sup E(an X + bn |C )
n∈N
≤ E sup(an X + bn )
n∈N
= E(f (X)|C ).
9. Wir zeigen, dass der Kandidat E(X|C )Y die Eigenschaften von E(XY |C ) besitzt.
C -Messbarkeit ist klar. Für Y = 1A mit A ∈ C ist
Z
Z
Z
Z
E(X|C )Y dP =
E(X|C )dP =
XdP =
XY dP, ∀C ∈ C
C
C∩A
C∩A
C
wie gewünscht. Weiter geht es mit algebraischer Induktion. Die Formel für den
unbedintgen Erwartungswert folgt nach Eigenschaft 3.
3.11.08
Der bedingte Erwartungswert lässt sich auch als eine Orthogonalprojektion auffassen.
Satz 1.22 Sei X ∈ L2 (Ω, F , P ). Dann ist E(X|C ) die Orthogonalprojektion von X auf
den Unterraum L2 (Ω, C , P ).
Beweis. Nach der Jensenschen Ungleichung gilt (E(X|C ))2 ≤ E(X 2 |C ) und somit
E E(X|C )2 ≤ E E(X 2 |C ) = E(X 2 ) < ∞.
Da E(X|C ) C -messbar ist, gilt also E(X|C ) ∈ L2 (Ω, C , P ). Für Y ∈ L2 (Ω, C , P ) gilt
nach Satz 1.21(7) ferner
hX − E(X|C ), Y i = E((X − E(X|C ))Y )
= E(XY ) − E(E(X|C )Y )
= E(XY ) − E(XY ) = 0,
d. h. X − E(X|C ) ist orthogonal zu L2 (Ω, C , P ). Mit Satz 1.16 folgt die Behauptung. Zur Berechnung bedingter Erwartungswerte ist mitunter folgendes Resultat nützlich.
18
KAPITEL 1. MATHEMATISCHE HILFSMITTEL
Lemma 1.23 Seien Y eine Zufallsvariable und g : R × R → R eine messbare Abbildung
derart, dass g(X, Y ) nichtnegativ oder integrierbar ist. Falls X C -messbar und Y unabhängig von C ist, dann gilt:
Z
E(g(X, Y )|C ) = g(X, y)P Y (dy).11
Beweis. Sei zunächst g nichtnegativ. Im Zusammenhang mit dem Satz von Fubini wird geR
zeigt, dass die Abbildung x 7→ g(x, y)P Y (dy) Borel-messbar ist. Somit ist auch die ZuR
fallsvariable g(X, y)P Y (dy) als Verkettung zweier messbarer Abbildungen C -messbar.
Für C ∈ C definiere Z := 1C . Da (X, Z) unabhängig von Y ist, gilt P (X,Z) ⊗ P Y =
P (X,Z,Y ) . Mit dem Transformationssatz und dem Satz von Fubini folgt
R R
C
g(X, y)P Y (dy)dP =
RR
g(X, y)ZP Y (dy)dP
=
RR
g(x, y)zP Y (dy)P (X,Z) (d(x, z))
=
R
g(x, y)zP (X,Z,Y ) (d(x, z, y))
=
R
g(X, Y )ZdP
=
R
g(X, Y )dP,
C
woraus die Behauptung folgt.
Der Beweis für integrierbares g(X, Y ) verläuft analog. Die Integrierbarkeit des Kandidaten folgt mit der obigen Rechnung angewandt auf |g(X, Y )| und C = Ω:
R
R
E(| g(X, y)P Y (dy)|) ≤ E( |g(X, y)|P Y (dy)) = E(|g(X, Y )|) < ∞.
Bezeichnung. E(X|Y ) := E(X|σ(Y )) für messbare Abbildungen Y : (Ω, F ) → (Γ, G )
mit Werten in einem messbaren Raum (Γ, G ).
Die Eigenschaft C -Messbarkeit der bedingten Erwartung ist intuitiv so zu verstehen,
dass E(X|C ) durch die Information in C determiniert ist. Wenn nun die σ-Algebra C von
einer Zufallsvariablen Y erzeugt ist, sollte man erwarten, dass sich E(X|C ) als Funktion
von Y schreiben lässt. Die folgende Bemerkung zeigt, dass dies in der Tat der Fall ist.
Lemma 1.24 Sei Y : (Ω, F ) → (Γ, G ) mit Werten in einem messbaren Raum (Γ, G ). Dann
ist X genau dann σ(Y )-messbar, wenn es eine messbare Abbildung g : (Γ, G ) → (R, B)
gibt mit X = g ◦ Y .
11
Das bedeutet im endlichen Fall
E(g(X, Y )|C )(ω) =
X
y∈R
g(X(ω), y)P (Y = y).
1.4. BEDINGTER ERWARTUNGSWERT
19
Beweis. ⇒: Im Falle X = 1C bedeutet C -Messbarkeit, dass C ∈ σ(Y ) = Y −1 (G ) ist, also
C = Y −1 (G) für ein G ∈ G . Somit ist X = 1G (Y ) = g ◦ Y für g := 1G . Weiter geht es mit
„algebraischer Induktion“.
⇐: Dies gilt, da die Verkettung messbarer Abbildung messbar ist.
Kapitel 2
Diskrete stochastische Analysis
In der stochastischen Finanzmathematik fasst man Wertpapierkursverläufe, wie man sie in
der Zeitung oder auf dem Bildschirm verfolgen kann, als stochastische Prozesse, d. h. als
zufällige Funktionen der Zeit, auf. Auch die variierende Zahl der Wertpapiere im Anlageportfolio sowie das daraus resultierende Anlagevermögen fallen in diesen Rahmen. Die zugehörigen mathematischen Begriffe, die auch ganz unabhängig von der Finanzmathematik
angewandt werden, werden in diesem Kapitel vorgestellt. Wir beschränken uns dabei an dieser Stelle auf eine diskrete Menge von Zeitpunkten (etwa Tage, Minuten, Sekunden). Der
kontinuierliche Fall erfordert eine erheblich kompliziertere Theorie.
2.1
Stochastische Prozesse
Wie schon im vorigen Kapitel angedeutet, spielt die bis zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung stehende Information eine wichtige Rolle. Entscheidungen wie z. B. der Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren können ja nur auf dem derzeitigen Wissen über den Zustand des
Finanzmarktes oder der Welt gründen. Mathematisch wird diese Information durch den Begriff der Filtrierung ausgedrückt.
Definition 2.1 Eine Filtrierung (Fn )n∈N auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, F , P )
ist eine Folge von σ-Algebren Fn ⊂ F mit Fm ⊂ Fn für m ≤ n. (Ω, F , (Fn )n∈N , P )
heißt filtrierter Wahrscheinlichkeitsraum.
Die σ-Algebra Fn steht für die bis zur Zeit n angesammelte Information. A ∈ Fn bedeutet,
dass wir schon zur Zeit n wissen, ob das Ereignis A eintritt oder nicht.
Von nun an sei ein filtrierter Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, F , (Fn )n∈N , P ) gegeben.
Definition 2.2
1. Ein stochastischer Prozess X = (Xn )n∈N ist eine Familie von Zufallsvariablen.
2. Ein Prozess X heißt adaptiert, falls Xn Fn -messbar ist für alle n ∈ N.
20
2.1. STOCHASTISCHE PROZESSE
21
Das n steht dabei wie oben schon für einen Zeitparameter. Ein stochastischer Prozess beschreibt also den zufälligen Zustand eines Systems durch die Zeit hindurch. Der Wertebereich von Xn ist üblicherweise R oder allgemeiner Rd , etwa wenn es sich bei Xn um den
Kurs eines oder mehrerer Wertpapiere zum Zeitpunkt n handelt. Falls nichts anderes vermerkt ist, nehmen wir alle Prozesse als reellwertig an.
Adaptiertheit bedeutet, dass wir den derzeitigen Wert des Prozesses kennen, zumindest
insofern, als er von zufälligen Einflüssen abhängt. Insbesondere ist jeder deterministische
Prozess adaptiert. Wir betrachten ab jetzt fast ausschließlich solche adaptierten Prozesse.
Bemerkung. Wir identifizieren einen Prozess X manchmal auch mit einer Abbildung
X : Ω × N → R (bzw. Rd ) oder einer Abbildung X : Ω → RN (bzw. (Rd )N ). Er kann also
auch als Zufallsvariable aufgefasst werden, deren Werte Funktionen N → R (bzw. Rd ) sind.
Bezeichnung.
1. Adaptierte Prozesse nennen wir auch diskrete Semimartingale.
2. Wir benutzen die Notation n− := n − 1 für n ∈ N \ {0}, 0− := 0. Ferner sei
∆Xn := Xn − Xn− .
Hier wie auch später im Text verwenden wir vergleichsweise hochtrabende Bezeichnungen
für ganz einfache Dinge (z. B. stochastisches Integral für eine Summe usw.). Die Idee ist,
eine möglichst weitgehende Analogie zur allgemeinen stochastischen Analysis zu erzielen,
wo die entsprechenden Begriffe und Ergebnisse oft einen hohen technischen Aufwand erfordern. Die hier behandelten zeitdiskreten Resultate lassen sich auch als Spezialfälle der
allgemeinen Semimartingaltheorie auffassen.
Etwas stärker als Adaptiertheit ist der folgende Begriff.
Definition 2.3 Ein Prozess X heißt vorhersehbar, falls Xn Fn− -messbar ist für alle n ∈ N.
Das bedeutet, dass der Wert von Xn ist schon kurz vor dem Zeitpunkt n bekannt ist. Vorhersehbare Prozesse spielen bei der stochastischen Integration eine zentrale Rolle.
Bislang ist offen, welche Gestalt die Filtrierung tatsächlich besitzt. Denkbar ist zumindest im Rahmen des mathematischen Modells, dass unser ganzes nicht-deterministisches
Wissen aus der Beobachtung eines einzigen stochastischen Prozesses X, etwa eines Aktienkursverlaufs, herrührt:
Definition 2.4 Die Filtrierung (Fn )n∈N heißt von dem Prozess X erzeugt, falls Fn =
σ(X0 , . . . , Xn ) für alle n ∈ N.
Zufällige Zeitpunkte, die nur insofern nicht deterministisch sind, als sie von zufälligen
Ereignissen in der Vergangenheit abhängen können, heißen Stoppzeiten.
Definition 2.5 Eine Stoppzeit ist eine Abbildung T : Ω → N ∪ {∞} mit {T ≤ n} ∈ Fn
für alle n ∈ N.
22
KAPITEL 2. DISKRETE STOCHASTISCHE ANALYSIS
Eine äquivalente Definition ist {T = n} ∈ Fn für alle n ∈ N. Anschaulich heißt das,
dass wir aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Information Fn zu jedem Zeitpunkt
n entscheiden können, ob wir „Stopp!“ sagen müssen oder nicht. Eine Stoppzeit ist z. B.
der erste Zeitpunkt, zu dem ein Vulkan ausbricht, sofern die Beobachtung des Vulkans in
der Informationsstruktur (Fn )n∈N enthalten ist. Auch jeder deterministische Zeitpunkt ist
eine Stoppzeit. Keine Stoppzeit ist hingegen der Zeitpunkt genau 3 Stunden vor dem Vulkanausbruch, denn dazu müsste man in die Zukunft blicken können. Auf Grundlage der
im Augenblick vorhandenen Information ist i. a. nicht sicher, ob dieser Zeitpunkt schon
gekommen ist.
Ein typisches Beispiel einer Stoppzeit ist die erste Eintrittszeit eines Prozesses in eine
Menge, etwa der Zeitpunkt, an dem der Aktienindex DAX zum ersten Mal die Schwelle
4000 überwindet.
Lemma 2.6 Sei X ein Rd -wertiges diskretes Semimartingal und B ∈ B d . Dann ist T :=
inf{n ∈ N : Xn ∈ B} eine Stoppzeit.
Beweis. Sei n ∈ N. Dann ist {T
{Xm ∈ B} ∈ Fm ⊂ Fn für m ≤ n.
≤ n} = ∪m≤n {Xm
∈ B} ∈ Fn , da
Für das „Einfrieren“ eines Prozesses ab einem gewissen Zeitpunkt gibt es einen eigenen
mathematischen Begriff.
Definition 2.7 Für einen Prozess X und eine Stoppzeit T ist der bei T gestoppte Prozess
X T definiert durch XnT := XT ∧n .
Ein gestoppter Prozess bleibt also ab der zugehörigen Stoppzeit konstant.
2.2
Martingale
Der Martingalbegriff ist von zentraler Bedeutung für die stochastische Analysis. Auch die
moderne Finanzmathematik wird in vielfältiger Weise von ihm durchdrungen.
Definition 2.8 Ein Martingal (bzw. Submartingal, Supermartingal) ist ein adaptierter
stochastischer Prozess X derart, dass E(|Xn |) < ∞1 und E(Xn |Fm ) = Xm (bzw. ≥ Xm ,
≤ Xm ) für alle m, n ∈ N mit m ≤ n.
5.11.08
Man kann sich unter einem Martingal z. B. das Spielkapital in einem fairen Spiel vorstellen. Als Beispiel sei etwa ein Roulettespiel betrachtet, wo der Einsatz bei Fallen von Rot
verdoppelt wird. Wir setzen über mehrere Ausspielungen hinweg 1 e auf Rot und bezeichnen den Spielkapitalprozess als X. Wenn nun Rot mit Wahrscheinlichkeit 21 fällt, dann sind
wir nach jeder Ausspielung im Mittel so reich wie vorher, d. h. X ist ein Martingal. Für die
(beschränkte) Zukunft ist im Mittel weder ein Gewinn noch ein Verlust zu erwarten.
1
Integrierbarkeit gilt für endliches Ω automatisch.
2.2. MARTINGALE
23
In Wirklichkeit ist das Roulettespiel unfair zu Gunsten der Spielbank, da nur mit Wahrscheinlichkeit 18
Rot fällt. Daher entsprechen die realen Gegebenheiten eher einem Super37
martingal. Anlagen in risikobehaftete Wertpapiere wie etwa Aktien hingegen werden die
meisten Anleger nur tätigen wollen, wenn zumindest im Mittel ein Gewinn zu erwarten ist,
d. h. wenn es sich um Submartingale handelt.
Lemma 2.9 Anstelle von E(Xn |Fm ) = Xm (bzw. ≥, ≤) für m ≤ n reicht es in der vorigen
Definition zu zeigen, dass E(Xn |Fn−1 ) = Xn−1 (bzw. ≥, ≤) für alle n ∈ N \ {0}.
Beweis. Wegen E(Xn |Fn−2 ) = E(E(Xn |Fn−1 )|Fn−2 ) usw. folgt dies mit vollständiger
Induktion.
Die einfachsten Martingale erhält man, indem man unabhängige, zentrierte Zufallsvariablen sukzessive aufsummiert.
Beispiel 2.10 Sei X1 , X2 , . . . eine Folge unabhängiger, integrierbarer Zufallsvariablen mit
P
E(Xn ) = 0 für n = 1, 2, . . . Dann wird durch Sn := nm=1 Xm und Fn := σ(X1 , . . . , Xn )
ein Martingal S bzgl. (Fn )n∈N definiert.
Beweis. Adaptiertheit und Integrierbarkeit sind offensichtlich. Die Martingaleigenschaft gilt
wegen
!
n−1
n−1
X
X
E(Sn |Fn−1 ) = E
Xm |Fn−1 + E(Xn |Fn−1 ) =
Xm + 0 = Sn−1 ,
m=1
m=1
da X1 , . . . , Xn−1 Fn−1 -messbar und Xn unabhängig von Fn−1 sind.
Auch aus einer einzigen Zufallsvariablen kann man ein Martingal erzeugen.
Lemma 2.11 Sei Y eine Zufallsvariable mit E(|Y |) < ∞. Dann wird durch Xn :=
E(Y |Fn ) für n ∈ N ein Martingal X definiert (das von Y erzeugte Martingal).
Beweis. Die Adaptiertheit ist offensichtlich. Die Integrierbarkeit folgt aus der Jensenschen
Ungleichung wegen E(|Xn |) ≤ E(|E(Y |Fn )|) ≤ E(E(|Y ||Fn )) = E(|Y |) < ∞. Ferner
gilt E(Xn |Fm ) = E(E(Y |Fn )|Fm ) = E(Y |Fm ) = Xm für m ≤ n.
Umgekehrt kann man sich fragen, ob jedes Martingal von einer Zufallsvariablen erzeugt
wird. Das hieße, dass man die Menge der Martingale mit der Menge der integrierbaren Zufallsvariablen identifizieren könnte. Das ist jedoch im allgemeinen nicht der Fall, sondern
nur unter einer zusätzlichen gleichgradigen Integrabiliätsbedingung oder wenn die Zeitindexmenge (hier N) nach oben beschränkt ist, wie es in den folgenden Kapiteln der Fall sein
wird.
Beispiel 2.12 Sei Q ∼ P ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Dann heißt das von
dQ|
Martingal Z der Dichteprozess von Q bzgl. P , und es gilt Zn = dP |FFn .
n
dQ
dP
erzeugte
24
KAPITEL 2. DISKRETE STOCHASTISCHE ANALYSIS
Beweis. Für C ∈ Fn gilt
Z
Z
Z
dQ
Zn dP |Fn =
Zn dP =
dP = Q(C) = Q|Fn (C).
C
C
C dP
Somit erfüllt Zn die Eigenschaften einer Dichte von Q|Fn bezüglich P |Fn
Lemma 2.12a (Verallgemeinerte Bayessche Formel) Sei Q ∼ P ein Wahrscheinlichkeitsmaß mit Dichteprozess Z. Für n ∈ N sei X eine Fn -messbare, nichtnegative oder Qintegrierbare Zufallsvariable. Für m ≤ n gilt dann
EQ (X|Fm ) =
E(XZn |Fm )
.
Zm
Beweis. Wir zeigen, dass EQ (X|Fm )Zm die Eigenschaften von E(XZn |Fm ) besitzt. Fm Messbarkeit und ggf. Nichtnegativität sind offensichtlich. Falls X Q-integrierbar ist, gilt
E(|XZn |) = E(|X|Zn ) = EQ (|X|) < ∞,
da Zn Dichte von Q auf Fn ist. Für C ∈ Fn gilt ferner
Z
Z
Z
Z
EQ (X|Fm )Zm dP =
EQ (X|Fm )dQ =
XdQ =
XZn dP
C
C
C
C
wie gewünscht, da Zm , Zn Dichten von Q auf Fm bzw. Fn sind.
Wenn man in Lemma 2.9 auf die Integrierbarkeit der Xn verzichtet, erhält man die etwas
größere Klasse der lokalen Martingale.
Definition 2.13 Ein lokales Martingal ist ein adaptierter Prozess X mit E(|X0 |) < ∞
sowie E(|Xn ||Fn−1 ) < ∞ und E(Xn |Fn−1 ) = Xn−1 für alle n ∈ N \ {0}.2
Der Begriff des lokalen Martingals ist weniger intuitiv als der des Martingals, lässt sich aber
in der stochastischen Analysis oft nicht umgehen, da er größere Stabiltät unter Operationen
wie stochastischer Integration besitzt. Ein häufig auftretendes Problem besteht darin zu zeigen, dass ein vorliegendes lokales Martingal ein wirkliches Martingal ist (vgl. auch Lemma
2.25).
Lemma 2.14 Jedes nichtnegative lokale Martingal ist ein Martingal.
Beweis. Es ist nur die Integrierbarkeit zu zeigen, die wegen
E(|Xn |) = E(Xn ) = E(E(Xn |Fn−1 )) = E(Xn−1 ) = E(|Xn−1 |)
induktiv folgt.
2
ist.
Für endliches Ω fallen Martingale und lokale Martingale zusammen, da jede Zufallsvariable integrierbar
2.3. STOCHASTISCHES INTEGRAL
25
Lemma 2.15 Seien X, Y lokale Martingale und N ∈ N mit XN = YN . Dann gilt Xn = Yn
für n = 0, . . . , N .
Beweis. Dies folgt induktiv für n = N, N − 1, . . . , 0.
Lokale Martingale sind also durch ihren Wert in der Zukunft schon zu jedem früheren
Zeitpunkt determiniert. Dies gilt allerdings nur in diskreter Zeit.
Wie wir gesehen haben, erwartet man bei einem Martingal für die Zukunft im Mittel den
heutigen Wert. Ein allgemeiner Prozess hingegen könnte einen positiven, negativen oder
auch wechselnden Trend aufweisen. Dies wird durch die Doobsche Zerlegung formalisiert.
Sie zerlegt den Zuwachs ∆Xn eines beliebigen Prozesses in einen kurzfristigen, vorhersehbaren Trend ∆An und eine zufällige Abweichung ∆Mn von diesem Trend.
Satz 2.16 (Doob-Zerlegung) Sei X ein diskretes Semimartingal mit E(|Xn | < ∞) für alle
n ∈ N. Dann lässt sich X fast sicher eindeutig in der Form
X = X0 + M + A
zerlegen, wobei M ein Martingal mit M0 = 0 und A ein vorhersehbarer Prozess mit A0 = 0
sind. A heißt Kompensator von X.
P
Beweis. Definiere An := nm=1 E(∆Xm |Fm−1 ) und M := X − X0 − A. Dann ist ∆Mn =
∆Xn − E(∆Xn |Fn−1 ). Offensichtlich ist M adaptiert, integrierbar und E(∆Mn |Fn−1 ) =
0, woraus die Martingaleigenschaft folgt.
Umgekehrt sei X = X0 + M + A eine beliebige Zerlegung wie im Satz. Wegen der
Vorhersehbarkeit von A und der Martingaleigenschaft von M gilt dann
∆An = E(∆An |Fn−1 ) = E(∆Xn |Fn−1 ) − E(∆Mn |Fn−1 ) = E(∆Xn |Fn−1 )
für alle n, woraus die Eindeutigkeit folgt.
Bemerkung. Falls X ein Submartingal (bzw. Supermartingal) ist, dann ist A monoton wachsend (bzw. fallend).
2.3
Stochastisches Integral
Der zentrale Begriff der stochastischen Analysis ist das stochastische Integral, das im Zeitdiskreten nichts anderes als eine Summe ist.
Definition 2.17 Sei X ein Rd -wertiges diskretes Semimartingal und H ein Rd -wertiger vorhersehbarer (oder zumindest adaptierter) Prozess. Unter dem stochastischen Integral von
H nach X versteht man das folgendermaßen definierte diskrete Semimartingal H • X:
Z n
n
X
>
•
H Xn :=
Hm dXm :=
Hm
∆Xm .
(2.1)
0
m=1
26
KAPITEL 2. DISKRETE STOCHASTISCHE ANALYSIS
Motivieren lässt sich das stochastische Integral sehr schön durch die folgende finanzmathematische Anschauung, auch wenn es davon unabhängig entwickelt wurde. Dazu fassen wir,
wie wir es auch in den folgenden Kapiteln tun werden, X als den Kursverlauf einer Aktie
und Hn als die Anzahl an Aktien auf, die wir zur Zeit n besitzen. Durch die Kursänderung
der Aktie zwischen n − 1 und n ändert sich nun unser Anlagevermögen, nämlich gerade um
Hn (Xn − Xn−1 ) = Hn ∆Xn . Das Integral H • Xn steht also für die kumulativen Handelsgewinne oder -verluste zwischen den Zeitpunkten 0 und n, wie sie sich aus Kursänderungen
(und nicht etwa durch Kauf oder Verkauf von Wertpapieren) ergeben. Wenn wir ein Portfolio aus mehreren Aktien besitzen, werden X und H vektorwertig. Hni steht in diesem Fall
für die Anzahl an Aktien vom Typ i und Xni für deren Kurs. Die Handelsgewinne zwischen
n − 1 und n ergeben sich nunmehr als Skalarprodukt Hn> (Xn − Xn−1 ) = Hn> ∆Xn . Auch
im vektorwertigen Fall lässt sich also das Integral H • Xn als kumulativer Handelsgewinn
auffassen.
Bei der obigen Interpretation muss man jedoch sehr vorsichtig sein, in welcher Reihenfolge sich die Dinge zum Zeitpunkt n ereignen. Wenn wir Hn (Xn − Xn−1 ) als den Kursgewinn zum Zeitpunkt n deuten, bedeutet dies offenbar, dass wir unser Portfolio Hn gekauft
haben, bevor sich der Aktienkurs von Xn−1 nach Xn geändert hat, also gewissenmaßen am
Ende des vorigen Zeitpunkts n − 1, nachdem sich der Preis Xn−1 schon eingestellt hatte.
Daher erscheint es plausibel, dass wir zur Wahl von Hn auch nur die bis zum Zeitpunkt
n − 1 gesammelte Information verwenden können und insbesondere nicht den Wert Xn ,
der für uns im Augenblick des Kaufs des Portfolios noch im Dunkeln liegt. Dies motiviert
auch zumindest aus finanzmathematischer Sicht, warum man sich überwiegend auf die Betrachtung vorhersehbarer Integranden beschränkt. Denn um die Adaptiertheit von H • X zu
gewährleisten, würde ja die Adaptiertheit von H reichen.
Definition 2.18 Seien X, Y reellwertige diskrete Semimartingale. Unter der Kovariation
von X und Y versteht man das durch
[X, Y ]n :=
n
X
∆Xm ∆Ym
m=1
definierte diskrete Semimartingal [X, Y ]. Im Falle X = Y spricht man von der quadratischen Variation von X.
10.11.08
Die Kovariation ist — zumindest im zeitdiskreten Fall — vor allem für die Regel der partiellen Integration (vgl. Lemma 2.20) von Interesse.
Definition 2.19 Seien X, Y Martingale (oder allgemeiner diskrete Semimartingale) derart,
dass E(|[X, Y ]|n ) < ∞ für alle n ∈ N. Dann heißt der Kompensator von [X, Y ] vorhersehbare Kovariation von X und Y und wird mit hX, Y i bezeichnet. Im Falle X = Y spricht
man wieder von der vorhersehbaren quadratischen Variation von X.
Bemerkung. Offenbar ist ∆hX, Y in = E(∆Xn ∆Yn |Fn−1 ) für n ∈ N.
2.3. STOCHASTISCHES INTEGRAL
27
Die vorhersehbare quadratische Kovariation von Martingalen kann als eine Art dynamische Verallgemeinerung der Kovarianz zentrierter Zufallsvariablen aufgefasst werden. Wir
benötigen sie aus technischen Gründen für den Satz von Girsanow (Lemma 2.27) und im
Zusammenhang mit finanzmathematischen Fragestellungen in Kapitel 5.2.
Lemma 2.20 Seien X, Y diskrete Semimartingale und H, K vorhersehbare Prozesse. Dann
gelten:
1. H • (K • X) = (HK) • X
2. [H • X, Y ] = H • [X, Y ]
3. die Regel der partiellen Integration:
XY
= X 0 Y0 + X− • Y + Y
•
X
(2.2)
= X0 Y0 + X− • Y + Y− • X + [X, Y ]
(2.3)
4. Falls E(|[X, Y ]n |) < ∞ und E(|[H • X, Y ]n |) < ∞ für alle n ∈ N, ist
hH • X, Y i = H • hX, Y i.
5. Wenn X ein lokales Martingal ist, dann ist H • X ein lokales Martingal.
6. Wenn X ein Martingal und H beschränkt sind, dann ist H • X ein Martingal.
7. Wenn X ein Supermartingal und H nichtnegativ und beschränkt sind, dann ist H • X
ein Supermartingal.
8. Wenn X ein Martingal und T eine Stoppzeit sind, dann ist auch X T ein Martingal.
9. Wenn X ein Supermartingal und T eine Stoppzeit sind, dann ist auch X T ein Supermartingal.
Intuitiv bedeuten die beiden letzten Regeln, dass ein gestopptes faires (bzw. ungünstiges)
Spiel fair (bzw. ungünstig) bleibt. Man kann also bei dem oben betrachteten Roulettespiel
den mittleren Gewinn nicht dadurch steigern, dass man zu einem geschickt gewählten
Zeitpunkt das Spielkasino verlässt.
Beweis. 1. H • (K • X)n =
2. Für festes n gilt
Pn
m=1
Hm ∆(K • X)m =
[H • X, Y ]n =
Pn
=
Pn
=
Pn
m=1 ∆(H
Pn
m=1
•
Hm Km ∆Xm = (HK) • Xn
X)m ∆Ym
m=1 Hm ∆Xm ∆Ym
m=1 Hm ∆[X, Y ]m
= H • [X, Y ]n .
28
KAPITEL 2. DISKRETE STOCHASTISCHE ANALYSIS
3. Für festes n gelten
Xn Yn = X0 Y0 +
Pn
= X0 Y0 +
Pn
m=1 (Xm Ym
− Xm−1 Ym−1 )
m=1 (Xm−1 (Ym
= X0 Y0 + X− • Yn + Y
•
− Ym−1 ) + Ym (Xm − Xm−1 ))
Xn
und
Y
•
Xn =
Pn
=
Pn
m=1 Ym ∆Xm
m=1 (Ym−1 ∆Xm
+ (Ym − Ym−1 )∆Xm )
= Y− • Xn + [X, Y ]n .
4. Es reicht zu zeigen, dass die Zuwächse übereinstimmen. Dies gilt wegen
∆(H • hX, Y in ) = Hn ∆hX, Y in
= Hn E(∆[X, Y ]n |Fn−1 )
= E(Hn ∆[X, Y ]n |Fn−1 )
2.
= E(∆[H • X, Y ]n |Fn−1 )
= ∆hH • X, Y in .
5. Die Adaptiertheit von H • X ist klar, da H
messbarer Zufallsvariabler ist. Für n ∈ N \ {0} ist
•
Xn eine Linearkombination Fn -
E(|H • Xn ||Fn−1 ) = E(|H • Xn−1 + Hn ∆Xn ||Fn−1 )
≤ E(|H • Xn−1 | + |Hn ||∆Xn ||Fn−1 )
= |H • Xn−1 | + |Hn |E(|∆Xn ||Fn−1 )
fast sicher endlich, da X ein lokales Martingal ist. Die Martingalbedingung folgt wegen
E(H • Xn |Fn−1 ) = E(H • Xn−1 + Hn ∆Xn |Fn−1 )
= H • Xn−1 + Hn E(∆Xn |Fn−1 )
aus der lokalen Martingaleigenschaft von X.
6. Im Lichte der vorigen Eigenschaft ist nur noch die Integrierbarkeit von H • Xn zu
P
P
zeigen. Diese folgt wegen |H • Xn | = | nm=1 Hm ∆Xm | ≤ nm=1 |Hm |(|Xm | + |Xm−1 |)
aus der Integrierbarkeit der Xn .
7. Dies folgt analog zu 6.
8.,9. Definiere den Prozess H durch Hn := 1{T ≥n} . H ist vorhersehbar, denn für festes
n ist {Hn = 1} = {T ≥ n} = {T ≤ n − 1}C ∈ Fn− . Ferner ist X T = X0 + H • X, denn
P
T
X0 + H • Xn = X0 + n∧T
m=1 ∆Xm = Xn∧T = Xn . Mit Eigenschaft 6 bzw. 7 folgt die
Behauptung.
2.3. STOCHASTISCHES INTEGRAL
29
Bemerkung.
1. Das stochastische Integral H • X ist linear in H und X.
2. Die Kovariation [X, Y ] und die vorhersehbare Kovariation hX, Y i sind linear in X
und Y .
3. Die obigen Aussagen gelten auch für vektorwertige Prozesse, sofern sich sinnvolle
Aussagen ergeben. Z. B. ist H • (K • X) = (HK) • X, falls K, X Rd -wertig sind.
Die Itô-Formel ist im Zeitdiskreten nichts anderes als eine mehr oder weniger kompliziert aufgeschriebene Teleskopsumme und spielt auch keine große Rolle. In der zeitstetigen
Analysis ist sie dagegen von zentraler Bedeutung, weswegen wir sie hier der Vollständigkeit
halber ebenfalls erwähnen.
Satz 2.21 (Itô-Formel) Seien X ein Rd -wertiges diskretes Semimartingal und f : Rd → R
eine differenzierbare Funktion. Dann ist f (X) ein diskretes Semimartingal, und es gilt:
f (Xn ) = f (X0 ) +
n
X
(f (Xm ) − f (Xm− ))
m=1
= f (X0 ) + (Df (X− )) • Xn +
n X
f (Xm ) − f (Xm− ) − Df (Xm− )> ∆Xm
m=1
Beweis. durch einfaches Nachrechnen.
Bemerkung. Wenn die Sprünge ∆X „klein“ sind und f zweifach stetig differenzierbar ist,
dann gilt näherungsweise
d
X
1
f (Xn ) ≈ f (X0 ) + (Df (X− )) • Xn +
D2 f (X− ) • [X i , X j ]n
2 i,j=1 ij
(2.4)
(d. h. f (Xn ) ≈ f (X0 ) + f 0 (X− ) • Xn + 12 f 00 (X− ) • [X, X]n für reellwertiges X).
Beweis. Die Näherungsformel folgt mit einer Taylorentwicklung 2. Ordnung:
2
f (Xn ) ≈ f (Xn− ) + Df (Xn− )> ∆Xn + 21 Dij
f (Xn− )∆Xni ∆Xnj .
Stochastische Exponentiale sind Prozesse von multiplikativer Gestalt und spielen in der
stochastischen Analysis eine wichtige Rolle. Sie lassen sich gut finanzmathematisch illustrieren: Wenn ∆Xn als Zins zwischen den Zeitpunkten n − 1 und n ausgeschüttet wird
(d. h. aus 1 e bei n − 1 werden 1 + ∆Xn e zur Zeit n), dann gibt E (X) an, wie sich ein
Anfangskapital von 1 e durch die Zeit hindurch mit Zins und Zinseszins entwickelt.
Definition 2.22 Sei X ein reellwertiges diskretes Semimartingal. Unter dem stochastischen Exponential E (X) versteht man das diskrete Semimartingal Z, das die Gleichung
Z = 1 + Z− • X
löst.
30
KAPITEL 2. DISKRETE STOCHASTISCHE ANALYSIS
Für das stochastische Exponential gibt es eine einfache explizite Darstellung.
Q
Lemma 2.23 Es gilt E (X)n = nm=1 (1 + ∆Xm ).
Beweis. Die Produktdarstellung zeigt man induktiv via
Zn = Zn−1 + Zn−1 ∆Xn =
Qn−1
m=1 (1
+ ∆Xm )(1 + ∆Xn ) =
Qn
m=1 (1
+ ∆Xn ).
12.11.08
Bemerkung.
1. Wenn die Sprünge ∆X „klein“ sind, dann gilt näherungsweise
1
E (X)n ≈ exp Xn − X0 − [X, X]n .
2
(2.5)
Beweis. In der Näherung o((∆Xm )2 ) ≈ 0 gilt
Q
exp(Xn − X0 − 12 [X, X]n ) = nm=1 exp(∆Xm ) exp(− 12 (∆Xm )2 )
Qn
1
1
2
2
2
2
=
m=1 (1 + ∆Xm + 2 (∆Xm ) + o((∆Xm ) )(1 − 2 (∆Xm ) + o((∆Xm ) ))
Qn
1
1
2
2
2
=
m=1 (1 + ∆Xm + 2 (∆Xm ) − 2 (∆Xm ) + o((∆Xm ) ))
Qn
≈
m=1 (1 + ∆Xm ) = E (X)n .
2. Wenn X ein lokales Martingal ist, so gilt dies nach Lemma 2.20(5) auch für E (X).
In der folgenden Rechenregel für das stochastische Exponential taucht im Vergleich zur
gewöhnlichen Exponentialfunktion noch ein Kovariationsterm auf.
Lemma 2.24 (Yorsche Fomel) Für diskrete Semimartingale X, Y gilt
E (X)E (Y ) = E (X + Y + [X, Y ]).
Beweis. Nach Lemma 2.20 gilt
E (X)E (Y ) = E (X)0 E (Y )0 + E (X)− • E (Y ) + E (Y )− • E (X) + [E (X), E (Y )]
= 1 + (E (X− )E (Y− )) • Y + (E (X− )E (Y− )) • X + (E (X− )E (Y− )) • [X, Y ]
= 1 + (E (X)E (Y ))− • (Y + X + [X, Y ])
und damit die Behauptung.
Im Fall zeitlich homogener Prozesse fallen die Begriffe Martingal und lokales Martingal
zusammen.
Lemma 2.25 Sei X ein diskretes Semimartingal mit X0 = 0 und derart, dass die Zuwächse
∆Xn für n = 1, 2, . . . identisch verteilt und unabhängig von Fn−1 sind. Wenn X (bzw.
E (X)) ein lokales Martingal ist, dann ist X (bzw. E (X)) ein Martingal.
2.3. STOCHASTISCHES INTEGRAL
31
Beweis. Sei zunächst X ein lokales Martingal. Dann ist E(|∆Xn |) = E(|∆Xn ||Fn−1 ) <
∞. Daher ist auch E(|Xn |) < ∞ und somit X ein Martingal.
Sei nun E (X) ein lokales Martingal. Dann ist
E(|∆X1 |) = E(|∆X1 ||F0 ) = E(|∆E (X)1 ||F0 ) < ∞
und somit
E(|E (X)n |) = E
n
Y
m=1
n
Y
|1 + ∆Xm | =
E(|1 + ∆Xm |) = (E(|1 + ∆X1 |))n < ∞.
m=1
Es folgt, dass E (X) ein echtes Martingal ist.
Da die Definition des Martingals einen Erwartungswert beinhaltet, ist sie nicht invariant
unter Wechsel des Wahrscheinlichkeitsmaßes. Der folgende Satz zeigt, wie man anhand des
Dichteprozesses feststellen kann, ob ein Prozess ein Martingal unter einem gegebenen äquivalenten Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Solche Maßwechsel, unter denen gewisse Prozesse zu
Martingalen werden, spielen in der Finanzmathematik eine wichtige Rolle.
Lemma 2.26 Sei Q ∼ P ein Wahrscheinlichkeitsmaß mit Dichteprozess Z, und sei X ein
diskretes Semimartingal. X ist genau dann ein (lokales) Q-Martingal, wenn XZ ein (lokales) P -Martingal ist.
Beweis. Die Adaptiertheit ist klar. Nach der verallgemeinerten Bayesschen Formel (Lemma
2.12a) gilt
Zn−1 EQ (|Xn ||Fn−1 ) = EP (|Zn Xn ||Fn−1 ),
d. h. EQ (|Xn ||Fn−1 ) ist genau dann endlich, wenn EP (|Zn Xn ||Fn−1 ) endlich ist. Ebenfalls
aus der verallgemeinerten Bayesschen Formel ergibt sich
Zn−1 EQ (Xn |Fn−1 ) = EP (Zn Xn |Fn−1 ).
X ist genau dann ein lokales Q-Martingal, wenn die linke Seite für n = 1, 2, . . . mit
Zn−1 Xn−1 übereinstimmt. Analog ist ZX ist genau dann ein lokales P -Martingal, wenn
die rechte Seite für n = 1, 2, . . . mit Zn−1 Xn−1 übereinstimmt. Somit folgt die Äquivalenz
für lokale Martingale.
Die entsprechende Aussage für Martingale ergibt sich aus der Betrachtung der Integrabilität:
EQ (|Xn |) = EP ( dQ
|Xn |) = EP (EP ( dQ
|Fn )|Xn |) = EP (|Zn Xn |).
dP
dP
Der Satz von Girsanow liefert die Doob-Zerlegung eines P -Martingals unter einem äquivalenten Wahrscheinlichkeitsmaß Q in Abhängigkeit des Dichteprozesses von Q.
32
KAPITEL 2. DISKRETE STOCHASTISCHE ANALYSIS
Lemma 2.27 (Girsanow) Sei Q ∼ P ein Wahrscheinlichkeitsmaß mit Dichteprozess Z.
Ferner sei X ein Martingal mit X0 = 0 und E(|[Z, X]n |) < ∞ für alle n ∈ N. Dann ist
X−
1
Z−
•
hZ, Xi
ein Q-lokales Martingal, wobei die vorhersehbare Kovariation bzgl. des Wahrscheinlichkeitsmaßes P zu verstehen ist.
Beweis. Für C := {Zn = 0} gilt
Q(C) = EP ( dQ
1 ) = EP (Zn 1C ) = 0,
dP C
also auch P (C) = 0 und somit Zn 6= 0 fast sicher. Folglich ist der vorhersehbare Prozess
A := Z1− • hZ, Xi wohldefiniert. Nach Lemma 2.20 ist
(X − A)Z = XZ − AZ
= X− • Z + Z− • X + [Z, X] − Z− • A − A • Z
= X− • Z + Z− • X + ([Z, X] − hX, Zi) − A • Z
ein P -lokales Martingal. Die Behauptung folgt mit Lemma 2.26.
Die Standard-Irrfahrt ist gewissermaßen das einfachste Martingal überhaupt (nach den
konstanten Prozessen).
Definition 2.28 Seien p ∈ (0, 1), a, b > 0. Unter einer einfachen Irrfahrt verstehen wir ein
Semimartingal X mit X0 = 0 derart, dass (∆Xn )n∈N\{0} unabhängige, identisch verteilte
Zufallsvariablen sind mit
P (∆Xn = a) = 1 − P (∆Xn = −b) = p.
Im Fall a = b = 1, p =
1
2
sprechen wir von einer Standard-Irrfahrt.
17.11.08
Nur sehr einfache Prozesse X wie die Standard-Irrfahrt oder deren asymmetrische oder
gestoppte Varianten besitzen die folgende Darstellungseigenschaft, dass sich jedes Martingal bzgl. ihrer Filtrierung schon als stochastisches Integral nach X schreiben lässt. Diese
Eigenschaft hängt in der Finanzmathematik eng mit der Vollständigkeit von Märkten zusammen (vgl. Kapitel 4).
Satz 2.29 (Martingaldarstellungssatz) Sei X eine einfache Irrfahrt mit der Martingaleigenschaft ap = b(1 − p). Wenn (Fn )n∈N die von X erzeugte Filtrierung ist, dann gibt es für
jedes Martingal Y einen vorhersehbaren Prozess H derart, dass Y = Y0 + H • X.
Beweis. Da ∆Yn σ(∆X1 , . . . , ∆Xn )-messbar ist, gibt es eine Funktion fn : {−b, a}n → R
mit ∆Yn = fn (∆X1 , . . . , ∆Xn ). Da Y ein Martingal ist, gilt
0 = E(∆Yn |Fn−1 ) = pfn (∆X1 , . . . , ∆Xn−1 , a) + (1 − p)fn (∆X1 , . . . , ∆Xn−1 , −b)
2.3. STOCHASTISCHES INTEGRAL
33
nach Lemma 1.23, also
1
f (∆X1 , . . . , ∆Xn−1 , a)
a n
= − 1b fn (∆X1 , . . . , ∆Xn−1 , −b) =: Hn .
Dann ist
Hn ∆Xn = fn (∆X1 , . . . , ∆Xn−1 , a) = ∆Yn
im Falle ∆Xn = a und analog für ∆Xn = −b.
Kapitel 3
Mathematische Marktmodellierung
In diesem Kapitel wird der allgemeine mathematische Rahmen abgesteckt, den wir zur Behandlung verschiedener konkreter Fragestellungen benötigen.
3.1
Wertpapiere und Handelsstrategien
In der stochastischen Finanzmathematik geht es überwiegend um Fragen, die mit dem
Wertpapierhandel zusammenhängen. Im mathematischen Modell des Finanzmarktes
kommen daher vor allem zwei Arten von stochastischen Prozessen zum Tragen: Wertpapierpreisprozesse, die das Auf und Ab der Kurse beschreiben, und Handelsstrategien, die
für unser eigenes Anlageportfolio stehen.
Gegeben sei ein Rd+1 -wertiges diskretes Semimartingal S = (S 0 , . . . , S d ), der
Preisprozess der d + 1 Wertpapiere am Markt.
Die Zufallsvariable Sni gibt den Preis oder Kurs von Wertpapier i zur Zeit n an. Konkrete
Modelle werden wir am Schluss des Kapitels kennenlernen.
Mit den Wertpapieren können wir handeln. Dies wird ebenfalls durch einen stochastischen Prozess ausgedrückt.
Definition 3.1 Eine Handelsstrategie (oder ein Portfolio) ist ein Rd+1 -wertiger vorhersehbarer Prozess ϕ = (ϕ0 , . . . , ϕd ). Der Wertprozess oder Vermögensprozess des Portfolios
ist
V (ϕ) := ϕ> S.
ϕin bezeichnet die Anzahl der Wertpapiere vom Typ i in unserem Portfolio zur Zeit n. Auch
diese ist in dem Sinne zufällig, dass wir sie von zufälligen Ereignissen wie z. B. Kursentwicklungen der Aktien bis zum Zeitpunkt n abhängig machen können. Dies erklärt, warum
es sich bei Handelsstrategien um adaptierte Prozesse handeln sollte. Warum fordert man
aber Vorhersehbarkeit? Dies hängt, wie wir im letzten Kapitel schon angedeutet haben, mit
der zeitlichen Abfolge der Ereignisse zusammen. Zwischen den Zeitpunkten n − 1 und n
34
3.1. WERTPAPIERE UND HANDELSSTRATEGIEN
35
ändern sich sowohl die Kurse als auch das Anlageportfolio. Wir folgen der Konvention, dass
zunächst das Portfolio von ϕn−1 zu ϕn umgeschichtet wird und danach die Kursänderung
von Sn−1 nach Sn stattfindet. Das neue Portfolio ϕn wird also noch zu den Preisen Sn−1
erworben. Insbesondere steht uns für die Wahl von ϕn die Information über Sn noch nicht
zur Verfügung; wir können sie nur von den Ereignissen bis zur Zeit n − 1 abhängig machen.
Dies wird gerade durch die Vorhersehbarkeit ausgedrückt. Der Wert Vn (ϕ) schließlich wird
nach der Kursänderung der Wertpapiere bestimmt, also zu Preisen Sn . Man beachte, dass
es sich in der Definition um ein Skalarprodukt handelt. Es werden also die Bestände der
verschiedenen Papiere aufsummiert. Bargeld im engeren Sinne ist im Modell übrigens nicht
vorgesehen. Stattdessen wird auch das Bankkonto, auf dem das nicht anderweitig angelegte
Vermögen ruht, als ein Wertpapier angesehen (vgl. Abschnitt 3.4).
In diesem einführenden Text beschränken wir uns auf einen in verschiedener Hinsicht
idealisierten Finanzmarkt. Wir nehmen an, dass sich Wertpapiere in beliebigen reellen — also auch gebrochenen oder negativen — Stückzahlen halten lassen. Dies erscheint vor allem
bei negativen Stückzahlen als abwegig. Es ist aber in der Praxis mit gewissen Einschränkungen durchaus möglich, Wertpapiere zu verkaufen, die man gar nicht besitzt (Leerverkauf), wenn zu einem späteren Zeitpunkt das entsprechende Gegengeschäft getätigt wird.
Ferner treten im mathematischen Modell keinerlei Transaktionskosten oder Dividendenausschüttungen auf, Guthaben- und Schuldenzinsen stimmen überein, und die Kursentwicklung
wird durch unseren Handel nicht beeinflusst. Wir betrachten also weder sehr große Anleger,
die Preise sehr wohl beeinflussen können, noch sehr kleine, für die Transaktionskosten und
Gebühren eine Rolle spielen. Ebensowenig passt dieser allgemeine Rahmen auf Märkte, an
denen so wenig gehandelt wird, dass die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs, also den
Kursen für Käufer und Verkäufer des Wertpapiers, nicht vernachlässigt werden kann.
Im Gegensatz zur den Wertpapierkursen können wir über die Handelsstrategie je nach
unseren Bedürfnissen selbst bestimmen. Wir beschränken uns allerdings ausschließlich auf
in folgendem Sinne selbstfinanzierende Strategien.
Definition 3.2 Eine Handelsstrategie ϕ heißt selbstfinanzierend, falls
(∆ϕn )> Sn−1 = 0
für n = 1, 2, . . .
Die Selbstfinanzierungsbedingung bedeutet, dass das Anlagevermögen zwar zwischen den
verschiedenen Wertpapieren umgeschichtet werden kann, dass aber nach dem Zeitpunkt 0
weder Kapital zugeführt noch entnommen wird. Wenn man, wie im vorigen Kapitel motiviert, das stochastische Integral als kumulative Handelsgewinne bzw. -verluste interpretiert,
liefert das folgende Lemma eine intuitive Form der Selbstfinanzierungsbedingung. Der Wert
des Portfolios gleicht dem Anfangskapital zuzüglich Kursgewinnen oder -verlusten aus dem
Handel mit den veschiedenen Wertpapieren.
Lemma 3.3 Eine Handelsstrategie ϕ ist genau dann selbstfinanzierend, wenn
V (ϕ) = V0 (ϕ) + ϕ • S.
36
KAPITEL 3. MATHEMATISCHE MARKTMODELLIERUNG
Beweis.
Vn (ϕ) = V0 (ϕ) + ϕ • Sn für alle n ≥ 0
⇐⇒ ∆(ϕ> S)n = ϕ>
n ∆Sn für alle n ≥ 1
>
>
>
⇐⇒ ϕ>
n Sn − ϕn−1 Sn−1 = ϕn Sn − ϕn Sn−1 für alle n ≥ 1
⇐⇒ (ϕn − ϕn−1 )> Sn−1 = 0 für alle n ≥ 1
Die mathematische Theorie wird dadurch stark vereinfacht, dass man nicht mit Währungseinheiten arbeitet, sondern die Kurse stattdessen als Vielfache eines beliebigen Referenzwertpapiers, des sogenannten Numeraires, ausdrückt. Oft wählt man dafür ein besonders einfaches Wertpapier, z. B. eine risikolose festverzinsliche Anlage (Bank- oder Sparkonto). Der Preisprozess des Numeraires sei S 0 , das ab jetzt als positiv vorausgesetzt wird.
Definition 3.4
1
Ŝ := 0 S =
S
S1
Sd
1, 0 , . . . , 0
S
S
heißt diskontierter Preisprozess. Ferner heißt
V̂ (ϕ) :=
1
V (ϕ) = ϕ> Ŝ
0
S
diskontierter Wert- oder Vermögensprozess der Strategie ϕ.
Die Selbstfinanzierungsbedingung kann auch mit Hilfe von diskontierten Größen ausgedrückt werden.
Lemma 3.5 Eine Strategie ϕ ist genau dann selbstfinanzierend, wenn
V̂ (ϕ) = V̂0 + ϕ • Ŝ.
Beweis. Offenbar ist ϕ genau dann selbstfinanzierend, wenn (∆ϕn )> Ŝn−1 = 0 für alle n.
Die Behauptung folgt nun aus Lemma 3.3 für Ŝ anstelle S.
Man beachte, dass das stochastische Integral ϕ • Ŝ im diskontierten Preisprozess nicht
vom Numeraireanteil ϕ0 abhängt.
Die Selbstfinanzierungsbedingung schränkt die Wahl der d + 1 Wertpapiere durch eine
Nebenbedingung ein. Der folgende Satz zeigt aber, dass die Anlage in d Wertpapieren stets
beliebig gewählt werden kann und dass dadurch die Position im verbleibenden Wertpapier
(z. B. dem Numeraire) eindeutig festgelegt ist.
Lemma 3.6 Für jeden vorhersehbaren Prozess (ϕ1 , . . . , ϕd ) und jedes V0 ∈ R existiert ein
eindeutiger vorhersehbarer Prozess ϕ0 derart, dass ϕ = (ϕ0 , . . . , ϕd ) selbstfinanzierend ist
mit V0 (ϕ) = V0 .
3.2. ARBITRAGE
37
Beweis. Nach dem vorigen Satz ist ϕ genau dann selbstfinanzierend, wenn
1
d
1
d •
1
d
ϕ0n Ŝn0 + (ϕ1 , . . . , ϕd )>
n (Ŝ , . . . , Ŝ )n = V̂0 + (ϕ , . . . , ϕ ) (Ŝ , . . . , Ŝ )n ,
d. h. genau dann, wenn
1
d
ϕ0n = V̂0 + (ϕ1 , . . . , ϕd ) • (Ŝ 1 , . . . , Ŝ d )n − (ϕ1 , . . . , ϕd )>
n (Ŝ , . . . , Ŝ )n
1
d
= V̂0 + (ϕ1 , . . . , ϕd ) • (Ŝ 1 , . . . , Ŝ d )n−1 − (ϕ1 , . . . , ϕd )>
n (Ŝ , . . . , Ŝ )n−1 .
Dies ist offenbar ein vorhersehbarer Prozess.
Zusammen mit der Tatsache, dass der diskontierte Wertprozess einer selbstfinanzierenden Strategie ϕ nicht vom Numeraireanteil ϕ0 abhängt, illustriert das vorige Lemma,
warum der Übergang zu diskontierten Größen die Buchführung so sehr vereinfacht:
Selbstfinanzierende Strategien ϕ können in kanonischer Weise mit ihren frei wählbaren
d letzten Komponenten (ϕ1 , . . . , ϕd ) identifiziert werden. Für die Berechnung des Wertprozesses V (ϕ) = S 0 V̂ (ϕ) = S 0 (V0 + ϕ • Ŝ) wird ϕ0 nicht benötigt. Wenn man sich
tatsächlich einmal für den Numeraireanteil interessiert, kann man diesen leicht z. B. durch
ϕ0 = V̂ (ϕ) − (ϕ1 , . . . , ϕd )> (Ŝ 1 , . . . , Ŝ d ) erhalten. Wir betrachten daher überwiegend
diskontierte Prozesse.
Bezeichnung. Wir identifizieren gelegentlich (Ŝ 1 , . . . , Ŝ d ) mit (Ŝ 0 , Ŝ 1 , . . . , Ŝ d ) und vorhersehbare Prozesse (ϕ1 , . . . , ϕd ) mit den selbstfinanzierenden Strategien (ϕ0 , ϕ1 , . . . , ϕd ) aus
Lemma 3.6 zu V0 = 0.
3.2
Arbitrage
In diesem Abschnitt sei ein Endzeitpunkt N ∈ N gegeben, d. h. die Indexmenge ist jetzt
{0, . . . , N } statt N.
In der Finanzmathematik nimmt man im allgemeinen an, dass ohne Anfangskapital keine risikolosen Gewinne (Arbitragegewinne) erwirtschaftet werden können. Man begründet
dies intuitiv damit, dass solche Gelegenheiten von sogenannten Arbitragehändlern ausgenutzt und so unverzüglich zum Verschwinden gebracht werden, so dass sie, wenn überhaupt,
dann nur kurzzeitig und in geringem Umfang auftreten. In der Tat werden Wertpapiere oder
Devisen an verschiedenen Börsen zu sehr ähnlichen Preisen gehandelt. Andernfalls bestünde ein Arbitragegeschäft darin, ein Wertpapier an einem Ort billig zu kaufen und am anderen
gleichzeitig teurer zu verkaufen. Statt auf Handel an verschiedenen Orten beziehen sich die
Arbeitragegewinne im Sinne der folgenden Definition auf Handel zu verschiedenen Zeitpunkten.
Definition 3.7 Eine selbstfinanzierende Strategie ϕ heißt Arbitrage, falls
V0 (ϕ) = 0,
VN (ϕ) ≥ 0 P -fast sicher, P (VN (ϕ) > 0) > 0.
Der Markt heißt arbitragefrei, falls keine solche Strategie existiert.
38
KAPITEL 3. MATHEMATISCHE MARKTMODELLIERUNG
Die unscheinbare Annahme der Arbitragefreiheit bildet eine wichtige Säule der stochastischen Finanzmathematik. Oben haben wir motiviert, dass sie dazu führt, dass die Kurse
der gleichen Wertpapiere an verschiedenen Orten übereinstimmen. Die dynamische Entsprechung besteht darin, dass Portfolios, deren Werte zu einem bestimmten Zeitpunkt in der
Zukunft übereinstimmen werden, auch schon zu jedem früheren Zeitpunkt gleich viel wert
sind.
Lemma 3.8 (Gesetz des einen Preises) Seien ϕ, ψ selbstfinanzierende Handelsstrategien
mit VN (ϕ) = VN (ψ) f. s. Wenn der Markt arbitragefrei ist, dann gilt Vn (ϕ) = Vn (ψ) f.
s. für n = 0, . . . , N .
Insbesondere gilt in arbitragefreien Märkten S i = V (ϕ) f. s., falls ϕ eine selbstfinanziei
rende Strategie und i ∈ {0, . . . , d} sind mit SN
= VN (ϕ).
Beweis. Sonst wähle man n und A ∈ Fn so, dass V̂n (ψ) − V̂n (ϕ) > 0. Seien
0
für m ≤ n
1
d
(ϑ , . . . , ϑ )m :=
1
d
1
d
(ϕ , . . . , ϕ )m − (ψ , . . . , ψ )m 1A für m = n + 1, . . . , N
19.11.08
und ϑ die selbstfinanzierende Strategie zu V0 = 0 aus Lemma 3.6. Dann gilt V̂0 (ϑ) = 0 und
V̂N (ϑ) = ϑ • Ŝn + (ϑ • ŜN − ϑ • Ŝn )
•
•
•
= 0 Ŝn + (ϕ − ψ) ŜN − (ϕ − ψ) Ŝn 1A
= V̂N (ϕ) − V̂N (ψ) − V̂n (ϕ) + V̂n (ψ) 1A
= V̂n (ψ) − V̂n (ϕ) 1A .
Dies ist überall nichtnegativ und positiv auf A; somit ist ϑ eine Arbitrage. Die zweite Aussage folgt durch Betrachtung von
1 für j = i
j
ψ :=
0 sonst.
Der folgende Satz verknüpft Arbitragefreiheit mit äquivalenten Martingalmaßen, die
uns noch mehrfach in der Finanzmathematik begegnen werden. Intuitiv besagt der Satz,
dass arbitragefreie Märkte unter hypothetischen Wahrscheinlichkeiten P ? als ein faires Spiel
aufgefasst werden können, in dem sich Kursgewinne und -verluste im Mittel die Waage
halten. Unter dem „wirklichen“ Wahrscheinlichkeitsmaß P muss das nicht der Fall sein.
Dort wird man eher erwarten, dass riskante Wertpapiere im Mittel stärker an Wert zunehmen
als risikolose, um einen Ausgleich für das Verlustrisiko zu bieten.
Satz 3.9 (1. Fundamentalsatz der Preistheorie) Der Markt ist genau dann arbitragefrei,
wenn es ein äquivalentes Martingalmaß gibt, d. h. ein Wahrscheinlichkeitsmaß Q ∼ P
derart, dass Ŝ ein Q-Martingal ist.
3.2. ARBITRAGE
39
Aus didaktischen Gründen beweisen wir die Aussage zunächst im Fall eines endlichen
Grundraums.
Beweis für |Ω| < ∞. ⇐: Sei ϕ eine selbstfinanzierende Strategie mit V0 (ϕ) = 0 und
VN (ϕ) ≥ 0. Dann ist ϕ • ŜN = V̂N (ϕ) ≥ 0. Da ϕ • Ŝ nach Lemma 2.20(6) ein QMartingal ist, gilt EQ (ϕ • ŜN ) = EQ (ϕ • Ŝ0 ) = 0, also ϕ • ŜN = 0 Q-fast sicher und somit
auch VN (ϕ) = 0 P -fast sicher.
⇒: Seien U := {ϕ • ŜN + Y ∈ RΩ : ϕ selbstfinanzierende Strategie mit ϕ0 = 0; Y = 0
P -fast sicher} und
n
o
P
K := X ∈ RΩ : X ≥ 0; X(ω) = 0 falls P ({ω}) = 0; ω∈Ω X(ω) = 1 .
Dann ist U ein Unterraum von RΩ und K eine kompakte, konvexe Menge. Aus der ArbitraP
gefreiheit folgt U ∩ K = ∅. Nach Satz 1.9 gibt es ein λ ∈ RΩ mit ω∈Ω λ(ω)x(ω) = 0 für
P
alle x ∈ U und ω∈Ω λ(ω)x(ω) > 0 für alle x ∈ K. Definiere ein Wahrscheinlichkeitsmaß
Q durch
λ(ω)
.
Q({ω}) = P
ω)
ω
e ∈Ω λ(e
Sei ω ∈ Ω. Im Fall P ({ω}) = 0 ist 1{ω} ∈ U und somit λ(ω) = 0. Im Fall P ({ω}) > 0
ist 1{ω} ∈ K und somit λ(ω) > 0. Folglich ist Q ein zu P äquivalentes Wahrscheinlichkeitsmaß.
Seien nun i ∈ {1, . . . , d}, m ≤ n, C ∈ Fm . Sei ϕ eine selbstfinanzierende Strategie mit
ϕ0 = 0 und
1C (ω)1{m+1,...,n} (`) für i = j,
j
ϕ` (ω) :=
0
sonst.
Dann ist
!−1
i
EQ (1C (Ŝni − Ŝm
)) =
X
ω
e ∈Ω
λ(e
ω)
X
λ(ω)(ϕ • ŜN )(ω) = 0,
ω∈Ω
i
|Fm ) = 0. Folglich ist Ŝ i ein Q-Martingal.
also EQ (Ŝni − Ŝm
Wir wenden uns nun dem wesentlich aufwändigeren allgemeinen Fall vor. Der untenstehende Beweis basiert auf [KS01]. Zunächst sind einige Vorarbeiten nötig. Das folgende
vorbereitende Lemma ist auch in der Statistik von Interesse.
Lemma 3.10 (Halmos-Savage) Für eine Familie P von endlichen Maßen auf einem messbaren Raum (Ω, F ) sind die folgenden Aussagen äquivalent:
1. P µ für ein σ-endliches Maß µ (d. h. P µ für alle P ∈ P).
2. P ∼ Q für eine abzählbare Teilfamilie Q von P (d. h. N ist genau dann eine P Nullmenge für alle P ∈ P, wenn es P -Nullmenge für alle P ∈ Q ist).
40
KAPITEL 3. MATHEMATISCHE MARKTMODELLIERUNG
Beweis. O. B. d. A. sei P eine Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen. Sonst normiere man
entsprechend.
P
−n
2⇒1: Definiere µ := ∞
Pn für Q = {P1 , P2 , . . .}.
n=1 2
1⇒2: O. B. d. A. sei µ endlich. Sonst ersetze man µ durch
∞
X
2−n
µ
e :=
µ(An ∩ ·)
µ(A
)
n
n=1
für eine Zerlegung (An )n=1,2,... von Ω mit µ(An ) < ∞ für alle n ∈ N. Für
R :=
X
∞
n=1
cn Pn : P1 , P2 , . . . ∈ P, c1 , c2 , . . . ∈ [0, 1],
∞
X
cn = 1
n=1
gilt R µ und P ⊂ R. Es reicht zu zeigen, dass ein Q0 ∈ R existiert mit mit R Q0 .
(Man wähle dann Q := {P1 , P2 , . . .} für die zu Q0 gehörigen Wahrscheinlichkeitsmaße
P1 , P2 , . . .)
Definiere
dQ
C := C ∈ F : Es existiert ein Q ∈ R mit Q(C) > 0 und
> 0 µ-f.ü. auf C .
dµ
24.11.08
Sei (Cn )n∈N eine Folge in C mit µ(Cn ) ↑ supC∈C µ(C). Definiere C∞ := ∪n∈N Cn . Wenn
P
P
−n dQn
−n
Qn ∈ R, also
Qn ∈ R zu Cn gehört, dann ist ∞
Dichte von Q0 := ∞
n=1 2
n=1 2
dµ
C∞ ∈ C .
Seien Q ∈ R, N ∈ F mit Q0 (N ) = 0. Es bleibt zu zeigen, dass Q(N ) = 0. Definiere
0
C := { dQ
> 0} und C0 := { dQ
> 0}. Wegen Q0 (N ∩ C0 ) = 0 ist µ(N ∩ C0 ) = 0, also
dµ
dµ
Q(N ∩ C0 ) = 0. Ferner ist Q(N ∩ C0C ∩ C C ) = 0.
Unter der Annahme Q(N ∩C0C ∩C) > 0 folgt N ∩C0C ∩C ∈ C , also C0 ∪(N ∩C0C ∩C) ∈
C . Das impliziert aber µ(C0 ∪ (N ∩ C0C ∩ C)) > µ(C0 ) ≥ µ(C∞ ) = supC∈C µ(C), also
einen Widerspruch.
Zusammen folgt Q(N ) = Q(N ∩ C0 ) + Q(N ∩ C0C ∩ C C ) + Q(N ∩ C0C ∩ C) = 0. Das folgende Resultat enthält bereits das zentrale Argument für den Fundamentalsatz.
Allerdings erfordert der Beweis, dass die Menge K, auf die dieses Lemma später angewandt
wird, abgeschlossen ist, einen hohen Aufwand. Das y in Lemma 3.11 und die Zufallsvariablen X0 , . . . , Xn in Lemma 3.14 dienen übrigens nicht zum Beweis des Fundamentalsatzes,
sondern werden erst im Zusammenhang mit späteren Ergebnissen benötigt.
Lemma 3.11 (Kreps-Yan) Sei K ⊃ −L1+ ein abgeschlossener konvexer Kegel (d.h K
abeschlossen, konvex, αξ ∈ K für alle ξ ∈ K, α ≥ 0) mit K ∩ L1+ = {0} (wobei
L1+ := {X ∈ L1 : X ≥ 0 µ-fast sicher}). Ferner sei y ∈ L1 \ K. Dann gibt es ein
Wahrscheinlichkeitsmaß Q ∼ µ mit dQ
∈ L∞ (µ) und EQ (y) > 0 und EQ (ξ) ≤ 0 für alle
dµ
ξ ∈ K.
3.2. ARBITRAGE
41
Beweis. Nach Satz 1.8 gibt es für jedes x ∈ {y} ∪ L1+ \ {0} ein zx ∈ (L1 )0 = L∞ derart,
dass E(zx ξ) < E(zx x) für alle ξ ∈ K. Da K ein Kegel ist, gilt E(zx ξ) ≤ 0 für alle solchen
x, ξ. Wegen −L1+ ⊂ K sind ferner alle zx fast sicher nichtnegativ, da sonst E(zx ξ) > 0 für
ξ := zx 1{zx <0} ∈ K. Aus 0 ∈ K folgt schließlich
E(zx x) > 0 für alle x ∈ {y} ∪ L1+ \ {0}.
(3.1)
Wir können zx für alle x so wählen, dass E(zx y) > 0: Sonst ersetze man zx durch
:= αzx + (1 − α)zy für geeignetes α ∈ (0, 1). Wegen E(zy y) > 0 und E(zy x) ≥ 0 gilt
nämlich E(zxα x) > 0 und E(zxα y) > 0 für genügend kleine α.
O. B. d. A. sei ferner zx ≤ 1 fast sicher für alle x. Sonst ersetze man zx durch kzzxxk∞ .
Nach Lemma 3.10 existiert eine Folge (xn )n∈N , so dass
zxα
{zxn P : n ∈ N} ∼ {zx µ : x ∈ {y} ∪ L1+ \ {0}}.
P∞ −n
Definiere % :=
zxn , x
e := 1{%=0} sowie das Wahrscheinlichkeitsmaß Q durch
n=0 2
dQ
%
:= E(%) . Für alle n ∈ N ist E(zxn x
e) = 0, also E(zx x
e) = 0 für alle x ∈ L1+ . Wegen
dµ
e = 0 fast sicher. Somit ist Q äquivalent zu µ.
x
e ∈ L1+ und (3.1) folgt x
In der Wahrscheinlichkeitstheorie taucht bisweilen das Problem auf, dass zwar für alle
ω ∈ Ω ein X(ω) mit gewissen gewünschten Eigenschaften existiert, dass aber nicht klar
ist, ob die resultierende Abbildung X messbar bzgl. einer gegebenen σ-Algebra auf Ω ist.
Diese Messbarkeit zeigt man gewöhnlich mit Hilfe von Sätzen über messbare Auswahl.
Das folgende Lemma dient dazu, einen Verweis auf solche Resultate an dieser Stelle zu
umgehen.
Lemma 3.12 Sei (ηn )n∈N eine Folge von Rd -wertigen Zufallsvariablen mit lim inf n→∞ |ηn |
< ∞. Dann gibt es eine konvergente Folge (e
ηn )n∈N von Rd -wertigen Zufallsvariablen derart, dass (e
ηn )n∈N für alle ω ∈ Ω eine Teilfolge von (ηn )n∈N ist.
Beweis. Seien τ0,0 := 0 und
n
o
τk,0 := inf m > τk−1,0 : ||ηm | − lim inf |ηn || < k1
n→∞
P
ek,0
für k = 1, 2, . . . Definiere ηek,0 := ητk,0 =
m∈N ηm 1{τk,0 =m} für k ∈ N. Dann ist η
messbar und supk∈N |e
ηk,0 | < ∞. Definiere ferner τ0,1 := 0 und
o
n
1
1
1
τk,1 := inf m > τk−1,1 : |e
ηm,0 − lim inf ηen,0 | < k
n→∞
1
für k = 1, 2, . . . sowie ηek,1 := ηeτk,1 ,0 für k ∈ N. Dann ist ηek,1 messbar und ηek,1
(ω) konvergiert für alle ω ∈ Ω. Analog definiere man sukzessive Folgen (τk,i )k∈N und Teilfolgen
i
(e
ηk,i )k∈N für i = 2, . . . , d, so dass ηek,i
(ω) konvergiert für alle ω ∈ Ω konvergiert. Wähle nun
(e
ηk )k∈N := (e
ηk,d )k∈N .
Wir definieren RN := {ϕ • ŜN : ϕ vorhersehbar, Rd -wertig} und AN := RN − L0+ ,
wobei L0+ die Menge der fast sicher nichtnegativen Zufallsvariablen bezeichnet.
42
KAPITEL 3. MATHEMATISCHE MARKTMODELLIERUNG
Lemma 3.13 Wenn der Markt arbitragefrei ist, sind AN , RN , R + RN abgeschlossen bzgl.
stochastischer Konvergenz.
Beweis. Zu AN : Wir führen den Beweis durch Induktion nach N , hier als Zahl der Handelsintervalle verstanden. Für N = 0 folgt die Aussage aus der Abgeschlossenheit von L0+ . Die
Aussage sei gültig für N − 1. Seien (ϕ(k) )k∈N eine Folge von Strategien, (rk )k∈N eine Folge
in L0+ , ζ eine Zufallsvariable mit ϕ(k) • ŜN − rk → ζ P -fast sicher für k → ∞. Zu zeigen
ist, dass eine Strategie ϕ und ein r ∈ L0+ existieren mit ζ = ϕ • ŜN − r.
Definiere A := {lim inf k→∞ |ϕ(k),1 | = ∞} ∈ F0 .
Fall 1: P (A) = 0. Nach Lemma 3.12 existiert eine fast sicher konvergente, F0 -messbare
punktweise Teilfolge von (ϕ(k),1 )k∈N , o. B. d. A. (ϕ(k),1 )k∈N selbst, etwa mit Grenzwert ϕ1 .
P
>
>
Somit gilt N
n=2 ϕ(k),n ∆Ŝn − rk → ζ − ϕ1 ∆Ŝ1 fast sicher. Nach Induktionsvoraussetzung
PN
>
existiert eine Strategie (ϕn )n∈{2,...,N } und r ∈ L0+ mit ζ − ϕ>
1 ∆Ŝ1 =
n=2 ϕn ∆Ŝn − r, also
ζ = ϕ • ŜN − r.
ϕ(k)
rk
Fall 2: P (A) > 0. Auf A definiere ψ(k) := |ϕ(k),1
, sk := |ϕ(k),1
für alle k ∈ N. Dann gilt
|
|
(ψ(k) • ŜN − sk )1A → 0 fast sicher für k → ∞. Nach Lemma 3.12 existiert eine fast sicher
konvergente, F0 -messbare punktweise Teilfolge (ψe(k),1 1A )k∈N von (ψ(k),1 1A )k∈N , etwa mit
Grenzwert ψe1 . Dann ist
!
N
N
X
X
>
>
e
e
ψen ∆Ŝn − s
(ψ(k),n 1A ) ∆Ŝn − sk 1A =
−ψ ∆Ŝ1 = lim
1
26.11.08
k→∞
n=2
n=2
nach Induktionsvoraussetzung für eine Strategie (ψn )n∈{2,...,N } und ein s ∈ L0+ . Es folgt
ψe • ŜN = s ≥ 0 und somit ψe • ŜN = 0 wegen der Arbitragefreiheit. Wegen |ψe1 | = 1 auf A
existieren paarweise disjunkte Mengen A1 , . . . , Ad ∈ F0 mit A = ∪di=1 Ai und ψ1i 6= 0 auf
Ai . Definiere
(
ϕd
e auf Ad
ϕ(k),1 − (k),1
ed ψ1
ψ
ϕ
e(k),1 :=
1
ϕ(k),1
sonst.
>
e•
e>
Dann gilt ϕ
ed(k),1 = 0 auf Ad und ϕ
(k),1 ∆Ŝ1 = ϕ(k),1 ∆Ŝ1 , denn ψ Ŝ1 = 0 nach Lemma 3.8.
O. B. d. A. kann also Ad = ∅ gewählt werden. (Sonst gehe man zu einer modifizierten
Folge mit gleichem Grenzwert ζ über.) Induktiv folgt, dass auch Ad−1 , . . . , A1 = ∅ und
somit A = ∅ gewählt werden kann.
Zu RN : Dies wird analog zu AN , jedoch mit rk = 0 für alle k ∈ N bewiesen.
Zu R + RN : O. B. d. A. sei Ŝ0 = 0. Die Abgeschlossenheit beweist man zum Beispiel,
in dem man den Markt durch die Festlegungen F−1 := {∅, Ω}, Ŝ−1 := (−1, 0, . . . , 0) um
einen zusätzlichen Zeitpunkt −1 erweitert. Dann entspricht die Menge
nP
o
N
>
d
RN +1 =
ϕ
∆
Ŝ
:
ϕ
vorhersehbar,
R
-wertig
n
n=0 n
in diesem erweiterten Markt der Menge R + RN im ursprünglichen Markt. Man beachte
dazu, dass für den obigen Beweis der Abgeschlossenheit von RN nur die Arbitragefreiheit
zwischen 1 und N benötigt wird.
3.3. WERTPAPIERE MIT DIVIDENDEN
43
Lemma 3.14 Seien X0 , . . . , Xk reellwertige Zufallsvariablen mit X0 ∈
/ AN . Wenn der
dQ
Markt arbitragefrei ist, gibt es ein äquivalentes Martingalmaß Q mit dP ∈ L∞ (P ) derart, dass X0 , . . . , Xk ∈ L1 (Q) und EQ (X0 ) > 0.
Pk
P
Pd
%
0
i
Beweis. Definiere % := exp(− N
j=0 |Xj |) ∈ (0, 1] und P := E(%) P .
n=0
i=1 |Ŝn | +
Dann ist P 0 ein zu P äquivalentes Wahrscheinlichkeitsmaß, unter dem Ŝni und Xj für
i = 1, . . . , d, n = 0, . . . , N , j = 0, . . . , k integrierbar sind. O. B. d. A. sei P 0 = P , da die Arbitragefreiheit invariant unter äquivalenten Maßwechseln ist. Nach Lemma 3.13 ist AN abgeschlossen bzgl. stochastischer Konvergenz. Da L1 -Konvergenz stochastische Konvergenz
impliziert, ist AN ∩L1 abgeschlossen in L1 . Wegen der Arbitragefreiheit gilt RN ∩L0+ = {0}
und somit AN ∩ L0+ = {0} und AN ∩ L1+ = {0}, wobei L1+ := L1 ∩ L0+ . Nach Lemma 3.11
gibt es ein Wahrscheinlichkeitsmaß Q ∼ P mit dQ
∈ L∞ (P ) derart, dass EQ (X0 ) > 0 und
dP
EQ (ξ) ≤ 0 für alle ξ ∈ AN ∩ L1 . Seien nun n ∈ {1, . . . , N }, i ∈ {1, . . . , d}, F ∈ Fn−1 ,
und definiere eine Strategie ϕ durch
±1 falls m = n, j = i, ω ∈ F
j
ϕm (ω) :=
0
sonst.
Dann ist 0 ≥ EQ (ϕ • ŜN ) = EQ (±1F ∆Ŝni ), also EQ (∆Ŝni |Fn−1 ) = 0. Somit sind
Ŝ 1 , . . . , Ŝ d Q-Martingale.
Lemma 3.15 Wenn ein äquivalentes lokales Martingalmaß Q existiert (d. h. Q ∼ P und
Ŝ ist Q-lokales Martingal), dann ist der Markt arbitragefrei.
Beweis. Sei ϕ ein Rd -wertiger vorhersehbarer Prozess mit ϕ • ŜN ≥ 0. Wir zeigen induktiv,
dass EQ (ϕ • ŜN |Fn ) = ϕ • Ŝn ≥ 0 fast sicher für n = N, . . . , 0: Für n = N ist dies
offensichtlich. Für den Induktionsschritt von n nach n−1 wird die Induktionsvoraussetzung
und die Tatsache verwendet, dass ϕ • Ŝ ein Q-lokales Martingal ist (vgl. Lemma 2.20(5)):
EQ (ϕ • ŜN |Fn−1 ) = EQ (EQ (ϕ • ŜN |Fn )|Fn−1 )
= EQ (ϕ • Ŝn |Fn−1 )
= ϕ • Ŝn−1 .
Insbesondere ist EQ (ϕ • ŜN ) = EQ (EQ (ϕ
also ϕ • ŜN = 0 fast sicher.
•
ŜN |F0 )) = EQ (ϕ
•
Ŝ0 ) = EQ (0) = 0,
Aus den obigen Resultaten ergibt sich nun direkt der Fundamentalsatz.
Beweis von Satz 3.9. Die Aussage folgt aus den Lemmata 3.14 und 3.15.
3.3
Wertpapiere mit Dividenden
Bislang haben wir angenommen, dass auf die Wertpapiere keine Dividenden ausgeschüttet
werden. Dies ist insbesondere im Zusammenhang mit Anleihen, für die ein regelmäßiger
44
KAPITEL 3. MATHEMATISCHE MARKTMODELLIERUNG
Zinskupon gutgeschrieben wird, unsinnig. Aber auch Futuresverträge, die wir im nächsten
Kapitel kennenlernen werden, können in geeigneter Weise als Wertpapiere mit Dividendenausschüttungen aufgefasst werden. Wir erweitern daher den im Abschnitt 3.1 eingeführten
Begriffsapparat auf diesen Fall.
Dies ist auf zwei Arten möglich. In der expliziten Heransgehensweise wird über die
Dividenden separat Buch geführt. Dies ist sehr übersichtlich, hat aber den Nachteil, dass
alle Berechnungen erneut in diesem etwas allgemeineren Rahmen formuliert werden müssen. Ein alternativer Ausweg besteht darin, die Wertpapiere mit Dividendenausschüttungen
durch virtuelle dividendenfreie Wertpapiere zu ersetzen, auf die sich alle in den vorangegangenen zwei Abschnitten hergeleiteten Resultate anwenden lassen. Im Anschluss ersetzt
man die virtuellen Einheiten wieder durch reale. Die Eleganz dieses Ansatzes bezahlt man
allerdings mit einer gewissen Unübersichtlichkeit.
3.3.1
1.12.08
Explizite Modellierung
Gegeben sei neben dem Rd+1 -wertigen Wertpapierpreisprozess S ein weiteres Rd+1 wertiges diskretes Semimartingal D = (D0 , . . . , Dd ) mit D0 = (0, . . . , 0), der kumulative Dividendenprozess. Dni steht für die Dividenden, die für Wertpapier S i bis n bezahlt
werden, d. h. zum Zeitpunkt n wird ∆Dni als Dividende ausgeschüttet.
Noch stärker als im dividendenfreien Fall muss die Reihenfolge der Ereignisse beachtet werden. Zum Zeitpunkt n finden drei Vorgänge statt: Das Portfolio wird von ϕn−1 zu
ϕn umgeschichtet, der Kurs der Wertpapiere ändert sich von Sn−1 zu Sn , und Dividenden
∆Dn werden ausgeschüttet. Wir nehmen an, dass sie genau in dieser Abfolge stattfinden.
Durch die Dividendenzahlung ändert sich das Portfolio, da wir auch das Bankkonto, dem
die Dividende gutgeschrieben wird, als ein Wertpapier auffassen (in der Regel als Numeraire). Wir interpretieren ϕn als Portfolio vor Dividendenausschüttung, Vn (ϕ) hingegen als
Wert des Portfolios nach der Dividendenzahlung zur Zeit n. Dies motiviert die folgenden
Definitionen.
Definition 3.16 Eine Handelsstrategie (oder ein Portfolio) ist ein Rd+1 -wertiger vorhersehbarer Prozess ϕ = (ϕ0 , . . . , ϕd ). Der Wertprozess oder Vermögensprozess des Portfolios ist
V (ϕ) := ϕ> (S + ∆D).
Eine Handelsstrategie ϕ heißt selbstfinanzierend, falls
>
ϕ>
n Sn−1 = ϕn−1 (Sn−1 + ∆Dn−1 )
oder, anders ausgedrückt,
(∆ϕn )> Sn−1 = ϕ>
n−1 ∆Dn−1
für n = 1, 2, . . .
Das Analogon von Lemma 3.3 bildet
3.3. WERTPAPIERE MIT DIVIDENDEN
45
Lemma 3.17 Eine Handelsstrategie ϕ ist genau dann selbstfinanzierend, wenn
V (ϕ) = V0 (ϕ) + ϕ • (S + D).
Beweis. Übungsaufgabe
Zur Vereinfachung der Buchführung arbeiten wir wieder mit diskontierten Größen. Dazu
seien das Numerairewertpapier S 0 als positiv vorausgesetzt und der diskontierte Preisprozess Ŝ wie bisher definiert.
Definition 3.18
1 •
D
S0
heißt diskontierter Dividendenprozess. Ferner heißt
D̂ :=
V̂ (ϕ) :=
1
V (ϕ) = ϕ> (Ŝ + ∆D̂)
0
S
diskontierter Wert- oder Vermögensprozess der Strategie ϕ.
Im Gegensatz zu den anderen diskontierten Größen wird der diskontierte Dividendenprozess
mit Hilfe eines stochastischen Integrals definiert. Dies führt zum einen zur intuitiven Formel
n
für die augenblicklichen Ausschüttungen und zum anderen dazu, dass sich die
∆D̂n = ∆D
0
Sn
Selbstfinanzierungsbedingung in eingängiger Weise mit diskontierten Prozessen schreiben
lässt.
Lemma 3.19 Eine Handelsstrategie ϕ ist genau dann selbstfinanzierend, wenn
V̂ (ϕ) = V̂0 (ϕ) + ϕ • (Ŝ + D̂).
Beweis. Offenbar ist ϕ genau dann selbstfinanzierend, wenn (∆ϕn )> Ŝn−1 = ϕ>
n−1 ∆D̂n−1
für alle n. Die Behauptung folgt nun aus Lemma 3.17 für Ŝ anstelle S.
Lemma 3.6 bleibt im Dividendenfall im Wortlaut gültig:
Lemma 3.20 Für jeden vorhersehbaren Prozess (ϕ1 , . . . , ϕd ) und jedes V0 ∈ R existiert
ein eindeutiger vorhersehbarer Prozess ϕ0 derart, dass ϕ = (ϕ0 , . . . , ϕd ) selbstfinanzierend
ist mit V0 (ϕ) = V0 .
Beweis. Übungsaufgabe
Zur Betrachtung des Zusammenhangs von Arbitrage und äquivalenten Martingalmaßen
sei wiederum ein endlicher Zeithorizont N ∈ N gegeben. Ferner setzen wir voraus, dass
auf das Numerairewertpapier S 0 keine Dividenden ausgeschüttet werden (d. h. D0 = 0).
Arbitrage wird wie in Abschnitt 3.1 definiert.
Aus der Tatsache, dass der Wertprozess selbstfinanzierender Strategien die gleiche Form
wie im dividendenfreien Fall, jedoch mit Ŝ + D̂ anstelle Ŝ besitzt, ergibt sich direkt, dass
sich der 1. Fundamentalsatz mit der entsprechenden Modifikation übertragen lässt.
46
KAPITEL 3. MATHEMATISCHE MARKTMODELLIERUNG
Korollar 3.21 (1. Fundamentalsatz der Preistheorie) Der Markt ist genau dann arbitragefrei, wenn es ein äquivalentes Martingalmaß für Ŝ + D̂ gibt, d. h. ein Wahrscheinlichkeitsmaß Q ∼ P derart, dass Ŝ + D̂ ein Q-Martingal ist.
3.3.2
3.12.08
Implizite Modellierung
Für den Anleger unterscheidet sich eine Dividendenauschüttung von 1 e von einer entsprechenden Kurserhöhung im Grunde nur dadurch, dass Dividenden in Währungseinheiten ausbezahlt werden, während sich bei einer Kurserhöhung das in Form von z. B. Aktien angelegte Vermögen vergrößert. In diesem Abschnitt sollen Dividendenzahlungen als Kurserhöhungen aufgefasst werden, um Märkte mit Dividenden mit der bisherigen Theorie dividendenfreier Preisprozesse behandeln zu können. Wie im vorigen Unterabschnitt sei neben dem
Wertpapierpreisprozess S ein zugehöriger kumulativer Dividendenprozess D mit D0 = 0
gegeben. Wir setzen voraus, dass das Numerairewertpapier S 0 positiv ist und keine Dividenden abwirft, d. h. D0 = 0.
Definition 3.22 Der imaginäre oder dividendenkorrigierte Wertpapierpreisprozess S =
(S 0 , . . . , S n ) wird definiert durch
1 • i
i
i
0
S := S + S
D
S0
für i = 0, . . . , d.
Die zu einer Handelsstrategie ϕ gehörige imaginäre Handelsstrategie ϕ für S ist gegeben durch ϕ0 := ϕ0
(
ϕin
:=
ϕin
ϕ0n −
, i = 1, . . . , d,
i
i
i S n− −Sn−
0
i=0 ϕn
Sn−
Pd
,i = 0
für n = 1, 2, . . .
Die oben definierten S i sind als imaginäre dividendenfreie Wertpapiere zu verstehen,
deren Handel die gleichen Gewinne und Verluste erzeugt wie der der zugrundeliegenden
realen S i , wenn die Dividenden jeweils in das Numerairewertpapier S 0 investiert werden.
Dies wird deutlich, wenn man sich mit dem vorigen Abschnitt daran erinnert, dass die diskontierten Dividenden bis n durch S10 • Dn gegeben sind. Der Gegenwert der kumulierten
und durch Anlage in S 0 verzinsten Dividenden in Währungseinheiten ist also Sn0 ( S10 • Dn ).
Die Definition der imaginären Strategie ist so konstruiert, dass die Aussagen 1 und 2 im
folgenden Lemma gelten, d. h. dass Gewinne und Verluste von ϕ unter S denen von ϕ im
realen Markt entsprechen.
Lemma 3.23
1. Für jede Strategie ϕ gilt V (ϕ) = V (ϕ), wobei V (ϕ) der Vermögensprozess von ϕ bezüglich des imaginären Preisprozesses S sei.
3.3. WERTPAPIERE MIT DIVIDENDEN
47
2. Eine Handelsstrategie ϕ ist genau dann selbstfinanzierend (bezüglich S, D), wenn die
zugehörige imaginäre Strategie ϕ selbstfinanzierend bezüglich S ist.
3. Jeder vorhersehbare Rd+1 -wertige Prozess ψ lässt sich in der Form ψ = ϕ mit einem
vorhersehbaren Rd+1 -wertigen Prozess ϕ schreiben.
4. Für die diskontierten Größen gilt Ŝ = Ŝ + D̂.
5. Sei Q ein zu P äquivalentes Wahrscheinlichkeitsmaß. Ŝ ist genau dann ein Q-Martingal, wenn Ŝ + D̂ ein Q-Martingal ist.
Beweis. 1. Nach Definition und partieller Integration gilt
1 • i
i
i
0
∆S n = ∆Sn + ∆ S
D
S0
n
1
1
i
0
0
i
•
Dn− ∆Sn + Sn ∆ 0
= ∆Sn +
S0
S
1
0
i
• Di
= ∆Sni +
n− ∆Sn + ∆Dn
S0
und
1
i
S in− − Sn−
0
∆S
=
n
0
Sn−
S0
•
•
D
i
n
i
Dn−
∆Sn0 .
(3.2)
(3.3)
Zusammen folgt
V n (ϕ) =
d
X
i=0
d
X
ϕin S in
i
S in− − Sn−
i
0
=
Sn
Sn −
0
S
n−
i=0
d
i
X
S in− − Sn−
i
i
0
i
0
=
ϕn S n− + ∆S n −
(Sn− + ∆Sn )
0
S
n−
i=0
=
=
d
X
ϕin
i
ϕin ∆Sni + ∆Dni + Sn−
i=0
ϕ>
n (S
+ ∆D)n = Vn (ϕ)
wie behauptet.
2. Nach Lemma 3.17 ist ϕ genau dann selbstfinanzierend, wenn
V (ϕ) − V 0 (ϕ) = ϕ • S.
(3.4)
Analog ist nach Lemma 3.3 ist ϕ genau dann selbstfinanzierend, wenn
V (ϕ) − V0 (ϕ) = ϕ • (S + D).
(3.5)
48
KAPITEL 3. MATHEMATISCHE MARKTMODELLIERUNG
Da die linken Seiten von (3.4, 3.5) nach 1. übereinstimmen, bleibt zu zeigen, dass auch die
rechten Seiten übereinstimmen, oder äquivalent dazu, dass
ϕ>
∆S n = ϕ>
n ∆(S + D)n
n
für n = 1, 2, . . . Dies folgt mit (3.2, 3.3) aus
ϕ>
∆S n
n
=
=
=
d
X
i=0
d
X
ϕin
∆S in
i
S in− − Sn−
∆Sn0
−
0
Sn−
ϕin (∆Sni + ∆Dni )
i=0
ϕ>
n ∆(S
+ D)n .
3. Dies folgt durch Auflösen der Definitionsgleichung nach ϕ.
4. Ŝ = S10 S = Ŝ + S10 • D = Ŝ + D̂
5. Dies folgt sofort aus 4.
Wie schon angedeutet, können auf die imaginären Prozesse S, ϕ alle bisherigen Resultate angewandt werden, da für sie keine Dividenden ausgeschüttet werden und da sich Selbstfinanzierungsbedingung und Arbitragefreiheit von den realen auf die imaginären Größen
übertragen. Durch Ausdrücken der Ergebnisse mittels S und D erhält man dann Aussagen
für Märkte mit Dividenden. Wir illustrieren dies anhand des Fundamentalsatzes, der schon
im vorigen Abschnitt behandelt wurde.
Korollar 3.24 (1. Fundamentalsatz der Preistheorie) Der Markt ist genau dann arbitragefrei, wenn es ein äquivalentes Martingalmaß für Ŝ + D̂ gibt, d. h. ein Wahrscheinlichkeitsmaß Q ∼ P derart, dass Ŝ + D̂ ein Q-Martingal ist.
Beweis. Die Arbitragefreiheit des durch S, D gegebenen Marktes ist wegen Aussagen 1–3
des vorigen Lemmas äquivalent zur Arbitragefreiheit des dazugehörigen dividendenkorrigierten Marktes. Ferner sind nach Aussage 5 desselben Lemmas die äquivalenten Martingalmaße für Ŝ genau jene für Ŝ + D̂. Die Behauptung folgt daher aus dem gewöhnlichen
Fundamentalsatz 3.9.
3.4
Konkrete Marktmodelle
Die bisherigen allgemeinen Aussagen gelten ganz unabhängig von der Verteilung der Preisprozesse. Zur Berechnung von Preisen und Strategien in den nächsten Kapiteln kommen
wir aber um konkrete Modelle nicht herum. Deren Konstruktion ist eine delikate Aufgabe,
bei der unterschiedliche Zielsetzungen eine Rolle spielen. Sie sollten der ökonomischen
Intuition zumindest nicht widersprechen und im Rahmen der Finanzmathematik handhabbar
sein. Den entscheidenden Prüfstein bildet aber die Verträglichkeit mit realen Finanzdaten,
3.4. KONKRETE MARKTMODELLE
49
über die in der Regel mit statistischen Methoden entschieden werden muss. Wir stellen an
dieser Stelle ein einfaches Marktmodell für zwei Wertpapiere vor.
Eine Anlage in Form von Bargeld unser Finanzmarktmodell nicht vor. An seine Stelle
tritt das folgende festverzinsliche Bankkonto (Geldmarktkonto, Sparkonto, Anleihe)
Sn0 = S00 exp(rn) = S00 (1 + r̃)n = S00 E (r̃I)n
(3.6)
mit r ∈ R, r̃ := er − 1 und In = n für n ∈ N. Es entspricht einer vollkommen risikolosen
Anlage mit festem Zins, der nicht in Währungseinheiten ausbezahlt, sondern diesem Sparkonto gutgeschrieben und dadurch mitverzinst wird. Vereinfachend wird angenommen, dass
es sich bei dem Zins r̃ um eine deterministische Konstante handelt. Wegen seiner einfachen
Struktur bietet sich das Sparkonto als natürlicher Numeraire an, auch wenn im Grunde jede
handelbare Anlage diese Rolle übernehmen könnte. Man beachte, dass die Existenz eines
solchen Wertpapiers nicht der Arbitragefreiheit im Sinne von Definition 3.7 widerspricht,
obleich das Sparkonto in gewissem Sinne risikolose Gewinne abwirft.
Das Sparkonto kann auch in negativen Stückzahlen gehalten werden, was einem Kredit
entspricht, der mit derselben Rate wie ein mögliches Guthaben verzinst wird. In der Realität ist die Zinsstruktur natürlich wesentlich komplizierter als in diesem Modell mit festem
Zins. Es gibt lang- und kurzfristige Anlagen mit mehr oder weniger variablem Zins, der zu
verschiedenen Zeitpunkten ausbezahlt wird.
Als erstes und einziges nichttriviales Wertpapier betrachten wir eine Aktie oder Fremdwährung, deren Kursverlauf in folgender Form angenommen wird:
n
Y
1
1
1
em ) = S 1 E (X)
e n.
Sn = S0 exp(Xn ) = S0
(1 + ∆X
(3.7)
0
m=1
Hierbei seien ∆X1 , ∆X2 , . . . unabhängig und identisch verteilt, X0 = 0 und
n
X
e
Xn :=
(e∆Xn − 1).
(3.8)
m=1
Der Aktienpreisprozess hat im Prinzip dieselbe Struktur wie die Anleihe, nur dass hier der
en für den Zeitraum von n − 1 bis n in zufälliger Weise variiert, verursacht etwa
„Zins“ ∆X
durch den Eingang von unerwarteten Nachrichten und Informationen, die die Gewinnerwartungen der Anleger und damit den Kurs positiv oder negativ beeinflussen.
Im klassischen Standardmarktmodell werden die täglichen logarithmischen Renditen
e
∆Xn zudem als normalverteilt vorausgesetzt, d. h. das Modell ist durch zwei Parameter
µ, σ 2 vollständig bestimmt. Diese Parameter bestimmt man durch Schätzung aus den in der
Vergangenheit beobachteten Kursdaten. Da die logarithmischen Renditen
1 Sn
∆Xn = log
1
Sn−1
in diesem Modell unabhängig und identisch verteilt sind mit Erwartungswert µ und Varianz
σ 2 , liegt die Wahl der Standardschätzer
N
1 X
µ̂ :=
∆Xn ,
N n=1
50
KAPITEL 3. MATHEMATISCHE MARKTMODELLIERUNG
N
σ̂
2
1 X
:=
(∆Xn − µ̂)2
N − 1 n=1
nahe, wenn als Datengrundlage die Beobachtung von Sn , n = 1, . . . , N zur Verfügung steht.
Angesichts seiner sehr einfachen Struktur beschreibt dieses Standardmodell reale Finanzdaten recht gut. Einer genaueren Untersuchung hält es jedoch nicht stand. Die immer
wieder beobachteten typischen Abweichungen haben zur Betrachtung einer Vielzahl alternativer Modelle geführt. Wir wollen dies kurz anhand eines Beispiels illustrieren. In Abb.
3.1 ist der Kursverlauf des deutschen Aktienindex DAX von April 1991 bis April 2001 abgebildet. Eine Simulation von Aktienindexdaten, die auf Gleichung (3.7) mit normalverteilten
logarithmischen Renditen beruht, ist in Abb. 3.2 gegenübergestellt. Qualitativ sehen sich
diese Kursverläufe recht ähnlich. Etwas aufschlussreicher ist die Darstellung der täglichen
1
) in Abb. 3.3. Im Modell handelt es sich
logarithmischen Renditen ∆Xn = log(Sn1 /Sn−1
dabei um unabhängige, identisch normalverteilte Zufallsvariablen. Die tatsächlich beobachteten Daten weichen von einer entsprechenden Simulation (Abb. 3.4) in zweierlei Hinsicht
ab. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von stylized facts. Zum einen treten große
Kursänderungen viel häufiger auf, als es dem Modell (3.7) mit einer zu den Daten passenden
Varianz entspricht (heavy tails). Mehrmals traten im dargestellten Zeitraum Kursänderungen von mehr als 6% auf. Dies kommt im Normalverteilungsmodell im Mittel nur alle 1300
Jahre vor. Gerade solche Kurssprünge bergen aber ein gewaltiges Anlagerisiko. Man sollte
sich daher stets fragen, in welchem Maße die anhand eines möglicherweise unpassenden
Modells gewonnenen finanzmathematischen Resultate auf reale Gegebenheiten angewandt
werden können.
Der angesprochene Mangel liegt aber weniger im Modell (3.7) an sich, als vielmehr
in der Wahl der Normalverteilung begründet. Diese wird gewöhnlich durch den zentralen
Grenzwertsatz motiviert, demzufolge sich die Summe vieler kleiner leidlich unabhängiger Einflüsse approximativ normalverteilt verhält. Tägliche Kursänderungen können aber
durchaus durch einzelne große Kursänderungen dominiert sein, so dass die Normalverteilungsannahme ihrer Grundlage entbehrt. Exemplarisch ist in Abb. 3.5 eine Simulation mit
einer Normal-invers-Gaußschen Verteilung dargestellt, die im Vergleich zur Normalverteilung bei gleicher Varianz mehr Masse in den Enden und im Zentrum besitzt.
Die Gegenüberstellung der Abbildungen 3.3 und 3.4, 3.5 macht jedoch noch einen weiteren Unterschied deutlich, der nun tatsächlich das Modell (3.7) betrifft. Große und kleine
Kursänderungen treten im realen Datensatz jeweils gehäuft auf (volatility clustering). Dieses
Verhalten kommt bei Prozessen mit unabhängigen, stationären Zuwächsen nicht vor und ist
daher mit unserem obigen Modell auch dann nicht verträglich, wenn man von der speziellen
Wahle der Normalverteilung absieht.
Ein Ausweg besteht darin, die Zuwächse ∆Xn in (3.7) in der Form
∆Xn = σn ∆Zn
anzusetzen, wobei ähnlich wie oben unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen ∆Z1 ,
3.4. KONKRETE MARKTMODELLE
51
8000
6000
4000
2000
0
0
500
1000
1500
2000
Handelstage
Abbildung 3.1: Kursverlauf des DAX April 1992 – April 2001
8000
6000
4000
2000
0
0
500
1000
1500
Handelstage
Abbildung 3.2: Kurssimulation nach Gleichung (3.7)
2000
52
KAPITEL 3. MATHEMATISCHE MARKTMODELLIERUNG
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Handelstage
Abbildung 3.3: Tägliche logarithmische Renditen des DAX
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Handelstage
Abbildung 3.4: Simulation täglicher normalverteilter Renditen
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Handelstage
Abbildung 3.5: Simulation täglicher normal-invers Gaußscher Renditen
3.4. KONKRETE MARKTMODELLE
53
∆Z2 , . . . für die täglichen Kursänderungen sorgen. Diese werden aber mit einem zeitlich
langsamer variierenden, positiven und vorhersehbaren Prozess σ multipliziert, dessen Gegenwart dazu führt, dass sich ruhige Phasen mit kleinem σn und turbulente Zeiten mit
großem σn abwechseln. Die konkrete Spezifikation und Schätzung eines parametrischen
Modells für ∆Z, σ gehört in den Bereich Statistik und Ökonometrie. Wie oben angesprochen sollte ein solches reale Daten gut beschreiben, sich gut schätzen lassen und finanzmathematischen Methoden zugänglich sein. Einem weiteren allgemeinen Grundsatz zufolge
zieht man aufwändige Modelle nur dann einfachen Modellen mit wenigen Parametern vor,
falls letztere reale Daten nicht hinreichend gut abbilden. Ob dies der Fall ist, hängt insbesondere auch davon ab, zu welchem Zweck das Modell eingesetzt wird.
8.12.08
Kapitel 4
Bewerten und Hedgen von Derivaten
Unter Derivaten versteht man Wertpapiere oder Verträge, deren Wert in mehr oder weniger
komplexer Weise vom Preis oder Kurs anderer, zugrundeliegender Wertpapiere oder Waren
abhängt. Oft handelt es sich dabei um Termingeschäfte, d. h. es wird vertraglich vereinbart,
ein bestimmtes Geschäft in der Zukunft zu einem jetzt schon vereinbarten Preis zu tätigen.
Der Abschluss eines Termingeschäfts kann einerseits dazu dienen, die eigene Abhängigkeit
von Kursschwankungen zu reduzieren, bedeutet aber für die Gegenseite, einem möglicherweise großen Risiko ausgesetzt zu werden. Daher besteht eine der zentralen Fragen der
Finanzmathematik darin, wie das z. B. aus dem Verkauf eines Derivats entstehende Risiko durch Handel mit den zugrundeliegenden Wertpapieren reduziert oder abgesichert (neudeutsch gehedgt) werden kann. Eng damit zusammen hängt das ebenfalls wichtige Problem,
einen fairen oder in gewissem Sinne rationalen Preis für ein Termingeschäft festzulegen.
Für eine genauere Analyse unterscheiden wir grundsätzlich zwei verschiedene Situationen. Im ersten, in Abschnitt 4.2 behandelten Fall ist das Derivat seinerseits ein liquide an der
Börse gehandeltes Wertpapier, auf das somit die Resultate des vorigen Kapitels angewendet
werden können. Der Schlüssel zur Beantwortung der obigen Fragen liegt dann in der plausiblen Annahme der Arbitragefreiheit, die wir schon im letzten Kapitel kennengelernt haben.
Bisweilen hat diese unscheinbare Annahme weitreichende Konsequenzen; in anderen Fällen
dagegen hilft sie nicht viel weiter.
Alternativ kann ein Termingeschäft aber auch zwischen zwei Parteien (over-the-counter,
OTC) abgeschlossen werden. In diesem in Abschnitt 4.3 diskutierten Fall hat man es eher mit
einer individuellen Perspektive statt einer Marktsichtweise zu tun. Letztendlich ergeben sich
aber ähnliche Ergebnisse, so dass in der Literatur oft nicht klar nach der unterschiedlichen
Ausgangssituation differenziert wird.
Unser allgemeines Marktmodell besteht wie im letzten Kapitel aus einem filtrierten
Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, F , (Fn )n=0,...,N , P ) mit Endzeitpunkt N ∈ N und einem
Rd+1 -wertigen Wertpapierpreisprozess S = (S 0 , . . . , S d ) mit positivem Numeraire S 0 . Der
Markt sei arbitragefrei im Sinne von Definition 3.7. Der Einfachheit halber setzen wir voraus, dass FN = F und F0 = {∅, Ω}. Das bedeutet, dass wir in unserem Marktmodell den
Anfangszustand als deterministisch oder festgelegt betrachten und dass der Zufall erst ab
54
4.1. TERMINGESCHÄFTE
55
Zeitpunkt 1 ins Geschehen eingreift.
4.1
Termingeschäfte
Viele, wenn auch nicht alle tatsächlich gehandelten Termingeschäfte lassen sich durch eine
Zufallsvariable X beschreiben, die den Wert des Vertrages zum Endzeitpunkt N angibt. Wir
betrachten einige Beispiele.
1. Eine europäische Kauf- oder Call-Option gibt dem Besitzer das Recht, eine festgelegte Menge eines zugrundeliegenden Gutes an einem festgelegten Zeitpunkt (Fälligkeit)
zu einem festgelegten Preis (Basispreis) zu erwerben. Eine Verpflichtung zum Kauf
besteht nicht.
Eine solche Option lässt sich leicht als Zufallsvariable X darstellen. Wenn der Marktpreis des Gutes zum Fälligkeitszeitpunkt unterhalb des Basispreises liegt, ist die Option wertlos; liegt er hingegen oberhalb, so ist der Wert der Option die Differenz von
Marktpreis und Basispreis. Selbst wenn nämlich der Besitzer der Option kein Interesse am Erwerb des Gutes hat, kann er durch dessen sofortigen Verkauf zu Marktpreisen
diese Differenz als Gewinn realisieren. Eine Call-Option auf eine Einheit von Wertpapier S 1 mit Fälligkeit N und Basispreis K besitzt daher am Endzeitpunkt N den
Wert
1
1
X = (SN
− K)+ = max(SN
− K, 0).
Oft findet daher bei Optionsgeschäften gar keine Lieferung mehr statt, sondern es wird
nur noch der entsprechende Zahlungsausgleich vorgenommen. Dies kann in der Praxis wegen auftretender Transaktions- und Lagerhaltungskosten durchaus einen Unterschied bedeuten, den wir aber im Rahmen der hier gemachten idealisierenden Annahmen vernachlässigen.
Wird nur ein reiner Zahlungsausgleich vorgenommen, kann der Preis des zugrundeliegenden Gutes im Prinzip durch jede andere wohldefinierte Größe ersetzt werden,
auch wenn es sich nicht im engeren Sinn um einen Preis handelt. So gibt es z. B.
Optionen auf Indizes.
2. Die europäische Verkaufs- oder Put-Option entspricht direkt dem Call, nur dass hier
ein Recht auf Verkauf statt auf Kauf des Gutes besteht. Ansonsten gilt das oben Gesagte. Eine Put-Option auf eine Einheit von Wertpapier S 1 mit Fälligkeit N und Basispreis K besitzt dementsprechend am Endzeitpunkt N den Wert
1 +
X = (K − SN
) .
3. Bei amerikanischen Call/Put-Optionen kann der Besitzer die Option zu jedem beliebigen Zeitpunkt bis zum Verfall ausüben. Er muss also nicht bis zur Fälligkeit warten.
Insofern liegt hier im Gegensatz zu den europäischen Optionen ein echtes Wahlrecht
56
KAPITEL 4. BEWERTEN UND HEDGEN VON DERIVATEN
vor. Dies erschwert die mathematische Behandlung, da der Verkäufer oder Stillhalter
der Option jetzt zusätzlich mit der Unsicherheit konfrontiert ist, zu welchem Zeitpunkt
das Kauf- bzw. Verkaufsrecht wahrgenommen wird. Amerikanische Optionen lassen
sich im allgemeinen nicht wie europäische in Form einer Zufallsvariablen ausdrücken.
4. Bei einem Forward-Geschäft wird vertraglich vereinbart, eine festgelegte Menge eines zugrundeliegenden Gutes an einem festgelegten Zeitpunkt (Fälligkeit) zu einem
festgelegten Preis (Forwardpreis) zu erwerben. Im Gegensatz zur Call-Option handelt es sich hier um eine Verpflichtung. Der Forwardpreis wird dabei so gewählt, dass
dieser Vertrag zu dem Zeitpunkt, an dem er geschlossen wird, nichts kostet. Man beachte den folgenden wichtigen, die Bezeichnungsweise betreffenden Unterschied zu
Call/Put-Optionen: Unter dem Optionspreis versteht man im Gegensatz zum Forwardpreis nicht den Basispreis, zu dem das Gut bei Fälligkeit gehandelt wird, sondern den
Preis, den die Option als eigenes Wertpapier hat.
Zur Darstellung in Form einer Zufallsvariablen betrachten wir ein Forwardgeschäft
auf eine Einheit von Wertpapier S 1 mit Fälligkeit N , das am Zeitpunkt n ∈
{0, . . . , N } zum Forwardpreis On abgeschlossen wird. Der Wert des Forwards zum
Zeitpunkt N beläuft sich dann auf
1
X = SN
− On ,
1
denn statt des Marktpreises SN
muss der Besitzer des Forwards „nur“ den vereinbarten Betrag On zum Erwerb von S 1 aufwenden, der allerdings auch höher als der
Marktpreis sein kann.
5. Forward-Geschäfte werden in der Regel zwischen zwei Parteien (over-the-counter)
abgeschlossen. Die börsengehandelte Version heißt Future und unterscheidet sich
vom Forward durch ein buchhalterisches Detail, das das Verständnis etwas erschwert.
Während beim Forward erst am Fälligkeitszeitpunkt Zahlungen erfolgen, geschieht
dies beim Future jeden Tag. Je nachdem, ob der Marktpreis des zugrundeliegenden
Gutes gestiegen oder gefallen ist, wird den Handelspartnern die entsprechende Preisänderung auf einem sogenannten Marginkonto gutgeschrieben oder belastet (markingto-market).
Formal kann man sich einen Future als einen Vertrag vorstellen, in den bzw. aus dem
man jederzeit ohne Kosten ein- und aussteigen kann. Diesem Vertrag ist ein zeitlich
veränderlicher Kurs, der Futurespreis Un , zugeordnet, der dem obigen Forwardpreis
ähnelt. Am Fälligkeitszeitpunkt N des Futures ist der Futurespreis wie beim Forward
1
durch den Preis eines zugrundeliegenden Gutes festgelegt (z. B. UN = SN
). Solange
man den Future besitzt, wird einem jeden Tag die Futurespreisänderung Un −Un−1 gegenüber dem Vortag gutgeschreiben bzw. belastet. Lässt man die anfallenden Zinsen
außer Acht, dann addieren sich die Gut- und Lastschriften zwischen n und N also zu
1
SN
− Un , was der Auszahlung des Forwards entspricht, wenn man den Futurespreis
4.2. MARKTBEWERTUNG
57
durch den Forwardpreis ersetzt. Wegen der täglichen, mit zwischenzeitlichen Zinszahlungen verbundenen Zahlungströme lässt sich ein Future im allgemeinen nicht als
zufällige Auszahlung in Form einer Zufallsvariablen darstellen.
4.2
Marktbewertung
Auch wenn nicht alle tatsächlich gehandelten Derivate in dieser Form darstellbar sind, nennen wir FN -meßbare Zufallsvariablen X alternativ (zufällige) Auszahlung, Derivat oder
Option. Die Zufallsvariable X steht dabei für den Wert des Vertrages zum Zeitpunkt N und
X̂ :=
X
0
SN
dementsprechend für die diskontierte Auszahlung. Wir betrachten eine zufällige Auszahlung in diesem Abschnitt als eigenständiges, an der Börse gehandeltes Wertpapier S d+1 , das
zu jedem Zeitpunkt n = 0, . . . , N einen Preis Snd+1 besitzt. Es soll hier um die Frage gehen,
was über diesen Preis ausgesagt werden kann.
Das folgende Korollar zeigt, dass die Arbitragefreiheit die Menge der möglichen
Derivatpreisprozesse durch eine Martingalbedingung einschränkt. Die einzig möglichen Optionspreise sind demgemäß bedingte Erwartungswerte unter äquivalenten Martingalmaßen.
d+1
Korollar 4.1 Sei X eine zufällige Auszahlung. Ein Derivatpreisprozess S d+1 mit SN
=X
0
d+1
führt genau dann zu einem arbitragefreien Markt (S , . . . , S ), wenn ein äquivalentes
Martingalmaß Q für den Markt (Ŝ 0 , . . . , Ŝ d ) existiert mit X̂ ∈ L1 (Q) und
Ŝnd+1 = EQ (X̂|Fn )
für n = 0, . . . , N .
Beweis. ⇐: Dies folgt aus dem ersten Fundamentalsatz 3.9, da Q ÄMM für (S 0 , . . . , S d+1 )
ist.
⇒: Nach dem ersten Fundamentalsatz 3.9 existiert ein ÄMM Q für (S 0 , . . . , S d+1 ).
d+1
Insbesondere ist X̂ = ŜN
∈ L1 (Q).
In manchen Fällen legt die Arbitragefreiheit den Derivatpreisprozess sogar eindeutig
fest. Dies ist bei duplizierbaren Auszahlungen im Sinne der folgenden Definition der Fall.
Definition 4.2 Eine zufällige Auszahlung X heißt duplizierbar oder erreichbar, falls eine selbstfinanzierende Strategie ϕ mit X = VN (ϕ) f. s. existiert. In diesem Fall heißt ϕ
(perfekte) Hedgingstrategie von X.
Bemerkung. Eine zufällige Auszahlung ist offenbar genau dann duplizierbar, wenn ein x ∈
R und ein Rd -wertiger stochastischer Prozess ϕ mit
X̂ = x + ϕ • ŜN
10.12.08
58
KAPITEL 4. BEWERTEN UND HEDGEN VON DERIVATEN
existieren, wobei Ŝ hier als Rd -dimensionaler Prozess (Ŝ 1 , . . . , Ŝ d ) interpretiert wird (vgl.
Bezeichnung 3.1).
Bei erreichbaren Auszahlungen macht es keinen Unterschied, ob man die Option selbst
oder das entsprechende duplizierende Portfolio ϕ besitzt — der Kontostand am Fälligkeitszeitpunkt ist derselbe. Eine solche Option ist also im dem Sinne überflüssig oder redundant,
als sie in Form der dynamischen Handelsstrategie ϕ ohnehin schon am Markt erhältlich ist.
Es liegt nahe, dass der Marktpreis eines solchen Derivats mit dem Wert dieser duplizierenden Strategie übereinstimmt.
Satz 4.3 Für jede zufällige Auszahlung X sind die folgenden Aussagen äquivalent:
1. X ist durch eine selbstfinanzierende Strategie ϕ duplizierbar.
2. Es gibt (bis auf fast sichere Gleichheit) genau einen Derivatpreisprozess S d+1 mit
d+1
X = SN
, so dass (S 0 , . . . , S d+1 ) ein arbitragefreier Markt ist.
3. Für jedes ÄMM Q mit X̂ ∈ L1 (Q) führt die Definition Ŝnd+1 := EQ (X̂|Fn ) zum
selben Prozess S d+1 .
In diesem Fall gilt S d+1 = V (ϕ) f. s.
Beweis. 1⇒2: Zum Beweis der Existenz definiere S d+1 := V (ϕ). Definiere Sei ψ ein Rd+1 wertiger vorhersehbarer Prozess mit ψ • (Ŝ 1 , . . . , Ŝ d+1 )N ≥ 0. Wegen
ψ • (Ŝ 1 , . . . , Ŝ d+1 )N =
Pd
i
+ ψ d+1 • (ϕ • Ŝ)N
ψ i • ŜN
=
Pd
i
ψ i • ŜN
+ (ψ d+1 • ϕ) • ŜN
=
i=1
i=1
1
ψ + ψ d+1 ϕ1 , . . . , ψ d + ψ d+1 ϕd
•
ŜN
und der Arbitragefreiheit von S ist ψ • (Ŝ 1 , . . . , Ŝ d+1 )N = 0. d. h. der erweiterte Markt
(S 0 , . . . , S d+1 ) ist arbitragefrei.
Für den Beweis der Eindeutigkeit sei S d+1 nun ein beliebiges Semimartingal mit Endwert X = VN (ϕ), so dass (S 0 , . . . , S d+1 ) arbitragefrei ist. Nach Lemma 3.8 gilt dann
S d+1 = V (ϕ).
2⇒3: Korollar 4.1
3⇒1: Wenn X nicht duplizierbar ist, existiert nach Lemma 3.14 ein ÄMM Q für S mit
X̂ ∈ L1 (Q). Nach Satz 1.8, angewandt auf L1 (Q), die abgeschlossene Teilmenge M :=
(R + RN ) ∩ L1 (Q) (vgl. Lemma 3.13) und x0 := X̂ ∈
/ R + RN , gibt es ein ξ ∈ L∞ (Q) mit
1
EQ (ξx) < EQ (ξx0 ) für alle x ∈ (R + RN ) ∩ L (Q). Da R + RN ein Vektorraum ist, folgt
EQ (ξx) = 0 für alle x ∈ (R + RN ) ∩ L1 (Q).
e := (1 + ξ )Q. Wegen EQ (ξ) = 0 ist Q
e ein WahrscheinlichDefiniere nun Q
2kξk∞
1
keitsmaß. Ferner ist EQe (x) = EQ (x) + 2kξk
EQ (ξx) = 0 für alle x ∈ RN ∩ L1 (Q).
∞
e
Wie im Beweis von Lemma 3.14 folgt, dass Ŝ 1 , . . . , Ŝ d Q-Martingale
sind. Es ist aber
EQe (X̂) = EQ (X̂) +
1
E (ξx0 )
2kξk∞ Q
> EQ (X̂) und somit EQe (X̂|F0 ) 6= EQ (X̂|F0 ),
4.2. MARKTBEWERTUNG
59
d. h. Aussage 3 gilt nicht für X.
In der Situation des vorigen Satzes ist der Preisprozess S d+1 der einzige, der insofern
fair ist, als kein Marktteilnehmer in Form von risikolosen Gewinnen vom Derivat profitieren
kann.
Definition 4.4 Falls eine zufällige Auszahlung X duplizierbar ist, nennen wir S d+1 aus Satz
4.3 den (eindeutigen) fairen Preisprozess von X.
Für duplizierbare Auszahlungen haben wir befriedigende Antworten auf die Frage nach
möglichen Marktpreisen gefunden. In glücklichen, aber leider eher seltenen Ausnahmefällen lässt sich schon jede zufällige Auszahlung duplizieren.
Definition 4.5 Der Markt heißt vollständig, falls jede zufällige Auszahlung X duplizierbar
ist, für die X̂ beschränkt ist. Der Markt heißt perfekt, falls sogar jede zufällige Auszahlung
duplizierbar ist.
Ähnlich der Arbitragefreiheit kann man auch die Vollständigkeit mit Hilfe von äquivalenten Martingalmaßen charakterisieren, wie der folgende Satz zeigt.
Satz 4.6 (2. Fundamentalsatz der Preistheorie) Für einen arbitragefreien Markt sind
äquivalent:
1. Der Markt ist perfekt.
2. Der Markt ist vollständig.
3. Es gibt genau ein äquivalentes Martingalmaß.
Beweis. 1⇒2: Das ist offensichtlich.
2⇒3: Für gegebenes A ∈ FN definiere die zufällige Auszahlung X̂ := 1A . Nach Satz
4.3 (1⇒3) stimmt EQ (X̂|F0 ) = Q(A) für alle ÄMM Q überein. Somit gibt es nur ein
ÄMM.
3⇒1: Dies folgt aus Satz 4.3 (3⇒1).
15.12.08
In vollständigen Marktmodellen braucht nur die Verteilung der zugrundeliegenden Wertpapiere spezifiziert zu werden; die Dynamik aller Derivate ist dadurch schon eindeutig festgelegt. Wir werden ein solches Modell in Abschnitt 4.4 kennenlernen. Andernfalls schränkt
die Arbitragetheorie die möglichen Preisentwicklungen zwar ein (vgl. Korollar 4.1), bisweilen aber nur in geringem Maße, wie wir in Abschnitt 4.4.4 sehen werden.
Das folgenden Aussagen zeigen, dass die Anzahl der möglichen Kursentwicklungen in
vollständigen Marktmodellen stark eingeschränkt ist.
Satz 4.7 Der Markt sei arbitragefrei und vollständig. Dann gibt es für n = 0, . . . , N und
k1 , . . . , kn ∈ {0, . . . , d} Mengen Fk1 ,...,kn ∈ F mit den folgenden Eigenschaften:
60
KAPITEL 4. BEWERTEN UND HEDGEN VON DERIVATEN
1. Für alle n bildet (Fk1 ,...,kn )(k1 ,...,kn )∈{0,...,d}n eine Zerlegung von Ω.
2. Für alle n und alle k1 , . . . , kn gilt Fk1 ,...,kn−1 ,kn ⊂ Fk1 ,...,kn−1 .
3. Für festes n und k1 , . . . , kn sind alle Fn -messbaren Zufallsvariablen auf der Menge
Fk1 ,...,kn f. s. konstant.
Beweis. 1. Schritt: Sei m ∈ {0, . . . , N }. Offenbar ist der verkürzte Markt mit Preisprozess
(Sn )n=0,...,m und Zeithorizont m anstelle N ebenfalls arbitragefrei. Wir zeigen zunächst,
dass er auch vollständig ist, wenn in der Definition der Duplizierbarkeit nur Fm -messbare
Auszahlungen betrachtet werden.
O. B. d. A. sei S 0 = 1, d. h. wir betrachten diskontierte Größen. Sei X eine beschränkte Fm -messbare Zufallsvariable und ϕ eine dazugehörige duplizierende Strategie im ursprünglichen Markt mit N Perioden. Ferner sei Q ein äquivalentes Martingalmaß. Dann ist
V (ϕ) = V0 (ϕ + ϕ • S) ein Q-lokales Martingal mit beschränktem Endwert VN (ϕ) = X.
Folglich ist V (ϕ) sogar ein Q-Martingal, und es gilt
X = EQ (X|Fm ) = EQ (VN (ϕ)|Fm ) = Vm (ϕ).
Insbesondere ist X durch eine Handelsstrategie im verkürzten Markt mit Zeithorizont m
erreichbar.
2. Schritt: Wir zeigen nun die Aussage des Satzes durch Induktion nach N . Für N = 0
ist nichts zu zeigen, da alle F0 -messbaren Abbildungen konstant sind und somit F = Ω
gewählt werden kann.
Für den indirekten Beweis des Induktionsschritts von N − 1 nach N nehmen wir an,
dass die Aussage nicht gilt. Man überlegt sich leicht, dass dann mindestens eine der Mengen Fk1 ,...,kN −1 in d + 2 Mengen A1 , . . . , Ad+2 ∈ FN postiver Wahrscheinlichkeit zerlegt
P
d+2
} entwerden kann. Der d + 2-dimensionale Vektorraum U := { d+2
i=1 λi 1Ai : λ ∈ R
e
hält keine zwei Elemente, die fast sicher übereinstimmen. Der zugehörige Raum U von
Äquivalenzklassen FN -messbarer Zufallsvariablen, die mit Elementen von U fast sicher
übereinstimmen, hat also ebenfalls Dimension d + 2. Analog definieren wir einen 1 + ddimensionalen Vektorraum V := {c> SN 1Fk1 ,...,kN −1 : c ∈ R1+d } und den zugehörigen,
höchstens 1 + d-dimensionalen Raum Ve von Äquivalenzklassen FN -messbarer Zufallsvariablen, die mit Elementen von V fast sicher übereinstimmen.
Für beliebiges X ∈ U gibt es wegen der Vollständigkeit eine selbstfinanzierende Strategie ϕ mit
X = X1Fk1 ,...,kN −1 = VN (ϕ)1Fk1 ,...,kN −1 = ϕ>
N SN 1Fk1 ,...,kN −1
f. s.
e ⊂ Ve im Widerspruch zu dim U
e = d+2 > dim Ve .
Da ϕN auf Fk1 ,...,kN −1 konstant ist, folgt U
Korollar 4.8 Der Markt sei arbitragefrei und vollständig. Dann gibt es eine Menge M ⊂
R(1+d)×(1+N ) mit |M | ≤ (1 + d)N , so dass
P (Sni )i=0,...,d;n=0,...,N ∈
/ M = 0.
4.3. INDIVIDUELLE SICHTWEISE
61
Beweis. Dies folgt direkt aus dem vorigen Satz, da Sni für alle i, n FN -messbar ist.
4.3
Individuelle Sichtweise
In diesem Abschnitt betrachten wir Derivate, die direkt zwischen zwei Parteien, nicht aber
unbedingt an der Börse gehandelt werden. Insbesondere ist nicht klar, ob und zu welchem Preis ein solcher Vertrag zwischen Abschluss und Fälligkeit weiterverkauft werden
kann. Wir können daher in der zugehörigen Theorie nicht auf den Begriff des Derivatpreisprozesses zurückgreifen, da dieser ja gerade einen Marktpreis repräsentiert, zu dem
jederzeit ge- oder verkauft werden kann.
Der allgemeine mathematische Rahmen sei wie im vorigen Abschnitt, d. h. neben dem
Marktmodell für Wertpapiere S 0 , . . . , S d sei eine Zufallsvariable X gegeben, die die zufällige Auszahlung eines Derivats zum Zeitpunkt N beschreibt. Mit X̂ wird wieder die zugehörige diskontierte Auszahlung bezeichnet.
Wir nehmen eine asymmetrische Situation an, in der ein potentieller Käufer an einem
Derivat aus unbekannten Gründen interessiert ist. Der Verkäufer — etwa eine Bank — tritt
als reiner Dienstleister für den Käufer auf, hat aber kein eigenes Interesse an dem Derivat.
Für die Bank stellen sich zwei Fragen, um die es im folgenden gehen soll:
1. Welchen Preis für das Derivat soll bzw. kann sie von dem Käufer fordern?
2. Wie sichert sie sich gegen das Verlustrisiko ab, das ihr durch die zu leistende zufällige
Auszahlung bei Fälligkeit des Derivats entsteht?
Die Antwort auf diese Fagen wird im allgemeinen von verscheidenen Faktoren abhängen, insbesondere von der Einstellung der Bank gegenüber Risiken. Der Mindestpreis, der
für sie akzeptabel ist, kann ohne solche Zusatzinformationen nicht bestimmt werden. Wir
betrachten daher zunächst einleuchtende grobe Grenzen, die sich auf der Grundlage allgemeiner Betrachtungen ergeben.
Definition 4.9 Sei X eine zufällige Auszahlung. Wir nennen
πO (X) := inf {x ∈ R : Es existiert eine selbstfinanzierende Strategie ϕ
mit V0 (ϕ) = x und VN (ϕ) ≥ X}
oberen Preis und
πU (X) := sup {x ∈ R : Es existiert eine selbstfinanzierende Strategie ϕ
mit V0 (ϕ) = x und VN (ϕ) ≤ X}
unteren Preis der Option.
62
KAPITEL 4. BEWERTEN UND HEDGEN VON DERIVATEN
Inwiefern handelt es sich um rationale Grenzen für die Preis, die die Bank für das Derivat verlangen kann oder wird? Wenn sie als Optionsprämie x ≥ πO (X) erhält, kann sie
dafür ein selbstfinanzierendes Portfolio kaufen, dessen Endwert VN (ϕ) in jedem Fall ausreicht, die Zahlungsverpflichtungen X bei Fälligkeit der Option zu begleichen. Für die Bank
besteht also keinerlei Verlustrisiko. Abgesehen von einem kleinen Verwaltungszuschlag besteht daher kein Grund, einen vom Käufer gebotenen Preis x ≥ πO (X) nicht zu akzeptieren.
Auf der anderen Seite sollte die Bank mit keinem geringeren als dem unteren Preis zufrieden sein. Am Markt kann sie für jeden Betrag x < πU (X) ein selbstfinanzierendes Portfolio mit Endwert VN (ϕ) ≤ X verkaufen. Die damit verbundenen Zahlungsverpflichtungen
zum Zeitpunkt N sind nicht größer, als wenn sie die Option verkauft. Die Bank sollte anstelle der Option lieber an der Börse ein solches Portfolio verkaufen, wenn der Käufer nicht
bereit ist, mindestens πU (X) als Optionsprämie zu bezahlen. Zusammen folgt, dass der vernünftigerweise geforderte bzw. gebotene Preis zwischen πU (X) und πO (X) liegen sollte.
Im folgenden Satz werden diese Grenzen mit Hilfe von äquivalenten Martingalmaßen
charakterisiert.
Satz 4.10 Sei X eine zufällige Auszahlung.
1. Für den oberen Preis gilt
πO (X) = min {x ∈ R : Es existiert eine selbstfinanzierende Strategie ϕ
mit V0 (ϕ) = x und VN (ϕ) ≥ X}
n
o
0
1
= sup S0 EQ (X̂) : Q ÄMM mit X̂ ∈ L (Q) .
2. Für den unteren Preis gilt entsprechend
πU (X) := max {x ∈ R : Es existiert eine selbstfinanzierende Strategie ϕ
mit V0 (ϕ) = x und VN (ϕ) ≤ X}
n
o
= inf S00 EQ (X̂) : Q ÄMM mit X̂ ∈ L1 (Q) .
3. Falls X nicht duplizierbar ist, dann ist
n
o
S00 EQ (X̂) : Q ÄMM mit X̂ ∈ L1 (Q)
(4.1)
ein offenes Intervall (und andernfalls einelementig).
17.12.08
Beweis. 1. Seien ϕ eine selbstfinanzierende Strategie mit VN (ϕ) ≥ X und Q ein ÄMM mit
X̂ ∈ L1 (Q). Da V̂ (ϕ) ein Q-lokales Martingal ist, folgt induktiv V̂n (ϕ) ≥ EQ (X̂|Fn ) für
n = N, . . . , 0. Wegen V̂0 (ϕ) ≥ EQ (X̂|F0 ) = EQ (X̂) folgt πO ≥ sup{. . .}.
Nun sei umgekehrt x ≥ sup{S00 EQ (X̂) : Q ÄMM mit X̂ ∈ L1 (Q)}. Es bleibt zu zeigen, dass dann eine selbstfinanzierende Strategie ϕ mit V0 (ϕ) = x und VN (ϕ) ≥ X existiert.
Andernfalls gilt
x
+ ϕ • ŜN : ϕ vorhersehbarer Prozess − L0+ ,
X̂ ∈
/
S00
4.3. INDIVIDUELLE SICHTWEISE
also X̂ −
x
S00
63
∈
/ RN − L0+ = AN im Sinne von Abschnitt 3.2. Nach Lemma 3.14 gibt es ein
ÄMM Q mit X̂ − Sx0 ∈ L1 (Q) und EQ (X̂ − Sx0 ) > 0, also X̂ ∈ L1 (Q) und EQ (X̂)S00 >
0
0
x ≥ πO (X) im Widerspruch zur Voraussetzung.
2. Diese Aussage folgt analog durch Betrachtung von −X anstelle X.
3. {S00 EQ (X̂) : Q ÄMM mit X̂ ∈ L1 (Q)} ist ein Intervall, da die Menge der ÄMM
konvex ist.
Sei nun πO (X) = S00 EQ (X̂) für ein ÄMM Q mit X̂ ∈ L1 (Q). Sei ferner ϕ eine selbstfinanzierende Strategie mit V0 (ϕ) = πO (X) und VN (ϕ) ≥ X. Induktiv folgt
EQ (V̂N (ϕ) − X̂|Fn ) = V̂n (ϕ) − EQ (X̂|Fn )
für n = N, . . . , 0. Wegen V̂0 (ϕ) − EQ (X̂|F0 ) = π0S(X)
− π0S(X)
= 0 folgt VN (ϕ) = X, also
0
0
0
0
ist X duplizierbar. Analog ergibt sich die Aussage für die untere Intervallgrenze. Wenn X
duplizierbar ist, ist die angegebene Menge nach Satz 4.3 einelementig.
Wir haben oben argumentiert, dass die von der Bank geforderte Optionsprämie im Intervall
[πU (X), πO (X)]
h
n
o
0
1
= inf S0 EQ (X̂) : Q ÄMM mit X̂ ∈ L (Q) ,
n
oi
sup S00 EQ (X̂) : Q ÄMM mit X̂ ∈ L1 (Q)
(4.2)
liegen sollte. Der vorige Satz zeigt, das dieses Intervall bis auf die Intervallgrenzen mit der
Menge (4.1) der mit Arbitragefreiheit verträglichen Anfangswerte von Derivatpreisprozessen im Sinne des vorigen Abschnitts übereinstimmt. Insofern führen die unterschiedlichen
Situationen und Ansätze dennoch auf ähnliche Preisformeln.
In Satz 4.10 wurde auch gezeigt, dass das Infimum in der Definition des oberen Preises
angenommen wird. Man benötigt also genau den oberen Preis der Option, um sich eine
solche Superhedgingstratgie leisten zu können, die einen vollständig gegen das Risiko aus
dem Verkauf der Option absichert.
Definition 4.11 Sei X eine zufällige Auszahlung. Eine selbstfinanzierende Strategie ϕ mit
V0 (ϕ) = πO (X) und VN (ϕ) ≥ X heißt billigste Superhedgingstrategie für X.
Wenn das Intervall (4.2) einelementig ist, kann die Option nach Satz 4.10 perfekt gehedgt werden. In solchen Fällen besitzen die Fragen am Anfang dieses Abschnitts eine klare
Antwort. Die Bank verlangt für die Option den Preis πO = πU (zuzüglich Verwaltungskosten), und sie sichert sich durch Kauf des Duplikationsportfolios vollständig gegen Kursrisiken ab. Im allgemeinen Fall könnte die Bank entsprechend versucht sein, den oberen Preis
zu verlangen und sich durch Kauf der billigsten Superhedgingstrategie abzusichern. Wie wir
in Abschnitt 4.4.4 sehen werden, ist dieser aber mitunter so hoch, dass er kaum am Markt
durchsetzbar sein wird. Wir kommen auf diese Problematik in Kapitel 5 zurück.
64
4.4
KAPITEL 4. BEWERTEN UND HEDGEN VON DERIVATEN
Beispiele
Wir betrachten nun einige konkrete Beispiele, in denen zufällige Auszahlungen dupliziert
und daher auch eindeutig fair bewertet werden können.
4.4.1
Forward
Zur mathematischen Behandlung des Forwards betrachten wir eine zufällige Auszahlung der
1
0
Form X := SN
−K für ein K ∈ R. Ferner nehmen wir an, dass SN
deterministisch ist, etwa
weil es sich bei dem Numeraire wie im Standardmarktmodell ohnehin um ein Wertpapier
mit festem Zins handelt oder weil S 0 eine zur Zeit N fällige Nullkuponanleihe ist. Im Markt
0
S = (S 0 , S 1 ) hat die konstante und damit selbstfinanzierende Strategie ϕ := (−K/SN
, 1)
0
Sn
1
1
den Wert V (ϕ)n = Sn − K S 0 . Wegen VN (ϕ) = SN − K = X ist somit X duplizierbar,
N
und V (ϕ) ist der einzige mit Arbitragefreiheit verträgliche Preisprozess des Derivats. Sei
nun n ∈ {0, 1, . . . , N } fest gewählt. Der Forwardpreis On ist das K, das das Derivat bei
Vertragsabschluss zur Zeit n wertlos macht, d. h.
On = Sn1
0
SN
0
= Ŝn1 SN
.
Sn0
Ein Forward lässt sich also schon dann perfekt hedgen, wenn eine Anleihe mit festem
Zins existiert, die am Fälligkeitszeitpunkt des Forwards ausbezahlt wird. Über den Preisprozess des zugrundeliegenden Wertpapiers müssen jedoch keine Annahmen gemacht werden.
4.4.2
Future
Auf den ersten Blick scheint sich der Future der hier entwickelten Theorie durch seinen
komplexen Zahlungsstrom zu entziehen. Bei näherem Hinsehen lässt er sich jedoch als Wertpapier mit — bisweilen negativen — Dividendenausschüttungen auffassen. Dessen Wert an
sich ist dabei stets 0, da Einstieg in den und Kündigung des Vertrages jederzeit ohne Kosten möglich sind. Da man pro Futuresvertrag zum Zeitpunkt n gerade ∆Un = Un − Un−1
gutgeschrieben bekommt, kann man den Futurespreis U als einen Dividendenprozess inter1
pretieren, der der Nebenbedingung UN = SN
genügt.
0
Betrachten wir also formal den Markt S , S 1 , (S 2 , D2 ), wobei S 0 wie immer der Numeraire, S 1 das Bezugswertpapier des Futures und (S 2 , D2 ) = (0, U ) den Future als Wertpapier
mit Dividenden bezeichnen. S 0 wird als vorhersehbar vorausgesetzt. Wenn dieser Markt arbitragefrei ist, gibt es nach Korollar 3.21 ein Wahrscheinlichkeitsmaß Q ∼ P derart, dass
Ŝ 1 und Ŝ 2 + D̂2 = S10 • U Q-Martingale sind. O.B.d.A. ist dann auch U = S 0 • D̂2 ein
Q-Martingal, da es nach Lemma 2.20 ein Q-lokales Martingal ist und Q nach Lemma 3.14
so gewählt werden kann, dass U Q-integrierbar ist. Folglich ist
1
Un = EQ (UN |Fn ) = EQ (SN
|Fn )
4.4. BEISPIELE
65
für n = 0, . . . , N . Man beachte, dass hier nicht wie sonst der diskontierte Preis ein QMartingal ist, sondern der Futurespreisprozess selbst. Da es sich dabei nicht um einen
Preisprozess im engeren Sinne handelt, widerspricht dies nicht der Arbitragefreiheit.
Falls das Sparkonto S 0 deterministisch ist, folgt
1 0
0
1
0
Un = EQ (ŜN
SN |Fn ) = SN
EQ (ŜN
|Fn ) = Ŝn1 SN
= Sn1
0
SN
,
Sn0
d. h. der Futurespreis stimmt mit dem oben hergeleiteten Forwardpreis überein.
In diesem Fall lässt sich der Zahlungsstrom eines Futures durch Numeraire und Basiswertpapier duplizieren. Nach Abschnitt 3.3 gilt nämlich für den diskontierten Wertprozess
der nur aus dem Future bestehenden Strategie ϕ = (0, 0, 1):
V̂ (ϕ) = 0 +
1
S0
•
D2 =
1
S0
•
0 1
(SN
Ŝ ) =
0
SN
S0
•
Ŝ 1 .
Dies stimmt mit dem diskontierten Wert derjenigen selbstfinanzierenden Strategie ψ mit AnS0
fangskapital 0 überein, die zum Zeitpunkt n gerade ψn1 = SN0 Anteile des Basiswertpapiers
n
S 1 hält.
Wir haben oben die Gleichheit von Futures- und Forwardpreisprozess im Falle deterministischer Zinsen hergeleitet, ohne dass Verteilungsannahmen an S 1 gemacht werden mussten. Interessanterweise unterscheiden sich jedoch die zugehörigen Duplikationsstrategien.
Während man einen verkauften Forward durch Kauf genau einer zugrundeliegenden Aktie
0
/Sn0 Aktien, also insbesondere
hedgt, enthält das Duplikationsportfolio für den Future SN
eine zeitlich variable Anzahl.
4.4.3
Europäische Call- und Put-Optionen im Binomialmodell
Europäische Call- und Put-Optionen sind in der Regel nicht duplizierbar. Nur in sehr einfachen Marktmodellen wie dem hier vorgestellten Binomial- oder Cox-Ross-Rubinstein-Modell ist dies der Fall. Dieser Markt ist sogar vollständig, d. h. jede zufällige Auszahlung lässt
sich fair bewerten und perfekt hedgen.
Der Markt bestehe aus einer Anleihe und einer Aktie wie in Abschnitt 3.4. Konkreter
seien
Sn0 = S00 (1 + r̃)n
mit Konstanten S00 > 0, r̃ ≥ 0 und
Sn1 = S01
n
Y
em )
(1 + ∆X
m=1
e1 ,
mit einer Konstanten S01 > 0 und unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen ∆X
eN , wobei P (∆X
en = u − 1) = p = 1 − P (∆X
en = d − 1) mit 0 < d < 1 + r̃ < u
. . . , ∆X
und 0 < p < 1. Die Aktie kann in einer Zeiteinheit also nur um einen festen Prozentsatz
12.1.09
66
KAPITEL 4. BEWERTEN UND HEDGEN VON DERIVATEN
steigen oder um einen ebenfalls festen Faktor fallen. Der diskontierte Preisprozess lässt sich
darstellen als
n
n
Y
em
S 1 Y 1 + ∆X
Ŝn1 = 00
= Ŝ01
(1 + ∆X̂m ),
S0 m=1 1 + r̃
m=1
P
em
X
− 1) definiert sind.
wobei (X̂n )n=0,...,N durch X̂n := nm=1 ( 1+∆
1+r̃
1
Die Filtrierung (Fn )n=0,...,N sei von S erzeugt und F = FN wie bisher. Die gesamte
Information des Investors rührt also aus der Beobachtung des Kursverlaufs her. Da sich jedes der Tupel (S11 , . . . , Sn1 ), (Ŝ11 , . . . , Ŝn1 ), (∆X̂1 , . . . , ∆X̂n ) und (X̂1 , . . . , X̂n ) in messbarer
Weise durch jedes der anderen Tupel ausdrücken lässt, wird die Filtrierung wahlweise auch
von Ŝ 1 , ∆X̂ oder X̂ erzeugt.
Auf der Suche nach einem äquivalenten Martingalmaß definieren wir Q ∼ P durch
u
d
Q(∆X̂1 = x1 , . . . , ∆X̂N = xN ) = q |{n∈{1,...,N }:xn = 1+r̃ −1}| (1 − q)|{n∈{1,...,N }:xn = 1+r̃ −1}|
mit q := 1+r̃−d
. Anhand dieser Definition sieht man sofort, dass ∆X̂1 , . . . , ∆X̂N unter Q
u−d
u
en =
eine Folge unabhängiger Zufallsvariablen ist mit Q(∆X̂n = 1+r̃
− 1) = q = 1 − Q(∆X
d
− 1). Insbesondere ist ∆X̂n unter Q unabhängig von σ(∆X̂1 , . . . , ∆X̂n−1 ) = Fn−1 .
1+r̃
Wegen
EQ (∆X̂n |Fn−1 ) = EQ (∆X̂n )
u
d
= q( 1+r̃
− 1) + (1 − q)( 1+r̃
− 1)
=
1+r̃−d u−1−r̃
u−d
1+r̃
+
u−1−r̃ d−1−r̃
u−d
1+r̃
=0
ist X̂ ein Q-Martingal. Da Ŝ 1 wegen Ŝ 1 = Ŝ01 E (X̂) ein stochastisches Integral nach X̂ ist,
ist es nach Lemma 2.20 ebenfalls ein Q-lokales Martingal und wegen der Beschränktheit
sogar ein Q-Martingal. Der betrachtete Markt ist also arbitragefrei nach Satz 3.9.
Zur Betrachtung der Vollständigkeit sei Ŷ eine beliebige Zufallsvariable. Nach dem Martingaldarstellungssatz 2.29 gibt es eine reelle Zahl y und einen vorhersehbaren Prozess H
1
mit Ŷ = y + H • X̂N = y + ŜH1 • ŜN
. Aus der Bemerkung nach Definition 4.2 ergibt sich
−
die Vollständigkeit des Marktes.
Insbesondere lassen sich europäische Call- und Put-Optionen perfekt hedgen. Wir wol1
len im folgenden deren Preis und Hedgingstrategie bestimmen. Sei dazu Y := (SN
− K)+
die Auszahlung einer europäischen Call-Option mit Basispreis K ∈ R. Für den diskontierten Endwert der Aktie gilt
u U
d N −U
1
ŜN
= Ŝ01 ( 1+r̃
) ( 1+r̃
)
u
mit U = |{n ∈ {1, . . . , N } : ∆X̂n = 1+r̃
− 1}|. Offenbar ist U unter Q eine mit Parametern
1
0
N, q binomialverteilte Zufallsvariable. Ferner gilt ŜN
> K/SN
genau dann, wenn
U > a :=
log(K/S01 ) − N log(d)
.
log(u/d)
4.4. BEISPIELE
67
Nach Satz 4.3 folgt für den fairen Preis des europäischen Calls:
Ŝ02 = EQ ( SY0 )
N
1
= EQ ((ŜN
− SK0 )+ )
N
R 1
K
1
=
(ŜN − S 0 )1(K/SN0 ,∞) (ŜN
)dQ
N
PN N n
K
N −n
1 u n d N −n
− S 0 1(a,∞) (n)
Ŝ0 ( 1+r̃ ) ( 1+r̃ )
=
n=0 n q (1 − q)
N
P
P
N
N
N k
N n
K
N −n
N −n
1
1(a,∞) (n) − S 0
1(a,∞) (n)
= Ŝ0 n=0 n qe (1 − qe)
n=0 n q (1 − q)
N
=
Ŝ01 b(N, qe)((a, ∞))
−
K
0 b(N, q)((a, ∞))
SN
= Ŝ01 b(N, 1 − qe)((−∞, N − a]) −
K
0 b(N, 1
SN
− q)((−∞, N − a]),
wobei b(N, p) die Binomialverteilung mit Parametern N, p bezeichnet und
qe :=
u(1 + r̃ − d)
u
q=
.
1 + r̃
(1 + r̃)(u − d)
Analog ergibt sich
Ŝn2 = EQ ( SY0 |Fn ) = Ŝn1 b(N − n, 1 − qe)((−∞, an ]) −
N
K
0 b(N
SN
− n, 1 − q)((−∞, an ])
für n = 0, . . . , N , wobei
an :=
log(Sn1 /K) − (N − n) log(d)
.
log(u/d)
Für den undiskontierten, fairen Preisprozess der Option ergibt sich also
0
Sn2 = Sn1 b(N − n, 1 − qe)((−∞, an ]) − K SS0n b(N − n, 1 − q)((−∞, an ]).
(4.3)
N
Zur Berechnung der Duplikationsstrategie schreiben wir Sn2 = C(Sn1 , n) mit einer Funktion C : R+ × {0, . . . , N } → R+ , deren Gestalt sich sofort aus Gleichung (4.3) ergibt. Sei ϕ = (ϕ0 , ϕ1 ) eine Hedgingstrategie des Calls durch Handel von (S 0 , S 1 ), d. h.
1
2
VN (ϕ) = (SN
− K)+ = SN
. Für den diskontierten Wertprozess gilt dann V̂ (ϕ) = Ŝ 2 und
somit ∆Ŝn2 = ϕ1n ∆Ŝn1 . Im Falle eines steigenden Aktienkurses erhalten wir daraus
1
1
0 C(Sn−1 u, n)
Sn
−
1
1
C(Sn−1
,n
0
Sn−1
u
1
− 1),
− 1) = ϕ1n Ŝn−1
( 1+r̃
1
1
C(Sn−1
,n
0
Sn−1
d
1
− 1) = ϕ1n Ŝn−1
− 1).
( 1+r̃
für fallenden Kurs entsprechend
1
1
0 C(Sn−1 d, n)
Sn
−
Subtrahieren und Auflösen nach der Handelsstrategie ergibt für den Aktienanteil in der Hedgingstrategie des Calls:
ϕ1n =
1
1
C(Sn−1
u, n) − C(Sn−1
d, n)
.
1
Sn−1 (u − d)
68
KAPITEL 4. BEWERTEN UND HEDGEN VON DERIVATEN
14.1.09
Den europäischen Put behandelt man analog oder mit Hilfe der Call-Put-Parität (vgl.
1
1 +
1
Aufgabe 1 auf Blatt 5). Am Fälligkeitsdatum N gilt (SN
− K)+ − (K − SN
) = SN
− K.
Der faire Preis der zufälligen Auszahlung auf der rechten Seite beträgt zum Zeitpunkt n
0
, wie in 4.4.1 gezeigt wurde. Aus Arbitragegründen muß also für den
gerade Sn1 − KSn0 /SN
0
Call-Preis Sn2 und den Put-Preis Sn3 gelten: Sn2 − Sn3 = Sn1 − KSn0 /SN
für n ∈ {0, . . . , N }.
Man erhält schließlich
0
Sn3 = K SS0n b(N − n, 1 − q)((−∞, bn ]) − Sn1 b(N − n, 1 − qe)((−∞, bn ])
N
als fairen Put-Preis zum Zeitpunkt n, wobei
bn :=
4.4.4
log(K/Sn1 ) − (N − n) log(d)
.
log(u/d)
Europäische Call- und Put-Optionen im Standardmarktmodell
Wir betrachten nun das Standardmarktmodell aus Abschnitt 3.4 mit normalverteilten ∆Xn
mit Erwartungswert µ und Varianz σ 2 . Nach Satz 4.8 kann dies kein vollständiges Marktmodell sein, eindutige Optionspreise sind also nicht zu erwarten. Wir wollen das durch unteren
und oberen Preis begrenzte Preisintervall eines europäischen Calls wie im vorigen Abschnitt
1
1
ist ϕ := (0, 1) eine Superhedgingstratege. Somit gilt
− K)+ ≤ SN
bestimmen. Wegen (SN
1
πO ≤ S0 . Analog folgt durch Betrachtung von ϕ := (0, 0) und ϕ := (−Ke−rN , 1) wegen
1
0
1
1
für den unteren Preis:
+ SN
− K)+ ≥ −Ke−rN SN
− K)+ ≥ 0 und (SN
(SN
πU ≥ max{0, S01 − Ke−rN } = (S01 − Ke−rN )+ .
Diese gewissermaßen trivialen Preisgrenzen πU , πO gelten unabhängig von dem für das
Wertpapier S 1 gewählte Marktmodell.
Wir konstruieren nun eine einparametrige Menge von äquivalenten Martingalmaßen. Sei
2
dazu σ
e > 0 gegeben. Da sowohl N (µ, σ) als auch N (r − σe2 , σ
e2 ) zum Lebesguemaß äquivalent sind, gibt es eine positive Dichte
2
dN (r − σe2 , σ
e2 )
f :=
.
dN (µ, σ 2 )
Definiere nun ein Wahrscheinlichkeitsmaß Q ∼ P durch die Dichte
N
Y
dQ
:=
f (∆Xn ).
dP
n=1
Lemma 4.12
1. ∆X1 , . . . , ∆XN sind unabhängige, N (r −
riablen unter Q.
2. Q ist ein äquivalentes Martingalmaß.
σ
e2
,σ
e2 )-verteilte
2
Zufallsva-
4.4. BEISPIELE
69
Beweis. 1. Für Borelmengen B1 , . . . , BN gilt
Q(∆X1 ∈ B1 , . . . , ∆XN ∈ BN )
Z
N
Y
=
1B1 (∆X1 ) · · · 1BN (∆XN )
f (∆Xn )dP
n=1
=
=
=
=
Z Y
N
(1Bn (xn )f (xn ))P (∆X1 ,...,∆XN ) (d(x1 , . . . , xN ))
n=1
N
YZ
n=1
N
Y
f (xn )N (µ, σ 2 )(dxn )
Bn
N (r −
n=1
N
O
N (r −
σ
e2
,σ
e2 )(Bn )
2
σ
e2
,σ
e2 )(B1
2
× . . . × BN ).
n=1
Daraus ergibt sich die erste Behauptung.
P
2. Für den durch Yn := nm=1 e∆Xn −r − 1 definierten Prozess Y gilt
S01 E (Y )n
=
S01
n
Y
(1 + ∆Yn ) =
m=1
S01
n
Y
e∆Xn −r = S01 eXn e−rn = Ŝn1
m=1
und
EQ (∆Yn ) = E(e∆Xn −r ) − 1
Z
1 (x + σe2 )2 1
x
2
√
=
e exp −
dx − 1
2
2
2
σ
e
2πe
σ
Z
1 (x − σe2 )2 1
2
= √
exp −
dx − 1
2
2
2
σ
e
2πe
σ
= 0.
Nach Beispiel 2.10 ist Y ein Q-Martingal. Mit Lemma 2.25 gilt dies auch für Ŝ 1 = S01 E (Y ).
Wir berechnen nun den mit Arbitragefreiheit verträglichen Anfangspreis
Z
0
1
+
0
πQ := S0 EQ ((SN − K) /SN ) = (S01 eXN −rN − Ke−rN )+ dQ.
P
Wegen XN = N
n=1 ∆Xn und da ∆X1 , . . . , ∆Xn unter Q unabhängig und N (r −
verteilt sind, gilt
Z +
√
2
πQ =
S01 exp( σ
e2 N x − σe2 N ) − Ke−rN N (0, 1)(dx)
Z ∞
Z
√
2
S01
Ke−rN ∞ − x2
− x2
σ
e2
2
= √
exp( σ
e N x − 2 N )e dx − √
e 2 dx
2π x0
2π x0
σ
e2
,σ
e2 )2
70
KAPITEL 4. BEWERTEN UND HEDGEN VON DERIVATEN
für
2
log SK1 − rN + σe2 N
0
√
x0 :=
.
σ
e N
Wenn Φ die Verteilungsfunktion der Standard-Normalverteilung bezeichnet, erhalten wir
πQ
S1
= √0
2π
=
=
=
∞
e
√
− 12 (x−e
σ N )2
Ke−rN
dx − √
2π
Z
∞
x2
e− 2 dx
x0
x0
√
1
S0 N (e
σ N , 1)([x0 , ∞)) − KN (0, 1)([x0 , ∞))
√
S01 N (0, 1)((−∞, −x0 + σ
e N ]) − KN (0, 1)((−∞, −x0 ])
S01 Φ(d1 ) − Ke−rN Φ(d2 )
mit
d1 :=
Z
log
S01
K
+ rN +
√
σ
e N
σ
e2
N
2
Für σ
e → 0 gilt
Φ(d1 ), Φ(d2 ) →
und
0
1
2
1
d2 :=
log
S01
K
+ rN −
√
σ
e N
σ
e2
N
2
(4.4)
.
falls S01 < Ke−rN ,
falls S01 = Ke−rN ,
falls S01 > Ke−rN
e → ∞ erhalten wir hingegen Φ(d1 ) → 1, Φ(d2 ) → 0
und somit πQ → (S01 −Ke−rN )+ . Für σ
1
und somit πQ → S0 . Wegen πU ≤ πQ ≤ πO folgt zusammen mit den obigen Abschätzungen
πU = (S01 − Ke−rN )+
19.1.09
und
πO = S01 .
Die Arbitragegrenzen im Standardmarktmodell sind also die trivialen, unabhängig vom Aktienkursmodell geltenden.
4.5
Amerikanische Optionen
Der Ausübungszeitpunkt einer amerikanischen Option kann als eine Stoppzeit aufgefasst
werden, die möglichst optimal gewählt werden sollte. Insofern führen amerikanische Optionen auf ein Problem optimalen Stoppens. Der folgende Satz zeigt, dass auch Snellsche
Hüllen eng mit Stoppproblemen zusammenhängen, bei denen es darum geht, eine erwartete
Auszahlung E(Xτ ) über alle Stoppzeiten τ zu maximieren. Die in gewissem Sinne früheste
und späteste optimale Stoppzeit τf und τs sind ebenfalls im Satz angegeben.
Definition 4.13 Sei X ein diskretes Semimartingal mit E(|Xn |) < ∞ für n = 0, . . . , N .
Unter der Snellschen Hülle von X versteht man das durch UN := XN und
Un := sup{Xn , E(Un+1 |Fn )}
für n = N − 1, . . . , 0 rekursiv definierte diskrete Semimartingal.
4.5. AMERIKANISCHE OPTIONEN
71
Satz 4.14 Für die Snellsche Hülle eines diskreten Semimartingals X wie in Definition 4.13
gelten:
1. U ist das kleinste Supermartingal mit U ≥ X.
2.
Un = ess supτ ∈Tn E(Xτ |Fn ) = E(Xτf |Fn ) = E(Xτs |Fn )
für n = 0, . . . , N , wobei Tn die Menge der {n, n + 1, . . . , N }-wertigen Stoppzeiten
bezeichne und
τf := inf{m ≥ n : Um = Xm },
τs := inf{m ≥ n : Xm > E(Um+1 |Fm )} ∧ N.
Dabei bezeichnet ess supτ ∈Tn E(Xτ |Fn ) eine Zufallsvariable, die jedes E(Xτ |Fn ) fast sicher dominiert, die aber ihrerseits durch jede Zufallsvariable mit dieser Eigenschaft fast
sicher definiert wird.
Beweis. 1. Wir zeigen induktiv E(|Un |) < ∞ und Un−1 ≥ E(Un |Fn−1 ) für n = N, . . . , 0,
woraus die Supermartingaleigenschaft von U folgt. Für n = N ist Un = XN integrierbar.
Die Ungleichung ist offensichtlich. Für n < N gilt nach Induktionsvoraussetzung
E(|Un |) ≤ E(|Xn | + |E(Un+1 |Fn )|) ≤ E(|Xn |) + E(|Un+1 |) < ∞.
Die Supermartingalungleichung ergibt sich wieder direkt aus der Definition.
Für die Minimalität betrachten wir ein weiteres Supermartingal mit V ≥ X. Wir zeigen
Vn ≥ Un durch Induktion nach n = N, . . . , 0. Für n = N ist nichts zu zeigen. Für n < N
gilt Vn ≥ Xn und nach Induktionsvoraussetzung Vn ≥ E(Vn+1 |Fn ) ≥ E(Un+1 |Fn ), also
auch Vn ≥ Un .
2. Zunächst einmal gilt für jede Stoppzeit τ ∈ Tn
E(Xτ |Fn ) ≤ E(Uτ |Fn ) = E(UNτ |Fn ) ≤ Unτ = Un ,
da U τ nach Lemma 2.20 ein Supermartigal ist. Wegen τf , τs ∈ Tn bleibt also nur noch zu
zeigen, dass Un = E(Xτf |Fn ) = E(Xτs |Fn ).
Wir zeigen induktiv, dass E(Uτf ∨m |Fm ) = Um für m = N, . . . , n. Für m = N ist
nichts zu zeigen. Für m < N sei A := {τf ≤ m} ∈ Fm . Zunächst ist E(1A Uτf ∨m |Fm ) =
E(1A Um |Fm ) = 1A Um . Ferner gilt nach Induktionsvoraussetzung
E(1AC Uτf ∨m |Fm ) = E(1AC Uτf ∨(m+1) |Fm )
= 1AC E(E(Uτf ∨(m+1) |Fm+1 )|Fm )
= 1AC E(Um+1 |Fm )
= 1AC Um ,
da Xm ≤ E(Um+1 |Fm ) auf AC .
72
KAPITEL 4. BEWERTEN UND HEDGEN VON DERIVATEN
Für m = n folgt Un = E(Uτf |Fn ) = E(Xτf |Fn ). Die Behauptung für τs zeigt man
analog.
Als nützlich wird sich unten die folgende äquivalente Charakterisierung Snellscher Hüllen erweisen.
Lemma 4.15 Für diskrete Semimartingale X wie in Definition 4.13 sind folgende Aussagen
äquivalent:
1. U ist Snellsche Hülle von X.
2. U ist ein Supermartingal mit U ≥ X, UN = XN und derart, dass 1{U− 6=X− }
Martingal ist.
Beweis. ⇒: Nach Satz 4.14 bleibt zu zeigen, dass 1{U− 6=X− }
Definition der Snellschen Hülle gilt
•
•
U ein
U ein Martingal ist. Nach
E(1{Un−1 6=Xn−1 } ∆Un |Fn−1 ) = 1{Un−1 6=Xn−1 } (E(Un |Fn−1 ) − Un−1 ) = 0
für n = 1, . . . , N , woraus diese Martingaleigenschaft sofort folgt.
⇐: Ebenfalls nach Satz 4.14 genügt es zu zeigen, dass für jedes Supermartingal V ≥
X auch V ≥ U gilt. Wir zeigen Vn ≥ Un induktiv für n = N, . . . , 0. Für n = N ist
dies offensichtlich. Sei Vn ≥ Un für n gezeigt. Vn−1 ≥ Un−1 ist im Fall Un−1 = Xn−1
offensichtlich. Andernfalls folgt es via
1{Un−1 6=Xn−1 } (Vn−1 − Un−1 ) ≥ 1{Un−1 6=Xn−1 } (E(Vn |Fn−1 ) − Un−1 )
≥ 1{Un−1 6=Xn−1 } (E(Un |Fn−1 ) − Un−1 )
= E(1{Un−1 6=n−1 } ∆Un |Fn−1 ) = 0
aus der Supermartingaleigenschaft von V und der Martingaleigenschaft von 1{U− 6=X− } • U .
Die Bewertung europäischer Optionen basiert auf dem ersten Fundamentalsatz. Die Arbitrageargumente, die diesem zugrundeliegen, verlangen, dass alle Wertpapiere in beliebigen positiven und negativen Stückzahlen gehalten werden können. Dies ist bei amerikanischen Optionen nur eingeschränkt der Fall. Es spricht zwar nichts dagegen, eine positive
Anzahl zu erwerben und später wieder zu veräußern. Bei einer negativen Anzahl ist das hingegen nicht offensichtlich. Eine durch einen Leerverkauf entstehende short position kann
vom Stillhalter der Option dadurch beendet werden, dass er die Option ausübt, wodurch sie
vom Markt verschwindet. Man kann jedoch annehmen, dass dies nicht geschieht, solange
deren Marktpreis echt größer als der Ausübungspreis ist. Der Stillhalter würde in diesem Fall
nämlich durch Verkauf einen höheren Ertrag erzeihen als durch Ausüben der Option. Der
Handel mit amerikanischen Optionen führt daher zu gewissen, vom Marktpreis abhängigen
Leerverkaufsbeschränkungen. Wir diskutieren zunächst eine Version des ersten Fundamentalsatzes für diese Situation.
4.5. AMERIKANISCHE OPTIONEN
73
Gegeben sei wie in Abschnitt 3.2 ein Markt mit d + 1 Wertpapieren, Endzeitpunkt N
und positivem Numeraire S 0 . Leerverkaufsbeschränkungen drücken wir durch vorhersehbare Mengen Γi ⊂ Ω × {0, . . . , N } für i = 1, . . . , d aus. Vorhersehbar bedeutet hier, dass der
Indikatorprozess 1Γ vorhersehbar ist. Die Idee ist, das Wertpapier i nicht in negativen Stückzahlen gehalten werden kann, solange dieser Prozess den Wert 1 hat, d. h. wir betrachten die
Menge
Θ := ϕ selbstfinanzierend : ϕi 1Γi ≥ 0 für i = 1, . . . , d
von Handelsstrategien.
Definition 4.16 Sei Γ := (Γ1 , . . . , Γd ). Wir nennen den Markt Γ-arbitragefrei, falls keine
Arbitragestrategie ϕ ∈ Θ existiert, wobei Θ wie oben zu Γ definiert wird.
Der folgende Resultat verallgemeinert Satz 3.2 auf solche Strategiemengen.
Satz 4.17 (Erster Fundamentalsatz unter Leerverkaufsbeschränkungen) Sei ein Tupel
Γ = (Γ1 , . . . , Γd ) wie oben gegeben. Dann sind äquivalent:
1. Der Markt ist Γ-arbitragefrei.
2. Es existiert ein Wahrscheinlichkeitsmaß Q ∼ P derart, dass für i = 1, . . . , d der
Prozess Ŝ i ein Q-Supermartingal und 1(Γi )C • Ŝ i ein Q-Martingal ist.
Beweis. Die Aussage folgt im Wesentlichen wie Satz 3.2 , wenn im Beweisverlauf RN :=
{ϕ • ŜN : ϕ ∈ Θ} betrachtet wird. Im unteren Teil des Beweises der Abgeschlossenheit
von AN in Lemma 3.13 muss die modifizierte Strategie ϕ
e(k),1 etwas anders definiert werden,
damit diese nach wie vor in Θ liegt. Ferner erhält man in Lemma 3.14 wegen der kleineren
Strategiemenge nur Q-Supermartingale mit der obigen, eingeschränkten Martingaleigenschaft.
21.1.09
Wir betrachten amerikanische Optionen nun analog zu Abschnitt 4.2 als liquide gehandelte Wertpapiere. Wir wollen untersuchen, welche Preisprozesse für solche Optionen mit
der Arbitragefreiheit des Gesamtmarkts verträglich sind. dazu sei zunächst wie in Kapitel 3
ein arbitragefreier Markt mit positivem Numeraire und d weiteren Wertpapieren gegeben.
Mathematisch ist eine amerikanische Option durch ein nichtnegatives, diskretes Semimartingal X definiert. Dabei steht Xn für die Auszahlung, die man bei Ausüben der Option zum Zeitpunkt n bekommt. Der zugehörige diskontierte Ausübungsprozess sei definiert
durch X̂ := SX0 . Wir bezeichnen den Marktpreisprozess der Option mit S d+1 . Der Wert einer
d+1
vorher noch nicht ausgeübten Option zum Endzeitpunkt beträgt offenbar SN
= XN . Ferd+1
ner sollte stets S
≥ X gelten. Fiele der Marktpreis der Option unter den Ausübungspreis,
dann könnte man diese zum niedrigeren Marktpreis kaufen und augenblicklich ausüben,
wodurch sich eine triviale Form von Arbitrage ergäbe, deren Existenz wir hier ausschließen wollen. Wir wir oben argumentiert haben, unterliegt der Handel mit amerikanischen
d+1
Optionen gewissen Leerverkaufsbeschränkungen. Im Falle Sn−
= Xn− kann eine negative
74
KAPITEL 4. BEWERTEN UND HEDGEN VON DERIVATEN
nicht unbedingt aufrecht erhalten werden, da die amerikanische Option mögPosition ϕd+1
n
licherweise durch Ausüben des Stillhalters vom Markt verschwindet. Wir haben oben auch
begründet, dass mit einem Ausüben nicht zu rechnen ist, solange der Marktpreis echt größer
als der Ausübungspreis ist. Wir haben es daher mit Handelsbeschränkungen der Form
Γd+1 := {S−d+1 = X− }
in obigem Sinne zu tun. Wir können nun ein Analogon von Korollar 4.1 für amerikanische
Optionen formulieren.
Korollar 4.18 Für einen Ausübungsprozess X wie oben sind äquivalent:
1. Ein Derivatpreisprozess S d+1 führt zu einem arbitragefreien Markt (S 0 , . . . , S d+1 ) in
d+1
dem Sinne, dass S d+1 ≥ X, SN
= XN gelten und der Markt (∅, . . . , ∅, Γd+1 )arbitragefrei ist.
2. Es gibt ein äquivalentes Martingalmaß Q für den Markt (Ŝ 0 , . . . , Ŝ d ) derart, dass
X̂n , n = 0, . . . , N Q-integrierbar sind und der diskontierte Derivatpreisprozess Ŝ d+1
die Snellsche Hülle von X̂ bezüglich des Wahrscheinlichkeitsmaßes Q ist.
Beweis. 2⇒1: Aus Lemma 4.15 folgt, dass Ŝ d+1 ein Q-Supermartingal und 1(Γd+1 )C • Ŝ d+1
ein Q-Martingal sind. Die Behauptung folgt somit aus dem ersten Fundamentalsatz 4.17.
1⇒2: Nach Satz 4.17 existiert ein Q ∼ P derart, dass S 1 , . . . , S d+1 Q-Martingale sind,
Ŝ d+1 ein Q-Supermartingal ist und 1{S d+1 6=X− } • Ŝ d+1 ein Q-Martingal ist. Insbesondere
−
sind die nichtnegativen X̂n wegen X̂n ≤ Ŝnd+1 Q-integrierbar, und Ŝ d+1 ist nach Lemma
4.15 die Q-Snellsche Hülle von X̂.
In vollständigen Märkten gibt es also einen eindeutigen, mit Abitragefreiheit verträglichen Marktpreisprozess für die amerikanische Option, da es ja nur ein ÄMM Q gibt.
Wir betrachten nun einen Markt, in dem sowohl eine amerikanische Option mit Ausübungsprozess X als auch eine europäische Option mit Endauszahlung XN gehandelt werden. Wenn dieser Markt arbitragefrei ist, dann muss die amerikanische Option zu jedem
Zeitpunkt mindestens so teuer wie die europäische sein. Dies folgt aus Korollar 4.18 oder
aus der folgenden einfachen Überlegung: Andernfalls kauft man die billige amerikanische
Option und verkauft gleichzeitig die teurere europäische. Den Differenzbetrag investiert
man z. B. in den Numeraire. Am Endzeitpunkt N gleichen sich die Auszahlung XN und die
Verpflichtung −XN der beiden Optionen aus, und es verbleibt die Anlage im Numeraire als
risikoloser Gewinn.
Im allgemeinen wird man natürlich erwarten, dass eine amerikanische Option mehr wert
ist als die entsprechende europäische, da man ja den Ausübungszeitpunkt selbst bestimmen
darf. Der folgende Satz zeigt aber, dass das bei Call-Optionen überraschenderweise nicht
der Fall ist.
4.5. AMERIKANISCHE OPTIONEN
75
Satz 4.19 In einem Markt S = (S 0 , S 1 , S 2 , S 3 ) seien S 2 , S 3 die Preisprozesse eines europäischen und eines amerikanischen Calls auf S 1 mit Basispreis K und Fälligkeitszeitpunkt
1
N (d. h. XN = (SN
− K)+ ist die Endauszahlung von S 2 , und X = (S 1 − K)+ ist der
Ausübungsprozess von S 3 ). Wenn der Numeraire S 0 monoton wachsend ist und der Markt
(∅, . . . , ∅, {S−3 = X− })-arbitragefrei ist, dann gilt S 2 = S 3 .
Beweis. Nach Korollar 4.18 gibt es ein Q ∼ P derart, dass Ŝ 2 Q-Martingal ist und S 3
Q-Snellsche Hülle von X̂. Da f (x) = (x − K)+ eine konvexe Funktion ist, folgt mit der
Jensenschen Ungleichung für bedingte Erwartungswerte
2
1
0
Ŝn = EQ f (SN )/SN Fn
0
1
)Sn0 /SN
= EQ f (SN
Fn /Sn0
1 ≥ EQ f (Sn0 ŜN
)Fn /Sn0
1
|Fn ) /Sn0
≥ f Sn0 EQ (ŜN
= f (Sn1 )/Sn0
= X̂n .
Es folgt zusammen mit der Q-Martingaleigenschaft von Ŝ 2 , dass
Ŝn3 = ess supτ ∈Tn EQ (X̂τ |Fn )
≤ ess supτ ∈Tn EQ (Ŝτ2 |Fn )
= Ŝn2 .
Da zudem
Ŝn3 = ess supτ ∈Tn EQ (X̂τ |Fn ) ≥ EQ (X̂N |Fn ) = Ŝn2
gilt, folgt die behauptete Gleichheit.
26.1.09
0
Falls der Numeraireprozess S konstant oder allgemeiner monoten fallend ist, gilt die
Aussage von Satz 4.19 auch für Put-Optionen.
Selbst im einfachen Binomialmodell erhält man für amerikanische Put-Optionen keinen
expliziten Ausdruck mehr für den Wert, aber immerhin noch eine rekursive Formel. Da die
Preise von europäischem und amerikanischem Call übereinstimmen, muss dieser Fall nicht
erneut betrachtet werden.
Beispiel 4.20 Im Binomialmodell aus Abschnitt 4.4.3 sei S 2 der faire Preisprozess einer
amerikanischen Put-Option auf S 1 mit Basispreis K ∈ R, d. h. mit Auszahlungsprozess
X = (K − S 1 )+ . Wir zeigen, dass es konvexe, monoton fallende Funktionen g0 . . . , gN :
R → R derart gibt, dass der diskontierte Preis die Form Ŝn2 = gn (Ŝn1 ) hat. gn ist rekursiv
0
gegeben durch gN = (K/SN
− x)+ ,
u
d
gn (x) = max ( SK0 − x)+ , qgn+1 (x 1+r̃
) + (1 − q)gn+1 (x 1+r̃
) .
n
76
KAPITEL 4. BEWERTEN UND HEDGEN VON DERIVATEN
Ferner gibt es ein xn ∈ [0, K/Sn0 ] derart, dass
u
d
( SK0 − x)+ > qgn+1 (x 1+r̃
) + (1 − q)gn+1 (x 1+r̃
)
n
⇐⇒
x < xn .
Anschaulich bedeutet das, dass man im Fall Ŝn1 < xn die Option unbedingt ausüben sollte,
da das Vermögen auf andere Weise besser angelegt ist. xn bezeichnet also eine Art Schwelle
oder Ausübungsgrenze für den diskontierten Aktienkurs, unterhalb derer sich das Ausüben
der Option lohnt.
Den Beweis dieser Aussagen führen wir durch Induktion nach n = N, . . . , 0, wobei wir
als zusätzliche Behauptung mitbeweisen, dass gn = (K/Sn0 − x)+ für x < SK0 ( 1+r̃
)N −n . Für
u
n
2
0
1 +
1
n = N gilt ŜN
= (K/SN
− ŜN
) = gN (ŜN
) wie gewünscht.
Für den Induktionsschritt von n + 1 nach n erhält man nach Korollar 4.18 und Lemma
1.23
2
K
1 +
2
Ŝn = max ( S 0 − Ŝn ) , EQ (Ŝn+1 |Fn )
n
= max ( SK0 − Ŝn1 )+ , EQ (gn+1 (Ŝn1 (1 + ∆X̂n+1 ))|Fn )
n
K
1 u
1 +
1 d
= max ( S 0 − Ŝn ) , qgn+1 (Ŝn 1+r̃ ) + (1 − q)gn+1 (Ŝn 1+r̃ )
n
=
gn (Ŝn1 ).
Da nichtnegative Linearkombinationen und Maxima von monoton fallenden, konvexen
Funktionen wieder monoton fallend und konvex sind, besitzen die gn diese Eigenschaften.
)N −n auch
Zum Nachweis der Zusatzbehauptung beachte man, dass im Falle x < SK0 ( 1+r̃
u
n
u
< SK0 ( 1+r̃
)N −(n+1) und somit nach Induktionsvoraussetzung
x 1+r̃
u
n
u
d
u +
d +
qgn+1 (x 1+r̃
) + (1 − q)gn+1 (x 1+r̃
) = q( SK0 − x 1+r̃
) + (1 − q)( SK0 − x 1+r̃
)
n
=
K
0
Sn
−
n
x uq+d(1−q)
1+r̃
=
( SK0
n
− x)+
gelten. Sei nun
xn := sup{x ∈ R : ( SK0 − x)+ > h(x)}
n
d
u
mit h(x) := qgn+1 (x 1+r̃
) + (1 − q)gn+1 (x 1+r̃
). Dann ist SK0 ( 1+r̃
)N −n
u
n
{x ∈ R : ( SK0 − x)+ > h(x)} ⊂ (−∞, SK0 ). Für x ∈ [xn , SK0 )gilt wegen
n
n
n
h offenbar ( SK0 − x)+ ≤ h(x).
n
≤ xn ≤ SK0 , denn
n
der Konvexität von
Am Ende dieses Abschnitts betrachten wir amerikanische Optionen noch kurz aus einer
individuellen Sichtweise ähnlich wie in Abschnitt 4.3. Die Option wird also nicht liquide
gehandelt, sondern einem Kunden von der Bank als Finanzdienstleister angeboten. Es sei
vorausgestzt, dass der Markt (S 0 , . . . , S d ) vollständig ist, so dass also ein eindeutiges ÄMM
Q existiert. Oben wurde dargelegt, dass
n
o
0
π := S0 sup EQ (X̂τ ) : τ Stoppzeit
der einzige mit Arbitragefreiheit verträgliche Anfangspreis der amerikanischen Option ist,
sofern sie liquide gehandelt wird. Das folgende Resultat zeigt, dass π auch aus OTC-Sicht
ein vernünftiger Preis für die Option ist.
4.5. AMERIKANISCHE OPTIONEN
77
Lemma 4.21 Zum Preis π kann die Bank ein selbstfinanzierendes Portfolio erwerben, das
sie jederzeit gegen die Forderung des Stillhalters absichert, d. h. V (ϕ) ≥ X. Wenn die Bank
die Option hingegen zum Preis x < π verkauft, gibt es eine Arbitragemöglichkeit für den
Käufer.
Beweis. Es ist π/S00 = U0 , wobei U die Q-Snellsche Hülle von X̂ bezeichnet. Wir schreiben
die Q-Doob-Zerlgung von U als U = U0 + M + A mit einem Q-Martingal M und einem
fallenden Prozess A mit M0 = 0 = A0 wie in Satz 2.16.
Wegen der Vollständigkeit gibt es eine selbstfinanzierende Strategie ϕ mit V̂N (ϕ) = U0 +
MN . Aus der Martingaleigenschaft folgt V̂ (ϕ) = U0 + M und insbesondere V̂0 (ϕ) = U0 ,
d. h. die Bank kann ϕ erwerben. Wenn der Stillhalter zum Zeitpunkt n ausübt, erhält er als
diskontierte Auszahlung
X̂n ≤ Un ≤ U0 + Mn = V̂n (ϕ),
d. h. der Wert des Absicherungsportfolios ϕ reicht für diese Zahlung aus.
Wir kommen nun zur zweiten Behauptung. Da π = S00 EQ (X̂τf ) für eine geeignet gewählte Stoppzeit τf , ist π der faire Preis einer europäischen Option mit diskontierter Auszahlung X̂τf . Der Käufer kann also den perfekten Hedge einer solchen Option leerverkaufen
und erhält dafür π. Für den kleineren Betrag x erwirbt er die amerikanische Option. Wenn
er diese bei τf ausübt, gleichen sich Auszahlung und leerverkaufter Hedge aus. Es verbleibt
ihm ein diskontierter Arbitragegewinn von π − x.
Kapitel 5
Unvollständige Märkte
Im vorigen Kapitel haben wir gesehen, dass die bescheiden anmutende Annahme der Arbitragefreiheit bisweilen weitreichende Folgen für die Bewertung und Absicherung von
Derivaten besitzt. In anderen durchaus wichtigen Fällen liefert die Arbitragetheorie aber
wenig konkrete Antworten. Bei der Betrachtung europäischer Call-Optionen im Standardmarktmodell erkannten wir, dass selbst Optionen mit hohem Basispreis prinzipiell fast zum
gegenwärtigen Aktienkurs gehandelt werden können, ohne dass dieszu Arbitrage führt. In
der Praxis sind solch extreme Preise, die das Derivat zu einer außergewöhnlich attraktiven oder unattraktiven Anlage machen würden, unrealistisch. Auch der Erwerb einer Superhedgingstrategie scheidet aus dem Grunde aus, dass der Verkäufer den dazu nötigen
oberen Preis, der im Fall einer Call-Option im Standardmarktmodell mit dem Aktienkurs
bereinstimmt, nicht annähernd erzielen kann. Wir diskutieren in diesem Kapitel mögliche
Vorgehensweisen zur Modellierung nicht erreichbarer Optionen. Wir unterscheiden dabei
wiederum liquide gehandelte Derivate vom OTC-Fall.
5.1
Martingalmodellierung
Wir haben in Abschnitt 4.2 gesehen, dass für Derivate nur solche Preisprozesse in Frage
kommen, die sich durch Erwartungswertbildung ungter einem äquivalenten Martingalmaß
Q ergeben. Wer aber wählt Q? Das tut der Markt durch Angebot und Nachfrage! Die Arbitragetheorie schränkt ihn nur insofern ein, dass sich die entstehenden Preise überhaupt konsistent zu einem Martingalmaß sind. Wie aber kommen wir nun zu einem mathematischen
Modell für die Derivatpreisprozesse, ohne die vielfältigen Präferenzen der Marktteilnehmer
und deren Einfluss auf die Preisbildung zu kennen?
Wir diskutieren hier einen Ansatz, der dem in der Praxis üblichen Vorgehen ähnelt und
der zum Teil auf statistischen Methoden beruht. Die Idee besteht darin, die am Markt beobachteten Preise liquider Standardoptionen heranzuziehen, um Informationen über das vom
Markt verwendete Preismaß Q zu erlangen.
Konkret gehen wir wie folgt vor. Seien Ŝ 1 bzw. Ŝ 2 , . . . , Ŝ d die diskontierten Preisprozesse einer Aktie und von d − 1 Optionen auf diese Aktie. Gemäß Fundamentalsatz 3.9 gibt es
78
5.1. MARTINGALMODELLIERUNG
79
ein Wahrscheinlichkeitsmaß Q ∼ P derart, dass alle diskontierten Preisprozesse (von Aktie
Ŝ 1 ebenso wie von den Derivaten Ŝ 2 , . . . , Ŝ d ) Q-Martingale sind. Leider können wir Q nicht
mit statistischen Methoden bestimmen, da reale Häufigkeiten dem Wahrscheinlichkeitsmaß
P unterworfen sind.
Wie in der Statistik können wir aber zur Vereinfachung annehmen, dass Q aus einer bestimmten parametrischen (oder auch nichtparametrischen) Klasse stammt (vgl. Beispiel 5.1
unten). Konkret beschreiben wir die Dynamik der Aktie unter Q durch ein parametrisches
Modell. Der Parametervektor ϑQ muss dabei so gewählt werden, dass Ŝ 1 ein Q-Martingal
ist. Die Dynamik der Optionen Ŝ 2 , . . . , Ŝ d muss hingegen nicht explizit beschrieben werden,
Da Q ein ÄMM für den gesamten Markt sein soll, erhält man Ŝ 2 , . . . , Ŝ d und insbesondere
die Anfangspreise Ŝ02 , . . . , Ŝ0d aus den Martingalbedingungen
i
Ŝni = EQ (ŜN
|Fn )
und insbesondere
i
Ŝ0i = EQ (ŜN
).
(5.1)
Wenn die Optionen liquide gehandelt werden, dann muss der Parametervektor ϑQ so gewählt werden, dass die theoretischen Optionspreise (5.1) zumindest approximativ mit dem
am Markt zum Zeitpunkt 0 beobachteten Preisen übereinstimmen. Mathematisch entspricht
diese Berechnung einem Momentenschätzer in der Statistik. Die „Schätzung“ von ϑQ durch
Gleichsetzen von theoretischen und beobachteten Optionspreisen wird als Kalibrierung des
Modells bezeichnet. Wenn die Dimension des Parametervektors klein im Vergleich zur Zahl
beobachteter Optionspreise ist, wird eine Approximation z. B. durch ein kleinste-QuadrateVerfahren notwendig sein. Im nichtparametrischen Fall kommen hingegen Methoden aus
der nichtparametrischen Statistik zum Zuge.
Strenggenommen sollte man zwei Situationen unterscheiden. Wenn es lediglich darum
geht, die funktionale Abhängigkeit der Optionen von der zugrundeliegenden Aktie zu bestimmen, dann reicht es, lediglich Q zu betrachten. Es ist im Grunde nicht nötig, die Dynamik des Marktes unter P ebenfalls zu modellieren. Wenn allerdings auch Aussagen über
reale Wahrscheinlichkeiten, Quantile, Erwartungen usw. gemacht werden sollen, muss auch
P modelliert werden. Häufig wählt man dabei dieselbe parametrische Klasse für ϑP und ϑQ .
Der Parametervektor ϑP wird durch statistische Schätzer aus vergangenen Beobachtungen
des Aktienkurses S 1 bestimmt, wohingegen man die entsprechenden Q-Parameter wie oben
angesprochen durch Kalibrierung erhält. Man beachte allerdings, dass die Wahl von ϑP und
ϑQ nicht gegen die im Fundamentalsatz geforderte Äquivalenz Q ∼ P verstößt. Es kann
also sein, dass durch diese Einschränkung das mithilfe statistischer Methoden bestimmte
Wahrscheinlichkeitsmaß P doch schon gewisse Informationen über den Q-Parametervektor
liefert.
Wie können wir beurteilen, ob die eingangs mehr oder weniger willkürlich gewählte
parametrische Klasse für Q angemessen ist? Anders als für P können hierfür keine statistischen Tests herangezogen werden, da sich reale Wahrscheinlichkeiten nicht nach Q richten.
Gewisse Hinweise können aber aus den beobachteten Optionspreisen gewonnen werden.
80
KAPITEL 5. UNVOLLSTÄNDIGE MÄRKTE
Falls keine Wahl des Parametervektors ϑQ zu theoretischen Optionspreisen führt, die nah an
den beobachteten liegen, dann ist die gewählte Klasse offenbar zur Beschreibung des vorliegenden Marktes ungeeignet. Wie in der Statistik sollte man sich allerdings davor hüten, eine
gute Übereinstimmung durch Wahl einer sehr großen parametrischen Klasse mit hochdimensionalem Parametervektor ϑQ zu erzeugen. Ein solches Overfitting kann sich beispielsweise dadurch bemerkbar machen, dass das Modell den Zusammenhang zwischen Aktienund Optionspreis nach einigen Tagen ungenügend beschreibt. Ein als Ausweg durchgeführtes häufiges Rekalibrieren, d. h. das erneute Bestimmen des Parametervektors ϑQ , steht im
Grunde im Widerspruch zum allgemeinen Modellrahmen, innerhalb dessen das Martingalmaß Q aus Satz 3.9 ein für allemal feststeht, also weder von der Zeit noch vom betrachteten
Wertpapier abhängt.
Beispiel 5.1 (Kalibrieren im Standardmarktmodell mittels impliziter Volatilität) Wir
betrachten die Situation des Standardmarktmodells aus Abschnitt 4.4.4. Seien Qσe , σ
e > 0
die dort betrachteten äquivalenten Martingalmaße. Wir nehmen an, dass alle Marktpreise im
Sinne des Fundamentalsatzes 3.9 konsisent sind zu einem ÄMM aus der entsprechenden parametrischen Familie {Qσe : σ
e > 0}. Auf das vom Markt verwendete Qσe kann bei Vorliegen
eines Call-Preises π durch Auflösen der Preisformel
πQ S01 Φ(d1 ) − Ke−rN Φ(d2 )
nach σ
e zurückgeschlossen werden, vgl. (4.4). Das zugehörige σ
e heißt die sich aus dem
Optionspreis ergebende implizite Volatilität. Wenn mehrere Optionen beobachtet werden,
müssen durch denselben Wert σ
e alle Gleichungen erfüllt werden. Wenn dies nicht in guter
Näherung möglich ist, deutet das auf eine zur Beschreibung des realen Marktes ungeeignete
Klasse von Martingalmaßen hin.
28.1.09
Das durch Kalibrierung erhaltene Modell kann nun zur Bewertung weiterer, bisher nicht
gehandelter Optionen verwendet werden. Wenn wir nämlich unterstellen, dass Q das nach
dem ersten Fundamentalsatz existierende Preismaß des ganzen, auch das neue Derivat umfassenden Markt ist, so erhalten wir den Anfangspreis wie üblich durch Berechnen des QErwartungswerts der diskontierten Auszahlung.
Hier ist allerdings in zweifacher Hinsicht Vorsicht angebracht. Zum einen bedeutet die
Anwendung des kalibrierten Modells auf neue Derivate eine Extrapolation. Es kann vorkommen, das verschiedene parametrische Klassen, die mit Erfolg an dieselben Optionsen
klaibriert wurden, zu sehr verschiedenen Preisen für weitere Derivate führen. Zum zweiten
ist nicht klar, was die so gewonnenen Preise für den einzelnen Investor beduten. Die Tatsache, dass sie nicht zu Arbitrage führen, bedeutet nicht, dass die so bewertete Option ohne
oder mit geringem Risiko gehedgt werden kann.
5.2
Varianz-optimales Hedgen
Wir kommen nun auf die in Abschnitt 4.3 aufgeworfenen Fragen zurück. Wir haben bereits das Superhedging kennengelernt, das den Gedanken der perfekten Absicherung auf
5.2. VARIANZ-OPTIMALES HEDGEN
81
nicht duplizierbare Optionen überträgt. Leider erweist sich das zum Erstellen der billigsten
Superhedgingstrategie erforderliche Anfangskapital, also der obere Preis der Option, in konkreten Marktmodellen als unvernünftig hoch. Wie oben angesprochen besteht die billigste
Superhedgingstrategie eines beliebigen europäischen Calls im Standardmarktmodell darin,
die zugrundeliegende Aktie zu kaufen.
In der Literatur wurde eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wie man sich im allgemeinen zumindest teilweise gegen das Kursrisiko absichern könnte. Wir stellen hier ansatzweise
das Konzept des varianz-optimalen Hedgens vor. Die Idee besteht darin, die zufällige Auszahlung so gut wie möglich durch ein handelbares Portfolio zu approximieren, wenn man
sie schon nicht duplizieren kann. das Hedgeportfolio kann dabei aus der zugrundeliegenden
Aktie, aber auch aus liquiden Standardoptionen bestehen, falls solche am Markt verfügbar
sind.
Das allgemeine Marktmodell sei das in Abschnitt 4.3 betrachtete. Der Einfachheit halber beschränken wir uns auf den Fall, dass der diskontierte Wertprozess Ŝ ein Martingal
mit E(|ŜN |2 ) < ∞ ist. Dies ist eine recht grobe, aber vielleicht in erster Näherung akzeptable Annahme. Für den allgemeinen Fall lassen sich verwandte, aber im Detail deutlich
aufwendigere Resultate zeigen. Ebenso wie in Kapitel 4 sei eine Option X gegeben, deren
0
hier als quadratisch integrierbar vorausgesetzt wird.
diskontierte Auszahlung X̂ := X/SN
Wir arbeiten in diesem Kapitel ausschließlich mit diskontierten Größen. Dies wird in der
Notation ˆ deutlich gemacht.
Die folgende Definition drückt aus, was unter einer besten Approximation verstanden
werden soll:
Definition 5.2 Wir nennen ϕ varianz-optimale Hedgingstrategie für X, falls ϕ = ϑ den
erwarteten quadratischen Hedgefehler
E (V̂N (ϑ) − X̂)2
über alle alle selbstfinanzierenden Strategien ϑ minimiert.
Der erwartete quadratische Hedgefehler ist offenbar nur dann endlich, falls E((ϑ •
ŜN )2 ) < ∞. Da ϑ • S ein lokales Martingal ist, folgt induktiv für n = N, . . . , 0 auch
E((ϑ • Ŝn )2 ) < ∞. Wir betrachten daher im folgenden nur Handelsstrategien, die diese
Integrierbarkeitsbedingung erfüllen.
Lemma 5.3 Der diskontierte Vermögensprozess V̂ (ϕ) einer varianz-optimalen Strategie ϕ
ist eindeutig, falls eine solche existiert.
Beweis. Für eine weitere optimale Strategie ϕ
e definiere ψ := (ϕ + ϕ)/2.
e
Im Falle
P (V̂N (ϕ) 6= V̂N (ϕ))
e > 0 gilt dann
E (V̂N (ψ) − X̂)2 = E ( 12 (V̂N (ϕ) − X̂) + 12 (V̂N (ϕ)
e − X̂))2
<
1
E((V̂N (ϕ)
2
− X̂)2 ) + 21 E((V̂N (ϕ)
e − X̂)2 )
= E((V̂N (ϕ) − X̂)2 )
82
KAPITEL 5. UNVOLLSTÄNDIGE MÄRKTE
im Widerspruch zur Optimalität von ϕ. Somit ist V̂N (ϕ) = V̂N (ϕ)
e fast sicher. (Dies könnte
man alternativ auch direkt aus der Eindeutigkeit der Orthogonalprojektion im L2 ableiten.)
Nach Lemma 3.8 stimmen sogar die ganzen Vermögensprozesse überein.
Funktionalanalytisch formuliert handelt es sich bei dem diskontierten Endwert V̂N (ϕ)
der varianz-optimalen Strategie um die Orthogonalprojektion der diskontierten Auszahlung
X̂ im Hilbertraum L2 auf den Unterraum der um eine additive Konstante verschobenen
stochastischen Integrale nach Ŝ. Ein zentrales mathematisches Hilfsmittel zur Berechnung
varianz-optimaler Hedgingstrategien bildet die folgende Martingalzerlegung.
Satz 5.4 (Galtschuk-Kunita-Watanabe-Zerlegung) Sei V̂ ein Martingal mit V̂N ∈ L2 .
Dann lässt sich V̂ in der Form
V̂ = V̂0 + ϕ • Ŝ + M
(5.2)
zerlegen, wobei ϕ ein vorhersehbarer, Rd -wertiger Prozess ist mit ϕ • Ŝn ∈ L2 für n =
0, . . . , N und M ein zu Ŝ orthogonales Martingal, d. h. M Ŝ i ist ein Martingal für i =
1, . . . , d. Die Martingale ϕ • Ŝ und M sind eindeutig. Der Integrand ϕ löst die vektorwertige
Gleichung
∆hV̂ , Ŝi = ϕ> ∆hŜ, Ŝi,
d. h.
∆hV̂ , Ŝ i in =
d
X
ϕjn ∆hŜ j , Ŝ i in
(5.3)
j=1
für n = 1, . . . , N und i = 1, . . . , d.
Beweis. Nach Lemma 3.13 ist die Menge
R + RN = {v + ϑ • ŜN : v ∈ R, ϑ vorhersehbar und Rd -wertig}
abgeschlossen bzgl. stochastischer Konvergenz. Somit ist
(R + RN ) ∩ L2 = {V̂N (ϕ) : ϕ selbstfin. Strategie mit V̂n (ϕ) ∈ L2 für n = 0, . . . , N }
ein abgeschlossener Unterraum des L2 . Seien Y = V̂N (ϕ) ∈ L2 die Orthogonalprojektion
von V̂N auf diesen Unterraum und U das durch Y erzeugte Martingal, d. h. Un = E(Y |Fn ).
Nach Lemma 2.20 gilt dann U = V̂ (ϕ). Setze M := V̂ − U = V̂ − V̂ (ϕ). Als Differenz
von Martingalen ist M ebenfalls ein Martingal.
Da Y die Orthogonalprojektion ist, gilt E((V̂N − Y )V̂N (ϑ)) = 0 für alle selbstfinanzierenden Strategien ϑ mit V̂n (ϑ) ∈ L2 für n = 0, . . . , N . Insbesondere ist V̂0 − V̂0 (ϕ) =
E(V̂N − V̂N (ϕ)) = 0. (Betrachte dazu die selbstfinanzierende Strategie ϑ mit V̂n (ϑ) = 1 für
alle n.) Wir erhalten somit (5.2).
Seien n ∈ {1, . . . , N } und A ∈ Fn−1 . Für den durch
1A falls j = i und m ≥ n
i
ϑm =
0 sonst.
5.2. VARIANZ-OPTIMALES HEDGEN
83
definierten vorhersehbaren Prozess ϑ folgt
i
0 = E((V̂N − Y )(ϑ • ŜN
))
i
i
= E(MN 1A (ŜN
− Ŝn−1
))
i
i
= E(MN 1A ŜN
) − E(E(MN 1A Ŝn−1
|Fn−1 ))
i
i
) − E(E(MN |Fn−1 )1A Ŝn−1
)
= E(MN 1A ŜN
i
i
= E(1A MN ŜN
) − E(1A Mn−1 Ŝn−1
),
d. h. M Ŝ i ist ein Martingal.
Da [M, Ŝ i ] = M Ŝ i − M0 Ŝ0i − M− • Ŝ i − Ŝ−i • M ein lokales Martingal und daher
wegen seiner Integrierbarkeit sogar ein Martingal ist, folgt hM, Ŝi = 0. Aus (5.2) ergibt
sich hV̂ , Ŝ i i = ϕ • hŜ, Ŝ i i + hM, Ŝ i i = ϕ • hŜ, Ŝ i i, woraus (5.3) folgt.
f eine weitere solche Zerlegung.
Zum Beweis der Eindeutigkeit sei V̂ = V̂0 + ϕ
e • Ŝ + M
f, M − M
fi = h(ϕ
fi = (ϕ
fi = 0 und
Dann ist hM − M
e − ϕ) • S, M − M
e − ϕ) • hS, M − M
f = 0 (z. B. wegen der Bemerkung nach Definition 2.19).
somit M − M
Korollar 5.5 Sei
V̂ = V̂0 + (ϕ1 , . . . , ϕd ) • Ŝ + M
die Galtschuk-Kunita-Watanabe-Zerlegung des Martingals V̂n := E(X̂|Fn ) bezüglich
Ŝ = (Ŝ 1 , . . . , Ŝ d ). Dann ist die im Sinne von Lemma 3.6 zu (ϕ1 , . . . , ϕd ) und zum diskontierten Anfangskapital V̂0 gehörende selbstfinanzierende Strategie ϕ eine varianz-optimale
Hedgingstrategie für X. Die Strategie ϕ löst die Gleichung
∆hV̂ , Ŝi = ϕ> ∆hŜ, Ŝi,
im Sinne von (5.3). Der erwartete quadratische Hedgefehler ist
2
•
•
E((V̂N (ϕ) − X̂) ) = E hV̂ − ϕ Ŝ, V̂ − ϕ ŜiN
= E hV̂ , V̂ iN −
d
X
!
(ϕi ϕj ) • hŜ i , Ŝ j iN
.
i,j=1
Beweis. Im Beweis von Satz 5.4 wurde gezeigt, dass V̂N (ϕ) = V̂0 + ϕ • ŜN die Orthogonalprojektion von X̂ auf {V̂N (ϑ) ∈ L2 : ϑ selbstfinanzierende Strategie} ist. Somit ist ϕ
offenbar varianz-optimal.
Da M ein Martingal ist, ist
M 2 − hM, M i = 2M− • M + [M, M ] − hM, M i
ein lokales Martingal, also wegen der Integrierbarkeit sogar ein Martingal. Somit erhalten
wir E(MN2 ) = E(hM, M iN ), woraus wegen (5.2) Gleichung (5.4) folgt.
2.2.09
84
KAPITEL 5. UNVOLLSTÄNDIGE MÄRKTE
Im Falle d = 1 erhält man die varianz-optimale Hedgingstrategie also als
ϕ1n =
∆hV̂ , Ŝ 1 in
∆hŜ 1 , Ŝ 1 in
.
Der Numeraireanteil ϕ0 ergibt sich wie immer aus der Selbstfinanzierungsbedingung.
Ein konkreter Vorschlag für die in Abschnitt 4.3 aufgeworfenen Fragen besteht etwa
darin, den Anfangswert der varianz-optimalen Strategie ϕ zuzüglich einer vom erwarteten
quadratischen Hedgefehler (z. B. linear) abhängigen Risikoprämie zu fordern. Durch Kauf
der varianz-optimalen Strategie kann sich die Bank zumindest partiell gegen Kursrisiken absichern. Ein Schwachpunkt des oben vorgestellten symmetrischen Kriteriums besteht darin,
dass Gewinne und Verluste gleichermaßen bestraft werden. In der Literatur werden daher
auch alternative Konzepte betrachtet. In der Praxis verwendet man hingegen eher heuristisch
motivierte Zugänge, die sich nur schwer in einem formalen finanzmathematischen Rahmen
rechtfertigen lassen.
Kapitel 6
Ausblick in die zeitstetige
Finanzmathematik
Alternativ zur den in dieser Vorlesung behandelten zeitdiskreten Modellen gibt es zeitstetige,
in denen statt N bzw. {0, . . . , N } solche Mengen R+ bzw. [0, t] von Zeitpunkten betrachtet
werden. Viele Begriffe und Resultate der vorangegangenen Kapitel lassen sich direkt oder
sinngemäß auf diesen Fall erweitern. Die damit verbundene Theorie sprengt jedoch den
Rahmen dieser Einführung. Dennoch soll hier ein kleiner Überblick gegeben werden und
im Anschluss das für die Finanzmathematik zentrale Black-Scholes-Modell angesprochen
werden.
6.1
Zeitstetige Theorie
Die Mehrzahl der Definitionen und Ergebnisse aus Kapitel 2 besitzen Entsprechungen in
stetiger Zeit. Dies umfasst Filtrierungen, filtrierte Wahrscheinlichkeitsräume, stochastische
Prozesse, Adaptiertheit, Semimartingale, Vorhersehbarkeit, erzeugte Filtrationen, Stoppzeiten, gestoppte Prozesse, Martingale, Sub- und Supermartingale, erzeugte Martingale, Dichteprozesse, die verallgemeinerte Bayessche Formel, lokale Martingale, die Doob-MeyerZerlegung, Kompensatoren, das stochastische Integral, Kovariation und vorhersehbare Kovariation, partielle Integration und andere Rechenregeln, Itô-Formel, stochastisches Exponential, Yorsche Formel, Satz von Girsanow, Martingaldarstellungssatz, Snellsche Hülle.
Einige Begriffe erfordern in stetiger Zeit allerdings technisch aufwändigere Definitionen,
insbesondere Semimartingale, Vorhersehbarkeit und stochastisches Integral. Vorsicht ist bei
einigen Resultaten angebracht, die keine oder eine inhaltlich abweichende Entsprechung
besitzen. Dazu gehören z. B. die Lemmata 2.10, 2.14, 2.15, 2.20 (6) und (7). Eine Analogon von Satz 2.16 beschreibt die Klasse der Spezialsemimartingale, an die Stelle der lokalen Martinale in Lemma 2.20 (6) treten die sogenanten σ-Martingale, die Itô-Formel und
die Lösungsformel für das stochastische Exponential haben eine etwas andere Gestalt, der
Martingaldarstellungssatz gilt für die Brownsche Bewegung, die in gewisser Hinsicht eine
Entsprechung der einfachen Irrfahrt in stetiger Zeit bildet.
85
86
KAPITEL 6. AUSBLICK IN DIE ZEITSTETIGE FINANZMATHEMATIK
Im folgenden verwenden wir aus Kapitel 2 bekannte Begriffe wie z. B. Semimartingal,
stochastisches Integral und Resultate wie die Regel der partiellen Integration, Assoziativität
des stochastischen Integrals im Zeitstetigen, ohne sie genau zu definieren oder formulieren. Wir appellieren in diesem informellen Kapitel an die vage Vorstellung, dass es sich
dabei um eine zeitstetige Entsprechung der bekannten Objekte und Zusammenhänge handelt. Stattdessen stellen wir einige Begriffe und Resultate über zeitdiskrete stochastische
Prozesse vor, die wir in dieser Form nicht aus Kapitel 2 kennen.
In der Theorie zeitdiskreter stochastischer Prozesse spielen die aus Summen unabhängiger, identisch verteilter Zufallsvariablen gebildeten Prozesse eine wichtige Rolle. In dieser
Vorlesung treten sie z. B. in den konkreten Marktmodellen aus Abschnitt 3.4 auf. Ihre zeitstetige Entsprechung bilden die folgendermaßen definierten Lévy-Prozesse.
Definition 6.1 Ein Lévy-Prozess (Prozess mit unabhängigen, stationären Zuwächsen)
ist ein Semimartingal X, für das gilt:
1. X0 = 0
2. Xt − Xs ist unabhängig von Fs für s ≤ t.
3. Die Verteilung von Xt − Xs hängt nur von t − s ab.
Lévy-Prozesse spielen in mancher Hinsicht eine ähnliche Rolle wie lineare Funktionen
in der Analysis. Zum einen stehen sie für konstantes Wachstum, auch wenn konstant nun in
einem stochastischen Sinne zu verstehen ist. Zum zweiten lassen sie sich wie eine lineare
Funktion durch relativ wenige Parameter eindeutig charakterisieren. Schließlich bilden sie
den Ausgangspunkt allgemeiner Prozesse, die zwar keine Lévy-Prozesse sind, diesen aber
lokal ähneln, so wie in der Analysis differenzierbare Funktion vereinfacht als lokal lineare
Funktionen aufgefasst werden können.
Der Einfachheit halber betrachten wir im folgenden eindimensionale Prozesse. Der
wichtigste Lévy-Prozess neben den deterministischen linearen Funktionen ist die StandardBrownsche Bewegung, auch wenn dies erst anhand des nachfolgenden Satzes deutlich wird.
Definition 6.2 Ein Lévy-Prozess heißt Standard-Brownsche Bewegung, sofern X1 standard-normalverteilt ist.
Bemerkung. Die Verteilung der Standard-Brownschen Bewegung (aufgefasst als funktionenwertige Zufallsvariable X : Ω → RR+ ) ist eindeutig bestimmt. Sie heißt Wiener-Maß.
Insbesondere ist Xt für N (0, t)-verteilt für beliebiges t > 0.
Ab jetzt betrachten wir stetige Prozesse, d. h. solche, für die Xt (ω) für festes ω stetig in t ist. Der folgende Satz formuliert die überraschende und tiefliegende Tatsache, dass
jeder stetige Prozess mit in obigem Sinne konstantem Wachstumsverhalten schon als Linearkombination zweier fundamentaler Prozesse darstellbar ist, nämlich einer linearen Funktion
und einer Standard-Brownschen Bewegung. Dies unterstreicht die zentrale Bedeutung der
6.1. ZEITSTETIGE THEORIE
87
Brownschen Bewegung für die stochastische Analysis. Ferner zeigt es in Analogie zur gewöhnlichen Analysis, dass die Objekte mit konstantem Wachstum — zumindest was ihre
Verteilung anbetrifft — durch wenige Parameter eindeutig charakterisiert sind, nämlich µ
und σ im Vergleich zur Steigung µ im deterministischen Fall.
Satz 6.3 Ein reellwertiger Lévy-Prozess ist genau dann stetig, wenn es eine StandardBrownsche Bewegung W und Konstanten µ ∈ R, σ ∈ R+ gibt mit
Xt = µt + σWt ,
t ∈ R+ .
Definition 6.4 Motiviert durch den vorigen Satz nennen wir stetige Lévy-Prozesse Brownsche Bewegung mit Drift.
Bezeichnung. Mit I bezeichnen wir von nun an den Identitätsprozess It := t, t ∈ R+ .
Differenzierbare Funktionen lassen sich wie oben angedeutet als lokal lineare auffassen
Rs
und z. B. in der Form f (t) = 0 µ(s)ds schreiben, wobei die Ableitung µ(s) das Wachstum derjenigen linearen Funktion beschreibt, die um s herum die Funktion f approximiert.
Ähnlich kann man nun Prozesse betrachten, die – vage formuliert – lokal einer Brownschen
Bewegung mit Parametern µ, σ ähneln. Man bezeichnet sie als Itô-Prozesse.
Definition 6.5 Sei W eine Standard-Brownsche Bewegung. Prozesse der Form
X = X0 + µ • I + σ • W
mit vorhersehbaren, nach I bzw. W integrierbaren Prozessen µ, σ heißen Itô-Prozess.
4.2.09
Bemerkung. In der Literatur ist dafür auch die Schreibweise
dXt = µt dt + σt dWt
gebräuchlich. Sie wird verständlich, wenn man auf beiden Seiten Integralzeichen ergänzt,
denn
Z T
Z T
Z T
1dXt =
µt dt +
σt dWt
0
0
0
bedeutet nichts anderes als
Z
XT = X0 +
T
Z
T
µt dt +
0
σt dWt
0
und damit
XT = X0 + µ • IT + σ • WT
in Integralnotation, vgl. (2.1).
Auch für zeitstetige Prozesse gibt es den Begriff der Kovariation. Für Itô-Prozesse X =
e =X
e0 + µ
X0 + µ • I + σ • W , X
e•I +σ
e • W ist sie gegeben durch
e = (σe
[X, X]
σ ) • I.
Man benötigt sie für die folgende Itô-Formel.
(6.1)
88
KAPITEL 6. AUSBLICK IN DIE ZEITSTETIGE FINANZMATHEMATIK
Satz 6.6 (Itô-Formel) Falls X = (X 1 , . . . , X d ) komponentenweise ein Itô-Prozess und f :
Rd → R eine zweifach stetig differenzierbare Funktion ist, gilt
d
1X 2
f (Xt ) = f (X0 ) + (Df (X)) Xt +
D f (X) • [X i , X j ]t
2 i,j=1 ij
•
(6.2)
RT
RT
Insbesondere gilt für Itô-Prozesse X = X0 + 0 µt dt + 0 σt dWt und zweifach stetig
differenzierbare Funktion f : R+ × R → R
1 00
0
2
˙
f (t, Xt ) = f (0, X0 ) + f (I, X) + f (I, X)µ + f (I, X)σ • It + (f 0 (I, X)σ) • Wt ,
2
(6.3)
wobei mit Punkt und Strich die Ableitungen nach ersten bzw. zweitem Argument von f bezeichnet sind, d. h. f˙ = D1 f , f 0 = D2 f usw.
Interessanterweise gilt also für Itô-Prozesse die Näherungsformel (2.4) exakt. Bei genauerer
Betrachtung fällt allerdings ein Unterschied auf. Statt X− haben wir in (6.2) X geschrieben. In der zeitstetigen Theorie wird das diskrete Xn− = Xn−1 anschaulich naheliegend zu
Xt− := lims↑t Xs . Im Falle der hier betrachteten stetigen Prozesse gilt also X = X− .
Wir zeigen noch, dass (6.3) aus (6.2) folgt. Dazu betrachtet man den komponentenweie := (I, X). Wegen (6.1) gilt [X, X] = σ 2 • I und [I, I] = [I, X] =
sen Itô-Prozess X
[X, I] = 0. Mit der Assoziativität des Integrals (vgl. Lemma 2.20(1)) folgt
1
f (t, Xt ) = f (0, X0 ) + f˙(I, X) • It + f 0 (I, X) • Xt + f 00 (I, X) • [X, X]t
2
1
= f (0, X0 ) + f˙(I, X) • It + (f 0 (I, X)µ) • It + (f 0 (I, X)σ) • Wt + f 00 (I, X)σ 2 • It
2
wie behauptet.
Aus der Itô-Formel erhält man als Spezialfall die Regel der partiellen Integration
XY = X0 Y0 + X • Y + Y
•
X + [X, Y ],
für Itô-Prozesse, indem man f (X, Y ) = XY betrachtet. Man beachte, dass dies der zeitdiskreten Formel (2.3), nicht aber (2.2) entspricht.
Das stochastische Exponential Z = E (X) eines Semimartingals X ist wieder als eindeutige Lösung der Gleichung Z = 1 + Z− • X definiert. Im hier betrachteten Fall stetiger
Prozesse kann wieder Z statt Z− geschrieben werden.
Satz 6.7 (Stochastisches Exponential) Für Itô-Prozesse X gilt
1
E (X)t = exp Xt − X0 − [X, X]t .
2
(6.4)
Beweis. Für den Itô-Prozess Y := X − X(0) − 12 [X, X] gilt [Y, Y ] = [X, X], da Konstanten
X(0) und Integrale nach I gemäß (6.1) nichts zur Kovariation beitragen. Mit der Itô-Formel
6.2. BLACK-SCHOLES-MODELL
89
erhält man für Z := exp(Y ):
Z = exp(Y )
= exp(Y0 ) + eY
•
1
Y + eY
2
1
X − eY
2
= 1+Z •X
= 1 + eY
•
•
•
[Y, Y ]
1
[X, X] + eY
2
•
[X, X]
wie gewünscht.
Auch hier gilt also die entsprechende Näherungsformel (2.5) aus dem Zeitdiskreten exakt.
In der finanzmathematischen Theorie ist die Situation unübersichtlicher als in der oben
diskutierten Theorie stochastischer Prozesse. Zeitstetige Entsprechungen besitzen Begriffe
und Resultate wie etwa Preisprozesse, Handelsstratgien, Wertprozesse, selbstfinanzierende Strategien, diskontierte Prozesse, Arbitrage, erster Fundamentalsatz, äquivalente Martingalmaße, Dividendenprozesse, Marktbewertung, Duplizierbarkeit, Vollständigkeit, zweiter
Fundamentalsatz, individuelle Bewertung, unterer und oberer Preis, Superhedging, amerikanische Optionen und ihr Bezug zu Stoppproblemen und Snellscher Hülle, Martingalmodellierung, Varianz-optimales Hedgen. Die Gültigkeit der entsprechenden Resultate
hängt jedoch empfindlich von den genauen Definitionen etwa der Menge betrachteter Handelsstrategien usw. ab. Diese unterscheiden sich in der Literatur je nach Modellrahmen und
Anwendungsproblem. Nicht in allen Fällen ist das zeitsteige Analogon der behandelten Resultate bislang mathematisch klar formuliert worden. Insgesamt haben wir es daher weniger
als im Bereich der stochastischen Prozesse mit einer geschlossenen Theorie zu tun.
6.2
Black-Scholes-Modell
Nach den allgemeinen Betrachtungen des vorigen Abschnitts betrachten wir nun ein konkretes Marktmodell mit zwei Wertpapieren. Dieses oft als Black-Scholes-Modell bezeichnete
Standardmarktmodell geht auf Osborne und Samuelson zurück und entspricht direkt dem
zeitdiskreten Analogon in Abschnitt 3.4. Auch hier ist die Idee, dass sich die relativen Kursänderungen homogen in der Zeit und unabhängig von der Vergangenheit entwickeln. Zudem
wird noch die Stetigkeit der Preisprozesse vorausgesetzt. Durch diese Annahmen ist das Modell im Gegensatz zum Zeitdiskreten, wo die Verteilung der täglichen Kursänderungen noch
weitgehend beliebig gewählt werden konnte, bis auf wenige Parameter eindeutig festgelegt.
Dies beruht auf der erstaunlichen, in Satz 6.3 angesprochenen Tatsache, dass jeder stetige
Prozess mit unabhängigen und stationären Zuwächsen schon eine Brownsche Bewegung mit
Drift ist. Insofern verdient der obige Prozess wirklich die Bezeichnung Standardmarktmodell, obgleich die datenanalytischen Vorbehalte auch hier zum Tragen kommen.
Das Geldmarktkonto oder die Anleihe werden modelliert durch
St0 = S00 exp(rt) = S00 E (rI)t
(6.5)
90
KAPITEL 6. AUSBLICK IN DIE ZEITSTETIGE FINANZMATHEMATIK
mit einem konstanten Zinssatz r ∈ R. Ferner betrachten wir eine Aktie oder Fremdwährung,
deren Kursverlauf in folgender Form angenommen wird:
µI + σW )t ,
St1 = S01 exp(µt + σWt ) = S01 E (e
(6.6)
2
mit µ, σ ∈ R, µ
e = µ + σ2 und einer Standard-Brownschen Bewegung W . Einen Prozess der
Form (6.6) nennt man geometrische Brownsche Bewegung. Die Itô-Prozess-Darstellungen
von S 0 und S 1 lauten
St0 = S00 + (S 0 r) • I,
St0 = S01 + (S 1 µ
e) • I + (S 1 σ) • W.
Man kann zeigen, dass dieses Black-Scholes-Modell vollständig ist. Unter dem entspreft := Wt + µ−r t eine Standard-Brownsche
chenden äquivalenten Martingalmaß Q definiert W
σ
Bewegung. Offenbar gilt
σ2
1
1
f
f )t .
St = S0 exp r − t + σ Wt = S01 E (r + σ W
2
Für den Renditeprozeß X := log S 1 gilt somit, dass dessen Zuwächse Xt − Xt−1 , t =
2
0, 1, 2, . . . unabhängig und N (r − σ2 , σ 2 )-verteilt sind. Eingeschränkt auf ganzzahlige Zeitpunkte ist der Prozess X also wie in Lemma 4.12 für σ
e = σ verteilt. Dies führt dazu, dass
man die entsprechenden Optionspreise aus (4.4) erhält.
Wir zeigen an dieser Stelle lediglich, dass der europäische Call (ST1 − K)+ duplizierbar ist und bestimmen die entsprechende perfekte Hedgingstrategie. Wir suchen also eine
selbstfinanzierende Strategie ϕ mit VT (ϕ) = (ST1 −K)+ . Wir machen dazu den einleuchtenden Ansatz, dass der Wert des Portfolios zu jedem Zeitpunkt eine deterministische Funktion
des Aktienkurses ist, d. h.
Vt (ϕ) = f (t, St1 )
für eine deterministische, zweifach stetig differenzierbare Funktion f : [0, T ] × R+ → R.
Aus der Itô-Formel folgt
Vt (ϕ) = f (t, St1 )
1 00
1
0
1
1
1
1
2
˙
= V0 (ϕ) + f (I, S ) + f (I, S )S µ
e + f (I, S )(S σ) • It
2
0
1
1
+ f (I, S )S σ • Wt .
(6.7)
Andererseits lautet die Selbstfinanzierungsbedingung
Vt (ϕ) = V0 (ϕ) + ϕ0 • St0 + ϕ1 • St1
= V0 (ϕ) + ϕ0 S 0 r + ϕ1 S 1 µ
e • It + (ϕ1 S 1 σ) • Wt
(6.8)
(6.9)
Da die Zerlegung eines Itô-Prozesses in Drift- und Diffusionsteil im wesentlichen eindeutig
ist, erwarten wir durch Vergleich von (6.7) und (6.9)
ϕ1 = f 0 (I, S 1 ).
6.2. BLACK-SCHOLES-MODELL
91
Nach Definition des Wertes gilt
V (ϕ) = ϕ0 S 0 + ϕ1 S 1 ,
woraus sich zusammen mit der vorigen Gleichung
ϕ0 S 0 = f (I, S 1 ) − f 0 (I, S 1 )S 1
ergibt. Durch Gleichsetzen der Driftterme von (6.7,6.9) erhalten wir
1
f˙(I, S 1 ) + f 0 (I, S 1 )S 1 µ
e + f 00 (I, S 1 )(S 1 σ)2
2
= ϕ0 S 0 r + ϕ1 S 1 µ
e
= f (I, S 1 )r − f 0 (I, S 1 )S 1 r + f 0 (I, S 1 )S 1 µ
e
Da dies für beliebige Werte von It = t und St1 gelten soll, erhalten wir die folgende partielle
Differentialgleichung für f :
1
f˙(t, x) = − f 00 (t, x)(xσ)2 − f 0 (t, x)xr + f (t, x)r
2
mit der aus VT (ϕ) = (ST1 − K)+ gewonnenen Endbedingung
f (T, x) = (x − K)+ .
Wegen der Verwandtschaft zu Abschnitt 4.4.4 kann man z. B. die dortige Preisformel
verwenden, um einen Lösungskandidaten zu raten. In der Tat rechnet man leicht nach, dass
die obige partielle Differentialgleichung von der Funktion
f (t, x) = xΦ(d1 (t, x)) − Ke−r(T −t) Φ(d2 (t, x))
mit
log Kx + r(T − t) +
√
d1 (t, x) :=
σ
e T −t
log Kx + r(T − t) −
√
d2 (t, x) :=
σ
e T −t
σ
e2
(T
2
− t)
σ
e2
(T
2
− t)
gelöst wird, die wir aus (4.4) kennen. Die zugehörige Handelsstrategie lautet
ϕ1t = f 0 (t, St1 ) = Φ(d1 (t, St1 ))
und
ϕ0t =
f (t, St1 ) − f 0 (t, St1 )St1
= −Ke−rT Φ(d2 (t, St1 )).
St0
Das Umkehren der obigen Rechnung zeigt, dass diese Strategie tatsächlich den Wert
Vt (ϕ) = f (t, St1 ) = St1 Φ(d1 (t, St1 )) − Ke−r(T −t) Φ(d2 (t, St1 ))
(6.10)
9.2.09
92
11.2.09
KAPITEL 6. AUSBLICK IN DIE ZEITSTETIGE FINANZMATHEMATIK
besitzt und dass sie die Selbstfinanzierungsbedingung (6.8) erfüllt. Da zudem VT (ϕ) =
(ST1 − K)+ gilt, haben wir eine duplizierende Strategie für den europäsichen Call gefunden.
An der Black-Scholes-Formel (6.10) ist bemerkenswert, dass der faire Preis des Calls
nur vom Volatilitätsparameter σ, nicht aber vom ohnehin nicht leicht zu schätzenden Driftparameter µ abhängt. Ausgerechet der Parameter, von dem ganz entscheidend abhängt, mit
welcher Wahrscheinlichkeit überhaupt eine Auszahlung stattfindet, geht nicht in den Preis
ein. Dies erscheint auf den ersten Blick paradox. Ferner bleibt anzumerken, dass man die
Zahl der Aktien im Hedgeportfolio durch Ableiten der Bewertungsfunktion nach dem Aktienkurs erhält. Diese Ableitung wird auch das Delta der Option genannt.
Schließlich sei erwähnt, dass man das Black-Scholes-Modell samt der Optionspreisformel (6.10) gewissermaßen als Limes einer Folge von Binomialmodellen erhält. Dies ergibt
sich aus Aufgabe 4 auf Blatt 10. Aus Sicht des Standardmarktmodells aus Abschnitt 4.4.4 ist
die Vollständigkeit des Black-Scholes-Modells jedoch äußerst überraschend. Wenn man die
Preisprozesse (6.5,6.6) auf ein noch so feines zeitdiskretes Gitter einschränkt, erhält man das
triviale Preisintervall für den Call; im zeitstetigen Grenzfall hingegen bleibt nur ein einziger
mit Arbitragefreiheit verträglicher Preis übrig.
Literaturverzeichnis
[Bau78] H. Bauer. Wahrscheinlichkeitstheorie und Grundzüge der Maßtheorie. de Gruyter,
Berlin, third edition, 1978.
[JP04]
J. Jacod and P. Protter. Probability Essentials. Springer, Berlin, second edition,
2004.
[KS01] Yu. Kabanov and C. Stricker. A teachers’ note on no-arbitrage criteria. In Séminaire de Probabilités XXXV, volume 1755 of Lecture Notes in Mathematics,
pages 149–152. Springer, Berlin, 2001.
[RW98] T. Rockafellar and R. Wets. Variational Analysis. Springer, Berlin, 1998.
[Wer02] D. Werner. Funktionalanalysis. Springer, Berlin, 2002.
93