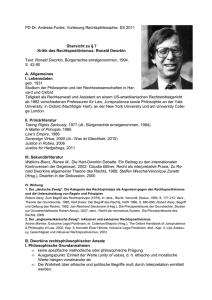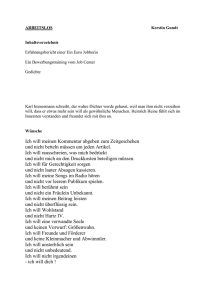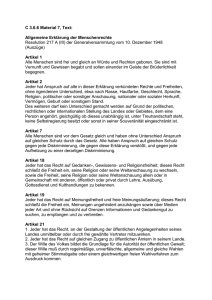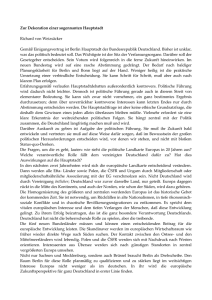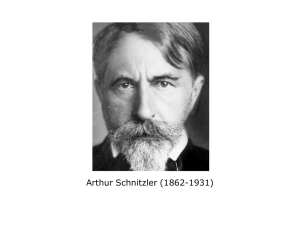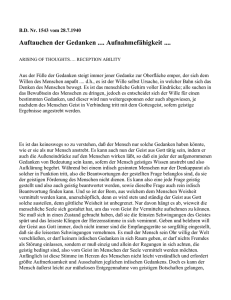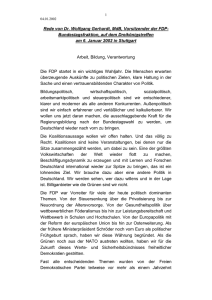Dietmar von der Pfordten Vorlesung Theorie und Methoden des
Werbung
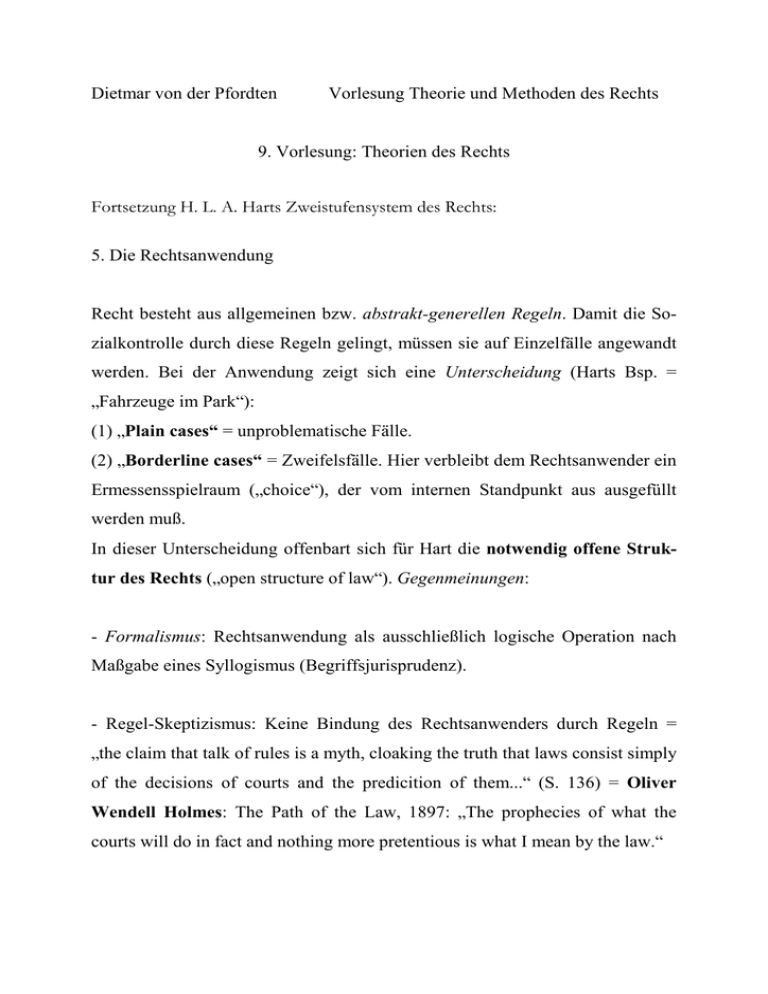
Dietmar von der Pfordten Vorlesung Theorie und Methoden des Rechts 9. Vorlesung: Theorien des Rechts Fortsetzung H. L. A. Harts Zweistufensystem des Rechts: 5. Die Rechtsanwendung Recht besteht aus allgemeinen bzw. abstrakt-generellen Regeln. Damit die Sozialkontrolle durch diese Regeln gelingt, müssen sie auf Einzelfälle angewandt werden. Bei der Anwendung zeigt sich eine Unterscheidung (Harts Bsp. = „Fahrzeuge im Park“): (1) „Plain cases“ = unproblematische Fälle. (2) „Borderline cases“ = Zweifelsfälle. Hier verbleibt dem Rechtsanwender ein Ermessensspielraum („choice“), der vom internen Standpunkt aus ausgefüllt werden muß. In dieser Unterscheidung offenbart sich für Hart die notwendig offene Struktur des Rechts („open structure of law“). Gegenmeinungen: - Formalismus: Rechtsanwendung als ausschließlich logische Operation nach Maßgabe eines Syllogismus (Begriffsjurisprudenz). - Regel-Skeptizismus: Keine Bindung des Rechtsanwenders durch Regeln = „the claim that talk of rules is a myth, cloaking the truth that laws consist simply of the decisions of courts and the predicition of them...“ (S. 136) = Oliver Wendell Holmes: The Path of the Law, 1897: „The prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious is what I mean by the law.“ 2 Dagegen Hart: Offens Struktur ist zunächst der Unzulänglichkeit der menschlichen Sprache und des menschlichen Erkenntnisvermögens geschuldet. Rechtstheoretische Wahrheit liegt zwischen Formalismus und Regelskeptizismus: „In fact all systems, in different ways, compromise between two social needs: the need for certain rules which can, over great areas of conduct, safely be applied by private individuals to themselves without fresh official guidance or weighing up of social issues, and the need to leave open, for later settlement by an informed, official choice, issues which can only be properly appreciated and settled when they arise in a concrete case.“ (S. 130) - Recht muß sowohl bindende Elemente als auch Elemente der Wahl enthalten. Nach Hart sind es vor allem die borderline cases, die den Gerichten und Verwaltungsbeamtenweite Spielräume der autoritativen Auslegung eröffnen: „The open texture of law means that there are, indeed, areas of conduct where much must be left to be developed by courts or officials striking balance, in the light of circumstances, between competing interests which vary in weight from case to case.“ (S. 135) Problem: Wahrnehmung des Ermessensspielraums? Wahl zwischen widerstreitenden Interessen. Keine Willkür, sondern nach Hart rationale Gründe aus dem internen Aspekt des Rechtssystems entscheidend (Prinzipien, Klugheitsregeln und Standards): was ist vom internen Standpunkt aus eine vertretbare und vermittelbare Entscheidung bzw. Auslegung? - Für die Gerichte ist das Recht gerade nicht die Voraussage, wie Gerichte entscheiden werden (externer Standpunkt). In jeder Großgruppe müssen allgemeine Regeln, also Normen und Präzedenzfälle, Hauptmittel der sozialen Kontrolle sein. Deren prinzipielle Unbestimmt- 3 heit führt zu einer „offenen Struktur“ des Rechts, denn es gibt eine Grenze der Anleitung durch allgemeine Sprache. Damit bleibt in jedem Rechtssystem ein großes und wichtiges Feld der freien Entscheidung der Gerichte und staatlichen Stellen überlassen. H. wendet sich mit seiner Theorie sowohl gegen jede Art von „mechanischer Jurisprudenz“ (Formalismus), die diese offene Struktur ignoriert, als auch gegen jede Form des Regelskeptizismus, z. B. den amerikanischen Rechtsrealismus, der sie überbetont. Er steht also insofern durchaus im mittleren methodischen Lager das mit Bezug auf die Rechtsanwendung durch die Interessenjurisprudenz und die Wertungsjurisprudenz gebildet wird. 6. Rechtsethik und Rechtspolitik Neben den rechtstheoretisch-analytischen finden sich bei H. auch rechtsethische bzw. rechtspolitische Untersuchungen, die sich vor allem mit Normen des Strafrechts beschäftigen, so The Morality of the Criminal Law (1965), Punishment and Responsibility (1968) und die berühmt gewordene Schrift Law, Liberty and Morality (1963). H. schaltete sich mit ihr in die öffentliche Diskussion ein, die sich 1959 in England an der Empfehlung des sog. Wolfenden Reports entzündete, homosexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen künftig straffrei zu stellen. Fraglich sei, ob es sich rechtfertigen lasse, die positive, bestehende Moral, die H. von einer kritischen unterscheidet, mit Hilfe des Rechts durchzusetzen. H. vertritt eine gemäßigt-Iiberale, durch soziale und demokratische Elemente ergänzte Position: Entgegen Mills Ansicht, Erwachsene wüßten immer selbst am besten, was ihnen nütze, sei ein gewisser Paternalismus durch das Recht zum Schutz der Person gerechtfertigt, z. B. durch Bestrafung des Täters trotz Einverständnisses des Opfers mit der Tat. Die moderat konservative Position 4 übersehe, daß eine Veränderung der positiven Moral keine Zerstörung der Gesellschaft bedeute, sondern zu ihrem Fortschreiten beitrage. Es spreche kein Anzeichen dafür, daß Moralität am besten durch Bestrafung gelehrt werde, wie die strikte Position meine. Wirklich gefährlich für bestehende Moralvorstellungen sei die freie Diskussion, die aber nicht unterbunden werden dürfe. I. Dworkins Kritik an Hart/Die Prinzipientheorie Ronald Dworkin hat in mehreren Aufsätzen, die dann in dem Band „Taking Rights Seriously“ (1977) zusammengefaßt wurden, gegen Hart geltend gemacht, daß Rechtsordnungen – anders als Hart in seinem zweistufigen Regelmodell annimmt – neben Regeln auch Prinzipien enthalten. Eine Regel ist als „Alles-oder-Nichts-Gebot“1 verpflichtend, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind, nicht verpflichtend, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen nicht gegeben sind. Prinzipien geraten dagegen miteinander in Konflikt und ihr relatives Gewicht entscheidet.2 Prinzipien werden im Gegensatz zu Regeln in ihrer Durchsetzungskraft durch andere Prinzipien limitiert. Bei jeder Anwendung muß demnach eine Abwägung und Gewichtung der relevanten Prinzipien erfolgen. Dworkin konzediert allerdings, daß Regeln und Prinzipien manchmal fast dieselbe Rolle spielen.3 Aus der Feststellung, daß das Recht aus Regeln und Prinzipien besteht, leitet Dworkin zwei Rechtfertigungen für die These des rechtsethischen Essentialismus, also die Annahme einer notwendigen Beziehung Dworkin 1977, p. 24; S. 58. Dworkin 1977, p. 26; S. 62. Vgl. R. Dreier 1986, S. 103 ff. 3 Dworkin 1977, p. 27; S. 63. 1 2 5 von Recht und Moral ab, eine strukturtheoretische und eine geltungstheoretische.4 4 Vgl. R. Dreier 1986, S. 105ff. 6 Das strukturtheoretische Argument besagt, daß Prinzipien kraft ihrer Struktur den engeren normativistischen Rechtsbegriff sprengen, weil sie die approximative Realisierung eines ethischen Ideals zur Rechtspflicht erheben. Das geltungstheoretische Argument besagt, daß die faktische und normativ gebotene Heranziehung solcher Prinzipien die strikte Grenzziehung zwischen rechtlichen Regeln und moralischen Prinzipien durch eine sekundäre Erkenntnisregel unmöglich macht. Harts sekundäre Erkenntnisregel kann als gesellschaftliche Regel zwar Primärregeln als gültiges oder ungültiges Recht auszeichnen, nicht aber Prinzipien.5 Zur Beurteilung des strukturtheoretischen Arguments ist festzustellen: Dworkin behauptet zwar, daß seine Thesen nicht nur für das amerikanische bzw. angelsächsische Rechtssystem gelten,6 aber er bezieht sich selbst überwiegend auf dieses. Im angelsächsischen Recht gibt es weite Bereiche ohne systematische Kodifikation oder Gesetzgebung, die nur durch richterliches Fallrecht geregelt werden. Hat man aber nur einzelne Fälle als Entscheidungsrichtlinie, so liegt es nahe, zwischen ihnen durch die Bildung von Prinzipien zeitliche und räumliche Kohärenz herzustellen. Man kann dies als Vorstufe einer abstrakt-generellen gesetzlichen Regelung auffassen. Aus der Tatsache, daß die spezielle Rechtsform des richterlichen Fallrechts eine solche Hilfe zur Kohärenzbildung benötigt, darf aber nicht geschlossen werden, dies gelte für alle Typen des Rechts, etwa auch für Rechtsordnungen, in denen Kodifikationen, Parlamentsgesetze und geschriebene Verfassungen eine zentrale Rolle spielen. Damit kann das 5 6 Dworkin 1977, p. 56ff.; S. 112. Dworkin 1977, p. 352; S. 562. 7 strukturtheoretische Argument zumindest für Rechtsordnungen wie die deutsche nicht überzeugen. Im übrigen müßte erst einmal erwiesen werden, daß die Prinzipienbildung auf Wertungen beruht, die nicht bloße Rechtswertungen des positiven Rechts sind. Die Tatsache, daß die Wertungen von Einzelentscheidungen zu einer allgemeinen Regel geformt werden, garantiert ja nicht, daß diese Regel in irgendeiner Weise als rechtsethische und damit überpositive zu qualifizieren ist. Die Mitglieder einer Räuberbande können ihre zufällige tägliche Einzelentscheidung, einen Überfall zu verüben, zum Prinzip erheben. Dieses Prinzip mag mit einem anderen Prinzip der Bande kollidieren, etwa einmal in der Woche ein Fest zu feiern, also nicht als Alles-oder-Nichts-Regel anwendbar sein. Dies alles beweist aber nicht, daß entsprechende Prinzipien rechtsethische und nicht rechtliche oder bloß technische Prinzipien sind. Aus einem Strukturunterschied von Normen kann man nicht auf die ethische Rechtfertigungskraft eines Normtyps schließen. Zum geltungstheoretischen Argument ist zu sagen: Wenn klare Verfassungsund Organisationsnormen die Erzeugung und Geltung von Gesetzen regeln, so ist für einen zentralen Rechtsbereich die Unterscheidung zwischen rechtlichen Normen und außerrechtlichen Rechtfertigungen eindeutig – wenn man von einer sprachlich bedingten unvermeidlichen Unschärfe absieht. Auch richterrechtliche Regeln können diesen zwei Bereichen zugeordnet werden. Sie bleiben im Normbereich des Rechts, wenn sie sich im Rahmen des möglichen Wortlauts und der Rechtswertungen des positiven Rechts halten. 8 Überdies haben Rechtsordnungen wie die der Bundesrepublik einen Großteil der ethischen Prinzipien in ihre Verfassung inkorporiert und damit zu positivem Recht erhoben.7 Die Rechtsprechung kann auf Rechtswertungen der Verfassung zurückgreifen. Dabei handelt es sich aber um rechtsimmanente rechtliche Wertungen und nicht um das positive Recht übersteigende ethische Wertungen. Aber selbst wenn man annimmt, daß die Rechtsprechung in zweifelhaften Fällen faktisch auch auf außerrechtliche Wertungen zurückgreift, ist der rechtsethische Essentialismus noch nicht bewiesen. Das tatsächliche Überschreiten der Grenzen des positiven Rechts durch einzelne Rechtsanwender beweist keine begrifflich-analytische Verbindung von Recht und Ethik. Für das deutsche Recht muß man bei der Rechtsanwendung wegen Art. 20 III GG vier Schritte annehmen, die vier konzentrischen Kreisen entsprechen: (1) die Gesetzesanwendung, wenn der Wortlaut eindeutig ist, (2) die Rechtsfindung durch Anwendung der Regeln der juristischen Methodenlehre, vor allem der Auslegungs- und Analogieregeln, (3) das Heranziehen von immanenten Rechtswertungen der Rechtsordnung, vor allem der Verfassung, (4) die Inkorporation außerrechtlicher Wertungen.8 Faktisch ist davon auszugehen, daß in immer stärkerem Maße außerrechtliche, moralische und ethische Wertungen in die Entscheidungsfindung einströmen, je weiter man von (1) bis (4) voranschreitet (deskriptive Diffusionsthese). Auch normativ muß man annehmen, daß die aneinanderstoßenden Normenordnungen in ihrer Verbindlichkeitskraft abnehmen bzw. zunehmen, je stärker bzw. schwächer die andere Normenordnung ist. Dies ist ethisch und juridisch (vgl. Art. 20 III GG) zu befürworten. Wenn 7 8 Vgl. BVerfGE 34, S. 269ff. (287); R. Dreier 1986, S. 107. Vgl. v. d. Pfordten 1993, S. 433ff. 9 weder der Gesetzeswortlaut noch die juristische Methodik und die Rechtswerte zu einer Entscheidung führen, dann sollte das Recht eher die Heranziehung außerrechtlicher rechtsethischer Wertungen in Kauf nehmen als eine reine Willkürentscheidung treffen (normative Diffusionsthese). Die deskriptive und die normative Diffusionsthese präzisieren den rechtsethischen Normativismus. Recht und Rechtsethik sind nicht wie zwei glatte aufeinanderliegende Oberflächen verbunden, sondern ethische Wertungen dringen unterschiedlich tief und stark in das Recht ein. Da die Stufen (1) – (3) genuin juridisch bestimmt sind, kann der Vertreter der analytischen Verbindungsthese mit seinem Prinzipienargument allenfalls auf die vierte Stufe der Rechtsanwendungskreise verweisen. Er kann aber seine These weder dadurch stützen, daß es faktisch eine solche Begründungsstufe in Urteilen gibt, denn Faktizität ist empirisch und kontingent und beweist keine 10 begriffliche Analytizität, noch dadurch, daß er die Notwendigkeit einer solchen vierten Stufe behauptet, denn dies ist lediglich eine mögliche Umformung der analytischen Verbindungsthese. Die analytische Verbindungsthese wäre nur bewiesen, wenn es zu zeigen gelänge, daß der Rechtscharakter einer Normenordnung aufgehoben wäre, wenn auf die Heranziehung der Stufe (4) verzichtet würde, sei dies auf eine normative Anweisung hin oder nicht. Dies kann aber als analytische These mit Verweis auf tatsächliches empirisches Verhalten gar nicht gezeigt werden. Man kann das Prinzipienargument auch noch auf einer basaleren normlogischen Ebene anzweifeln. Jede Präskription bzw. jede Norm enthält sowohl in ihrem deskriptiven Voraussetzungsteil als auch in ihrem normativen Gebotsteil ein striktes und ein graduell-relatives Element. Nur im Rahmen des tatsächlichen Sprachgebrauchs kann eines dieser Elemente im Einzelfall als unsinnig oder kontraproduktiv ausgeschlossen werden. Man denke sich folgendes Beispiel: Wenn ich einen Freund bitte, unter der Voraussetzung, daß es noch vier Eier gibt, vier Eier beim Händler zu besorgen (striktes deskriptives und normatives Element), so impliziert dies normalerweise, daß er auch ein, zwei oder drei Eier kaufen soll, wenn nur noch ein, zwei oder drei Eier vorhanden sind (graduellrelatives deskriptives und normatives Element). Die letzten beiden graduellrelativen Elemente meiner Bitte äußere ich nur dann nicht, wenn ich zu erkennen gebe, daß ich ausnahmsweise genau vier Eier brauche und mit zweien nichts anfangen kann, etwa weil ich für uns beide ein Omelett zubereiten will. Im Regelfall („Vier Eier oder weniger!“) enthält dieses Gebot also im Voraussetzungsteil und im Rechtsfolgeteil eine strikte sowie eine graduelle Deskription und Präskription. Im Ausnahmefall („Nur genau vier Eier!“) ist die graduelle Deskription und Präskription im Voraussetzungs- und im Rechtsfolgeteil aufgehoben. Es gibt nun auch Normen, die nicht erst durch eine zusätzliche Sprachhandlung eingeschränkt werden müssen, sondern schon inhaltlich strikt, also 11 nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip, gefaßt sind. Die Bitte an meinen Freund, unter der Voraussetzung, daß der Händler offen hat, einzukaufen, wäre ein solches Gebot. Ein Händler kann zu einem bestimmten Zeitpunkt nur offen haben oder nicht offen haben. Eine graduelle Abstufung ist nicht möglich. Die zweifelhafte Annahme Dworkins und mancher Anhänger der Regeln-/Prinzipienunterscheidung besteht nun darin zu glauben, der soeben erläuterte abstrakte sprachfunktionale bzw. normlogische Sachverhalt führe zu unterschiedlichen Normtypen und diese seien mit Rechts- und. Moralnormen bzw. ethischen Rechtfertigungen zu identifizieren. Dagegen muß man einwenden: Es kann selbstverständlich auch Moral- oder Ethiknormen geben, die strikt gebieten, wie dies Kant etwa für das Verbot der Lüge annahm. Und es kann Rechtsnormen geben, die graduelle Abstufungen zulassen, etwa einzelne Verfassungsnormen. Der Zusammenhang zwischen den beiden Normcharakterisierungen strikt/graduell und Recht/Moral bzw. Ethik ist also ein kontingenter, kein analytischer und notwendiger. Zuzugeben ist nur eine gewisse statistische Häufung: Rechtsnormen werden häufiger strikt gebieten, weil sie stärker ins Detail gehen und weil jeder Rechtsetzer im Zweifel wahrscheinlich die präzisere Formulierung wählen wird. Ist dies nicht möglich, wird er eher die strikte Formulierung bevorzugen, die auch die Gradualisierung enthält, als sich von vornherein auf die Gradualisierung zu beschränken. Moralische Normen und ethische Rechtfertigungen sind dagegen abstrakter. Zwischen ihnen wird es häufiger zu Kollisionen kommen, die eine Gradualisierung notwendig machen. Aus dieser statistischen Häufung kann aber nicht auf eine begrifflich-analytische Verbindung beider Merkmale und damit auch nicht auf eine begrifflich-analytische Verbindung von Recht und Ethik geschlossen werden. Alexy hat weiterhin geltend gemacht, daß das Recht einen „Anspruch auf Richtigkeit“ erhebe, was vom Standpunkt des Beobachters für das Rechtssystem als 12 Ganzes und vom Standpunkt des Teilnehmers sowohl für das Rechtssystem als Ganzes als auch für einzelne Normen die analytische Verbindungsthese beweisen soll.9 Er führt das Beispiel einer Banditenbande an, die andere Menschen ausbeutet: „Auf lange Sicht erweist sich die prädatorische Ordnung nicht als zweckmäßig. Die Banditen bemühen sich daher um eine Legitimation. Sie entwickeln sich zu Herrschern und damit die prädatorische zu einer Herrscherordnung. An der Ausbeutung der Beherrschten halten sie fest. Die Akte der Ausbeutung erfolgen aber im Wege einer regelgeleiteten Praxis. Es wird jedermann gegenüber behauptet, daß diese Praxis richtig sei, weil sie einem höheren Zweck, etwa dem der Entwicklung des Volkes diene. ... Der entscheidende Punkt ist vielmehr, daß in der Praxis des Herrschersystems ein Anspruch auf Richtigkeit verankert und gegenüber jedermann erhoben wird. Der Anspruch auf Richtigkeit ist ein notwendiges Element des Begriffs des Rechts.“10 Gegenüber dieser These ist zunächst zu fragen, was unter einem „Anspruch auf Richtigkeit“ zu verstehen ist. Dabei begegnet schon die Wortverbindung Zweifeln. Ein Anspruch wird immer gegenüber einem anderen erhoben; und zwar mit dem Ziel, diesen anderen zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen. Man erhebt einen Anspruch auf Zustimmung, Befolgung, Anerkennung, Respekt etc. „Richtigkeit“ ist demgegenüber kein mögliches Verhalten eines angesprochenen anderen Menschen oder einer Gemeinschaft von Menschen. „Richtigkeit“ ist die Substantivierung einer janusköpfigen Verbindung aus Wertung und Beschreibung. Wir beurteilen Normen oder Handlungen als „richtig“. Damit kann unter „Anspruch auf Richtigkeit“ „Bewertung als richtig durch den Urheber“ oder 9 Alexy 1992, S. 62ff., 124. Alexy 1992, S. 61f. 10 13 weitergehend „Bewertung als richtig durch den Urheber, verbunden mit dem Anspruch gegenüber dem Adressaten auf Zustimmung zur Bewertung als richtig“ verstanden werden. Auf das Banditenbeispiel übertragen, kann dies bedeuten, daß die Banditen gegenüber den Beherrschten eine „Behauptung der Richtigkeit“ erheben wollen und es ihnen gleichgültig ist, ob die Hörer diese Behauptung nur registrieren, oder es kann bedeuten, daß die Banditen wollen, daß die Hörer dieser Behauptung zustimmen. Da die Qualifizierung als „richtig“ eine positive Bewertung darstellt, kann man die Frage so formulieren: Verbinden die Banditen mit ihren Regeln notwendig eine positive Bewertung ihrer Regeln als richtig (erste Teilfrage), und wenn ja, wollen sie, daß die Unterworfenen ihrerseits diese positive Bewertung übernehmen (zweite Teilfrage)? Wie sich aus den obigen Überlegungen ergibt, ist die erste Teilfrage aus sprachlogischen Gründen mit „ja“ zu beantworten, wenn man annimmt, daß die Banditen ihre Normen autonom, d. h. ohne Zwang durch andere, erlassen. Wer einen anderen zu einem Verhalten verpflichtet, wertet damit gleichzeitig – wenn er selbst nicht unter Zwang handelt – die Realisation dieses Verhaltens und die normative Anforderung gegenüber dem anderen positiv.11 Die positive Antwort auf die erste Teilfrage trägt aber für die Annahme eines „Anspruchs auf Richtigkeit“ nichts ein, denn jeder Befehl, jedes Gebot, ja sogar jedes tatsächliche Verhalten, das andere betrifft, enthält implizit eine derartige positive Bewertung des Befehls, Gebots oder tatsächlichen Verhaltens durch den Sprecher oder Akteur. Dies gilt auch schon, bevor sich die Banditenbande um „Legitimation bemüht“. 11 Vgl. v. d. Pfordten 1993, S. 248. 14 Die sprachfunktionale Tatsache einer Wertungsimplikation ist für das Recht nicht spezifisch und bedeutet nicht, daß die implizierte Wertung in irgendeiner zufälligen oder gar notwendigen Verbindung zu außerrechtlichen Wertungen steht. Die Banditen können etwa gewohnheitsmäßig oder rein dezisionistisch Vorschriften erlassen, ohne daß damit die durch die Vorschriften implizierte Bewertung irgendein außerhalb der Vorschriften liegendes ethisches Pendant hätte. Auf die zweite Teilfrage, ob neben der Bewertung auch der Anspruch gegenüber den Unterworfenen erhoben wird, daß diese die Bewertung übernehmen, kann man antworten: Dies geschieht nicht notwendig, aber regelmäßig. Denn nur wenn ein Angesprochener ebenfalls eine positive Bewertung entwickelt, wird er auch ohne Zwang zur Ausführung der vom Sprecher erwarteten Handlung bereit sein. Es liegt also im Interesse des Sprechers, daß auch der Angesprochene das erwartete Verhalten positiv wertet. Die zweite Teilfrage ist aber dann häufig negativ zu beantworten, wenn dem Sprecher Sanktionen bzw. Zwangsmittel zur Verfügung stehen. Kann er den Hörer zum geforderten Verhaltens zwingen, so muß er sich nicht darum bemühen, bei diesem eine zustimmende Bewertung zu erzeugen. Man könnte somit bei der Räuberbande nur dann von einem durchgängigen – wenn auch nicht notwendigen – Bemühen um positive Bewertung aller Maßnahmen durch die Unterworfenen ausgehen, wenn die Bande den Charakter als Zwangsordnung aufgeben würde. Dies nimmt aber weder Alexy in seinem Beispiel an, noch kann es für entwickelte Rechtsordnungen demokratischer Staaten der westlichen Welt postuliert werden, die ihre Rechtsregeln zumindest partiell mit Zwang durchsetzen. 15 Man könnte nun entgegnen: Es kommt nicht auf eine positive Bewertung durch die Unterworfenen in Einzelfällen an, sondern auf eine positive Bewertung der regelgeleiteten Praxis als Ganzes. Es kann nicht geleugnet werden, daß sich Rechtsetzer häufig um eine derartige generelle positive Bewertung bemühen. Es kann auch nicht geleugnet werden, daß sich die Banditen empirisch-faktisch „um eine Legitimation“ bemühen. Sie tun faktisch genau das, was mit dem Beispiel als begrifflich notwendig apostrophiert wurde: Sie verbinden ihre Normenordnung mit ethischen Rechtfertigungen. Aber das beweist nicht die begrifflich-analytische Verbindungsthese. Denn die Banditen können auch auf eine derartige Verbindung verzichten oder sie nur in beschränktem Maße anstreben – etwa wenn eine Revolution droht – oder nur gegenüber einzelnen Personen, etwa gegenüber den Clanführern der Unterworfenen. Ab welcher Intensität eine solche zusätzliche normative Legitimität dann die Zwangsordnung als Rechtsordnung qualifizieren soll, ist kaum festzulegen. Jedenfalls kann ein solches kontingentes und graduelles Verhalten nicht die These einer begrifflichanalytisch notwendigen Verbindung von Recht und Ethik rechtfertigen. Die These des rechtsethischen Essentialismus ist damit nicht erwiesen. Wer das „Bemühen um Legitimation gegenüber den Beherrschten“ als notwendiges Rechtskriterium postuliert, hat des weiteren zu bedenken, daß damit nicht nur Mörderregimen und Räuberbanden der Rechtsstatus abgesprochen wird, sondern auch einer größeren Anzahl von Normenordnungen, die bisher als Rechtsordnungen – wenn auch vielleicht als ungerechte Rechtsordnungen – angesehen wurden: allen Herrscherordnungen, die sich auf ein legitimatorisches Prinzip berufen, ohne dafür von den Rechtsunterworfenen eine Zustimmung in Anspruch zu nehmen. Dies gilt etwa für die christlichen Könige und Kaiser des Abendlandes mit ihrer Rückführung der Herrschermacht auf göttliche Einsetzung sowie für die alliierten Besatzungsmächte in Deutschland nach 1945. Aus pragmatischen Gründen haben natürlich auch diese Herrscher zum Teil ge- 16 genüber den Beherrschten auf ihre rechtsethische Legitimation verwiesen, zum Teil aber auch nicht. Aus diesem tatsächlichen Verhalten, das pragmatisch sinnvoll und rechtsethisch geboten ist, kann aber nicht auf seine begrifflichanalytische Notwendigkeit geschlossen werden. Im übrigen bedeutet das Erheben eines „Anspruchs auf Richtigkeit“ ja noch nicht, daß hier Richtigkeit – und damit eine notwendige Verbindung von Ethik und Recht – tatsächlich anzunehmen ist. Für die Teilnehmerperspektive versucht Alexy, die begrifflich-analytische Verbindungsthese des rechtsethischen Essentialismus zu erhärten, indem er Äußerungen anführt, die gegen den immer schon performativ erhobenen „Anspruch auf Richtigkeit“ verstoßen, zum Beispiel eine Verfassungsnorm „X ist eine souveräne, föderale, ungerechte Republik“,12 „Der Angeklagte wird, was falsch ist, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.“13 Gegen diese Vorgehensweise kann man schon methodische Einwände erheben: So wie ein Naturgesetz nicht durch einzelne positive Experimente als im strengen Sinne bewiesen angesehen werden kann, weil die Induktion kein logisch gültiger Schluß ist, so kann man kaum durch einzelne Äußerungsbeispiele, in denen performative Widersprüche auftreten, beweisen, daß ein „Anspruch auf Richtigkeit“ begrifflich notwendig, das heißt immer und überall erhoben wird. Die Beispiele können allenfalls den Status einer Plausibilisierung unserer kontingenten Sprachkonventionen für sich in Anspruch nehmen. Aber selbst unter diesem Vorbehalt sind sie kaum überzeugend: 12 13 Alexy 1992, S. 67. Alexy 1992, S. 68. 17 Zum ersten Beispiel: Die Verfassungsnorm ist aufgrund ihrer illokutionären Einbettung – das heißt ihrer Verwendung im Rahmen einer Verfassung – als präskriptiver Sprechakt zu interpretieren, der als solcher – wie sich oben ergab – immer auch eine positive Eigenbewertung enthält. Eine derartige positive Eigenbewertung ist nicht spezifisch für das Recht, sondern begleitet alle autonomen Präskriptionen. Es ist auch fehlerhaft zu sagen: „Geh’ zum Einkaufen, obwohl ich es für ungerecht halte, dich zum Einkaufen zu schicken!“ Die sprachliche Inkorporation einer Bewertung kann deshalb einer analytischen Verbindung von Rechtsethik und Recht nicht gleichgesetzt werden. Zum zweiten Beispiel: Wichtig ist zunächst, daß in diesem Beispiel nur ein performativer Widerspruch entsteht, wenn man Alexys Deutung als „Der Angeklagte wird, was eine falsche Interpretation des geltenden Rechts ist, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt“14 übernimmt. Versteht man das Beispiel dagegen als „Der Angeklagte wird, obwohl ich es persönlich für falsch halte, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt“, so ergibt sich kein performativer Widerspruch. Der Richter kann demnach ein geltendes Gesetz ohne weiteres anwenden, obwohl er selbst eine andere Fallösung vorziehen würde, etwa weil er eine lebenslange Freiheitsstrafe für inhuman hält. Aber selbst wenn man Alexys Deutung des Beispiels übernehmen würde, könnte nie ausgeschlossen werden, daß der performative Widerspruch in der Äußerung aus einem Widerspruch zwischen innerjuridischen Rechtswertungen erwächst. Daß der Verweis auf außerjuridische rechtsethische Wertungen notwendig ist, kann deshalb durch einen derartigen performativen Widerspruch nicht dargetan werden. 14 Alexy 1992, S. 68. 18 II. Exklusiver Rechtspositivismus/Inklusiver Rechtspositivismus Der Positivismus hat auf die Kritik Dworkins mit einer Spaltung in zwei Schulen reagiert. Die Existenz der Prinzipien wird zwar anerkannt. Aber je nachdem ob es zumindest möglich ist, die Prinzipien als Teil oder nicht als Teil des Rechts aufzunehmen werden, wird ein inklusiver oder exklusiver Positivismus unterschieden. 1. Exklusiver Rechtspositivismus Joseph Raz und sein Schüler Andrei Marmoor vertreten einen sog. exklusiven Rechtspositivismus. Marmoor führt zwei Argumente an:15 (1) Das Recht ist dadurch gekennzeichnet, daß konventionelle Regel soziale Tatsachen als Quellen des Rechts bestimmen. Die Erkenntnisregel moderner Rechtssysteme legt fest, wie Recht erzeugt wird. Warum sollten diese Konventionen dann nicht festlegen, daß Recht durch ein moralisches oder politisches Argument erzeugt wird? Die Antwort Marmoors lautet: Das kann nicht der Fall sein, denn es gibt hier nichts, was Konventionen konstituieren könnten. Es gibt keine konstitutive Rolle für Konventionen bei der Frage, daß Menschen gemäß In: The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, hg. von Jules Coleman und Scott Shapiro, Oxford 2002, S. 104ff. 15 19 der Moral handeln sollen. Politik, Moral, Ethik und vergleichbare Überlegungen beruhen auf unserem praktischen Denken ohne Bezug zu Konventionen. Konventionen können nur eine Rolle, spielen, wenn diese Fragen Teil des Rechts werden, also Teil einer konventionell etablierten rechtlichen Praxis. Die Konventionen konstituieren also das Recht als soziale Praxis, anders als bei der Politik und der Moral. (2) Raz hat geltend gemacht, daß das Recht eine authoritative Institution ist, und zwar in doppeltem Sinn: Zum einen ist es eine de-facto-Autorität, zum anderen fordert es auch Autorität. Welche Dinge können nun legitime Autorität in Anspruch nehmen? Dafür gibt es zwei Argumente: Zum einen müssen ihre Direktiven als solche identifizierbar sein, ohne sich noch einmal auf die Gründe zu stützen, die eigentlich ersetzt werden sollen. Ansonsten kann die Autorität nicht ihre praktische Funktion erfüllen. Autoritäten sind dazu da, eine praktische Differenz zu bewirken. Und das können sie nicht, wenn die Direktive nicht als solche erkannt werden kann. Zum anderen muß die Autorität in der Lage sein, eine Meinung darüber zu bilden, wie die unterworfenen Subjekte sich verhalten sollen, und zwar unabhängig von den eigenen Überlegungen der Subjekte, wie sie sich verhalten sollen. Es muß personale Autorität sein. Es kann keine Autorität ohne Autor geben. 2. Inklusiver Rechtspositivismus (Soft legal positivism) Nach dem inklusiven Rechtspositivismus spricht dagegen nichts dagegen, daß die Erkenntnisregel auch moralische Normen in das Recht integriert. 20 Es gibt also drei große Lager: Prinzipien der Prinzipien der Mo- Prinzipien der Mo- Moral notwendi- ral möglicher Teil ral unmöglich Teil ger Teil des des Rechts, falls des Rechts Rechts vom Recht vorgesehen Ronald Dworkin Robert Alexy inklusiver Rechts- exklusiver Rechts- positivismus positivismus H. L. A. Hart- Hans Kelsen Postscript Joseph Raz Jules Coleman Andrei Marmoor Kenneth Himma III. Eigener Vorschlag Meine grundsätzliche Kritik richtet sich gegen den Versuch, das Recht ausschließlich mit Bezug auf bestimmte unterschiedliche Formen oder Strukturen seiner Elemente bestimmen zu wollen. Dieser Versuch mag aus einer soziologischen oder juristischen Perspektive befriedigen. Er tut es aber nicht aus einer philosophischen Perspektive: Was ist Recht? – Zunächst ist es erforderlich, die Frage zu verstehen. Die Frage kann sich auf das in einer gegenwärtigen Rechtsordnung tatsächlich Gebotene richten. Das ist die Perspektive der Dogmatik. Die Frage kann sich aber auch auf das früher rechtlich Gebotene beziehen. Das ist die Perspektive 21 der Geschichte. Die Frage kann weiterhin das Recht als Tatsache im Verhältnis zur Gesellschaft untersuchen. Das ist die Perspektive der Soziologie. Und so sind noch viele weitere einzelne und vereinzelnde Perspektiven auf das Recht möglich: die Perspektive der Psychologie, der Ethnologie, der Kriminologie, der Linguistik, der Ökonomie, der Statistik, der Politikwissenschaft usw. Worin kann dann die Perspektive der Philosophie auf das Recht liegen? Die Perspektive der Philosophie ist zwar ebenfalls nur eine einzelne Perspektive auf das Recht. Aber sie unterscheidet sich von allen anderen einzelnen Perspektiven in einem Merkmal: Sie ist nicht vereinzelnd. Sie schneidet das Recht nicht aus seinem Zusammenhang als Teil der Welt. Die Philosophie entwickelt vielmehr eine umfassende, auf die abstraktesten und damit allgemeinsten Merkmale eines Phänomens oder Gegenstandes gerichtete Einsicht. Dabei bezieht sie die Perspektiven der anderen Wissenschaften und der Erfahrungen des Alltags ein. Sie ist also auch empirisch und nicht rein apriorisch oder metaphysisch. Sie läßt sich aber nicht auf die bloße Summierung der einzelnen anderen Perspektiven reduzieren. Die Philosophie entfaltet vielmehr einen umfassenden Rahmen der Erkenntnis eines Phänomens oder Gegenstandes. Dieser Rahmen enthält sowohl rezeptive als auch produktive Elemente. Wie geht die Philosophie dabei vor? Sie sucht nach den relativ überzeitlichen, überräumlichen und überkulturellen, also jenseits konkreter Vorkommnisse eines Phänomens bzw. Gegenstandes liegenden, das heißt nach den relativ notwendigen Merkmalen oder Bedingungen des Phänomens – in unserem Fall des Rechts. Die philosophische Perspektive erfaßt das Recht also nicht in seinen einzelnen zeitlichen, räumlichen und kulturellen Realisierungen. Sie zielt deshalb auch nicht auf die Vollständigkeit der Erfassung dieser einzelnen Realisierungen. Sie ermöglicht deshalb nur eine sehr eingeschränkte, einzelne Teilantwort auf die Frage „Was ist Recht?“. Aber auch die dogmatische, historische und soziologische usw. Perspektive ist wegen ihrer jeweiligen Vereinzelung nur 22 zu einer Teilantwort auf die Frage nach dem Recht in der Lage. Die philosophische Perspektive läßt sich nicht auf eine dogmatische, historische oder soziologische reduzieren. Aber sie enthält auch diese Perspektiven. Die relativ notwendigen Merkmale der philosophischen Perspektive sind quasi Destillationsergebnisse des zeitlichen, räumlichen und kulturellen Phänomens Recht. Und zwar so wie wir dieses Phänomen wahrnehmen und in unser Begriffssystem einordnen. Die philosophische Einsicht versucht also die relativ beständigsten und damit notwendigsten Bedingungen des Begriffs Recht zu ermitteln. Phänomenerkenntnis und Begriffserkenntnis gehen Hand in Hand. Ein erster Weg ist dabei die Bestimmung der notwendigen Begriffsteile. 1. Die vier notwendigen Merkmale des Rechts Im Folgenden wird nur menschliches oder zumindest durch Menschen erkanntes, d. h. in einem sehr weiten Sinne positives Recht als Recht erfaßt. Die religiöse und theologische Frage nach einem göttlichen Recht bleibt also ausgeklammert. Dann erscheinen vier Merkmale für das Phänomen bzw. den Begriff Recht notwendig, die zunächst genannt und dann erläutert werden. Recht ist danach notwendig: (1) ein menschliches Erzeugnis, (2) das dem Zweck der Vermittlung zwischen potentiell oder aktuell widerstreitenden Belangen, d. h. Strebungen, Bedürfnissen, Wünschen und Zielen (Belangen, Interessen) dient, 23 (3) und zwar mittels begründeter Verpflichtungen und Ermächtigungen, (4) bei denen anders als bei der Moral der Schwerpunkt der handlungsleitenden Normativität typischerweise nicht im Verpflichteten oder Ermächtigten selbst liegt, sondern im äußeren Handeln anderer. 1) Der Schlüssel zum Verständnis des Rechts liegt in der Einsicht, daß es sich um etwas von Menschen Geschaffenes bzw. Erzeugtes in einem sehr weiten Sinne handelt. Das Recht ist also kein bloß natürliches Phänomen. Dies gilt selbst für ein eventuell anzuerkennendes Naturrecht. Denn auch dieses muß von Menschen erkannt und angewandt werden, enthält also zumindest auch einen Aspekt menschlicher Erzeugung enthalten. Dieses erste Merkmal des menschlichen Erzeugnisses grenzt das Recht von allen reinen Naturphänomenen, wie den Strahlen der Sonne oder den Planeten ab. Das Recht ist ein soziales Faktum, aber die Charakterisierung als soziales Faktum, die bei den Positivisten so eine große Rolle spielt, ist relativ unspezifisch. Auch nicht geplante und damit nichtartifizielle Fakten sind soziale Fakten, etwa die Bevölkerungsentwicklung. 2) Alles von Menschen Geschaffene bzw. Erzeugte wird nun aber zentral durch sein Ziel bzw. seinen Zweck bestimmt, sofern man die seltenen und bestreitbaren Ausnahmefälle möglicherweise bewußt zweckloser Erzeugnisse, wie Kunst und Spiel außer Betracht läßt. Da das Recht ganz offensichtlich nicht zu dieser sehr kleinen Gruppe von bewußt zwecklosen menschlichen Erzeugnissen gehört (falls man sie überhaupt anerkennt), muß man fragen, worin das Ziel bzw. der Zweck des Rechts besteht. Der Zweck des Rechts besteht darin, zwischen potentiell widerstreitenden Strebungen, Bedürfnissen, Wünschen bzw. Zielen (Belangen, Interessen) zu vermitteln. Diese Vermittlung setzt voraus die widerstrei- 24 tenden Belange zumindest zu erkennen und zu berücksichtigen. Dies grenzt das Recht gegenüber vielen anderen menschlichen Artefakten ab, etwa gegenüber Werkzeugen, um ein Haus zu bauen, oder Fahrzeugen, um eine Fahrt zu unternehmen. Es grenzt das Recht auch gegenüber bloßen Machthandlungen ab. 3) Hat man den Zweck eines menschlichen Erzeugnisses gefunden, so stellt sich die Frage, ob und wie dieser Zweck mit einzelnen Mitteln zu erreichen ist. Und das ist bei der Vermittlung potentiell widersprechender Belange tatsächlich der Fall. Eine Lösung des entsprechenden potentiellen Konflikts kann auch durch soziale Steuerungsmaßnahmen erfolgen, die kein Recht sind, etwa durch die Verteilung sozialer Transferleistungen oder die Ermöglichung eines Gesprächs. Von derartigen bloßen sozialen Maßnahmen der Steuerung unterscheidet sich das Recht dadurch, daß es notwendig eine Verpflichtung enthält. Das Recht ist nicht nur faktisch wirksam, sondern es ist auch verbindlich. Und zwar ist diese Verpflichtung kein bloßer Befehl oder Machtspruch, sondern eine Verpflichtung, die explizit oder implizit eine wenigstens sehr rudimentäre Begründung enthält, und sei dies auch nur durch die Tatsache, daß das Recht der Vermittlung der Interessen dient und damit ihre Berücksichtigung einschließt. 4) Jede Verpflichtung setzt schließlich eine Quelle voraus. Während die Moral diese Quelle auch vollständig im Inneren des Menschen, in seinem Gewissen bzw. seinem Sittengesetz oder dem Faktum der Vernunft finden kann, muß die Quelle rechtlicher Verpflichtung immer auch in äußerem Handeln liegen, also etwa in einem Vertrag, einem Richterspruch, einer Gewohnheit, einer richterrechtlichen Praxis oder einem Gesetz. 25 2. Die verschiedenen Rechtsquellen Im Anschluß an das vierte notwendige Merkmal des Rechts stellt sich die Frage, durch welche Formen äußeren Handelns nun die rechtliche Verpflichtung erzeugt werden kann. Die empirische Konkretisierung dieser Formen liegt bereits jenseits dessen, was notwendiges Merkmal des Rechts bzw. notwendige Bedingung des Rechtsbegriffs ist. Hier eröffnet sich das weite Feld der zeitlich, räumlich und kulturell variablen Rechtserzeugung. Die philosophische Perspektive erreicht hier ihre Grenze und geht dann in eine dogmatische, historische oder soziologische Perspektive über. Die philosophische Perspektive kann hier nur noch die verschiedenen grundsätzlichen Möglichkeiten und ihre Komplexität aufweisen. Welche Möglichkeit dann in welchem Maße in einer bestimmten Zeit und Gesellschaft realisiert ist, müssen die Dogmatik, Soziologie und Geschichte feststellen. Man kann vier Formen bzw. nach der Komplexität geordnete Stufen des Rechts unterscheiden, die ihrerseits wieder Unterformen haben: (1) Einfachste Form: Übereinkunft, Richterspruch, gemeinschaftsrepräsentierende Verpflichtung (2) Verallgemeinerte Form: Gewohnheitsrecht, Richterrecht (Präjudizienbindung) (3) Sicherung der Verallgemeinerung durch Setzung einer allgemeinen Regel: Ge setzesrecht 26 (4) Autorisierung und Vereinheitlichung der verschiedenen Formen des Rechts: Verfassungsrecht Man erhält also folgendes Tableau zunehmender Komplexität: (1) Übereinkunft Verpflichtung durch Gemeinsch. (2) Gewohnheitsrecht Erlaßrecht (3) Gesetzesrecht (4) Verfassungsrecht Richterspruch Richterrecht/Juristenrecht Jede der komplexeren Stufen nimmt regelmäßig für sich einen Vorrang der Erkenntnis und Normierung der vorherigen Stufen in Anspruch, also einen epistemologischen und einen normativen Vorrang. Dies geschieht historisch verschieden radikal. Es kann soweit gehen, daß der einfacheren Rechtsform explizit oder implizit der Charakter als selbständiger Rechtsquelle abgesprochen wird. So wenn Montesquieu den Richter nur noch als „Mund des Gesetzes“ bezeichnet. Oder wenn Savigny nur Verallgemeinerungen als Rechtsquelle gelten läßt. Man kann zwischen der normativen Überlagerung, also dem was die komplexere Rechtsquelle normiert, und der tatsächlichen Überlagerung, also dem Grad in dem diese Überlagerung tatsächlich realisiert wird, unterscheiden. Im ersten Fall beschreibt man den normativen Anspruch der Rechtsquellen, im zweiten die faktische Realisierung dieses Anspruchs. 27 Für den Übergang von der ersten Stufe des einzelnen Vertrags oder Richterspruchs zur zweiten Stufe der allgemeinen Regeln des Gewohnheitsrechts und des Richterrechts steht etwa Friedrich Carl v. Savigny. Er definiert als Rechtsquellen ausdrücklich nur die „Entstehungsgründe des allgemeinen Rechts“,16 also Gewohnheitsrecht, Gesetzesrecht und als drittes Juristenrecht bzw. wissenschaftliches Recht, also eine über das Richterrecht hinausgehende Rechtsquelle. Für den Übergang von der zweiten Stufe zur dritten Stufe des Gesetzesrechts stehen alle Theoretiker der Notwendigkeit. des Vorrangs oder gar der Ausschließlichkeit des Gesetzesrechts, etwa Montesquieu, mit seiner Vorstellung, daß der Richter nur der Mund des Gesetzes sein soll bis hin zum Gesetzespositivismus der ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. In diese Gruppe gehört aber wohl auch H. L. A. Hart, wenn er ein zweistufiges Regelsystem fordert. Für den Übergang von der dritten zur vierten Stufe stehen alle Theoretiker, die eine weitere Hierarchisierung im Wege einer Verfassung für notwendig halten, etwa Hans Kelsen. Ich glaube nun, daß alle diese weiteren Anforderungen zumindest als notwendige Merkmale des Rechts aus einer philosophischen Perspektive nicht erforderlich sind. Es handelt sich vielmehr um zufällige empirische Erscheinungen komplexerer Rechtsordnungen. 16 Friedrich Carl v. Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Berlin 1840, S. 11.